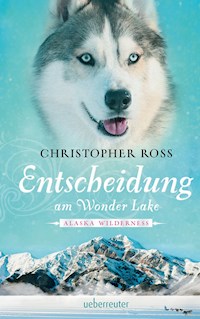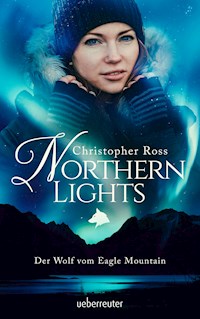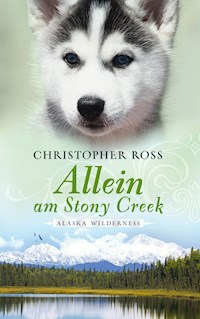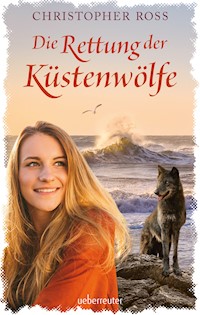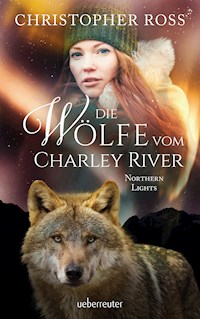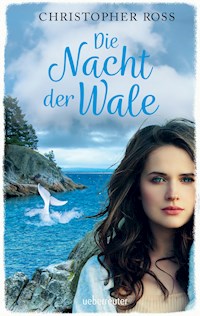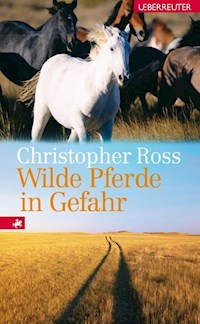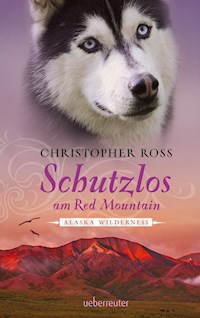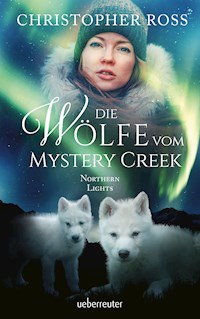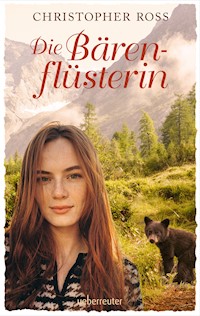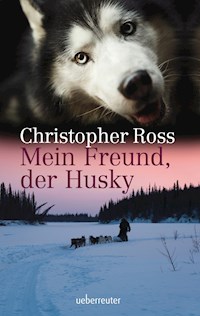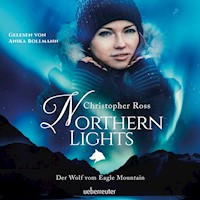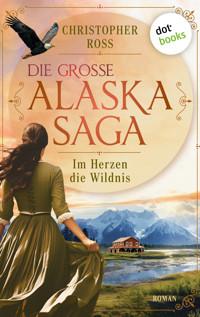
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder Landschaftsroman mit authentischem Setting – über das Leben von Indigenen und Siedlern in den faszinierenden Weiten Kanadas und Alaskas. Vancouver im ausgehenden 19. Jahrhundert: Als ihre Eltern tragisch versterben, muss Clarissa sich als junge Frau Arbeit suchen, um zu überleben. Doch schon bald weckt ihre Schönheit in Frank Whittler, dem Sohn des reichen Eisenbahnmanagers, gefährliche Begehrlichkeiten. Er bedrängt sie und als Clarissa sich weigert, verleumdet er sie als Diebin. Clarissa bleibt nur ein Ausweg – die Flucht in die Bergwildnis Kanadas, völlig auf sich allein gestellt. Erst, als Clarissa dem Fallensteller Alex begegnet, schöpft sie wieder Hoffnung, dass ein Leben in dieser Wildnis doch möglich sein kann. Aber Clarissas Häscher sind fest entschlossen, sie um jeden Preis zu finden … »Großartige Romane voller verhaltener Poesie.« Kieler Nachrichten Diese große Nordamerika-Saga in sechs Bänden, die unabhängig lesbar sind, erschien vorab bereits als »Clarissa«-Reihe und wird Fans von Sarah Lark begeistern!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Vancouver im ausgehenden 19. Jahrhundert: Als ihre Eltern tragisch versterben, muss Clarissa sich als junge Frau Arbeit suchen, um zu überleben. Doch schon bald weckt ihre Schönheit in Frank Whittler, dem Sohn des reichen Eisenbahnmanagers, gefährliche Begehrlichkeiten. Er bedrängt sie und als Clarissa sich weigert, verleumdet er sie als Diebin. Clarissa bleibt nur ein Ausweg – die Flucht in die Bergwildnis Kanadas, völlig auf sich allein gestellt. Erst, als Clarissa dem Fallensteller Alex begegnet, schöpft sie wieder Hoffnung, dass ein Leben in dieser Wildnis doch möglich sein kann. Aber Clarissas Häscher sind fest entschlossen, sie um jeden Preis zu finden …
Über den Autor:
Christopher Ross gilt als Meister des romantischen Abenteuerromans. Es ist das Pseudonym des Autors Thomas Jeier, der in Frankfurt am Main aufwuchs, heute in München und »on the road« in den USA und Kanada lebt. Seit seiner Jugend zieht es ihn nach Nordamerika, immer auf der Suche nach interessanten Begegnungen und neuen Abenteuern, die er in seinen Romanen verarbeitet, mit den bevorzugten Schauplätzen Kanada und Alaska. Seine über 2100 Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet.
Christopher Ross veröffentlichte bei dotbooks seine große Alaska-Saga mit den Romanen »Im Herzen die Wildnis«, »Wo der Himmel brennt«, »Die Nacht der Wölfe«, »Allein durch die Wildnis«, »Gefangen im ewigen Eis« und »Das Leuchten am Horizont«.
Die Website des Autors: www.jeier.de/
Der Autor auf Facebook: www.facebook.com/thomas.jeier
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2024
Copyright © der Originalausgabe 2012 by Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock und Adobe Stock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-637-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Christopher Ross
Im Herzen die Wildnis
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Clarissa Howe hatte sich daran gewöhnt, dass ihr die meisten Männer nachstarrten. Obwohl sie zu wenig verdiente, um sich nach der neuesten Mode zu kleiden, und sie sich keine extravaganten Hüte wie die reichen Ladys aus dem West End leisten konnte, waren selbst vornehme Gentlemen so sehr von ihrem Aussehen angetan, dass sie ihr freundlich zunickten und ein wohlwollendes Lächeln schenkten. Einfache Fischer und Handwerker gaben sich etwas dreister, sie ließen sich schon mal zu einer kühnen Bemerkung hinreißen, und wenn sie ihren Vater vom Hafen abholte, ging immer ein anerkennendes Raunen durch die Menge. Einer hatte ihr mal einen Heiratsantrag auf offener Straße gemacht, ohne dass er jemals mit ihr ausgegangen war.
Warum die Männer sie bewunderten, wusste sie nicht. Wie oft hatte sie vor dem Spiegel in ihrem Zimmer gestanden und sich prüfend betrachtet, während sie mit den flachen Händen die Konturen ihrer schlanken Gestalt nachfuhr, als könnte sie so die Geheimnisse ihres Körpers ergründen. Ihr Gesicht war schmal, die Augen dunkel, die Haare so schwarz, dass sie für eine Indianerin durchgegangen wäre, hätte ihre Haut nicht so hell und weiß geschimmert. Auch an diesem Morgen waren ihre Haare zu locker gebunden. Es würde ihr wohl niemals gelingen, ihre Haare so streng zu frisieren wie damals ihre Mutter. Ständig hingen ihr ein paar vorwitzige Strähnen ins Gesicht. Sie hatte sich angewöhnt, sie aus dem Gesicht zu pusten, so wie sie es als kleines Mädchen getan hatte, eine scheinbar harmlose Geste, die jedoch ebenfalls bei Männern ankam, wie sie zu ihrer Verwunderung festgestellt hatte.
»So sind die Männer nun mal«, hatte ihre Mutter gesagt, »selbst dein Vater dreht sich nach jedem Weiberrock um!« Aber das war keine Erklärung. Eine ihrer Freundinnen beklagte sich heute noch darüber, dass ihr die Männer keine Beachtung schenkten, obwohl Clarissa nichts Abstoßendes an ihr entdecken konnte. »Du bist anders«, hatte die Freundin erklärt, »du bewegst dich so ... aufreizend«, und sie hatte lachend geantwortet: »Das liegt daran, weil ich so oft bei meinem Vater auf dem Fischerboot war und ständig denke, ich würde das Gleichgewicht verlieren.« Das schönste Kompliment hatte ihr ein studierter junger Mann aus Seattle gemacht: »In Ihren Augen leuchten kleine Sterne! Wussten Sie das, Miss? Wie bei einer Fee aus dem Märchen!« Leider war er nach der zweiten Verabredung abgereist, wohl auch deswegen, weil seine Eltern nicht wollten, dass er sich mit der Tochter eines Fischers traf.
Normalerweise reagierte Clarissa nicht mehr auf die bewundernden Blicke der Männer. Die Gefahr, sich dabei lächerlich zu machen, war zu groß. Doch als an diesem Morgen eine Kutsche an ihr vorbeifuhr und sich ein vornehmer Gentleman weit aus dem Fenster beugte und sie anstarrte, blieb sie stehen und wunderte sich einmal mehr, wie sehr sich manche Gentlemen aus der Oberschicht für sie interessierten. Er nahm sogar seinen Zylinder ab und grüßte sie wie eine Dame, deren Bekanntschaft er gerne gemacht hätte. Neben ihm erkannte sie die Umrisse einer vornehmen Lady. Sie glaubte wohl, dass er eine Bekannte grüßte, und sah sein verräterisches Lächeln nicht.
Clarissa blieb reglos stehen und war froh, als die Kutsche in einer Seitenstraße verschwand. Zu aufdringlich und auch zu abschätzend hatte sie der Fremde gemustert, als wollte er sie mit seinen Blicken ausziehen. In seinen Augen hatte sie jenen Hochmut erkannt, den sie oft bei Gentlemen der Oberschicht beobachtete; die Annahme, sie könnten sich bei einfachen Frauen alles erlauben und das ausleben, was ihnen die feinen Damen der Gesellschaft nicht gestatteten. Als könnte man sie mit einem Lächeln kaufen.
Sie verdrängte die Gedanken an den Gentleman und ging langsam weiter. Auch an diesem Sonntag schlenderte sie an der English Bay entlang, dem weiten Strand im Westen von Vancouver, der im Sommer vor lauter Sonnenhungrigen kaum zu sehen war und jetzt im Spätherbst einsam und verlassen unter dem grauen Himmel lag. Ihr langer Mantel und der Hut schützten sie gegen den kühlen Wind, der über die Bucht hereinkam und sich zwischen den Häusern im West End verfing. Am Strand säumten schmale Holzhäuser mit steilen Giebeldächern die Beach Avenue, ein paar Blocks weiter ragten die herrschaftlichen Villen der Reichen empor. Die wohlhabenden Familien waren noch vor der Eisenbahn gekommen und hatten sich die besten Grundstücke gesichert. Auch sie wohnte in einer dieser Villen, allerdings nur in der winzigen Dachkammer, die dem Dienstmädchen zur Verfügung gestellt wurde.
Mit dem Wind wehten einige Regentropfen über die Straße. Die düsteren Wolken hingen so tief, dass sie beinahe die Fichten am Strand und im nahen Stanley Park berührten. Kein Wetter zum Spazierengehen, schon gar nicht für eine alleinstehende Dame ohne Begleitung, aber ein Ritual, auf das Clarissa um keinen Preis verzichten wollte. An jedem freien Tag lief sie über die Beach Avenue am Strand entlang, auf dem Küstenweg im Stanley Park, der sich wie eine undurchdringliche Wildnis im Nordwesten der Halbinsel ausbreitete. Dort begegnete sie nur selten Spaziergängern oder Wanderern, höchstens mal einer Squamish-Familie beim Angeln oder Beerenpflücken. Angeblich wohnten noch mehrere Indianerfamilien in verstreuten Dörfern auf der Halbinsel.
Im Schatten einiger Douglasfichten, die neben dem Weg in die Höhe ragten, blieb sie stehen. Sie trat nah an einen der mächtigen Bäume heran und ließ ihre flache Hand über die Inschrift gleiten, die sie selbst mit einem Messer in die Rinde geritzt hatte: Arthur Howe, August 24, 1892 und Charlotte Howe, March 3, 1893. Neben beide Daten hatte sie ein Kreuz geritzt. Drei Jahre war es nun schon her, seit ihr Vater in einem heftigen Sturm über Bord gegangen und ertrunken war. Sie hatten seine Leiche nie gefunden. Nur ein halbes Jahr später war ihre Mutter ins Wasser gegangen und in den Tod geschwommen. Aus Kummer, wie in einem Brief gestanden hatte. Auch nach ihrer Leiche hatte man vergeblich gesucht. Im Meer hatten sie die letzte Ruhe gefunden. Es gab keine Gräber, keine Grabsteine, nur die geritzten Namen und Daten in der Baumrinde, und selbst die waren kaum noch zu erkennen.
Clarissa trat ans flache Ufer, bis sie mit ihren Schuhen beinahe im Wasser stand, und blickte aufs Meer hinaus. Düstere Nebelschwaden hingen über der Bucht. Die Luft roch nach Salz und Tang und verfaultem Holz, und der kalte Sprühregen erinnerte sie an den nahenden Winter. Nur noch wenige Wochen, vielleicht auch nur Tage, trennten sie von der kalten Jahreszeit. In Vancouver waren die Winter verhältnismäßig mild, doch schon in den Ausläufern der Berge, wo ihr Onkel seine Farm hatte, trieb er eisige Schneestürme über das Land, und in den Coast Mountains weiter nördlich lag der Schnee so hoch, dass man nur mit dem Hundeschlitten oder auf Schneeschuhen vorwärtskam.
Auf dem Meer waren die Umrisse eines Fischerbootes zu sehen. Ein Kutter, der wahrscheinlich nur Kabeljau und Heringe in seinen Netzen hatte. Um diese Zeit gab es nicht viel zu holen in diesen Breiten, das wusste sie aus eigener Erfahrung. Oft waren sie mit leeren Netzen nach Hause gekommen, wenn sie im Spätherbst rausgefahren waren. Sie war häufig dabei gewesen, wenn sie im Sommer für ihre Eltern und im Winter als Haushälterin oder Köchin gearbeitet hatte, meist zusammen mit ihrer Mutter, die ebenfalls arbeiten gehen musste, weil sonst das Geld nicht gereicht hätte. Nach ihrem Tod hatte sie das verschuldete Boot bezahlt und ihren restlichen Besitz verkauft und keine fünfzig Dollar dafür bekommen. Das Geld lag in einem Beutel unter ihren Kleidern.
Ihr Vater hatte seinen Beruf so manches Mal verflucht, auf das stürmische Wetter vor Vancouver Island und die niedrigen Fangquoten geschimpft und die chinesischen Einwanderer dafür verantwortlich gemacht, dass ihre Netze immer leichter wurden und sie kaum noch über die Runden kamen, obwohl keiner der Chinesen als Fischer arbeitete. Die meisten Asiaten hatten beim Bau der Canadian Pacific geholfen und arbeiteten jetzt in Fabriken oder Wäschereien. Doch das Meer hatte ihn auf magische Weise angezogen. »Das Meer ist mein Leben«, hatte er gesagt und wohl schon gewusst, dass es auch einmal sein Tod sein würde. Clarissa konnte sich noch gut an den Jahrhundertsturm erinnern, wie er heulend und fauchend über die Bucht gebraust war und ihre Mutter und sie gemeinsam am Fenster standen und auf das schäumende Meer hinausgeblickt hatten. Schon damals war ihnen klar gewesen, dass er nicht wieder nach Hause zurückkehren würde. Seine eigene Schuld, wie sie zugeben musste, weil er trotz aller Warnungen hinausgefahren war. »Du bleibst bei der Mutter«, hatte er zu ihr gesagt, »ich schaff das schon.«
Sieben Monate später, nachdem sie vergeblich versucht hatte, einen entfernten Verwandten für die Fischerei zu begeistern, war ihre Mutter dem Vater ins Meer gefolgt. Clarissa war unterwegs gewesen und hatte nach ihrer Rückkehr mit anderen Fischern stundenlang nach ihr gesucht. Sie hatten sie nicht gefunden. Vielleicht war es besser so, und sie war jetzt wieder mit ihrem Mann vereint, so wie der Mann und die Frau in der Indianerlegende, die beide ertranken und als Wale wiedergeboren wurden. Die Vorstellung, dass ihre Eltern zu Walen geworden sein könnten, beruhigte sie seltsamerweise.
Wie jedes Mal, wenn sie um ihre Eltern trauerte, sprach sie ein kurzes Gebet und beendete es mit den Worten »Gott schütze euch!«. Der Wind antwortete mit einem leisen Seufzen, als hätte er sie verstanden. Sie wandte sich ab und kehrte langsam zum Haus zurück. Seit dem Tod ihrer Mutter arbeitete sie als Dienstmädchen für eine wohlhabende Familie, die ihren Reichtum wie die meisten Familien im West End mit der Eisenbahn verdient hatte. Thomas Whittler war einer der führenden Manager der Canadian Pacific und hatte schon früh gewusst, dass man den Endpunkt der Transatlantik-Eisenbahn nicht nach Port Moody, sondern an die Küste legen und dort eine neue Stadt gründen würde. Noch bevor Vancouver vor neun Jahren auf der Landkarte erschienen war, hatte er sich mehrere wertvolle Grundstücke gesichert. Seine Frau Louise und er besaßen mehr Geld als Königin Victoria im fernen England, behaupteten manche.
Die Whittlers wohnten in einer zweistöckigen Villa in der Broughton Street. Zwei Giebeldächer erweckten den Eindruck, als hätte man zwei Häuser ineinandergebaut und so verschachtelt, dass sie noch größer und eindrucksvoller wirkten. Eine kiesbedeckte Auffahrt führte durch den gepflegten Garten zum Haus, dessen Wände bis zum ersten Stock türkisfarben und im zweiten Stock unter einem der beiden Dächer blassgelb gestrichen waren. Eine breite Veranda, von schlanken Säulen und einem kunstvoll gedrechselten Holzzaun umgeben, zog sich auf der Vorder- und der Südseite um das Erdgeschoss. Unter einem kleinen Giebeldach führte eine Treppe zum Eingang.
Clarissa ging durch den Dienstboteneingang auf der Rückseite und stieg die steile Treppe zu ihrem Zimmer unter dem Dach empor. Es war kaum größer als die Abstellkammer zwei Türen weiter und lag neben der ebenfalls winzigen Kammer der Köchin, die nachts laut schnarchte und ihr schon manches Mal den Schlaf geraubt hatte. Viel machte es nicht her. Das einfache Bett ließ gerade mal Platz für den Schrank, in dem ihre gesamte Habe untergebracht war, und einen kleinen Tisch mit Stuhl. Auf dem Tisch stand eine Öllampe, elektrisches Licht gab es nur im Erdgeschoss und im ersten Stock.
Im Mantel, weil es unter dem Dach auch keinen Ofen gab und sich die Wärme, die vom Kamin, der direkt neben ihrem Zimmer zum Dach führte, nur langsam in ihrem Zimmer ausbreitete, trat sie ans Fenster. Aus dem leichten Nieseln war stetiger Regen geworden, der gegen das Fenster und in unregelmäßigem Rhythmus auf das Giebeldach schlug. Das Meer sah sie kaum und erkannte die Bäume im Stanley Park nur als dunkle Schatten. Bei schönem Wetter konnte sie, wenn sie ihr Fenster öffnete und sich weit hinausbeugte, sogar die schneebedeckten Gipfel der Coast Mountains sehen, ein Anblick, der sie immer wieder begeisterte und eine unerklärliche Sehnsucht in ihr weckte: Vancouver hinter sich zu lassen und nach Norden in die Wildnis zu ziehen, fernab des großstädtischen Trubels und weit entfernt von reichen Familien wie den Whittlers, die ihren einzigen Lebensinhalt darin sahen, Reichtum anzuhäufen und Gesellschaften für andere Reiche zu geben.
Sobald sie genug Geld gespart hatte, würde sie kündigen und einen Neuanfang wagen. Ob sie es wagte, in die Wildnis zu gehen und in einem dieser winzigen Dörfer abseits der befahrenen Wagenstraßen zu leben, wusste sie noch nicht. Eine Zeitlang hatte sie daran gedacht, zu ihrem Onkel zu ziehen und ihm auf der Farm zu helfen. Als Kind war sie einige Male bei ihm gewesen, hatte ihm bei der Ernte geholfen und jede freie Minute damit verbracht, auf Morning Star über die Hügel zu reiten. »Morning Star« war der etwas hochtrabende Name des stämmigen Wagenpferdes, auf dem sie reiten gelernt hatte. Doch die Wildnis jenseits der geschäftigen Siedlungen am Schienenstrang lockte sie noch stärker, vielleicht weil sie das genaue Gegenteil von dem Meer war, das sie bis zu ihrem Lebensende an den tragischen Tod ihrer Eltern erinnern würde, ihr aber gleichzeitig die Hoffnung vermittelte, sich dort ebenso frei und ungebunden fühlen zu können wie fernab der Küste.
Sie zog langsam ihren Mantel aus und warf ihn aufs Bett. Nach dem Essen, das sie auch an ihren freien Tagen in der Küche bekam, würde sie sich aufs Bett legen und den Nachmittag mit einem guten Buch verbringen. Anders als ihre Eltern, die selten gelesen hatten, tauchte sie gern in fremde Welten ein, etwa in das neue Tom-Sawyer-Buch von Mark Twain, das auf ihrem Kissen lag. Bücher waren der einzige Luxus, den sie sich leistete, sehr zur Verwunderung von Louise Whittler, die anscheinend an ungebildete Dienstmädchen gewöhnt war. Ihre Vorgängerin war eine Indianerin gewesen, die weder lesen noch schreiben konnte. An Weihnachten hatte Mrs Whittler ihr sogar ein Buch geschenkt, eines aus dem eigenen Bücherschrank natürlich, denn unnütze Geldausgaben waren den Whittlers ein Gräuel. Sie waren geizig, eine Eigenschaft, die sie bei vielen reichen Leuten beobachtet hatte.
Von der Straße drang Hufgeklapper herauf. Sie trat erneut ans Fenster und beobachtete, wie eine Kutsche vor dem Haus hielt, und ein Gentleman mit seiner Begleiterin ausstieg. Der Mann mit dem Zylinder, der ihr auf der Beach Avenue hinterhergestarrt hatte! Sie erkannte ihn an seinem hageren Gesicht und seinem spöttischen Lächeln und zuckte unwillkürlich zurück, als er seinen Zylinder abnahm und seine Begleiterin zur Treppe führte. Er sagte etwas, das sie nicht verstand, und sprach anscheinend mit der dicken Köchin, die sie an ihrem freien Tag als Dienstmädchen vertrat. Seine hochmütige Miene ließ vermuten, dass er sie zurechtgewiesen hatte. Das Gesicht der blonden Lady, die mit ihm gekommen war, war unter einem breitkrempigen Hut verborgen.
Clarissa nahm ihren Hut ab und setzte sich aufs Bett. Der Gedanke, dass der aufdringliche Gentleman länger bleiben könnte, beunruhigte sie. Sie verspürte keine Lust, sich noch einmal sein spöttisches Lächeln gefallen lassen zu müssen. Und es war nicht nur dieses Lächeln und die Art, wie er sie angesehen und mit seinen Blicken verschlungen hatte. Von ihm war etwas Bedrohliches ausgegangen, als hätte er geschworen, ihr so lange nachzustellen, bis sie sich ihm hingab, ungeachtet der blonden Lady an seiner Seite und ungeachtet ihrer Weigerung, sein Lächeln und Winken zu erwidern.
Ein abwegiger Gedanke, wie sie zugeben musste, und doch nicht aus der Welt, hörte man doch immer wieder von Gentlemen seines Schlages, dass sie sich bei Abhängigen das holten, was sie bei ihren Ehefrauen oder Verlobten nicht bekamen. Erst vor ein paar Wochen war das Gerücht umgegangen, der Juniorchef einer Gießerei hätte eine Fabrikarbeiterin vergewaltigt und dabei so stark verletzt, dass sie keine Kinder mehr bekommen konnte. Die Arbeiterin wusste natürlich, dass es vollkommen sinnlos war, einen Mann wie ihn zu verklagen, und hatte die Stadt mit unbekanntem Ziel verlassen.
Über die Treppe näherten sich Schritte. Es klopfte, die Tür ging auf, und die Köchin streckte ihren Kopf ins Zimmer. »Gut, dass du hier bist, Clarissa«, sagte sie. »Die Herrin schickt mich. Es wäre unerwarteter Besuch gekommen, und du solltest heute Dienst machen. Ihr Sohn ist aus Toronto zurückgekehrt. Frank Whittler und seine Verlobte. Keine Ahnung, wie sie heißt.« Sie senkte ihre Stimme und blickte sich um, bevor sie fortfuhr: »Ein widerlicher Geselle, wenn du mich fragst, und seine Verlobte ist nicht viel besser. Ich soll ihr um Punkt drei den Tee servieren, nicht um vier, sondern um drei, das sei sie von zu Hause gewöhnt.« Sie verdrehte die Augen. »Kommst du? Sie warten auf dich. Die Herrin möchte dich in spätestens zehn Minuten im Salon sehen.«
»Frank Whittler?« Clarissa war bereits am Schrank und zog ihre Dienstmädchen-Uniform heraus, den schwarzen Rock, die weiße Bluse und die weiße Haube. »Ich dachte, der wollte in Toronto eine Anwaltskanzlei eröffnen.«
Die Köchin blickte sich erneut um. »Hat anscheinend nicht geklappt. Soviel ich gerade mitbekommen habe, will er bei seinem Vater einsteigen.«
»Und seine Verlobte?« Clarissa schlüpfte aus ihren Kleidern.
»Spielt die Madame. Du kennst doch den Typ.«
»Betsy!«, schallte es von unten herauf. »Wo bleibst du denn?«
»Ich bin schon unterwegs, Madame!«, rief die Köchin. Sie zog die Tür zu und lief nach unten. Unter jedem ihrer schweren Schritte knarrten die Stufen.
Clarissa hatte bereits ihre Uniform angezogen, band vor dem Spiegel über der Kommode ihre Haare neu und steckte die Haube mit zwei Klammern fest. Sie pustete eine Strähne von ihrem linken Auge und strich sie mit angefeuchteten Fingern nach hinten. Ihr Gesicht war noch vom Spaziergang gerötet.
Mit einem Seufzer wandte sie sich vom Spiegel ab und folgte der Köchin nach unten. Die Tür zum Salon stand offen und gab den Blick auf Frank Whittler und seinen Vater frei, einen stattlichen Mann mit schlohweißem Vollbart. »Lass mir noch ein wenig Zeit«, sagte Frank, »ich muss mich erst einmal an diese Stadt gewöhnen und möchte mit Catherine noch ein paar Wochen Urlaub genießen, bevor ich zu arbeiten anfange. Die Jahre in Toronto waren sehr hart.« Er blickte sich zu seiner Verlobten um, die von der Treppe nicht zu sehen war. »Nicht wahr, Schatz? Das haben wir uns verdient.«
»Meinetwegen«, antwortete Thomas Whittler, »aber zu viel Zeit sollten wir nicht verstreichen lassen. Wir haben eine neue Nebenstrecke in Planung, und jemand muss sich um die Grundstücke am Fraser River kümmern.« Er kaute auf einer kalten Zigarre. »Und ihr beide meint es wirklich ernst? Dann sollten wir für nächsten Samstag einen Empfang planen, auf dem wir eure Verlobung offiziell bekannt geben. Ihr müsst unbedingt den Bürgermeister kennenlernen.« Er blickte die Lady an. »Ihr Vater ist Manager der Southern Ontario?«
Clarissa hatte den Flur erreicht und sah Louise aus einem der anderen Zimmer kommen. »Da sind Sie ja endlich, Clarissa!«, begrüßte die Frau des Managers sie ungeduldig. »Unser Sohn und seine Verlobte sind überraschend aus Toronto zurückgekommen. Bringen Sie uns Champagner, den guten französischen, und vier Gläser und decken Sie den Tisch fürs Mittagessen, ja?«
»Sehr wohl, Madame«, antwortete sie.
Kapitel 2
Sie schloss für einen Moment die Augen und holte tief Luft, bevor sie eine Flasche französischen Champagner und vier Gläser auf einem Servierwagen in den Salon schob. Auch ohne Frank Whittler anzublicken, glaubte sie zu spüren, wie er sie neugierig musterte und mit einem frechen Grinsen bedachte, als er sie erkannte. »Der Champagner, die Herrschaften«, verkündete sie.
Thomas Whittler nahm ihr die Flasche ab. »Danke, Clarissa, ich mach das schon. Sagen Sie der Köchin, dass wir in einer Stunde zu speisen wünschen.«
»Sehr wohl, Sir.« Sie verbeugte sich höflich.
»Habe ich dich vorhin nicht am Strand gesehen?«, fragte Frank.
War es ihr bisher noch gelungen, seinen Blicken auszuweichen, blieb ihr bei seinen Worten gar nichts anderes mehr übrig, als den Kopf zu heben und ihm in die Augen zu sehen. Er gehörte zu den wenigen Menschen, die nur mit dem Mund lächelten, und seine Augen wirkten eher kalt und berechnend, wie bei einer Raubkatze, die eines ihrer möglichen Opfer betrachtet. Seine Gesichtszüge waren kantig und auf gewisse Weise attraktiv, zumindest für junge Frauen wie seine Verlobte, denen es nicht gelang, hinter seine Fassade zu blicken. Clarissa wurde schon zu lange von Männern umgarnt, um sich von ihm täuschen zu lassen. Gentlemen seiner Sorte kannten keine echten Gefühle.
Gegen ihren Willen errötete sie. »Gut möglich, Sir. Ich war an der English Bay und im Stanley Park spazieren. Dort bin ich gern an meinem freien Tag.«
»Ist es denn nicht gefährlich für eine junge und hübsche Frau wie dich, sich dort aufzuhalten? Ich habe gehört, der Stanley Park ist immer noch Wildnis, und man könnte sich dort leicht verirren. Es soll sogar Indianer geben.«
»Ich habe keine Angst vor Indianern, Sir.«
»Und vor aufdringlichen Männern?« Es bereitete ihm anscheinend Spaß, sie auf diese Weise in die Enge zu treiben. »Hier treiben sich doch sicher eine ganze Reihe von rauen Burschen herum, die sich nicht zu benehmen wissen.«
»Nicht nur raue Burschen, Sir«, konterte sie. »Oft sind es die unscheinbaren Männer, die einem den größten Ärger bereiten. Ich komme zurecht, Sir.«
»Danke, Clarissa«, brach Thomas Whittler die Unterhaltung ab.
Clarissa deutete einen Knicks an und verließ den Raum. Erleichtert kehrte sie in die Küche zurück. Sie goss sich ein Glas von der Limonade ein, die Betsy auf dem Küchentisch stehen hatte, und nahm einen großen Schluck.
»Sag ich doch, er ist ein Ekel!«, bemerkte die Köchin. Sie stand vor dem neuen Gasherd und rührte in dem Muscheleintopf, den es zum Lunch geben würde. »Genau der Typ, vor dem ich mich in Acht nehmen würde, wenn ich so jung wie du und zwanzig Pfund leichter wäre. Sieh dich vor, Clarissa!«
»Keine Angst! Den lasse ich keine zwei Schritte an mich ran.«
»Sieh dich trotzdem vor.« Betsy sah vom Kochtopf auf. Die Lachfältchen um ihren Mund waren verschwunden. »Bei der letzten Familie, für die ich gekocht habe, gab es auch einen wie Frank, der machte sich in der Hochzeitsnacht an ein junges Dienstmädchen ran. Und weißt du, was passiert ist?«
»Sie wurde gefeuert?«
»Schlimmer. Sie jagten die Arme mit Schimpf und Schande davon und drohten ihr sogar mit der Polizei. Angeblich hatte sie dem Sohn im Flur aufgelauert und versucht, ihn in ihre Kammer zu locken. Den Lohn, der ihr noch zugestanden hätte, behielten sie zurück. Ich weiß, ich hätte mich für die Kleine einsetzen sollen, aber das hätte ihr auch nichts genützt. Und mich hätten sie genauso gefeuert und behauptet, wir würden unter einer Decke stecken.«
»Ich schiebe jeden Abend den Riegel vor, Betsy.«
»Das will ich doch hoffen.« Ihr Mund verzog sich zu einem entschlossenen Lächeln. »Und wenn doch etwas passiert, schreist du laut um Hilfe, dann komm ich mit der Bratpfanne hoch und zeige dem Mistkerl, wie er sich zu benehmen hat!«
Clarissa lachte. »Mach ich, Betsy.«
Doch ganz so leicht, wie es den Anschein hatte, nahm sie die Gefahr nicht. So sehr sie sich auch einredete, Frank Whittler wäre lediglich ein Angeber, der einer einfachen Frau wie ihr imponieren wollte, musste sie im Lauf der Woche erkennen, dass er doch mehr im Schilde führte. Bei jeder Gelegenheit, wenn sie das Essen oder den Tee servierte oder er ihr beim Saubermachen oder auf der Treppe begegnete, musste sie sich sein unverschämtes Grinsen gefallen lassen, und einmal im Flur spürte sie sogar seine Hand an ihrer Hüfte. Als sie erschrocken herumfuhr und ihn vorwurfsvoll anblickte, lachte er.
Wie ernst die Lage wirklich war, erkannte sie jedoch erst einen Tag vor dem Empfang, der zu Ehren seiner Rückkehr und seiner Verlobung stattfinden sollte. Sie war gerade dabei, die Fenster im ersten Stock zu putzen, als er unbemerkt hinter ihr auftauchte und seine Arme um ihren Körper legte. »Nun?«, hörte sie ihn sagen. »Darauf wartest du doch die ganze Zeit, oder?«
Sie erstarrte mitten in der Bewegung, den Putzlappen in einer Hand.
»Ich weiß, dass du darauf wartest, Schätzchen. Oder glaubst du, ich hätte deine feurigen Blicke nicht bemerkt? Die ganze Woche machst du mir schon schöne Augen.« Seine rechte Hand wanderte an ihrem Bein hinab. »Weißt du eigentlich, wie hübsch du bist? Wäre doch schade, wenn eine Frau wie du verblühen würde, ohne jemals von einem richtigen Mann geliebt zu werden.«
Sie versuchte vergeblich, sich aus seiner Umklammerung zu befreien. »Lassen Sie mich los!«, fauchte sie ihn an. »Sie sollen mich loslassen, haben Sie nicht gehört? Wenn Sie nicht sofort aufhören, schreie ich laut um Hilfe!«
»Mein Vater ist im Büro, und Catherine und meine Mutter sind in der Stadt beim Einkaufen. Deine Hilferufe würden dir also nicht viel nützen.« Er kicherte verhalten. »Und wenn du denkst, die fette Betsy könnte dir helfen, muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe die Tür verriegelt.« Sie spürte seinen heißen Atem im Nacken. »Nur zur Sicherheit, damit uns niemand stört.«
Sie wehrte sich verzweifelt. »Sie gemeiner Kerl! Wenn Sie nicht sofort ...«
Das Klappern der Haustür und die Stimme seiner Mutter retteten sie, bevor er handgreiflich werden konnte. »Frank! Bist du zu Hause, Frank? Du musst dir unbedingt das Kleid ansehen, das ich Catherine für morgen Abend gekauft habe! Sie wird wie eine Prinzessin aussehen. Wo steckst du denn, Frank?«
Frank blickte sie scharf an. »Kein Wort!«, warnte er sie flüsternd. »Wenn du auch nur einen Ton sagst, verbreite ich überall, dass ich dich beim Stehlen erwischt habe. Dann werfen dich meine Eltern raus, und du bekommst keinen Fuß mehr auf die Erde. Hast du mich verstanden?« Er ließ sie los und ging zur Tür. Als er leise den Riegel aufschob, hatte er schon wieder Oberwasser. Er grinste unverschämt. »Unser kleines Techtelmechtel holen wir ein anderes Mal nach.«
Clarissa behielt den Zwischenfall für sich. Nicht einmal Betsy gestand sie, dass Frank sich an sie herangemacht hatte. Je weniger die Köchin wusste, desto besser war es für sie. Nach der Erfahrung mit dem jungen Dienstmädchen würde sie bestimmt nicht mehr stillhalten und nur ihre Stellung verlieren. Sobald Frank und Catherine verlobt waren und ein eigenes Haus gefunden hatten, würden sie nur noch alle paar Wochen bei seinen Eltern auftauchen, und die Gefahr wäre sowieso vorüber. Bis es so weit war, würde Clarissa ihm aus dem Weg gehen und darauf achten, dass sie nicht mehr allein mit ihm im Haus blieb. Für einen kurzen Moment überlegte sie sogar, heimlich ein Messer aus der Küche mitzunehmen, für alle Fälle, verwarf den Gedanken aber gleich wieder. Damit würde sie nur noch größeres Unglück provozieren. Wenn Frank einigermaßen bei Verstand war, würde er sich von ihr fernhalten und sich das, was er suchte, bei einem leichten Mädchen holen.
»Warum heiratet er sie bloß?«, fragte Clarissa am Samstagnachmittag die Köchin. Sie standen gemeinsam in der Küche und bereiteten das Essen für die Einladung vor. Zwanzig Personen waren angemeldet, darunter der Bürgermeister, der Chef des neuen Elektrizitätswerks und der Besitzer der Gießerei, alle mit ihren Gattinnen. »Ohne seine Verlobte hätte er doch freie Bahn.«
»Weil sie aus einer reichen Familie kommt.« Betsy probierte die Vorspeise, schüttelte den Kopf und gab etwas Salz und Pfeffer nach. »Ihr Vater ist ein hohes Tier bei der Southern Ontario Railroad. Liegt doch nahe, dass er so eine ins Haus holt. Würde mich nicht wundern, wenn sich die Canadian Pacific und die Southern Ontario bald zusammenschließen würden. So läuft das in den Kreisen. Kerle wie der denken doch selbst beim Heiraten ans Geschäft.«
»Wenn ich seine Verlobte wäre, würde ich mich weigern.«
Betsy probierte wieder und nickte zufrieden. »Die wird gar nicht gefragt. Ihr Vater hat erfahren, dass die Whittlers was bei der Canadian Pacific zu sagen haben, und sie nach Vancouver mitgeschickt. Der kann es wahrscheinlich gar nicht erwarten, dass sein Töchterchen den Whittler-Sohn heiratet und er einen großen Coup mit der Canadian Pacific landen kann. Glaub mir, ich weiß Bescheid. So lief das bei allen reichen Familien, für die ich gekocht habe. Aus Liebe hat kein Einziger von denen geheiratet. Und so einer wie Frank schon gar nicht.«
»Mit mir könnten sie so was nicht machen«, erwiderte Clarissa, »ich würde nur aus Liebe heiraten. Wenn das nicht klappt, bleibe ich lieber allein. Was will ich mit einem Mann, der nur mein Geld will und sich das, worauf es ankommt, bei anderen Frauen holt?« Sie schüttelte den Kopf. »Ohne mich, Betsy! Lieber bleibe ich mein ganzes Leben allein. Du schaffst es doch auch.«
Betsy nickte traurig. »Und rackere mich als Köchin ab. Aber ich war auch mal verheiratet ... mit achtzehn. Mit einem Mann, der dreizehn Jahre älter war als ich. Ich habe ihn geliebt, Clarissa, ob du’s glaubst oder nicht, ich habe ihn geliebt und ein halbes Jahr geheult, als er sich diese verfluchte Lungenentzündung einfing. Als er tot war, durfte ich ihn nicht einmal mehr sehen!«
Pünktlich um neunzehn Uhr erschienen die ersten Gäste. Im Salon war bereits gedeckt, und die Flaschen mit dem Champagner und die Gläser für die Begrüßungsdrinks standen auf einem Servierwagen. Clarissas Aufgabe war es, die Gäste einzulassen und ihre Mäntel in die Garderobe zu hängen. Die meisten behandelten sie von oben herab oder straften sie mit Nichtachtung, bedankten sich nicht einmal, wenn sie ihre Mäntel entgegennahm und ihnen den Weg zum Salon wies. Doch daran störte sie sich schon lange nicht mehr.
Der einzige Gast, der sie zu beachten schien, war Frank Whittler. Jedes Mal, wenn sie ihn bediente oder sich ihre Blicke zufällig kreuzten, lächelte er ihr verschwörerisch zu, als wollte er sie daran erinnern, was er vor einigen Tagen zu ihr gesagt hatte. Sie ging ihm, so gut es ging, aus dem Weg und tröstete sich damit, dass ihr in dieser Gesellschaft nichts passieren konnte. Solange sich so viele Menschen im Haus aufhielten, war sie sicher. Und die Geschmacklosigkeit, sich ihr ausgerechnet in seiner Verlobungsnacht zu nähern, würde selbst ein Mistkerl wie er nicht begehen.
Catherine war eine hübsche Frau, selbstgefällig, hochnäsig und eingebildet, aber ganz sicher imstande, seine Bedürfnisse zu befriedigen, selbst wenn sie nicht seine Traumfrau war.
Nach dem Essen musste Clarissa noch einmal Champagner servieren, bekam aber nur von draußen mit, wie Thomas Whittler mit seiner sonoren Bassstimme die Verlobung seines Sohnes ankündigte und ihn und seine zukünftige Schwiegertochter hochleben ließ. »Auf Catherine und Frank!«, rief er. Falls sein Sohn etwas sagte, ging es im fröhlichen Applaus der Gäste unter. »Na, das ist ja eine gelungene Überraschung!«, hörte sie den Bürgermeister sagen. Thomas Whittler fügte hinzu: »Möge der Zug, den die beiden besteigen, in eine glorreiche Zukunft fahren.« Womit er wohl auch die Verbindung der beiden Eisenbahnlinien, Canadian Pacific und Southern Ontario, meinte.
Nachdem sie dem Champagner zugesprochen hatten, blieben die Damen in einem Nebenzimmer des Salons, und die Herren zogen sich in die Bibliothek zurück, eine Angewohnheit, die Clarissa seltsam fand. Die Damen unterhielten sich über die neueste Mode und tauschten den aktuellen Klatsch aus, die Herren hüllten sich in Zigarrenrauch und erörterten bei Whiskey, Brandy oder Sherry die Geschäfte. Als sie den Servierwagen mit dem Kaffee in die Bibliothek schob, erkannte sie selbst in dem dichten Qualm, wie Frank ihr zuzwinkerte und sein Glas hob, als wollte er ihr zuprosten. Er vertrug anscheinend weniger als die anderen Gentlemen und schwankte leicht.
Ein Blick auf die Wanduhr im Salon zeigte Clarissa, dass es bereits auf ein Uhr zuging, als sich die Gäste verabschiedeten und sie die letzten Gläser abräumte. Louise Whittler gestattete ihr, auf ihr Zimmer zu gehen, bestand aber darauf, dass sie am nächsten Morgen, ihrem freien Tag, zum Dienst antrat und gründlich das Haus putzte. Ein halber freier Tag würde wohl auch mal genügen, und Gott würde sicher Verständnis dafür haben, wenn sie die Kirche ausfallen ließ. Dafür dürfte sie am Montag etwas später anfangen.
Erschöpft stieg sie die Treppe hinauf. Sie war seit sieben Uhr früh auf den Beinen und so müde, dass ihr nicht einmal Franks lüsterner Blick auffiel, als sie an der offenen Tür der Bibliothek vorbeiging. Er hatte sein Glas behalten, für einen »letzten Whiskey«, wie er sich ausgedrückt hatte, und stand allein zwischen den Bücherregalen. Seine Verlobte war bereits zu Bett gegangen.
In ihrem Zimmer vergaß Clarissa vor lauter Müdigkeit, den Riegel vorzuschieben, ein Fehler, den sie zumindest die nächsten Tage bereuen würde. Sie zog ihre Kleider aus, schlüpfte in ihr warmes Flanellnachthemd und kroch unter ihre Decken. Schon wenige Minuten später war sie fest eingeschlafen.
Es konnte keine halbe Stunde vergangen sein, als sie durch ein verdächtiges Knarren geweckt wurde. Sie fuhr hoch und rieb sich erschrocken die Augen. Eine dunkle Gestalt stand im Zimmer. In dem trüben Licht, das durchs Fenster hereinfiel, erkannte sie Frank Whittler, aber dafür hätte ihr auch schon der Whiskey- und Zigarrendunst, der ihn umfing, genügt. Sie erstarrte vor Angst. Eine unsichtbare Fessel legte sich um ihren Hals und zog sich so fest zusammen, dass sie kaum noch Luft bekam. Ängstlich starrte sie ihm entgegen.
»Hier bin ich«, sagte er grinsend. Er stand nur ein paar Schritte von ihr entfernt, beschwipst oder leicht angetrunken, aber nicht so stark, dass er nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen wäre. Seine Jacke und seine Schuhe hatte er zurückgelassen. Über seinem gestärkten Hemd, das zur Hälfte aufgeknöpft und feucht vom verschütteten Whiskey war, spannten sich die Hosenträger. »Ich wusste doch, dass du die Tür für mich offen lassen würdest.«
Clarissa rang nach Luft und fand mühsam ihre Sprache wieder. »Gehen Sie! Gehen Sie bitte!«, presste sie hervor. In ihre Augen schossen Tränen. »Gehen Sie zu Ihrer Verlobten! Ich will nicht, dass Sie ... Gehen Sie bitte!«
Ihre Verzweiflung schien ihn nicht zu beeindrucken. »Empfängt man so den Mann, nach dem man sich die ganze Zeit gesehnt hat?« Seine Stimme klang unnatürlich. »Glaubst du etwa, ich hätte nicht gesehen, wie du mich den ganzen Abend angestarrt hast? Gib’s zu, du hast doch nur darauf gewartet, dass ich zu dir komme. Du willst es genauso wie ich, stimmt’s, Schätzchen?«
»Gehen Sie bitte!«, flehte sie ihn an. »Sie sind ... sind betrunken!«
»Wir sind verabredet, Schätzchen! Hast du das etwa vergessen? Wir wollten unser Techtelmechtel nachholen.« Er trat bis dicht vor ihr Bett und schob seine Hosenträger über die Schultern. Seine Hose rutschte ein Stück nach unten. Er nestelte an den Knöpfen herum. »Du willst doch jetzt nicht kneifen?«
Ihr trat der Schweiß auf die Stirn. »Lassen Sie mich in Ruhe! Ich ...«
»Stell dich nicht so an!« Sein Tonfall änderte sich. »Du bist nicht die Erste, der ich’s besorge, und bisher hat sich noch keine beschwert! Also zieh dein verdammtes Nachthemd aus und mach die Beine breit, oder muss ich es dir erst vom Körper reißen?« Seine Miene hellte sich auf. »He, vielleicht legst du es ja darauf an! Du magst es auf die harte Tour, was? Das kannst du haben!«
Seine derbe Sprache riss sie aus ihrer Erstarrung. Noch bevor er aus seiner Hose gestiegen war und nach ihr griff, hatte sie die Decke zurückgeschlagen und stieß mit beiden Beinen nach ihm, dabei erwischte sie ihn am linken Schienbein.
Er stöhnte vor Schmerz und taumelte zurück. »Was fällt dir ein, du Miststück? Du hältst dich wohl für was Besseres!« Er rieb sich das schmerzende Schienbein und ging erneut auf sie zu. In seinen Augen blitzte wilde Entschlossenheit. »Na, warte ... Dir werde ich’s zeigen! Ich werde es dir so hart besorgen, dass du den Rest des Jahres an mich denkst. Und glaube bloß nicht, dass du mich bei Catherine oder meinen Eltern anschwärzen könntest. Die würden dir sowieso nicht glauben. Also benimm dich gefälligst wie eine Frau, oder ich sorge dafür, dass du wegen Diebstahls im Knast landest! Kapiert?«
In ihrer Panik stieß Clarissa wieder zu. Sie traf sein rechtes Knie und brachte ihn erneut aus dem Gleichgewicht, verschaffte sich etwas Raum, als er nach einem Halt suchte und fluchend ins Leere griff. Ohne ihm nachzusetzen, sprang sie aus dem Bett, wollte an ihm vorbei aus dem Zimmer fliehen und spürte plötzlich, wie sich seine rechte Hand um ihren linken Oberarm schloss und sie herumriss. Das wutverzerrte Gesicht des Eindringlings vor Augen, drosch sie mit der freien Hand auf ihn ein und traf seine Nase so heftig, dass sie zu bluten begann. Für einen Moment verlor er die Fassung.
Mit beiden Händen stieß sie ihn wütend von sich. Er war viel zu überrascht, um sich zu wehren, stolperte rückwärts durch den Raum, prallte mit dem Hinterkopf gegen die Wand und rutschte benommen zu Boden.
Kapitel 3
Clarissa blieb keuchend stehen und massierte ihre schmerzenden Finger. Bittere Tränen der Wut und Verzweiflung füllten ihre Augen. Sie hatte noch nie einen Menschen geschlagen, und der Anblick des blutverschmierten Mannes verstörte sie so sehr, dass sie ihn lange betrachtete und für einen Augenblick sogar versucht schien, ihm ein Taschentuch zu reichen und ihm aufzuhelfen.
Erst sein leises Stöhnen und ein dumpfes Knarren, das aus dem ersten Stock zu kommen schien, ließ sie den Ernst der Lage erkennen. Sie hatte nicht mehr viel Zeit. Sobald Frank Whittler zu sich kam, würde er alles daransetzen, sie festzuhalten und der Polizei zu übergeben. Er würde sie des Diebstahls beschuldigen und vielleicht sogar seine Brieftasche in ihrem Zimmer verstecken, um einen scheinbar eindeutigen Beweis zu haben. Niemand würde ihr glauben, und wenn sie zehn Mal auf die Bibel schwor, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen. Als einfaches Dienstmädchen hatte sie gegen eine der angesehensten Familien der Stadt nicht die geringste Chance.
Ihr blieb nur die Flucht. Sie musste so schnell wie möglich hier weg, bevor die anderen aufwachten und die Treppe heraufkamen. Sie lauschte noch einmal, hörte wieder ein Knarren, als würde sich jemand im Bett aufsetzen, nur übertönt vom regelmäßigen Schnarchen der Köchin, die sich an den Resten in den Champagnerflaschen vergriffen hatte und tiefer als sonst schlief. Clarissa ließ sich nicht täuschen. Wenn die Whittlers etwas gehört hatten, konnte Thomas Whittler jeden Augenblick aus seinem Schlafzimmer kommen, um nach dem Rechten zu sehen, und dann blieben ihr nur noch wenige Sekunden.
Sie zog ihren Mantel an und band die Haare zu einem Knoten, steckte ihren Hut mit zwei Nadeln daran fest. Ihre wenige Habe, die Kleider, ihre guten Schuhe, ihren Kamm und ein paar andere Kleinigkeiten, eine Fotografie ihrer Eltern, die sie ein Jahr vor dem Tod ihres Vaters auf einem Jahrmarkt hatten anfertigen lassen, und das Tom-Sawyer-Buch packte sie in ihre Reisetasche. Den Lederbeutel mit dem gesparten Geld verstaute sie in ihrer Manteltasche. Ein rascher Blick in den Spiegel überzeugte sie davon, wie eine normale Reisende und nicht wie nervöses Dienstmädchen auf der Flucht auszusehen, sogar ihre Haare saßen einigermaßen. Nur das unruhige Flackern musste sie aus ihren Augen verschwinden lassen, falls sie sich unangenehme Fragen ersparen wollte.
Sie wollte gerade zur Tür gehen, als Frank Whittler sich stöhnend regte und einen heiseren Laut ausstieß. Gleich darauf ging im ersten Stock eine Tür auf, und Catherine rief verschlafen: »Frank! Frank! Bist du hier irgendwo?«
Clarissa erkannte, dass ihr keine Zeit mehr blieb. Über den Dienstboteneingang verließ sie das Haus und schlich auf der Außentreppe nach unten. Bis auf das schwache Licht, das von den Lampen an der Hauptstraße ausging, war es dunkel, und wegen der dichten Wolken waren auch der Mond und die Sterne nicht zu sehen. Vom Meer wehte kühler Wind herüber. Das ferne Tuten eines nahenden Dampfschiffes hallte als dumpfes Echo über die Stadt.
Im ersten Stock, direkt neben ihr, flammte eine Lampe auf. Sie lief rasch weiter. Mit der Tasche in der Hand schlich sie die restlichen Stufen zum Garten hinunter und lief durch die Büsche aufs Nachbargrundstück. Die Villa gehörte einem Richter, der wegen seiner strengen Urteile gefürchtet war, das hatte sie von Betsy erfahren, die sich besser als jeder andere in Vancouver auszukennen schien und bestens über den Klatsch und Tratsch informiert war. Clarissa lief geduckt an der Villa vorbei, überquerte die Straße und blieb zwischen den Büschen eines benachbarten Grundstückes stehen. Ein kleineres Haus, deren Besitzer sie nicht kannte. Sie blickte zurück und sah, dass mehrere Fenster im Haus der Whittlers erleuchtet waren, sie glaubte auch zu beobachten, wie ein Mann über die Außentreppe nach unten stieg, wahrscheinlich Frank.
Sie hatte keine Ahnung, wohin sie sich wenden sollte, und rannte ziellos weiter, über die Straße in den Schatten eines Hauses. Ein Hund bellte nervös, er klang nicht gefährlich, war aber laut genug, um die Aufmerksamkeit ihres Verfolgers zu wecken. Sie spähte in die Dunkelheit und sah Frank, denn nur er konnte es sein, auf der Außentreppe verharren und in ihre Richtung blicken. In dem Haus, in dessen Schatten sie sich versteckt hatte, ging ein Licht an, und eine weibliche Stimme rief: »Was ist los mit dir, Rusty? Sag bloß, da draußen treiben sich wieder diese aufdringlichen Katzen herum!«
Clarissa schlich geduckt davon und rannte an den Nachbarhäusern entlang nach Osten; sie hielt sich im Schatten der vielen Bäume, die immer noch im West End wuchsen und der Gegend einen fast ländlichen Charakter gaben. Der Boden war morastig vom vielen Regen, und sie war alle paar Schritte gezwungen, einer Pfütze auszuweichen. Über einige unbebaute Grundstücke, die sich wie ein Park zwischen den Villen ausbreiteten, erreichte sie die breite Robson Street, tagsüber eine belebte Geschäftsstraße und um diese Nachtzeit genauso vereinsamt wie alle anderen Straßen in Vancouver. Nicht einmal eine Straßenbahn ließ sich blicken. Die Schienen schimmerten blass im düsteren Licht der Lampen, die erst seit einigen Monaten die Straße säumten. Die Mitglieder des Stadtrats waren so stolz auf ihre neue Errungenschaft und das große Elektrizitätswerk, dass sie die Straßenlampen die ganze Nacht brennen ließen.
Schon nach wenigen Schritten merkte Clarissa, dass sie einen großen Fehler begangen hatte. Einer der beiden Polizisten, die nachts ihren Dienst in der Stadt versahen, patrouillierte auf der Robson Street. Er tauchte so plötzlich aus einem der dunklen Hauseingänge auf, dass sie erschrocken zusammenfuhr.
»Ich wollte Sie nicht erschrecken, Miss«, entschuldigte er sich. Er war nicht viel älter als sie und hatte die Schirmmütze seiner blauen Uniform so weit in die Stirn gezogen, dass man kaum seine Augen sah. Das Abzeichen auf seiner Brust glitzerte. »Darf ich fragen, wohin Sie um diese Zeit unterwegs sind? Wir hatten in letzter Zeit einigen Ärger mit einer Jugendbande, und ich halte es für keine gute Idee, nachts um zwei spazieren zu gehen. Eine junge Dame wie Sie sollte sich überhaupt nicht allein in der Stadt aufhalten.«
Clarissa hatte sich schon wieder gefangen und versuchte ein Lächeln. »Ich weiß, Officer, und glauben Sie mir, ich bin um diese Zeit bestimmt nicht freiwillig auf der Straße. Ich will zu meiner Tante. Sie ist sehr krank und braucht jemanden, der sich Tag und Nacht um sie kümmert. Sie ist lieber allein und will wohl nicht, dass sie jemand leiden sieht. Gestern Abend hat sie mich sogar aus dem Haus gejagt. Aber ich mache mir Sorgen, Officer, und weil ich sowieso nicht schlafen kann, dachte ich ... Ich muss zu ihr, Officer.«
Die Ausrede war etwas weit hergeholt, überzeugte den Polizisten aber und entlockte ihm sogar ein verständnisvolles Lächeln. »Wie meine Großmutter«, erwiderte er, »die will auch keinen an sich ranlassen, obwohl sie sich kaum noch selbst waschen und anziehen kann. Zu manchen Dingen muss man die Alten zwingen, sagt meine Mutter, die ist auch ständig für sie unterwegs.« Ihm fiel wohl ein, dass ein Polizist nichts von seinem Privatleben preisgeben sollte, und fügte hinzu: »Darf ich fragen, wo Ihre kranke Tante wohnt, Miss?«
Clarissa überlegte kurz. Wenn sie Frank Whittler und einer möglichen Verhaftung entkommen wollte, musste sie zum Hafen oder zum Bahnhof, und beide lagen im Norden der Stadt. Also musste ihre vermeintliche Tante möglichst im Süden wohnen, falls Frank ebenfalls den Polizisten traf und nach ihr fragte. Sie rief sich die Straßennamen ins Gedächtnis. »In der Pacific Street.«
»Am False Creek? Ist vielleicht besser, wenn ich Sie begleite, Miss.«
»Nicht nötig, Officer«, wehrte sie rasch ab. Sie lächelte ihn an. »Ich komme schon zurecht. Ist ja nicht weit.«
»Die Tasche ist nicht zu schwer?«
»Nein, da sind nur ein paar Kleider meiner Tante drin. Ich hab sie bei mir zu Hause gewaschen. Ein paar Kleider und Schokolade ... Die isst sie gern.«
»Na, dann. Passen Sie auf sich auf, Miss!«
Clarissa ging langsam weiter. Sie spürte die Blicke des Polizisten in ihrem Rücken und musste sich zwingen, nicht zu schnell zu laufen, selbst wenn die Gefahr bestand, dass Frank Whittler auf der Robson Street auftauchte, solange sie noch nicht abgebogen war. Im trüben Schein der Straßenlampen hielt sie auf die nächste Kreuzung zu. Ihre Tasche, die tatsächlich so leicht war, wie sie dem Polizisten erklärt hatte, wog plötzlich schwer in ihrer Hand, und sie musste sich zwingen, sie nicht von einer Hand in die andere zu wechseln, um keinen unnötigen Verdacht zu erregen. Sie kam sich vor wie eine Diebin.
An der Kreuzung überquerte sie die Straße und bog in die Howe Street nach Süden ab. Aus den Augenwinkeln suchte sie vergeblich nach dem Polizisten, der wohl wieder in den Hauseingang verschwunden war. Sie sah gerade noch, wie Frank Whittler aus einer Nebenstraße gerannt kam, mitten auf der Straße stehen blieb und fluchte, als er sie nirgendwo entdecken konnte. Sie versteckte sich hinter dem Eckhaus und spähte vorsichtig zu ihm hinüber, sah den Officer aus dem Schatten treten und hörte ihn fragen: »Was ist denn mit Ihnen los, Mister? Warum sind Sie so nervös? Gibt es ein Problem?«
»Ein Problem?«, erwiderte er. »Natürlich gibt es ein Problem! Und wenn Sie nicht so untätig hier rumstehen würden, hätten wir es vielleicht längst gelöst. Ich suche eine junge Frau. Dunkle Haare, ziemlich groß und schlank ...«
»Hat sie Ihnen vielleicht den Laufpass gegeben, Mister?« Das süffisante Lächeln des Polizisten war bis in ihr Versteck zu spüren. Anscheinend glaubte er, dass sie mit Frank Whittler befreundet gewesen und weggelaufen war.
»Den Laufpass gegeben? Was fällt Ihnen ein?« Frank Whittler war außer sich vor Wut. »Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Frank Whittler von der Canadian Pacific. Sie wissen, dass diese Stadt der Eisenbahn gehört, und die CP auch über die Zusammensetzung der Polizei entscheidet. Also sagen Sie mir jetzt endlich, wohin die Frau gelaufen ist, oder Sie fliegen hochkantig raus! Sie ist eine Diebin, verstehen Sie? Eine gottverdammte Diebin! Sie hat mir fünfhundert Dollar gestohlen! Die leere Brieftasche lag auf ihrem Bett! Und als ich sie aufhalten wollte, ging sie mit einem Messer auf mich los!«
»Eine junge Frau? Mit einer Reisetasche?
»Ja, verdammt!
»Die ist zur Pacific Street runter. Wollte angeblich ihre kranke Tante aufsuchen. Hören Sie, woher sollte ich denn wissen, dass sie eine Diebin ist?«
»Geschenkt«, erwiderte er und lief weiter.
Clarissa hatte den Wortwechsel der beiden genutzt, um weiter nach Osten zu laufen und im Schutz der Dunkelheit, die unter einer defekten Straßenlampe herrschte, die Robson Street nach Norden zu überqueren und unbemerkt in die Granville Street abzubiegen. Am Ende der Straße ragte der Bahnhof der Canadian Pacific empor, ein wuchtiges Gebäude mit turmähnlichen Seitenflügeln, die es wie ein Stadttor einer mittelalterlichen Stadt erscheinen ließen.
Jetzt lief sie nicht mehr, sie rannte. Getrieben von der Panik, mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre in einem Gefängnis verbringen zu müssen, falls man sie erwischte, hastete sie auf das Ende der Straße zu. Bis zum Bahnhof waren es fünf Häuserblocks, und sie war vollkommen außer Atem, als sie ihr Ziel erreichte und sich in einem Hauseingang von der Anstrengung erholte.
Sie spähte zurück und konnte niemanden entdecken. Die Straße lag leer und verlassen im Schatten der mehrstöckigen Häuser. Kein Schatten flackerte über die Hauswände, keine hastigen Schritte und keine Flüche waren zu hören. Frank Whittler war nirgendwo zu sehen, doch es würde sicher nicht lange dauern, bis er ihre Finte durchschaute und von selbst darauf kam, dass sie die Stadt verlassen wollte. Spätestens dann würde er am Bahnhof und im Hafen auftauchen. Er würde alle Polizisten, die er finden konnte, nach Norden scheuchen und ihnen befehlen, die Gegend nach ihr abzusuchen. Solange kein Zug oder Schiff die Stadt verließ, musste sie noch in der Nähe sein.
Ihr Blick wanderte über das Bahnhofsgelände jenseits der Uferstraße. Nur von zwei schwachen Lampen beleuchtet, ragte der klobige Bau dunkel und bedrohlich empor. Dahinter erhoben sich die Masten der ankernden Segelschiffe und die Schlote riesiger Dampfer. An Bord brannten einige Lampen.
Auf den Gleisen hinter dem Bahnhof waren mehrere Güterwagen abgestellt. Weiter westlich spiegelte sich das Licht einer Lampe in den Fenstern eines Personenwagens. Bei genauerem Hinsehen entdeckte sie drei weitere Waggons. Ein Personenzug, der in Kürze auf das Abfahrtsgleis geschoben würde? Soweit sie sich erinnern konnte, fuhr jeden Morgen ein Personenzug nach Westen, aber es war bestimmt sicherer, auf einen Güterzug zu klettern und damit die Stadt zu verlassen. Leider kannte sie den Fahrplan nicht.
Sie blieb unschlüssig im Hauseingang stehen und dachte für einen Augenblick sogar daran, sich an Bord eines der Schiffe zu schleichen und dort zu verstecken. Nur was passierte, wenn das Schiff nach China oder Indien fuhr? Was sollte sie in einem Land, dessen Kultur ihr fremd war, und dessen Sprache sie nicht verstand? Wovon sollte sie dort leben? In die Heimat zurücknehmen würde man sie bestimmt nicht mehr. Die Seeleute waren sicher froh, wenn sie das Schiff verließ, und würden sie nicht mehr an Bord lassen. Irgendwo hatte sie gelesen, dass man Frauen auf einem Handelsschiff nicht duldete. Sie bedeuteten großes Unglück, hieß es in den Seemannslegenden.
Von der Robson Street tönte ein Pfiff herauf. Aufgeregte Rufe hallten als dumpfes Echo von den Häuserwänden zurück. Die Polizei suchte nach ihr. Sie blickte ängstlich zurück, sah einige dunkle Schatten und verließ rasch ihr Versteck. An dem Haus entlang lief sie zur Uferstraße und rannte im Schutz eines großen Bürogebäudes zum Bahnhof. Von der Angst getrieben, die Verfolger könnten sie im Lichtschein sehen, tauchte sie im Schatten unter und tastete sich zu den Gleisen vor. Neben dem Bahnhofsgebäude und nur wenige Schritte von einem der abgestellten Personenwagen entfernt, blieb sie stehen.
Wieder drang ein Pfiff an ihre Ohren. Auf der Granville Street, die zum Bahnhof führte, erschienen zwei Männer: Frank Whittler und der Polizist, dem sie etwas vorgelogen hatte. Ihr blieb keine Zeit mehr. Kurz entschlossen lief sie zu dem Personenwagen, erklomm die hintere Plattform und betrat den Wagen. Unter einem der Fenster ging sie rasch in die Knie und spähte von der Seite, damit man sie nicht sehen konnte, nach draußen. Ein denkbar ungünstiges Versteck, wie sie erkannte, aber jetzt nicht mehr zu ändern. Die beiden Männer hatten den Bahnhof bereits erreicht und blickten sich suchend um.
»So dumm, in einen der abgestellten Wagen zu klettern, wird sie doch nicht sein«, sagte der Polizist. »Sie muss doch wissen, dass wir hier suchen.«
»Wer weiß?«, erwiderte Whittler. »Rufen Sie Ihre Kollegen und suchen Sie das ganze Gelände nach der Diebin ab, auch im Hafen. Blasen Sie schon in Ihre verdammte Pfeife! Oder brauchen Sie was Schriftliches?«
»Aber so viele Leute sind wir nicht! Das dauert Stunden!«
»Versuchen Sie es wenigstens, Officer! Und lassen Sie sich nicht von ihren dunklen Augen täuschen! Die Lady hat es faustdick hinter den Ohren!«
»Wir tun, was wir können, Sir.«
»Dann fangen Sie endlich damit an!« Er deutete auf den Wagen, in dem sie sich versteckt hatte. »Ich nehme mir inzwischen schon mal die Wagen vor.«
Clarissa sah ihren Verfolger kommen, schob ihre Reisetasche unter die Sitzbank und kroch rasch hinterher. Sie machte sich so klein wie möglich und zog ihren Mantelkragen vors Gesicht, damit ihre weiße Haut nicht in der Dunkelheit leuchtete. Whittler begann anscheinend am anderen Ende mit der Suche, und es dauerte eine Weile, bis sich die Tür am Ende des Wagens öffnete, ein kühler Windhauch durch den Wagen fuhr, und sich scharrende Schritte durch den Gang näherten. Ihr Puls wurde schneller, und sie kroch weiter unter den Sitz, bis kaum noch Raum zwischen ihr und der Wand blieb.
»Hätte mich auch gewundert«, sagte er so laut, dass sie es hören konnte, »so dumm ist sie nicht. Das Miststück ist mit allen Wassern gewaschen!«
Die Schritte entfernten sich, und sie entspannte sich ein wenig, dankbar dafür, dass es noch kein Licht in dem Wagen gab und er sich nicht gebückt und unter jedem Sitz nachgesehen hatte. Wahrscheinlich hatte er Angst, sich seine teure Hose schmutzig zu machen. Trotz ihrer misslichen Lage musste sie lachen. Ein Gentleman wie er überließ die Drecksarbeit lieber anderen.
Die Tür hinter ihrem Sitz öffnete sich und wurde wieder geschlossen. Frank Whittler verließ den Zug und trieb sofort wieder die Polizisten an. »Seht bei den Güterwagen nach! Irgendwo muss sie sich verkrochen haben!«
Die Polizisten eilten davon, und als sie vorsichtig ihr Versteck verließ und aus dem Fenster spähte, sah sie Frank Whittler langsam zur Uferstraße zurückgehen. Er zog eine kleine Flasche aus der Innentasche seines Mantels, nahm einen kräftigen Schluck und sagte irgendetwas, das sie nicht verstand.
»Dieser miese Lügner!«, fluchte Clarissa leise vor sich hin.
Kapitel 4
Der durchdringende Pfiff einer Lokomotive ließ Clarissa aus dem Schlaf schrecken. Sie öffnete verwirrt die Augen und stellte entsetzt fest, dass sie mit dem Kopf an der Schulter eines Mannes lehnte. Er roch nach einem Duftwasser, wie es eigentlich nur Damen benutzten, und nach frischer Seife. Dicht vor ihren Augen glänzte eine goldene Krawattennadel im ersten trüben Tageslicht.
Sie wollte sich aufrichten und setzte gerade zum Sprechen an, als sich sein rechter Arm fest um ihre Schultern legte, und er mit der freien Hand ihren Kopf an seine Schulter drückte. »Kein Wort!«, warnte sie seine flüsternde Stimme. »Oder wollen Sie im Gefängnis landen? Die Polizei kommt!«
Sie verschluckte die heftigen Worte, die ihr auf der Zunge lagen, und stellte sich schlafend. Nur einmal öffnete sie kurz die Augen und sah einen Polizisten durch den Wagen kommen. Ein älterer Officer, der die wenigen Passagiere, die schon auf ihren Plätzen saßen, erschöpft musterte. Seine schlurfenden Schritte kamen langsam näher. Es fiel ihr schwer, die Augen geschlossen zu halten und so regelmäßig zu atmen, dass sie keinen Verdacht erregte.
»Guten Morgen, Mister«, hörte sie ihn sagen. »Ihre Gattin?«
»Meine Verlobte«, antwortete der Mann, an dessen Schulter sie lehnte. Sein Duftwasser stieg ihr in die Nase. »Wir haben eine lange Anreise hinter uns, und die Arme ist ziemlich erschöpft. Wir wollen nach Calgary ... Dringende Geschäfte. Ich handele mit Grundstücken, wissen Sie?« Er klang wie ein vornehmer Gentleman. »Darf ich fragen, wonach Sie suchen, Officer?«
»Nach einer jungen Frau«, antwortete der Polizist bereitwillig. Er schien einigen Respekt vor dem eleganten Gentleman zu haben, »dem Dienstmädchen von Mister Whittler. Sie hat seinem Sohn fünfhundert Dollar aus der Brieftasche gestohlen und muss sich noch irgendwo in der Stadt aufhalten.«
»Sie hat den Sohn des Eisenbahn-Managers bestohlen?« Clarissa nahm an, dass der Gentleman den Kopf schüttelte. »Dann wäre sie schön dumm, wenn sie sich ausgerechnet in einem Zug verstecken würde. Hier entdeckt Whittler sie doch am ehesten. Über den Telegraf kann er an jedem Bahnhof seine Leute warnen, die brauchen sie nur abzufangen, wenn sie irgendwo aussteigt.«
»Hab ich Mister Whittler auch gesagt.« Der Officer sprach mit gedämpfter Stimme, als hätte er Angst, sie zu wecken. »Wenn Sie mich fragen, ist sie bei einer Freundin untergekrochen und wartet, bis sich die Aufregung gelegt hat. Aber Mister Whittler will wohl ein Exempel an ihr statuieren. Besonders der junge Mister Whittler. Er hat uns sogar eine Belohnung versprochen, falls wir die Diebin finden. Leider haben wir keine genaue Beschreibung.«
»Es gibt keine Fotografie oder Zeichnung von ihr?«
»Nur eine Beschreibung, und die passt auf jede zweite junge Frau. Wir sollen auf allein reisende Frauen achten.« Obwohl Clarissa die Augen geschlossen hatte, glaubte sie den Officer grinsen zu sehen. »Ihre Verlobte wecken wir besser nicht. Mit einem Gentleman wie Ihnen wird sie sich ihren Lebensunterhalt wohl kaum als Dienstmädchen verdienen müssen. Auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen, Officer. Viel Glück bei der Suche!«
Der Officer öffnete die Tür und stieg aus dem Wagen. Sie atmete befreit auf, als sie hörte, wie sich seine Schritte entfernten. Um ganz sicherzugehen, behielt sie die Augen aber geschlossen und öffnete sie erst, als sich der Druck des Arms um ihre Schultern lockerte, und der Gentleman sagte: »Sie haben es überstanden, Miss. Den Officer sind wir los, und der Schaffner wird wohl kaum an eine Diebin denken, wenn er Sie in meiner Gesellschaft sieht. Sie haben gehört, was er gesagt hat, sie suchen nach einer allein reisenden Frau.«
Sie löste sich von ihm und blickte ihn erstaunt an. Er war nicht besonders groß, trug einen Zylinder aus echtem Biberfell, und sein Anzug und das weiße Hemd saßen so makellos, dass sie nur maßgeschneidert sein konnten. Seine Haut war blasser als ihre und wirkte im morgendlichen Zwielicht, das durch die Fenster in den Wagen fiel, beinahe krank. Über seinen Lippen schimmerte ein bleistiftdünner Bart. Auffallend waren seine Hände, die auch einer reichen Lady gut gestanden hätten. Sie hatte noch nie einen Mann mit so sauberen und sorgfältig geschnittenen Nägeln gesehen. Weniger zu seiner eleganten Erscheinung passten seine blauen Augen, die sie in einer seltsamen Mischung aus Arroganz und Spott ansahen. Weniger verachtend als Frank Whittler, aber von einem ähnlich übersteigerten Selbstbewusstsein bestimmt.
»Vielen Dank«, sagte sie leise. »Warum haben Sie mir geholfen?«
Der Gentleman lächelte. »Sollte ich etwa zulassen, dass man eine hübsche Lady wie Sie ins Gefängnis wirft? Ich dachte mir gleich, dass Sie dieses Dienstmädchen sind, als ich Sie auf dem Boden liegen sah. Warum sollten Sie sich sonst hier verstecken? Wie eine Landstreicherin sehen Sie nicht aus.« Er betrachtete seine manikürten Hände, eine Geste, die sie noch öfter an ihm beobachten würde. Sein Lächeln blieb. »Sie können von Glück sagen, dass ich als Erster in den Wagen kam, Miss, ein anderer hätte vielleicht die Polizei gerufen. Ich hab Sie auf die Bank gehoben, Ihren Mantel gesäubert und Ihre Tasche ins Gepäcknetz gelegt.« Er deutete auf die Ablage über ihrem Sitz.
»Das war sehr freundlich von Ihnen«, bedankte sie sich noch mal. Eigentlich gehörte er zu der Sorte Männer, mit der sie nichts zu tun haben wollte. »War das der einzige Grund? Weil Sie mich für eine hübsche Lady halten?«