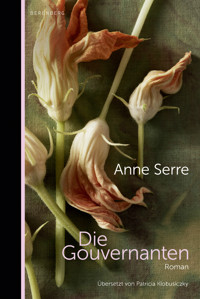Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich halte mich für sehr geschickt, wenn es um die Verfertigung von Träumen geht. Pro Nacht gelingen mir im Schnitt vier, und es sind wahre Romane, genauer gesagt Erzählungen.« Träume, Erinnerungen, Fantasien, mal scharf konturiert, mal vage verschwimmend – daraus knüpft Anne Serre ihr raffiniertes, spielerisch leichtes Selbstportrait in dreiunddreißig Facetten. Eine unbekannte Mutter, die Liz Taylor ähnelt, ein verheirateter Liebhaber, der mit einem Revolver spielt, ein anderer, der an Becketts Todestag auftaucht … und wie Karten, die man aufdeckt, erscheint mal ein weibliches, mal ein männliches, verletzliches oder mörderisches Ich. Ausgezeichnet mit dem Prix Goncourt de la Nouvelle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Serre
Im Herzeneines goldenenSommers
Aus dem Französischenvon Patricia Klobusiczky
Geheimnisvoller, fremder
Als wäre sie tot
Nicht größer als ein Taschentuch
Auf dem Rasenplatz
In der Hinterhand
In jenem Sommer
Ein Würfelwurf
Stark wie ein Löwe
Unter den Eukalyptusbäumen
Das Paradebeispiel einer Flucht
Ist es nicht wundervoll, einzigartig zu sein?
Wir messen all diesen Dingen große Bedeutung bei
Madame Gandi
Keine Spur von Sonne
My God!
Ein kleiner Fehler
Querfeldein
Vor fünfzehn Jahren in London
Selbst Schluss machen
Wenn ein naher Angehöriger stirbt
Das ist eine Hypothese
Hyères
Irène und ich
Papa ist zurück
Meine Tolstoibluse
Dirty Old Town
Wladimir
Eine Sünde
Ein Strauß Stiefmütterchen
Der Großschriftsteller
Um Mitternacht, bei dir hinterm Haus
Mit einem Lächeln
Was fehlt
Über die Autorin
Jeder von uns ist mehrere, ist viele, ist ein Übermaß an Selbsten. […] In der weitläufigen Kolonie unseres Seins gibt es Leute von mancherlei Art, die auf unterschiedliche Weise denken und fühlen.
FERNANDO PESSOA
Geheimnisvoller, fremder
Meine Mutter hat gepackt und ist so weit, sie will mitfahren. Aber dann ruft sie am Sonntagnachmittag in allerletzter Minute an, um uns zum Abendessen einzuladen. Ich taue den Kühlschrank ab, erklärt sie mir. Da kann ich das Hähnchen doch nicht verkommen lassen.
Nichts ist für mich befremdlicher als diese Worte aus dem Mund meiner Mutter, einer eleganten Frau ohne Sinn fürs Praktische, die sich nie um ihren Kühlschrank oder ums Kochen kümmert, das übernimmt eine Haushaltshilfe, die man früher als Köchin bezeichnete. Wie bitte, was ist denn los, Mama?, frage ich. Ich habe mich doch klar und deutlich ausgedrückt, antwortet meine Mutter, die sich noch nie in ihrem Leben so ausgedrückt hat, ich wollte nicht, dass das Hähnchen verdirbt, und ihr könnt ruhig ab und an bei mir zu Abend essen, du und Françou. Meinen Lebensgefährten François nenne ich nie Françou, und auch niemand sonst, soviel ich weiß, erst recht nicht meine Mutter, die ihn immer gesiezt hat. Mama, sage ich, da stimmt doch was nicht. Ich erkenne dich nicht wieder. Das ist nicht deine Art zu reden. Und dann höre ich zu meiner Verblüffung ein ziemlich hämisches Lachen: Ha, ha, ha, das soll dir eine Lehre sein, sagt meine Mutter.
Sprachlos lege ich auf. François ist nicht da, ich weiß nicht recht, was ich tun soll. Mama spinnt offenbar, sie leidet an Altersdemenz, dabei ist sie erst achtundsechzig, aber es heißt ja, dass es manchmal früh anfängt. Ich gehe im Wohnzimmer auf und ab, bis ich mich entschließe, das Auto zu nehmen und zu ihr zu fahren, um zu sehen, was los ist, und eventuell einen Arzt einzuschalten. Wir wohnen in der Stadt, meine Mutter in einem rund zwanzig Kilometer entfernten Nachbardorf. Ich versteh’s nicht, denke ich beim Verlassen der Garage, gestern hörte sie sich am Telefon ganz normal an. Sie sagte, ich möchte euch wirklich nicht stören, mein Schatz. Es ist ja sehr nett von euch, besonders von François, dass ihr mich auf euren Wochenendtrip mitnehmen wollt, aber ich möchte euch nicht zur Last fallen. Ihr sollt ganz frei schalten und walten, ich fühle mich zu Hause sehr wohl und wir können uns auch nächste Woche sehen.
Das ist meine Mutter, wie sie denkt und spricht. Nie hat sie mit mir über Gefrierschränke oder dringend zu verzehrende Hähnchen geredet, oder höchstens in einem vollkommen anderen Ton: Meinst du nicht, wir sollten dieses Hähnchen essen, das seit Tagen im Kühlschrank liegt, mein Schatz? Sandra wird es zubereiten (Sandra ist die Köchin). Und das auch nur, falls ich sie besuche, wir in ihrer Küche sind und sie mich den Kühlschrank öffnen sieht. Ansonsten würde ihr das nicht einmal im Traum einfallen.
Was ist mit Mama los? Unterwegs mache ich mir ein wenig Sorgen, und als ich vor dem Haustor parke, kann ich es kaum erwarten, sie zu sehen und mich zu vergewissern, dass sie die alte ist. Ich klingle und rufe dann wie immer Huhu!, um mich zu erkennen zu geben, und als sie die Tür aufmacht, bin ich erleichtert und zugleich überrascht. Es ist meine Mutter, aber auch wieder nicht. Vertraut sind mir ihr schönes Gesicht, das sorgfältig frisierte Haar, aber sie trägt ein unglaublich gelbes und duftiges Kleid, das ich noch nie an ihr gesehen habe und das vor allem ganz anders ist als das, was sie üblicherweise trägt. Wir umarmen uns, sie bittet mich in den Salon, was mich etwas beruhigt, weil das zu unserem Begrüßungsritual gehört, und äußert sich nur leise erstaunt über mein Kommen, was ebenfalls zu ihr passt.
Ich freue mich sehr, dich zu sehen, mein Schatz, sagt sie, aber das kommt so unerwartet, was ist denn los? Sie erinnert mich an Liz Taylor. Genau. Nicht wegen der Frisur – meine Mutter hat ihr Haar hochgesteckt –, sondern wegen des hübschen Gesichts mit den klaren Zügen, dem geraden Näschen und den tiefblauen Augen, der unverwechselbaren Art, mit der die Schauspielerin sowohl körperlich als auch mimisch Präsenz zeigte, und auch wegen dieses kurzen gelben Musselinkleids. Was für ein hinreißendes Kleid, ich habe dich noch nie darin gesehen, sage ich. Pah, antwortet meine Mutter, ich habe es aus irgendeinem Schrank gezogen, es stammt sicher aus den Sechzigern, aber es steht mir immer noch gut, findest du nicht? Ich versuche, mein Lachen liebevoll klingen zu lassen. Etwas eigenwillig für einen Wintersonntag, oder? Du warst ja schon immer recht konventionell, mein Schatz, sagt meine Mutter und bläst Rauchringe aus, dabei habe ich sie bisher noch nie mit Zigarette gesehen.
Mir ist durchaus klar, dass wir nichts über die Menschen wissen, die uns am nächsten stehen. Oder dass uns zumindest ein Großteil zu ihren Lebzeiten verborgen bleiben kann und manchmal nach ihrem Tod unerwartet zutage tritt, in Kalendereinträgen, Tagebüchern oder Briefen. Vielleicht hat meine Mutter ja jemanden kennengelernt, kommt mir plötzlich in den Sinn. Einen Mann. Das ist die einzige Erklärung für das gelbe Kleid. Dafür, dass sie neuerdings raucht. Dass sie Liz Taylor ähnelt. Unwillkürlich horche ich auf Schritte, auf einen Dritten im Haus. Ich stelle mir einen Mann vor, der auf einmal im Türrahmen steht und sagt: Hello! Wie geht es Ihnen? Ich bin der Lebensgefährte von Liz (meine Mutter heißt Élisabeth). Aber nein, anscheinend sind wir beide allein im Haus. Meine Mutter wirft mir einen sehr merkwürdigen Blick zu. Sie belauert mich. So habe ich sie noch nie erlebt. Normalerweise begegnet sie mir mit einer Art freundlicher Gleichgültigkeit.
Ich lasse nicht locker: Was sollte das mit dem Hähnchen? Ich verstehe nicht, warum dir das so wichtig ist. Sonst hast du doch keine Ahnung, was in deiner Küche oder deinem Kühlschrank lagert. Das kümmert dich nicht. Meine Mutter bückt sich wie ein junges Mädchen zum Aschenbecher, der auf dem Teppichboden steht, drückt ihre Zigarette aus, steht auf und geht zum Schreibtisch. Manchmal ändert man sich eben, sagt sie und wühlt in irgendwelchen Papieren. Du etwa nicht? Aber du bist ja auch noch so jung. Dann dreht sie sich um, und in ihrem gelben Kleid, mit dem schönen, entschlossenen Gesicht – und diesen so tiefblauen Augen, dass mir plötzlich die Frau wieder einfällt, die einmal zu ihr sagte: Élisabeth, Ihre Augen sind wie ein Magnet –, kommt sie mir jünger und lebendiger vor als ich, erotischer, gefährlicher, geheimnisvoller, fremder.
Als wäre sie tot
Die Postkarte zeigt eine Esplanade, bepflanzt mit Palmen, die sich unter einem zu blauen Himmel am Ufer eines zu blauen Meeres aneinanderreihen. Die Karte ist nicht schlecht gewählt, eine von denen, die Fernweh wecken und die Sehnsucht, Neues zu erkunden, alte Gewohnheiten aufzugeben und infolge dieser Dynamik ein wenig freier und klüger zu werden. Bedauerlicherweise werden kaum noch Postkarten verschickt. Wir brauchen sie nicht mehr, um Sehenswürdigkeiten, Straßen oder Plätze zu entdecken, die im Internet viel besser präsentiert werden, aber die digitalen Bilder, ob bewegt oder nicht, lösen im Gegensatz zu Postkarten nicht auf Anhieb diese Reiselust aus.
Die Karte stammte von Valérie, sie schrieb: Ich liebe diese Gegend wirklich über alles, und sie wird mir nie langweilig. Du solltet auch mal hinfahren. Sie hatte das »s« vergessen. Wie konnte einem so etwas unterlaufen? Prüften die Leute nicht, was sie geschrieben hatten? Mir kam das sehr merkwürdig vor. Oder vielleicht fiel es Valérie schwer, zwischen »ich«, »du«, »ihr« und »sie« zu unterscheiden. Oder zwischen Modus und Tempus.
Ich mag Palmen, den blauen Himmel und das blaue Meer ausgesprochen gern, leere Esplanaden mag ich hingegen nicht so sehr. Diese war komplett verwaist. So ein menschenleeres Meeresufer finde ich trist, erst recht mit diesen Palmenreihen. Da bevorzuge ich Paris mitten im August, wo es zwar auch schrecklich öde ist, aber dann ist man wenigstens zu Hause, umgeben von vertrauten Dingen.
Ich malte mir aus, wie es wäre, in einem Hotel an diesem zu blauen Meer unter dem zu blauen Himmel und mit dem Dutzend gelben Palmen an der menschenleeren Esplanade zu wohnen, und kam zu dem Schluss, dass ich mir die Kugel geben würde. Valérie findet aber vieles reizvoll, was in meinen Augen jeden Reizes entbehrt, ein Zeichen ihrer großen Stärke. Wobei ich mal einen jungen Mann kannte, der unablässig auf der Suche nach möglichst trostlosen Dörfern, Seebädern und Ferienorten war. Ich weiß nicht, warum, doch ihm gefiel das. Vermutlich hatten diese Orte für ihn eine gewisse erotische Anziehungskraft. Oder er kostete das Gefühl aus, dass ihn absolut niemand kannte. Und so konnte er dort ein anderer sein. Wo man vergleichsweise allein ist, fällt das leichter als in Gesellschaft, egal wie groß oder klein.
Natürlich fand ich es schon immer recht verlockend, eine andere zu sein (nur für einen Tag oder höchstens eine Woche). Irgendwo auftauchen, mich anders kleiden, frisieren, verhalten, es ein Stück weit ausprobieren und dann zack kehrtmachen und mich unterwegs wiederfinden.
Nach eingehender Betrachtung rief Valéries Postkarte in mir zwei Erinnerungen wach: an ein Meeresufer auf Martinique, in einem ziemlich tristen und hässlichen Städtchen, seltsamerweise aber auch an einen Urlaub, den ich in Italien verbracht und im Rückblick dermaßen verklärt habe, dass er mir inzwischen als herrliche Zeit an einem herrlichen Ort erscheint. Ich nahm mir die Karte noch einmal vor, griff sogar zur Lupe und sah im Fensterrahmen eines Gebäudes an der Esplanade eine Frau mit aufgestützten Ellenbogen, die Sophia Loren zu ihren Glanzzeiten ähnelte. Dann bemerkte ich die zu drei Vierteln vom Stamm einer Palme verdeckte Silhouette eines Mannes, der zu ihr hochblickte. Offenbar hatte der Postkartenfotograf diese Liebe festgehalten. Und das zu blaue Meer, den zu blauen Himmel und die leere Esplanade hatte er wohl so stark ins Licht gerückt, um von dieser Liebe abzulenken, die ihm ins Auge gefallen war, die er aber nicht auf den ersten Blick preisgeben wollte. Dann sah ich eine Katze in einer Seitenstraße, sah, wie Fensterläden aufgingen und Leute zum Strand schlenderten, und dachte, dass ich zunächst nur die Zeit der Siesta wahrgenommen hatte, diese furchtbare Pause zwischen zwölf und sechzehn Uhr, wenn die Menschen sich einschließen, um der sengenden Hitze und Sonne zu entgehen, und die Welt so öde wirkt, als wäre sie tot.
Nicht größer als ein Taschentuch
An einem Frühlingsmorgen kam ich durch die Via Margutta. Ich war auf dem Weg zu einem kleinen Synchronstudio, das in einem der alten Höfe zwischen der Margutta und den Hängen des Pincio liegt. Jeden Moment rechnete ich damit, Fellini zu begegnen. In Rom war allgemein bekannt, dass er, sobald es wieder milder wurde, zwischen neun und halb zehn einen kurzen Spaziergang in seinem Wohnviertel unternahm. Man erkannte ihn von Weitem an seinem Schal, den er erst im August ablegte. Unterwegs trank er bei Giovanni am Tresen stehend einen Kaffee. Die Römer lächelten ihm zu, den Touristen blieb bei seinem Anblick die Spucke weg, manche wollten ihn anfassen, um sich zu vergewissern (wie?), dass er es wirklich war. Natürlich lungerten eine Menge junger und weniger junger Schauspieler in der Gegend herum und hofften, dass er sie bemerken würde. Vor allem einer, Silvio Silvio, den alle in der Branche kannten, dieser winzige, kaum anderthalb Meter große Schauspieler, versuchte ständig, Fellini von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten, und schaffte es nie, als wäre er tatsächlich, wie es hieß, vom Pech verfolgt. Und so traf jeder, der im April um neun Uhr morgens in der Via Margutta unterwegs war, sowohl Fellini als auch Silvio Silvio, aber nie gleichzeitig, nie von Angesicht zu Angesicht. Angeblich ging Silvio Silvio danach stets heim und weinte bis zwölf Uhr mittags (seiner Frau zufolge), was Tullio Dartoli zu seinem wunderbaren Roman Silvios Tränen anregte, der mit dem Stresa-Preis ausgezeichnet wurde und sich in Italien 200.000 Mal verkaufte. Silvio Silvio hoffte, der Erfolg dieses Buches würde in Fellini den Wunsch wecken, ihn kennenzulernen, er hoffte sogar (hieß es), dass dieser Lust hätte, den großartigen und im Grunde so felliniesken Roman von Tullio Dartoli zu verfilmen, doch Fellini meldete sich nie (hieß es weiter), als könnten oder sollten sich die Leben beider Männer, die einander räumlich und auch beruflich (Silvio Silvio war nämlich ein hervorragender Schauspieler, wie seine Filme mit Nanni Duigi, Roberto Falli und Gianni De Gargi gezeigt hatten) so nah waren, um keinen Preis vermengen.
Mir sind noch andere Fälle bekannt, von zwei Menschen, die wie geschaffen waren, einander zu verstehen, zu schätzen und gegenseitig zu ergänzen, während ihre Lebenswege sich unweigerlich gabelten und dennoch ständig streiften, als wäre der eine letztlich nur eine Spiegelung des anderen. Ich denke da an Henrietta Van De Mine, die am Fuße des Campidoglio wohnte und sich in den achtziger Jahren in den schönen Luciano dei Monti verliebt hatte. Eigentlich hätten sie sich überall begegnen müssen: Henrietta sang, Luciano komponierte, Sängerinnen und Komponisten teilten oft das Bett. Doch sobald Henrietta auf einem Fest erschien, verließ Luciano es durch eine andere Tür. Wenn Luciano ein Casting für Opernsängerinnen einberief, war Henrietta stets auf Tournee oder krank und bettlägerig. Die Unmöglichkeit ihrer Zusammenkunft war in römischen Künstlerkreisen zur Legende geworden, denn man wusste nicht nur, dass Henrietta Luciano verfallen war, als sie ihn ein einziges Mal von fern eine seiner Eigenkompositionen dirigieren sah, sondern auch, dass Luciano seit jeher davon träumte, sie kennenzulernen, da sowohl ihr Talent als auch ihre Schönheit gerühmt und gepriesen wurden. Es war aber nichts zu machen, offenbar lag ein Fluch (oder Segen? Wer weiß?) auf diesem Paar, das sich nicht paaren ließ. Man organisierte Abendgesellschaften zu ihren Ehren, und dann sagte sie oder er in letzter Minute ab, wegen dringender familiärer Verpflichtungen oder weil ein Bruder gestorben oder das Haus in Flammen aufgegangen war. Tatsächlich mutete es recht dreist und unüberlegt an, die beiden unbedingt zusammenführen zu wollen, denn inzwischen war auch legendär, dass kurz vor diesen unmöglichen Treffen entweder Henriettas oder Lucianos Verwandte, Freunde oder Güter aus heiterem Himmel von einem Unglück heimgesucht wurden.