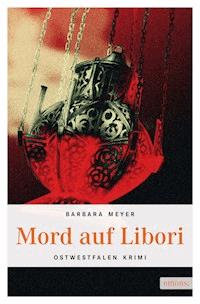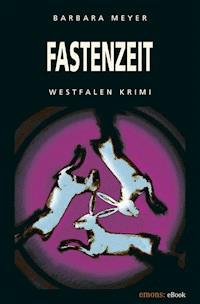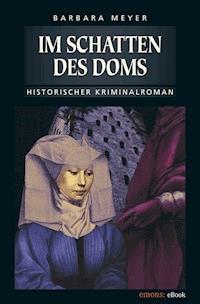
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Schatten des Doms entführt den Leser in das Paderborn des Jahres 1611, eine Zeit religiöser Kämpfe und dunkler Geheimnisse.
Bischof Dietrich von Fürstenberg setzt alles daran, die Stadt zu rekatholisieren - notfalls auch mit Gewalt. Als ein Mord geschieht, gerät der junge Advokat Diether Meschede unter Verdacht. Um nicht als Ketzer gebrandmarkt zu werden, macht er sich auf die Suche nach dem wahren Täter. Doch in der Domstadt hat fast jeder etwas zu verbergen.
Die Ermittlungen führen ihn tief in ein Netz aus Intrigen, Macht und Verrat. Und offenbar gibt es Kräfte, die vor nichts zurückschrecken, um ihre Geheimnisse zu schützen - selbst vor Mord.
Im Schatten des Doms ist ein fesselnder historischer Kriminalroman, der den Leser in eine Zeit voller Spannungen und Umbrüche entführt. Barbara Meyer zeichnet ein lebendiges Bild des frühneuzeitlichen Paderborn und lässt dabei auch die dunklen Seiten der Kirchengeschichte nicht aus. Ein Muss für Fans intelligenter historischer Spannungsliteratur!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Meyer studierte Mediävistik und Allgemeine Literaturwissenschaften in Paderborn. Sie arbeitet als freiberufliche Autorin im Bereich Regional- und Familiengeschichte. Seit Kurzem lebt sie außer in der Nähe des Paderborner Doms auch in Puerto de la Cruz auf Teneriffa.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind, soweit nicht historisch vorgegeben, frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Menschen sind rein zufällig, die mit längst verstorbenen gewollt.
© 2014 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagzeichnung: Heribert Stragholz eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-703-1 Historischer Kriminalroman Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
»Judicium melius posteritatis erit.«
»Was heute noch beschnarcht der Neid,
so achten wird die künftge Zeit.«
Wahlspruch Dietrich von Fürstenbergs, Fürstbischof von Paderborn (1585–1618),
PROLOG 1586, AM DONNERSTAG NACH ST. LUCIA
18.Dezember
Lucia von Syrakus (†13.12.310) gilt als Patronin der Bauern, Blinden, reuigen Dirnen, Glaser, Notare, Schreiber und Türhüter. Sie wird angerufen gegen Armut, Augenleiden, Feuersbrunst und Infektionen.
Vorsichtig schlich er am Rathaus entlang und lauschte zur Marktkirche hinüber. Alles ruhig. Auch Kamp und Schildern– keine Schritte, keine Lichter.
Sein erlauchter Oheim ließ sich Zeit. Was, wenn er die Urkunde nicht bekommen hatte? Wenn der Bischof nochmals Änderungen, weitere Sicherungen verlangt hatte? So oder so, er hatte seinen Lohn verdient.
Die protestantische Verwüstung wird ein Ende haben. Das hat der Fürstenberger mir zu verdanken, dachte er, mir, dem unbedeutenden Angehörigen des Paderborner Magistrats. Die Anerkennung hätte er mir ruhig bei Tageslicht aussprechen können. Wie ein Dieb drückte er sich mitten in der Nacht in den Schatten herum.
Längst hatte die Rathausuhr die zweite Stunde geschlagen, zu der ihn der hochmögende Beauftragte des Bischofs treffen wollte. Hier an der zugigsten Ecke der ganzen Stadt. Am frühen Abend hatte es geschneit, doch jetzt trieb der Wind eisigen Regen die Westernstraße herauf. Er zog den Mantel enger und lief ein paar Schritte, um seine Füße aufzuwärmen.
Nur der Wind pfiff, sonst war die Stadt totenstill. Tagsüber war es hier zu voll, um den Wind zu spüren, der sich im engen Schildern fing. Der Markt, die Waage im Rathaus, mehrere Schenken, die Schulen, Kirchen und Klöster– aus allen Straßen, von den umliegenden Dörfern, aus dem ganzen Land sogar strömten die Leute hierher. Dann war die ausladende Freitreppe zum Ratssaal dicht umlagert, und manch einer warf ob der verfließenden Zeit besorgte Blicke auf die Uhr im Türmchen darüber.
Am Tag grüßte man ihn ehrerbietig, wenn er im fellgefütterten Umhang über dem bauschigen Wams das Rathaus aufsuchte. Jeder, der ihn jetzt sähe, ohne Kröse und versteckt unter dem dunklen Mantel, das Barett tief in die Stirn gezogen, musste ihn für einen Verbrecher halten.
Unwillkürlich wandte er den Kopf in Richtung des Domturms, der wie ein mahnend erhobener Zeigefinger die Häuser der Stadt überragte. Auch in der Nacht. Oft genug hatte er gedacht, er müsse jeden Augenblick auf ihn fallen.
Aber er war kein Verbrecher. Er hatte nur die Sakramente in die Stadt zurückholen wollen.
Aufatmend bog er um die Ecke des schmalen Fachwerkbaus. Hier sah ihn niemand. Der vorkragende Rathausgiebel schluckte jedes Licht, die Scharnegasse mit den stinkenden Fleischbänken lag im Dunkeln. Befriedigt nahm er den vertrauten Mief wahr. Obwohl die Ratten längst jeden Unrat zwischen den Verkaufsständen weggeputzt hatten, roch es durch den Regen hindurch deutlich nach Verwesung.
Niemand wäre auf die Idee gekommen, auf dieser Seite des Rathauses ein Fenster zu öffnen. Deshalb hatte auch niemand überprüft, ob nach der Sitzung alle geschlossen waren. Sowieso war reichlich gebechert worden. Selbst Brabeck, sonst so gewissenhafter Stadtdiener, hatte schwankend auf seinen Rundgang verzichtet.
Er gratulierte sich zu seiner Voraussicht. Geschah ihnen recht, wenn sie hintergangen wurden. Reißende Wölfe und falsche Propheten hatte Abt Ruben die Ratsherren genannt. Und wenn es zur Vollendung seines Werks gehörte, durch den speckigen Dreck der Scharnegasse zu stapfen, so stapfte er eben.
Aus dem Kötterhagen näherten sich Schritte, unsicher, schlitternd. Das musste er sein. Statt über den gepflasterten Kamp zu gehen, rutschte Johann Westphal, vornehmer Gefolgsmann des Fürstbischofs, die feuchten Hintergassen entlang.
Blödsinnige Heimlichtuerei! Er trat aus dem Schatten des Rathauses und ging auf den Oheim zu. »Habt Ihr die Urkunde?«, flüsterte er aufgeregt.
Westphal gab gedämpft zurück: »Der Bischof hat unterschrieben. Wir können doch hinein?«
Ein Stein fiel ihm vom Herzen. Eilig wisperte er: »Ja, aber achtet auf Eure Füße. Nachts gibt es hier Ratten. Hatte Zeit genug, sie kennenzulernen, während ich auf Euch wartete.«
Westphal gab keine Antwort. Hielt es nicht für nötig, sich wegen der Verspätung zu entschuldigen. Die Gunst des Bischofs erhob ihn wohl turmhoch über den Sohn seiner Base, dem er ohnehin nichts zutraute. Dabei hatte er den herrschaftlichen Auftrag makellos ausgeführt im letzten Jahr. Und heute Abend: Lief es nicht wie am Schnürchen?
Nachdem er erst den knochigen Oheim und dann sich selbst über die schmierige Fensterbank gehievt hatte, durchquerten sie die dunkle Halle, deren größten Raum die Stadtwaage einnahm. An der Wand entlang tasteten sie sich zur Tür des angrenzenden Vorraums, wo sie nahezu geräuschlos die Falltür öffneten. Erst am Fuß der Stiege in die finstren Gewölbe unter dem Rathaus entzündete er die von oben mitgebrachte Laterne.
»Hier, lies.« Westphal gab dem Neffen die Urkunde, nahm ihm gleichzeitig aber das Licht aus der Hand. Ob mit Absicht, war dem hageren, von flackernden Schatten entstellten Gesicht nicht zu entnehmen.
»Es war ein schönes Stück Arbeit, den hochwürdigen Herrn Bischof dazu zu bringen, sie zu unterzeichnen«, berichtete er salbungsvoll. »Er war durchaus der Meinung, dass du ohne Auftrag gehandelt hast und er dir keineswegs verpflichtet ist. Herr Kaspar und ich haben ihn schließlich überzeugt, dass du, Auftrag oder nicht, dem Bistum einen großen Dienst erwiesen hast.«
Argwöhnisch musterte er den Oheim und erkundigte sich: »Und die Schenkung erstreckt sich über den gesamten Besitz?« Er brach eine der Kerzen ab, die auf einem Wandbord in den Überresten zahlloser Vorgänger klebten. Westphal öffnete die Laterne, damit er sie anzünden konnte.
»Er ist dein und wird vererbt auf deine Nachfahren«, erwiderte er. »Aber es ist zurzeit nicht ratsam, das Dokument offen herumliegen zu lassen. Allzu leicht könnte jemand eine Verbindung ziehen. Wir werden es gut verstecken, damit es die Zeiten überdauert. Solange Dietrich lebt, wird er den Besitz bezeugen, und deine Enkel können auf die Urkunde zurückgreifen.«
»Aber der Bischof kann sterben!«
»Beschrei es nicht«, sagte Westphal warnend. »Und wenn– deshalb verstecken wir sie ja hier. Du musst sie nur rechtzeitig herausholen und zu den anderen legen.«
Lieber hätte er sie gleich an ihren Platz gelegt. Aber was nicht war, konnte noch werden.
Er zog das ersehnte Dokument aus der ledernen Hülle und entrollte es. Im flackernden Kerzenschein konnte er die Worte kaum entziffern. Lang war der Text nicht. Schnell fuhr er mit dem Finger die Namen der Flurstücke entlang und prüfte, ob keins fehlte. Dann wandte er sich den bischöflichen Dankesfloskeln zu.
Westphal nahm die Laterne und inspizierte die verdreckten Kerker im vorderen Rathauskeller, die schon lange keine Gefangenen mehr gesehen hatten.
»Die Lutheraner lassen die Stadt verlottern, und niemand tut was dagegen«, grummelte er verdrossen.
Im diffusen Licht wurden schroffe Bruchsteinkanten sichtbar, hier und da mit bröckligem Erdreich durchsetzt. Wo die winzigen Fensterlöcher unter der Decke dem Regen ungehindert Einlass boten, hatten sich im gestampften Lehm Pfützen gebildet.
Nicht angenehm, hier eingesperrt zu sein. Schnell drängte er den Gedanken beiseite.
Noch immer kam es ihm wie ein Wunder vor, dass alles so glattgegangen war. Er glaubte fest daran, dass schon das Gelingen die Tat rechtfertigte. Alle Heiligen hatten ihm beigestanden. Doch noch heute verfolgte ihn in seinen Träumen ein grässlich verzerrtes Gesicht…
An der Tür zur Triesekammer blieb Westphal stehen. Sie als Einzige war mit einem Schloss versehen, allerdings ohne Schlüssel. Viel war ohnehin nicht zu stehlen, bis auf Brabecks Weinvorräte, die in der steinernen Kammer kühl gehalten wurden. Immerhin lag hier, jedenfalls so weit das Licht reichte, kein Unrat herum.
Westphal leuchtete in leere Truhen und inspizierte die Regale, auf denen ein paar wertlose Pfandstücke verstaubten. Nur aus einem offenen Schrank in der äußersten Ecke des Raums, hinter einer Mauer aus Weinfässern fast verborgen, schimmerte es matt silbern.
»Wenn man uns ertappt, wird wenigstens niemand unterstellen, wir seien auf die Schätze der Stadt aus gewesen.«
So, so, der hohe Herr konnte also auch witzig sein.
Westphal wandte sich von den verwahrlosten Beständen ab und murmelte: »Aber es wird den Bischof interessieren, wie es in der Schatzkammer der hochnäsigen Magistratsherren aussieht.«
Verdrossen schaute er auf den Neffen. »Wird Zeit, dass du aufhörst, die Urkunde zu studieren. Ist dir wohl nicht groß genug, die Belohnung?«, fragte er. Seinem Gesicht war anzusehen, dass er bedauerte, sich für den Verwandten eingesetzt zu haben. In beißendem Ton fuhr er fort: »Du bist dem hochwürdigen Herrn Bischof zu Dank verpflichtet, nicht umgekehrt, dass du es nur weißt. Du schuldest ihm deine Existenz, und er wird sie dir nehmen, wenn es sein muss!«
Er folgte dem Oheim ins Archiv, ging an ihm vorbei zu den hinteren Schränken und suchte nach der krakeligen Aufschrift »Maspern«. Hier lag die Urkunde über den Familienbesitz, die er vor Kurzem erst eingesehen hatte. Jetzt gehörte das weitläufige Nachbargrundstück ebenfalls ihm. Und nicht nur das. Wie er sehr wohl wusste, gehörten zu dem alten Hof an der Stadtmauer fast sechzig Morgen Äcker und Wiesen auf der Sülte und in Ammenhusen, außerdem ein Teil des Dörner Holzes. Ab sofort war er Hof- und Landbesitzer, nicht mehr nur Erbe der Klitsche seines Vaters.
Westphal legte die Akziselisten beiseite, in denen er neugierig geblättert hatte, und riss ihn aus seinen Gedanken. »Brabeck sollte etwas gegen die Ratten tun, sonst fressen sie deinen gesamten Besitz auf!« Meckernd wies er auf Fraßspuren an den Pergamenträndern.
Insgeheim gab er dem Oheim recht. Wie alles, was die derzeitigen Stadtherren in Händen hatten, war auch das Archiv vernachlässigt. Niemand fühlte sich zuständig, es zu beaufsichtigen, und wer eine Urkunde einsehen wollte, nahm sie einfach mit. Auch der Schrank vor ihm stand offen. Die Pergamentrollen lagen, von ungeduldigen Händen immer wieder umsortiert, kreuz und quer durcheinander, und kein Besucher machte sich die Mühe, sie zu ordnen.
»Brabeck hat es längst aufgegeben, hinter den Ratsherren herzulaufen«, erwiderte er, den Stadtdiener verteidigend. »Meist wollen sie ja doch nur einen Extraschluck. Sie lassen Türen und Schränke offen, sodass jedes Ungeziefer hineinkann, und nehmen alles Wertvolle mit. Auch er ist froh, wieder einen richtigen Bischof als Stadtherrn zu haben, glaube ich.«
»Glaubst du oder hast du ihn gefragt?«, zischte Westphal. »Dietrich will wissen, auf wen er sich verlassen kann, vergiss das nicht!«
»Wenn der Bischof ins Rathaus will, wird er Brabeck nicht brauchen«, sagte er ausweichend. »Ist es denn schon so weit?«
Westphal leuchtete in die vollgestopften Schränke. »Hier braucht man gar nicht erst etwas zu verstecken«, brummte er. »Es wird entweder sofort gefunden oder geht für immer verloren.«
Danach hatte er nicht gefragt.
»Der Bischof wartet ab«, antwortete Westphal endlich und hielt ihm die Laterne vors Gesicht. »Ständest du denn offen auf seiner Seite, wenn er jetzt schon versuchte, die Zustände zu ändern? Dietrich braucht entschlossene Männer, die auch mal sagen, was die anderen nicht hören wollen. Nimm dir ein Beispiel an Liborius Wichart: Der ist zwar in seinem Glauben verstockt, aber er gibt dem verfilzten Magistrat Kontra, wie er’s braucht.«
»Wichart ist Pelzhändler und hat seine Kundschaft. Sogar unter den Magistratsherren, mit denen er sich sonst nur zankt. Ihr wisst doch, warum Vater wollte, dass ich in den Rat gehe!«
»Du wärst nicht im Rat, wenn ich dir nicht geholfen hätte. Denk manchmal daran. Aber jetzt lass uns sehen, wo wir die Urkunde sicher unterbringen können. Schließlich ist es dir zu verdanken, dass Dietrich so bald aufsteigen konnte, davon beißt keine Maus einen Faden ab. Und auch keine Ratte«, fügte er angewidert hinzu, als das Licht der Laterne, die er auf einem leeren Regalbrett abgestellt hatte, auf Spuren winziger Füße im Staub und überall herumliegende Rattenküttel fiel.
Dann rückte der Oheim einen der leeren Schränke von der Wand und stellte die Laterne um, damit sie den Spalt beleuchtete. Mithilfe seines Dolchs kratzte er einen der Bruchsteine frei und brach aus der Rückseite ein paar lose Stücke heraus.
»Das wird reichen«, sagte er zufrieden. »Hast du die Urkunde wieder in die Hülse gesteckt? Das Leder wird sie vor Feuchtigkeit schützen. Nun leg sie hinein und dann lass uns diesen unwirtlichen Ort verlassen.«
Sie schoben den Stein zurück an seinen Platz und füllten die Lücken säuberlich mit herumliegenden Splittern, sodass die Wand an dieser Stelle so fest schien wie nie zuvor. Der Schrank hatte allerdings deutliche Schleifspuren im Staub hinterlassen, und ihre Fußabdrücke waren im hinteren Teil des Kellers, wohin sonst niemand kam, gut zu sehen. Westphal nahm ein paar Urkunden, fegte damit den Boden und warf die Dokumente mit anderen zusammen vor den Schrank und in den Gang.
»So schnell wird niemand hier aufräumen, und wenn, wird er sich nicht wundern, dass es unter den Urkunden nicht so dreckig ist wie überall sonst«, bemerkte er boshaft, als er das Licht aus dem Regal nahm und das Durcheinander im Dunkeln zurückblieb. Nachdem die Türen geschlossen, die Laterne zurückgestellt und sie unbehelligt durch das Fenster gestiegen waren, verabschiedeten sie sich kühl und gingen – der Oheim zum Kamp, er Richtung Pader– auseinander.
Nun gut, dachte er, als er an der Marktkirche vorbei bergab lief. Westphal konnte es einerlei sein, was aus den Besitzurkunden der Stadtbürger wurde. Seiner Meinung nach, natürlich auch der Dietrichs, gehörte ohnehin aller Besitz Gott und damit dem Fürsten, der nehmen und geben konnte, wie er wollte.
Er war von beiden Seiten abgesichert. Erleichtert sprang er die zur Bache führenden engen Stufen hinab. Den Kauf des väterlichen Grundstücks hatte der Magistrat besiegelt, und jetzt kam das große nachbarliche Anwesen hinzu, dokumentiert als bischöfliche Schenkung und mit einem ebenso stattlichen Wachsabdruck versehen.
Nur der Vater wusste, dass es nun ihm gehörte. Es war vereinbart, dass er den alten Hof mit den ausgedehnten Ländereien vorgeblich in Pacht nahm, um nach und nach durchsickern zu lassen, dass er sich mit Kaufabsichten trage. Niemand wolle nach ein paar Jahren noch etwas über die genauen Besitzverhältnisse wissen, hatte Westphal prophezeit, wenn er, der neue Besitzer, nicht so dumm sei, den Hof verkaufen zu wollen.
Nein, so dumm war er nicht. Was dachte der Oheim von ihm? Er würde sich fein säuberlich auf dem Anwesen niederlassen und den Kopf nicht heben.
Nur schade, dass der Hof so abgelegen war. Im Vorbeigehen bewunderte er die geschwungene Giebelspitze von Rötekens Haus auf der Bache, deren filigrane Umrisse sich vor dem dunklen Himmel abzeichneten. Eine Fassade wollte gesehen werden. Der Ükern war jedoch nicht die Gegend, wohin sich seine Ratsgenossen verirrten. Ihre Häuser lagen in den feinen Gegenden auf dem Berg– am Gierstor, am Kamp oder in der Westernstraße, die man jederzeit trockenen Fußes passieren konnte.
Anders in der unteren Stadt. Schon hier zwischen den Spitälern watete man im Dreck. Vorsichtig balancierte er über die glitschigen Bohlen und umging die Misthaufen, um nicht in die der Pader entgegensickernde Jauche treten zu müssen.
Auf der Kisau war es nicht besser. Linker Hand die warme Pader, rechts zwei weitere Paderarme, dazwischen unberechenbare Tümpel, die mal hier, mal da auf der Straße auftauchten. An allen Paderarmen waren die Mühlen der Kapitelsherren aufgereiht, deren knarrende Räder und rumpelnde Mahlwerke jetzt jedoch schwiegen.
Tastend suchte er nach einem Weg durch die Pfützen. Hatte er den Ükern jemals trocken erlebt? Der Matsch war überall, auch die Schweine, die sich darin suhlten und denen es nur recht war, wenn er durch Speisereste, Erbrochenes und den Inhalt so manchen Nachttopfs angereichert wurde.
Wie immer schien ihm, als fiele auf den stinkenden Ükernwegen jede Ratsherrenwürde von ihm ab. Als sie noch Kinder waren, hatte ihnen der Schmutz nichts ausgemacht. Sie hatten in den Gassen gespielt und es genossen, wenn es zwischen den Zehen quatschte. Heute schüttelte es ihn bei der Erinnerung.
So tiefgründig, undurchschaubar und übel riechend wie der Ükernmatsch sei der Filz der versippten Magistratsherren, sagte der Vater oft. Auch wenn sie auf dem Berg mit seinen gepflasterten Straßen wohnten– die Füße hatten sie tief im zähen Dreck.
Jetzt gab es weder Schweine noch Kinder auf der Straße. Die Lichter in den Fachwerkhäuschen waren gelöscht, über den Dächern wehten magere Rauchfahnen. Es hatte wieder zu schneien begonnen, doch nun war es nicht mehr weit. Der Vater wartete sicher auf ihn und hatte das Feuer noch nicht abgedeckt. Wärme und ein heißes Bier, das war es, was er jetzt brauchte.
Wie vom Vater aufgetragen, hatte er die Urkunde sorgfältig geprüft, nachdem Westphal sie ihm ausgehändigt hatte. Obwohl im flackrigen Schein der Kerze kaum etwas zu erkennen war, hatte er sich nicht nur die Aufstellung seiner neuen Besitztümer, sondern auch die Danksagung genau angesehen und sich deren Wortlaut eingeprägt. »Wegen der unvergesslichen Dienste, die unser treuer Diener« – dann folgte rot umschnörkelt sein Name– »am Palmsonntag des Jahres 1585 der Christenheit und dem rechten Glauben des Bistums geleistet hat, gehen die unten verzeichneten Höfe und Flächen in seinen Besitz über…«
Fast hätte er die Kerze fallen lassen, als ihm – erst auf den zweiten Blick– aufgegangen war, was da geschrieben stand. Es war nicht beabsichtigt gewesen, den Grund für die Belohnung offenzulegen. Was also sollte die Erwähnung des bewussten Palmsonntags? Warum hatte der Bischof einfügen lassen, wann der Dank verdient worden war? Jahrzehnte konnten vergehen, doch diesen Tag vergaß so leicht niemand in der Stadt.
Dietrich wollte ihn also in der Hand haben. Solange er lebte, sollte er nicht wagen, auf den Besitz zu pochen. Als ob er das je vorgehabt hätte! Dennoch hatte er es für sicherer gehalten, noch auf dem Flur des Rathauskellers, während Westphal überall herumstöberte, mit der Kerze um den Palmsonntag herum das Pergament so anzusengen, dass der Tag für alle Zeit unleserlich blieb.
Vorsichtig umging er den Uißenpuhl, der allen Aufschüttungen zum Trotz seine Sumpffinger immer wieder ausstreckte. Ob der Vater den Einfall mit der Kerze guthieß? Immerhin war jetzt in der Urkunde ein Loch, was bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung ungünstig aussehen könnte…
Hier war die Stadtmauer. Versperrte grau und massig den Blick auf den wolkenverhangenen Himmel. Die letzten Schritte konnte er sorglos hinter sich bringen. Vom Graben jenseits der Mauer entwässert und gepflastert mit herabgefallenen Kalksteinscherben, war im gesamten Ükern nur der Weg entlang der Mauer trockenen Fußes zu begehen. Der Matsch war zu besiegen, das musste er den Ratsgenossen nur klarmachen.
1611
AM TAG DES HEILIGEN NIKOLAUS
6.Dezember
Nikolaus von Myra (4.Jahrhundert) ist der Schutzheilige der Kinder, aber auch der Apotheker, Bäcker, Kaufleute, Notare, Metzger, Seeleute, Bierbrauer, Fischer, Pilger und Reisenden. Er wird angerufen für die Befreiung aus der Gefangenschaft, gegen Diebstahl, falsches Urteil und für die Wiedererlangung gestohlener Sachen.
Diether! Diether! Diether!«
Die kleine Nichte hatte Johannas Hand losgelassen und stolperte ihm über den uneben gepflasterten Dielenboden entgegen. Sie sprach noch kaum ein deutliches Wort außer seinem Namen, den sie deshalb begeistert und beharrlich wiederholte.
Der junge Dr.Meschede, Anwalt ohne Erfolg und Ratsherr ohne Einfluss, verzog das Gesicht. Geschrei hatte er genug gehört, der Kopf schwirrte ihm davon. Bedeutungsvolles Geschrei, das ja, mit großen Folgen und manchem Risiko. Jeder hatte zu Wort kommen wollen. Wichtigtuerisches Getöse, das kein Ende nahm.
Er hängte den nassen Umhang über die Herdumrandung, um die letzte Wärme einzufangen. Seine fürsorgliche Schwester nahm ihm den weißen Spitzenkragen ab, den er nur zur Ratssitzung trug, und verwahrte ihn sorgsam. Auch das enge Wams legte er ab und zog den warmen Hausrock über Unterzeug und Kniehosen. Jetzt freute er sich auf einen ruhigen Abend im Kreis der Familie, was Katrinchen wenig kümmerte.
»Wenn sie weiter so kreischt, vertreibt sie jeden Diether, der ihr jemals über den Weg läuft«, knurrte er mit finsterer Miene.
»Das ist ihr egal, sie will nur dich«, sagte Johanna lachend und ging ihm voraus. Sie kannte den kleinen Bruder gut genug, um seinen Unmut nicht ernst zu nehmen.
Mit dem immer noch »Diether« rufenden Katrinchen auf dem Arm betrat er die Wohnstube seiner Eltern, wo ihm fünf Köpfe erwartungsvoll zugewandt waren.
»Hast du gesprochen?«, erkundigte sich die Mutter, kaum dass er sich einen Platz am Kamin gesucht hatte.
»Danke der Nachfrage, liebe Mutter, es geht mir gut«, entgegnete er flachsend. In ihr unzufriedenes Gesicht hinein fuhr er ungerührt fort: »Draußen pfeift der Wind, und es schneit immer noch. Inzwischen ist kaum noch durchzukommen, und ich bin froh, dass ich nicht in einer Schneewehe versunken bin.«
Altklug mischte sich Gese ein. »Was das nur wieder werden soll! Es schneit seit Tagen und ist doch eigentlich viel zu kalt dafür.«
Auf die kleine Magd war Verlass. Als Schäferstochter fühlte sie sich gefordert mitzureden, sobald jemand über das Wetter sprach. Wie der mürrische, aber herzensgute Knecht Henrich gehörte sie zur Familie und konnte sich manche Freiheiten herausnehmen, obwohl sie im katholischen Paderborn christliche Demut lernen sollte.
Die Mutter soll ruhig warten, sagte er sich. Die Neuigkeiten aus dem Rathaus würde er ohnehin erst bekannt geben, wenn er mit Vater und Schwager allein war. Sie interessierte sich vor allem dafür, wie ihr Sohn geglänzt hatte; die Beschlüsse mit ihren Folgen und Kosten waren ihr einerlei.
Gese betete allerlei Wetterzeichen her, die einen harten Winter vorausgesagt hatten. Sie ignorierte die giftigen Blicke der Hausfrau und genoss die unverhoffte Aufmerksamkeit des jungen Herrn. »Und außerdem spukt immer noch das Böse in der Feldmark herum. Das Wetter ist verhext, und das liegt nur an den Jesuiten«, behauptete sie, ernsthaft mit dem Kopf nickend.
Für Gese zog der ungesühnte Tod des Wanderdoktors, dessen Mörder die Jesuiten im letzten Sommer entkommen lassen hatten, alles seitherige Unheil und auch das schlechte Wetter nach sich. Trotz ihrer Herkunft aus dem kalvinistischen Büren ist sie ganz schön abergläubisch, dachte Diether. Bis zu den Schäfern auf dem Feld schien sich die neue Lehre nicht herumgesprochen zu haben. Ihr ohnehin rosiges Gesicht unter den hellen Flechten glühte vor Eifer.
Belustigt gab er zurück: »Wie du von jedem Wind auf die Jesuiten kommst, ist geradezu unheimlich. Bei aller Düsternis um sie herum hat man von schwarzer Magie nun doch noch nichts gehört.«
»Hört jetzt auf! Über die Brüder Jesu macht man keine Späße«, warf die Mutter tadelnd ein.
Auch sie verpasste ihr Stichwort nie.
Hilflos wandte sie sich an ihren Mann. »Willst du etwa nicht hören, wie der Magistrat entschieden hat?«
»Das kann warten«, brummte der Vater vom Tisch her, wo er mit Johannas Ehemann Sieghart über den Abrechnungen saß. Gutmütig zwinkerte er dem Sohn zu und bedeutete seiner Frau: »Lass den Jungen erst mal nach Hause kommen. Hat er überhaupt schon zu Abend gegessen?«
Maulend stand Gese auf.
»Lass gut sein, Vater.« Diether hielt sie zurück. »Wir haben üppig getafelt. Schließlich gab es einen Beschluss zu feiern, der einigen viel Geld bringen wird. Der arme Brabeck musste, obwohl er kaum noch laufen kann, viele Krüge schleppen. Wie er es schafft, sich bei dem Gerenne selbst dermaßen zu betrinken, ist mir ein Rätsel.«
Müde vom reichlich genossenen Wein lehnte er den Kopf gegen die gekachelte Ofenwand. In der behaglichen Wärme entspannte er sich, doch seine Gedanken wanderten zu den Vorkommnissen des Abends zurück. Es war gelaufen wie erwartet. Der vom Bischof geforderte, dennoch lang diskutierte Beschluss war gefasst worden. Anderes war nicht erledigt worden. Heinrich Westphal, als Amtmann des Bischofs mit der Aufsicht über die städtischen Angelegenheiten betraut, hatte wie so oft gefehlt, und so konnte wieder nicht über die längst fällige Abschaffung der bürgerlichen Stadtwachen abgestimmt werden. Das ärgerte Schwager Sieghart, der regelmäßig auf der Mauer Wachdienst zu leisten hatte.
In Paderborn gingen die Uhren langsamer als anderswo, das hatte Diether inzwischen gelernt. In den Städten, die er auf seinen Studienreisen besucht hatte, wehte ein schnellerer Wind. Schon an der Sprache hatte er es gemerkt: Je weiter er nach Süden kam, umso geschwinder waren die Leute mit dem Wort, und ihm war es erschienen, als ob viele auch schneller dächten. Ganz anders seine Ratsgenossen, die in ihrem gemächlichen Bauernplatt Ewigkeiten brauchten, um einen Satz herauszubringen. Nur im Streit waren sie flink, da flogen die Worte so rasch hin und her, dass Diether sich wünschte, der Eifer käme auch einmal dem Stadtwesen zugute.
Anderswo bewachten seit Langem bezahlte, gut ausgebildete Kriegsknechte die Stadtmauern. In Paderborn machten das immer noch die Bürger selbst, obwohl kaum jemand gelernt hatte, mit Spieß und Schwert zu kämpfen oder gar mit Kanonen zu schießen. Auch Diether nicht. Sein Fach war die Verteidigung des Rechts, dazu brauchte man eine spitze Zunge, und die hatte er von der Mutter geerbt. Sie hielt sich viel darauf zugute, in der Stadt aufgewachsen zu sein und sich – anders als die maulfaulen Bauern, wie sie gern sagte– einer Städterin gemäß auszudrücken. Sogar zu schreiben und zu lesen hatte sie gelernt, was nicht einmal unter den wohlhabenden und hochnäsigen Paderbornerinnen weit verbreitet war.
Bisher allerdings hatte ihm sein Wortwitz wenig geholfen, da die älteren Magistratsherren den Grünschnabel kaum ernst nahmen. Vorgeschlagen vom Bruder der Mutter, dem bischöflichen Rentmeister Antonius Barcholt, war der junge Advokat am letzten Silvesterabend auf Anhieb in den Rat gewählt worden, was ihn selbst nicht wenig überrascht hatte. Doch hörte ihm kaum jemand zu, wenn er – selten genug– zur Sache sprach, und noch nie hatte der Stadtsekretär seine Ausführungen im Ratsbuch festgehalten.
»Hat Dorbecher es aufgeschrieben?«, erkundigte sich die Mutter jedes Mal, wenn er über seine Reden berichtete, und war enttäuscht, wenn der Sohn wieder nicht in die Annalen der Stadt eingegangen war.
Für heute hatte sie es wohl aufgegeben, etwas aus ihm herauszubekommen. Gefolgt von Johanna und der Magd, verließ sie mit Katrinchen auf dem Arm die Stube, um noch ein wenig für die Familie zu beten, wie sie es nannte.
Klang da etwa ein Vorwurf mit?
***
Missmutig stand Margret Meschede am Fenster ihrer Schlafkammer. Draußen trieb immer noch der Schnee vorbei und türmte in den Hofecken schroffe Hänge auf. In welligen Hügeln lag er auf der Hoffläche, aus Richtung des Stalls durchzogen von einem schwarzen Jaucherinnsal. Wie so oft folgte sie ihm mit den Augen, bis es unter der Mauer verschwand, wo ein Durchlass es dem Graben entlang des Wegs vor ihrem Haus zuführte.
Wenn nur alle Ärgernisse so leicht verschwänden! Ihre vorlaute Magd beispielsweise. Bei jeder Gelegenheit musste sie ihre ketzerischen Ansichten zum Besten geben, und ihr wohlerzogener Sohn lachte noch darüber. Hatten sie ihn dafür studieren lassen?
Natürlich waren nicht die Patres schuld am schlechten Wetter, dachte sie empört. Wenn Gott die Stadt strafen wollte, dann für ihren Abfall vom rechten Glauben, und eben den wollten die heiligen Brüder in der Stadt wieder verbreiten. Was ihnen schwer genug gemacht wurde: Jeden frühen Sonntag sah sie mit eigenen Augen die Kutschen der irrgläubigen Familien zum Gottesdienst ins protestantische Lippstadt fahren. Sie hatte Pater Bodo, ihrem stattlichen Beichtvater und väterlichen Freund, schon oft davon erzählt, was schließlich ihre Christenpflicht war.
Sie ließ den Vorhang fallen und trat ins Zimmer zurück. Mit ungeduldigen Fingern zerrte sie die Haube vom Kopf, hängte sie dann aber sorgfältig auf den Haken. Erlöst ließ sie das schwere dunkle, von nur wenigen grauen Fäden durchzogene Haar fallen. Dann band sie die wattierten Hüftpolster unter dem Rock los und legte sie in die Truhe, damit Johann sie nicht zu Gesicht bekam.
Ächzend ließ sie sich im Betstuhl vor der Marienfigur nieder und nahm den Rosenkranz zur Hand. Die Winterastern zu Füßen der Gottesmutter waren längst vertrocknet, und wie jeden Abend nahm sie sich vor, am nächsten Morgen ein paar grüne Zweige hinzustellen. Trotz des traurigen Anblicks sorgte die Jungfrau Maria redlich für den Frieden in ihrem Haus und das Glück ihrer Kinder, weshalb sie ihr nicht zu danken vergaß.
Nur wenige Eltern hatten so viel Freude an ihrem Nachwuchs, zumal Diether, anders als manch studierter Sohn sonst, widerspruchslos in seine Heimatstadt zurückgekehrt war. Seine Zukunft gab zu den schönsten Hoffnungen Anlass. Bei seinem Aussehen konnte er, wenn er einmal ins Heiratsalter kam, unter den reichsten und schönsten Mädchen der Stadt wählen. Er hatte vom Vater das weizengelbe Haar geerbt, die dunkelblauen Augen und die robuste Haut. Auch die eindrucksvolle Größe kam von Meschedes, bei Diether allerdings ohne die Korpulenz. Aber die war bei Johann auch erst später gekommen.
Die Tochter dagegen schlug ihr nach. Zumindest äußerlich. Klein war auch sie nicht, aber dunkelhaarig wie die Mutter, mit den gleichen kaum zu bändigenden Locken, die sie sehr zu Margrets Leidwesen nur zum Kirchgang unter einer Haube versteckte. Auch vom zusätzlichen »Weiberspeck« unter dem Rock, den jede ehrbare Bürgerin trug, wollte sie nichts wissen. Wie eine Zigeunerin, dachte sie oft, wenn Johanna erhitzt, mit flatternden Röcken und aufgelöstem Haar von ihren Streifzügen zurückkam, völlig unbekümmert darum, wer sie sah auf ihrem Weg durch die Stadt.
Andererseits hatte kaum eine Mutter eine so zuverlässige und arbeitsame Tochter wie ihre Johanna. Eilig murmelte Margret zum Dank an die Gottesmutter ein Ave-Maria.
Beruhigt sinnierte sie weiter. Ganz von allein wanderten die geweihten Perlen von einer Hand zur anderen, hielten ihre Finger sie die angemessene Zeit lang ehrfurchtsvoll fest.
Auf den gebildeten Sohn konnte sie mit Recht stolz sein. Geboren im Jahr der Thronbesteigung Bischof Dietrichs und nach ihm benannt, war Diether einer der Lieblingsschüler der Jesuiten gewesen, aufgeweckt, eifrig und schon damals liebenswert genug, um mit seinen Possen nicht anzuecken. Die vier Jahre ältere Johanna hatte sie selbst alles Nötige gelehrt, bis auf ein paar Jahre, die sie als Haustochter bei ihren Verwandten, den Baers, verbracht hatte, um auch einen vornehmen Haushalt kennenzulernen. Doch außer dass sie in Goste, Jobsts Baers jüngerer Schwester, eine wahrhaft dicke Freundin gewonnen hatte, war nicht viel dabei herausgekommen.
Sie war leicht zufriedenzustellen, ihre Johanna, immer schon war sie das. Margret seufzte ergeben. Auch nach der Heirat hatte sich das nicht geändert. Die Meschedes liebten es schlicht, wie die Bauern, pflegte sie bei sich zu sagen. Ohnehin war die halbe Stadt immer noch ein Bauerndorf, dachte sie verdrießlich, ganz anders als das heilige Köln oder Münster, von denen Pater Bodo erzählt hatte. Außer den Kirchen- und Adelsherren lebten in Paderborn nur die reichsten und wichtigsten Familien wie die Baers, Gogreven oder Berringers herrschaftlich in steinernen Stadthäusern und wurden von außerhalb liegenden Höfen versorgt.
Voll schlechten Gewissens ob des aufschießenden Neids fiel ihr Blick auf die Schlange zu Füßen der Gipsfigur, zertreten von einem schmalen Fuß, dessen rosafarbene Bemalung stellenweise abblätterte. Beinahe hätte der allgegenwärtige Böse sie zu einer Todsünde verführt, doch Maria schützte die Ihren.
Wieder wanderten ihre Gedanken zurück, erfassten die Erinnerungen wie ihre Finger die Perlen. Zu ihrer Kinderzeit war ihr Haus ebenfalls ein Bauernhof gewesen, doch hatte bereits ihr Vater die Ställe an der Vorderseite zu Kontoren ausgebaut. Sie hatte dann den Salzsieder Johann Meschede geheiratet, dessen erste Frau jung gestorben war, weshalb er in Salzkotten nicht bleiben wollte. Gemeinsam hatten sie im weitläufigen, verschachtelten Fachwerkhaus ihrer Eltern den Salzhandel aufgebaut, er mit Hilfe seiner Kenntnisse und des Knechts Henrich, sie mit ihren Verbindungen in der Stadt und darüber hinaus.
Doch noch immer hätte ihr Haus in jedem beliebigen Bauerndorf stehen können. Als sie es mit Johann übernommen hatte, war zwar aus dem drei Stufen höher gelegenen Lagerraum ihre Wohnstube geworden. Herd und Esstisch aber standen zu ihrem Leidwesen nach wie vor in der offenen Diele, wo jeder in ihre Töpfe schauen und der über den gepflasterten Boden verteilte Straßendreck hineinwehen konnte.
»Für uns ist es fein genug«, sagte Johann unbeirrt, wenn sie weitere Umbauten verlangte.
Zum Hof gehörten umfängliche Gärten vor der Stadt zwischen Rimkesbach und Pader, die sie selbst, Barcholts Tochter, mit Geses und Johannas Hilfe zu beackern hatte. »Dafür hat dir dein Vater doch das gute Gartenland vererbt!« Entrüstet hatte er ihrem Vorschlag widersprochen, es zu verpachten. Immerhin willigte er ein, Fleisch, Eier und Milch von den Nachbarhöfen zu beziehen und auf einen eigenen Stall zu verzichten.
Das fehlte noch, dachte sie aufsässig. Wie die Schwerdtfeger’sche die Kühe melken! Es war schon genug, dass die Männer den Pferdegestank in ihre gute Stube trugen.
Wie eine Bauersfrau kochte sie also Eintöpfe quer durch den Gemüsegarten, wo, wie Johann sagte, »der Löffel drin stehen kann«. Das war nicht fein, aber nahrhaft, und die Kinder waren gewachsen wie Gras im Mai. Hochgestellte Verwandte, die zu Besuch kamen, konnte man so jedoch nicht beeindrucken, weshalb sie immer hoffte, dass sie vor der Essenszeit aufbrachen.
Gleichwohl war die einflussreiche Sippe ihr ganzer Stolz. Mit dem halben Magistrat und sogar mit dem Schultheiß war sie verwandt. Die Barcholts hatten allezeit auf der richtigen Seite gestanden. Seit Generationen waren sie als gut katholisch bekannt und hatten in schlechteren Zeiten auch darunter zu leiden gehabt. Das wurde nun belohnt. Ihr Bruder Antonius war, nachdem Dietrich Bischof geworden war, seinen Verdiensten entsprechend aufgestiegen, war als Rentmeister in Neuhaus die rechte Hand seines Herrn.
Ihre Finger waren an einem der silbernen Medaillons angekommen und strichen sanft über das Kreuz mit dem erhabenen Korpus. »Vater unser, der du bist…«, murmelte sie den Anfang des fälligen Gebets und dachte sich den Rest.
Wenn nur Diether ein wenig strebsamer wäre! Sie flehte zur Gottesmutter und hob die gefalteten Hände mit dem abgegriffenen Rosenkranz darin. Er könnte längst in des Bischofs Diensten stehen und am Hofgericht die großen Prozesse gegen den rebellischen Stiftsadel führen. Das hätte nicht einmal der Protektion der weitläufigen Familie bedurft, denn Kaspar von Fürstenberg, des Bischofs älterer Bruder und Ratgeber, hatte sich bereits bei ihrem Bruder, dem Rentmeister, nach den Zukunftsplänen des jungen Mannes erkundigt. Doch Diether, von dem großen Namen nicht im mindesten beeindruckt, hatte es vorgezogen, sich als selbständiger Advokat, wenn auch bisher ohne eigene Kanzlei, in der Stadt niederzulassen.
»Ich will mir selbst aussuchen können, für wen ich spreche«, hatte er gesagt, als sie ihn drängte, sich bei Kaspar vorzustellen.
Sie nahm die Hände herab und schob mechanisch eine Perle nach der anderen weiter. In den Magistrat der Stadt war ihr Sohn immerhin schon eingezogen, und den Bürgermeisterstuhl würde er bestimmt auch bald erobern. Bis dahin musste sie ihm die Studentenkleidung abgewöhnt haben, die nach Pater Bodos Worten verdächtig reformatorisch aussah. Einem Ratsherrn stand immer noch die gute alte Kröse zu, die fein gefältelt in ihrer Truhe auf ihren Einsatz wartete. Aber Diether weigerte sich eisern, den »Mühlsteinkragen«, wie er ihn nannte, zu tragen.
Ebenso schwer auszutreiben waren ihm die Sticheleien über die »Papisten«. Johann hätte auf sie hören und den Sohn statt ins lockere Freiburg zu den Fuldaer Jesuiten schicken sollen. In Gese hatte er nun die perfekte Mitspielerin gefunden. Margret wusste sehr wohl, dass er sich nur an deren Gespött beteiligte, um seine Mutter aufzuziehen. Besonders die Marienverehrung der Jesuitenpatres hatte es ihnen angetan, und oft genug hatte sie selbst lachen müssen, wenn die beiden mit dem jauchzenden Katrinchen als Madonna durch die Diele zogen und psalmodierend »Prozession« spielten.
Abbittend sah sie zur Gottesmutter auf. Sollte sie dem Sohn gegenüber weniger nachsichtig sein? Zur Buße wollte sie noch ein wenig länger beten, obwohl ihre Knie nicht wenig schmerzten und das Zimmer sich fühlbar abkühlte.
Von unten drang immer noch Gemurmel herauf, dessen ruhige und gleichmäßige Tonart darauf schließen ließ, dass ihre Männer noch lange mit der Politik zu tun hatten. Bestimmt hatten sie Henrich um mehr Bier geschickt, weshalb sie nicht vergessen durfte, morgen als Erstes die Vorräte zu überprüfen.
Endlich schlug sie aufatmend ein letztes Kreuz und erhob sich von der unbequemen Kniebank. Den Rosenkranz schlang sie der Gipsfigur um die Füße, um ihn beim Morgengebet griffbereit zu haben.
***
Henrich, Johann Meschedes Gehilfe und Freund aus alten Salzkottener Tagen, hatte Holz nachgelegt und den Schürhaken in die Glut gestellt. Fürsorglich hatte er allen, auch sich selbst, eingeschenkt. Nun zischte das glühende Eisen in den Humpen, und die Männer tranken sich freundschaftlich zu.
Aus den verbeulten Taschen seines Arbeitskittels holte der Knecht eine Handvoll Nüsse und legte sie für alle auf den Tisch. Diether sah den treuen Gefährten seiner jungen Jahre liebevoll an. Wieder fiel ihm auf, wie farblos und grau dessen früher flammend rote Haare jetzt waren. Nur der zottige Bart hatte den Kastanienton bewahrt, ließ aber die runzlige Haut durchscheinen.
In seiner bedächtigen und nüchternen Art ähnelte Henrich dem Vater, war gutmütig wie er, aber aufbrausend, wenn ihm etwas nicht passte. Wo Johann sich seiner gesprächigen Frau angeglichen hatte, war er auf seine Ruhe bedacht und sprach kein Wort zu viel. »Redselig wie ein Upsprunger Bauer«, sagte die Mutter bissig, wenn sie wieder einmal vergeblich versucht hatte, etwas aus ihm herauszubekommen. Dennoch nahm er gern an ihren Gesprächen teil und sperrte die Ohren auf, wenn es um die Skandale der Stadtherrschaften ging.
»Wisst ihr, dass der heilige Nikolaus nicht nur der Patron der Kaufleute ist, sondern auch der Advokaten?« Diether brach das wohlige, nur von knackenden Nussschalen unterbrochene Schweigen. »Der Legende nach erscheint er in vollem Ornat ungerechten Richtern im Traum und bringt sie dazu – wie, ist nicht überliefert–, ihre Urteile zu überdenken. Manchmal wünsche ich mir, der heilige Bischof würde mir und meinen Mandanten auch mal beistehen!«
»Viel Erfolg hast du wirklich noch nicht gehabt!« Wie immer bohrte Schwager Sieghart, zehn Jahre älter und bedeutend geschäftstüchtiger als er, genüsslich den Finger in die Wunde. Bisher hatte Diether sich nur mit aussichtslosen Streitigkeiten abgemüht, die alle Juristen der Stadt längst aufgegeben hatten.
»Wie sieht es denn mit Schwerdtfegers Garten aus?«, erkundigte sich der Vater nach seinem hoffnungsvollstem Fall. Eben noch war er seinetwegen mit dem alten Brabeck zusammen in den Rathauskeller hinabgestiegen. Es ging um ein Grundstück vor dem Spiringstor, das sowohl Degenhard Schwerdtfeger, dessen Schreinerei dem Anwesen der Meschedes schräg gegenüber lag, als auch die Erben des früheren Ratsherrn Gruben beanspruchten.
Nun wusste in Paderborn jedes Kind, dass Florian Gruben zu den früheren Amtsinhabern gehörte, die sich hemmungslos bereichert hatten. Auch er hätte sich vor Gericht verantworten sollen, nachdem vor neun Jahren die Vertreter der Burschaften die Betrügereien aufgedeckt hatten. Doch das bischöfliche Gericht hatte das Verfahren jahrelang verschleppt und schließlich eingestellt, ohne die korrupten Ratsherren zu bestrafen und ohne offene Besitzfragen wie diese hier zu klären.
Froh über den gebildeten Nachbarssohn, übertrug Degenhard die Verteidigung Diether Meschede, der sofort angefangen hatte, die Besitzurkunden im Rathauskeller durchzusehen. Es hatte Tage gedauert, bis er, entsetzt über das Durcheinander, alle Schränke aus- und nach Straßen geordnet wieder eingeräumt hatte. Einen Hinweis auf Gruben’schen Besitz am Spiringstor hatte er nicht gefunden. Da die Erben selbst darauf bestanden, das Grundstück habe früher der Stadt gehört, konnte eine entsprechende Urkunde auch nicht im Archiv des Domkapitels oder in der Neuhäuser schriverigge des Bischofs liegen, wo nur der Kirchenbesitz dokumentiert wurde.
»Den Prozess zu gewinnen wird nicht schwer sein«, sagte Diether dem Schwager zuvorkommend. »Aber du hättest sehen sollen, wie ich in den verwahrlosten Schränken gewühlt habe, dann wüsstest du, wie dreckig die Juristerei sein kann. Du machst dir doch den ganzen Tag die Hände nicht schmutzig!« Er zog Sieghart auf, der schon wegen des täglichen Umgangs mit dem Salz auf Sauberkeit achten musste.
Für seinen Geschmack sorgte der Schwager sich ein wenig übertrieben um sein Äußeres, wenn auch nicht darum, mit der Zeit zu gehen. Zu Diethers Spott, jedoch zur Freude der Mutter, trug er immer noch die spanische Tracht mit bauschigem Wams und geschlitzten Pluderhosen. Zusammen mit dem Altväterbart gab er das Urbild eines ehrbaren Kaufmanns ab. Der Eindruck schwand allerdings, sobald er neben dem stattlichen Vater stand, der ihn wie einen vorzeitig gealterten Lehrling wirken ließ.
Johann ersparte dem Schwiegersohn die Antwort. »Ist das Archiv nicht erst vor zwei oder drei Jahren aufgeräumt worden?«, fragte er, verwundert über die erneute Unordnung. »Damals hat Meister Richel die Wände vertäfelt, und die Feuerherren sollten sich darum kümmern, dass die Urkunden ordentlich in die Schränke zurückkamen. Die acht Taler für das anschließende Gelage hab ich jedenfalls zu Lichtmess in der Stadtrechnung gefunden.«
Als Burschaftsvertreter und gewissenhafter Kaufmann ließ Johann Meschede es sich nicht nehmen, bei der jährlichen Prüfung der städtischen Rechnungsbücher anwesend zu sein. Und als vor zehn Jahren der korrupte Rat sich geweigert hatte, die Bücher vorzulegen, und von den Bürgern zwei Tage lang auf dem Rathaus festgehalten wurde, um die Herausgabe zu erzwingen, war er ebenfalls dabei gewesen.
So kannte Diether seine Paderborner: Sie achteten aufs Geld und besonders darauf, dass nicht andere ihre schwer verdienten Taler leichtfertig verprassten. Solange er zurückdenken konnte, hatte es darum Streit gegeben, der schließlich zur größten Katastrophe der Stadt geführt hatte.
»Jedenfalls eine unnütze Ausgabe, denn die Vertäfelung kommt wieder ab.« Er sprach das eigentliche Thema des Abends an. »Das neue Rathaus wird gebaut, das ist beschlossen. Nach vielem Hin und Her…«
Doch war niemand darauf erpicht zu erfahren, wie die Diskussion verlaufen war.
»Ging das denn ohne den Schultheiß?«, erkundigte sich Henrich.
»Diesmal ja«, bestätigte er seufzend. »Der Vorschlag kam schließlich vom Bischof höchstpersönlich. Um den städtischen Kleinkram kümmert er sich wenig, auch nicht darum, wofür die Ratsherren die städtischen Gelder ausgeben, solange sie nicht Geschütze kaufen und nach Neuhaus ziehen.«
»Es wundert mich schon lange«, überlegte der Vater laut, »dass Dietrich nicht stärker in die Stadtregierung eingreift. Nach dem Paukenschlag mit Wichart meint er wohl, die Paderborner sind gebändigt. Auch diese neuen Geschichten: Wenn sich die Aufregung gelegt hat, wird alles so weitergehen wie bisher. Glaubt mir das.«
Wie immer zog die Politik das Geschäft nach sich. Das Gespräch wandte sich den möglichen Auswirkungen der bischöflichen Anordnungen auf den Salzverkauf zu. Diether hörte kaum hin. Der Handel hatte ihn nie gelockt, sodass er froh gewesen war, als Sieghart die ihm zugedachte Rolle übernahm. Die Arbeit seiner Familie ermöglichte ihm ein sorgloses Leben, solange er ohne Kanzlei war, wofür er durchaus dankbar war. Seine Mitwirkung im Kontor allerdings hatte sich der Schwager energisch verbeten, nachdem Diethers Kalkulationen und Mengenangaben voller Fehler gewesen waren.
»Der ist doch nur zum Säckeschleppen zu gebrauchen«, hatte er damals gesagt, den Vorschlag aber nicht erneuert, als Diether mit seinem Doktorhut aus Freiburg zurückgekommen war.
Dennoch half Diether Henrich oft beim Aufladen und fuhr gern mit ihm über Land, rumpelte mit dem schweren Pferdewagen durch die wasserreichen Gegenden um Büren und Lippstadt und zu den trockenen Dörfern des Hochlands. Nur wenige der Bauern konnten sich das kostbare Salz leisten, doch Henrich kannte seine Kunden und verschwendete keine Zeit mit fruchtlosem Laufen von Tür zu Tür.
Meist säumte den Weg dichter Wald, den die Erzählungen des alten Knechts mit Räubern und Gesetzlosen füllten, sodass Diether froh war, wenn die finsteren Eichen von helleren Birkenwäldchen abgelöst wurden. Immer lagen die Dörfer hinter Bäumen versteckt, wurden erst im letzten Augenblick die winzigen Kirchen sichtbar, um die sich ein paar gedrungene Meierhöfe mit ihren Katen scharten.
Ganz anders seine Stadt: Wenn sie zurückkehrten, war von weit her der mächtige Turm der Paderborner Bischofskirche zu erkennen, dessen fingerartiger Dachreiter gen Himmel wies und den Untertanen des fürstlichen Hausherrn die Richtung vorgab.
Für Diether war es schwer, mit den Dorfbewohnern ins Gespräch zu kommen. Misstrauisch beäugten sie den jungen Städter, der sogar bei der Arbeit Lederschuhe trug. »Von unserem Geld«, stand in ihren abfälligen Mienen geschrieben. Henrich trug Holschen und sprach Platt, der gehörte zu ihnen. Gern malte sich Diether das Gesicht seiner Mutter aus, wenn er demnächst zu ihren Fahrten über die Dörfer ebenfalls Holzschuhe anzog. Oder wenn er gar eins der stämmigen Bauernmädchen mit zurückbrächte, die mit verschämten Blicken und roten Köpfen Interesse an ihm zeigten, neuerdings. Der größte Hof und noch so viel »Land an den Füßen« würde die junge Frau nicht davor bewahren, von Margret Meschede als Bauerntrampel abgetan zu werden.
Diether zwang seine Gedanken an den Familientisch zurück, wo sich das Gespräch weiterhin um Bischof und Geschäft drehte. Die »neuen Geschichten« des Vaters waren heiß diskutiert worden, erinnerte er sich. Es hatte sogar Protestzüge aufgebrachter Bürger zum Sternberger Hof gegeben, wo die Landstände tagten. Die jedoch legten sich schon lange nicht mehr mit den Fürstenbergern an, hatten sie sich doch bei ihren ersten Widerstandsversuchen allesamt blutige Nasen geholt. So blieb es beim Verbot der evangelischen Schulen, und für das nächste Jahr hatten alle Einwohner, die bis Ostern nicht bei Beichte und Kommunion gesehen wurden, die Ausweisung aus der Stadt zu befürchten.
Ob der Vater recht behielt? Diether hatte nicht vor, sich in Religionsfragen zu etwas zwingen zu lassen.
Man sprach davon, dass diesmal die Jesuiten beauftragt waren, die Einhaltung der Vorschriften zu kontrollieren. Kein schlechter Einfall, dachte er. Konnte den Vater Lügen strafen. Wenn jemand über die Glaubensangelegenheiten der Paderborner Bescheid wusste, dann die Patres vom Kamp, denn derlei Informationen sammelten sie seit Jahren. Er konnte sich gut daran erinnern, wie er und seine Mitschüler aufgefordert worden waren, vor der ganzen Klasse für ihre Angehörigen zu beten und besonders für die, denen abweichende Glaubensinhalte unterstellt wurden.
»Und was ist mit eurem Knecht Henrich?«, hatte Pater Bodo gefragt, als er den beim Gebet ausgelassen hatte. »Auch er glaubt nicht an das Fegefeuer, sagst du. Meinst du nicht, dass du für ihn beten musst?«
Das war lange vor 1604 gewesen, und alle hatten gelacht, als er zu Hause davon erzählte.
Henrich und dem Vater waren schon damals Glaubensangelegenheiten ziemlich gleichgültig. Vielleicht waren sie es leid geworden, in ständigen Religionswirren die jeweils richtigen Positionen beziehen zu müssen. Was für sie zählte, waren das Salz und das Geschäft; für »das Geistige« waren die Frauen zuständig.
Dem erwachsenen Sohn war dann die Aufgabe zugefallen, die Familieninteressen im Magistrat zu vertreten. Doch heute schienen dessen Beschlüsse unwichtig zu sein…
Plötzlich, als hätte er seine Gedanken gelesen, forderte der Vater: »Bevor wir zu Bett gehen, soll Diether aber noch erzählen, was im Rathaus los war!«
Jetzt also doch, dachte Diether, dem bereits die Augen zufielen. Gedehnt begann er: »Ja… das Wichtigste wisst ihr ja schon. Was noch? Laut war’s jedenfalls«, fiel ihm dann wieder ein. »Beide Räte, der vom vorigen und der von diesem Jahr, waren versammelt und dazu die Vertreter der Gemeinheit, wie es die Statuten bei so weitreichenden Entscheidungen vorsehen. Am Nachmittag haben wir die Kleiderspende an die armen Familien ausgegeben, und schon dabei ist reichlich gebechert worden. Die Stimmung war gut und der Ratssaal so voll, dass man kaum sein eigenes Wort verstehen konnte.«
»Und was hast du gesagt?«, erkundigte sich der Vater.
»Was ihr mir aufgetragen habt: dass der Überschuss in der Stadtkasse nicht leichtfertig ausgegeben werden sollte. Und dass angesichts der unsicheren Lage draußen im Land die Reparatur der Stadtmauern wichtiger sei als ein neues Rathaus, wozu mehrere genickt haben.«
Letzteres hatte er nur dem Vater zuliebe gesagt. Selbst glaubte er nicht an die überall lauernden Spanier, Holländer und Hessen, die jederzeit raubend und mordend in die Stadt einfallen konnten. Mit dem wehrhaften Hochstift würde sich so schnell kein Kriegsherr anlegen; so viel Gutes hatte Dietrichs Regierung mit sich gebracht.
»Und dann?«, fragte Sieghart ungeduldig. Diether wusste, dass er vor allem hören wollte, was seine Bekannten unter den Ratsherren geäußert hatten, um demnächst mit ihnen darüber diskutieren zu können.
»Dann«, antwortete Diether gespielt bedächtig, »dann hab ich noch das schöne alte Rathaus verteidigt, das in stolzer Zeit von unseren Vorvätern erbaut wurde und bisher durchaus seinen Zweck erfüllt hat. Der Meinung waren auch Steling und der Schneider Hartmann aus dem Ükern. Auch Meister Rokeß und Jobst Baer übrigens, was mich gewundert hat.«
Henrich warf zustimmend ein: »Die verdienen doch am meisten daran!«
Diether nickte und fuhr fort: »Steling, witzig wie immer, meinte, für das wenige, das uns seit 1604 zu entscheiden bleibt, reiche sowieso der letzte Ziegenstall. Hartmann und den übrigen Gemeinheitsvertretern war ohnehin alles zu teuer. Sie wollten das Geld lieber für die Stadtmauer ausgeben, besonders für das Stück um den Ükern herum.«
Den sonst so wortkargen Knecht hatte das warme Bier vorwitzig gemacht. »Jau, da gibt es bald mehr Bruchsteinhäuser als Mauer«, sagte er grinsend.
Diether musste ebenfalls lachen. Für dieses »Jau« war er in seiner Studienzeit oft gehänselt worden, dabei war es das wichtigste Wort seiner Heimat. Er hatte Bauern erlebt, die darüber hinaus nicht viel herausbrachten, ihr »jau« aber im entsprechenden Tonfall jeder Gesprächssituation anzupassen wussten. Obwohl redseliger, hatte sich Diether nur schwer an die in Kanzleien und Kontoren längst verbreitete hochdeutsche Sprache gewöhnen können. Statt kurz und bündig »jau« sagte er dann »genau« und kam sich gespreizt vor, weshalb er willig zur Sprache seiner Nachbarn zurückgekehrt war. Natürlich zum Missfallen seiner Mutter…
Müde nahm er den Faden wieder auf. »Und wenn nicht dafür, dann für die Befestigung der Straßen, damit endlich der Matsch aus der Stadt verschwindet. Nachdem die Wegeherren jahrzehntelang das Wegegeld in die eigene Tasche gesteckt hätten, komme man nicht nach mit dem Ausbau. Das hätte Hartmann allerdings nicht sagen sollen, denn einige der früheren Wegeherren waren da und machten Tumult. Der Bürgermeister musste eingreifen und die Gemüter beruhigen. Man soll nicht immer in der Vergangenheit wühlen, meinte er, und außerdem werde schon seit Jahren jede Abrechnung genau geprüft.«
»Wäre Westphal dagewesen, hätte Gogreve auch noch gesagt, dass wir die neue Ordnung in den Stadtkassen Ihrer fürstbischöflichen Gnaden zu verdanken haben, da möchte ich drauf wetten«, warf Sieghart bissig ein. »Dabei kümmert sich der Bischof um nichts, und die Ratsherren werden nach wie vor in ihren Ämtern reich und fett.«
Diether betrat den Pferdestall über den Landweg, wie sie es als Kinder genannt hatten, durch Spülküche, Vorrats- und Sattelraum, statt über den Hof, der immer noch im Schneetreiben lag, zum Abtritt zu gehen. Hier bei den Pferden war es schön warm, und auch Henrich, der in der Kammer darüber schlief, würde nicht frieren. Seine Kammer hingegen war kalt wie ein Eiskeller, aber er hoffte darauf, dass Gese wie sonst an kühlen Abenden ihm einen heißen Backstein ins Bett gelegt hatte.
Er hatte vergessen, fiel ihm jetzt ein, dem Vater von dem Aufruhr um Balthasar Stricker zu erzählen. Das musste er gleich morgen nachholen. In allen Unterhaltungen auf dem Ratssaal war der Name des Weinzapfs genannt worden, mit Abscheu, weil Balthasar bei Unregelmäßigkeiten erwischt worden war, und mit Schadenfreude, weil es nicht sie selbst getroffen hatte. Solange die jährliche Weinrechnung ausstand, war nichts offiziell, doch sprach man von mehreren Hundert fehlenden Talern.
AM TAG DES HEILIGEN AMBROSIUS
7.Dezember
Ambrosius von Mailand (4.Jahrhundert) wurde ungetauft zum Bischof gewählt, stieg aber dann zum Kirchenlehrer und kaiserlichen Berater auf. Er schützt die Bienen und die Bienenzüchter, die Lebkuchenbäcker, die Wachszieher und die Haustiere.
Am Morgen hatte es aufgehört zu schneien. Diether und Henrich hatten den Hof begehbar gemacht und den Schnee zu einem hohen Berg aufgetürmt. Vor dem Haus fegte Gese dick vermummt die hohen Wechten aus dem Hauseingang, gab angesichts der fast kniehohen Schneedecke aber bald auf und ließ Henrich dafür sorgen, dass Besucher das Haus erreichen konnten.
Diether wärmte seine Hände am Feuer, als sich die Dielentür öffnete und Elmar, Nachbarssohn und Stadtbote, eintrat. Überrascht drehte er sich um, als gleichzeitig Henrich die Seitentür aufriss und rief: »Er hat die Schütter mitgebracht! Sie stehn vor dem Hoftor!«
Auch Sieghart und der Vater, die schon früh im Kontor verschwunden waren, kamen mit fragenden Gesichtern heraus.
»Was ist denn geschehen?«, fragte Johann. »Was verschafft uns die Ehre deines frühen Besuchs?«
»Von wegen Ehre!«, knurrte Elmar. »Ich muss Euren Sohn auffordern, sofort mit mir aufs Rathaus zu kommen. Der Droste will ihn dringend sprechen. Es ist was passiert, und Diether ist dabei gesehen worden. Wenn er nicht mitkommen will, muss ich die Feldhüter reinholen.«
Gese, die Diether und Henrich nach der anstrengenden Schipperei gerade ein zweites Frühstück zubereitete, ließ das Messer fallen und lief die Treppe hinauf zu ihrer Herrin.
»Nun mal langsam«, erwiderte der Vater. »Ich bin sicher, dass mein Sohn sich nichts hat zuschulden kommen lassen. Es wird sich alles aufklären, aber erst einmal will ich wissen, worum es geht.«
»Das soll ich eigentlich nicht sagen«, gab der Bote zögerlich zur Antwort. »Plettenberg meint, der Täter verrät sich, wenn er ihn mit der Nachricht überrascht. Aber wegen der guten Nachbarschaft: Heute Morgen haben wir den alten Brabeck im Rathaus gefunden. Er lag im Keller an der kleinen Treppe. Tot. Muss wohl schon die ganze Nacht da gelegen haben.«
In das betroffene Schweigen hinein fuhr er fort: »Der Droste war der Ansicht, dass jemand, der sich so gut im Rathaus auskennt wie Brabeck, nicht eine Treppe hinunterfällt, die er jeden Tag benutzt. Er wusste allerdings nicht, wie betrunken der Alte war, weil er und Westphal gestern nicht da waren. Ich denke ja, er hat sich selbst zu Tode gestürzt, und das hab ich Plettenberg auch gesagt. Ganz bestimmt hat Euer Diether da nicht nachgeholfen.«
Diethers Gesicht, gerade noch von Arbeit und Feuer erhitzt, hatte alle Farbe verloren. In den letzten Wochen hatte er viel Zeit mit dem alten Stadtdiener verbracht und manch Wissenswertes von ihm erfahren. Er machte sich über Diethers Unkenntnis lustig, erklärte ihm aber geduldig alles, wonach er fragte. Kaum gedankt hatte er Brabeck, fiel ihm ein. Das wollte er am Schluss der Arbeiten tun, und Johanna hatte ihm dazu einen Kuchen versprochen. Zu spät– das Wort nahm ihm die Luft und drückte ihm einen Kloß in den Hals.
»Und warum soll er dann mit aufs Rathaus kommen?«, fragte die Mutter, die inzwischen mit Johanna die Stiege hinabgekommen war und Elmars Bericht gehört hatte. Gese stand mit dem Kind auf dem Arm am Geländer und schaute ängstlich hinunter.
»Er war gestern Abend mit Brabeck im Rathauskeller«, sagte Elmar. »Jemand hat die beiden beobachtet. Der Droste will wissen, was er da gewollt hat. Mehr Wein hätte ihm Brabeck gebracht, und welchen Grund hat sonst ein Ratsherr, während eines Festessens in den schmutzigen Keller zu gehen?«
Diether war überzeugt, die Anschuldigungen aufklären zu können, doch fühlte er sich verantwortlich, weil er dem Alten aufgetragen hatte, nach dem Gelage wenigstens die Triesekammer zu verschließen. Wenn es nun dabei geschehen war? Es wären wohl nicht gerade in dieser Nacht die Schätze der Stadt gestohlen worden…
Aber für Kümmernisse war jetzt keine Zeit. Er musste seine Haut retten. Was steckte wirklich hinter dem Tod des Stadtdieners?
»Brabeck war alt und grau. Stand er nicht schon seit Jahrzehnten im Dienst der Stadt?« Er wandte sich an den Vater. »Aber er war kein bisschen gebrechlich! Ich habe gesehen, wie flink er die steile Stiege hinabkletterte. Er wusste genau, wer ich war und was ich suchte, schon bei meinem ersten Besuch im Archiv. Also war er auch nicht tüddelig. Ich habe ihn nicht die Treppe hinuntergeworfen, das weiß ich genau, aber dass da etwas nicht mit rechten Dingen zuging, kann ich mir gut vorstellen.«
»Elmar wird schon recht haben, Junge«, warf die Mutter ein, die erschrocken seinen Arm umklammert hielt. »Geh zu Plettenberg oder lieber zu Heinrich Westphal und erkläre ihnen, was du im Keller gesucht hast. Alles andere kann dir einerlei sein. Du hast selbst erzählt, dass Brabeck betrunken war. Warum soll er also nicht die Treppe hinuntergefallen sein?«
Unwillig machte er sich los. Der Vater bot an, ihn zu begleiten, doch Diether hatte keine Bedenken, allein mit dem Amtmann des Bischofs fertig zu werden. Johann bestand allerdings darauf, dass der Stadtbote mit den Feldhütern vorgehen und Diether ihnen eine Weile später folgen solle, damit nicht der Anschein einer Verhaftung erweckt werde. Er selbst, Johann Meschede, bürge für seinen Sohn, fügte er hinzu, woraufhin Elmar nickte und das Haus verließ.
Um der bedrückten Stimmung zu entgehen und eine rührselige Abschiedsszene zu vermeiden, winkte Diether grinsend zu Katrinchen hinauf, die freudig ihr »Diether! Diether!« anstimmte. Sie entwand sich Geses Arm, um auf ihn zuzustolpern. Er fing sie auf und setzte sie auf der Treppe ab.
»Ich muss jetzt fort«, erklärte er ihr ernsthaft, »und die bösen Drachen besiegen. Wenn du brav bist, bringe ich dir ein Stück Drachenherz mit.«
Die Mutter gab ihm kopfschüttelnd seinen Umhang. Reumütig legte er den Arm um sie. »Mach dir keine Sorgen, Mutter, ich bin bald zurück. Du sagst doch immer, wer reinen Herzens ist, kann ruhig schlafen gehen, und ich habe bestens geschlafen. Das war natürlich auch Geses Backstein«, fügte er hinzu, schon auf dem Weg zur Dielentür, sodass er nicht mehr sehen konnte, wie sich deren bekümmertes Gesicht aufhellte.
Diether bemühte sich, in den Fußspuren der Stadtdiener zu bleiben, da der Schnee auf den Straßen weitgehend unberührt war. Die Stadt war unbelebt wie um diese Zeit sonst nie. Erst in der Nähe des Rathauses häuften sich die Fährten, kamen von der Pader herauf, aus dem Schildern und vom Kamp.
Um das Rathaus herum schippten ein paar Tagelöhner vom Ükern den Schnee beiseite. Besorgt stieg Diether die vereiste Freitreppe zum Ratssaal hinauf. Wenn Plettenberg sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war ihm das schwer auszutreiben. Als Angehöriger des Landadels beanspruchte er besondere Ehren und führte sich dem Magistrat gegenüber auf wie in den Zeiten, als er noch Herr über Leib und Leben seiner Untertanen war. Er war allen Ratsherren und besonders den Gemeinheitsvertretern gegenüber misstrauisch, weil er bei fast jedem versteckte protestantische Gesinnungen und dann auch bald Umtriebe vermutete.
Mit Heinrich Westphal war leichter umzugehen, dem Schultheiß und zweiten Amtmann des Bischofs, der – wie weitläufig, wusste Diether gar nicht– mit der Mutter verwandt war. Das traf allerdings auf die halbe Stadt zu, und ob es ihm im Ernstfall helfen würde, war nicht so sicher.
Außerdem war Westphal für den Bischof auf Reisen, wohin, wusste niemand. Angesichts des Wetters war mit einer baldigen Rückkehr nicht zu rechnen. Was war, wenn Plettenberg ihn so lange in einer der kalten Zellen des Ratskellers einsperrte, wohin ihm die Mutter täglich das Essen schicken musste? Erst kürzlich war unter dieser Treppe das Fenster zugemauert worden, weil die Gefangenen das Gerichtsgeschehen störten, sodass nicht einmal Licht hineinfallen konnte.
Er öffnete die Tür und betrat die Amtsstube, wo der Stadtsekretär über seinen Rechnungen saß. Dorbecher sah auf, beugte sich aber gleich wieder eifrig über den Tisch. Kein Gruß zurück. Die Tür zum Ratssaal stand offen. Plettenberg saß auf dem erhöhten Stuhl des Bürgermeisters, vor sich Elmar und die Feldhüter, die ihm Bericht erstatteten.
»Da seid Ihr ja endlich!«, rief er ungeduldig, als Diether entlang der Seitenbänke auf ihn zuging. Er grüßte kurz und verneigte sich nicht allzu tief, was der Amtmann stirnrunzelnd vermerkte.
»Das nächste Mal bitte ich mir aus, meinen Anordnungen sofort Folge zu leisten!« Plettenbergs Ton war frostig. »Meint Ihr, als Ratsherr wäret Ihr davor gefeit, von den Feldhütern verhaftet zu werden?«
»Es wäre mir angenehm, wenn Ihr mir mitteiltet, was mir vorgeworfen wird«, erwiderte Diether ebenso kühl. »Wenn Ihr mich bei dem Wetter und zu so früher Stunde aufs Rathaus holt, werdet Ihr einen guten Grund haben, vermute ich.«
Der Droste schaute ihn lange schweigend an, dann den Stadtboten und die Feldhüter.
»Erzählt mir nicht, Ihr wisst nicht, worum es geht. Der Bote wird Euch doch bestimmt verraten haben, was passiert ist?«
»Der Bote war ziemlich kurz angebunden, was ich von Elmar gar nicht kenne. Wir sind seit Langem gute Nachbarn und haben sonst keine Geheimnisse voreinander. Aber nun sagt mir endlich, worum es geht.«
Ob Plettenberg ihm glaubte, war nicht zu erkennen. Er hatte wohl beschlossen, es noch ein wenig spannend zu machen. »Der Bischof wird nicht erfreut sein, wenn er von der neuerlichen Gewalttat in seiner Stadt hört. Ihr Paderborner könnt wohl nicht ruhig vor euch hin leben und keinen Ärger machen, wie? Alle paar Monate geschieht etwas Böses, und man fragt sich, ob nicht die ganze Stadt der Hexerei verfallen ist.«
Sollte der Droste mit Gese eines Sinnes sein?
Nach einer weiteren Pause und einer langen Musterung der Umstehenden kam er endlich damit heraus, warum er Diether so dringend zu sehen wünschte. »Könnt Ihr mir sagen, was Ihr gestern auf die Nacht im Keller des Rathauses gesucht habt?«, fragte er mit lächerlich anklagendem Zeigefinger. Die altmodische weiße Kröse, die selbst der Bischof nicht mehr trug, bebte über dem schwarzen Gewand.
Ohne den Finger zu senken, fuhr der Amtmann fort: »Wie mir der Stadtsekretär erzählte, seid Ihr heimlich hinter Brabeck hergeschlichen. Was habt Ihr da unten gesucht, wo doch alle Magistratsherren noch auf dem Saal saßen und das neue Rathaus begossen? Die Schätze aus der Triesekammer können es nicht gewesen sein, denn deren Tür war fest verschlossen, als die Stadtdiener heute Morgen kamen. Sie suchten nach Brabeck, und was meint Ihr, wo sie ihn gefunden haben?«