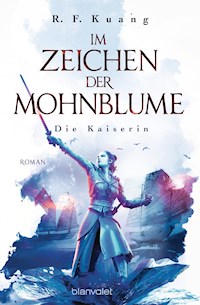9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Legende der Schamanin
- Sprache: Deutsch
Die TikTok-Sensation aus den USA! Rebecca F. Kuang erschafft eine Welt voller Kampfkunst, Götter und uralter Magie.
Rin ist ein einfaches Waisenmädchen, das im Süden des Kaiserreichs Nikan lebt. Ihre Adoptiveltern benutzen sie als billige Arbeitskraft, und um sie herum gibt es nur Armut, Drogensucht und Ödnis. Um diesem Leben zu entfliehen, setzt sie alles daran, um an der Eliteakademie von Sinegard aufgenommen zu werden. Doch auch dort wird Rin wegen ihrer Herkunft verspottet und ausgegrenzt. Da bricht ein Krieg gegen das Nachbarreich aus. Rin muss nun kämpfen und entdeckt dabei, dass ihre Welt nie so einfach war, wie sie geglaubt hatte – und dass sie zu viel mehr in der Lage ist, als sie selbst je für möglich gehalten hätte.
RF Kuang wurde 2020 der Astounding Award for Best New Writer verliehen, der renommiertesten Auszeichnung, die ein Fantasy-Debütautor erlangen kann. Sie wird auf dem WorldCon als Teil der Hugo-Awards-Zeremonie verliehen.
Im Zeichen der Mohnblume bei Blanvalet:
1. Die Schamanin
2. Die Kaiserin
3. Die Erlöserin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 859
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Rin ist ein einfaches Waisenmädchen, das im Süden des Kaiserreiches Nikara lebt. Ihre Adoptiveltern benutzen sie als billige Arbeitskraft, und um sie herum gibt es nur Armut, Drogensucht und Ödnis. Um diesem Leben zu entfliehen, setzt sie alles daran, um an der Eliteakademie von Sinegard aufgenommen zu werden. Doch auch dort wird Rin wegen ihrer Herkunft verspottet und ausgegrenzt. Da bricht ein Krieg gegen das Nachbarreich aus. Rin muss nun kämpfen und entdeckt dabei, dass ihre Welt nie so einfach war, wie sie geglaubt hatte – und dass sie zu viel mehr in der Lage ist, als sie selbst je für möglich gehalten hätte.
Autorin
Rebecca F. Kuang wanderte im Jahr 2000 aus Guangzhou, China, in die USA aus. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in International History von Georgetown, wo sie sich auf chinesische Militärstrategien, kollektive Traumata und Kriegsdenkmäler konzentrierte. Im Jahr 2018 erhielt sie ein Stipendium und studiert seitdem an der University of Cambridge Sinologie. Rebecca F. Kuang liebt Corgis, trinkt gerne guten Wein und guckt immer wieder die Fernsehserie »Das Büro«.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet undwww.twitter.com/BlanvaletVerlag
R. F. Kuang
IMZEICHENDERMOHNBLUME
Die Schamanin
ROMAN
Deutsch von Michaela Link
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »The Poppy War (1)« bei Harper Voyager, New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2018 by Rebecca F. Kuang Published by Arrangement with Rebecca F. Kuang This work was negotiated through Literary Agency Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover. Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Sigrun Zühlke Covergestaltung und – illustration: Isabelle Hirtz, Inkcraft, unter Verwendung eines 3-D-Modells von © TurboSquid (paultosca) HK · Herstellung: sam Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
TEIL 1
Kapitel 1
»Zieh deine Sachen aus.«
Rin zog überrascht die Brauen hoch. »Was?«
Der Aufseher schaute von seinem Heft auf. »Vorschrift zur Verhinderung von Betrug.« Er zeigte auf eine Aufseherin. »Geh mit ihr, wenn es sein muss.«
Rin verschränkte die Arme fest vor der Brust und ging zu der Frau. Sie wurde hinter einen Wandschirm geführt und bekam einen formlosen blauen Sack ausgehändigt.
»Zieh das gleich an!«, befahl die Aufseherin.
»Ist das wirklich nötig?« Rin klapperten die Zähne, während sie sich entkleidete. Dann untersuchte die Aufseherin gründlich, ob Rin sich auch keine unerlaubten Hilfsmittel in eine Körperöffnung geschoben hatte. Der Prüfungskittel war zu groß. Rins Hände verschwanden in den Ärmeln, sodass sie sie mehrmals umkrempeln musste.
Die Aufseherin bedeutete ihr, sich auf eine Bank zu setzen. »Letztes Jahr sind zwölf Schüler erwischt worden, die sich Spickzettel ins Hemd genäht hatten. Wir ergreifen Vorsichtsmaßnahmen. Mach den Mund auf.«
Rin gehorchte.
Die Aufseherin drückte ihr mit einem schmalen Stab die Zunge herunter. »Keine Verfärbung, das ist gut. Augen weit aufmachen.«
»Warum sollte jemand vor einer Prüfung Drogen nehmen?«, fragte Rin, während die Frau ihr die Lider auseinanderzog. Sie antwortete nicht.
Nach der Untersuchung schickte sie Rin zu den anderen Bewerbern, die in einer unordentlichen Reihe im Flur warteten. Ihre Gesichter waren ängstlich und angespannt, ihre Hände leer. Sie hatten kein Schreibmaterial zur Prüfung mitgebracht: hohle Stifte könnten zusammengerollte Notizzettel enthalten.
»Hände so, dass wir sie sehen können«, befahl der Aufseher und trat an die Spitze der Schlange. »Die Ärmel müssen bis über den Ellbogen aufgekrempelt bleiben. Ab jetzt dürft ihr nicht mehr miteinander sprechen. Wenn ihr urinieren müsst, hebt die Hand. Hinten im Raum steht ein Eimer.«
»Was ist, wenn ich scheißen muss?«, fragte ein Junge.
Der Aufseher bedachte ihn mit einem langen Blick.
»Die Prüfung dauert zwölf Stunden«, verteidigte der Junge sich.
Der Aufseher zuckte die Achseln. »Versuch, leise zu sein.«
Rin war am Morgen zu nervös gewesen, um etwas zu essen. Allein der Gedanke daran verursachte ihr Übelkeit. Ihre Blase und ihr Darm waren leer. Nur ihr Kopf war voll, prall gefüllt mit Unmengen von mathematischen Formeln, Gedichten, Verträgen und historischen Daten, die darauf warteten, in das Prüfungsheft zu fließen. Sie war bereit.
Rin betrat den Raum mit den anderen Schülern und nahm den ihr zugewiesenen Platz ein. Sie fragte sich, wie die Prüflinge wohl von oben aussahen: ordentliche Quadrate schwarzen Haares, einheitliche blaue Kittel und braune Holztische. Sie stellte sich vor, wie in diesem Moment Schüler im ganzen Land in ähnlichen Klassenzimmern mit nervöser Erwartung die Wasseruhr beobachteten.
Der Prüfungsraum bot Platz für hundert Schüler. Die Tische waren in ordentlichen Zehnerreihen angeordnet. Auf jedem Tisch befanden sich ein dickes Prüfungsheft, ein Tuschfässchen und ein Schreibpinsel.
Die meisten anderen Provinzen in Nikan mussten ganze Rathäuser absperren, um die vielen tausend Schüler unterzubringen, die sich jedes Jahr der Prüfung stellten. Aber Tikany in der Provinz Hahn war ein Bauerndorf. Die Familien brauchten Feldarbeiter dringender als Sprösslinge mit Universitätsabschluss. Deshalb gab es in Tikany nur einen Klassenraum für alle.
Rins Zähne klapperten so heftig, dass es bestimmt alle hören konnten, und das lag nicht nur an der Kälte. Sie presste die Kiefer zusammen, aber nun wanderte das Beben ihre Arme und Beine entlang bis in die Finger und Knie. Der Schreibpinsel in ihrer Hand zitterte und verspritzte schwarze Tröpfchen über den Tisch.
Sie hielt ihn fester und schrieb ihren vollen Namen auf den Umschlag des Heftes. Fang Runin.
Sie war nicht die Einzige, die nervös war. Schon jetzt hörte man Schüler über dem Eimer hinten im Raum würgen.
Sie schloss die Finger fest über die blassen Brandnarben am Handgelenk und atmete tief ein. Konzentrier dich.
Die Wasseruhr in der Ecke klingelte leise.
»Fangt an«, sagte der Prüfer.
Hundert Hefte wurden geräuschvoll aufgeschlagen. Es klang, als erhebe sich ein großer Spatzenschwarm in die Luft.
Vor zwei Jahren, an dem Tag, der nach der willkürlichen Festlegung der Obrigkeit von Tikany Rins vierzehnter Geburtstag war, hatten ihre Zieheltern sie in ihre Räume gerufen.
Das kam selten vor. Die Fangs schenkten Rin nur Beachtung, wenn sie eine Aufgabe für sie hatten, und sprachen dann mit ihr wie mit einem Hund, dem sie Befehle erteilten. Schließ den Laden ab. Häng die Wäsche auf. Bring dieses Päckchen Opium hier zu den Nachbarn und geh erst weg, wenn du ihnen das Doppelte von dem abgeknöpft hast, was wir dafür bezahlt haben.
Eine Frau, die Rin noch nie zuvor gesehen hatte, saß auf dem Gästestuhl. Ihr Gesicht war weiß eingestäubt, es sah aus wie eine Schicht Reismehl, aus der verkrustete Farbkleckse auf Lippen und Augenlidern hervorstachen. Sie trug ein helles fliederfarbenes Kleid mit Pflaumenblütenmuster, das sich vom Schnitt her eher für ein sehr viel jüngeres Mädchen geeignet hätte. Ihre gedrungene Figur quoll über den Stuhl wie ein Getreidesack.
»Ist das das Mädchen?«, fragte die Frau. »Hm. Es ist ein bisschen dunkel – dem Inspektor macht das nichts aus, aber es drückt den Preis.«
Rin erschrak, sie ahnte, was hier geschah. »Wer seid Ihr?«, fragte sie.
»Setz dich, Rin«, befahl Onkel Fang.
Er streckte eine ledrige Hand aus, um sie auf einen Stuhl zu drücken. Rin drehte sich um, wollte fliehen. Tante Fang packte sie am Arm und zog sie zurück. Es folgte eine kurze Rangelei, bis Tante Fang Rin überwältigt und zu dem Stuhl zurückgerissen hatte.
»Ich gehe nicht ins Bordell!«, rief Rin.
»Sie ist nicht vom Bordell, du Idiot«, blaffte Tante Fang. »Setz dich. Erweise Kupplerin Liew Achtung.«
Kupplerin Liew wirkte vollkommen ungerührt, als würde sie in ihrem Beruf oft des Sexhandels beschuldigt.
»Du stehst im Begriff, ein sehr glückliches Mädchen zu werden, Liebes«, sagte sie. Ihre Stimme klang heiter und zuckersüß. »Möchtest du hören, warum?«
Rin umklammerte die Stuhlkante und blickte auf Kupplerin Liews rote Lippen. »Nein.«
Kupplerin Liews Lächeln wurde schmal. »Wirklich ganz reizend.«
Es stellte sich heraus, dass Kupplerin Liew nach einer langen und anstrengenden Suche in Tikany einen Mann gefunden hatte, der bereit war, Rin zu heiraten. Er war ein wohlhabender Händler, der seinen Lebensunterhalt mit dem Import von Schweineohren und Haifischflossen bestritt. Er war zweimal geschieden und dreimal so alt wie sie.
»Ist das nicht wunderbar?« Kupplerin Liew strahlte.
Rin stürzte zur Tür. Sie war noch keine zwei Schritte weit gekommen, als Tante Fangs Hand hervorschnellte und sie am Unterarm festhielt.
Rin wusste, was als Nächstes kam. Sie wappnete sich gegen den Schlag, gegen die Tritte in die Rippen, wo man die Prellungen nicht sah, aber Tante Fang zerrte sie nur zurück zu ihrem Stuhl.
»Benimm dich gefälligst«, zischte sie flüsternd. Ihre zusammengebissenen Zähne versprachen Strafe, aber nicht jetzt, nicht vor Kupplerin Liew.
Tante Fang behielt ihre Grausamkeit gern privat.
Kupplerin Liew, die davon nichts ahnte, wirkte überrascht. »Hab keine Angst, Süße. Das sind aufregende Neuigkeiten!«
Rin war schwindlig. Sie drehte sich zu ihren Zieheltern um und bemühte sich, mit ruhiger Stimme zu sprechen. »Ich dachte, ihr braucht mich im Laden.« Es war das Einzige, was ihr einfiel.
»Kesegi kann sich um den Laden kümmern«, antwortete Tante Fang.
»Kesegi ist acht.«
»Er ist bald erwachsen.« Tante Fangs Augen glitzerten. »Und dein künftiger Ehemann ist der Importinspektor des Dorfes.«
Da verstand Rin. Für die Fangs war es ein einfacher Handel: ein verwaistes Pflegekind für die fast alleinige Herrschaft über Tikanys Opium-Schwarzmarkt.
Onkel Fang nahm einen langen Zug aus seiner Pfeife, atmete aus und erfüllte den Raum mit schwerem, süßlichem Rauch. »Er ist ein reicher Mann. Du wirst glücklich sein.«
Nein, die Fangs würden glücklich sein. Sie würden Opium in großen Mengen einführen können, ohne für Bestechungsgelder bluten zu müssen. Aber Rin hielt den Mund fest geschlossen – weitere Einwände würden nur Schmerz bringen. Es war klar, dass die Fangs sie verheiraten würden, und wenn sie sie persönlich ins Brautbett zerren mussten.
Sie hatten Rin von Anfang an nicht gewollt. Sie hatten sie damals nur aufgenommen, weil nach dem Zweiten Mohnkrieg ein Befehl der Kaiserin Haushalte mit weniger als drei Kindern dazu zwang, Kriegswaisen zu adoptieren, die sonst zu Dieben und Bettlern geworden wären.
Da Kindstötungen in Tikany nicht gern gesehen wurden, hatten die Fangs Rin als Ladenmädchen und Opium-Kurier eingesetzt, sobald sie zählen konnte. Doch obwohl sie ohne Lohn arbeitete, waren die Kosten für ihren Unterhalt und ihre Ernährung höher, als die Fangs zu tragen bereit waren. Jetzt war die Gelegenheit gekommen, sich der finanziellen Last zu entledigen.
Der Händler konnte es sich leisten, Rin für den Rest ihres Lebens zu ernähren und zu kleiden, erklärte Kupplerin Liew. Sie brauchte ihm nur wie eine gute Ehefrau zärtlich zu dienen, ihm Kinder zu schenken und sich um seinen Haushalt zu kümmern (zu dem, wie Kupplerin Liew betonte, nicht nur ein, sondern gleich zwei Waschräume im Haus gehörten). Es war ein wesentlich besseres Geschäft, als eine Kriegswaise wie Rin ohne Familie oder Verbindungen es sich erhoffen konnte.
Ein Ehemann für Rin, Geld für die Kupplerin und Drogen für die Fangs.
»Meine Güte«, sagte Rin schwach. Der Boden unter ihren Füßen schien zu schwanken. »Das ist großartig. Wirklich großartig. Fantastisch.«
Kupplerin Liew strahlte wieder.
Rin verbarg ihre Panik und zwang sich, gleichmäßig zu atmen, bis die Kupplerin hinausgeleitet worden war. Sie verbeugte sich tief vor den Fangs und brachte wie eine ehrfürchtige Ziehtochter ihren Dank für die Mühen zum Ausdruck, die sie auf sich genommen hatten, um ihr eine so sichere Zukunft zu ermöglichen.
Sie kehrte in den Laden zurück, arbeitete schweigend bis zum Einbruch der Dunkelheit, nahm Bestellungen entgegen, machte Bestandsaufnahme der Waren und notierte neue Bestellungen im Rechnungsbuch.
Bei der Bestandsaufnahme musste man gut aufpassen, wie man die Zahlen schrieb. Wie leicht sah eine Neun wie eine Acht aus. Noch leichter war es, eine Eins wie eine Sieben aussehen zu lassen …
Lange nachdem die Sonne untergegangen war, schloss Rin den Laden und sperrte die Tür hinter sich ab.
Dann schob sie sich ein gestohlenes Päckchen Opium unter die Bluse und rannte los.
»Rin?« Ein kleiner verhutzelter Mann öffnete die Tür der Bibliothek und spähte zu ihr hinaus. »Große Schildkröte! Was machst du denn hier? Es schüttet.«
»Ich möchte ein Buch zurückgeben«, antwortete sie und hielt ihm einen wasserfesten Beutel hin. »Außerdem werde ich heiraten.«
»Oh. Oh! Was? Komm herein.«
Lehrer Feyrik gab einen kostenlosen Abendkurs für die Bauernkinder von Tikany, die sonst nicht Lesen und Schreiben gelernt hätten. Rin vertraute ihm mehr als jedem anderen, und sie verstand seine Schwächen besser als irgendjemand sonst.
Mit ihm stand und fiel ihr Fluchtplan.
»Die Vase ist weg«, bemerkte sie, als sie sich in der vollgestopften Bibliothek umschaute.
Lehrer Feyrik entzündete eine kleine Flamme im Kamin und zog zwei Kissen davor. Dann bedeutete er ihr, Platz zu nehmen. »Schlechte Entscheidung. Überhaupt eine ganz schlechte Nacht, wirklich schlecht.«
Lehrer Feyrik hatte eine unglückliche Vorliebe für Fan Tan, ein in Tikanys Spielhöllen ungeheuer beliebtes Spiel. Es wäre nicht so gefährlich, wäre er ein besserer Spieler.
»Das ergibt keinen Sinn«, murmelte Lehrer Feyrik, nachdem Rin ihm von der Kupplerin erzählt hatte. »Warum sollten die Fangs dich verheiraten? Schließlich leistest du für sie unbezahlte Arbeit.«
»Ja, aber sie denken, dass ich ihnen im Bett des Importinspektors von noch größerem Nutzen bin.«
Lehrer Feyrik wirkte angewidert. »Deine Leute sind Arschlöcher.«
»Dann werdet Ihr es tun«, sagte sie hoffnungsvoll. »Ihr werdet mir helfen.«
Er seufzte. »Mein liebes Mädchen, wenn deine Familie dir erlaubt hätte, bei mir zu lernen, als du noch jünger warst, hätten wir darüber nachdenken können … Ich habe es den Fangs damals gesagt, ich habe ihnen gesagt, dass du begabt bist. Doch jetzt ist unmöglich, wovon du sprichst.«
»Aber …«
Er hob die Hand. »Jedes Jahr legen mehr als zwanzigtausend Schüler das Keju ab, und kaum dreitausend treten den Akademien bei. Von diesen macht gerade mal eine Handvoll die Prüfung in Tikany. Du würdest gegen reiche Kinder antreten – Kinder von Kaufleuten, Kinder von Adligen –, die ihr ganzes Leben lang dafür gelernt haben.«
»Aber ich habe auch Kurse bei Euch belegt. Wie schwer kann es schon sein?«
Er lachte leise. »Du kannst lesen. Du kannst mit einen Abakus umgehen. Das ist nicht die richtige Vorbereitung, um das Keju zu bestehen. Das Keju prüft gründliche Kenntnisse der Geschichte, der höheren Mathematik, der Logik und der Klassiker …«
»Die vier edlen Fächer, ich weiß«, unterbrach sie ihn ungeduldig. »Aber ich lese schnell. Ich kenne mehr Schriftzeichen als die meisten Erwachsenen im Dorf. Auf jeden Fall mehr als die Fangs. Ich kann mit Euren Schülern mithalten, wenn Ihr mir nur erlaubt, es zu versuchen. Ich brauche nicht einmal an der Übung teilzunehmen. Ich brauche nur Bücher.«
»Bücher lesen ist eine Sache«, entgegnete Lehrer Feyrik. »Die Vorbereitung auf das Keju ist etwas völlig anderes. Meine Keju-Schüler verbringen ihr ganzes Leben damit, dafür zu lernen, neun Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Du arbeitest die meiste Zeit im Laden.«
»Ich kann im Laden lernen«, wandte sie ein.
»Hast du keine echten Pflichten?«
»Ich, ähm, kann gut mehrere Dinge gleichzeitig tun.«
Für einen Moment beäugte er sie zweifelnd, dann schüttelte er den Kopf. »Du hättest nur zwei Jahre. Das ist nicht zu schaffen.«
»Aber mir bleibt nichts anderes übrig«, sagte sie schrill.
In Tikany war ein unverheiratetes Mädchen wie Rin weniger wert als ein schwuler Hahn. Sie konnte ihr Leben als Magd in einem reichen Haushalt verbringen – wenn sie die richtigen Leute fand, die sie bestechen konnte. Anderenfalls blieb ihr nur ein Dasein als Prostituierte und Bettlerin.
Sie übertrieb, aber nicht sehr. Wenn sie genug Opium stahl, könnte sie sich wahrscheinlich einen Platz in einer Karawane in eine andere Provinz kaufen … aber wohin sollte sie gehen? Sie hatte keine Freunde und keine Verwandten. Niemand würde ihr zu Hilfe kommen, wenn sie ausgeraubt oder entführt wurde. Sie konnte nichts, wofür irgendjemand etwas bezahlen würde. Sie hatte Tikany nie verlassen und wusste nicht das Geringste über das Überleben in der Stadt.
Und wenn man sie mit so viel Opium erwischte … Opiumbesitz galt im Reich als Kapitalverbrechen. Man würde sie auf den Marktplatz schleppen und als jüngstes Opfer in dem vergeblichen Krieg der Kaiserin gegen die Drogen öffentlich enthaupten.
Sie hatte nur diese eine Möglichkeit. Sie musste Lehrer Feyrik umstimmen.
Sie hielt das Buch hoch, das sie ihm zurückbringen wollte. »Das ist Mengzi. Betrachtungen über die Staatskunst. Ich hatte es nur drei Tage, richtig?«
»Ja«, erwiderte er, ohne im Verzeichnis nachzusehen.
Sie reichte es ihm. »Lest mir einen Absatz vor. Irgendeinen.«
Lehrer Feyrik machte ein zweifelndes Gesicht, schlug das Buch aber ihr zuliebe in der Mitte auf. »Das Gefühl des Mitleids ist die Grundlage …«
»… der Mitmenschlichkeit«, beendete sie den Satz. »Das Gefühl der Scham und Abneigung ist die Grundlage für Rechtschaffenheit. Das Gefühl der Achtung und Ehrerbietung ist die Grundlage für, äh … für Anstand. Und das Gefühl der Billigung und Missbilligung die Grundlage für Weisheit.«
Er zog eine Braue hoch. »Und was bedeutet das?«
»Keine Ahnung«, gab sie zu. »Ehrlich, ich verstehe Mengzi überhaupt nicht. Ich habe ihn einfach auswendig gelernt.«
Er blätterte zum Ende des Buches weiter, wählte einen anderen Absatz und las vor: »Im irdischen Königreich herrscht Ordnung, wenn jedes Wesen weiß, wohin es gehört. Jedes Wesen weiß, wohin es gehört, wenn es die ihm bestimmte Rolle erfüllt. Der Fisch versucht nicht zu fliegen. Der Iltis versucht nicht zuschwimmen. Nur wenn jedes Wesen die himmlische Ordnung achtet, kann es Frieden geben.« Er klappte das Buch zu und sah auf. »Was ist mit diesem Absatz? Verstehst du, was er bedeutet?«
Sie wusste, was Lehrer Feyrik ihr sagen wollte.
Die Nikara glaubten an klar umrissene gesellschaftliche Rollen, an eine starre Rangordnung, in die man unentrinnbar hineingeboren wurde. Alles unter dem Himmel hatte seinen Platz. Prinzlinge wurden Kriegsherren, Kadetten wurden Soldaten, und verwaiste Ladenmädchen aus Tikany sollten es zufrieden sein, verwaiste Ladenmädchen aus Tikany zu bleiben. Das Keju war eine vermeintlich leistungsorientierte Einrichtung, aber nur die wohlhabende Klasse besaß das Geld und konnte sich die Lehrer leisten, ohne die ihre Kinder die Prüfung nicht bestehen würden.
Scheiß auf die himmlische Ordnung der Dinge. Wenn die Ehe mit einem widerlichen alten Mann ihre vorbestimmte Rolle auf dieser Erde war, dann war Rin entschlossen, sie umzuschreiben.
»Es bedeutet, dass ich sehr gut darin bin, ellenlanges Kauderwelsch auswendig zu lernen«, sagte sie.
Lehrer Feyrik schwieg für einen Moment. »Du hast kein bildhaftes Gedächtnis«, erklärte er schließlich. »Ich habe dir das Lesen beigebracht. Es wäre mir aufgefallen.«
»Nein«, räumte sie ein. »Aber ich bin stur, ich lerne fleißig, und ich will nicht verheiratet werden. Ich habe drei Tage gebraucht, um Mengzi auswendig zu lernen. Es war ein kurzes Buch, daher werde ich für längere Texte wahrscheinlich eine ganze Woche brauchen. Aber wie viele Texte stehen auf der Keju-Liste? Zwanzig? Dreißig?«
»Siebenundzwanzig.«
»Dann lerne ich sie alle auswendig. Jedes einzelne Buch. Mehr braucht man nicht, um das Keju zu bestehen. Die anderen Fächer sind nicht so schwer. Es sind die Klassiker, die die Leute ins Straucheln bringen. Das habt Ihr selbst gesagt.«
Lehrer Feyriks Augen wurden jetzt schmal, und sein Gesichtsausdruck war nicht mehr zweifelnd, sondern berechnend. Sie kannte diesen Blick. Es war der Blick, den er immer zeigte, wenn er seinen Gewinn bei Fan Tan vorherzusagen versuchte.
In Nikan wurde der Erfolg eines Lehrers daran gemessen, wie gut seine Schüler beim Keju abschnitten. Man zog Kunden an, wenn die Schüler es auf die Akademie schafften. Mehr Schüler bedeuteten mehr Geld, und für einen verschuldeten Spieler wie Lehrer Feyrik zählte jeder neue Schüler. Wenn Rin an einer Akademie angenommen wurde, konnte der daraus folgende Zustrom von Schülern Lehrer Feyrik von unangenehmen Schulden befreien.
»Dieses Jahr haben sich erst wenige Schüler angemeldet, nicht wahr?«, drängte sie.
Er verzog das Gesicht. »Es ist ein Dürrejahr. Natürlich melden sich weniger an. Die Familien wollen kein Schulgeld zahlen, wenn ihre Kinder ohnehin kaum eine Aussicht haben zu bestehen.«
»Aber ich kann bestehen«, sagte sie. »Und dann habt Ihr eine Schülerin, die von einer Akademie angenommen wurde. Was meint Ihr, wie sich das auf die Anmeldungen auswirken wird?«
Er schüttelte den Kopf. »Rin, ich könnte nicht guten Gewissens dein Schulgeld annehmen.«
Das war das zweite Problem. Sie nahm ihren Mut zusammen und sah ihm in die Augen. »Das macht nichts. Ich kann sowieso kein Schuldgeld bezahlen.«
Er sträubte sich sichtlich.
»Im Laden verdiene ich nichts«, sprach Rin weiter, bevor er etwas erwidern konnte. »Die Waren gehören mir nicht. Ich bekomme keinen Lohn. Ihr müsst mir kostenlos helfen, für das Keju zu lernen, und doppelt so schnell wie Eure anderen Schüler.«
Lehrer Feyrik schüttelte wieder den Kopf. »Mein liebes Mädchen, ich kann nicht … das ist …«
Zeit, ihre letzte Karte auszuspielen. Rin zog ihre Ledertasche unter dem Stuhl hervor und ließ sie lautstark auf den Tisch fallen.
Lehrer Feyriks Blicke folgten Rin begierig, als sie eine Hand in die Tasche schob und ein schweres, süß duftendes Päckchen herauszog. Dann noch eins. Und noch eins.
»Das ist erstklassiges Opium im Wert von sechs Tael«, erklärte sie gelassen. Sechs Tael entsprachen etwa dem halben Jahresverdienst von Lehrer Feyrik.
»Das hast du den Fangs gestohlen«, murmelte er unbehaglich.
Sie zuckte die Achseln. »Schmuggel ist ein schwieriges Geschäft. Die Fangs kennen das Risiko. Es verschwinden ständig Päckchen. Sie können es wohl kaum dem Dorfvorsteher melden.«
Er zwirbelte seinen langen Schnurrbart. »Ich will es mir mit den Fangs nicht verderben.«
Er hatte guten Grund, die Familie zu fürchten. Die Menschen in Tikany kamen Tante Fang nicht in die Quere – nicht, wenn ihnen etwas an ihrer persönlichen Sicherheit lag. Sie war geduldig und unberechenbar wie eine Schlange. Sie ließ Fehler jahrelang durchgehen, nur um dann mit einer wohlplatzierten Giftkugel zuzuschlagen.
Aber Rin hatte ihre Spuren verwischt.
»Eine ihrer Ladungen ist letzte Woche von der Hafenbehörde beschlagnahmt worden«, berichtete Rin. »Und sie hatte noch keine Zeit, Bestandsaufnahme zu machen. Ich habe die Päckchen gerade als verloren eingetragen. Sie kann sie nicht zurückverfolgen.«
»Sie könnten dich immer noch verprügeln.«
»Nicht wirklich schlimm.« Rin zwang sich zu einem Achselzucken. »Beschädigte Ware können sie nicht verheiraten.«
Lehrer Feyrik starrte mit unverhohlener Gier auf die Tasche.
»Abgemacht«, sagte er schließlich und griff nach dem Opium.
Sie riss es aus seiner Reichweite. »Vier Bedingungen. Erstens, Ihr unterrichtet mich. Zweitens, Ihr unterrichtet mich kostenlos. Drittens, Ihr raucht nicht, wenn Ihr mich unterrichtet. Und viertens, wenn Ihr irgendjemandem verratet, woher Ihr es habt, werde ich Eure Gläubiger wissen lassen, wo Ihr zu finden seid.«
Lehrer Feyrik funkelte sie eine ganze Weile lang an, dann nickte er.
Sie räusperte sich. »Außerdem möchte ich dieses Buch behalten.«
Er bedachte sie mit einem schiefen Lächeln.
»Du würdest wirklich eine schreckliche Prostituierte abgeben. Kein bisschen Charme.«
»Nein«, sagte Tante Fang. »Wir brauchen dich im Laden.«
»Ich lerne nachts«, erwiderte Rin. »Oder wenn der Laden geschlossen ist.«
Tante Fang schrubbte mit verkniffenem Gesicht den Wok. Alles an Tante Fang war rau: ihr Gesicht, eine offene Zurschaustellung von Ungeduld und Ärger; ihre Finger, rot vom stundenlangen Putzen und Waschen; ihre Stimme, heiser, weil sie ständig alle anschrie: Rin, ihren Sohn Kesegi, ihre gedungenen Schmuggler und Onkel Fang, der reglos in seinem verqualmten Raum lag.
»Was hast du ihm versprochen?«, verlangte sie misstrauisch zu wissen.
Rin versteifte sich. »Nichts.«
Tante Fang knallte den Wok auf die Theke. Rin zuckte zusammen und hatte plötzlich Angst, dass ihr Diebstahl entdeckt worden war.
»Was ist denn so verkehrt daran, verheiratet zu werden?«, fragte Tante Fang scharf. »Als ich deinen Onkel geheiratet habe, war ich jünger als du jetzt. Jedes andere Mädchen im Dorf wird bis zu seinem sechzehnten Geburtstag verheiratet sein. Hältst du dich für etwas Besseres?«
Rin war so erleichtert, dass sie sich daran erinnern musste, angemessen reumütig zu wirken. »Nein. Ich meine, das tue ich nicht.«
»Denkst du, es wird so schlimm werden?« Tante Fangs Stimme wurde gefährlich leise. »Worum geht es wirklich? Hast du Angst davor, sein Bett zu teilen?«
Daran hatte Rin noch gar nicht gedacht, aber jetzt schnürte sich ihr bei der bloßen Vorstellung die Kehle zu.
Tante Fang verzog erheitert die Lippen. »Zugegeben, die erste Nacht ist die schlimmste. Steck dir ein Baumwollknäuel in den Mund, damit du dir nicht auf die Zunge beißt. Schrei nicht, es sei denn, er will es. Halt den Blick gesenkt und tu, was er sagt – werde seine stumme kleine Haushaltssklavin, bis er dir vertraut. Aber dann versorge ihn mit Opium – zuerst nur ein wenig, obwohl ich bezweifle, dass er noch nie geraucht hat. Dann gibst du ihm jeden Tag etwas mehr. Tu es nachts, gleich nachdem er mit dir fertig ist, damit er es immer mit Vergnügen und Macht in Verbindung bringt. Gib ihm mehr und mehr, bis er abhängig davon ist und von dir. Lass das Opium seinen Körper und seinen Geist zerstören. Du wirst mehr oder weniger mit einer atmenden Leiche verheiratet sein, aber du wirst über seinen Reichtum verfügen, seine Ländereien und seine Macht.« Tante Fang legte den Kopf schräg. »Ist es da so schlimm, das Bett mit ihm zu teilen?«
Rin wollte sich übergeben. »Aber ich …«
»Sind es die Kinder, vor denen du Angst hast?« Tante Fang sah sie an. »Es gibt Methoden, sie im Leib zu töten. Du arbeitest in der Apotheke. Du weißt das. Aber du wirst ihm zumindest einen Sohn schenken wollen. Festige deine Position als seine erste Gemahlin, damit er seinen Besitz nicht mit einer Konkubine verprassen kann.«
»Aber ich will das alles nicht«, stieß Rin mit erstickter Stimme hervor. Ich will nicht so werden wie du.
»Wen schert es, was du willst?«, fragte Tante Fang leise. »Du bist eine Kriegswaise. Du hast keine Eltern, keinen Rang und keine Beziehungen. Du kannst dich glücklich schätzen, dass es dem Inspektor gleichgültig ist, dass du nicht hübsch bist, sondern ihn nur interessiert, dass du jung bist. Das ist das Beste, was ich für dich tun kann. Weitere Gelegenheiten wird es nicht geben.«
»Aber das Keju …«
»Aber das Keju«, äffte Tante Fang sie nach. »Was bildest du dir nur ein? Denkst du etwa, du wirst an eine Akademie gehen?«
»Ja, allerdings.« Rin richtete sich gerade auf und versuchte, Sicherheit in ihre Stimme zu legen. Beruhige dich. Du hast immer noch einen Trumpf. »Und du wirst es mir erlauben. Denn eines Tages könnten die Behörden fragen, woher das Opium kommt.«
Tante Fang musterte sie für einen langen Moment. »Willst du sterben?«, fragte sie.
Rin wusste, dass das keine leere Drohung war. Tante Fang war mehr als bereit, Probleme endgültig zu lösen. Rin hatte es schon früher gesehen. Sie hatte den größten Teil ihres Lebens damit verbracht, dafür zu sorgen, dass sie selbst nicht zu einem Problem wurde.
Aber jetzt konnte sie sich zu Wehr setzen.
»Wenn ich verschwinde, wird Lehrer Feyrik den Behörden sagen, was mit mir passiert ist«, erklärte sie laut. »Und er wird deinem Sohn sagen, was du getan hast.«
»Kesegi ist das egal«, höhnte Tante Fang.
»Ich habe Kesegi aufgezogen. Er liebt mich«, widersprach Rin. »Und du liebst ihn. Du willst nicht, dass er weiß, was du tust. Deshalb schickst du ihn nicht in den Laden. Und deshalb darf ich ihn nicht aus unserem Zimmer lassen, wenn du dich mit deinen Schmugglern triffst.«
Das saß. Tante Fang starrte sie mit offenem Mund und bebenden Nasenflügeln an.
»Lass es mich wenigstens versuchen«, flehte Rin. »Es kann nicht schaden, mich lernen zu lassen. Wenn ich die Prüfung bestehe, dann bist du mich zumindest los – und wenn ich durchfalle, hast du immer noch eine Braut.«
Tante Fang griff nach dem Wok. Rin versteifte sich unwillkürlich, aber Tante Fang fuhr nur fort, kräftig zu schrubben.
»Wenn du im Laden lernst, werfe ich dich auf die Straße«, drohte Tante Fang. »Der Inspektor darf es unter keinen Umständen erfahren.«
»Abgemacht«, log Rin.
Tante Fang schnaubte. »Und was passiert, wenn du es schaffst? Wer zahlt dann dein Schuldgeld? Dein lieber, verarmter Lehrer?«
Rin zögerte. Sie hatte gehofft, dass die Fangs ihr die Mitgift zur Verfügung stellen würden, aber jetzt sah sie ein, dass es eine idiotische Hoffnung gewesen war.
»Der Unterricht in Sinegard ist kostenlos«, bemerkte sie.
Tante Fang lachte laut auf. »Sinegard! Du denkst, du schaffst die Aufnahmeprüfung für Sinegard?«
Rin hob das Kinn. »Ja.«
Die Militärakademie in Sinegard war die angesehenste Einrichtung des Reiches, eine Ausbildungsstätte für künftige Generäle und Staatsmänner. Sie nahm nur selten Schüler aus dem ländlichen Süden auf, wenn überhaupt.
»Du hast wirklich den Verstand verloren.« Tante Fang schnaubte wieder. »Na schön – meinetwegen lerne und mach das Keju, wenn du unbedingt willst. Aber wenn du durchfällst, wirst du diesen Inspektor heiraten. Und dankbar dafür sein.«
In dieser Nacht, im Schein einer gestohlenen Kerze auf dem Boden des engen Schlafzimmers, das sie sich mit Kesegi teilte, schlug Rin das erste Keju-Lehrbuch auf.
Das Keju prüfte die vier edlen Fächer: Geschichte, Mathematik, Logik und die Klassiker. Die kaiserlichen Beamten in Sinegard betrachteten sie als wesentliche Grundlage für die Entwicklung eines Gelehrten und Staatsmannes. Rin musste sie bis zu ihrem sechzehnten Geburtstag lernen.
Sie stellte einen engen Zeitplan auf: Sie musste jede Woche mindestens zwei Bücher lesen und jeden Tag zwischen zwei Fächern wechseln. Jeden Abend, nachdem sie den Laden abgeschlossen hatte, lief sie zu Lehrer Feyrik, bevor sie zu den Fangs zurückkehrte, die Arme vollbeladen mit weiteren Büchern.
Geschichte war das einfachste Fach. Nikans Geschichte war eine überaus unterhaltsame Erzählung von unablässiger Kriegsführung. Vor tausend Jahren war das Reich unter dem mächtigen Schwert des unbarmherzigen Roten Kaisers gegründet worden, der die über den Kontinent verteilten Mönchsorden aufgehoben und einen geeinten Staat von nie da gewesener Größe erschaffen hatte. Es war das erste Mal, dass das Volk der Nikara sich als Nation betrachtet hatte. Der Rote Kaiser vereinheitlichte die nikarische Sprache, führte einheitliche Maße und Gewichte ein und ließ ein Straßennetz erbauen, das seine ausgedehnten Territorien miteinander verband.
Doch das neue nikarische Reich überlebte den Tod des Roten Kaisers nicht. Seine zahlreichen Erben stürzten das Land in der darauffolgenden Ära der Streitenden Reiche in ein blutiges Chaos, das Nikan in zwölf rivalisierende Provinzen spaltete.
Seitdem war das große Land wieder vereinigt, erobert, ausgebeutet, zerschlagen und dann erneut geeint worden. Nikan hatte mit den Khanen der nördlichen Hinterländer und den langen Westmännern von jenseits des großen Meeres im Krieg gelegen. Beide Male hatte sich die fremde Besatzung in dem gewaltigen Reich nicht lange halten können.
Von allen Möchtegerneroberern Nikans war die Föderation von Mugen ihrem Ziel am nächsten gekommen. Der Inselstaat hatte Nikan zu einer Zeit angegriffen, als die inneren Unruhen zwischen den Provinzen auf ihrem Höhepunkt waren. Zwei Mohnkriege und fünfzig Jahre blutiger Besatzung hatte es gebraucht, um Nikans Unabhängigkeit zurückzugewinnen.
Jetzt herrschte Kaiserin Su Daji, das letzte lebende Mitglied der Troika, die während des Zweiten Mohnkrieges die Macht über den Staat ergriffen hatte, über ein Land mit zwölf Provinzen, dem es nie ganz gelungen war, die Einheit wiederherzustellen, die der Rote Kaiser durchgesetzt hatte.
Das nikarische Reich hatte sich in der Vergangenheit als nicht dauerhaft fremdbeherrschbar erwiesen. Aber es war auch unsicher und uneins, und die gegenwärtige Phase des Friedens ließ nicht darauf hoffen, dass der Frieden von Dauer sein würde.
Wenn es eines gab, was Rin über die Geschichte ihres Landes gelernt hatte, dann dies: Das einzige Beständige am nikarischen Reich war der Krieg.
Das zweite Fach, Mathematik, war die reinste Schinderei. Es war nicht besonders anspruchsvoll, aber langweilig und ermüdend. Das Keju suchte nicht nach genialen Mathematikern, sondern nach Schülern, die die Finanzen und Bilanzbücher des Landes führen konnten. Rin hatte für die Fangs die Buchhaltung gemacht, seit sie rechnen konnte. Sie hatte eine natürliche Begabung dafür, im Kopf mit großen Summen zu jonglieren. Sie musste sich noch auf den neusten Stand bringen, was die abstrakteren trigonometrischen Theoreme betraf, die man vermutlich bei Seeschlachten brauchte, aber sie stellte fest, dass sie angenehm einfach zu lernen waren.
Der dritte Bereich, Logik, war ihr vollkommen fremd. Das Keju stellte Logikrätsel in Form von offenen Fragen. Rin schlug zur Übung eine Probeprüfung auf. Die erste Frage lautete: »Ein Gelehrter, der auf einer ausgetretenen Straße reist, kommt an einem Birnbaum vorbei. Der Baum hängt so voll, dass die Äste sich unter der Last der Früchte biegen. Doch er pflückt sie nicht. Warum?«
Weil es nicht sein Birnbaum ist, dachte Rin sofort. Weil er Tante Fang gehören könnte, die ihm den Kopf mit der Schaufel einschlagen wird. Aber diese Antworten waren weder moralisch noch passten sie, denn die Antwort des Rätsels musste in der Aufgabe selbst zu finden sein. Es musste einen Trugschluss geben, einen Widerspruch in dem vorgegebenen Fall.
Rin musste lange nachdenken, bevor sie die Lösung fand: Wenn ein Baum an einer vielbereisten Straße noch so viele Früchte trägt, stimmt mit den Früchten etwas nicht.
Je mehr sie übte, umso mehr betrachtete sie die Fragen als Spiele. Es machte Spaß, sie zu knacken. Rin zeichnete Diagramme in die Erde, studierte die Strukturen logischer Schlüsse und prägte sich die häufigeren Trugschlüsse ein. Nach wenigen Monaten konnte sie diese Art von Fragen in Sekundenschnelle beantworten.
Ihr bei weitem schlechtestes Fach waren die Klassiker. Sie bildeten die Ausnahme in ihrem Rotationsplan. Die Klassiker musste sie jeden Tag lernen.
Für diesen Teil des Keju mussten die Schüler Texte eines festgelegten Kanons von siebenundzwanzig Büchern auswendig vortragen, untersuchen und vergleichen. Die Bücher waren nicht in der modernen Sprache geschrieben, sondern in der altnikarischen Schriftsprache, die für ihre unberechenbare Grammatik und heikle Aussprache berüchtigt war. Die Bücher enthielten Gedichte, philosophische Abhandlungen und Aufsätze über die Staatskunst, geschrieben von den legendären Gelehrten der nikarischen Vergangenheit. Sie sollten den moralischen Charakter der künftigen Staatsmänner der Nation formen. Und sie waren ohne Ausnahme hoffnungslos verwirrend.
Anders als bei Logik und Mathematik kam Rin bei den Klassikern mit Vernunft nicht weiter. Die Klassiker verlangten eine Wissensgrundlage, die sich die meisten Schüler nach und nach aufgebaut hatten, seit sie lesen konnten. Rin hatte zwei Jahre Zeit, um mehr als fünf Jahre unablässigen Lernens nachzuholen.
Zu diesem Zweck erbrachte sie im Auswendiglernen eine außergewöhnliche Leistung.
Sie sagte die Texte rückwärts auf, während sie am Rand der alten Verteidigungswälle entlangging, die Tikany umgaben. Sie sagte sie mit doppelter Geschwindigkeit auf, während sie über Pfähle im See sprang. Sie murmelte sie im Laden vor sich hin und fauchte verärgert, wenn Kunden sie um Hilfe baten. Sie schlief erst ein, wenn sie ihren Text fehlerlos aufgesagt hatte. Wenn sie aufwachte, trug sie klassische Gedichte vor und jagte Kesegi damit Angst ein, der dachte, sie sei von Geistern besessen. Und in gewisser Weise war sie das auch – sie träumte von alten Versen längst verstorbener Dichter und erwachte zitternd aus Albträumen, in denen sie sie falsch aufgesagt hatte.
»Der Weg des Himmels ist, sich ständig zu bewegen und nirgends sich zu stauen; dadurch gelangen alle Dinge zur Vollendung … So ist der Weg, und darum fällt ihm alles unter dem Himmel zu, gehorcht ihm alles zwischen den Meeren.«
Rin legte Zhuangzis Schriften beiseite und machte ein finsteres Gesicht. Sie hatte nicht nur keine Ahnung, worüber Zhuangzi schrieb, sie sah auch nicht ein, warum er es unbedingt in der ärgerlichsten und weitschweifigsten Art wie nur irgend möglich tun musste.
Sie verstand sehr wenig von dem, was sie las. Selbst die Gelehrten des Berges Yuelu hatten Mühe, die Klassiker zu verstehen. Man konnte kaum von ihr erwarten, dass sie von allein ihre Bedeutung entschlüsseln konnte. Und weil sie weder die Zeit noch die Ausbildung hatte, um sich in die Texte zu vertiefen – und da ihr weder nützliche Gedächtnistricks noch Abkürzungen einfielen, um die Klassiker zu lernen –, musste sie sie einfach Wort für Wort auswendig lernen und hoffen, dass das genügen würde.
Wo sie auch hinging, hatte sie ein Buch bei sich. Sie lernte beim Essen. Wenn sie müde wurde, beschwor sie Bilder von sich selbst herauf und erzählte sich die Geschichte ihrer schlimmstmöglichen Zukunft.
In einem Kleid, das dir nicht passt, schreitest du zum Altar. Du zitterst. Er wartet. Er sieht dich an wie ein saftiges, gemästetes Schwein, ein durchwachsenes Stück Fleisch, das ihm zum Kauf angeboten wird. Er verteilt Speichel auf seinen trockenen Lippen. Während des ganzen Banketts wendet er den Blick nicht von dir ab. Wenn es vorüber ist, trägt er dich in sein Schlafzimmer. Er drückt dich auf die Laken.
Sie schauderte, kniff die Augen fest zusammen, öffnete sie wieder und suchte nach der Stelle auf der Seite.
Als Rin fünfzehn wurde, hatte sie eine Unmenge alter nikarischer Literatur im Kopf und konnte das meiste davon auswendig. Aber ihr unterliefen immer noch Fehler: Sie vergaß Worte, warf komplizierte Sätze durcheinander, verwechselte die Reihenfolge der Strophen.
Sie wusste, dass es gut genug war, um von einem Lehrerseminar oder einer medizinischen Akademie aufgenommen zu werden. Sie vermutete, dass sie sogar vom Gelehrteninstitut am Berg Yuelu angenommen werden würde, wo die hervorragendsten Geister Nikans atemberaubende literarische Werke schufen und über die Rätsel der Natur nachsannen.
Doch sie konnte sich keine dieser Akademien leisten. Sie musste einfach die Aufnahme in Sinegard schaffen. Sie musste zu den Schülern mit der höchsten Punktzahl gehören, und zwar nicht nur in ihrem Dorf, sondern im ganzen Land. Anderenfalls würden ihre zwei Jahre des Lernens vergeudet sein.
Sie musste ihr Gedächtnis vervollkommnen.
Sie hörte auf zu schlafen.
Ihre Augen waren bald blutunterlaufen und geschwollen. Vom tagelangen Pauken schwirrte ihr der Kopf. Als sie eines Abends Lehrer Feyrik besuchte, um sich neue Bücher zu holen, wirkte sie verzweifelt und sah an ihm vorbei, während er mit ihr sprach. Seine Worte trieben wie Wolken über sie hinweg, und sie nahm seine Gegenwart kaum wahr.
»Rin. Sieh mich an.«
Sie holte scharf Luft und zwang sich, die Augen auf seine verschwommene Gestalt zu richten.
»Wie geht es dir?«, fragte er.
»Ich schaffe es nicht«, flüsterte sie. »Ich habe nur noch zwei Monate, und ich schaffe es nicht. Kaum packe ich etwas in den Kopf, fließt es schon wieder hinaus, und …« Ihre Brust hob und senkte sich hektisch.
»Oh, Rin.«
Worte sprudelten aus ihrem Mund, sie sprach, ohne nachzudenken. »Was passiert, wenn ich nicht bestehe? Was, wenn ich doch verheiratet werde? Ich könnte ihn töten, ihn im Schlaf ersticken, versteht Ihr? Würde ich sein Vermögen erben? Das wäre doch gut, nicht?« Sie lachte hysterisch. Tränen strömten ihr über die Wangen. »Es ist einfacher, als ihn unter Drogen zu setzen. Niemand würde es je erfahren.«
Lehrer Feyrik erhob sich schnell und zog einen Hocker heran. »Setz dich, Kind.«
Rin zitterte. »Ich kann nicht. Ich muss bis morgen noch die Gespräche des Konfuzius durchgehen.«
»Runin. Setz dich.«
Sie ließ sich auf den Hocker sinken.
Lehrer Feyrik nahm ihr gegenüber Platz und ergriff ihre Hände. »Ich werde dir eine Geschichte erzählen«, begann er. »Einmal, vor nicht allzu langer Zeit, lebte ein Schüler in einer sehr armen Familie. Er war zu schwach, um lange Stunden auf den Feldern zu arbeiten, und seine einzige Möglichkeit, um für seine Eltern zu sorgen, wenn sie alt waren, bestand darin, sich eine Beamtenstelle zu sichern, damit er ein ordentliches Gehalt bekam. Dafür musste er sich an einer Akademie einschreiben. Von seinem letzten Geld kaufte sich der Schüler Lehrbücher und meldete sich für das Keju an. Er war sehr müde, weil er den ganzen Tag auf den Feldern schuftete und nur nachts lernen konnte.«
Rins Lider schlossen sich. Ihre Schultern zuckten, und sie unterdrückte ein Gähnen.
Lehrer Feyrik schnippte vor ihren Augen mit den Fingern. »Der Schüler musste einen Weg finden, wach zu bleiben. Also nagelte er das Ende seines Zopfes an die Decke, sodass ihn jedes Mal, wenn er nach vorn sank, sein Haar am Schädel riss und der Schmerz ihn weckte.« Lehrer Feyrik lächelte mitfühlend. »Du hast dein Ziel fast erreicht, Rin. Halt noch ein kleines bisschen durch. Bitte, begehe keinen Gattenmord.«
Aber sie hörte ihm nicht mehr zu.
»Der Schmerz hat ihm geholfen, sich zu konzentrieren«, murmelte sie.
»Darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus …«
»Der Schmerz hat ihm geholfen, sich zu konzentrieren«, wiederholte sie.
Schmerz konnte ihr helfen, sich zu konzentrieren.
Also stellte Rin danach eine Kerze neben ihre Bücher und tröpfelte sich heißes Wachs auf den Arm, wenn sie einnickte. Wenn ihr die Augen vor Schmerz tränten, wischte sie sie weg und setzte ihre Studien fort.
Am Tag der Prüfung waren ihre Arme mit Brandnarben übersät.
Hinterher fragte Lehrer Feyrik sie, wie die Prüfung gelaufen sei. Sie konnte es ihm nicht sagen. Noch Tage später konnte sie sich nicht an die schrecklichen, kräftezehrenden Stunden erinnern. Da war eine Lücke in ihrem Gedächtnis. Wenn sie versuchte, sich darauf zu besinnen, wie sie eine bestimmte Frage beantwortet hatte, spielte ihr Geist nicht mit und ließ nicht zu, dass sie die Prüfung noch einmal durchlebte.
Sie wollte sie nicht noch einmal durchleben. Sie wollte nie wieder daran denken.
Sieben Tage, bis die Ergebnisse vorlagen. Jedes Heft in der Provinz musste doppelt und dreifach geprüft werden.
Für Rin waren diese Tage unerträglich. Sie schlief kaum. In den vergangenen zwei Jahren hatte sie die Tage mit unermüdlichem Lernen ausgefüllt. Jetzt hatte sie nichts zu tun – hatte ihre Zukunft nicht mehr selbst in der Hand, und dieser Gedanke machte alles nur noch schlimmer.
Mit ihren Sorgen machte sie alle anderen verrückt. Sie machte Fehler im Laden. Sie richtete ein Durcheinander im Warenbestand an. Sie fauchte Kesegi an und stritt unnötig mit den Fangs.
Mehr als einmal überlegte sie, ob sie nicht ein weiteres Päckchen Opium stehlen und es rauchen sollte. Sie hatte von Frauen im Dorf gehört, die Selbstmord begangen hatten, indem sie ganze Opiumklumpen herunterschluckten. In den dunklen Stunden der Nacht dachte sie auch daran.
Alles verharrte in einem seltsamen Schwebezustand. Sie hatte das Gefühl dahinzutreiben, als sei ihr ganzes Leben auf diese eine Punktzahl reduziert.
Sie dachte daran, Notfallpläne zu schmieden und Vorkehrungen zu treffen, um aus dem Dorf zu fliehen, falls sie doch nicht bestanden hatte. Aber ihr Verstand weigerte sich, bei dem Thema zu bleiben. Sie konnte sich ein Leben nach dem Keju nicht vorstellen, weil es nach dem Keju vielleicht gar kein Leben gab.
Am Ende war Rin so verzweifelt, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben betete.
Die Fangs waren alles andere als fromm. Sie besuchten den Dorftempel bestenfalls gelegentlich und meist, um hinter dem goldenen Altar Opiumpäckchen zu verteilen.
Sie waren nicht allein in ihrem Mangel an religiöser Hingabe. Einst waren die Mönchsorden einflussreicher gewesen als heute die Kriegsherren, aber dann war der Rote Kaiser über den Kontinent gestürmt, in seinem glorreichen Streben, das Reich zu einen, und hatte abgeschlachtete Mönche und leere Tempel hinterlassen.
Die Mönchsorden gab es nicht mehr, doch die Götter waren geblieben: zahlreiche Gottheiten, die jeden Bereich des Lebens verkörperten, von den großen Themen der Liebe und der Kriegskunst bis hin zu den weltlichen Sorgen der Küchen und Haushalte. Irgendwo wurden diese Traditionen heimlich von hingebungsvollen Gläubigen am Leben erhalten, aber die meisten Dorfbewohner in Tikany besuchten die Tempel nur aus ritualisierter Gewohnheit. Niemand glaubte wirklich – zumindest wagte niemand, es zuzugeben. Für die Nikara waren Götter Überreste der Vergangenheit: Stoff für Mythen und Legenden, mehr nicht.
Doch Rin ging kein Risiko ein. Sie stahl sich eines frühen Nachmittags aus dem Laden und brachte den vier Göttern Opfergaben: gefüllte Teigtaschen und Lotoswurzeln.
Im Tempel war es sehr still. Es war Mittag, und sie war die Einzige, die da war. Vier Statuen blickten sie stumm aus aufgemalten Augen an. Rin blieb zögernd vor ihnen stehen. Sie war sich nicht ganz sicher, zu welcher sie beten sollte.
Natürlich kannte sie die Namen – der weiße Tiger, die schwarze Schildkröte, der blaue Drache und der zinnoberrote Vogel. Und sie wusste, dass sie für die vier Kardinalrichtungen standen, aber sie bildeten nur eine kleine Untergruppe des gewaltigen Pantheons, das in Nikan verehrt wurde. Der Tempel enthielt auch Schreine für kleinere Wächtergötter, die auf Rollbildern an den Wänden dargestellt waren.
So viele Götter. Welcher war der Gott der Prüfungsergebnisse? Welcher war der Gott der unverheirateten Ladenmädchen, die unverheiratet bleiben wollten?
Sie beschloss, einfach zu allen zu beten.
»Wenn es euch gibt, wenn ihr da oben seid, helft mir. Zeigt mir einen Ausweg aus diesem Dreckskaff. Oder wenn ihr das nicht könnt, macht, dass der Importinspektor einen Herzinfarkt bekommt.«
Sie sah sich in dem leeren Tempel um. Was kam als Nächstes? Sie hatte sich immer vorgestellt, dass zum Beten mehr gehörte, als nur seine Bitten vorzutragen. Sie entdeckte unbenutzte Räucherstäbchen, die neben dem Altar lagen. Also entzündete sie das Ende eines dieser Stäbchen, indem sie es in den Opferkessel tauchte, dann wedelte sie damit versuchsweise in der Luft herum.
Musste sie den Rauch den Göttern hinhalten? Oder sollte sie das Stäbchen selbst rauchen? Sie hatte sich gerade das brennende Ende an die Nase gehalten, als ein Tempelhüter hinter dem Altar hervortrat.
Sie sahen sich überrascht an.
Langsam nahm Rin das Weihrauchstäbchen von ihrer Nase.
»Hallo«, begrüßte sie ihn. »Ich bete.«
»Bitte, geh«, sagte er.
Die Prüfungsergebnisse sollten mittags vor dem Prüfungssaal ausgehängt werden.
Rin schloss früh den Laden und ging eine halbe Stunde vor dem Termin mit Lehrer Feyrik ins Dorf. Um den Pfahl hatte sich bereits eine große Menschenmenge versammelt, daher suchten sie sich hundert Meter entfernt ein schattiges Eckchen und warteten.
Es hatten sich so viele Menschen vor dem Saal eingefunden, dass Rin nicht sehen konnte, wann die Schriftrollen angeschlagen wurden, aber sie wusste es trotzdem, weil plötzlich alle durcheinanderriefen und die Menge nach vorn drängte und Rin und Lehrer Feyrik mitriss.
Ihr Herz schlug so schnell, dass sie kaum Luft bekam. Sie konnte nichts sehen, außer den Rücken der Leute vor ihr, und hatte das Gefühl, sich gleich übergeben zu müssen.
Als sie endlich vorne ankamen, brauchte Rin lange, um ihren Namen zu finden. Mit angehaltenem Atem überflog sie die untere Hälfte der Schriftrolle. Sie hatte sicher nicht gut genug abgeschnitten, um unter die besten zehn zu kommen.
Nirgendwo konnte sie Fang Runin entdecken.
Erst als sie Lehrer Feyrik anschaute und sah, dass er weinte, begriff sie, was geschehen war.
Ihr Name stand ganz oben auf der Schriftrolle. Sie war nicht unter den besten zehn. Sie war die Beste des Dorfes. Der gesamten Provinz.
Sie hatte einen Lehrer bestochen. Sie hatte Opium gestohlen. Sie hatte sich Verbrennungen zugefügt, ihre Pflegeeltern belogen, ihre Pflichten im Laden vernachlässigt und eine Heiratsvereinbarung gebrochen.
Und sie würde nach Sinegard gehen.
Kapitel 2
Als das letzte Mal ein Schüler aus Tikany nach Sinegard gegangen war, hatte der Dorfvorsteher ein dreitägiges Fest veranstaltet. Diener hatten körbeweise Kuchen mit roter Bohnenpaste und Krüge mit Reiswein auf den Straßen verteilt. Der Schüler, der Neffe des Vorstehers, war unter dem Jubel betrunkener Bauern in die Hauptstadt aufgebrochen.
In diesem Jahr war es dem Adel von Tikany einigermaßen peinlich, dass ein verwaistes Ladenmädchen den einzigen Platz in Sinegard ergattert hatte. In der Prüfungsstelle gingen mehrere anonyme Nachfragen ein. Als Rin im Rathaus erschien, um sich anzumelden, wurde sie eine Stunde lang festgehalten, in der die Aufseher versuchten, ihr das Geständnis abzupressen, dass sie gemogelt hatte.
»Ihr habt recht«, sagte sie. »Ich habe die Antworten vom Prüfungsverwalter erhalten. Ich habe ihn mit meinem schönen jungen Körper verführt. Ihr habt mich erwischt.«
Die Aufseher glaubten nicht, dass ein Mädchen ohne richtige Schulbildung das Keju bestanden haben könnte.
Sie zeigte ihnen ihre Brandnarben.
»Ich habe euch nichts zu sagen«, erklärte sie, »weil ich nicht betrogen habe. Und ihr könnt das Gegenteil nicht beweisen. Ich habe für diese Prüfung gelernt. Ich habe mich selbst verstümmelt. Ich habe gelesen, bis mir die Augen brannten. Ihr könnt mich nicht durch Einschüchterung zu einem Geständnis bringen, denn ich sage die Wahrheit.«
»Denk an die Folgen«, blaffte die Aufseherin. »Verstehst du, wie ernst es ist? Wir können dein Ergebnis für ungültig erklären und dich dafür ins Gefängnis werfen lassen. Du wirst bis an dein Lebensende Strafe zahlen. Aber wenn du jetzt gestehst, können wir die Anschuldigung zurücknehmen.«
»Nein, denkt ihr über die Folgen nach«, fauchte Rin. »Wenn ihr mein Ergebnis für ungültig erklärt, bedeutet das, dass dieses schlichte Ladenmädchen so schlau war, eure berüchtigten Maßnahmen zur Verhinderung von Betrug zu umgehen. Und das bedeutet, dass ihr Stümper seid. Und ich wette, der Dorfvorsteher wird euch mit Freuden die Schuld für einen möglichen Betrug zuweisen.«
Eine Woche später wurde sie von allen Anschuldigungen freigesprochen. Der Dorfvorsteher von Tikany verkündete, die Ergebnisse seien ein »Versehen« gewesen. Er bezeichnete Rin zwar nicht als Betrügerin, aber er erkannte ihr Prüfungsergebnis auch nicht an. Die Aufseher baten Rin, das Dorf unauffällig zu verlassen, und drohten ihr unbeholfen, sie in Tikany festzuhalten, wenn sie nicht gehorchte.
Rin wusste, dass es eine leere Drohung war. Die Aufnahme an der Akademie von Sinegard entsprach einem kaiserlichen Ruf, und eine Behinderung jedweder Art – selbst durch Provinzbehörden – kam einem Verrat gleich. Das war auch der Grund, warum die Fangs sie nicht daran hindern konnten zu gehen – ganz gleich, wie sehr sie sie zu einer Heirat zwingen wollten.
Rin brauchte keine Bestätigung aus Tikany, weder vom Dorfvorsteher noch von den Adligen. Sie ging fort, sie hatte einen Ausweg, und allein darauf kam es an.
Formulare wurden ausgefüllt, Briefe verschickt. Am Ersten des nächsten Monats würde Rin sich in Sinegard einschreiben.
Der Abschied von den Fangs fiel verständlicherweise nicht schwer. Niemand tat so, als sei er besonders traurig, den anderen loszuwerden.
Nur Kesegi, Rins Ziehbruder, zeigte echtes Bedauern.
»Geh nicht weg«, jammerte er und klammerte sich an ihren Reiseumhang.
Rin kniete sich hin und zog Kesegi fest an sich.
»Ich hätte dich ohnehin verlassen«, antwortete sie. »Wenn ich nicht nach Sinegard gegangen wäre, dann in das Haus eines Ehemannes.«
Kesegi wollte sie nicht loslassen. »Lass mich nicht mit ihr allein«, murmelte er kläglich.
Rin zog sich der Magen zusammen. »Es wird schon alles gut werden«, flüsterte sie ihm ins Ohr. »Du bist ein Junge. Und du bist ihr Sohn.«
»Aber es ist nicht gerecht.«
»So ist das Leben, Kesegi.«
Kesegi begann leise zu weinen, aber Rin löste sich aus seiner schraubstockartigen Umarmung und stand auf. Er wollte sich an ihre Taille klammern, aber sie stieß ihn heftiger von sich, als sie beabsichtigt hatte. Kesegi stolperte verdutzt zurück, dann brach er in lautes Heulen aus.
Rin wandte sich von seinem tränenüberströmten Gesicht ab und tat so, als würde sie die Riemen ihrer Reisetasche befestigen.
»Oh, halt den Mund.« Tante Fang packte Kesegi am Ohr und zog daran, bis er aufhörte zu weinen. Sie funkelte Rin an, die in ihren schlichten Reisekleidern in der Tür stand. Es war Spätsommer, und Rin trug eine leichte Baumwolltunika und zweimal ausgebesserte Sandalen. Ihre einzige Kleidung zum Wechseln trug sie in einer geflickten Tasche über der Schulter. Rin hatte auch das Buch von Mengzi eingepackt, einen Satz Schreibpinsel, die ein Geschenk von Lehrer Feyrik waren, und einen kleinen Geldbeutel. Die Tasche enthielt alles, was sie auf der Welt besaß.
Tante Fang verzog den Mund. »Sinegard wird dir das Genick brechen.«
»Darauf lasse ich es ankommen«, erwiderte Rin.
Zu Rins großer Erleichterung gab ihr das Büro des Dorfvorstehers zwei Tael als Fahrgeld mit – der Ruf der Kaiserin hatte den Vorsteher gezwungen, für ihre Reisekosten aufzukommen. Mit anderthalb Tael war es Rin und Lehrer Feyrik gelungen, zwei Plätze in einem Karawanenwagen zu ergattern, der nach Norden in die Hauptstadt unterwegs war.
»In den Tagen des Roten Kaisers konnte eine Braut mit ihrer Mitgift ohne Begleitung vom Südzipfel der Provinz Hahn bis zum nördlichsten Gipfel der Wudang-Berge reisen.« Als sie in den Wagen stiegen, schlug der Lehrer in Feyrik durch. »Heutzutage würde ein einzelner Soldat es keine zwei Meilen weit schaffen.«
Schon lange patrouillierten keine Wachen der Kaiserin mehr in den Bergen von Nikan. Allein auf den ausgedehnten Straßen des Reiches unterwegs zu sein bedeutete mit hoher Wahrscheinlichkeit, ausgeraubt, ermordet oder gefressen zu werden. Manchmal alles zusammen – und manchmal nicht in dieser Reihenfolge.
»In Eurem Fahrpreis ist mehr als ein Platz im Wagen enthalten«, erklärte der Karawanenführer, als er die Münzen einsteckte. »Damit bezahlt Ihr für Eure Leibwachen. Unsere Männer sind die Besten auf ihrem Gebiet. Wenn wir der Roten Dschunke begegnen, nimmt sie sofort Reißaus.«
Die Rote Dschunke war eine religiöse Sekte von Banditen und Gesetzlosen, die für ihre Anschläge auf das Leben der Kaiserin nach dem Zweiten Mohnkrieg berühmt geworden war. Inzwischen war sie zu einem Mythos verblasst, in der Fantasie der Nikara aber lebte sie fort.
»Die Rote Dschunke?« Lehrer Feyrik kratzte sich nachdenklich den Bart. »Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Treibt sie immer noch ihr Unwesen?«
»In den letzten Jahren ist es stiller um sie geworden, aber ich habe Gerüchte gehört, dass sie im Kukhonin-Gebirge gesichtet wurde. Aber wenn unser Glück beständig bleibt, werden wir keine Spur von ihr zu sehen bekommen.« Der Karawanenführer schlug sich auf den Gürtel. »Ladet eure Sachen auf. Ich will aufbrechen, bevor es noch heißer wird.«
Die Karawane war drei Wochen unterwegs und kroch in einem quälend langsamen Tempo nach Norden. Lehrer Feyrik verbrachte die Reise damit, Rin mit alten Geschichten von seinen Abenteuern in Sinegard zu unterhalten, aber seine schillernden Beschreibungen der Stadt machten sie nur wild vor Ungeduld.
»Die Hauptstadt schmiegt sich an den Fuß der Wudang-Berge. Der Palast und die Akademie sind in den Hang hineingebaut, doch der Rest der Stadt liegt darunter im Tal. Manchmal, wenn man an nebligen Tagen hinausschaut, scheint es, als stünde man über den Wolken. Schon der Marktplatz ist größer als ganz Tikany. Auf dem Markt könnte man sich verlaufen … Du wirst Musikanten sehen, die auf Kürbismundorgeln spielen, Straßenhändler, die Pfannkuchen in Form deines Namens backen können, Meisterkalligrafen, die für nur zwei Kupferpfennige vor deinen Augen Fächer bemalen. Da wir gerade davon sprechen, das hier werden wir irgendwann wechseln müssen.« Lehrer Feyrik klopfte auf die Tasche, in der er den Rest ihres Reisegeldes aufbewahrte.
»Kann man im Norden nicht mit Taels und Kupferpfennigen zahlen?«, fragte Rin.
Lehrer Feyrik lachte leise. »Du bist wirklich noch nie aus Tikany herausgekommen, wie? Im Reich gibt es wahrscheinlich zwanzig verschiedene Währungen – Schildpatt, Kaurischnecken, Gold, Silber, Kupferbarren … jede Provinz hat ihre eigene Währung, weil sie der kaiserlichen Verwaltung die Geldversorgung nicht zutraut, und die größeren Provinzen haben zwei oder drei Währungen. Das Einzige, womit man überall zahlen kann, sind die normalen sinegardischen Silbermünzen.«
»Wie viele können wir dafür bekommen?«, fragte Rin.
»Nicht viele«, antwortete Lehrer Feyrik. »Aber der Wechselkurs wird schlechter, je näher wir der Hauptstadt kommen. Am besten tauschen wir sie um, solange wir noch in der Provinz Hahn sind.«
Lehrer Feyrik war außerdem voller Warnungen vor der Hauptstadt. »Bewahr dein Geld immer in der Vordertasche auf. Die Diebe in Sinegard sind kühn und verzweifelt. Ich habe einmal ein Kind mit der Hand in meiner Tasche erwischt. Der Junge hat noch um meine Münze gekämpft, obwohl ich ihn schon ertappt hatte. Jeder wird dir etwas verkaufen wollen. Wenn du Werber hörst, richte den Blick geradeaus und tu so, als hättest du sie nicht bemerkt, sonst werden sie dich die ganze Straße lang verfolgen. Sie werden dafür bezahlt, dich zu belästigen. Lass die Finger von billigem Schnaps. Wenn dir jemand einen Krug Hirseschnaps für weniger als einen Kupferbarren anbietet, ist da kein richtiger Weingeist drin.«
Rin war entsetzt. »Wie kann man Weingeist fälschen?«
»Indem man Hirseschnaps mit Holzgeist mischt.«
»Holzgeist?«
»Der entsteht, wenn man Holz unter Luftabschluss erhitzt. Es ist giftig, man kann blind davon werden.« Lehrer Feyrik rieb sich den Bart. »Wo wir schon mal dabei sind, du solltest auch einen Bogen um die Sojasoße der Straßenhändler machen. Manche Stände verwenden Menschenhaar, um eine billige Soße mit einem ähnlichen Geschmack herzustellen. Angeblich hat man auch in Teig für Brot und Nudeln Haare gefunden. Hm … am besten lässt du ganz die Finger von der Straßenküche. Die Frühstückspfannkuchen kosten zwar nur zwei Kupferlinge das Stück, aber sie werden in Gossenöl gebraten.«
»Gossenöl?«
»Öl, das auf der Straße gesammelt wurde. Die großen Restaurants kippen ihr verbrauchtes Kochöl in die Gosse. Die Straßenköche schöpfen es ab und benutzen es wieder.«
Rin drehte sich der Magen um.
Lehrer Feyrik zog an einem von Rins eng geflochtenen Zöpfen. »Die wirst du abschneiden lassen müssen, bevor du an die Akademie gehst.«
Rin legte sich schützend die Hände aufs Haar. »Sinegardische Frauen lassen sich nicht die Haare wachsen?«
»Die Frauen in Sinegard sind so eitel, was ihr Haar betrifft, dass sie rohe Eier aussaugen, um mit dem Eigelb seinen Glanz zu bewahren. Aber mir geht es nicht um Schönheit. Ich will nicht, dass jemand dich in die Gassen zerrt. Niemand würde von dir hören, bis du Monate später in einem Bordell auftauchst.«
Rin betrachtete widerstrebend ihre Zöpfe. Sie war zu dunkelhäutig und zu dürr, um als Schönheit zu gelten, aber sie hatte immer das Gefühl gehabt, dass ihr langes, dichtes Haar zu ihren Vorzügen gehörte. »Muss das sein?«
»An der Akademie wird man dich wahrscheinlich ohnehin zwingen, dir das Haar zu scheren«, sagte Lehrer Feyrik. »Und sie werden es dir in Rechnung stellen. Sinegardische Barbiere sind nicht billig.« Er rieb sich den Bart, während er weitere Warnungen ersann. »Sei auf der Hut vor Falschgeld. Eine falsche Silbermünze erkennt man daran, dass sie bei zehn Würfen hintereinander den Roten Kaiser zeigt. Wenn du jemanden ohne sichtbare Verletzungen am Boden liegen siehst, hilf ihm nicht auf. Er wird behaupten, du hättest ihn gestoßen, und wird dich vor Gericht bringen und dir das Hemd vom Leib klagen. Und halt dich von den Spielhäusern fern.« Lehrer Feyriks Tonfall wurde säuerlich. »Diese Leute verstehen keinen Spaß.«
Allmählich verstand Rin, warum er Sinegard verlassen hatte.
Doch Lehrer Feyrik konnte ihre Vorfreude nicht dämpfen. Wenn überhaupt, verstärkte er nur ihre Ungeduld, die Stadt endlich zu erreichen. Sie würde dort keine Außenseiterin sein. Sie würde nicht an den Straßenküchen essen oder in den Elendsvierteln der Stadt leben. Sie brauchte nicht um Essensreste zu kämpfen oder um Münzen für eine Mahlzeit zu betteln. Sie hatte sich bereits einen Platz gesichert. Sie war Schülerin an der angesehensten Akademie des ganzen Reiches. Das würde sie doch bestimmt vor den Gefahren der Stadt schützen.
An dem Abend schnitt sie sich mit einem rostigen Messer, das sie sich von einem der Karawanenwächter geborgt hatte, selbst die Zöpfe ab. Sie zog die Klinge so dicht über den Ohren hin und her, wie sie es wagte, bis sie abfielen. Es dauerte länger, als sie dachte. Als sie fertig war, blickte sie auf die beiden dicken Haarstränge auf ihrem Schoß.
Sie hatte sie behalten wollen, aber jetzt sah sie darin keinen Gewinn. Es war nur totes Haar. Sie würde es oben im Norden nicht einmal für viel Geld verkaufen können – sinegardisches Haar war bekanntermaßen fein und seidig, und niemand würde die groben Zöpfe einer Bäuerin aus Tikany haben wollen. Also schleuderte sie sie aus dem Wagen und sah zu, wie sie hinter ihr auf die staubige Straße fielen.
Als Rin das Gefühl hatte, vor Langeweile den Verstand zu verlieren, erreichte die Reisegesellschaft die Hauptstadt.
Schon aus großer Entfernung konnte sie Sinegards berühmtes Osttor sehen – eine eindrucksvolle graue Mauer, gekrönt von einer dreigeschossigen Pagode, auf der das Thronmotto des Roten Kaisers prangte: Ewige Stärke, Ewige Harmonie.
Ein Witz, dachte Rin, für ein Land, in dem häufiger Krieg als Frieden geherrscht hatte.
Als sie sich bereits dem Torbogen näherten, kam die Karawane unvermittelt zum Stillstand.
Rin wartete. Nichts geschah.
Nachdem zwanzig Minuten verstrichen waren, beugte Lehrer Feyrik sich aus dem Wagen und lenkte die Aufmerksamkeit eines der Karawanenführer auf sich. »Was ist los?«
»Vor uns sind Föderationstruppen«, berichtete der Mann. »Sie sind wegen einer Grenzstreitigkeit hier. Am Tor werden ihre Waffen untersucht – es wird noch ein paar Minuten dauern.«
Rin setzte sich aufrecht hin. »Das sind Soldaten der Föderation?«
Sie hatte noch nie mugenische Soldaten gesehen. Am Ende des Zweiten Mohnkrieges waren alle Mugener aus den besetzten Gebieten vertrieben und entweder nach Hause geschickt oder in die wenigen diplomatischen Vertretungen und Handelsbüros auf dem Festland versetzt worden. Für die Nikara, die nach der Besatzung geboren waren, waren sie Gespenster der modernen Geschichte, die im Grenzgebiet hausten – eine gesichtslose, allgegenwärtige Bedrohung.
Lehrer Feyriks Hand schnellte vor und schloss sich um ihr Handgelenk, bevor sie aus dem Wagen springen konnte. »Hiergeblieben.«
»Aber ich will sie sehen!«
»Nein, willst du nicht.« Er packte sie an den Schultern. »Du willst überhaupt keine Föderationssoldaten sehen. Wenn du sie verärgerst – wenn sie auch nur denken, du hättest sie komisch angesehen –, können und werden sie dir etwas antun. Sie genießen immer noch diplomatische Immunität. Es kümmert sie einen Dreck. Hast du das verstanden?«
»Wir haben den Krieg gewonnen«, stieß sie verächtlich hervor. »Die Besatzung ist vorbei.«
»Wir haben den Krieg knapp