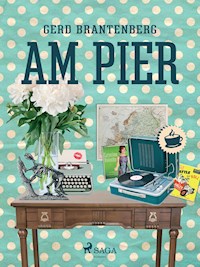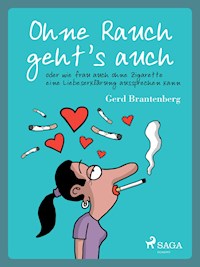Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
'In alle Winde' ist ein spannendes und witziges Roman über die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens im Norwegen der sechziger Jahre. Über die Vergangenheit wird geschwiegen, ganz besonders, wenn die Eltern Nazikollaborateure waren; von Sexualität spricht niemand, schon gar nicht, wenn es um Homosexualität und Lesbisch sein geht. Inger Holm aus Fredrikstad sucht ihren Weg aus der Enge heraus findet ihn - trotz des Tabus, die um sie aufgestellt sind. Nach der Schule arbeitet sie ein Jahr als Au-pair-Mädchen in Edinburgh, danach geht sie auf die Universität in Oslo. Allmählich wird ihr bewusst, dass sie Frauen liebt; aber auch, daß sie zumindest ihrer Mutter mitteilen möchte, von welcher Art ihr Leben sein wird. Ein Bild der sechziger Jahre, verknüpft mit einer Coming-out-Geschichte. AUTORENPORTRÄT Gerd Brantenberg, geboren 1941 in Oslo, wuchs in der norwegischen Kleinstadt Fredrikstad auf. Sie studierte Englisch, Geschichte und Staatswissenschaft und arbeitete ab 1971 als Lehrerin. Von Anfang an beteiligte sie sich aktiv an der neuen Frauenbewegung in Oslo und Kopenhagen, rief die lesbische Bewegung Norwegens ins Leben, was Mitbegründerin des Krisenzentrums für misshandelte Frauen in Oslo und einer homosexuellen LehrerInnengruppe. 1978 gründete sie ein literarisches Frauenforum, das Frauen zum schreiben und Veröffentlichen ermunterte. 1986 war sie Mitorganisatorin der Zweiten Internationalen Frauenbuchmesse in Oslo. TEXTAUSZUG "Die Welt war voller Frauen. Dicke, dünne, breitschultrige und schmächtige, Frauen mit genau der richtigen modischen Frisur, Frauen mit hochgestecktem Haar und Frauen mit wilden Locken, die unbedingt geschüttelt werden wollten. Manche waren so schön, dass Inger sie nicht ansehen konnte. Deshalb machte sie es, immer wieder, und wurde geblendet. Viele riefen und zogen sich zurück, und andere waren ganz grau und taten so, als wären sie gar nicht vorhanden, und wenn sie sich so einer Frau näherte und etwas Lustiges sagte, dann konnte auch so eine Frau plötzlich aufleuchten und schön werden. Es gab keine, die nicht schön werden konnte, wenn sie mit ihr sprach. Denn etwas wohnte in allen Frauen, das nur darauf wartete, zu seinem Recht zu kommen.'
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GERD MJØEN BRANTENBERG
IN ALLE WINDE
ROMAN
Aus dem Norwegischenvon Gabriele Haefs
Saga
Für Mama
Die Phönixtreppe
Inger steht auf der Phönixtreppe in Fredrikstad, trägt ihre Studentenmütze und hat ein gutes Abitur gebaut. In ihr herrscht die Katastrophe. Neben ihr reckt Vater den Hals, um mit aufs Bild zu kommen. Auf der anderen Seite steht ihre Mutter mit den anderen Müttern und schaut zu. Um Inger herum steht der ganze Abiturjahrgang in ordentlichen Reihen auf den sieben Treppenstufen – alle mit ihren Paten, genau wie sie. Hartvig mit Kaspar Olesen, Leif Monradsen mit seinem Vater. Else Tøgern mit Turid aus Plus, Lillian mit ihrer Mutter (einer der wenigen Mütter mit Abitur in der Stadt), Tove Midtbø mit ihrem Vater. Alle. Da sind sie alle. Das ist meine Welt, denkt Inger. Das weiß sie. Alles, was ich bin, wohnt in diesem Jahrgang, alles, was ich kenne, und jetzt müssen wir uns trennen, und in ihr herrscht die Katastrophe.
Niemand von all denen in ihrer Welt, die sie so gut kennen, sieht diese Katastrophe. Sie ist unsichtbar, und Inger ist ein ziemlich hübsches Mädchen (sagen sie), und sie ist tüchtig, sie ist sogar komisch, eine sehr gefragte Eigenschaft. Das sagen sie, wenn sie „hübsch“ auch oft nur unter Vorbehalten anführen. „Du müßtest abnehmen“, hatte Jorunn Johansen gesagt. „Wenn sie sich nur ein bißchen flotter zurechtmachte, dann wäre sie die Hübscheste im ganzen Jahrgang“, hatte Sigvart Jespersen gesagt, allerdings nicht zu ihr. Die Haare und der Speck und die Unordentlichkeit waren Hindernisse beim Hübsch-Sein, und das konnten alle sehen. Aber das ließ sich ändern, an dem Tag, an dem sie das selber wollte. Sie brauchte nur aufzuhören, heimlich alle diese Smiles zu essen und alle diese Coca Colas zu trinken, sie müßte sich nur die Haare zurechtmachen, sich gerade halten und etwas Hübsches anziehen – und dann würde es ihr genauso ergehen wie H. C. Andersens Entlein. Aber in ihr würde noch immer die Katastrophe herrschen. Und wer kann schon mit der Katastrophe in der Brust Schwanenfittiche ausbreiten?
Die Katastrophe war Tove. Die Katastrophe war, daß Tove dort stand und die Hübscheste und Schönste war, die jemals durch Nygaardsgata gewandert war, die Phönixtreppe betreten und die Welt erfüllt hatte. Die Katastrophe war: Wenn Tove sie ansah, mit ihr sprach, sie am Arm faßte, weinte oder lachte oder mit ihr Bridge spielte, dann war das Ziel des Lebens erreicht.
Einmal – ein einziges Mal – ganz früh am Morgen, als die Vögel in Kirkeparken sangen und sie auf dem Heimweg von einem Abiturfest im Pavillon saßen und sie nicht mehr ganz nüchtern gewesen war, hätte sie Tove um ein Haar die ganze Katastrophe erzählt. Aber in diesem Moment hämmerte ihr Herz so wütend los, daß ihr die Worte im Hals steckenblieben. Und jetzt mußten sie sich trennen. Tove würde in einem Pub in Wiltshire stehen und den Bauern Bier ausschenken. Wie es möglich sein sollte, auf den Beinen zu bleiben, wenn der Zug mit Tove abfuhr, war ein ungelöstes Rätsel.
Solche Rätsel dürfte es in meinem Leben nicht geben, dachte Inger, aber es hatte sie immer gegeben. Immer kam ein Mädchen und machte ihr weiche Knie. Ihre Haut wurde lebendig, und ihre Gedanken waren hundertmal schneller als vorher und wirbelten mit den ausgefallensten Ideen durcheinander. Wenn nur Tove geschehen wäre und sonst keine andere, wäre die Katastrophe vielleicht nicht so groß. Aber so war es ja nicht. Nein, nein und abermals nein. Sie brauchte nur über all die neuen schwarzen Mützen hinwegzublicken, und sie wußte, daß dort Beate Halvorsen und Elsa Tøgern und Jorunn Johansen standen, und sie waren geschehen, allesamt, jede auf ihre Weise, nicht gleich gewaltig, nicht gleich lange, sie waren so verschieden geschehen, wie ihre Gesichter waren, ihre Stimmen und ihr Lachen, sie war ganz einfach unverbesserlich verrückt auf Mädchen. Idiotisch, das war das Wort, das Fredrikstadwort, das sich auf die Katastrophe anwenden ließ und das alle verstehen würden, und wenn sie es gehört hätten – all diese Menschen, die ihre Welt ausmachten –, dann hätten sie gekotzt. Daran gab es keinen Zweifel.
Sie selber kotzte nicht. Sie mußte mit der Schönheit leben, die diese Mädchen waren. Sie hatte ein gutes Abitur gebaut. Sie konnte machen, was sie wollte, und sie konnte nur eines machen, nämlich in die Welt ziehen und hoffen, daß die Mädchen verschwinden würden.
Alle stehen auf der Phönixtreppe in Fredrikstad. Sie hoffen. Sie denken. Sie werden die Stadt verlassen, die sie großgezogen hat, die Stadt, der sie alles schulden. Aber so denken sie nicht. Sie finden nicht, daß sie irgendwem irgendwas schulden. Sie haben nicht darum gebeten, geboren zu werden. Es ist ihnen einfach passiert. In Fredrikstad, im St. Josefs-Hospital sind sie auf die Welt gekommen, fast alle. Und sie schulden niemandem etwas. Sie stehen da und lächeln. Sie werden schließlich fotografiert.
Sie stehen da und hoffen, daß sie auf dem Bild gut aussehen werden. Daß sie flott aussehen werden. Daß sie genau so aussehen werden, wie sie sind. „Hallo, Leute!“ sagt der Fotograf. Und alle sehen ihn an und hoffen, daß das Bild ihre Schönheit und Klugheit ausstrahlen wird.
Es wird ein klares und flottes Bild. So klar und flott wie alle anderen Bilder, die nach jedem Abitur auf der Phönixtreppe in Fredrikstad aufgenommen worden sind. Es wird bei Fotograf Sollem für alle ausgestellt, die sich die Mühe machen, im Vorbeigehen stehenzubleiben und hinzuschauen, die sich zum Fenster vorbeugen, die Augen zusammenkneifen und sagen: „Ach, das ist sie ja!“ oder „Aber da ist er ja! Siehst du? Da rechts, in der zweiten Reihe von oben! Das habe ich ja immer gesagt – dieser Junge, der hatte was Besonderes.“
Für andere, die vorbeikommen und niemanden in diesem Jahrgang kennen, gibt es nichts Außergewöhnliches zu sehen. Einfach noch ein Jahrgang von Köpfen unter schwarzen Mützen. Seltsam, wie gleich sie alle aussehen, Jahr für Jahr, abgesehen davon natürlich, daß es Jungen und Mädchen sind.
Und manche bleiben stehen und denken: Da hätte ich stehen sollen!
Inger hatte immer gewußt, daß sie dort stehen würde. So sicher, wie es im Winter auf Wiesebanen Schlittschuheis und im Frühling in Rødskogen Leberblümchen geben würde, so sicher war auch, daß sie eines Tages Abitur machen würde. Und jetzt kam der Sommer, und an seinem Ende wartete keine Schule mehr. Sie fuhr mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester Ellen nach Tjøme, wie immer, dort gab es Meer und Felsen, und sie hatte keine Ahnung, was sie werden sollte. Das lag daran, daß sie wußte, sie würde Schriftstellerin werden.
„Was willst du werden?“ fragten alle. Werden, werden, werden. Immer redeten sie von „werden“. „Ich bewerbe mich um ein Lehramt in Karasjok und Kautokeino“, sagte sie, denn sie hatte gerade entdeckt, daß es eine Zeitschrift gab, in der Stellen ausgeschrieben waren, und daß darin Karasjok und Kautokeino vorkamen. „Das wird mein Militärdienst, schließlich darf ich mein Land sonst nicht verteidigen, wegen meines Geschlechts.“ Das war blödsinnig. Das Militär war auch blödsinnig, keiner der Jungen wollte hin. Aber das machte das andere nicht weniger blödsinnig. Sie bekam keine Antwort, weder aus Karasjok noch aus Kautokeino. „Dann nicht. Dann müssen sie eben ohne mich zurechtkommen“, sagte sie. Oder: „Eines schönen Tages werde ich mich wohl als Schlagersängerin durchschlagen.“ „Du, Inger“, fragte Liv Mo, „wenn du eine berühmte Schauspielerin bist und ich mit Blumen komme, versprichst du mir, mich dann noch zu kennen?“
Das Seltsame war, daß sie erwarteten, sie würde sich schon durchschlagen. Egal, als was. Und sie witzelte sich durch die Zukunftsmöglichkeiten hindurch. „Vielleicht werde ich Journalistin.“ „Journalistin“ war das Wort, das sie statt „Schriftstellerin“ verwendete. Denn die Hoffnung war so groß, daß sie sie zusammen mit der Katastrophe in ihrem Herzen versteckte.
Als Schriftstellerin würde sie „Kristin Lavranstochter“ schreiben, „Anna Karenina“ und „Meuterei auf der Bounty“, und sie würde ein Buch schreiben, das „Tausend Kessel“ hieß und das sie noch nicht gelesen hatte. Sie würde auch gern „Ruf der Wildnis“ von Jack London schreiben und die Auswandererbücher von Moberg, vor allem „Bauern ziehen übers Meer“. „Bauern ziehen übers Meer“ war das schönste von allen Büchern, die sie schreiben würde.
Um alle diese Bücher schreiben zu können, mußte sie weg. In Fredrikstad hatte sie nichts erlebt, worüber sie schreiben könnte, es war entweder so öde, daß sie längst eingeschlafen wäre, noch ehe sie halb fertig war, oder so entsetzlich, daß sie es nicht erwähnen konnte. Ein Roman war in seinem Wesen das genaue Gegenteil von Fredrikstad.
Eines Tages kam Evelyns älteste Schwester, Solveig, in ihren roten Gewändern mit einer Zeitung über den Hof geflattert. „Hier“, sagte sie und zeigte auf eine Annonce. „Edinburgh Family of six wants au pair for a year. Write to: Mrs. Mayfield, 6, Aberdeen Road, Edingburgh 5. 1 £ a week.“
Inger starrte die Anzeige an. Das Zeichen £ war beeindrukkend. „Aber ich kann Hausarbeit nicht ausstehen!“ sagte sie.
„Das macht doch nichts“, erwiderte Solveig, die selbst die seltsamsten Arbeiten verrichtet hatte, in Europa und in Amerika, einfach, um die Welt zu sehen. Inger sah ihre Tante skeptisch an. „Du kommst raus! Und das wirst du nie bereuen!“
Inger schrieb, sie heiße Inger. Sie sei achtzehn, ihre Hobbys seien Gitarre spielen, schreiben und lesen, und Hausarbeit könne sie nicht ausstehen. Yours sincerely, Inger Holm. Dann wartete sie voller Spannung darauf, daß das Leben endlich geschah.
Schließlich kam ein Brief. Mrs. Mayfield schrieb, sie sei sorry, weil Inger Hausarbeit nicht möge, aber es handle sich auch nur um light housework, und sie könne drei oder vier Abende die Woche The Royal High School besuchen und sonntags in The Scandinavian Church in Leith gehen. (Die glaubt doch tatsächlich, ich würde in die Kirche gehen!) Here’s our family.
Ein kleines Bild von the family war beigelegt. Die bestand aus Mr. und Mrs. Mayfield, dem zwanzigjährigen Glen, der achtzehnjährigen Sheila, dem vierzehnjährigen Duncan und dem sechsjährigen Adam. Die beiden jüngeren Söhne schienen eine Art Uniform zu tragen. Sheila hatte ein Sommerkleid an und ein ganz winziges Verkäuferinnenlächeln. Inger beugte sich über das Bild und betrachtete es genau, und plötzlich wußte sie, daß dieses Mädchen – diese unbekannte Schottin auf dem winzigen Bild – ihre neue Katastrophe sein würde.
Evelyn und Inger saßen auf dem Felsen, die Möwen jagten hin und her, und Mama grauste sich vor Ingers Abreise. „Du bringst soviel Leben ins Haus!“ sagte sie. Aber sie sagte auch: „Wenn du Jahr für Jahr am selben Ort wohnst, ist ein Jahr wie das andere. Aber im Ausland ist immer alles neu, und du bekommst eine Quelle, aus der du später immer wieder schöpfen kannst.“
Sie hatten gebadet, ihre Beine waren sonnenbraun, und Inger hatte Evelyns schlanke Beine geerbt. Daß sie ansonsten nicht so schlank war, hielt Mama ihr nie vor. Sie sagte: „Wart nur ab! Wenn du dich verliebst, dann wirst du dünn!“
Das war ihr nämlich passiert, und auch ihrer Schwester Lisa war es immer so gegangen. Dünn und verliebt. Mama sprach über das Ausland. Sie erzählte von damals, als sie jung und verliebt war. Ehe Papa auftrat. Inger kannte Mamas ganzes Leben. Mama mit vierzehn Jahren, lachlustig und voller Hemmungen, die sich unter dem Tisch in der Ris-Schule mit ihrer besten Freundin, Ragnhild, traf, während die Lehrerin sich den Kopf zerbrach, wo sie denn wohl steckten. Mama mit fünf Jahren, ein bißchen zu dick und mit einem blonden Pony, als sie nur deutsch sprechen und das norwegische L nicht zustandebringen konnte. Und dabei brauchte sie es dringend, denn sie lernte bald, daß sie „Selber dick“! rufen mußte, wenn jemand „Dicke!“ zu ihr sagte. Aber das schaffte sie nicht. Mama war immer in Deutschland gewesen und hatte als Kind Heimweh. Aber ihre Mutter, Emilie, hatte gesagt, sie würden jeden Tag um zwölf Uhr aneinander denken. Deshalb dachte Mama jeden Tag um zwölf Uhr an Emilie, die sich vielleicht in Italien befand oder in Oslo, jedenfalls viele Meilen weit weg, und jeden Tag um zwölf Uhr dachte Emilie an Mama, egal, wo sie war.
Inger wußte auch jetzt, wie es war, Mama zu sein. Sie war gefesselt und gefangen. Sie war nervös. Aber Papa machte sie noch nervöser. „Nerven?“ fragte Mama, als sie jung war. „Was ist das?“ Aber dann heiratete sie Papa. Das war 1937 in Potsdam, und es kam dazu, weil Papa dafür gesorgt hatte, daß Helga unterwegs war. Das Schlimmste in Mamas Leben war, daß sie Helga verloren hatte. Das war auch das Schlimmste in Ingers Leben. Inger wußte nicht mehr, wie oft sie die fünf Tage durchgegangen waren, vom Samstag, als Helga krank wurde und alle dachten, es sei eine Sommergrippe oder vielleicht Mumps, bis zum frühen Donnerstagmorgen, dem 27. September 1951, als sie an Kinderlähmung gestorben war.
Helga war im Felsen. Darin, wie er sich rundete, nur darin. Sie war in den herumjagenden Möwen und in den Gletschermühlen auf der anderen Seite der Bucht. Nirgends war sie so sehr in allem wie hier. Das wußten sie beide, als sie dort saßen. Sie konnten es sagen oder darüber schweigen. „Weißt du noch, wie sie dahinten beim Eisenbolzen stand und die Hüften schwenkte und sang: Tarara pompia!“ Und dann lachten sie. Helga war witzig. Es war vielleicht ein bißchen seltsam, über sie zu lachen. Aber Helga wußte doch nicht, daß sie in all den vielen Jahren die Schwester sein würde, die gestorben war.
Und jetzt verliert Mama auch mich, dachte Inger. Aber ich sterbe ja schließlich nicht. Obwohl auch das nicht sicher ist. Denn schon mit zehn Jahren wußte Inger, daß man jederzeit sterben konnte. Und sie kam gar nicht auf die Idee, sich davor zu fürchten. Sie würde nur dorthin kommen, wo Helga war, und sie war doch immer schon hinter Helga hergetrottet. Daß andere sterben könnten, davor hatte sie sich seit damals allerdings immer gefürchtet.
„Warst du eigentlich noch nie verliebt?“ fragte Mama.
Die Frage kam so plötzlich. Sie hatten lange still gesessen. Mamas Frage. Sie war nah und warm.
Inger hatte immer gewußt, daß diese Frage kommen würde. Eines Tages. Eines Augenblicks. Dieser Augenblick war jetzt. Jetzt, und nicht ein anderes Mal.
Ihr Herz hämmert: Ich muß antworten. Der Felsen ist rund und glatt, sie sehen auf die Schären. Inger sieht nicht dorthin, wo Mama ist. „Meinst du etwa, ich wäre ganz und gar gefühllos?“ fragt sie. „Aber nicht doch“, wehrt Mama sofort ab. Denn das glaubt sie ja nicht. Das glaubt sie wirklich nicht.
Aber Inger hat geantwortet, und mehr antwortet sie nicht. Sie spürt Mamas Sehnsucht, und sie denkt: Ach, Mama! Du hättest Helga behalten sollen! Was bin ich für eine Tochter, wenn ich das nicht beantworten kann? Das Schlimmste, was mir passieren kann, weißt du, was das ist? Daß ich mich von Tove verabschieden muß. Aber die Worte – die unglaublich schlichten Worte – wollen nicht heraus.
Der August ist von Abschieden erfüllt. Und bei jedem wird die Stadt unwirklicher. Fredrikstad wird der Inhalt des Lebens entzogen. Da steht sie tatsächlich, zusammen mit einigen anderen, die noch nicht losgefahren sind, auf dem Bahnhof, um einen Zug abfahren zu sehen, und gegen jedes Naturgesetz tragen ihre Beine sie. Wann wird sie sie wiedersehen? Wann wird irgendwer irgendwen wiedersehen? Niemand weiß es; allen Versicherungen zum Trotz, daß sie immer befreundet sein wollen, wissen sie, daß die Welt in Wirklichkeit schrecklich groß ist. Aber was ist sie? Und was wird jetzt ihr Inhalt sein, wo wir nicht mehr ihr Inhalt sind?
Bei diesen Abschieden wird nicht geweint. Junge Menschen weinen nicht. Die Beine, auf denen sie stehen, weinen. Aber das sieht niemand.
Inger wird am 26. September abfahren. Dieses seltsame Datum rückt näher. Das hat zwar jedes Datum bisher getan. Aber dies hier ist ganz und gar unwirklich. „Ich kann gar nicht an diesen Tag denken“, sagt Evelyn.
Ørnulf dagegen sagt nichts. Wenn er seine Tochter schon in die Welt hinausschicken muß, dann wenigstens erster Klasse. Sie haben eine kleine Broschüre von Fred. Olsens Reederei mit einer Querschnittzeichnung der M/S Blenheim. Alle Kabinen sind Vierecke in verschiedenen Farben, die die Klassen kennzeichnen. Die erste Klasse ist rot, aber auch hier gibt es unterschiedliche Schattierungen, die Preis und Qualität ansagen. Das dunkelste Rot kann er sich nicht leisten. Im hellsten Rot will er sie aber auch nicht fahren lassen. Darin fahren alle, die es sich nur ganz haarscharf leisten können, fein zu sein. Inger sitzt auf seinem Schoß, sie studieren die Broschüre. Er zeigt auf ein Viereck. „Hier!“ sagt er. „Wir buchen eine Überfahrt in der zweitbilligsten ersten Klasse!“ „Kannst du dir das denn leisten?“ „Ja“, nickt er großartig.
Eines Tages ruft er sie ins Wohnzimmer. Evelyn sitzt schon bereit. „Inger“, beginnt Papa, und seine Stimme klingt feierlich. „Wir haben uns etwas überlegt.“ „Ja? Und was denn?“ „Daß Mama und ich uns dich nicht ohne Schreibmaschine vorstellen können.“
Ein Abschiedsgeschenk? Inger blickt vom einen zur anderen. Dann lacht sie. „Spinnst du vielleicht, oder was?“ „Ich habe bei Kontor-Service angerufen“, antwortet Papa stolz. „Du kannst hingehen und dir eine aussuchen.“
Inger entscheidet sich für eine kleine Royalite-Reiseschreibmaschine, glänzend und hellgrau, mit weißen Tasten und einem hellbraunen Lederkoffer. Sie nimmt sie in die Hand. Trägt sie zur Zollstation. Die Schreibmaschine muß plombiert werden. Sie erhält ein kleines rundes Plombierdings. „Gute Reise nach Edinburgh“, wünscht der Zollbeamte. Gute Reise, gute Reise! sagen alle. Als sie oben in Lillians Wohnung steht, erscheint Lillians große, dünne Mutter in der Tür und sagt das auch. Sie ist immer ein bißchen streng gewesen, diese Frau Oppegaard. Als sie aber jetzt dasteht und gute Reise wünschen will, hat sie Tränen in den Augen.
Es ist seltsam. Sie weinen. Fredrikstad weint.
Ørnulf und Evelyn veranstalten ein Abschiedsfest für ihre Tochter. Das Fest findet im Gesellschaftsclub Phönix statt, hinter der ehrwürdigen Treppe, auf der das Bild aufgenommen worden ist. Obwohl schon viele abgereist sind, sind immer noch genug übrig, um „Auf Wiedersehen“ zu sagen.
Inger denkt: Das ist mein Fest! Ich kann tanzen, mit wem ich will. Und ich will mit Sigvart Jespersen tanzen. Er ist ein Herzensbrecher. Das Problem ist nur, daß er mein Herz nie brechen wird. Trotz der Katastrophe, die sie in ihrem Herzen trägt, auch auf diesem Abschiedsfest, hofft Inger auf einen Jungen. Sie hat immer auf einen Jungen gehofft. Sie weiß, wenn er kommt, ist die Katastrophe getilgt.
Und sie hat Sigvart im Bassin nicht vergessen. Er hatte gewettet, er würde in den Sperlingsbrunnen auf dem Floraplatz springen, wenn er die Französischprüfung bestünde, und das hat er gemacht. Sie hat auch ein Ereignis auf Grusbanen nicht vergessen. Sie waren gerade in dieselbe Klasse gekommen, und er trug ein weißes Hemd und war aus Trara. Halb Fredrikstad hatte sich auf Grusbanen versammelt, weil ein Fakir mit brennender Flamme in eine Wassertonne springen wollte. Da kam Sigvart auf einem grünen Fahrrad. Er hielt mit quietschenden Bremsen genau vor ihr. „Hast du die Matheaufgaben schon gemacht?“ fragte er.
Warum sie sich daran erinnerte, nach so langer Zeit, fragte sie sich. Aber sie nahm an, daß sie sich mehr von diesen Erlebnissen erhoffen müßte, wenn sie in die Welt ziehen und auf einen Jungen hoffen wollte. Später hatte sie ihn auch bekommen. Sie hatten sich an kalten Herbstabenden in Lykkebergparken hinter der Blauen Grotte umarmt. Er war warm und groß. Sie lagen mit einer ganzen Clique aus St. Croix und Trara auf dem Rasen, die anderen hatten auch gerade in diesem Herbst zueinander gefunden. Und als Sigvart mit einer 2 in Französisch triefnaß aus dem Sperlingsbrunnen gestiegen war und sich bei Frau Olsrud, der obersten Moralwächterin von Flora, hatte entschuldigen müssen, waren die Gefühle wieder aufgeflammt. So gehört sich das, dachte Inger und hoffte auf Sigvart, und da kam er auch schon auf sie zu. „Ein letzter Tanz?“
Sigvart und Inger tanzten. Sie sangen „I could have danced all night“ und sahen einander mit all den gemeinsamen unausgesprochenen Erinnerungen in die Augen. Weißt du noch, wie der Fakir in die Tonne gesprungen ist?
Ørnulf sieht ein ganz anderes Schauspiel. Er sieht Inger in den Armen des Herzensbrechers der Klasse, er sieht ihre muntere Willigkeit, und er wird wahnsinnig. Er stürzt durch den Saal, steif in seinem Suff. „Hört auf damit!“ ruft er.
„Aber Papa! Wir tanzen ja bloß!“ Doch das stimmt nicht ganz. „Komm“ sagt Ørnulf. „Ich will dir etwas zeigen.“
Er geht mit Inger nach draußen. „Da!“ sagt er. Da ist der Mond. Er steht gelb und rund über dem weißen Holzbau der Methodistenkirche. Papa schwankt hin und her. Er ist sturzbetrunken, ein seltener Anblick, denn an sich trinkt er jeden Tag sehr viel. Aber jetzt ist es ihm gelungen, das zu werden, was er „knatschbesoffen“ nennt, und er zeigt Inger den Mond.
Sie stehen da und betrachten den Mond, und Inger weiß, daß er nicht aussprechen kann, was ihm jetzt so zusetzt. Denn er ist eifersüchtig wie ein Ehemann, und Inger weiß, daß Papa dazu nur sagen kann: „Da ist der Mond!“
Er tut ihr leid, wie er so dasteht. Er hat sie lieb, schon seit er sie zum erstenmal in der Klinik in Josefinegaten gesehen hat. Danach ging er mit Frank, seinem besten Freund, in die dunkle Kriegsnacht hinaus, und draußen blieb er stehen und betrachtete Franks Fußspuren im Neuschnee. In diesen Spuren lag Papas Liebe zu Inger, und in diesen Spuren lag auch Ingers Liebe zu Papa. Nie vergaß sie die Spuren und was sie bedeuteten, obwohl sie in der Klinik gelegen hatte und eben erst geboren war. Aber jetzt sagt Papa: „Du mußt eines wissen: An dem Tag, an dem du mir einen Schwiegersohn vorstellst, schlag’ ich ihn zu Brei.“
Das hat er schon oft gesagt, aber jetzt sagt er es dem schönen Mond über der Methodistenkirche. Niemand konnte das Wort „Schwiegersohn“ mit tieferer Verachtung in den „s“ aussprechen als Papa. Und das Kerngehäuse, das er unter dem Bett im Schlafzimmer fand, in dem sie während ihres Sturmfreie-Bude-Festes gelegen hatte, hatte er auch nie vergessen. Sie war da mit Mofa gewesen, aber das wußte Papa doch nicht, und wieso dabei ein Kerngehäuse übrigbleiben konnte, hatte sie nie begriffen. „Sigvart ist kein Schwiegersohn, Papa“, sagt Inger. „Er ist ein Rotzbengel“, antwortet Papa.
Inger wird wütend. Sie kann fast so wütend werden wie Papa, und sie geht sofort wieder hinein und küßt Sigvart. Sie gehört zum Henker nochmal nicht Papa, und er kennt Sigvart nicht, und er hat überhaupt keine Ahnung, ob Sigvart ein Rotzbengel ist oder nicht, und ihr ist das schnurz. Er soll sich bloß nicht einbilden, er könnte hier kommandieren. Nein. Sie finden einen Vorhang. Hinter dem Vorhang küssen sie sich noch einmal. Es ist schön, und Papa geht das nichts an, und dann tanzen sie weiter, und Inger ist weiß Gott auch nicht nüchtern. Niemand ist nüchtern, Ørnulf am wenigsten, und jetzt kommt er angestürzt, packt Sigvart am Arm und stößt ihn mit großem Schwung beiseite. Sigvart rutscht aus, weicht zurück. „Verschwinde, du Rotzbengel!“ ruft Ørnulf.
Sigvart verschwindet. Er geht in die Garderobe und holt seine Jacke, aber Ørnulf rennt hinterher. „Verschwinde, du Rotzbengel!“ wiederholt er und geht mit hinaus auf die Treppe. Dort, auf der obersten Treppenstufe bleibt Sigvart zögernd stehen. „Immer mit der Ruhe“, murmelt er. „Verschwinde, du Rotzbengel!“ ruft Ørnulf noch einmal und stößt ihn die Treppe hinunter.
Das war das Schauspiel, dessen Zeugin die Phönixtreppe drei Monate nach dem historischen Bild werden sollte. Die Grüne Minna kommt. Alle Gäste in ihren dünnen Festkleidern stehen auf der Treppe. Sigvart ist verschwunden. Die Polizisten überqueren die Straße. Ørnulf tritt an den Kantstein und blickt auf sie herab. Er schwankt. „Wir sind gerufen worden“, sagen die Polizisten. „Ich bin Dr. Holm“, erwidert Ørnulf ruhig. „Hier soll eine Schlägerei stattgefunden haben“, sagen die Polizisten. „Hier hat es keine Schlägerei gegeben!“ antwortet Ørnulf.
Die Polizisten blicken zu den Festgästen hoch, hinüber auf Fergestedsveien und schließlich in den Rinnstein. „Na gut“, sagen sie, legen die Hand an die Mütze und verschwinden in ihrer Grünen Minna.
Aber dann passiert etwas Merkwürdiges. Mofa tritt vor. Er ist ziemlich kurzgewachsen, und er stellt sich dicht neben Ørnulf an den Kantstein, ballt die Faust unter Ørnulfs Kinn und zischt: „Jetzt bitten Sie Ihre Tochter um Entschuldigung!“
Das ist gegen sämtliche Regeln. Die Jungen haben den Vätern Platz zu machen. Sie haben sich zu verbeugen und zu grüßen. Wenn sie kommen, sollen sie sich schweigend über Hintertreppen schleichen und im Gebüsch verstecken. Ørnulf blickt auf Mofa herab. Er schwankt. „Holm!“ zischt Mofa wieder, rot im Gesicht. „Jetzt bitten Sie Ihre Tochter um Entschuldigung.“
Ørnulf weicht zurück. Er geht ganz einfach, ohne ein Wort. Die Treppe hinauf und in den anderen Teil des Lokals, zu Evelyn. Sie ist schon vor einiger Zeit rübergegangen und weiß nichts von dem Vorfall. Dorthin torkelt er. Das Abschiedsfest ist vorbei.
Alle haben diesen entsetzlichen Auftritt gesehen. Aber niemand sagt etwas. Jetzt haben alle gesehen, wie Papa ist. In all den Jahren hat sie das verschwiegen. Sein ewiges Trinken und seine Streitsucht in den Nächten und Mamas Weinen über seine Tyrannei. Es war etwas, das nach drinnen gehörte. Ins Innere von allem, von dem alle in Fredrikstad wußten. Und nun war es herausgekommen – auf der Treppe, am Herbstabend, und der Streifenwagen kam und verschwand wieder. Hier gibt es keine Schlägerei.
Und ganz plötzlich geht Inger auf, was es bedeutet, auf dieser Welt Dr. Holm zu sein und nicht Jens Jensen. Jens Jensen säße jetzt nämlich in der Ausnüchterungszelle.
Inger schämt sich, sie schämt sich für Sigvart vor den anderen, und sie schämt sich vor Sigvart. Sie schreibt ihm einen Brief und bittet für ihren Vater um Entschuldigung. Danach schämt sie sich auch deshalb.
Sie begegnen sich zufällig vor der Blauen Grotte und umarmen sich. Jetzt sind wir erwachsen! denkt Inger. Hier stehen wir am hellichten Tage und umarmen uns zum Abschied. Aber sie sprechen nicht von dem, was passiert ist. Und sie schämt sich noch immer. Das einzige, was ihre Scham wegwaschen kann, sind Mofas Worte: „Jetzt bitten Sie Ihre Tochter um Entschuldigung!“
Und das tut Ørnulf.
Sie machen auf Kråkerøy einen langen Ausflug in seinem neuen Austin Cambridge. Er ist eifrig, zeigt ihr den Rückwärtsgang. „Du ziehst zuerst die Gangschaltung gerade heraus und preßt sie dann dicht neben dem Lenkrad nach unten. Versuch’s mal!“ sagt er.
„Ich weiß, daß ich schwierig bin. Aber einen anderen Vater bekommst du nicht“, sagt er.
So entschuldigt er sich bei Inger, die nicht weiß, ob sie diese Entschuldigung annehmen kann. Er hat ihr ein entsetzliches Abschiedsfest bereitet. Zum erstenmal wird die Wahrheit ihrer Kindheit in ihr erschüttert.
„Ich habe ihn nicht mehr lieb, Mama, wenn er sowas macht!“
Evelyn stutzt. „Doch, du hast ihn wohl lieb? Aber Liebe kann zerbrechen!“ sagt sie plötzlich.
Was soll ohne mich aus Mama werden? denkt Inger. Wie soll es mit Mama und Papa im Wohnzimmer werden?
In diesem Moment sieht sie Ellens kleines Overallhinterteil mit einem Köfferchen durch die Tür der Abstellkammer verschwinden. Dahinter sitzt Tone aus dem zweiten Stock, mit der Ellen jeden Nachmittag spielt. Sich von ihrer kleinen Schwester zu verabschieden, ist das Schlimmste von allem. Immer trottete sie hinter Inger her, so wie Inger früher hinter Helga hergetrottet war. Jetzt hört sie drinnen Ellens Stimme. „Auf Wiedersehen, Kleine-Bah! Hüte das Haus, solange ich weg bin.“ – „Auf Wiedersehen, Große-Ba. Kaufst du mir was Geheimes, wenn du weg bist!“ fragt Tone.
Das ist die Welt, die Inger verläßt. In dem Herbst, als die M/S Blenheim sie davonträgt, wird sie neunzehn. Wohin sie unterwegs ist, ahnt sie so wenig wie die Bauern, die übers Meer zogen. Sie weiß, daß sie lernen muß. Und sie weiß, daß sie weg muß. Zu ihren Füßen an der Reling steht eine kleine, hellbraune Schreibmaschine.
Das Paar auf dem Fred. Olsen-Kai wird immer kleiner. Er steht da mit grauen Hosen und braunen Schuhen, einer Jacke in einem anderen Grauton, barhäuptig. Sie trägt eine halblange gelbe Jacke mit großen Taschen, ein großgeblümtes Sommerkleid, hochhackige, weiße Schuhe und einen Kamm in ihrem dunkelbraunen Haar. Dicht beieinander stehen sie, abseits von den anderen Winkenden. Niemand ist so barhäuptig, wenn er keinen Hut aufhat, wie Papa. Sein Schädel ist blank und von einem dunklen Kranz umgeben, und auf dem Schädel liegen drei schwarze Haare.
Inger unterdrückt die aufsteigenden Tränen. Sie wird ganz wirr im Kopf vom Weinen, das gezähmt werden muß. Innen zittert alles. Wie klein sie werden. Wie schrecklich klein.
Ein fremder Passagier mit Schirmmütze und Kniebundhosen steht neben ihr. Er sieht eine winkende junge Frau in blauer Matrosenjacke. Das Paar am Ufer wird immer kleiner, bald ist es nur noch ein gelber Punkt. Inger nimmt ihren großen, bunten Seidenschal und winkt dem Punkt zu. Sie bemerkt den Passagier neben sich. Was weiß der schon, denkt Inger.
Abschied
Beim Abschied brach Evelyn in Tränen aus. Sie war entschlossen gewesen, das nicht zu tun, aber sie schaffte es nicht. Durch die Tränen sah sie Ingers Gesicht, erschrocken und verwirrt – und einen kurzen, klaren Moment sah sie dasselbe Gesicht vor neun Jahren, an einem frühen Herbstmorgen, und Ingers Stimme sagte: „Mama, was ist los? Was ist los?“ Und sie konnte nicht antworten.
Helene hatte damals geantwortet, Ørnulfs Mutter. Hatte ihrer Enkelin die Hände auf die Schultern gelegt und die Worte ausgesprochen, die Evelyn nicht über die Lippen brachte: „Helga ist eingeschlafen.“
Das fiel Evelyn jetzt ein, und eine alte Trauer stieg hoch und vermischte sich mit der neuen. Das Schiff war nun schon so weit entfernt, daß sie die einzelnen Passagiere nicht mehr unterscheiden konnte. Dennoch standen sie da und blickten ihm nach, Ørnulfs Körper dicht an ihrem, seine Gedanken ebenso dicht, fast physisch, auch sie.
Evelyn war immer froh darüber gewesen, daß Inger kein Junge war. Denn dann hätten sie und Ørnulf nicht im selben Haus sein können, und sie wäre viel früher gegangen. Inger hatte sein hitziges Temperament geerbt. Und da war es gut, daß sie nicht auch noch seine Muskelkraft geerbt hatte. Sie spürte sie jetzt, als er sie in den Arm nahm, Geborgenheit. Wenn er sich nur darauf beschränken wollte, seine Kraft so zu verwenden!
Aber er hatte einen merkwürdigen Drang, beweisen zu wollen, daß er souverän war. „Ja, wir wollen hier eigentlich kein Zelt aufschlagen“, sagte er traurig, in einem Versuch, sie aufzumuntern. Sie entdeckten plötzlich, daß außer ihnen niemand mehr an der Landungsbrücke stand. Evelyn lachte, stellte sich auf die Zehen und küßte ihn auf den Mund.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!