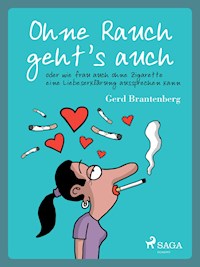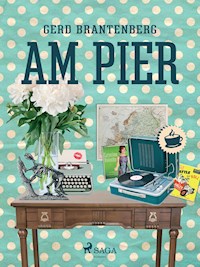
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der fünfziger Jahre in Norwegen.Inger kommt aufs Gymnasium, sie fühlt sich in der neuen Umgebung einsam und elend. Aber dann trifft sie Beate, und alles ist gut. Aber Beate ist ein uneheliches Kind, und es wird allgemein missbilligt, dass ihre Mutter, die alle 'Fräulein Halvorsen' nenne, ihre Tochter aufs Gymnasium schickt; ein uneheliches Kind ist eine Katastrophe. Und dann gibt es Hartvig. Hartvig ist von einer frommen Familie adoptiert, und er möchte wissen, wer seine biologischen Eltern sind. Er entdeckt, dass sein Vater ein deutscher Soldat war. Kinder von deutschen Soldaten und Kinder von Kollaborateuren waren zu wer Zeit elend dran. Der fünfziger Jahre: Alle hören Catarina Valente und Bill Hailey; Aufklärung, Verhütung und Abtreibung gibt es nicht; und den Mädchen wird vom naturwissenschaftlichen Zweig abgeraten, weil Frauen für Mathematik nun mal ungeeignet sind. Ein präzises, witziges Zeitbild der fünfziger Jahre, kommentiert vom Chor der Kellnerinnen des Restaurants im Erdgeschoß von Ingers Haus - sie haben den Klatsch der ganzen Stadt im Kopf und eine Meinung zu allem, was geschieht.AUTORENPORTRÄTGerd Brantenberg, geboren 1941 in Oslo, wuchs in der norwegischen Kleinstadt Fredrikstad auf. Sie studierte Englisch, Geschichte und Staatswissenschaft und arbeitete ab 1971 als Lehrerin.Von Anfang an beteiligte sie sich aktiv an der neuen Frauenbewegung in Oslo und Kopenhagen, rief die lesbische Bewegung Norwegens ins Leben, was Mitbegründerin des Krisenzentrums für misshandelte Frauen in Oslo und einer homosexuellen LehrerInnengruppe. 1978 gründete sie ein literarisches Frauenforum, das Frauen zum schreiben und Veröffentlichen ermunterte. 1986 war sie Mitorganisatorin der Zweiten Internationalen Frauenbuchmesse in Oslo.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd Mjøen Brantenberg
Am Pier
Saga
Erster Schultag
Schon seit vielen Jahren gingen die Jugendlichen durch die Stadt. Mit großen Schultaschen, die sie in der Hand trugen oder sich über die Schulter warfen, gingen sie in Gruppen, mit Fahrrädern, mit denen sie nicht fuhren, durch Fergestedsveien und durch Nygaardsgata, in einem großen Strom, um zwei Uhr. Jeden Tag. Sie redeten und gingen. Und wenn einige von ihnen doch fuhren, fuhren sie im Gehtempo neben denen her, mit denen sie redeten. Einige von ihnen waren fast schon Damen. Und am Ende machten sie das Abitur.
So war es schon seit vielen Jahren. Die Jugendlichen bekamen es nie über, auf die immer gleiche Weise um zwei Uhr durch die Straßen zu gehen oder langsam zu radeln und die Stadt zu füllen. Jetzt würden sie auch so sein. Jetzt würden auch die Kleinen aus der Volksschule ihre Ranzen an den Nagel hängen und sich in langsamen Gruppen auf den Straßen unterhalten.
Sie gehen durch das hohe gewölbte Tor in die Gebäude, in die die Jugendlichen gehören, das alte gelbe Haus mit Treppengiebel gegenüber dem Pier und das neue graue langweilige Gebäude nebenan. Es ist warm, die Sonne scheint auf den Asphalt, an allen ersten Schultagen sind fünfundzwanzig Grad im Schatten. Wieder sind sie die Kleinsten.
Von den dreiundzwanzig Mädchen, die vor den Sommerferien die Schule von St. Croix verlassen hatten, begegnen sich nun elf wieder. Sie drängen sich zusammen und warten. Alle anderen verschwinden in Türen und auf Treppen des gelben Gebäudes und des Neubaus und wissen, wohin sie gehören. Sie selber bleiben stehen und warten ab. Alle aus Trara auf einem Haufen, alle aus Gamlebyen, Seiersten, von überallher und sogar vom Land stehen und warten; sie wagen nicht, einander anzusehen, sehen nur hin, wenn die anderen das nicht merken, damit sich ihre Blicke nicht begegnen müssen. Die Jungs aus Trara sind so groß!
Der Rektor erscheint mit milder, ernster Miene auf der Treppe. Er wird ihre Namen verlesen. Und sie in sechs Klassen von A bis F einteilen. Er hält ein Blatt Papier in der Hand und blickt über sie hinweg. Zögernd wenden sie sich ihm zu. Neben ihm stehen sechs Lehrer, sechs Studienräte, und halten in der Luft nach nichts Ausschau. Jetzt braucht niemand mehr „pst“ zu sagen. Es ist still in der heißen Sonne auf dem Hof, wo alle nur auf ihren Namen warten.
„Alle, die in die A-Klasse kommen, kommen hier herüber, wenn ich sie aufgerufen habe“, sagt der Rektor und nickt leicht zu einer unbestimmten Ecke bei der Treppe hinüber. Er ruft auf, einen Namen nach dem anderen, und bei jedem Namen verläßt jemand die dichtgedrängte Menge und geht zur Ecke bei der Treppe, wo die Gruppe wächst und wächst, bis sie zum Schluß die gesamte A-Klasse bildet. Die, die das Glück haben, schon jemanden aus dieser neuen Klasse zu kennen, lachen sich an, und einige fangen eifrig an zu reden. „Pst!“ Die ursprünglichen Gruppen werden erbarmungslos getrennt. Drei bis vier aus jeder der großen Schulen kommen in eine Klasse. Jetzt verschwinden Lillian Oppegaard und Jorunn Johansen zusammen mit einem Schwall aus Seiersten, Lahellemoen, in einer der Türen des Neubaus, und Gott weiß, ob nicht auch welche aus Tørp in Børje dabei sind, angeführt von einem Studienrat mit unvorstellbar weit auseinanderzeigenden Füßen, Aktentasche und düsterem Gesicht.
Die B-Klasse wird aufgerufen. Das Ganze wiederholt sich. Was war hier los? Waren die Gerüchte ihnen vorausgeeilt? Hatte der Oberlehrer aus St. Croix irgendwann im Laufe des Sommers den Rektor angerufen und gesagt: „Ja, hallo? Also hör mal zu. Dieses Jahr haben wir hier in St. Croix eine Mädchenklasse, die wirklich alle Rekorde in schlechtem Benehmen schlägt. Sorg dafür, daß so wenige wie möglich von denen in dieselbe Klasse kommen.“
Inger Holm wird zusammen mit einigen großen Jungen aus Trara aufgerufen. Nur Sølvi Andersen landet in derselben Klasse, und mit der hat Inger nie viel geredet. Sølvi ist vom lieben und ängstlichen Typ. Ansonsten kennt sie niemanden aus der neuen Klasse und weiß nicht, was sie sagen soll. Sie ist es gewöhnt, drauflos zu quatschen und zu lachen. Aber jetzt geht sie einfach nur mit der B-Klasse über den Schulhof und sagt kein Wort und tut so, als wäre überhaupt nichts los. Die Jungen sagen auch nichts, aber plötzlich rufen sie einander etwas zu und lachen. Inger versteht nicht, worüber. Hier gibt es nichts zu lachen.
Jetzt wird die C-Klasse aufgerufen, und darin landen nur zwei aus St. Croix. Schweigend ziehen sie davon. Kurz darauf stößt jemand ein Heulen aus. Nina Bøhmer und Liv Mo sind in dieselbe Klasse gekommen, sie umarmen sich und prusten sofort los, gehen Arm in Arm an der Spitze der D-Klasse neben einem flaschenförmigen Studienrat mit roten Haaren und unsichtbaren Augenbrauen, den sie in Englisch haben werden.
Derweil entsteht in der Ecke langsam die E-Klasse. Astrid Evensen, Marthe Rud und Vivi Strøm-Hanche landen darin. Am Ende sind neunundzwanzig übrig und bilden die F-Klasse.
Als die B-Klasse ihr Klassenzimmer im Erdgeschoß des Neubaus erreicht, stürmen die Trara-Jungen hinein und belegen die Tische am Fenster. Wer nicht rechtzeitig dort angekommen ist, läßt sich in der Nachbarreihe nieder, die Mädchen nehmen die restlichen Plätze. Siebenundzwanzig gehen in diese Klasse, zwölf Mädchen und fünfzehn Jungen.
Es ist seltsam, mit Jungen in einer Klasse zu sein. Inger ist nicht sicher, ob sie das so richtig findet. Sie geht seit sieben Jahren zur Schule. Aber sie war nie zusammen mit Jungen in einem Klassenzimmer. In St. Croix gab es getrennte Klassen. Inger sieht sie an. Sie können nicht still sitzen. Einige zuckten unaufhörlich mit den Beinen. Warum machen sie das? Inger glotzt die Beine von einem namens Sigvart Jespersen in der ersten Reihe an. Seltsam. Einige von den Jungen sind so klein, daß sie genausogut in die dritte Volksschulklasse hätten gehen können. Einer von ihnen heißt Yngve und hat eine Igelfrisur und eine rötliche Haut.
Inger sieht die Mädchen an. Ob die wohl lachen können? Ob sie mit ihnen so herumjuxen kann wie mit Astrid Evensen und Marthe Rud? Sie sehen allesamt aus wie die reinen Tugendengel. Die mit dem ärgsten Engelblick heißt Beate Halvorsen. Das wird entsetzlich werden.
Was soll sie machen? Aber sie kann nichts machen. Sie muß hierbleiben. Inger sieht ihren Klassenlehrer an und fragt sich, was sie von ihm halten soll. Er ist ein kleiner sanfter Langweiler und soll ihnen Deutsch beibringen. Er hat seinen Namen gemurmelt, aber es war nicht möglich, den zu verstehen. Hat er Ulrik gesagt? Aber so kann man doch wohl nicht mit Nachnamen heißen? Sie freut sich auf Deutsch. Sie werden eine ganz neue Sprache lernen!
Der Klassenlehrer hat eine seltsame Stellung eingenommen, er verschränkt hinter dem Kopf die Hände, als ob er dort etwas festhalten müßte. Aber dort ist nichts zu sehen, abgesehen von ein paar mit Pomade eingeschmierten Haarsträhnen, die nach oben wollen. Kein Lehrer in St. Croix hat sich je so hingestellt. Ab und zu geben seine Knie nach. Er diktiert in einem südnorwegischen Akzent den Stundenplan und teilt die Bücherlisten aus. Jetzt sollen sie einfach ruhig sitzenbleiben, dann kommen auch die anderen Lehrerinnen und Lehrer und erzählen ihnen, welche Bücher sie sich kaufen sollen, sagt er.
Und sie kommen, einer nach dem anderen. Mathematik, Englisch, Erdkunde. Ein Lehrer pro Fach! Kommen herein und stellen sich vor und reden erwachsen. Hat sich bisher jemals ein Erwachsener die Mühe gemacht, sich ihnen vorzustellen? Kommen herein und sind ihr Fach. Niemand hier kann alles. Denn das, was sie können, ist so schwierig, daß keiner mehr als ein Fach beherrscht. Rasch informieren sie über die Bücher. Søgaard und Lyche – Mathematik, Norwegisches Lesebuch für Höhere Schulen, Band I, Deutsche Grammatik, Statistische Tabellen, Skard und Midgaard – Weltgeschichte, Cappelens Schulatlas, Fjellbu – Entstehung des Christentums. Ankreuzen. Auf Wiedersehen. Manche kommen herein und öffnen die Tür nur einen Spalt breit, sehen sich um und lassen scheinbar zufällig ihren Blick durch die Klasse wandern. Ist hier die 1 B? Ja. Ach, ich dachte schon, ich hätte mich verirrt. Ich heiße Davidsen. Sich verirrt! Hat sich vielleicht irgendein Lehrer von St. Croix je verirrt? Das kann ja heiter werden.
Als sie die Klasse verlassen, fragt Inger so halb in die von Lärm erfüllte Luft hinein: „Wie heißt unser Klassenlehrer eigentlich? Ulrik?“ „Muldvig“, antwortet ein lockiger Trara-Junge, Leif heißt er wohl. „Ole Muldvig“, sagt er und blickt auf sie herab und ist fast genauso groß wie ihr Vater. Hinter ihnen kommt ein Junge mit hängenden Schultern und Brille. Offenbar will er etwas sagen, starrt aber nur in die Luft. Komischer Typ. Inger weiß nicht, wie er heißt.
Sie quetschen sich durch das große Tor und schwärmen durch Skolegata und um die Ecke zu Fergestedsveien, vorbei am weißen Holzgebäude der Seemannsschule. Sie finden einander und lachen und reden über all die Typen von Lehrern, die sie bekommen haben. Sie gehen in Gruppen und reden ununterbrochen, und plötzlich sind sie an einem warmen Sommertag die Jugendlichen geworden, die durch die Stadt wandern.
Als sie zu Hause angekommen waren, blieben Inger und Lillian vor den Schwingtüren des Restaurants Bjørnen stehen und redeten über all die seltsamen Leute, die sie jetzt unterrichten sollten. „Du hättest mal den sehen sollen, den wir in Mathe kriegen“, sagte Lillian. „Den, der die ganze Zeit aussieht, als ob er bergab geht?“ – „Ja, genau der. Waschfaß wird er genannt. Und dann die, die wir in Deutsch kriegen! Hast du die gesehen? Die ist total verrückt. Sie kam herein und hat sich als allererstes die Nase zugehalten, ist an die Fenster gestürzt, hat sie weit aufgerissen und gesagt: ‚Schtinkts, schtinkts!‘ Und als sie wieder weg war, hatte niemand kapiert, welches Buch wir kaufen sollen.“
Sie bemerkten, daß die Kellnerinnen vom Bjørnen sich hinter den hohen Fenstern drängten und sie ansahen.
„Ne, ne, jetzt stehnse wieder da und quasseln über uns, Mönsch!“ sagte Inger mit übertriebenem Fredrikstad-Tonfall. „Da stehen die Tochter von Doktor Holm und die Tochter von Zahnarzt Oppegård, und jetzt gehnse wieder zur Schule, sagense.“
„Ganz schön neugierig sindse ja, nich?“
Inger hielt sich die Hand an die Stirn und starrte zu den Kellnerinnen hinein. Die starrten mit strammen Mienen zurück und wichen nicht eine Sekunde. Inger und Lillian lachten sie an und winkten ihnen begeistert zu, erlitten dann aber einen so heißen Lachanfall, daß sie sich krümmten. „Wir sehn uns nachher“, sagte Inger. „Ja, um fünf, falls es kein Erdbeben gibt“, antwortete Lillian.
„Die sind ja vielleicht groß geworden“, sagte im Restaurant Iversen zu Ringstad.
„Ja, da sagste was Wahres“, antwortete Ringstad.
„Aber se sind noch genauso frech wie früher.“
„Da sagste auch was Wahres.“
„Ja, genau“, meinte Hauge. „Und die sollen nu aus besseren Kreisen kommen, meine Güte!“
„Ach“, erwiderte Iversen. „Man ist bloß einmal jung.“
„Ja, da sagste was Wahres“, wiederholte Ringstad. „Ein wahres Wort.“
„Aber als wir klein waren, sind wir doch nicht so rumgerannt und haben Faxen gemacht, oder?“
„Nein, ist noch gar nicht so lang her, daß sie uns einen Schneeball durchs Küchenfenster geschmissen haben. Und der ist im Suppentopf gelandet.“
Das war die Köchin, die sich zu ihnen gesellt hatte. Als Iversen das hörte, lachte sie laut und herzlich. Wie ein junges Mädchen lachte sie, und die hohen Fenster klirrten dazu.
„Iversen! Und wenn jetzt der Chef kommt?!“
„Ja, ich sag’s ja“, das war Hauges Schlußfolgerung, „die Kinder von besseren Leuten sind die Schlimmsten.“
„Warten wir’s ab, Hauge. Aus denen kann auch noch was werden“, sagte Iversen.
Mit diesem Urteil kehrten sie zu den Tischen zurück. Denn, ganz richtig, der Chef war im Anmarsch.
„Na, wie war’s denn in der Schule?“ fragte Mama.
„Ich hab’ keine Bekannten von St. Croix in meiner Klasse. Nur Sølvi Andersen. Bestimmt, weil wir auf der Volksschule so frech waren. Jetzt bin ich in einer schrecklichen Klasse mit lauter Engelchen.“
„Vielleicht wird das besser, wenn du sie näher kennengelernt hast?“ fragte Evelyn.
„Und die Lehrer erst mal! Die sind das Ärgste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Die waren alle total verwirrt. Und dann kriegen wir für jedes Fach einen Lehrer, stell dir das vor. Und wir sollen ‚Sie‘ zu ihnen sagen. Ich freu mich auf Deutsch. Aber der Deutschlehrer sieht total vertrocknet aus.“
In diesem Moment läutete das Telefon. Inger nahm ab.
„Bei Dr. Holm, ja bitte?“
Am anderen Ende hörte sie Astrid Evensens Stimme.
„Ach, ist das schrecklich! Ich bin in einer total öden Klasse mit lauter Bauern gelandet! Nur Typen von Lahellemoen und Torp in Børje und Selbak und ein Haufen Leute aus Onsøy.“ Sie weinte fast am Telefon.
„Himmel, wie scheußlich! Bist du denn nicht mit Marthe und Vivi zusammen?“
„Doch, aber die wissen auch nicht, was sie machen sollen.“
„Weißt du was? Ich glaube, die haben uns aus purer Bosheit getrennt.“
„Wie ist denn deine Klasse?“
„Ach, da gibt’s fast nur Trara-Menschen. Ich hab’ noch nicht mit ihnen geredet. Aber vielleicht wird das besser, wenn wir sie näher kennenlernen?“
„Ja-a.“ Astrid hörte sich nicht sehr überzeugt an. „Wie heißen die denn?“
„Einer heißt Leif Bang Monradsen und einer Sigvart Jespersen und – nein, ich weiß auch nicht, wie die anderen heißen.“
„Ich frage mich, ob ich nicht versuchen soll, in deine Klasse versetzt zu werden. Bei dir ist noch eine, die ich von früher her kenne.“
„Ja, mach das.“
Prokurist Evensen aus Cicignon sprach mit dem Rektor, und am nächsten Tag war auch Astrid in der B-Klasse. Gott sei Dank dafür, wenigstens.
Seit vier Jahren stand ein kleiner dunkelbrauner Koffer mit blanken Ecken im Kabuff. Seit Helgas Tod hatte niemand ihn geöffnet. Aber Inger hatte ihn oft betrachtet und nachgedacht. Kein Tag verging, an dem sie nicht an ihre große Schwester dachte. Jetzt ging sie mit der Liste, die sie in der Schule bekommen hatte, wieder zu Evelyn in die Küche. Ob sie vielleicht den Koffer öffnen sollten? Evelyn trocknete sich die Hände ab und nickte.
Zusammen holten sie den Koffer hinter Stiefeln und Pappkartons hervor und trugen ihn ins Kämmerchen. Inger öffnete ihn. Darin lagen die Bücher, eingeschlagen in glattes, gelbes Umschlagpapier, Helga hatte sie mit dunkelblauer Tinte in Schönschrift beschriftet. Englisches Lesebuch von Helga Gjarm Holm. Deutsche Grammatik von Helga Gjarm Holm.
Ach, wie neidisch war sie auf diese Bücher gewesen! Inger spürte, wie es zu ihren Augen aufstieg, das Gefühl, das sie gehabt hatte, als sie die Bücher zum erstenmal sah. Damals waren sie auf Helgas Schreibtisch und Bett verstreut gewesen. Jetzt wurde Helga erwachsen. Ob Helga jetzt wohl keine Zeit mehr haben würde, mit ihr zu spielen?
Nun stand sie hier, am Rand der Welt, in die Helga nur kurz einen Fuß gesetzt hatte. Sie holte tief Atem und faltete die Buchliste mit den angekreuzten Büchern auseinander.
„Wollen wir mal nachsehen?“ fragte sie Mama.
Evelyn dachte an alle Briefe, die sie damals bekommen hatten. Sie waren so erfüllt von echtem Mitgefühl gewesen. Und alle hatten versucht, einen Trost zu finden. Einige sagten, vielleicht sei Helga viel erspart geblieben, im Leben gibt es soviel Grausames, es ist gut, jung zu sterben. Andere schrieben: „Wen der Herr liebt, nimmt er früh zu sich.“
War Helga ein Liebling Gottes? Aber was war dann mit allen anderen Kindern, die er nicht zu sich nahm?
Dennoch hatte sie in der Religion ihren größten Trost gefunden. Eine entfernte Freundin hatte ihr geschrieben, sie müßte ihr glauben, es hätte einen Sinn, wir wüßten ihn bloß nicht. Gott wüßte ihn, und zu guter Letzt war Sein Weg der einzige, den man gehen konnte.
Sie hatte es versucht. Und manchmal glaubte sie, einen Sinn zu sehen. Nein, keinen Sinn, sondern einen größeren Zusammenhang. Eine Glut, eine Hoffnung. Obwohl doch damals, vor vier Jahren, gerade die Hoffnung zerbrochen war.
„Mama?“ fragte Inger, als sie in die Küche kam. „Weißt du, was ich mir so überlege?“
„Nein.“
Inger redete nicht sofort weiter. Sie ging zum Küchenfenster, setzte sich auf den Rand des Spülsteins, stellte die Füße auf die Heizung, wie das so ihre Gewohnheit war, und blickte hinaus auf die halbfertige Kråkerøybrücke.
„Ich habe mir überlegt, daß ich jetzt genauso alt bin wie Helga.“
„Ja“, meinte Mama. „Das habe ich mir auch überlegt.“
Sie schwiegen eine Weile.
„Ich frage mich oft, wie es wohl wäre, wenn Helga noch lebte“, sagte Inger.
„Das tue ich auch. Aber die Vorstellung, daß sie vielleicht in einem Rollstuhl sitzen müßte, nein... das wäre fast noch schlimmer gewesen.“
„Aber Mama, das finde ich überhaupt nicht. Sie hätte eine weltberühmte Malerin werden können! Ich hätte sie überallhin geschoben.“
Mama weiß nicht, daß Inger seit vier Jahren neben Helga im Rollstuhl lebt. Manchmal war sie auch ganz normal und ohne Rollstuhl. Aber manchmal saß sie im Rollstuhl, und das war überhaupt nicht so grausam, wie man denken könnte. Manchmal weinte Helga und war böse, aber sie konnte ja nicht ununterbrochen traurig sein. Und sie hatte doch Inger. Und wenn sie etwas brauchte, brauchte sie bloß Inger danach zu schicken. Nach der Palette und den Pinseln und der Staffelei und den Ölfarben, die sie kurz vor ihrem Tod bekommen hatte, nach dem Holzkasten mit den schönen Pastellkreiden. Und wenn sie die ganze Malerei satt hatte, dann konnte sie Inger bitten, für sie das Filmjournal und Motion Picture zu kaufen. Niemals würde sie sie vergeblich um etwas bitten müssen.
Denn es gab etwas, das Inger bereute, mehr als alles andere, was sie auf dieser Welt falsch gemacht hatte. Es war der letzte Tag, an dem sie und Helga zusammengewesen waren, und Inger hatte sich um sie kümmern müssen, weil Mama und Papa zu einem Fußballspiel wollten. Und dann hatte Helga im Bett gesessen und gesagt, daß sie genau 1,50 für ein Motion Picture hätte, gerade war eine neue Nummer erschienen, und sie hatte gefragt, ob Inger nicht eben zum Kiosk laufen und sie ihr kaufen könnte.
Inger hatte abgelehnt. Ohne besonderen Grund. Sie hatte einfach keine Lust, sie wollte lieber am Schreibtisch sitzen und sich langweilen und sauer sein und darauf warten, daß Mama und Papa von ihrem blöden Fußballspiel zurückkämen, damit sie zum Spielen nach draußen könnte.
Seither war sie immer total außer sich, wenn sie daran dachte. Sie wollte nicht daran denken. Aber es kam ihr immer wieder in den Kopf. Sie dachte, daß es ja nur eine kleine Nebensächlichkeit gewesen war und gar nicht wichtig, und Helga hatte ja auch nicht weiter herumgequengelt. Aber es half nichts. Sie konnte nicht vergessen, daß sie damals nicht zum Kiosk gelaufen war. Denn sie konnte es nie, nie, nie mehr wieder gutmachen.
„Mama?“ fragt Inger tief aus ihren Gedanken heraus. „Weißt du noch, der letzte Sonntag, an dem Helga gelebt hat? Als ihr zum Fußballspiel gegangen seid... ?“ Sie will von der Motion Picture-Zeitschrift erzählen, aber als sie dazu ansetzt, kann sie es doch nicht.
„Ja“, antwortet Mama, „ich habe mir nie verzeihen können, daß wir zu diesem Fußballspiel gegangen sind.“
„Aber ihr seid doch zurückgekommen.“
Wieder möchte Inger Mama von der Zeitschrift erzählen, aber noch immer schafft sie das nicht.
Ja, wir dachten doch, es wäre einfach eine Sommergrippe oder sowas. Das hattet ihr doch so oft. Aber es hilft nichts.“ Mama schluckt. „Weißt du, in ihrer letzten Nacht zu Hause hat sie soviel Seltsames gesagt, sie phantasierte, und ich habe eine Weile bei ihr gewacht. Und da dachte ich, das werde ich ihr erzählen, wenn sie wieder gesund ist...“
„Aber am nächsten Tag mußte sie ins Krankenhaus.“
„Ja, und am Nachmittag wurde sie in den Respirator gelegt.“
„Und wir sind alle drei ins Wohnzimmer gekommen, nachdem das Krankenhaus angerufen hatte, und im selben Moment sind wir in Tränen ausgebrochen. Weißt du, was ich da gedacht habe, Mama? Jetzt sind wir drei, habe ich gedacht.“
„Das hast du gedacht?“ Mama wischte sich mit dem Fingerknöchel die Augen. „Du hast sicher viel gedacht, was wir nicht begriffen haben.“
Wieder verstummt Inger. Mama hat schon recht. Vor allem erinnert sie sich an das Gefühl, daß die anderen sie für ein Kind hielten. Daß das, was passierte, so grausam war, daß sie von einem Tag zum anderen erwachsen werden mußte. Aber das tat sie nicht. Sie war weiterhin kindlich wie ein Kind, hatte weiterhin Kinderfreuden und Kindergedanken und Kinderstimme und Kinderbewegungen. Deshalb glaubten sie, sie dächte überhaupt nicht. Sie glaubten, sie hätte nichts begriffen. Helga war fort. Was gab es da zu begreifen? Aber sie wußte, daß sie gedacht hatte: Für mich ist es am schlimmsten.
Eigentlich wußte sie nicht, wie sie diesen Gedanken gemeint hatte. Sie wußte nur, daß sie ihn für sich behielt, weil niemand ihn verstanden hätte. Sie war allein. Sie hatte ihre Gefährtin verloren. Alle Spiele verschwanden, die sie gespielt hatten. Sie versanken mit Helga. Inger hatte die Ulme draußen auf dem Hof angesehen und gespürt, wie sie versank.
Oder vielleicht hatte sie das gedacht, weil es Helga war, die ihr die Welt gezeigt hatte? Helga hatte ihr als erste beigebracht, wie alles hieß. Deshalb erinnerte seither alles an sie.
Später hatte sie gedacht: Für Mama ist es am schlimmsten. Ein Kind zu verlieren, ist das Schrecklichste, was passieren kann. Mama hatte Helga doch schon, als sie noch winzig klein war, hatte sie wachsen sehen, um dann zu erleben, wie sie damit aufhörte. Mama hatte ihr ganzes Leben ihren Kindern gegeben. Helga zu verlieren war wie das Leben selber zu verlieren.
Aber vielleicht durfte man nicht so denken, überlegte sich Inger. Für wen es am schlimmsten war. Denn es ist für jeden am schlimmsten.
Sie gehen ins Wohnzimmer. Keine kann an etwas anderes denken. Sie setzen sich und sprechen über die letzte Woche in Helgas Leben, sie gehen Tag für Tag durch, wie eine Geschichte, auch wenn beide wissen, was passieren wird, und auch wenn sie schon so oft darüber gesprochen haben. Jedesmal scheint Helga zu ihnen zurückzukehren, nur ein wenig.
„Mama? Es ist so schrecklich seltsam, daran zu denken, daß es nur vier Tage waren.“
„Ja, das ist schrecklich seltsam.“
Auch das haben sie schon früher gesagt. Trotzdem müssen sie es wiederholen. Denn noch nie haben sie erlebt, daß sich die Zeit so ausdehnen und kein Ende nehmen, daß sie wie eine eigene Epoche wirken kann, ein eigenes verzweifeltes Leben. Und jedesmal muß Inger hören, daß es für Mama ganz genau dasselbe war.
Sie hören Papa aus der Praxis. Er kommt zur Küchentür herein und dreht die Wasserhähne auf, läßt das Wasser lange fließen. Dann wäscht er sich die Hände, fährt sich mit Wasser durchs Gesicht, wäscht sich wieder die Hände. Sie kennen seine Geräusche. Wissen, was er macht, ehe er in seinem weißen Arztkittel ins Wohnzimmer kommt. Er geht zu Evelyn und senkt den Kopf, damit sie ihn auf die Wange küssen kann. „Na, sitzt ihr hier herum und faulenzt?“
„Nein, wir denken an Helga.“
Papa richtet sich auf. Wird ernst. „Ja“, sagt er, „ich habe heute auch so sehr an sie gedacht.“
Inger holt Klein-Ellen mit dem Fahrrad aus dem Kindergarten ab. Sie fahren durch St. Croixgaten, vorbei an der Schule, über St. Croix plass und in den Park. In diesem Herbst gibt es unglaublich viele Eichhörnchen. Sie tauchen überall auf und rennen zu einem Baum, jagen den Stamm hoch und verschwinden im Nichts. Dann tauchen sie wieder auf und pressen ihre Schwänze an sich. Es gibt kein anderes Tier, das solche Ähnlichkeit mit einem Zeichentrickfilm über sich selber hat.
„Eicho!“ ruft Ellen. „Eicho, Eicho!“ Sie will sie aufhalten, damit sie eines streicheln kann. Aber wenn sie stehenbleiben und ein Eichhörnchen dicht an sie herankommt – sie sind so frech in diesem Jahr –, bekommt sie doch einen Schrecken und ruft: „Nein, Eicho! Nein, nein, nein.“ Es sind die ersten Tiere, mit denen sie gesprochen hat.
Beate aus Lahellemoen
Den Kindern aus St. Croix hat immer schon die Stadt gehört. Sie kommen aus den feinen grauen Villen von Cicignon oder aus den modernen weißen Steinhäusern der Nygaardsgata und erobern die Kinoschlangen vor der Blauen Grotte und der Roten Mühle, erobern alle Spielplätze und Karussells in der Stadt, nehmen sonntags Hatthütte und Skihütte ein, und im Winter kommen sie mit ihren schwarzweiß-gestreiften Hockeyschlägern und ihren rot und blau gestrickten Pullovern und Mützen und besetzen die Wiesenbahn und den St. Croix plass. Und als dann dunkelblaue Mützen in Mode kamen, hatten sie die auch. Sie spannten die Schlittschuhe stramm, probierten es ein paarmal kurz auf den Zehenspitzen, ehe sie übers Eis jagten, riefen einander zu, klopften einander dreimal auf die Schultern und machten im Handumdrehen die ganze Bahn zu einem Spielplatz für ihr Bockspringen, ihr Räuber und Gendarm, mit dem Gefängnis in der hintersten Ecke, Richtung Bydalen. Die anderen mußten sich mit den übrigen Ecken und dem Rand begnügen, wo sie auf ihren Klammerschlittschuhen in einer braunen Jacke mit Gummizug in der Taille, die sie von ihrer Kusine geerbt hatten, dahinstapften. Mit lautem Rufen und ohne etwas wahrzunehmen außer sich selber und die, die dazugehörten, glitten die Jungen und Mädchen aus St. Croix übers Eis, beugten sich vor und zurück, und immer hatten sie genügend Geld für eine Wurst und eine Cola, mit denen sie zu den Klängen des Schneewalzers und anderer Wiesenbahnschlager aus den knackenden Lautsprechern übers Eis tanzten. „Schneyschney schneyschneywalllzer!“ sangen die Kinder von St. Croix und schwangen sich und wogten hierhin und dorthin, und plötzlich kam eins von ihnen angefegt und warf einen fast um, und im nächsten Moment stand man ohne Mütze da. Und dann durfte man sich nichts anmerken lassen. Der Versuch, in einer solchen Situation die Mütze zurückzuerlangen, war das Blödeste, worauf ein Kind aus Lahellemoen oder Lislebyveien verfallen konnte. Bald kamen sie dann wieder angefegt, mit ihren Vor- und Zurücktricks, bremsten ganz scharf und hielten einem die Mütze hin. „Willst du deine Mütze wiederhaben?“ fragten sie. Dann galt es, die Hand nicht auszustrecken. Und wenn man sich gleichzeitig noch umdrehen und ein Stück weggleiten konnte, als ob man Wichtigeres zu tun hätte als sich die Ohren abzufrieren, war die Schlacht gewonnen. Bald darauf würde die Mütze mit ihrem kleinen grauweißen Bommel einsam auf einer Schneewehe liegen.
Mit diesen Menschen sollte Beate Halvorsen aus Lahellemoen jetzt in die Schule gehen – in diese Schule, die unten im feinsten Stadtviertel lag, gleich bei Cicignon, und die manche immer noch „Mittelschule“ nannten, obwohl sie doch schon lange nicht mehr so hieß. Nur zwei aus Lahellemoen waren in diesem Jahr dorthin übergewechselt. Hartvig Gravdahl, der ganz oben in Bydalen bei der Brauerei wohnte, und Beate, die auf Kapellfjellet wohnte, durch den sich jetzt die Baumaschinen hindurchfraßen, um Fredrikstad die Fredrikstadbrücke zu bauen. Gravdahl. Eigentlich konnte Hartvig Gravdahl ihr gestohlen bleiben. Er war immer so arrogant, und er hatte selten mit ihr gesprochen, hatte nur gerufen, und auch das war jetzt schon lange her. Aber Beate war nur froh, wenn er die Ruferei auch weiterhin nicht wieder aufnahm. Am besten wäre überhaupt niemand aus Lahellemoen dabeigewesen.
Beate schleppte sich mit ihrer Tasche voller Bücher Kapellveien hoch. Nur gut, daß sie unten alte Bücher verkauft hatten, sonst hätte ihre Mutter einen Schock erlitten. 163 Kronen und 25 Öre kosteten die Bücher insgesamt, wenn sie alles neu kaufen mußte. Viele von den alten Büchern, die die großen Schüler verkauft hatten, waren so zerfleddert, daß sie kaum noch zusammenhingen, aber zum Glück hatte sie auch zwei erwischen können, die noch einigermaßen gut aussahen. Die deutsche Grammatik, schwarz und gelb, und dieses Christenheitsbuch von Fjellbu oder so hatte sie nicht bekommen, es kostete 4,70. Das norwegische Lesebuch kostete neu 17,50. Sie hatte es für fünf bekommen. Sie freute sich darauf, ihrer Mutter das zu erzählen. Das Erdkundebuch hatte sie nicht, auch das war schrecklich teuer, 8,85 stand auf der Liste. Aber sie würde Tone fragen, die letztes Jahr Abi gemacht hatte.
Beate nahm die Schultasche in die andere Hand und hoffte, daß Tone dieses Erdkundebuch nicht hatte. Ein neues Buch wäre auch schön. Nur eines. Sie konnte doch an ihre Sparbüchse gehen. Aber dann würde es noch länger dauern, bis sie sich ein Fahrrad kaufen konnte, und jetzt hätte sie gut eins brauchen können. Wenn sie sich jeden Tag so abschleppen mußte, wäre ihre Schulter bald ausgerenkt.
Beate näherte sich ihrem Haus. Es war ein langes flaches hufeisenförmiges Haus, ungefähr auf halber Höhe des Hangs, weiß, wie so viele Häuser hier oben. Hier wohnte sie mit ihrer Mutter in zwei Zimmern und Küche in der Hälfte des einen Flügels. Sie ging auf den Hof, blieb bei der Pumpe stehen und trank einen Schluck, es war so schwül, es würde sicher ein Gewitter geben. Sie blickte hoch zu den blauschwarzen Wolken über dem Dach, dann stieg sie die beiden Treppenstufen hoch und erreichte den schmalen Flur. Hinter dem Fenster sah sie das kleine zerfurchte Gesicht ihrer Mutter.
„Schon wieder da? Ich habe noch nicht mit dem Mittagessen angefangen, aber jetzt dauert’s nicht mehr lange.“ Wie üblich redete ihre Mutter mit dem Mund voller Stecknadeln.
„Laß dir ruhig Zeit. Ich hab’ sowieso noch keinen Hunger.“
Sie ging ins Wohnzimmer. Überall lagen Teile des dunkelblauen Gabardinestoffs für Frau Direktor Bøhmers neues Kostüm herum, das zum Empfang fertig sein sollte, den der Herr Direktor Ende des Monats geben wollte. Frau Bøhmer mit ihren weißen Haaren sah so elegant aus in schwarz oder blau.
„Nina hat heute auch in der Schule angefangen“, sagte Beate und wanderte durch das Wohnzimmer ins andere Zimmer. Tone hatte ihr erzählt, ab jetzt würde sie ununterbrochen Hausaufgaben machen und dicke Bücher lesen müssen, die kein Ende nahmen, von dem Moment an, wo sie nach Hause kam, bis zur Schlafenszeit am Abend. Aber das machte Beate keine Angst. Sie freute sich darauf, die Welt der Bücher zu betreten, nahm sie aus der Tasche und legte sie auf den Tisch. Die Mutter schaute herein. „Jetzt wirst du wohl klug?“
„Ach, ich weiß nicht. Du hättest mal die Lehrer sehen sollen. Die sahen allesamt so aus, als ob sie nicht alle Tassen im Schrank hätten.“
Fräulein Halvorsen dachte ein Weilchen darüber nach. Sie beendete den Saum der Jacke und ging in die Küche. „Kennst du welche von den Kindern, mit denen du jetzt zur Schule gehst, Mädi?“ rief sie Beate zu.
„Wir sind keine Kinder mehr, Mensch, falls du dir das eingebildet hast“, kam die Antwort aus dem Schlafzimmer. „Aber ich kenne sie nicht. Nur Nina, natürlich, und die anderen aus St. Croix. Aber die wissen nicht, wer ich bin.“
„Hast du denn mit irgendwem gesprochen?“
„Nein, ich hab’ zu niemandem ein Wort gesagt. Was hätte ich denn auch sagen sollen?“
„Aber Nina kennt dich doch wohl?“
„Ja, aber ich glaub’ nicht, daß sie mich gesehen hat, und außerdem ist sie sowieso in der D-Klasse gelandet. Ich bin in der B-Klasse. Dies Jahr gibt es nämlich sechs erste Klassen.“
„Du bist also nicht in derselben Klasse wie Hartvig?“
„Doch. Aber ich könnte gut ohne ihn auskommen.“
„Und mit wem bist du sonst noch zusammen?“
„Ach, mit der Hälfte von allen Bonzenkindern aus der Stadt. Mit der Tochter vom Oberingenieur Hauger – Gudrun heißt sie, sie ist schrecklich dick, und mit der Tochter von Inspektor Martinsen aus Trara, die heißt Sandra und ist schrecklich sportlich, und mit der Tochter von Dr. Holm unten in der Stadt, die hat sich getraut, etwas zum Klassenlehrer zu sagen. Und dann ist da noch einer, der heißt Rolf Magnor, Sohn von Granit-Magnor, und einer heißt Sigvart Jespersen, Sohn von der Kartonfabrik, und Kjell Grunder, Sohn von der Glommen-Kreditbank, und eine heißt Liv Abrahamsen. Die ist auch aus Trara. Und dann ist da noch ein ganz langer, der Leif Bang Monradsen heißt.“ Hiermit beendete Beate ihre Aufzählung.
„Ach? Wer ist das denn?“
„Der? Ach, einfach so ein Junge, natürlich.“
Wieder dachte Fräulein Halvorsen eine Weile nach. Seit vielen Jahren hatte alles dem Ziel gedient, ihre Tochter in die Gelbe Anstalt zu bringen. Nichts durfte dabei schiefgehen. Aber gleichzeitig wußte sie, daß sie jetzt nicht mehr von früh bis spät auf sie aufpassen konnte. Das mußte sie jetzt selber schaffen. Das tat weh.
„Heute gibt’s Erbsensuppe, Mädi.“
„Schön“, rief Beate. „Aber Mama, kannst du nicht anfangen, mich Beate zu nennen?“
Im kleinen Zimmer neben dem Wohnzimmer hatten sie ans Fenster neben dem Bett ein Tischchen gestellt. Hier konnte Beate hinter den Blumentöpfen sitzen und auf Kapellveien hinausblicken. Das Fenster war ziemlich niedrig, wenn Leute dicht vorbeigingen, konnte sie sie ungefähr von der Taille aufwärts sehen. Waren sie weiter entfernt, sah sie sie ganz. Es war schön, hinter dem kleinen Dschungel aus Topfblumen zu sitzen und einfach nur zu schauen. Auf dem Tisch lag ein großer neuer grüner Bogen Löschpapier als Unterlage, darauf Hefte und Kladden und ein kleiner hellgrüner Behälter für Bleistifte, Radiergummi und Bleistiftspitzer. Endlich hatte sie einen Ort für sich allein.
Beate fragte, ob sie keinen Vorhang haben könnte. „Wozu soll das denn gut sein?“ fragte Mama, und darauf hatte Beate nicht sofort eine Antwort. „Einfach so“, sagte sie.
„Ist denn das, was du jetzt machst, so schrecklich geheim?“ hakte Mama nach. „Ach, Mama, du könntest doch gut so einen Vorhang nähen. Das macht doch wohl nichts.“ – „Aber wozu soll das gut sein, frage ich?“ fragte Mama noch einmal. „Naja, nur so, nur so... es wäre schrecklich gemütlich, finde ich.“ – „Schrecklich gemütlich? Ich glaube nicht, daß sich das Zimmer gut machen würde mit einem Vorhang in der Mitte, Mädi. Dazu ist es nicht geschaffen.“ – „Macht es sich jetzt vielleicht gut?“ fragte Beate. Aber sie gab nach. Denn eigentlich hatte sie nicht daran gedacht, wie sich das Zimmerchen vom Zimmer aus machen, sondern wie es drin sein würde. Aber das schien Mama nicht zu begreifen.
In diesen Zimmern hatten sie und ihre Mutter immer gewohnt. Nichts hatte sie bisher getrennt. Sie hatte ein schlechtes Gewissen. Die Mutter tat alles für sie. Sie hatte nur sie, hatte sonst keinen Menschen. Und daß sie nie einen Vater für Beate gehabt hatte, trug sie jeden Tag mit ihrem Namen mit sich herum.
Beate war Fräulein Halvorsens uneheliches Kind, das wußten alle, was aus dem Vater geworden war, das wußte niemand. Auch Beate wußte es nicht. Sie hatte sich oft den Kopf darüber zerbrochen, hatte wissen wollen, was eigentlich los war. Wann immer sie das Thema anschnitt, winkte ihre Mutter ab. „Dazu gibt es nichts zu sagen“, erklärte sie. „Aber warst du mit ihm zusammen? Hast du ihn gekannt?“ fragte Beate. „Darüber reden wir nicht, habe ich gesagt. Wir müssen ihn vergessen, Mädi, das ist das Beste.“
Aber Beate konnte ihren Vater nicht vergessen, auch wenn er nur ein Schatten war. Er war ein Samenkorn gewesen, im Leib ihrer Mutter war er zu Beate geworden, und im letzten halben Jahr oder so hatte sie sich mehr den Kopf darüber zerbrochen als je zuvor. Sie träumte von ihm und hoffte, daß er zurückkommen würde. Er kam mit Geschenken aus Amerika. Ein andermal war er tot. Vielleicht war er im Duell gefallen. Oder er war ertrunken. Manchmal segelte er zwischen den Inseln des Stillen Ozeans, und auf den Inseln tanzte er mit Hula-Hula-Mädchen und trug einen Blumenkranz in den Haaren. Sie mußte einfach an ihren Vater denken; las sie „Die drei Musketiere“, war er einer von ihnen, las sie „Der Graf von Monte Christo“, war er das; er fand sich in allen Büchern Jack Londons, er umsegelte Kap Horn oder unterwarf sich König Alkohol, in den Flickabüchern ritt er über Wyomings Prärien, überall war er, denn Beate las ungeheuere Mengen von Büchern, und niemals hatte sie genug.
„Die Suppe ist fertig!“ rief ihre Mutter aus der Küche. Beate las schnell noch einen Abschnitt in „Segen der Erde“, ihrer derzeitigen Lektüre. Gerade hatte Inger Sellanraa ihr Kind umgebracht. Es hatte wie sie eine Hasenscharte. Beate weint innerlich, legt das Lesezeichen ins Buch und geht in die Küche. Sie füllt ihren Teller bis zum Rand mit Erbsensuppe. Erbsensuppe ist ihr Lieblingsessen. Es war klar, daß es das heute geben würde. Ihre Mutter sitzt an der anderen Seite des Küchentischs und bläst auf ihren Löffel. Auf dem leeren Hocker zwischen ihnen sitzt Beates Vater mit dichter schwarzer Mähne und lobt das Essen.
Die Stunden
Die Mädchen aus Trara hatten immer etwas zu lachen. Vor allem eine Else, die am vorletzten Tisch an der Tür saß und sich mit Lippenstift bemalte. Dann kicherte sie zusammen mit den anderen Mädchen in ihrer Ecke. Sie hatte in ihrem Mäppchen einen Spiegel. Darin betrachtete sie ihren Lippenstift und ihren Mund, wenn der Lehrer das nicht sehen konnte, und danach prustete sie los. Manchmal warf sie sich vor Lachen über den Tisch, und wenn sie sich wieder eingekriegt hatte und sich umdrehte, um der mit der Zahnklammer am letzten Tisch etwas zuzuflüstern, war das, was sie sagen wollte, so komisch, daß sie es einfach nicht herausbrachte. Einmal lachte sie so sehr, daß sie vor die Tür gestellt werden mußte. Das war im Norwegischunterricht, sie nahmen gerade einen Roman von Gabriel Scott durch.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!