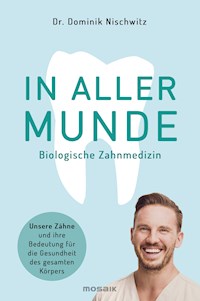
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
++++ Der Literaturspiegel-Bestseller ++++
Unser Mund ist nicht bloß zum Lächeln da, unsere Zähne können mehr als Kauen und unsere Zunge leistet mehr als nur zu schmecken und zu schlucken. Die Mundhöhle ist ein empfindliches Ökosystem und das Tor zu unserem Körper. Durch den Mund ernähren wir uns, durch ihn sprechen wir mit anderen – und er ist zentral für die Gesundheit des gesamten Körpers.
Ist der Mund nicht gesund, entstehen Krankheiten: Von Gereiztheit, Müdigkeit und Übergewicht über Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Schlaganfall, Alzheimer und Krebs – im Mund nimmt alles seinen Anfang.
Dr. Dominik Nischwitz, Vorreiter der biologischen Zahnmedizin, erklärt mithilfe der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse alles, was wir noch nicht über unsere Zähne wussten, und wie man über einen gesunden Mundraum zu einem gesunden Körper gelangt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Unser Mund ist nicht bloß zum Lächeln da. Er ist ein empfindliches Ökosystem und zentral für die Gesundheit des gesamten Körpers. Denn in der Mundhöhle entstehen nicht nur Karies und Parodontitis. Heute weiß man, dass auch sehr viele chronische Erkrankungen wie Allergien, Depressionen, Herzkrankheiten oder unerfüllter Kinderwunsch hier ihren Anfang nehmen.
Autor
Dr. Dominik Nischwitz ist niedergelassener Zahnarzt und Heilpraktiker. Als Spezialist für biologische Zahnmedizin gründete er zusammen mit seinem Vater das »Zentrum für Biologische Zahnmedizin« in Tübingen. Er ist Vorreiter auf diesem Gebiet der Zahnheilkunde und hält dazu regelmäßig Vorträge auf wissenschaftlichen Kongressen rund um den Globus.
Dr. Dominik Nischwitz
IN ALLER
MUNDE
Unsere Zähne und ihre Bedeutung
für die Gesundheit des gesamten Körpers
Mit Illustrationen
von Ole Schleef
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2019: Mosaik Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Illustrationen: Ole Schleef
Umschlag: *zeichenpool, München
Autorenfoto: © Christian Metzler
Illustration Zahn: © *zeichenpool
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
JE ∙ Herstellung: IH
ISBN 978-3-641-23225-2V004
www.mosaik-verlag.de
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Einleitung
Biologische Zahnmedizin: vom Pixel zum ganzen Bild
Wie gewinnt man eine Fußballweltmeisterschaft?
Paradigmenwechsel in der Zahnmedizin
Kapitel I
Zähne und Mikrobiologie
Das orale Mikrobiom: die Entdeckung einer neuen Welt
Kleine Zellen. Große Hilfe.
Durch die Hintertür: die etwas späte Entdeckung der Mundhöhle
Leben in der Mundhöhle: Bakterien zwischen Himmel und Hölle
Der Biofilm: Leben durch Kleben
Das Pellikel: magischer Schutzschild unserer Zähne
Der Speichel: unterschätztes Wunderwasser
Mikrobielle Homöostase: was unseren Mund wirklich krank macht
Karies: neue Erkenntnisse über eine alte Erkrankung
Die ökologische Plaquehypothese
Süßes macht sauer, und sauer macht krank
Exkurs: Weston Price und die Bedeutung der Ernährung
Iatrogene Faktoren: wenn der Zahnarzt schuld an Zahnproblemen ist
Vorsicht Füllungen: warum sie nicht nur nützlich sind
Die biologische Breite: wenn Millimeter entscheiden
Das Füllmaterial und seine tragende Rolle
Die Gingiva: die sensible Grenze
Parodontitis: gefährlich für den gesamten Körper
Kapitel II
Zähne und Immunsystem
Still, aber gefährlich: die chronische Entzündung
Der wurzelbehandelte Zahn: die Wurzel allen Übels
Die Folgen von Wurzelbehandlungen
Exkurs: Von Anfang an in der Kritik
Zysten, Fisteln und entzündete Wurzelspitzen
Wurzelspitzenresektion
NICOs: die Weisheitszahn-OP und ihre Folgen
Exkurs: Warum Weisheitszähne überhaupt gezogen werden müssen
Zähne und Toxikologie
Enzymblockaden und Energieräuber
Metalle in der Mundhöhle: niemals eine gute Lösung
Gefährliche Gase
Jeder Körper reagiert anders
Exkurs: Methylierung
Miese Mischung
Gold
Titan
Die Periimplantitis
Metalle plus Entzündungen: eine verhängnisvolle Kombination
Zähne und Nervensystem
Das autonome Nervensystem
Der Sympathikus
Der Parasympathikus
Stress von innen
Kapitel III
Zähne und chronische Krankheiten
Chronische Müdigkeit und ständige Infektanfälligkeit
Herz- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Übergewicht
Diabetes mellitus
Allergien
Autoimmunerkrankungen
Gestörte Darmbarriere: das Leaky-Gut-Syndrom
Depressionen
Fruchtbarkeit und Kinderwunsch
Alzheimer und Demenzerkrankungen
Krebs
Der Schlüssel zu einem gesunden Leben
Kapitel IV
Gesund werden, gesund bleiben mit biologischer Zahnmedizin
Die Entfernung von Metallen
Die Amalgamentfernung
Der richtige Umgang mit toten und wurzelbehandelten Zähnen
Keramikimplantate: die metallfreie Lösung
So werden NICOs behandelt
Warum die Vorbereitung auf einen Eingriff so entscheidend ist
Nahrung heilt
Protein
Kohlenhydrate
Obst
Fett
Gemüse
Nahrungsintoleranzen
Gluten
Kuhmilchprodukte
Zucker
Geschmacksverstärker
Warum Nahrungsergänzungsmittel?
Die wichtigsten Nährstoffe im Überblick
Vitamin D3
Magnesium
Zink
Vitamin C
Essen für eine gesunde Bakterienflora
Exkurs: Wie Nahrung unsere Stimmung beeinflusst4
Dopamin
Acetylcholin
GABA
Serotonin
Problematische Nahrungsmittel und Alternativen
Kuhmilchprodukte
Zucker
Süßstoffe
Stimulantien
Geschmacksverstärker
Transfette
Sonstiges
Superfoods
Der richtige Umgang mit dem Ernährungsdesign
Was bedeutet 80:20?
Individuelle Ziele und Empfehlung
Zahngesund bleiben: so gelingt es
Zähne in der Kindheit
Zähne im Alter
Gesund bleiben: häufige Fragen zur Zahnpflege
Plädoyer für eine neue Zahnmedizin
Anhang
Danksagung
Quellen
Register
Übersicht der Kästen
Für meine Frau und Seelenpartnerin Steffi,
ohne die all mein Tun niemals möglich wäre.
Vorwort
In meiner Jugend wollte ich nichts lieber, als Profiskater zu werden. Ich trainierte in jeder freien Minute, aber jedes Mal bevor ich ein neues Level erreichen konnte, warf eine Krankheit mich zurück. Aus irgendeinem Grund war mein Körper nicht so widerstandsfähig und gesund, wie er sein sollte. Entweder waren meine Mandeln entzündet, oder ich hatte mal wieder eine hartnäckige Erkältung. Ich bekam Gürtelrose und Pfeiffersches Drüsenfieber. Mein Blinddarm entzündete sich und wurde rausgenommen. Ich hatte sehr schlechte Haut, war eigentlich immer müde, trotzdem konnte ich abends oft nur sehr schlecht einschlafen. Ich wollte fit sein und trainieren, stattdessen war ich dauernd krank und wurde behandelt. Gegen die schlechte Haut nahm ich ein Mittel, das zwar die Haut besser machte, dafür aber die Leber angriff. Gegen die ständigen Halsentzündungen bekam ich immer wieder Antibiotika, am Ende überwies mich ein Arzt schließlich zum Chirurgen, der die Mandeln entfernen sollte.
Diesmal schickte meine Mutter mich vorher zu einem Heilpraktiker, einfach nur, um noch eine zweite Meinung einzuholen. Er checkte mich durch und stellte eine Allergie gegen Kuhmilch fest. Zu der Zeit hatte ich Joghurt und Milch täglich und reichlich zu mir genommen. Ohne zu ahnen, dass das zu meinem schlechten Gesundheitszustand beitrug.
Über Krankheiten hatte ich bis dahin in der üblichen Schablone gedacht: Sie sind etwas, das einen befällt, man nimmt ein Medikament ein oder lässt einen Eingriff machen, und im besten Fall wird man dadurch wieder gesund – zumindest bis zur nächsten Krankheit. Die Überweisung zum Chirurgen kam nie zum Einsatz. Denn wenigstens die Halsschmerzen hatten sich erledigt, seit ich Milchprodukte einfach wegließ. Ich hatte mir noch keine großen Gedanken gemacht, aber am Rande bemerkte ich doch: Es gibt offensichtlich auch andere Wege, mit einer Krankheit umzugehen, außer nur Medikamente einzunehmen.
Profiskater wurde ich dann trotzdem nicht, ich begann Zahnmedizin zu studieren. Sport blieb mir wichtig, aber jetzt hatte mich das Krafttraining gepackt. Wer Muskeln aufbauen will, der merkt bald, dass es mit Pumpen alleine nicht getan ist. Man muss seinem Körper auch die richtigen Bausteine liefern. Ich begann, mich mit Ernährung zu beschäftigen und darauf zu achten, was sie mit mir macht. Zu dieser Zeit war ich Student, und ich lebte auch so: Partys, Schlafmangel, schlechtes Essen. Körperlich fühlte ich mich manchmal steinalt. Und psychisch immer öfter völlig niedergeschlagen, ohne dass es dafür einen wirklichen Grund gab. Ich änderte ein paar Dinge und war erstaunt, welche Wirkung das bald hatte: Es gibt Nahrungsmittel, die einem Antrieb geben, und es gibt welche, die einen direkt ins Sofa drücken. Ich entschied mich immer öfter für die, die mir guttaten. Ich begann mich zu fragen, ob ich mit Ernährung und Sport einen Zustand erreichen konnte, den man normalerweise als Kind hat. Kann man die Uhr zurückdrehen? Ich versuchte jetzt, nicht einfach nur mehr Muskeln aufzubauen, ich wollte versuchen, meinen Körper so gesund wie möglich zu bekommen.
Das Studium lieferte mir zu. Früher in der Schule hatten Chemie und Physik mich so gelangweilt, dass ich sie abgewählt hatte. Bezogen auf den menschlichen Körper fand ich die Fächer wieder spannend. Was genau ist eigentlich ein Protein? Was bewirken Kohlehydrate im Körper? Was ist Glykolyse? Welche Aminosäuren braucht man wirklich? Warum Kreatin und Glutamin? Ich probierte ziemlich viel aus, bis ich das Passende für mich gefunden hatte, ich machte Sport und ernährte mich anders. Ich war bald so fit, wie ich es als Jugendlicher oder Kind niemals gewesen war.
Das Studium neigte sich dem Ende zu, aber ich freute mich nicht wirklich darauf. Das Handwerkliche und Filigrane an der Zahnmedizin liebte ich sehr, aber alles andere blieb seltsam unbefriedigend. Mir fehlte etwas Wesentliches, ich wusste nur noch nicht, was. Dann trat ich die Assistenzzeit in einer chirurgisch-implantologisch versierten Zahnarztpraxis an. Die Praxis war seit vielen Jahren etabliert, mein Chef ein absoluter Spezialist im Bereich der Implantologie. Er war der perfekte Lehrmeister und wusste genau, wie er mich motivieren konnte. Karieslöcher wurden hier allerdings noch mit Amalgam gefüllt. Ohne wirklich zu wissen, warum, sagte ich zu meinem neuen Chef: »Entschuldigung, aber das kann ich nicht machen.«
An der Uni lernt man, dass Amalgam ein einfach zu bearbeitender Füllstoff ist, der ewig hält, nicht sonderlich teuer ist und Bakterien abtötet. Nur bei Schwangeren und Kindern soll man es nicht verwenden, ansonsten sei das kein Problem. Ich wusste aber von meinem Vater, der auch Zahnarzt ist, dass er Amalgam schon seit 20 Jahren nicht mehr einsetzt, weil er es für ungesund hält. Wenn man als Assistenzarzt so eine Ansage macht, braucht man allerdings schon ein paar Argumente mehr. Ich hatte keine, aber ich machte mich noch an diesem Tag daran, welche zu sammeln. Was als einfache Recherche begann, riss mich immer weiter mit. Ich las Studien und Bücher, ich besuchte Seminare zu dem Thema und andere Zahnärzte, Ärzte und Heilpraktiker, ich schaute Videos, Vorträge und hospitierte in anderen Praxen.
Ich hatte nur Antworten auf ein paar Fragen gesucht, aber vor mir hatte sich unerwartet nicht weniger als ein neues Universum geöffnet. Ich lernte Ärzte kennen, die völlig anders dachten, handelten und lehrten, als ich es im Studium gehört hatte. Sie betrachteten die Mundhöhle nicht isoliert, sondern immer im Zusammenhang mit dem Rest des Körpers. Mir wurde klar, dass Zahnmedizin handwerklich oft hervorragend funktioniert, gesundheitlich aber erhebliche Schäden anrichten kann.
Wie jeder Zahnarzt hatte ich gelernt, mich auf den Mund und die Zähne zu konzentrieren, jetzt erst lernte ich, wie der Mund mit dem gesamten Organismus verwoben ist und nur in dieser Gesamtheit funktioniert. Ich bemerkte, dass ich zwar viel darüber wusste, wie man Zähne repariert, aber sehr wenig darüber, was es eigentlich genau ist, was sie krank macht, und dass auch das sehr viel mit dem gesamten Körper zu tun hat. Immer wieder begegneten mir in dieser Zeit Dinge, mit denen ich mich schon früher beschäftigt hatte, weil sie mich persönlich interessiert hatten: Ernährung, Nährstoffe, Biochemie, Immunsystem. Ein paar scheinbar lose Enden in meinem Leben fügten sich auf einmal zusammen. Was mich einst privat interessiert hatte, verband sich mit dem Beruflichen. Ich wusste jetzt, dass ich ein Zahnarzt werden wollte, der genau diese Zusammenhänge im Blick hat. Einer, der nicht bloß Schäden repariert, sondern der hilft, Schäden vorzubeugen. Endlich fühlte sich alles richtig an.
Manchmal sind es nur ein paar Dinge, die man tun muss, um gesund zu sein oder wieder gesund zu werden. Was ich für mich erreicht hatte, konnte ich auch an meine Patienten weitergeben. Ich begriff, dass ich als Zahnarzt dafür an genau der richtigen Stelle war. Ich musste nur noch ein paar Puzzleteile zusammenführen. Ich begann, mein Studium nicht als das Ende meiner Ausbildung zu betrachten, sondern als den Anfang. Fünf Jahre lang saugte ich so viel neues Wissen auf wie möglich. Ich ließ mich in Neuraltherapie ausbilden, machte die Prüfung zum Heilpraktiker, ich beschäftigte mich mit funktioneller Medizin, die den Körper nicht in seine Einzelteile zerlegt und verschiedenen Fachbereichen überlässt, sondern den Organismus als ein einziges, dynamisches System begreift, in dem alles mit allem verbunden ist und zusammenarbeitet. Ich lernte alles über zahnärztliche Werkstoffe, die sich im Körper so verträglich einfügen, dass sie keine Allergien oder Entzündungen auslösen.
Heute bin ich der Zahnarzt, der ich werden wollte. 2015 habe ich zusammen mit meinem Vater das erste Zentrum für »Biologische Zahnmedizin« gegründet. Eine Zahnmedizin, die die Mundhöhle nie isoliert betrachtet, sondern immer auf das komplexe Zusammenspiel des gesamten Organismus Rücksicht nimmt. Ich behandle Zähne, aber ich sehe in meiner Praxis jeden Tag, wie der gesamte Körper auf diese Behandlung reagiert, wenn man ihn von Anfang an in die Therapie einbezieht. Es ist möglich, gesünder zu leben, sich besser zu fühlen und Krankheiten zu verhindern. Mit diesem Buch möchte ich das tun, was ich ohnehin seit Jahren tue: jedem davon zu erzählen, dass der Schlüssel für die Gesundheit des gesamten Körpers in unserer Mundhöhle liegt.
EINLEITUNG
Biologische Zahnmedizin: Vom Pixel zum ganzen Bild
Wie gewinnt man eine Fußballweltmeisterschaft?
1957, ein Jahr vor der Austragung in Schweden, zog sich Vicente Feola, Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft, zurück, um wie kein anderer vor ihm darüber nachzudenken. Dann begann er eine exakte Vorbereitung. Natürlich brauchte er die talentiertesten Spieler und die besten Trainingsmethoden. Aber Feola dachte darüber hinaus. Er wollte keinen Aspekt übersehen, der die Leistung seiner Spieler beeinträchtigen konnte, und er ergriff deshalb Maßnahmen, die im Fußball bis dahin noch nie eine Rolle gespielt hatten. Er ließ seine Spieler nicht nur von einem Psychologen begutachten und betreuen, sondern schickte die gesamte Mannschaft zu einem Zahnarzt. Und der hatte reichlich zu tun. Insgesamt behandelte er 470 Zähne, von denen 32 so krank oder entzündet waren, dass sie gezogen werden mussten. Als die Brasilianer ein Jahr später den Wettkampf antraten, hatten sie vermutlich unter allen Teilnehmern die gesündesten Gebisse.
Trotz der Vorrunden, die bei dieser WM als besonders kräftezehrend galten, weil sie sehr dicht aufeinanderfolgten, gewann Brasilien die Weltmeisterschaft so souverän und überlegen wie keine andere Mannschaft zuvor.1 Feolas Methoden erschienen damals allenfalls wunderlich. Brauchte ein Fußballer nicht vor allem stramme Waden, Ballgefühl und sehr viel Ausdauer? Heute könnte man dem Trainer zahlreiche Studien in die Hand drücken, die belegen, dass seine Intuition richtig war: Gesundheit und bestmögliche Fitness sind nur dann möglich, wenn auch die Zähne und die Mundhöhle in Ordnung sind.
Jahrzehntelang dachte man, dass Karies und Zahnfleischentzündungen die einzigen Krankheiten sind, die in unserem Mund entstehen. Heute ist vielfach bewiesen, dass auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Unfruchtbarkeit, Schlaganfälle, Darmerkrankungen sowie viele Krankheiten des Autoimmunsystems sehr oft im Mund beginnen oder diese Krankheiten von dort aus verstärkt werden. Kranke Zähne, entzündetes Zahnfleisch und schlecht verträgliche Füllstoffe betreffen nicht nur die Mundhöhle. Oft machen sie sich sogar an ganz anderen Stellen im Körper bemerkbar: als Kniegelenksprobleme, Schulter- und Rückenschmerzen oder weil uns Allergien plagen, auf die wir uns keinen Reim machen können. Kranke oder schlecht versorgte Zähne kosten uns Energie und Nährstoffe, sie können im Körper Prozesse in Gang setzen, die eine Depression auslösen, sie beeinflussen unsere Hormone und die Körperchemie, reizen das Immunsystem und aktivieren die Stressachse 24 Stunden am Tag.
Heute weiß man, dass die meisten chronischen Krankheiten nicht einfach Schicksal, Pech oder schlechte Gene sind, sondern die Folge von anhaltenden, stillen Entzündungen im Körper und dem damit verbundenen chronischen Stress. In der Mundhöhle kommen solche Entzündungen besonders oft vor: Sie verstecken sich an entzündeten Zahnwurzelspitzen, in Zahnfleischtaschen, um Implantate herum, in toten Zähnen oder in den Höhlen, die übrig bleiben, wenn ein Zahn entfernt werden musste. Obwohl die Forschung immer neue Zusammenhänge zwischen Zähnen und Körper entdeckt, kommt dieses Wissen in der Praxis noch viel zu selten an. Mediziner und Zahnärzte arbeiten traditionell in zwei getrennten Sphären. Ein Allgemeinarzt schaut nur selten nach der Mundhöhle, und der Zahnarzt betrachtet sie vor allem aus handwerklicher Sicht. Unser medizinisches Versorgungssystem ist so aufgebaut, dass wir auf Pixel schauen – aber was wir dringend brauchen, ist das ganze Bild. Bisher geht die Mundhöhle als zentrales Organ zwischen zwei Disziplinen oft komplett unter und damit die Chance, die Ursache für viele Erkrankungen rechtzeitig zu entdecken.
Außen hart, innen sehr lebendig: Unter dem sichtbaren Schmelz ist jeder einzelne Zahn ein eigenes Organ.
Und es sind nicht nur wir Zahnärzte, denen man beibringt, die Mundhöhle vor allem danach zu beurteilen, ob darin die Mechanik funktioniert und das Lächeln stimmt. Unsere Zähne erledigen täglich eine enorme Kraftarbeit für uns, wenn sie unsere Nahrung zerkleinern. Aber wenn wir sie lediglich als Kauwerkzeuge betrachten, die man reparieren kann, wenn sie kaputtgehen, dann tun wir ihnen nicht nur ziemlich unrecht. Wir übersehen auch, was sie wirklich sind und welche Rolle sie in unserem Körper spielen. Das, was wir von unseren Zähnen sehen können, ist nämlich gerade mal ein Drittel von ihnen. Den wirklich spannenden Rest bekommen wir leider nie zu Gesicht. Dabei hätte auch der durchaus mal ein bisschen Aufmerksamkeit verdient: Im Kern eines jeden Zahnes befindet sich auf kleinstem Raum alles, was ein Organ ausmacht: pulsierende Blutgefäße, Lymphe, ein Nerven- und ein Immunsystem. Wie jedes andere Organ sind unsere Zähne darüber mit dem Rest des Körpers verbunden. Geht es dem Körper nicht gut, dann leiden auch die Zähne. Leiden die Zähne, dann macht sich das auch immer im Rest des Körpers bemerkbar.
Paradigmenwechsel in der Zahnmedizin
Viele von uns geben sich viel Mühe bei der Mundhygiene und sind enttäuscht oder schämen sich sogar, wenn sie viel putzen und ihre Mundhöhle trotzdem krank wird. Lange Zeit galt das Credo: Ein sauberer Zahn wird nicht krank. Meterlange Regale mit Produkten versprechen, uns dabei zu helfen. Wir haben Interdentalbürsten, fluoridierte Zahnseide und antibakterielle Spülungen – und trotzdem haben 95 Prozent der Menschen Karies, 65 Prozent leiden an Parodontitis. Resigniert kommen viele Menschen auf den Gedanken, dass unsere Zähne einfach nicht für Langlebigkeit gemacht sind. Aber bei manchen Menschen halten sie nicht einmal die ersten vier Jahre. Dabei sind unsere Zähne durchaus für ein langes Leben geschaffen. Es hilft ihnen nur nicht weiter, wenn wir sie behandeln wie Autolack. Deshalb ist es gut, dass der neue Blick auf die Mundhöhle derzeit auch die Sichtweise darüber verändert, wie und warum sie krank wird. Langjährig gültige Theorien stehen auf dem Prüfstand und werden korrigiert. Wo lange Zeit Einigkeit herrschte, findet gerade ein Paradigmenwechsel statt. Wir haben gelernt, uns so sehr auf die Bekämpfung von schlechten Bakterien zu konzentrieren, dass diejenigen, die uns guttun und unsere Gesundheit fördern, aus dem Blick geraten sind. Wir haben uns auf Löcher konzentriert, aber die Mechanismen vergessen, die unsere Zähne widerstandsfähig machen und ganz von selbst laufend reparieren. Wir haben gelernt, unsere Zähne als unbelebtes Material zu betrachten, und dabei ganz übersehen zu prüfen, ob sie die Reparaturmethoden, die wir für sie erfunden haben, überhaupt vertragen.
Biologische Zahnmedizin fügt die übersehenen Faktoren zusammen, sie stellt Zusammenhänge her und Traditionen infrage. Sie nimmt Rücksicht auf die empfindliche Biochemie, Physik und Biologie des Körpers. Unser Organismus ist mit enormen Selbstheilungskräften ausgestattet und kann erstaunlich gut regenerieren, wenn man ihn von dem entlastet, was ihn krank macht.
Eine neue Zahnmedizin kann ihn dabei unterstützen. Die wenigsten von uns müssen eine Weltmeisterschaft gewinnen. Aber die meisten von uns wünschen sich, gesund und aktiv bleiben zu können. Manche Menschen suchen schon lange verzweifelt nach Antworten, warum sie krank geworden sind oder einfach nicht mehr so fit sind wie früher. Sie wollen wissen, wie sie selbst dafür sorgen können, dass es ihnen besser geht oder wie sie gesund bleiben können. Wir sollten die zentrale Rolle, die unser Mund dabei spielt, nicht länger übersehen und verleugnen. Wir können uns heute auf so viel mehr verlassen als auf unsere Intuition wie einst der Trainer der brasilianischen Fußballmannschaft. Wir haben neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft und erkennen dadurch körperliche Zusammenhänge, die so deutlich sind, wie noch nie zuvor. Wir müssen uns nicht länger mit Ausschnitten begnügen. Heute sehen wir das ganze Bild.
Let the healing begin!
KAPITEL I
Zähne und Mikrobiologie
Vor etwas mehr als dreihundert Jahren entwickelte ein junger, ruheloser Niederländer das präziseste Vergrößerungsglas, das die Welt bis dahin gesehen hatte. Sein Name war Antoni van Leeuwenhoek und sein eigentlicher Beruf war Tuchmacher. In seiner Freizeit aber war er das, was man heute wohl als Geek bezeichnen würde, ein streberhafter Sonderling. Für ihre Arbeit benutzten Tuchhändler oft Lupen, um die Qualität der Stoffe zu beurteilen. Van Leeuwenhoek aber liebte es, damit auch seine Umgebung zu erforschen. Fasziniert betrachtete er Käferbeine, Fliegenrüssel, die Facettenaugen von Bienen oder die Struktur von Pflanzenblättern. Er entdeckte, dass es hinter der Welt, die wir mit bloßen Augen sehen, noch eine weitere, vielschichttigere gab, die man nur sah, wenn man nah genug hineinzoomen konnte. Dafür lernte er den Linsenschliff und arbeitete auf eigene Faust daran, immer bessere Objektive zu entwerfen. Mehr als 550 Linsen hatte er bearbeitet, bis er schließlich ein Mikroskop mit 275-facher Vergrößerung konstruierte.
Mit dieser »Superlupe« entdeckte er, dass Blut nicht einfach nur eine etwas zähe rote Flüssigkeit ist, sondern dass es einzelne, dicht aneinandergelagerte Plättchen waren, die es rot erscheinen lassen: die roten Blutkörperchen. Auf dieselbe Weise wischte van Leeuwenhoek mal eben die bis dahin gültige Zeugungslehre über die spontane Entstehung von Arten vom Tisch, als er entdeckte, dass in Samenflüssigkeit millionenfach kleinste Spermien umherwimmelten. Da van Leeuwenhoek nun die Erfahrung gemacht hatte, dass alles, was auf den ersten Blick vertraut, auf den zweiten fremd und voller Geheimnisse war, kratzte er sich ein bisschen von dem weißen Belag an den Zähnen ab, den wir alle gut kennen, wenn wir uns ein paar Stunden nicht die Zähne geputzt haben, und betrachtete ihn durch sein Mikroskop. Auch in diesem schmierigen Film gab es etwas zu bestaunen, etwas ziemlich Sonderbares sogar: Es wimmelte dort vor lauter Lebewesen. Einige waren klein und rund, andere recht lang, einige lagen einfach still da, während wieder andere sich munter bewegten. Van Leeuwenhoek konnte sich absolut keinen Reim darauf machen und nannte die Lebewesen schlicht »Dierkens«, kleine Tierchen. Er hatte keine Ahnung, dass er in diesem Augenblick als erster Mensch mit einer ganz besonderen Spezies Bekanntschaft gemacht hatte: den Mikroorganismen. Einzellige Lebewesen waren bis dahin völlig unbekannt, weshalb van Leeuwenhoek recht lange Schwierigkeiten hatte, jemanden von ihrer Existenz zu überzeugen. Man stellte seine Beobachtungen sogar völlig infrage. Hunderte Jahre technischen Fortschritts später leugnet zwar niemand mehr ihre Existenz, aber begriffen haben wir diese unglaublichen Mitbewohner unserer Körper bis heute noch immer nicht.
Was Wissenschaftler bisher sicher sagen können, ist, dass Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Viren die robustesten und langlebigsten Geschöpfe auf der ganzen Welt sind. Man kann ihr Wirken bis zu dem Urknall nachvollziehen, also rund 13,8 Milliarden Jahre zurück. Bis schließlich irgendwann andere Lebewesen hinzukamen, hatten Mikroorganismen die Erde drei Milliarden Jahre lang sogar für sich alleine. Später arrangierten sie sich eben mit allem, was sonst noch auftauchte, und bis heute besiedeln sie so ziemlich jedes Material. Sie leben auf Pflanzen und hängen auf Tieren herum, man findet sie in allen Böden, Sedimenten und auf Gesteinen. Sie können selbst auf Gletschereis, in kochenden Quellen, Felsen oder radioaktiv kontaminierten Wüsten ein schönes Leben führen. Manche haben sogar schon auf Raumfahrzeugen die Erde verlassen. Aber Mikroorganismen sind nicht einfach nur da, sondern sie gestalten Erde und Lebewesen aktiv. In allen ihren Lebensräumen findet man davon deutliche Spuren. Und einer dieser Lebensräume sind wir Menschen.
Das orale Mikrobiom: die Entdeckung einer neuen Welt
Mikroorganismen finden unseren Körper so großartig, dass sie sich sofort über jeden neuen Menschen hermachen, kaum dass er auf der Welt ist. Die ersten Einzeller besiedeln uns, noch während wir uns durch den Geburtskanal quetschen. In der Gebärmutter ist ein Baby quasi steril, aber kaum, dass es den Mund zum ersten Schrei geöffnet hat, sind darin bereits die ersten Organismen eingezogen und richten sich schon mal häuslich ein. Lange bleiben sie nicht allein. Dafür sorgen zwei ziemlich starke Motive, die uns Menschen zeit unseres Lebens antreiben:
Erstens: Wir haben Hunger.Zweitens: Wir wollen erfahren, in was für einer Welt wir leben.In unseren ersten Lebenswochen sind unsere Augen so gut wie blind, und von unseren Händen wissen wir noch nicht einmal, dass wir sie haben. Aber wir haben einen Mund. Unsere gesamte Existenz ist am Anfang ganz auf Oralität eingestellt: Wir sind eine einzige hungrige und neugierige Mundhöhle. Sie dient uns nicht nur zum Essen, sondern als wichtigstes Wahrnehmungsorgan. Nicht umsonst ist sie unserem Gehirn am nächsten und über den kräftigsten Nerv unseres Körpers – den Nervus trigeminus – auf dem direktesten Weg verbunden. Etwa bis zum dritten Lebensjahr schlabbern wir uns durch die Welt, weil wir die Beschaffenheit von Gegenständen und Oberflächen mit dem Mund sehr viel präziser erfassen können als mit unseren Händen, deren Tastsinn sich erst sehr viel später entwickelt. Während wir unseren Kopf auf diese Weise fleißig mit Informationen über unsere Umgebung bestücken, füllt sich unser Mund gleichzeitig mit immer neuen Bewohnern.
Über den Nervus trigeminus, den stärksten Nerven unseres Körpers, sind unsere Zähne direkt an das Hirn angeschlossen.
In den ersten Jahren herrscht darin ein ziemliches Kommen und Gehen. Je nachdem, welche Bedingungen in unserer Mundhöhle gerade herrschen, fühlen sich mal diese oder jene Mikroorganismen darin besonders wohl. Wird ein Kind zum Beispiel abgestillt, packen einige ihren Koffer und verschwinden, da mit der mütterlichen Milch ihre bevorzugte Lebensgrundlage ausbleibt. Dafür ziehen andere ein, die die festere Nahrung bevorzugen, welche die Milch ersetzt. Wieder andere schauen zum ersten Mal vorbei, wenn die ersten Zähne durchbrechen, weil sie unsere Mundhöhle mit solchen harten Substanzen erst so richtig lebenswert finden. Vom Milchgebisswechsel bis zu den permanenten Zähnen wandeln sich die ökologischen Bedingungen in der Mundhöhle einige Male und damit auch immer die Zusammensetzung der Mikrogemeinschaft. Erst im Erwachsenenalter hat jeder von uns die für ihn typische und einzigartige Zusammensetzung erworben. Mikrobiologen bezeichnen sie auch als »residente Mikroflora«, weil sie nun – unter günstigen Bedingungen – relativ stabil bleibt und unter den unterschiedlichsten Bewohnern ein ausgeglichenes Verhältnis herrscht. Es schauen zwar öfter auch mal Mikroben vorbei, die hier eigentlich nichts zu suchen haben, aber solange das Ökosystem nicht nachhaltig gestört ist, haben sie es schwer, sich niederzulassen, und verschwinden bald wieder.
Kleines Lexikon unserer unsichtbaren Mitbewohner
Wenn wir an Bakterien denken, dann häufig in schwarz oder weiß, nämlich in gut oder böse. In Wahrheit haben sie aber ziemlich viele unterschiedliche Eigenschaften, fast so wie wir Menschen. Manche sind etwas genügsamer als andere, manche empfindlich, manche sehr agil, andere eher träge.
Wenn Mikrobiologen Bakterien nach Eigenschaften sortieren, klingt das aber natürlich ein bisschen anders. Ganz grob unterteilen sie die Minimitbewohner unserer Mundhöhle in vier Hauptgruppen: in kommensale, symbiotische, pathogene und opportunistische Mikroorganismen, die trotz aller Unterschiede normalerweise in Symbiose miteinander leben.
Kommensale Bakterien kann man weder als gut noch schlecht bezeichnen. Sie sind einfach da, futtern ein bisschen mit, woraus dem Wirt – also uns – weder ein Vorteil noch ein Nachteil entsteht.
Bei den symbiotischen Bakterien ist es anders: Sie halten ihrem Standort gerne die Treue, und die Produkte, die sie durch ihren Stoffwechsel abgeben, sind gut für uns sowie auch für Teile der mikrobiellen Gemeinschaft.
Unter den kommensalen Bakterien befinden sich allerdings auch welche, die man als opportunistisch bezeichnet, weil sie sich genau so verhalten: Die meiste Zeit sind sie völlig harmlos, es sei denn, es ergibt sich für sie eine Gelegenheit zu wachsen und sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Ab einer bestimmten Anzahl werden sie krankheitsauslösend, also pathogen.
In einem ausgeglichenen System leben sie einfach mit und sind ganz harmlos. Darunter sind selbst solche wie Streptokokken, vor denen wir uns besonders fürchten. Wir vermuten sie in unserem Körper nur dann, wenn wir krank sind. Dabei trifft man sie durchaus auch in einer gesunden Flora an. Ein Streptokokken-Abstrich, auf den vor allem Eltern oft bestehen, wenn das Kind mal Fieber hat, ist deshalb auch in der Regel wenig aussagekräftig.
In der Regel stellen wir uns einen gesunden Mundraum als sauber oder bakterienarm vor. In Wahrheit ist unser Mund aber dann gesund, wenn es darin ziemlich brummt und blüht. Viel entscheidender als Sterilität sind Stabilität und Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Arten. Forscher sind noch dabei, sie zu zählen, aber bisher haben sie rund 700 unterschiedliche Mikrobenspezies entdeckt, die zu einer normalen Mundflora gehören und darin im besten Falle ziemlich viele nützliche Aufgaben erledigen. Wenn uns in der Werbung eine Mundspülung Hilfe verspricht, weil sie besonders antibakteriell ist, so ist dieses Versprechen also fragwürdig. Die Werbung eifert einer ziemlich alten Schule nach.
Während van Leeuwenhoek Bakterien noch neutral bis liebevoll als kleine Tierchen bezeichnete, bekamen sie einige Jahre später ein ziemlich mieses Image. Seitdem Wissenschaftler und Mediziner einige Arten von ihnen als Ursache für Infektionen entdeckten, standen Bakterien bald unter Generalverdacht für das Auslösen von Krankheiten. Seit Jahrzehnten stellen wir sie uns hauptsächlich als lauernde Parasiten vor, die wir bekämpfen müssen. Wir putzen unser Haus mit desinfizierenden Haushaltsreinigern, waschen uns mit antimikrobiellen Seifen und essen mit Antibiotika gefütterte Tiere. Zum Glück schaut man heute ein bisschen differenzierter auf Mikroorganismen. Als van Leeuwenhoek vor mehr als dreihundert Jahren durch ein sehr starkes Vergrößerungsglas blickte, entdeckte er, dass es Lebewesen gibt, die eng mit uns zusammenleben. Die sehr starken Vergrößerungsgläser, die uns heute zur Verfügung stehen, erlauben uns noch sehr viel mehr: Diese Lebewesen näher kennenzulernen – zum Beispiel von ihrer äußerst angenehmen Seite.
Kleine Zellen. Große Hilfe.
Machen wir einen kurzen Ausflug in die Welt der Wirtschaft: Wenn Firmen wachsen, aber trotzdem nicht alles selbst erledigen können oder wollen, dann greifen sie zu einer Strategie, die man »Outsourcing« nennt. Sie lagern bestimmte Aufgabenbereiche einfach an eine Tochterfirma aus. Die kann eine Dienstleistung im besten Falle viel kompetenter ausführen, und die Muttergesellschaft hat wieder mehr Zeit für das Kerngeschäft. Natürlich will diese damit meistens auch kräftig Geld sparen, weil andere die Arbeit eventuell günstiger erledigen als die eigenen Mitarbeiter.
Die Gründe, warum auch unser Körper Aufgaben auslagert, sind noch nicht ganz klar, aber fest steht, dass er es ausgiebig tut. So sourct er zum Beispiel Dinge aus, von denen man vermuten würde, dass die nun wirklich zu seinem Kerngeschäft gehören: unseren Stoffwechsel etwa. Stoffwechsel, also unsere Verdauung, ist gemeint, wenn unser Körper ein Käsebrot in Energie, Nährstoffe und hundert verschiedene passgenaue Bausteinchen verwandelt, die er an allen möglichen Stellen im Körper gebrauchen kann, um ihn zu stärken und zu erhalten.
Bis ein Lebensmittel genau die Form angenommen hat, die dem Körper am besten für seine Zwecke passt, durchläuft es viele, zumeist chemische Prozesse, bis es sich verwandelt hat oder eben: von einem Stoff zu einem anderen wechselt.
Von Vitaminen zum Beispiel denken wir, dass wir sie aufnehmen, indem wir Obst essen. Vitamin K aber bekommt unser Körper dadurch, dass bestimmte Bakterien es für uns herstellen. Unser Körper sagt dann freundlich »Danke!«, nimmt es an sich und reicht es an die Leber weiter, die daraus Gerinnungsfaktoren bauen kann, die zum Beispiel dafür sorgen, dass eine Blutung aufhört, wenn wir uns verletzt haben. Andere Bakterien produzieren zum Beispiel den Nervenbotenstoff Serotonin2, und zwar viel mehr davon als unser Gehirn, wovon man lange Zeit ausgegangen ist. Serotonin sorgt dafür, dass unsere Stimmung ausgeglichen ist und wir uns weniger ängstlich fühlen. Auch für andere Nervenbotenstoffe ist der Darm übrigens ein zentraler Ort: Insgesamt werden hier 95 Prozent aller Neurotransmitter gebildet.
Mensch oder Mikrobe?
Wenn wir jede einzelne Zelle unseres Körpers zählen könnten, würden wir bei einem durchschnittlichen Menschen auf rund 30 Billionen kommen. Zählt man die Zellen aller auf und in uns lebenden Mikroorganismen dazu, dann ergibt das etwa 39 Billionen. Unterm Strich sind wir also etwas mehr Mensch als Mikrobe. Es gibt medizinische Forscher, die empfehlen, nicht länger nur den Menschen allein ins Zentrum zu rücken, sondern ihn als Summe aller seiner Organismen zu betrachten, weil wir nur zusammen mit ihnen funktionieren. Sie gehen so weit, dass sie sagen, Bakterien besiedeln uns Menschen nicht einfach. Sie sind wir. Zusammen mit seinen Mikroorganismen bilde der Mensch einen Superorganismus, einen so genannten Holobionten. Erst wenn wir lernen, den Körper in dieser Gesamtheit zu begreifen, würden wir ihn wirklich begreifen, und in der Folge, warum er krank wird und wie er wieder gesund werden kann. Die wichtige Erkenntnis: Die meisten Krankheiten haben ihre Ursache in einem gestörten Verhältnis von Mensch und Mikrobe.





























