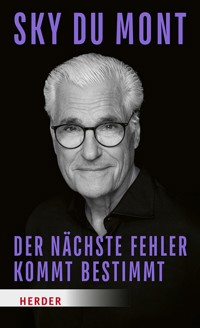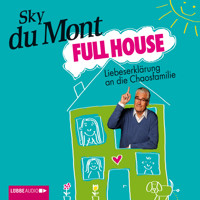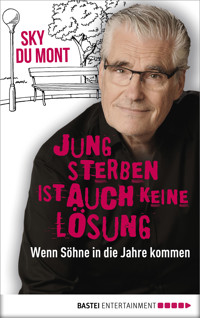2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Blindes Vertrauen kann tödlich sein Sie war der Typ Frau, der die Männer reihenweise zu Füßen liegen. Und tatsächlich soll Schwester Beate nicht nur ein Verhältnis mit dem Oberarzt Dr. Englisch, sondern auch mit dessen jungen Kollegen Dr. Wenger gehabt haben. Als die hübsche Blondine mitten in der Nacht von einem Auto überfahren und getötet wird, geht die Polizei von einem Unfall aus. Doch Mark Richter hat das Gefühl, dass mehr hinter der Sache stecken könnte. Als nun auch noch Richters Tochter Ricarda mit dem jungen Dr. Wenger anbandelt, hält es den besorgten Vater nicht mehr in seinem Krankenbett. Er ist fest entschlossen, Licht in die dunkle Angelegenheit bringen. Der dritte Kriminalroman von einem der beliebtesten Schauspieler Deutschlands!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Sky du Mont
In besten Händen
Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 2007 by Sky du Mont
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-101-9
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
1. Kapitel
1.
Hätte nicht der alte Bergström an diesem Tag wegen einer Beerdigung Urlaub gehabt, es wäre nie zu dem Eklat gekommen. So aber begrüßte ein neuer Clubsekretär die Gäste, und man konnte ihm kaum verübeln, dass er so danebenlag. Bergström hätte die Situation mit souveräner Gelassenheit und formvollendet gerettet – selbst wenn er den ungewöhnlichen Besucher an diesem Sonntagmittag nicht gekannt hätte!
Die Mitglieder der vornehmen »Alstergesellschaft von 1887« schätzten es, ihren Lunch im Kreise der Ihren zu sich zu nehmen – ungestört vom Lärm der weiter südlich gelegenen touristischen Binnenalster und dem »gewöhnlichen Volk«. Im Club war man unter sich. Es war eine Art von Adel, der sich täglich hier begegnete. Doch nicht durch bloße Abstammung, sondern durch eigenes Verdienst zählte man zu den Reihen der »Alstergesellschaft von 1887«. Neue Mitglieder nahm die Gesellschaft nur auf, wenn eines der alten Mitglieder verstarb. Es war vermutlich leichter, in die Académie française aufgenommen zu werden als in die Alstergesellschaft.
Als gegen 12.00 Uhr ein Mann im Jogginganzug das Foyer betrat, schrillten bei dem neuen Clubsekretär gleich die Alarmglocken. Es war offensichtlich, dass sich ein ungebetenes Subjekt Zugang zu den Clubräumen zu verschaffen versuchte! »Verzeihung, mein Herr«, hielt er ihn auf, »darf ich fragen, wohin Sie wollen?«
»In den Salon, denke ich«, antwortete der Jogger und fuhr sich mit dem Ärmel über die schweißnasse Stirn. »Und anschließend vielleicht ins Restaurant.«
»Ah ja«, sagte der Clubsekretär und versuchte, den Mann zurückzudrängen. »Und Sie sind sicher, dass Sie hier richtig sind?«
»Ich denke doch, ja«, erwiderte der Eindringling, machte einen Schritt zur Seite und fragte mit spöttischem Lächeln: »Oder residiert die Alstergesellschaft nicht mehr hier?«
»Gewiss, das tut sie.« Der Clubsekretär hatte sichtlich Mühe, die Fassung zu wahren. Was bildete sich dieser ungepflegte, schwitzende Mensch ein. Er überwand sich und packte den Mann am Ärmel. »Aber nur für Mitglieder. Wenn ich Sie also bitten darf …«
»Hoppla!«, rief der Eindringling und riss sich los. »Wollen Sie mich hier rauswerfen? Vielleicht sollten Sie sich erst einmal erkundigen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich bin Doktor Richter!«
»Gewiss«, sagte der Clubsekretär. »Und ich bin der Kaiser von China. Herr Doktor Richter ist längst hier. Wenn ich Sie also nochmals höflich bitten dürfte … Wir erörtern das besser vor der Tür, an der frischen Luft.« Erneut griff er nach dem Arm des Mannes, doch der stieß ihn von sich und durchmaß mit großen Schritten die Halle, um die Tür zum Salon aufzureißen. Der Clubsekretär hastete hinterher und klammerte sich an den Eindringling, als ginge es um sein Leben oder zumindest um seinen Job, während sich die Gesichter der Anwesenden zu ihnen umwandten.
»Papa!«, rief der Jogger. »Kannst du mir das erklären?« Und er nickte in Richtung auf den deutlich kleineren Empfangschef, der in dieser Sekunde erkannte, dass er zu weit gegangen war, und losließ. »Empfangt ihr neuerdings eure Gäste mit roher körperlicher Gewalt?«
»Mark!«, seufzte ein Mann älteren Semesters und erhob sich aus seinem Clubsessel. »Was ist das denn für ein Auftritt?«
»Verzeihung, Herr Doktor Richter«, stotterte der Clubsekretär. »Er hat sich für Sie ausgegeben …«
»Ich sagte, ich bin Doktor Richter«, korrigierte der Eindringling und blickte den Empfangschef mit süffisantem Lächeln an.
»Nun, das ist er, Kleinschmidt«, erklärte der ältere Herr. »Er trägt nun einmal meinen Nachnamen – und auch denselben Titel.«
Doktor Reinhard C. Richter, Seniorpartner von Richter & Oppenheim, der alteingesessenen Hamburger Privatbank, legte den Arm um seinen Sohn und bugsierte ihn zu seinem Tisch. »Komm, setz dich, dann können die anderen Gäste sich endlich wieder auf ihre Angelegenheiten konzentrieren.«
»Gerne, Papa«, erwiderte Mark Richter. »Wollte nur mal sehen, wie es meinem alten Herrn so geht.«
»Danke. Bis eben konnte ich noch nicht klagen.«
»Das darfst du einem Anwalt nicht sagen«, lachte Mark. »Nicht klagen zu können ist für meinen Berufsstand wenig erquicklich.«
Der alte Mann seufzte und blickte zu seinem Sohn hin, der sich in einem so gar nicht angemessenen Aufzug präsentierte. »Anwalt ohne Zulassung solltest du wohl sagen.«
»Ich könnte sie jederzeit wiederbekommen.« Mark nahm sich eine Traube aus der Schale auf dem Tisch und ließ den Blick durch den Raum schweifen.
»Mir scheint eher, du legst es darauf an, sie möglichst nicht wiederzubekommen«, stichelte sein Vater. Er nahm seine Brille ab und fuhr sich über das immer noch dichte weiße Haar.
»Ach, Papa.« Mark winkte ab. Diese Diskussion hatten sie schon so oft geführt. »Lädst du mich zum Essen ein?«
»In diesem Aufzug?«
»Wieso, du siehst doch perfekt aus.«
»Ich spreche von dir, mein Junge.«
»Oh, für mich ist das fein genug.«
Einen Augenblick schwieg der alte Herr und ließ nachdenklich seine Augen auf diesem Jungen ruhen, der inzwischen selbst ein gemachter Mann sein müsste, der eigentlich gut aussah, intelligent war und, ja, auch charmant – und der doch hier saß wie ein Mann, der bessere Tage gesehen hatte, verschwitzt, unrasiert, abgezehrt. Wenn Mark sich ordentlich anzog, wenn er sein Haar kämmte und sich rasierte, dann war er eine beeindruckende Erscheinung. So aber … Reinhard Richter atmete tief durch. »Für mich ist das zu früh. Aber du kannst dir gerne ein Sandwich bestellen. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen, habe noch etwas zu erledigen.« Er erhob sich, strich sich den Anzug glatt, blickte sich kurz um und klopfte dann seinem Sohn auf die Schulter. »Also, wir sehen uns zu Hause? Deine Mutter würde sich sehr freuen, dich mal wieder bei uns zu begrüßen.« Er war schon im Gehen, als er sich noch einmal umdrehte, zurückkam und sich zu Mark hinunterbeugte. »Und bitte trink keinen Alkohol dazu, ja?«
2.
Es war ein klarer Tag, nicht warm, aber ungewöhnlich windstill. Möwen kreisten über dem Alstervorland. Es tat gut, sich so richtig zu verausgaben. Mark hatte auf das Sandwich verzichtet und hatte den Club schon kurz nach seinem Vater verlassen, um nach Hause zu laufen. Durch die Baumkronen blitzte die Sonne, der Weg war noch nass vom Regen am Vorabend. Studenten führten die Hunde der Reichen spazieren. Mark ärgerte sich, dass er Nelson nicht mit zum Joggen genommen hatte. Dem hätte ein wenig Bewegung auch gutgetan. Mark musste lächeln, als er an den Clubsekretär dachte und daran, wie wunderbar die Szene womöglich eskaliert wäre, wenn er auch noch den Hund dabeigehabt hätte, dieses Riesenvieh, das er von einer Tante mütterlicherseits geerbt hatte.
Es war kurz vor dem Fährpark, als an Mark ein Notarztwagen mit Blaulicht und Sirene vorbeifuhr und gut hundert Meter weiter entfernt auf der Straße stehen blieb. Es schien sich um einen Autounfall zu handeln. Mark sah genauer hin. War das nicht der dunkelblaue Mercedes seines Vaters? Ein seltsames Gefühl beschlich ihn. Mark beschleunigte seine Schritte. Er merkte nicht, wie seine Lunge nach Luft verlangte, wie seine Muskeln sich schmerzhaft spannten, als er über den Rasen rannte. Mit weit aufgerissenen Augen und atemlos erschöpft lief Mark auf den Rettungswagen zu – ehe er am Bordstein umknickte und stürzte.
3.
»Sie sollten dich hierbehalten und mich nach Hause schicken«, sagte mit spöttischem Ton Reinhard Richter und sah zu seinem Sohn auf, der mit verbundener Schulter an seinem Bett stand. »Ich weiß nur nicht, ob sie hier überhaupt eine psychiatrische Abteilung haben.«
»Papa«, seufzte Mark. Sein Mund war trocken, sein Schädel brummte trotz der Medikamente, die er bekommen hatte. »Wie ist das passiert?« Mark sah vor seinem geistigen Auge noch den Wagen seines Vaters vor sich, die weit aufgerissene Fahrertür, die Trage, auf der man ihn in den Laderaum des Rettungswagens schob …
»Ihr Vater ist hier, weil er offenbar am Steuer einen leichten Schlaganfall erlitten hat«, schaltete sich der Arzt ein, der an Reinhard Richters Seite stand.
»Ich erinnere mich«, murmelte Mark. »Das Blaulicht, der Wagen, der Mercedes. Dann war es also kein Unfall …«
»Irgendein Idiot hat mir die Vorfahrt genommen«, entrüstete sich Reinhard Richter.
»Sie sollten sich nicht aufregen«, erinnerte ihn der Arzt.
Mark schloss für einen Moment die Augen. Ein Schlaganfall. Wie alt war sein Vater jetzt? Dreiundachtzig. Und so aktiv wie eh und je. Kein Tag, an dem der alte Reinhard Richter nicht wenigstens zehn Stunden im Büro oder bei Geschäftsterminen verbrachte, kein Empfang, bei dem er nicht zugegen war, keine repräsentative Pflicht, die er nicht für sein Hanseatisches Beteiligungs-Kontor wahrgenommen hätte. Es war kein Wunder, wenn er einen Schlaganfall erlitt. »Ist es sehr schlimm?«, fragte er.
»Wir werden Ihren Vater ein paar Tage zur Beobachtung hierbehalten«, erwiderte der Arzt. »Soweit wir bisher sagen können, sind seine Körperfunktionen im Großen und Ganzen unbeeinträchtigt geblieben …«
»Herr Doktor«, unterbrach ihn Richter. »Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie nicht von mir in der dritten Person sprächen. Immerhin bin ich noch kein vergreister Trottel!«
»Entschuldigen Sie, Herr Doktor Richter.« Der Arzt sah auf seinen Beeper. »Ah, ich werde gerufen. Wenn Sie mich bitte entschuldigen …«
Er war gerade an der Tür, als von draußen ein aufgeregter Wortwechsel hereindrang. Unmittelbar darauf öffnete sich die Tür, und Mark musste lächeln, als er eine ihm wohlbekannte Stimme hörte: »Papperlapapp, Besuchszeiten. So ein Unfug. Ich wüsste nicht, dass Sie mir etwas zu sagen hätten …«
4.
Viola Richter liebte den großen Auftritt. Doch was nun folgte, überstieg ihr Talent zur Inszenierung. Sie hatte mit einem Patienten gerechnet. Stattdessen sah sie sich plötzlich ihrem Mann und ihrem Sohn gegenüber, der eine im Krankenbett, doch scheinbar munter, der andere mit bedrückter Miene und verbundener Schulter. »Was haben Sie mit meinem Sohn gemacht?«, fuhr sie den Arzt barsch an und eilte auf Mark zu, der sich tapfer bemühte, einen gefassten Eindruck zu machen. »Mama!«
»Mark. Was ist mit dir?«, flehte die alte Dame und nestelte heftig an ihren Handschuhen, die sie aber vor Aufregung kaum von den Händen brachte. »Was ist mit ihm?«, fragte sie noch einmal den Arzt. Es war unschwer zu erkennen, dass sie mühsam um Fassung rang. Dennoch war sie in ihrem Dior-Kostüm und mit ihrer kerzengeraden Haltung eine eindrucksvolle Person.
»Gnädige Frau«, versuchte der Arzt mit beschwichtigender Stimme. »Hier muss ein Missverständnis vorliegen. Ihr Sohn …?« Er sah mit fragender Miene zu Mark hin, der nickte, und fuhr dann fort: »Ihr Sohn hat lediglich eine leichte Gehirnerschütterung und einen Haarriss der Schulterkapsel. Ihr Gatte dagegen hat einen Gehirnschlag erlitten.« Er wies mit der Hand auf Reinhard Richter, als müsse er die Dame darauf hinweisen, welcher von beiden ihr Ehemann sei.
»Reinhard«, sagte Viola Richter mit strengem Ton. »Was hast du wieder angestellt.« Und zum Arzt gewandt: »War Alkohol im Spiel?«
Der Arzt hob nur vage die Hände. Doch das war der alten Dame Beweis genug. »Da siehst du es. Die Trinkerei ist ein Fluch. Und du wirst daran zugrunde gehen.«
»Also Viola«, verteidigte sich Reinhard Richter, »ich muss schon sagen, von uns beiden bist eindeutig du …«
»Reinhard, du vergisst dich!«, fuhr ihm seine Frau ins Wort. Sie nahm Marks Hand und seufzte: »Ach, mein Junge. Was machst du nur immer für Sachen.«
Von der Tür her war ein Hüsteln zu hören. »Ähm, ich stör ja ungern, aber vielleicht könnte uns Herr Doktor Wenger kurz erzählen, was Sache ist?« Eine junge Frau um die zwanzig trat ein und streckte dem Arzt selbstbewusst eine Hand entgegen. »Ricarda Richter. Sieht so aus, als hätten Sie meinen Vater und meinen Großvater hier bei sich zur Pflege.«
2. Kapitel
1.
»Tja«, sagte Doktor Englisch, Oberarzt an der Hamburger Feilhauer-Klinik, und blickte Mark über den Rand seiner Brille hinweg an. »Damit ist nicht zu spaßen. Es hätte auch tödlich ausgehen können. Ihr Vater ist Gott sei Dank trotz seines stolzen Alters sehr rüstig.«
Rüstig. Ein Wort, das Mark nicht gerne hörte. Rüstig nannte man Greise, keine Männer, die noch mitten im Leben standen. Andererseits: Würde sein Vater jemals wieder so die Puppen tanzen lassen können, wie er das all die Jahre über getan hatte, seit Mark sich erinnern konnte?
Der Arzt sah ihm die Frage förmlich an. »Um es gleich zu sagen, es wird nicht mehr alles so sein wie früher. Ihr Vater wird zwar weiterhin ein normales Leben führen können – das hoffen wir zumindest –, aber er wird ein paar Gänge runterschalten müssen. Immerhin ist er über achtzig …« Doktor Englisch stand auf und ging zum Fenster, wo er, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, stehen blieb und eine kleine Weile schweigend hinausblickte. »Ich bin geneigt zu sagen, der Stress sei für den Schlaganfall verantwortlich. Doch das wäre nur die halbe Wahrheit. Man muss bedenken, dass es auch dieser Stress war, der ihn bisher so fit gehalten hat. Das Teilnehmen am öffentlichen Leben, die Verantwortung, die er bis zuletzt in seiner beruflichen Stellung hatte. Ihr Vater war ja kein Unbekannter …«
»Aber so sprechen Sie doch nicht immer in der Vergangenheit von ihm, Herr Doktor«, unterbrach ihn Mark. »Immerhin lebt er ja noch und ist auf dem Weg der Besserung. Hoffentlich.«
»Aber sicher!«, betonte der Oberarzt und hob die buschigen Augenbrauen. »Meine Prognose ist gut. Aber wissen Sie, ich kenne Männer wie Ihren Vater. Wenn Sie in zwei, drei Tagen hier rausmarschieren und tun, als wäre nichts gewesen, dann geht das völlig in Ordnung. Ihre Gehirnerschütterung hatte einen äußeren Anlass, und der wird sich hoffentlich nicht wiederholen. Wenn Ihr Vater in einiger Zeit die Klinik verlässt und tut, als wäre nichts gewesen, dann haben wir ihn schneller wieder hier, als Sie alle sich das vorstellen können.«
»Verstehe«, sagte Mark. »Das wird nicht leicht sein.«
»Kann ich mir vorstellen.« Der Arzt lächelte und kehrte zu seinem Stuhl zurück.
»Sie sagen: Wenn er in einiger Zeit die Klinik verlässt … Wie lange rechnen Sie, dass er hierbleiben muss?«
»Schwer zu sagen. Erst mal müssen wir ihn ein paar Tage beobachten …«
Das Telefon klingelte, Doktor Englisch nahm den Hörer ab und meldete sich mit einem knappen »Ja«. Dann lauschte er. »Und die wollen was?«, fragte er. »Mein Gott, ja, sagen Sie ihnen, sie sollen im Institut anrufen, die sollen ihnen einfach die Kopien schicken. Oder besser, Sie rufen im Institut an und sagen es denen. Einfach die letzten drei oder vier Jahrgänge. Ja.« Englisch musterte Mark mit düsterem Blick, während er wieder lauschte. »Ich finde das albern, Wenger«, sagte der Arzt ungehalten.
Wenger, dachte Mark. Offenbar war der Arzt, der ihn behandelt hatte, die rechte Hand des Oberarztes.
»Die Sache ist doch klar«, raunzte Englisch in den Hörer. »Seit Paduani tot ist, herrscht hier dieses lächerliche Kompetenzgerangel. Machen Sie kurzen Prozess mit den Herren und … Ja, ja, natürlich, alles auf die sanfte Art. Also. Bis dann.« Er legte auf.
»Ärger mit den Behörden wegen eines Todesfalls?«
Englisch schürzte die Lippen. »Ja. So kann man das auch sagen.« Er suchte etwas in der Tasche seines Kittels. »Kein Patient. Keine Sorge.« Die Suche war offenbar erfolglos, weil er sich nun mit gefurchter Stirn auf dem Schreibtisch umsah. »Unser Chefarzt«, erklärte er. »Krebs«, als wäre damit alles gesagt.
»Das tut mir leid.«
»Tja«, sagte Englisch und blickte auf. »Damit ist nicht zu spaßen.«
2.
»Mein Gott, Junge, wie siehst du denn aus?«, entrüstete sich Viola Richter und fuhr ihrem Sohn mit den Fingern durch das immer noch volle, aber schon leicht ergraute Haar. Sie roch nach Chanel No. 5 und Plymouth Gin. Mark atmete ihren Duft ein wie eine lieb gewonnene Erinnerung. Eins Komma zwei Promille, schätzte er und warf einen Blick aus dem Fenster. Ja, es war noch nicht Mittag, da durfte das etwa hinkommen.
»Wie geht es dir, Mama?«, fragte er und betrachtete die Sorgenfalten auf der Stirn seiner immer noch schönen Mutter, die stets größte Sorgfalt auf ihre Erscheinung verwendete. Wie immer war ihr leicht getöntes Haar perfekt arrangiert, und sie trug ein Paar exquisite Ohrringe, die den vielleicht ein wenig zu harten Gesichtszügen eine etwas weichere Note gaben. Ja, seine Mutter hatte Stil, das stand fest.
»Mir geht es wie immer, mein Junge.« Die alte Dame griff nach dem Knopf über Marks Bett und drückte ihn. Einmal. Zweimal. Und zur Sicherheit noch ein drittes Mal.
»Alles in Ordnung?«, fragte Mark irritiert.
»Junge. Hier ist nichts in Ordnung! Was soll das hier für eine Verpflegung sein? Das Nachttischchen biegt sich vor alten Tassen und Kannen. Du müsstest dringend zum Friseur. Und dein Pyjama sieht aus, als hättest du darin geschlafen!«
»Ich habe darin geschlafen, Mama«, erwiderte Mark und überlegte, ob ihm die alte Dame bei aller Liebe nicht doch etwas auf die Nerven ging. »Warst du schon bei Papa?«
»Natürlich war ich bei deinem Vater! Man kann ihn kaum aus den Augen lassen. Er ist so unvernünftig!«
»Aber warum bist du dann nicht ein bisschen bei ihm geblieben?«
»Er wollte nicht gestört werden«, stellte sie pikiert fest und streifte sich einen unsichtbaren Staubkrümel von der violetten Seidenbluse.
»Gestört? Du meinst, er wollte schlafen.«
»Wo denkst du hin, mein Junge, er hing ununterbrochen am Telefon. Ein Gespräch mit Singapur, ein Gespräch mit London, eines mit Mailand …«
»Singapur? Du übertreibst, Mama«, rügte Mark. »In Singapur ist es tiefste Nacht.«
»Siehst du? Das ist es, was ich meine! Er lässt die Leute nicht einmal schlafen, wenn er auf dem Krankenbett liegt.«
Mark musste lachen, doch das verursachte ihm Kopfschmerzen, sodass er das Gesicht verzog und sich ins Kissen zurücksinken ließ.
»Was du zu wenig hast«, schloss Viola Richter, »das hat dein Vater zu viel. Er kann einfach nicht anders. Immer steht er unter Strom.«
Die Schwester trat ein. »Sie haben geklingelt, Herr Richter?«
»Ich habe geklingelt«, stellte Viola Richter fest. »Ich möchte gerne den Chefarzt sprechen. Er soll bitte zu uns kommen. Ach, und würden Sie mir dann bitte einen Gin bringen?« In das verblüffte Schweigen der Schwester hinein ergänzte sie: »Ohne Eis.«
Die Schwester lachte hell auf. »Ohne Eis können Sie haben«, sagte sie dann. »Nur Gin haben wir hier ganz sicher nicht. Sie meinen doch Gin, den Schnaps, oder?«
»Wenn ich Gin sage, meine ich für gewöhnlich Gin«, stellte Viola Richter klar. »Ehe Sie mir irgendeinen …« Sie zögerte einen winzigen Augenblick und betonte das Wort, als würde sie von einem Eimer voll Waschwasser sprechen. »… einen Schnaps bringen, lassen Sie es lieber ganz bleiben.« Sie verdrehte die Augen und neigte sich ein wenig zu Mark hin, sprach aber laut genug, dass auch die Schwester verstehen konnte, wie sie sagte: »Dein Vater spricht nicht umsonst immer von der Servicewüste Deutschland.«
Eins Komma acht Promille, entschied Mark.
Zur Schwester aber sagte Viola Richter: »Dann schicken Sie uns nur den Chefarzt.«
»Das wird leider nicht gehen, Madame«, entgegnete die Schwester und betonte das Wort »Madame« wie Marks Mutter das Wort »Schnaps« betont hatte. »Einen Chefarzt haben wir zurzeit nicht. Herr Doktor Englisch, unser Oberarzt, leitet die Klinik kommissarisch.«
»Kommissarisch. So.«
»Ich war eben erst bei ihm«, warf Mark ein, als seine Mutter ihn prüfend ansah.
»Nun, dann brauchen wir ihn auch nicht kommen zu lassen, nicht wahr?« Sie wedelte mit der Hand zur Schwester hin. »Sie können gehen. Danke.«
Die Schwester drehte sich auf dem Absatz um und rauschte zur Tür hinaus.
Mark wandte sich seiner Mutter zu. »Mama«, sagte er in leicht tadelndem Tonfall, »das ist hier ein Krankenhaus und keine Bar.« Mühsam richtete er sich wieder auf. »Der Arzt sagt, ich kann in zwei, drei Tagen wieder raus.«
Viola Richter lächelte ihren Sohn verbindlich an und griff in ihre voluminöse Krokoledertasche.
»Bei Papa ist es etwas heikler«, tastete sich Mark weiter vor, während er beobachtete, wie seine Mutter einen silbernen Flachmann hervorzog und aufschraubte. »Der Oberarzt meint zwar, dass er früher oder später wieder auf den Beinen sein wird …«
»Früher oder später?«
»Er wollte sich nicht festlegen.«
»Oh«, kommentierte Viola Richter. Sie füllte den Deckel der Flasche mit einer klaren Flüssigkeit und hielt ihn ihrem Sohn hin. »Gin?«
Mark schüttelte den Kopf und sank sogleich wieder in das Kissen. Er stöhnte auf und fluchte innerlich. Er musste endlich dran denken, den Schädel ruhig zu halten. »Er sagt«, fuhr er nach einer Weile fort, während seine Mutter den Deckel noch ein zweites Mal gefüllt und wieder geleert hatte, »Papa sei in einem verhältnismäßig guten Zustand. Aber er dürfe nicht, wenn er raus ist, so tun, als wäre nichts gewesen.«
»Keine Sorge«, sagte Viola Richter und steckte die Flasche wieder weg. »Das wird er nicht tun, wenn er wieder raus ist.« Sie seufzte. »Das tut er jetzt schon.«
Nun war es Mark, der zur Klingel griff. Viola Richter zog die Augenbrauen hoch und musterte ihn überrascht. Doch sie sagte nichts. Die Schwester kam erneut. Diesmal streckte sie nur noch den Kopf zur Tür herein.
»Hätten Sie etwas Eis für mich?«, fragte Mark. Er sah, wie die Schwester den Mund öffnete und wieder schloss. Sie blickte von Mark zu seiner Mutter und zurück. Dann machte sie Anstalten, die Tür ohne ein weiteres Wort wieder zu schließen. »Schwester!«, rief Mark und erklärte, als sie doch noch einmal hereinschaute: »Es ist für meinen Kopf. Ich habe Schmerzen.«
3.
Heiteres Sonnenlicht blinzelte durch das Blätterdach der alten Ulmen auf die gekiesten Wege, die den kleinen Park hinter der Klinik durchzogen. Es war ein Tag wie gemalt, und Mark wünschte, er wäre endlich wieder draußen. Er war bestimmt kein Sportsmann, doch mit Turnschuhen an den Füßen im Grünen unterwegs fühlte er sich wohler als an jedem anderen Ort. Das musste mit seiner früheren Tätigkeit im Rathaus zu tun haben, als er das Büro oft erst spät in der Nacht hatte verlassen können, um am nächsten Tag bereits in der Morgendämmerung wieder am Schreibtisch zu sitzen. Moderne Sklavenarbeit, wie man sie von freien Mitarbeitern oder politischen Referenten erwartete. In seinem Fall hatte die unglückliche Konstellation bestanden, dass er beides gewesen war: freier Mitarbeiter und politischer Referent. Wäre nicht Alexandra gewesen, er wäre wahrscheinlich verrückt geworden, hätte sich wie ein Hamster im Laufrad so lange auf der Stelle bewegt, bis er irgendwann mit einem Herzinfarkt auf dem alten Eichenparkett gelegen hätte. Doch schlimmer noch war der Zynismus des politischen Geschäfts gewesen. Es ging nicht um die Sache, es ging nur um die Macht. Eiskalt hatte man ihn Gesetzesentwurf und Gegenentwurf im selben Atemzug entwerfen lassen, als stünden dahinter nicht die Schicksale zahlloser Menschen. Nein, der Rechtsstaat war ein Witz, leider ein schlechter. Die Hüter der Staates fühlten sich nicht mehr ihren Wahlversprechen verpflichtet. Der Zweck, nämlich der Erhalt der Macht, heiligte die Mittel. Dieser kleine Funke Rebellion, der schon seit seiner Jugend in ihm geschlummert hatte, brach nun mit vehementer Kraft aus ihm heraus. Die Regeln des Staates bedurften in Marks Augen einer gründlichen Revision. So konnte und wollte er viele Gesetze nicht akzeptieren. Und so weigerte er sich immer häufiger, für Vergehen, die in seinen Augen keine waren, Strafe zu bezahlen.
Mark strich sich mit beiden Händen übers Gesicht, um die Schatten der Vergangenheit zu vertreiben. Er wollte diesen schönen Tag genießen, und sei es hier am Fenster seines Krankenhauszimmers stehend. Er lauschte den Geräuschen, die durch den Spalt des gekippten Fensters hereindrangen, dem fernen Straßenverkehr, dem leisen Rauschen, das stets über Hamburg lag, den Stimmen der Patienten und Besucher, die im Park spazieren gingen, dem Lachen von Ricarda, das gedämpft an sein Ohr drang … dem Lachen von Ricarda? Er schaute genauer, ließ den Blick über den Rasen schweifen. Auf einer Bank entdeckte er tatsächlich seine Tochter zusammen mit – Doktor Wenger, beide unterhielten sich offensichtlich glänzend, ja, es sah fast so aus, als würden beide heiß miteinander flirten.
Wieder drang das Lachen Ricardas herauf. Mark kniff die Augen zusammen und schaute so angestrengt, dass sich schon nach wenigen Sekunden die Kopfschmerzen wieder zurückmeldeten. Plötzlich standen beide auf und schlenderten auf das Haus zu. Vermutlich würde seine Tochter in wenigen Augenblicken bei ihm im Zimmer auftauchen. Er legte sich schnell zurück ins Bett und setzte seine bewährte Leidensmiene auf. Er musste innerlich schmunzeln. Obwohl Ricarda längst erwachsen war, versetzte ihm jeder kleine Flirt seiner Tochter mit einem Mann einen Stich. Er wusste sehr wohl, wie lächerlich er sich damit machte, also beschloss er, den verständnisvollen, toleranten Vater zu spielen. Im selben Augenblick wurde ihm aber klar, dass ihm das mit Sicherheit doch wieder nicht gelingen würde.
Auf dem Flur waren Schritte zu hören, doch es kam niemand herein. Wahrscheinlich besuchte sie erst Papa. Das konnte etwas dauern. Mark nahm eine Zeitschrift zur Hand und blätterte darin, doch er konnte sich nicht konzentrieren. Immer wieder glitten seine Gedanken ab, und es schwebte ihm das Bild seiner Tochter mit dem Mediziner vor Augen. Sicher, der Mann hatte seine Qualitäten. Zweifellos war er intelligent und auch ziemlich gut aussehend, wenn man das als Vater einigermaßen neutral beurteilen konnte. Mama hätte ihn vermutlich außerdem für eine relativ gute Partie gehalten. Ricardas letzter Freund war jedenfalls Mitglied einer Punkband gewesen. Mit allem, was dazugehörte. Grüne Haarbüschel, Tattoos und ein Piercing in der Nase. Für Mark spielte dergleichen keine Rolle. Seit er sich selbst frei gemacht hatte von den Regeln der sogenannten Gesellschaft.
Mark seufzte. Mit Alexandra hatte er sich darüber in den letzten Monaten vor dem Unglück häufiger gestritten. Sie hatte ihm vorgeworfen, seine Zukunft, ihre gemeinsame Zukunft zu gefährden. Doch Mark hatte nicht einsehen wollen, dass er das angenehme Leben auf später verschieben sollte, nur um im Hier und Jetzt das ohnehin beträchtliche Familienvermögen noch weiter zu vergrößern. Mark legte die Zeitschrift beiseite. Es war schon merkwürdig. Bei den meisten Paaren hatte er beobachtet, dass sie sich, je länger sie zusammenlebten, immer ähnlicher wurden. Bei ihm und seiner Frau war es genau umgekehrt gewesen: Je länger sie zusammenwaren, umso tiefer wurden die Gräben, die zwischen ihren Meinungen und Ideen, ihren Hoffnungen und Wünschen verliefen. Dabei hatte er seine Frau immer geliebt, ja, es schien ihm, als wäre seine Liebe zu Alexandra immer noch gewachsen. Ob ihre Liebe zu ihm indes gewachsen war, hätte er beim besten Willen nicht zu sagen gewusst.
4.
»Sie sind eine interessante Frau, wissen Sie das?«, sagte Doktor Steffen Wenger und blinzelte in die Herbstsonne, die durch das schon etwas fadenscheinige Blätterdach der Buchen fiel.
»Und Sie sind ein ziemlicher Charmeur«, sagte Ricarda und warf ihr volles, dunkles Haar über die Schulter, »wissen Sie das?«
»Nur, wenn ich nicht anders kann. Kommen Sie, gehen wir ein Stück gemeinsam. Sie wollen doch auch ins Haupthaus?«
»Klar. Ich habe ja zwei Patienten bei Ihnen.«
»Erzählen Sie mir ein bisschen von Ihren Träumen.«
Ricarda lachte auf. »Sind Sie auch Seelenklempner? Oder ist das nur eine Methode, einen besseren Zugang zu Ihren Patienten zu bekommen?«
»Oh, weder noch. Das ist lediglich Interesse. Sie sind eine attraktive junge Frau und kommen aus einer angesehenen Familie, Sie sind von Hause aus reich. Da fragt man sich natürlich, welche Ziele jemand hat, der vom Glück so begünstigt wurde.«
»Ach, so sehen Sie das? Na ja, vielleicht stimmt die Analyse ja. Sie wäre zumindest eine Erklärung dafür, dass ich ständig mein Studienfach wechsle.«
»Ah ja? Und was ist es jetzt?«
»Kunstgeschichte, Kunsttheorie und Grafikdesign.«
»Sie haben es auf eine Karriere im Kunsthandel abgesehen. Oder als Kuratorin in einem der großen Museen? Bei den Beziehungen Ihres Großvaters sehe ich Sie schon vor mir als Leiterin der Eremitage in Sankt Petersburg.«
Die Bemerkung missfiel Ricarda. Sie war es gewohnt, dass alle Welt mutmaßte, jede gute Note, die sie schrieb, jedes gelungene Vorhaben, das sie anpackte, wäre nichts weiter als das Ergebnis der geschäftigen Erfolge ihres Großvaters. »Vermutlich«, sagte sie betont knapp, »Aber ich habe es nicht auf eine Karriere als Hüterin der Kunstwerke anderer abgesehen. Ich werde Konzeptkünstlerin.«
»Oh.« Wenger schwieg eine Weile. Es war offensichtlich, dass er nicht sicher war, was eine Konzeptkünstlerin war. Ricarda genoss die Verlegenheit und schwieg ebenfalls. Schließlich fragte Wenger: »Und was macht man so als Konzeptkünstlerin? Ich bin Arzt, und von moderner Kunst verstehe ich so gut wie nichts.«
»Nun, je nachdem, durch welche Mittel man sich künstlerisch ausdrücken will, greift man auf Tanz, Theater, Malerei, Bildhauerei, Literatur zurück, auf Vortrag oder Video, bewegte oder statische Bilder.«
»Ah, ich verstehe.« Man sah Wenger deutlich an, dass er von alldem nichts verstanden hatte. »Das klingt aufregend. Ich kann mir vorstellen, dass das großen Spaß macht.«
»Tut es«, bestätigte Ricarda. »Na ja, sagen wir: täte es.«
»Täte es?«
»Wenn es nicht so verdammt schwer wäre, Konzeptkunst zu platzieren. Sie können sich nicht vorstellen, wie spießig die Kunstszene ist.« Sie sah ihn von der Seite an. »Und auf die guten Verbindungen meines Großvaters möchte ich mich nicht berufen.«
»Sie wollen das allein schaffen«, stellte Wenger fest und blieb stehen.
»Exakt.«
Er überlegte. »Vielleicht kann ich Ihnen dabei helfen.«
»Echt?«
»Es gibt da eine Stiftung, zu der ich ganz gute Kontakte habe, weil unser ehemaliger Chefarzt dort Vorsitzender war. Vielleicht kennen Sie sie: die Paduani-Stiftung.«
»Sagt mir nichts.«
»Sie fördert vielversprechende Kunstprojekte, und ich könnte arrangieren, dass Sie dort vor den entsprechenden Leuten Ihr Projekt vorstellen.«
Ricarda strahlte Wenger an. Vielleicht war das die Chance. Vielleicht hatte sie gerade das Gespräch geführt, das ihrem Leben die entscheidende Wendung geben würde.
5.
Es klopfte. Mark schloss die Augen und neigte den Kopf zur Seite. Es klopfte noch einmal, doch er stellte sich schlafend. Die Tür wurde geöffnet, und jemand kam auf leisen Sohlen ins Zimmer, trat an sein Bett und verharrte dort eine kleine Weile wort- und regungslos. Es fiel Mark schwer, ein Grinsen zu unterdrücken.
Ein Rascheln, dann ein paar Schritte im Zimmer, das Rauschen von Wasser, kurze Stille und erneut einige Schritte. Mark spähte unter fast geschlossenen Lidern hervor und erschrak, als er sah, dass Ricarda ihm direkt in die Augen blickte.
»Tu nicht so«, lachte sie. »Ich weiß doch, dass du nicht schläfst.«
»Wieso? Sah es nicht echt aus?«
»Doch, täuschend echt. Aber du schnarchst, wenn du schläfst.«
»Ich schnarche nicht.« Mark richtete sich scheinbar empört auf.
Ricarda lachte. »Das sagt Großmama auch immer. Und trotzdem zieht Großpapa jede zweite Nacht ins Gästezimmer.«
»Du hast mir Blumen mitgebracht. Das ist wirklich lieb von dir.«
»Ja. So bin ich eben.« Sie setzte sich zu ihm ans Bett und legte ihre Hand auf die seine. »Ich hoffe, du kommst bald wieder raus. Ihr beide«
»Das hoffe ich auch, Ricki.« Er seufzte. »Lust auf eine Partie Schach?«
Im Nu war seine Tochter wieder aufgesprungen. »Keine Zeit«, beschied sie ihn hastig. Etwas zu hastig, wie er fand. »Ich muss noch zu Großpapa. Und dann muss ich wieder in die Uni.«
»Aber es ist Sonntag!«
»Ach, ja. Privater Arbeitskreis. Wir wollen vorwärtskommen, wenn du verstehst, was ich meine.« Ricarda lächelte und schnappte sich ihre Tasche. »Also dann, tschüs.«
»Bis dann«, sagte Mark, doch das hörte sie schon nicht mehr.
6.
Es war hier, dachte Mark, hier in dieser Klinik. Wahrscheinlich hat sie schon nicht mehr gelebt, als sie hier angekommen ist. Dennoch: Es gruselte ihn, als er daran dachte, dass sein Vater und er in dasselbe Krankenhaus gebracht worden waren, in dem seine Frau nach ihrem Unfall verstorben war. Mark stand auf dem Flur und schaute einmal mehr in den Park hinab, der im schönsten Herbstlicht dalag und gut und gerne zu einem Nobelhotel hätte gehören können.
»Alles in Ordnung, Herr Richter?«, fragte die Krankenschwester, die mit ihrem Tablett mit den Fieberthermometern unterwegs war.
Mark seufzte. »Doch, doch«, sagte er leise und drehte sich um, um wieder in seinem Zimmer zu verschwinden.
»Nehmen Sie doch gleich Ihr Thermometer mit«, rief die Schwester ihm nach.
»Mein was?« Mark wandte sich um.
»Zum Temperaturmessen«, erklärte sie.
»Danke, sehr freundlich«, erwiderte Mark, »ich weiß, wozu die Dinger gut sind. Aber Sie werden von mir nicht erwarten, dass ich meine Temperatur messe. Ich meine, ich habe eine Gehirnerschütterung und eine harmlose Schulterverletzung, nicht wahr? Und keinen Infekt oder so was.«
»Ach«, lachte die Schwester unbekümmert, »so genau nehmen wir das hier nicht. Messen Sie – und wir überlegen uns dann, was wir daraus machen.«
Mark machte eine ablehnende Handbewegung. »Ich halte das in meinem Fall für unnötig«, murmelte er und verschwand in seinem Zimmer. »Blödsinn«, schimpfte er leise, während er sich auf sein Bett fallen ließ, was er aber sogleich mit heftigen Kopfschmerzen büßte.
Die Tür ging auf. Die Krankenschwester trat herein. Sie hatte nichts von ihrem professionellen Charme verloren, während sie vor ihn hintrat, ihm das Thermometer unter die Nase hielt und in aller Gelassenheit sagte: »Sie können gerne unter der Zunge messen, wenn Ihnen das lieber ist – die anderen Patienten messen woanders …« Sie lächelte siegesgewiss. »Jedenfalls: Gemessen werden muss. Sie sind hier in einer Klinik, und da gelten unsere Spielregeln. Schöne Blumen, die Sie da bekommen haben.«
Mark bewegte den Kopf lieber nicht, sondern machte nur kurz die Augen zu, um zu zeigen, dass er sich in sein Schicksal gefügt hatte. »Kann ich wenigstens noch ein bisschen Tee haben?«, fragte er mit Leidensmiene.
»Immer gern!«, erwiderte die Schwester, die ein wenig drall, aber durchaus attraktiv war, wie Mark aus den Augenwinkeln feststellte. Sie entsprach wahrscheinlich genau dem Typ Frau, den sein Vater unwiderstehlich fand. Sie stellte ihr Tablett ab, trat kurz nach draußen, um sogleich wieder mit einer Kanne frischen Tees zurückzukommen und ihm etwas in die leere Tasse zu gießen. »Wir wollen ja, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.«
»Damit ich möglichst oft wiederkomme, oder was?« Langsam, ganz langsam drehte sich Mark auf den Rücken.
»Nur, wenn es wirklich nötig ist. Und das wollen wir natürlich nicht hoffen«, sagte die Schwester und nahm ihr Tablett wieder auf. »Sie sollten sich jetzt besser auf die Seite legen. Sie wissen schon: wegen dem Thermometer.«
»Zu Befehl«, murmelte Mark, rollte sich wieder zur Seite und wartete, bis die Tür sich hinter der Schwester schloss, ehe er das Thermometer in die frisch gefüllte Tasse tauchte und zusah, wie sich seine Temperatur in Windeseile lebensbedrohlich erhöhte.
Als die Schwester keine halbe Stunde später in sein Zimmer trat, war von Mark Richter nichts zu sehen Sie nahm das Thermometer aus der Tasse, warf einen kurzen Blick darauf und betrachtete es kopfschüttelnd, dann begann sie, das Bett zu machen. Als sie die Vorhänge aufzog, sah sie ihren Patienten schräg gegenüber und ein Stockwerk tiefer am Fenster eines anderen Krankenzimmers stehen. Offenbar hatte er nach seinem Vater auf der Intensivstation sehen wollen.
7.
Mark drehte sich wieder zu seinem Vater um. Sein Zustand hatte sich wieder verschlechtert. So krank hatte er seinen alten Herrn noch nie gesehen. Mit einem Schlaganfall war eben nicht zu spaßen. Er seufzte und berührte im Vorbeigehen nur sacht das Bein seines Vaters, um ihn nicht zu wecken.
Vor der Tür traf er Dr. Wenger. »Wie geht es ihm?«, fragte der.
»Das müssten Sie mir sagen, Doktor.« Mark zuckte mit den Achseln. »Er schläft.«
»Das ist das Beste, was er tun kann«, erwiderte der Arzt.
»Ich weiß nicht«, murmelte Mark. »Ich denke nicht, dass er in den letzten fünfzig Jahren um diese Tageszeit geschlafen hat.« Mark sah unwillkürlich auf seine Uhr. Es war gerade erst kurz nach fünf.
Dr. Wenger nickte und sah Mark in die Augen. »Ja«, sagte er. »Das kann ich mir denken. Aber sehen Sie«, der Arzt griff sich an die Seite, um den Beeper auszuschalten, der Laut gab, »gönnen wir ihm seine Ruhe. Ich kann etwas später noch mal wiederkommen.« Mit einer knappen Handbewegung verabschiedete er sich und ging schnellen Schrittes den Gang hinunter.
Mark aber wurde das Gefühl nicht los, als sei es weniger die Rücksichtnahme als vielmehr der Beeper gewesen, der den Arzt hatte davoneilen lassen. Langsam, um seinen empfindlichen Kopf nicht allzu sehr zu erschüttern, ging er zum Lift und fuhr nach unten, um sich am Kiosk nach etwas Lesbarem umzusehen. Doch dort stellte er fest, dass er kein Geld bei sich hatte. Also kehrte er um und ging wieder auf sein Zimmer. Die Schwester hatte inzwischen für etwas Ordnung gesorgt.
Er schaltete den Fernseher ein und zappte durch die Programme. Nichts. Er schaltete wieder aus und griff nach der Zigarettenschachtel, die natürlich nicht vorhanden war. Mein Gott, dachte er, scheint doch ein härterer Sturz gewesen zu sein. Wie lange rauche ich schon nicht mehr? Zehn Jahre? Fünfzehn? Es waren gut zwanzig Jahre, fiel ihm ein. An dem Tag, an dem Alexandra ihm eröffnet hatte, dass sie schwanger war, hatte er aufgehört zu rauchen. Sieben Monate später war Ricarda zur Welt gekommen.
Ein Klopfen an der Tür riss ihn aus seinen Gedanken. »Ja?«
Christina steckte den Kopf herein. »Tach!«, rief sie leichthin und trat näher. »Wollte mal nach dir sehen.«
»Christina! Das ist aber eine nette Überraschung!«, sagte Mark und kam sich schrecklich hölzern dabei vor.
Er war ihr das erste Mal begegnet, als sie beide mit demselben Fall zu tun hatten, er als Strafverteidiger eines üblen Kiez-Kriminellen, sie als Gutachterin der Staatsanwaltschaft. Sie waren in der Gerichtskantine zufällig am selben Tisch gelandet, er mit seinem Kaffee, sie mit einem Würstchen, das sie sehr säuberlich aus der Pelle schälte.
»Man erkennt sofort die Pathologin«, hatte er sie angesprochen.
»Psychologin«, hatte sie ihn verbessert. »Aber der Versprecher lässt interessante Rückschlüsse auf Ihre Persönlichkeit zu.«
»Ja«, hatte er schmunzelnd bemerkt. »Schade, dass Sie gegen meinen unschuldigen Mandanten einen schweren Stand haben werden.«
»Natürlich. Ihr Mandant ist die Unschuld in Person«, hatte sie gekontert. Sie hatten sich auf Anhieb verstanden, ohne dass es großer Worte bedurft hätte. Und wann immer sie sich begegnet waren, hatten sie sich füreinander Zeit genommen, hatten einen Kaffee zusammen getrunken oder waren im Park spazieren gegangen und hatten wild drauflosgeflirtet. Zu mehr war es allerdings nie gekommen. Mark musste sich eingestehen, dass er sich von dieser ausnehmend attraktiven Frau, deren Witz und Intelligenz ihn faszinierte, sehr angezogen fühlte. Und nun stand sie vor ihm und sah ihn mit diesen türkisgrünen Augen an, als könne sie in seine Seele blicken.
»Du siehst gut aus«, sagte sie, doch ihre Miene besagte das Gegenteil.
»Danke. Du bist eine lausige Lügnerin.«
Sie lächelte verlegen. Doch dann fiel ihr ein, dass sie ihm etwas mitgebracht hatte. »Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer nicht so auf Blumen stehen«, sagte sie und zog eine Schachtel Pralinen aus der Tasche.
»Blumen sind schön anzusehen«, sagte Mark und nahm ihr die Schachtel aus der Hand, »aber die hier schmecken besser.« Er grinste. »Das ist natürlich ein ganz niederträchtiger Anschlag auf meine Linie.«
»Nichts da!«, erwiderte Christina leichthin. »Männer müssen nicht dünn sein. Sie müssen intelligent sein, Humor haben«, sie hielt kurz inne und musste grinsen, »und natürlich einen knackigen Hintern!«
»Genau, Waschbrettbauch ist out – Charakter ist in«, bestätigte Mark tiefernst und steckte sich eine Praline in den Mund. Beide mussten lachen.
8.
Ein stechender Schmerz ließ Mark aus seinem unruhigen Schlaf auffahren. Mit glasigem Blick registrierte er, dass er über dem Schachspiel eingeschlafen war, das er auf dem Nachttisch aufgebaut und sich übers Bett gezogen hatte. Sein Genick schmerzte. Mark schob den Nachttisch beiseite und rollte sich langsam in eine sitzende Haltung. Nur mühsam kämpfte er sich aus dem Bett hoch, um hinüber ins Badezimmer zu schlurfen, weil ihn auch noch seine volle Blase peinigte.
»Ich fühle mich, als wäre ich hundert«, murmelte er und riskierte lieber keinen Blick in den Spiegel. Er war noch nicht zurück am Bett, als er entschied, lieber mit einigen Chemikalien mehr im Blut, dafür glücklich und schmerzfrei zu leben und sich eine dieser starken Kopfschmerztabletten geben zu lassen.
Er warf sich den Morgenmantel über und trat hinaus auf den Flur, der jetzt im Halbdunkel lag und auf dem gähnende Leere herrschte. Das Schwesternzimmer lag nicht weit von seinem Zimmer entfernt, direkt neben dem Fahrstuhl. Doch auch dort war niemand. Sollte er zurückgehen und doch nach der Schwester läuten? Nein, er entschloss sich zu warten.
Um die Schmerzen in seinem Genick ein wenig zu lindern, massierte er sich mit einer Hand den verspannten Muskel. Nach einer Weile sah Mark sich um. Eine Sitzmöglichkeit gab es nicht, also ging er langsam auf und ab. Das Schwesternzimmer war verglast. Hinter der Durchreiche, die ihn an die Schalterhalle der Bank seines Vaters erinnerte, lagen Patientenakten. Mark blieb stehen und spähte durch das Glas. Tatsächlich: Seine Akte lag auch da. Er blickte sich um. Aber es war immer noch niemand zu sehen.
Vorsichtig öffnete er die Tür, nahm sich seine Akte und blätterte darin. Doch es gab nicht viel zu sehen. Drei handschriftliche Zeilen in einer unleserlichen Schrift, einige Kreuzchen und sonstige Zeichen. Interessant fand er den Vermerk »Selbstzahler« und beschloss, aufmerksam den Honorarsatz zu prüfen, den man für ihn veranschlagen würde. Mit flinker Hand sah er die anderen Akten durch, ob auch die seines Vaters dabei war, konnte sie aber nicht entdecken. Klar, dachte er, das ist eine andere Station. Die werden sie dort haben.
Er ordnete die Unterlagen wieder und verließ das Schwesternzimmer – gerade rechtzeitig, denn im nächsten Moment ging die Fahrstuhltür auf. Er hörte, wie ein Mann ziemlich erregt sagte: »Und warum nicht? Früher hat dir das nichts ausgemacht! Jeder sieht doch, dass er dir …« Und eine Frau fiel ihm ins Wort: »Das haben wir oft genug besprochen. Es ist aus und vorbei. Ich habe auch keine Lust, dir ständig wieder …«
In diesem Augenblick traten Schwester Beate und Doktor Wenger aus dem Fahrstuhl, und abrupt verstummte das Gespräch. Es war offensichtlich, dass die Beziehung zwischen ihnen nicht nur beruflicher Natur war. Mark musste an Ricarda denken und daran, wie er sie am Nachmittag mit dem Arzt im Park gesehen hatte. Hatte dieser Wenger tatsächlich mit seiner Tochter geflirtet? Vielleicht sollte er mit Ricarda sprechen. Aber dann schob er diesen Gedanken beiseite. Sie würde ihn nur wieder der väterlichen Eifersucht bezichtigen, und Mark gestand sich ein, dass sie meistens damit auch recht hatte.
»Kann man Ihnen irgendwie helfen?«, fragte Doktor Wenger und musterte zuerst Mark und dann die Tür zum Schwesternzimmer.
Verdammt, dachte Mark, ich habe sie offen gelassen. »Ich, äh, bräuchte etwas gegen meine Kopfschmerzen«, sagte er und hatte das Gefühl, dass Wenger verärgert schien. Hatten sich die beiden gestritten? Auch Schwester Beate wirkte ungehalten.
»Gerne«, sagte sie knapp. »Ich bringe Ihnen gleich was.« Sie ging ins Schwesternzimmer und schloss die Tür hinter sich lauter, als es nötig gewesen wäre.
»Danke«, murmelte Mark verdutzt und winkte dem Arzt mit müdem Arm. »Gute Nacht dann. Ich hoffe, Sie haben heute keinen Nachtdienst.«
Doktor Wenger lächelte gequält. »Das war für mich die letzte OP heute«, sagte er, offenbar um einen gelassenen Tonfall bemüht. »Gute Nacht. Versuchen Sie etwas zu schlafen.«