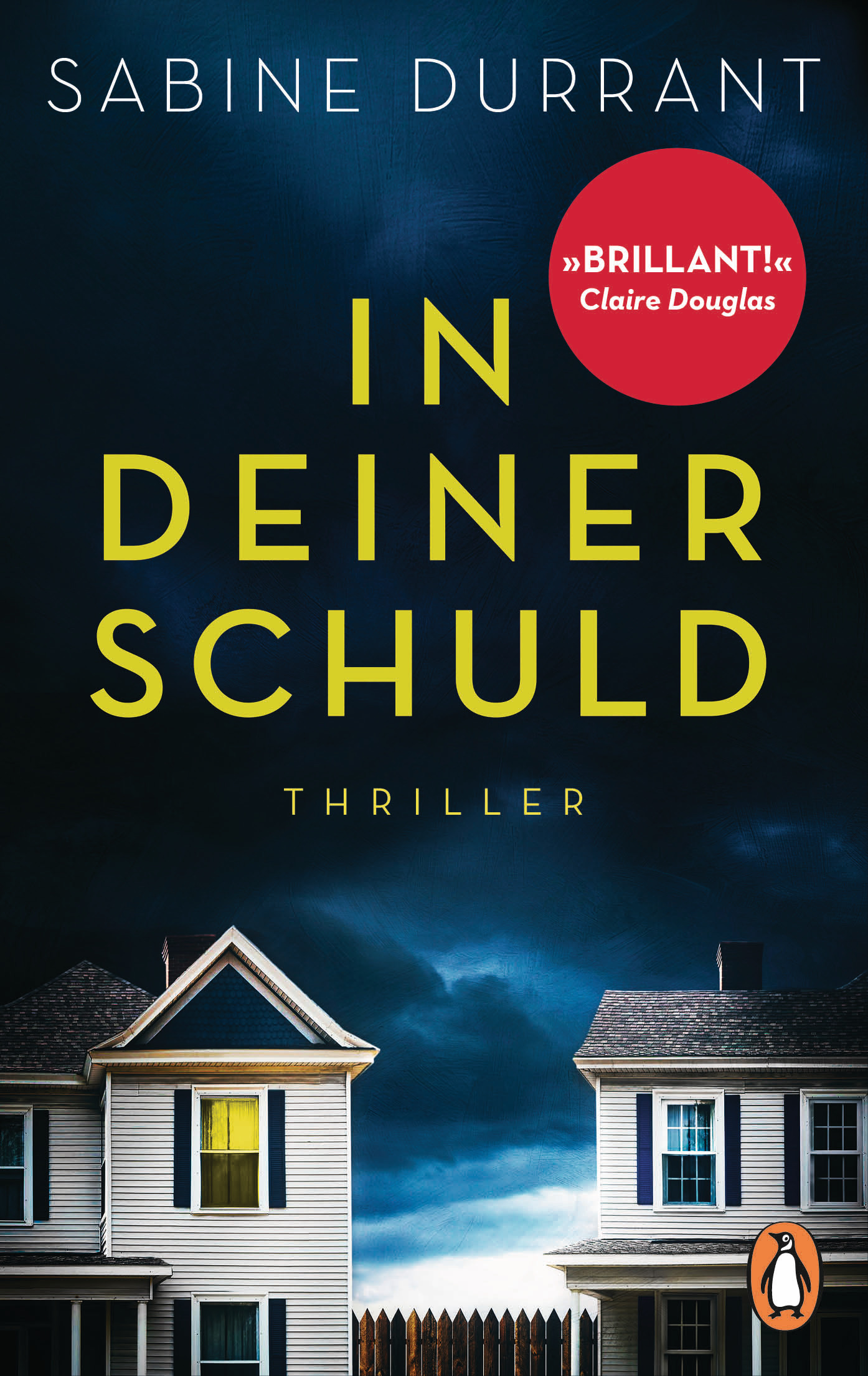
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er hat deinem Sohn das Leben gerettet. Jetzt stehst du in seiner Schuld ...
Ein Strandurlaub sollte ihre Ehe retten. Doch der kleine Josh kam den Fluten zu nah. Nur für Sekunden hatten Tessa und Marcus ihren Sohn aus den Augen gelassen – dafür werden sie teuer bezahlen … Denn in diesem einen Moment der Unaufmerksamkeit sprang ein Fremder ein und rettete ihn vor dem Ertrinken. Und jetzt ist dieser Mann in ihrem Leben. Tessa und Marcus wissen: Sie schulden ihm viel. Doch wieder zu Hause in London entdeckt Tessa ihn auf den Straßen, die sie entlanggeht. Er taucht in dem Büro auf, in dem Marcus arbeitet. Er klopft an ihre Haustür ... Und langsam beschleicht die beiden das Gefühl, dass er mehr von ihnen will, als sie zu geben bereit sind: ihre Freiheit, ihre dunkelsten Geheimnisse. Und vielleicht sogar ihr Leben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sabine Durrant lebt mit ihrer Familie in London, wo sie als Autorin und Journalistin arbeitet. Sie schreibt unter anderem für den Guardian, den Daily Telegraph sowie die Sunday Times und hat bereits mehrere Kinderbücher und Romane veröffentlicht, die in bis zu 15 Sprachen übersetzt wurden. Nach Die Hochstapler erscheint mit In deiner Schuld nun ihr zweiter Thriller im Penguin Verlag.
In deiner Schuld in der Presse:
»Fesselnd!« Vogue
»Genial konzipiert!« The Sun
»Ein Thriller voller unvorhergesehener Wendungen, den du nicht mehr aus der Hand legen wirst!« Grazia
»Ein spannendes Leseerlebnis!« The Guardian
»Packender Lesestoff von einer unserer besten Thriller-Autorinnen!« The Sunday Mirror
Außerdem von Sabine Durrant lieferbar:
Die Hochstapler
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Sabine Durrant
In deiner Schuld
Thriller
Aus dem Englischen von Karin Dufner
Die englische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel Take Me In bei Mulholland Books, an imprint of Hodder & Stoughton, an Hachette UK company, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung.
Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch
unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder
öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer
Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen
nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2018 by TPC & G Ltd
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by Penguin Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Das Zitat stammt aus Charles Dickens’ Große Erwartungen und wurde von Karin Dufner übersetzt.
Umschlag: Favoritbüro
Umschlagmotiv: © Sandra Cunningham / Trevillion Images
Redaktion: Sabine Thiele
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-24494-1 V002
www.penguin-verlag.de
Für Barney
»Ein Knabe kann seine Tür abschließen, es im Bett warm haben, sich hineinschmiegen, sich die Laken über den Kopf ziehen und sich sicher und geborgen fühlen. Doch der junge Mann wird sich ganz verstohlen und allmählich an ihn anschleichen und ihn zerreißen.«
Charles Dickens, Große Erwartungen
Alles beginnt mit einer Geschichte.
Das ist einer der Slogans, die wir uns im Büro ausgedacht haben. Mein Gott, was waren wir stolz darauf. Wenn man die Webseite von Hawick Nicholson aufruft, läuft dieser Satz quer über eine Diashow, die positive Ereignisse auf der ganzen Welt zeigt: den Start der Apollo 11, Obamas Amtseinführung, Mo Farahs Sieg bei einem Marathonlauf. Und dann, darunter, eine serifenlose Schriftart, die laut Designer Zuverlässigkeit ausstrahlt (Verdana, glaube ich). »Wir helfen Ihnen, Ihre zu erzählen.«
Das klingt ziemlich arrogant. Und außerdem trügerisch. Googeln Sie »Weltereignisse«. Los, tun Sie es. Schauen Sie, auf wie viel Positives Sie nach 9/11 stoßen. Sie bestimmen, wie Ihre Geschichte aussieht. Das raten wir allen.
Doch so einfach ist das nicht. Inzwischen weiß ich das. Erfahrungen können unschön sein. Keine Geschichte gehört nur einem Menschen und kann sein Eigentum werden.
Und selbst wenn Sie einwenden, dass es möglich ist, dass man ein bestimmtes Ereignis vom Durcheinander des Lebens trennen kann wie einen einzelnen Faden aus einem Strang Garn oder eine Farblinie aus einer großflächigen Tätowierung, habe ich eines aus dieser ganzen Tragödie gelernt. Nicht der Anfang ist wichtig.
Sondern das Ende.
STUFE EINS
Er
Jeremy, ein Kontaktmann bei der Financial Times, hatte die griechische Insel vorgeschlagen. Er war einige Jahre hintereinander hingefahren, als seine Kinder noch klein waren. Ich war skeptisch, denn ich betrachtete mich immer noch als einen Menschen, der seine Ferien auf Ibiza verbringt: himmelbettähnliche Sonnenliegen, aufgereiht am Strand wie aufgemotzte Panzer, wummernde Barmusik, Sangria in mit Kondenswasser beschlagenen Gläsern. Doch Tessa hatte schon immer einen bescheideneren Geschmack gehabt, und außerdem hatten wir Josh. Deshalb musste sogar ich einräumen, dass wir etwas Ruhigeres brauchten. Sanfte Wellen: in Ordnung. Kontakt zu anderen Kindern: okay. Ein Haus, das sich mühelos mit dem Kinderwagen ansteuern ließ: Gott steh mir bei.
Es war der erste Ferientag. Wir waren über die heiße, angetrocknete Sandkruste bis zu einem schütteren Olivenhain am anderen Ende gestapft, wo wir unsere Handtücher ausbreiteten. Offen gestanden, war ich erledigt. Wie von TripAdvisor empfohlen, hatten wir für die Anfahrt ein kleines Boot gemietet, was sich als umständlicher erwies als erwartet. Ich war völlig verschwitzt, und ich hatte mein T-Shirt von der Brust weggezogen und damit gewedelt wie mit einem Minifächer. Vielleicht gab ich sogar so eine Art »uff« von mir. Tessa achtete nicht auf mich. Wie mittlerweile immer war sie beschäftigt, baute die Strandmuschel auf, nahm Josh die Schwimmweste ab, rieb seine Arme und Beine gründlich mit einer weiteren Schicht Sunblocker ein und legte ihm dann orangefarbene Schwimmflügel an. Sie trug ein rosafarbenes, mit gelben Gänseblümchen bedrucktes ärmelloses Frotteekleid, eine der Mamaklamotten, die sie sich in letzter Zeit online bestellte. Ihre Schwimmweste hatte rote Striemen auf ihren nackten Schultern hinterlassen. Sie rieb sie geistesabwesend.
»Ich suche mir ein Plätzchen zum Umziehen«, sagte sie. Die Lockenmähne klebte ihr am Kopf. Ihre hellgrünen Augen, die mich anfangs fasziniert hatten, traten ein wenig hervor – wie so oft, wenn sie müde war. Ich empfand einen Anflug von Mitleid, Zuneigung und, wie immer, schlechtem Gewissen. Wir hatten uns schon seit einer Weile nicht mehr berührt. Das war eindeutig meine Schuld. Wie mittlerweile die meisten Dinge.
Ich trat einen Schritt auf sie zu. »Niemand schaut hin«, wandte ich ein. »Außer mir.«
»Nein … Ich …«
»Kannst du nicht unter dem Kleid in den Bikini schlüpfen? Oder ich halte dir ein Handtuch vor.«
»Nein, es könnte verrutschen, und dann stünde ich nackt da.«
»Hier ist fast niemand. Außerdem, falls es ein bisschen verrutscht … Ich hätte nichts gegen ein paar Einblicke.« Ich legte ihr die Hände auf die Schultern und wollte sie auf den Mund küssen. Mein Körper neben ihrem fühlte sich ungeschickt und unbeholfen an. Als sie sich leicht bewegte, streiften meine Lippen ihre Wange. Ich nahm den warmen, salzigen Niveaduft an ihrem Hals wahr und ihren weichen Schenkel, als ich das Knie hob und es daran rieb. Ihre Haut war so aufregend glatt. »Je mehr ich sehe, desto besser«, murmelte ich.
Sie machte sich los, diesmal ziemlich abrupt. »Es ist ein Badeanzug, kein Bikini«, entgegnete sie.
Ich ließ sie gehen, setzte mich an den Rand des Handtuchs und seufzte schwer auf, was hoffentlich eine eher allgemeine Enttäuschung zum Ausdruck brachte. Es lag nicht nur am Badeanzug. (Hatte sie nicht früher einen Bikini besessen? Hatte sie ihn weggeworfen oder passte er nicht mehr? Wie dem auch sei, nachzufragen hätte sie nur verärgert.) Plötzlich fühlte ich mich einsam und auf kindische Weise ausgeschlossen.
»Bestimmt gibt es da drüben ein Klo«, meinte sie. »Bin gleich zurück.«
»Okay.«
Ich streckte die Beine in die Sonne und beschloss, mir die Sonnencreme zu sparen, ein kleiner Akt des Widerstands gegen Tessas Paranoia. Sie sahen blass und unbehaart aus. Ich sollte Mitglied in einem Fitnessstudio werden, die Antwort meiner Generation auf den Wehrdienst. Oder mir einen Personal Trainer zulegen wie Jeff, mein Geschäftspartner. Alles, um wieder muskulöser zu werden. Vielleicht würde sie mich dann anziehender finden. Wieder seufzte ich auf. Beide Alternativen kosteten viel Geld. Selbst wenn ich Lust dazu gehabt hätte, hatte ich bei der momentanen geschäftlichen Lage nicht die notwendigen Mittel. Oder die Zeit.
»Passt du bitte auf Josh auf?«
»Okay«, sagte ich und fügte ein »natürlich« hinzu, als sie sich nicht von der Stelle rührte.
Wir betrachteten ihn einen Moment lang. Er kauerte am Eingang der Strandmuschel, rollte einen kleinen Plastiktraktor über die Kiesel und flüsterte dabei, offenbar in eine seiner Geschichten versunken, im Singsang vor sich hin.
In einem Moment der Zuneigung vereint, lächelten Tessa und ich uns an.
»Es dauert nicht lang.«
»In Ordnung.«
Ich blickte ihr nach, als sie über den Strand auf die Taverne zuschlenderte. Ich war noch gestresst, das war das Problem. Meine Nerven lagen blank. Die Bewerbung um den KazNeft-Auftrag hatte mir die letzte Kraft geraubt. Ganz zu schweigen von der Reise am Vortag. Mit einem Kind zu reisen, verkompliziert den üblichen Mist noch. Der Aufbruch zu unchristlich früher Stunde, die Gepäckwagenschlacht in Stansted, die Warteschlange bei Avis. Auch das Haus war eine Enttäuschung. Ja, jetzt ist es heraus. Bei unserer Ankunft wurde ich von dem unangenehmen Gefühl, fehl am Platz zu sein, schier überwältigt. Mir erschien es unvorstellbar, eine Woche in einem Haus zu verbringen, das so viel kleiner und schlechter ausgestattet war als unser eigenes. Sieben volle Tage. Tessa hatte alles gegoogelt, ausgewählt und recherchiert. Der perfekte Familienurlaub war zu ihrer Mission geworden. Also hatte sie auch das Recht, enttäuscht im Wohnzimmer zu stehen, sich mit den Mittelfingern die Stirn zu reiben und die Mundwinkel nach unten zu ziehen. Mir fiel die Aufgabe zu, begeistert hin und her zu laufen. »Das wird spitze. Er wird ausschlafen, wenn er nicht vom Tageslicht gestört wird! Der Fußboden ist toll! Die Fliesen sind wie Glas. Man kann auf ihnen herumrutschen!« Super, Tessa. Gut gemacht. Ein Paradies.
In Wirklichkeit war das Haus klein, ohne Atmosphäre und stickig. Außerdem eingezwängt von einem identischen Gebäude nebenan. Keine Aussicht. Überall roch es nach Abflussrohr. Warum waren wir nicht wieder in das Hotel in Cornwall gefahren?
Verdammter Mist.
Josh, noch immer gut sichtbar in seinem UVA- und UVB-Strahlen abweisenden Sonnenschutzanzug und einer blauen Baumwollkappe mit Ohrenklappen, hatte seinen Sandeimer gefunden. Nun hob er Steine auf und legte sie hinein, nachdem er sie zuerst begutachtet hatte. Dabei redete er weiter vergnügt mit sich selbst. Wieder überkam mich Freude darüber, dass es ihn gab. Er war glücklich. Nur das zählte. Ich hielt mir vor Augen, dass es sein Urlaub war. Wenn er Spaß hatte, war es die Sache wert. Unsere kleine Fahrt über die Bucht hatte ihm gefallen. Bei jeder Welle und jedem Wasserspritzer hatte er gelacht. Also, ja, es war eine gute Idee gewesen, das Boot zu mieten, auch wenn es einige heikle Momente gegeben hatte. Unvermittelte Untiefen, die sich schwarz unter uns auftaten, und gefährlich nahe schartige Felsen. Aber ich hatte wohlbehalten angelegt. Davor hatte mir nämlich gegraut. Und da lag es nun, sicher vertäut am Ende des kleinen Betonstegs, und schien keine Anstalten zu machen, gegen das größere weiße Boot daneben zu prallen. Ich hatte es richtig vertäut. Also. Wenigstens etwas in unserem Leben war geregelt. Der eitle Versuch, meine Männlichkeit zu beweisen, war nicht völlig erfolglos gewesen. Ich hatte uns hierhergebracht, oder?
Ich blickte mich um. Die Bucht war wirklich hübsch. Ein geschwungener Halbmond aus hellem, pockennarbigem Sand mit einer einzigen Taverne am Ende und zwischen den Bäumen dahinter verstreut stehenden Ferienhäusern. Nur die mit Zinnen versehenen Mauern des vulgären weißen Hotels, an dem wir vorbeigekommen waren, waren an der fernen Landzunge zu sehen. So früh im Juni war es noch ruhig, ja, fast verschlafen. In meiner Nähe lag eine stark sonnengebräunte Frau mittleren Alters auf einer Binsenmatte. Sie hatte die Augen geschlossen und einen Arm über den Kopf gelegt. Eine goldene Uhr glitzerte, ihre Achselhöhle bildete einen weißen Kontrast zu ihrem sonst teakholzfarbenen Körper. Am Ufer spielten ein Mann und eine Frau Strandtennis. Ihre kühnen Sprünge waren von reizender Verlegenheit geprägt. Inzwischen hatte sich Josh, angelockt vom Tock-Tock von Gummi auf Holz, ihnen genähert. Sie bemerkten ihn, beugten sich vor und winkten ihm mit den Fingern zu. Einen idyllischen Moment lang fragte ich mich, ob sie mit ihm spielen würden. Aber nein. Sie setzten ihren Wettkampf fort, zu verliebt und zu begeistert von ihrer eigenen Jugend und Tatkraft.
Neben ihnen hatte sich eine Großfamilie niedergelassen. Jede Menge Krimskrams, ein Kinderwagen, ein Sonnenschirm, einige Klappstühle, Picknicktaschen, eine Kühlbox, unzählige Sachen, Kleidung in nicht zueinander passenden Farben. Peinlich laute englische Stimmen. Vermutlich kamen sie aus dem großen Hotel. Ein hünenhafter Mann mit rasiertem Schädel und einer seitlich geschlossenen Sonnenbrille, die Arme mit Tattoos bedeckt, warf einigen Kindern, die bestimmt in der Schule hätten sein müssen, einen Ball zu. Turnschuhe, frisch aus dem Karton. Glänzende Fußballshorts.
Ich wandte den Blick ab. Am dunklen Rand des weit entfernten Horizonts glitzerte das Wasser perlblau. Draußen lag eine Jacht vor Anker. Es war zwar heiß, aber nicht unerträglich. Eine leichte Brise hob den Zipfel des Handtuchs. Josh war noch nah genug. Sein Anzug wirkte wie ein im Dunkeln leuchtender Pyjama. Vielleicht konnte ich mich ja etwas entspannen? Allmählich wurde ich ruhiger. Ich schlüpfte aus meinen Birkenstocks und spürte, wie warmer Sand und kleine, trockene, gekräuselte Seetangstückchen zwischen den Zehen hindurchglitten. Ich nahm die Brille ab und stützte mich auf die Ellbogen. Das Sonnenlicht kitzelte durch die Zweige der Olivenbäume meine Augenlider.
Ich wurde erst von einem Ruf, dann von einem Schrei aus dem Schlaf gerissen. Ich öffnete die Augen, starrte orientierungslos hinauf in das Gewirr aus silbergrauen Blättern und setzte mich auf. Die Frau auf der Binsenmatte hatte sich aufgerappelt. Eine Hand an der Stirn sah sie mich an und deutete schreiend hinaus aufs Wasser. Als ich ihrem Finger mit dem Blick folgte, bemerkte ich, dass die vorhin noch vor Anker gelegene Jacht in einem anderen Winkel zum Ufer stand und, eine weiße Bugwelle hinter sich herziehend, um die Landzunge herumfuhr. Das lenkte mich ab. Allerdings war die Frau inzwischen aufgesprungen und schrie immer lauter. Das junge Paar am Strand warf Schläger und Ball weg und rannte los. Jemand hatte einen Sonnenschirm umgeworfen. Auch andere rannten zum Ufer, wo die plätschernden Wellen einen grellbunten Gegenstand antrieben: einen einzelnen orangefarbenen Schwimmflügel.
Dennoch brauchte ich noch eine Sekunde, bis mir klar wurde, dass das etwas mit mir zu tun hatte. Ich erkannte es erst, als ich Joshs Kopf mit dem Gesicht nach unten am Bootssteg bemerkte, ein türkisfarbenes und rotes Bündel, ein gelegentliches orangenes Aufblitzen im Wasser. Und zwar ein gutes Stück weit draußen. Ich stürmte los, über die Handtücher, wo ich fast ins Stolpern geriet, und dann über Sand und Kiesel und vorbei an dem jungen Paar. Ich taumelte den plötzlich abfallenden Strand hinab und watete, erst bis zu den Knien, dann bis zum Schritt, ins Wasser hinein, angetrieben von Furcht, Adrenalin und der Todesangst, die alle Eltern in ihren Herzen bewahren. Vor der Unvermeidlichkeit der tragischen Ereignisse, die ständig überall lauern und irgendwann wirklich geschehen. Den schrecklichen Anblick von Joshs Körper vor mir hörte ich, wie Tessa meinen Namen schrie. Aus dem Augenwinkel sah ich ihre panisch rudernden Arme, ihr entsetztes Gesicht und ihren offenen Mund. Doch der Boden unter meinen Füßen war steinig und glitschig. Brauner, brackiger Schleim bedeckte harte Gegenstände wie Ziegelsteine, möglicherweise ein Rohr und eine verborgene Betonplatte. Ich rutschte aus und stürzte. Wasser schwappte mir ins Gesicht und in die Nasenlöcher, und ich spürte einen stechenden Schmerz in Ferse und Hand. Selbst in diesem Moment wusste ich, dass die Behauptungen von Menschen, sie hätten vor lauter Panik keine Schmerzen wahrgenommen, nicht stimmten. Denn ich war in heller Panik und hatte dennoch Schmerzen, die mich behinderten. Die Erkenntnis, dass dieses herzzerreißende Drama, das sich vor mir abspielte, mich körperlich überforderte, war vernichtend.
Ich rappelte mich wieder auf und warf mich nach vorne in dem verzweifelten Versuch, tieferes Wasser zu erreichen, damit ich endlich schwimmen und meine Füße von dem trügerischen Untergrund lösen konnte. Im nächsten Moment ertönten ein Ruf und donnernde Schritte. Ein weißes T-Shirt und Schuhe flogen dicht an mir vorbei. Jemand tat das Vernünftige und Offensichtliche, nämlich so schnell und kraftvoll den Steg entlangzustürmen, dass dieser erbebte und Ringe im Wasser entstanden. Er machte einen Kopfsprung ins Meer, und zwar hinter der Stelle, wo ich das Boot vertäut hatte, sodass er näher bei Josh war. Ich stand überflüssig und hilflos da, ein gehäuteter Vater, während ein anderer Mann mein Kind rettete.
Das war meine erste Begegnung mit Dave Jepsom.
Natürlich kannte ich da seinen Namen noch nicht. Den erfuhr ich erst später.
Doch ich sah ihn zum ersten Mal.
Eine Heldentat.
Unser Retter. Dachten wir zumindest.
Der Mann brauchte drei kräftige, Wasser aufwirbelnde, halb gekraulte Züge, um die Stelle zu erreichen, an der Josh trieb. Er packte ihn, drehte ihn um, riss den verbliebenen Schwimmflügel ab, warf in abfällig weg und hob den kleinen Kinderkörper hoch aus dem Wasser. Ich sah, dass Josh mit den Armen um sich schlug und sich am Kopf des Mannes festhielt, um nicht zu stürzen. Später versuchte ich, mir einzureden, er habe die Eltern nur beruhigen und ihnen zeigen wollen, dass alles in Ordnung sei. Doch damals wirkte es, als schwenkte er eine Trophäe.
Allmählich nahm ich hinter mir am Strand Menschen wahr, die gedämpft jubelten und erleichtert nach Luft schnappten. Tessa schluchzte trocken. Als ich mich umdrehte, kniete sie im Schatten, kläglich, blass und halb nackt in ihrem schwarzen Badeanzug. Ich hätte aus dem Wasser waten und sie in die Arme nehmen sollen, während wir warteten. Aber ich ließ den Moment verstreichen und wandte mich, starrsinnig geworden durch meine eigene Blamage, wieder der Bucht zu. Ich konnte nur an meinen Vater denken und malte mir die Wucht seiner Enttäuschung aus. Offenbar hatte sich seine Prophezeiung erfüllt. Die Bemerkung nicht der Sohn meines Vaters kam mir in den Sinn, als ich zitternd dastand und wartete. Der Fremde hielt Joshs kleines Kinn umfasst und schwamm gemächlich ans sichere Ufer.
Als er stehen konnte, richtete er sich plötzlich auf. Wasser strömte von seinen Schultern, und er hielt sich Josh an die breite Brust wie ein Baby. Natürlich lag es an den Umständen, dass er so gewaltig wirkte wie ein Held aus der Mythologie. Seine rot-weißen Fußballshorts – wer sich damit auskennt, hätte gewusst, von welcher Mannschaft – klebten an den muskulösen Schenkeln. Meermotive und Gesichter zierten seine tätowierten Arme: verschlungene Haarsträhnen oder eine Schlange, vielleicht eine Meerjungfrau. Er befand sich nur wenige Meter entfernt von mir und wusste sicher, warum ich mit ausgestreckten Armen dastand und beweisen wollte, dass ich auch etwas wert war. Aber er änderte die Richtung. Tessa meinte später, er habe wahrscheinlich der Betonplatte ausweichen wollen, auf der ich ausgerutscht war. Ganz gleich, wie die Wahrheit auch lautete, trat er ohne meine Unterstützung an den Strand, sodass ich ihm nur, buchstäblich in seinem Kielwasser, folgen konnte. Über seine Schultern erstreckte sich ein Paar kunstvoll eintätowierter Engelsflügel, detailgetreu wie eine Zeichnung von da Vinci, die seine Muskeln nachzubilden schienen.
Tessa rannte ihm entgegen. »Danke, danke, danke«, schluchzte sie. Ihr Gesicht war gerötet, sie weinte. Sie wollte dem Mann Josh abnehmen, doch der strampelte bereits und trat um sich. Der Mann zuckte zusammen, als Joshs Füße seine Achselhöhle trafen. Unbeholfen stellte er ihn, halb im Sand, halb im Wasser ab. Josh hatte auch zu weinen angefangen, hustete und würgte und boxte Tessa gegen die Fußknöchel. Mittlerweile hatten sich weitere Leute versammelt; die mageren Kinder mit den nagelneuen Turnschuhen und eine dünne, faltige Frau mit langem Haar. Sie trug einen knappen gepunkteten Bikini und war eindeutig zu alt, um ihre Mutter zu sein. Außerdem ein zierliches junges Mädchen, das ein mit einer Windel und einer gerüschten rosafarbenen Haube bekleidetes Baby auf der Hüfte balancierte. Jetzt wurde mir klar, wer unser Retter war. Der zur Großfamilie gehörende Hüne, der mit den beiden Jungen Fußball gespielt hatte.
»Ich kann Ihnen gar nicht genug danken«, stammelte ich, als ich endlich vor ihm stand. »Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Es ging alles so schnell.« Am liebsten hätte ich mich auf den Boden geworfen, Josh und Tessa umarmt und beteuert, wie leid es mir täte. Aber die Verlegenheit ließ mich erstarren. Zu so viel Vertrautheit war ich nicht fähig. Mir stand die Rolle des Trösters nicht zu. Meine Schuld wog zu schwer. Also legte ich dem Mann die Hand auf die nasse Schulter über eine Flügelspitze. Seine Haut war kalt und fest unter meinen Fingern und von Gänsehaut bedeckt.
»Zur richtigen Zeit am richtigen Ort«, erwiderte er nickend. Aus der Nähe stellte ich fest, dass er etwa Ende vierzig war und tief liegende Augen, eine gewölbte Stirn und Bartstoppeln hatte.
»Ich war nur beim Umziehen«, erklärte Tessa. »Ich habe mich wirklich beeilt, aber ich hätte noch schneller sein sollen. Ich dachte, Marcus …«
»Die kleinen Racker. Man kann sie keine Minute aus den Augen lassen.«
»Es war meine Schuld«, sagte ich und sehnte mich danach, dass Tessa mich ansah.
»Er hätte ertrinken können«, erwiderte sie und vergrub das Gesicht in Joshs Haar.
Die Frau mit dem Punktebikini reichte ihr ein Handtuch aus einem großen Wäschesack. Es war aus rotem und schwarzem Velours mit aufgedrucktem Spiderman-Motiv. Tessa trocknete Josh die Haare ab und wollte ihn auf ihren Schoß ziehen. Er weinte zwar nicht mehr, hustete aber immer noch und würgte kleine Klumpen schleimiges Meerwasser aus. Da Tessa den Kopf gesenkt hatte, verbarg das Handtuch ihr Gesicht, doch ich bemerkte, dass sie sich rasch die Augen damit abtupfte.
»Ja, das Problem sind diese Aufblasdinger«, meinte der Mann. »Die vermitteln ein falsches Sicherheitsgefühl.«
»Ja, genau«, stimmte ich zu.
Er musterte mich prüfend. »Das Beste ist, wenn man Kindern das Schwimmen beibringt.«
»Ja«, antwortete ich. »Er ist zwar erst drei, aber Sie haben recht.«
»Man kann nicht früh genug damit anfangen«, ergänzte der Mann.
Als ich aus dem Wasser gekommen war, hatte ich gefroren. Doch inzwischen fühlte ich mich klebrig und verschwitzt. Meine Waden brannten. Mein Gesicht war angespannt, und meine Beine zitterten. Die Erleichterung war nur eine Armeslänge entfernt. Ich wollte, dass diese Leute verschwanden und sich in Luft auflösten, damit ich mich voll und ganz um Josh und Tessa kümmern konnte. Den Schock überwinden und beweisen, dass es nie geschehen war. Sie hatte recht, er hätte ertrinken können. Doch das war nicht passiert. Nur das zählte. Alles andere, meine Schwäche und meine Unfähigkeit, war zweitrangig. Ich wollte, dass wir drei uns auf unser Plätzchen im Schatten zurückzogen. Wenn wir allein waren, konnte ich es wiedergutmachen und den beiden erklären. Wenn Tessa wusste, wie müde ich war, dann würde sie es verstehen. Wir würden auf unserem Handtuch liegen, ich würde die zwei umarmen, und alles würde sich beruhigen.
»Ach, herrje«, sagte die ältere Frau und betrachtete Josh. »Er braucht etwas zu trinken. Mikey, hol ihm eine Cola.«
Aus den Tiefen ihres Wäschesacks kramte sie einen Zehneuroschein hervor und drückte ihn dem angesprochenen Kind in die Hand. Die beiden Jungen rannten los, sodass der Sand unter ihren Füßen hochspritzte.
Endlich blickte Tessa mich an.
»Wirklich«, protestierte ich. »Das müssen Sie nicht … Bitte.« Aber die Frau schüttelte den Kopf und brachte mich mit einer Handbewegung zum Schweigen.
Der Mann hatte ein weiteres Handtuch aus dem Beutel genommen, es klein zusammengefaltet und fuhr sich damit über den rasierten Schädel und die bebilderten Arme und Oberschenkel, als polierte er die Motorhaube eines Autos mit einem Fensterleder. »Schon gut«, sagte er. »Was passiert ist, ist passiert, richtig? Es hat keinen Sinn, darauf herumzureiten. Er ist okay, nur das zählt.«
Tessa räusperte sich. »Wir können Ihnen einfach nicht genug danken.«
»Danke«, stieß ich hervor. »Ehrlich. Es war einfach … Ich weiß nicht, wie ich meine Dankbarkeit ausdrücken soll. Wir stehen auf ewig in Ihrer Schuld.«
»Das hätte doch jeder getan.« Er fuhr sich mit der Hand über den Kopf und betastete mit den Fingerspitzen die Stoppel.
Das junge Mädchen mit dem Baby auf der Hüfte war zum Steg geschlendert und bückte sich. Nun kehrte sie zurück und ließ einen Schuh am Schnürsenkel baumeln. Es war ein Adidas-Superstar, fleckenloses weißes Leder mit einem Streifen im Burberry-Muster an der Ferse.
»Hey, Dave«, rief sie. »Schuhe wie Kindersärge!«
»Sei nicht so frech.« Er lachte. »Nur Größe fünfundvierzig. Wo ist der andere?«
»Keinen Schimmer. Ich habe nur den einen gefunden.«
Er schaute sich um. »Ich habe ihn weggetreten. Kannst du ihn nicht sehen? Wahrscheinlich treibt er draußen auf dem Meer.«
»Dave«, entgegnete das Mädchen. »Du hast ihn verloren, du Blödmann.«
Ihre Stimme klang tadelnd. War sie seine Frau? Nein, dafür war sie viel zu jung. Sie hatte Akne um den Mund und selbst gefärbtes Haar und trug eine Zahnspange. Ganz bestimmt zu jung, um die Mutter des Babys zu sein. Seine Tochter vielleicht. Waren es alles seine Kinder? Ein gewaltiger Altersunterschied, doch das kam häufiger vor.
»O Gott, das tut mir leid«, sagte ich. »Die sehen teuer aus. Erlauben Sie mir, sie Ihnen zu ersetzen. Ich will etwas wiedergutmachen.«
Es war das erste Mal, dass ich Geld oder irgendeine Form von finanzieller Entschädigung erwähnte, wenn man das Wort »Schuld« von vorhin nicht mitzählte. Selbst in diesem Moment sprach ich es nicht wörtlich aus, sondern klopfte nur in einer albernen Geste meine hosentaschenlosen Hüften ab, als suche ich nach meiner Brieftasche. »Lassen Sie mich …«, fügte ich hinzu und wies den Strand hinauf auf unsere Sachen.
»Nein.« Er schüttelte den Kopf. Er nahm dem Mädchen den Schuh ab, hüpfte ein wenig herum, schlüpfte halb hinein und hinkte übertrieben. »Das kann ich nicht von Ihnen verlangen. Meine Schuld. Ich hätte besser aufpassen sollen.« Als er lachte, fing das Mädchen auch zu kichern an. Das Baby packte eine Handvoll ihres Haars, und sie bückte sich, um es zu befreien. Ich lächelte aufmunternd, obwohl mir das alles schrecklich peinlich war. Hilfe suchend sah ich Tessa an, doch sie hatte sich einige Meter entfernt mit Josh auf dem Schoß in den Sand gekauert und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Er war blass und wirkte erschöpft. Bestürzt wurde mir klar, dass sie immer noch weinte. Dave hörte auf zu lachen. Er zog den Schuh aus und versuchte, den nassen Sand von den mattweißen Seiten zu entfernen, bevor er Hand und Schuh sinken ließ.
»Vielleicht ist er ja noch da. Ich könnte rausschwimmen«, schlug ich vor.
»Ach, Sie können schwimmen?«
»Ja«, erwiderte ich und wäre am liebsten im Erdboden versunken. »Allerdings nicht sehr gut, wie Sie gerade gesehen haben.«
»Zwecklos.«
Er betrachtete den Horizont und dann den Schuh in seiner Hand. Im nächsten Moment holte er aus und schleuderte ihn mit voller Wucht, sodass er etwa hundert Meter durch die Luft segelte, bis er mit einem leisen Platschen in der Ferne verschwand.
»Zwecklos«, wiederholte er. »Ein einzelner Schuh, meine ich. Schuhe sind wie Menschen. Nur als Paar zu etwas zu gebrauchen.«
»Du Schwachkopf.« Das junge Mädchen schüttelte den Kopf. »Du absoluter Schwachkopf.«
Ich starrte ihn an und tastete mit dem Fuß nach nassem Sand. Er wurde von einer winzigen Welle umspült, und meine Zehen versanken. Zu nichts zu gebrauchen. Ich hatte gedacht, er hätte mich gemeint.
Dave klopfte mir auf den Rücken. »Besser, mein Schuh landet auf dem Meeresgrund als Ihr Kleiner.«
Die kleinen Jungen rannten von der Taverne auf uns zu. Einer umklammerte drei Flaschen Cola Light, der andere versuchte, sie ihm abzujagen.
»Da sind sie ja«, meinte ihre Großmutter. »Ihr habt euch aber Zeit gelassen.«
Sie nahm dem Jungen eine Cola ab und wischte mit der Handfläche über den Rand der Flasche. »Für dich, Schätzchen.«
Sie hielt die Cola Josh hin, der offenbar nicht verstand, was hier geschah. »Für dich«, wiederholte sie. »Ich beiße nicht.«
Tessa griff nach der Flasche. Als sie in meine Richtung blickte, nickte ich mit einem fröhlichen Lächeln. Ich wollte, dass sie ihm erlaubte, die Cola zu trinken und all das Aspartam und Koffein in sich hineinzuschütten. Dabei malte ich mir aus, wie wir alle später darüber lachten und es in eine Urlaubsanekdote verwandelten. Natürlich war das traumatischste Erlebnis nicht, dass er beinahe ertrunken wäre, sondern dass er sich seine erste Cola Light genehmigt hat.
»Ich bin nicht sicher«, sagte sie. »Es ist wirklich nett von Ihnen, aber ich glaube nicht, dass er Durst hat.«
»Wenn er sie nicht mag, trinke ich sie«, rief einer der Jungen.
»Vorsicht.« Seine Großmutter versetzte ihm eine leichte Kopfnuss. »Du hattest schon eine. Lass den armen Kleinen in Ruhe. Er trinkt sie schon, wenn er Lust dazu hat.«
»Danke«, erwiderte Tessa. Ich hoffte, die Gefahr sei gebannt, aber Josh stürzte sich plötzlich auf die Flasche, und sie riss sie ihm so schnell und heftig weg, dass sich eine Fontäne in den Sand ergoss. Josh schrie und strampelte und wollte unbedingt die Flasche zurück.
»Nein«, sagte Tessa streng, schaute auf und erkannte ihren Fehler. »Tut mir leid. Ich möchte nur nicht, dass er auf den Geschmack kommt.«
Die Großmutter, falls sie denn die Großmutter war, lachte, während einer der Jungen ein abfälliges Grunzen ausstieß.
»Herrje, lasst sie doch. Nicht alle Leute erlauben ihren Kindern, Cola zu trinken. Ich kann es ihr nicht verübeln. Das Zeug ist voller Zucker und macht ihre Zähne kaputt. Außerdem werden sie davon überdreht. Wenn du den beiden Wasser anstelle von Limo geben würdest, wären sie vielleicht nicht so wild«, sagte das Mädchen.
»Eine Cola wird ihn nicht umbringen«, meinte der Mann zu ihr, als hätte sie sich danebenbenommen. Als wäre sie unnötig streng.
»Es ist Cola Light, Tracey«, sagte die Großmutter zu dem Mädchen. Sie wandte sich an Tessa. »Zuckerfrei. Ich wollte nur helfen.«
»Natürlich.« Tessa bohrte den Boden der halb leeren Flasche in den feuchten Sand, hob Josh von ihrem Schoß und stand auf. »Sie beide waren so nett zu uns. Sie alle. Ich weiß nicht, wie wir es Ihnen vergelten können.« Ich merkte ihr an, dass es ihr schwerfiel, die Worte auszusprechen. »Vielleicht sollten wir den kleinen Mann jetzt aus der Sonne bringen, damit Sie wieder Ihre Ruhe haben.« Sie umarmte die ältere Frau und trat auf Dave zu. »Danke«, sagte sie, bevor sie noch einen Schritt vorwärts machte und fest die Arme um ihn legte. Dann wich sie zurück und blieb mit leicht gesenktem Kopf stehen.
Vor Erleichterung, dass wir uns in wenigen Sekunden von ihnen verabschiedet haben und wieder allein sein würden, wurden mir die Knie weich.
Als ich mich zu Dave umdrehte, stellte ich fest, dass er mich weiterhin anstarrte. Zum ersten Mal bemerkte ich, wie blau seine Augen waren. Solche Augen werden häufig als »durchdringend« beschrieben, doch Daves hatten nichts Eindringliches oder Bohrendes an sich. Sie wirkten wie ausgewaschen, verblasst und weich, wie eine ausgeblichene Jeans oder ein verschleierter Himmel. Sein Gesicht war kantig mit dichten Brauen, einem vorspringenden Kinn und markanten Wangenknochen, die die Haut bis zum Äußersten anzuspannen schienen. Seine Augen allerdings waren makellos blau, wie der erste Strampelanzug eines Babys. Er lächelte kurz und neigte leicht den Kopf. Ich versuchte, seinen Gesichtsausdruck zu deuten. Enttäuscht vielleicht, oder auch bedauernd.
Der Strand trat in den Hintergrund. Die Ereignisse der letzten Minuten spulten sich rückwärts in meinem Kopf ab.
Ihr Kleiner.
Eine Cola wird ihn nicht umbringen.
Oh, Sie können schwimmen?
Ich holte tief Luft und wagte nicht, Tessa anzusehen. »Hören Sie«, meinte ich. »Es ist fast Mittag. Bald Zeit zum Essen. Sie auf etwas zu trinken einzuladen, ist doch das Mindeste, was wir tun können. Oder zum Essen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin am Verhungern. Josh und ich sind schon seit sechs Uhr auf den Beinen.«
Ich neigte das Handgelenk, um auf eine nicht vorhandene Uhr zu schauen. Mir war klar, wie hilflos meine Gesten waren. Daves Verhalten war direkt und dramatisch. Es hatte Folgen. Ich hingegen hausierte nur mit leerer Luft und schönem Schein.
Die Frau warf Dave einen Seitenblick zu. Er überlegte einen Moment und vollführte dabei seltsame Handbewegungen, indem er sie in einigen Zentimetern Abstand ausstreckte und sie drehte, als tippte er ins Leere.
Dann sah ich Josh an. Er stand mit völlig regloser Miene und offenem Mund neben seiner Mutter und zog in einem übertriebenen Erschaudern immer wieder die Schultern hoch. Ich legte ihm die Hand auf den Kopf. Seit ich befürchtet hatte, er könne tot sein, berührte ich ihn zum ersten Mal. Sein Haar war steif vom Salzwasser. Am liebsten hätte ich mich vorgebeugt und seinen Geruch eingeatmet.
Es schnürte mir die Kehle zu, ein stechender Schmerz, der immer stärker wurde. Alles verschwamm vor meinen Augen.
»Tja, wenn Sie das wirklich wollen«, erwiderte Dave. Er knackte mit den Fingerknöcheln und führte die Hände zusammen wie zwei Fäuste im Gebet. »So hätten wir Gelegenheit, einander kennenzulernen.«
Sie
Ich hatte keine Lust, mit ihnen zu Mittag zu essen. Das heißt nicht, dass ich nicht dankbar war. Meine Dankbarkeit hätte ich gar nicht in Worte fassen können. Ich fühlte mich einfach nur überfordert. Das Grauen flackerte noch immer hinter meinen Lidern: der Moment, als ich ins Freie trat, meine Augen sich an das grelle Licht gewöhnten und ich erst die blaue Baumwollmütze auf den Wellen tanzen sah und dann Josh selbst, fünfzig Meter entfernt. Seine Arme ruderten lautlos und Hilfe suchend. Mein Schrei gellte mir in den Ohren, und es zerriss mir das Herz. Und dann die schreckliche, meine Eingeweide durchbohrende Erkenntnis, dass ich in der Taverne zu lange gebraucht hatte. Ich hätte mich mehr beeilen müssen. Nun wollte ich nur noch mit Josh allein sein, jeden Zentimeter seines Körpers untersuchen, ihn an mich drücken und ihn atmen hören. Und dann wollte ich mich bäuchlings in den Sand werfen und vor lauter Angst und Erleichterung hemmungslos schluchzen.
Doch Marcus war da anders. »Lassen Sie uns zu Mittag essen«, war seine typische Reaktion auf alles. Er tat so, als sei alles in Ordnung und als sei er absolut entspannt. Er gehörte nicht zu den Helikoptereltern. Solche Leute waren wir nicht. Beinahe das eigene Kind zu verlieren, war eine Alltäglichkeit.
Und um das zu beweisen, würden wir um ein Mittagessen nicht herumkommen.
Ich wünschte nur, wir hätten es gelassen.
Dave Jepsom hatte für uns etwas Großartiges geleistet. Nur, dass er sich jetzt in unser Leben gedrängt hatte. Und das würden wir schon bald bereuen.
Wir saßen am letzten Tisch auf der Terrasse mit Blick auf die Bucht. Das Wasser, das durch die Ritzen unter unseren Füßen schimmerte, war so klar, dass man die Fische hin und her flitzen sehen konnte. Plastiktische und eine weiße Papiertischdecke, die in der Brise flatterte wie die Flügel einer Möwe im Küstenwind. Essig und Öl in zusammenpassenden Flaschen. Ein Geruch nach Seetang und Salz. Die Glut des Grills flirrte in der Luft.
So ein Mittagessen hatte ich mir ausgemalt. Unter anderen Umständen hätte es idyllisch sein können.
Ich bemerkte, dass meine Beine unter dem Tisch zitterten und dass ich ein merkwürdig gefrorenes Lächeln auf dem Gesicht hatte. Ich erinnerte mich an eine Sendung auf Sky Atlantic, in der ein Kind an den Folgen des Ertrinkens ums Leben gekommen war, und zwar einige Stunden nach dem Untertauchen. Der Junge war zwar aus den Wellen gerettet worden, aber an dem Meerwasser, das noch in seiner Lunge schwappte, im Bett ertrunken. Sollte ich Josh zum Arzt bringen? Sollte ich ihn die ganze Nacht wach halten? Vermutlich war es das Beste, wenn er nicht zu viel aß. Nur eine leichte Mahlzeit. Und viel Flüssigkeit.
Ich versuchte, mich auf das Gespräch zu konzentrieren und herauszufinden, wer diese Leute waren, die so viel für uns getan hatten. Der Mann, der Josh gerettet hatte, hieß Dave, die ältere Frau offenbar Maureen. Die Namen der beiden Jungen waren Mikey und Carl, der des jungen Mädchens Tracey. Eine gewisse Sherry fehlte, die einige Male erwähnt wurde, anscheinend am Vorabend verdorbene Calamari gegessen hatte und »den Tag mehr oder weniger auf der Toilette« verbrachte. Keine Ahnung, wessen Baby es war. Das kleine Mädchen lag mit zurückgeklappter Lehne im Kinderwagen. Dennoch schien ihr die Sonne unter dem Verdeck hindurch ins Gesicht. Ich griff hinter mich, um es zurechtzurücken, was niemand bemerkte.
Am Ende des Tisches betrieb Marcus nach Kräften Konversation. Er war gekünstelt fröhlich und warf mit Fragen um sich, als veranstalte er ein Motivationsseminar oder müsse schwierige Kunden bei Laune halten. Sie seien schon seit ein paar Tagen hier, sagte Maureen, und »wir haben die vollen zwei Wochen gebucht«. »Sie auch?«, erkundigte sie sich bei Marcus, der ihr erklärte, wir hätten den Urlaub in diesem Jahr aufgeteilt: eine Woche im Ausland und ein wenig später im Sommer noch eine in Großbritannien. »Ein Cottage in Suffolk«, fügte er hinzu. »Wir dachten, mit einem Kleinkind sind zwei Kurzurlaube besser als ein langer.«
»Das wird sicher nett«, meinte Maureen, als habe sie ein wenig Mitleid mit uns.
Eigentlich hätte ich mich mit Dave unterhalten sollen. Das war mir klar. Er saß mir gegenüber, und ab und zu spürte ich seinen Blick auf mir, als suche er meine Aufmerksamkeit. Obwohl ich nach seiner Hand hätte greifen sollen, um eine Verbindung herzustellen, fand ich nicht den richtigen Moment und die richtigen Worte. Es lag nicht nur daran, dass er mich körperlich einschüchterte: die harte Wand aus Muskeln und die Tätowierungen. Wenn ich nicht so aufgewühlt gewesen wäre, hätte ich die Situation besser gemeistert. Ich hätte ihn auf seine Tattoos ansprechen und sie zu etwas Normalem machen können: Wo haben Sie die her? Hat es wehgetan? Doch ich schwieg. Ich konnte ihn nicht ansehen. Trotz seiner Heldentat und Hilfsbereitschaft ängstigte er mich. Er erinnerte mich daran, was hätte geschehen können. Daran, dass wir als Eltern versagt hatten.
Marcus fragte immer weiter. Sie waren von Gatwick aus geflogen und wohnten nicht in dem großen Hotel. »Nein, in einer Wohnung«, erwiderte Dave. Lautstark atmete er durch die Nase ein, straffte die Schultern und reckte den Hals nach vorne. Eine Geste, die nicht zum weiteren Nachhaken ermutigte. Nichts von dem üblichen Urlaubsgeplänkel, bei dem man seine Eindrücke vergleicht, Informationen abspeichert und Urteile fällt. Er schob den Kiefer vor, presste die Lippen zusammen und schützte seine Privatsphäre.
»Ja, wir auch«, antwortete Marcus. »Beziehungsweise in einem Haus. Einem kleinen.«
Hatten sie ein Auto gemietet? Nein.
»Sehr vernünftig«, erwiderte Marcus rasch. Er hätte es dabei belassen sollen, doch er hängte noch eine kleine Tirade gegen das System an. Genau das war es, was unsere schon lange brodelnde Gereiztheit gestern zum Überkochen gebracht hatte. »Man erledigt alles online, und wenn man dann kaputt vom Flug am Schalter steht und nichts wie weg will, wartet man stundenlang in einer Schlange, während alle vor einem, die ebenfalls im Netz gebucht haben, trotzdem endlose Formulare ausfüllen müssen.«
Er redete zu viel, um zu beweisen, dass es ihm nicht peinlich war, und duldete keine Gesprächspausen.
Das Essen wurde serviert. Maureen und Tracey aßen Omeletts, die beiden Jungen Hähnchenspieße. Die Paprikastücke zwischen dem Fleisch ließen sie in den orangefarbenen Ketchuppfützen liegen. Hätte ich sie gezwungen, den Paprika zu essen, wenn es meine Kinder gewesen wären? Keine Ahnung. War es in Ordnung, ihnen so viele Pommes zu erlauben? In der Elternschaft gab es jede Menge unerforschte Gebiete. Marcus hatte wie Dave Schweinekoteletts bestellt, die mit Reis, Pommes und Tsatsiki serviert wurden. Er ahmte Dave nach, als glaubte er, dessen Anerkennung zu erringen, indem er das Gleiche aß. Dave hatte ein weiß und marineblau gemustertes Polohemd mit einem gewaltigen Logo auf der Brust angezogen. Ralph Lauren oder eine Fälschung. Er steckte eine Papierserviette in den Ausschnitt und strich sie einige Male glatt, bevor er mit Appetit zu essen begann. Ich beobachtete, wie Marcus das Gleiche tat. Ich bin ein Mann und gönne mir jetzt eine Männermahlzeit, sollte das besagen.
Josh und ich teilten uns eine Portion frittierte Fischlein.
»Na«, meinte Maureen zu Josh, als dieser den Mund für das winzige Stück silbrigen Hering zwischen meinen Fingern aufmachte. »Du bist aber schon erwachsen.«
»Ich möchte, dass er so viele Geschmacksrichtungen wie möglich kennenlernt«, erklärte ich.
Wie sich herausstellte, war Maureen Hilfslehrerin in einer dritten Klasse und wusste alles darüber, wie man Kinder mit verschiedenen Lebensmitteln vertraut machte. Die empfohlenen Nahrungsmittelgruppen gehörten zum Lehrplan.
»In welcher Schule arbeiten Sie denn?«, erkundigte ich mich.
»Ashburnam Primary in Orpington«, sagte sie. »Wirklich nett, bis auf die Direktorin.«
Wir sprachen ein wenig darüber, und ich bemitleidete sie, bis sie die ethnische Herkunft der Direktorin erwähnte, worauf ich das Thema wechselte.
»Niedliches Baby«, sagte ich und schaute mich um.
»Wollen Sie noch mehr?«, erkundigte sie sich.
Wie immer führte diese Frage dazu, dass sich in mir alles zusammenkrampfte. Ich versuchte weiterzulächeln. »Eigentlich wollte ich eine große Familie«, antwortete ich. »Doch es hat nicht sollen sein.«
Reflexhaft streckte ich die Hand nach Joshs Kopf aus, ließ sie einen Moment dort liegen, strich das Haar an seinem Hinterkopf glatt und steckte das Etikett des UV-Anzugs in den Kragen.
»Sie sind doch noch nicht zu alt, oder?« Sie machte ein Gesicht, als zweifle sie an meinen Worten. »Die medizinischen Fortschritte heutzutage. Letztens hat eine Frau in Italien mit über sechzig noch ein Baby bekommen. Das finde ich zwar daneben, aber so weit ist es bei Ihnen ja noch nicht.«
Ich lächelte tapfer weiter. »Ich kann nicht«, entgegnete ich. »Die Geburt war ziemlich schwierig. Man musste mir in einer Not-OP die Gebärmutter entfernen. Schicksal eben.«
»Oh.«
»Deshalb habe ich auch aufgehört zu arbeiten. Wenn ich nur ein Kind haben kann, will ich es so gut wie möglich auskosten.«
»Wie nett.« Sie tätschelte mir die Hand. »Warum nehmen Sie nicht Poppy?« Sie rief zum anderen Ende des Tisches hinüber. »Tracey! Ich habe Tessa gerade gesagt, dass sie Poppy mit nach Hause nehmen kann!«
Dave lachte. Er legte den Arm über eine Stuhllehne und zauste Mikey das Haar.
»Solange sie gut für sie sorgt«, meinte er.
»Ich tue mein Bestes«, erwiderte ich.
Als unsere Blicke sich trafen, spürte ich, dass sich etwas zwischen uns abspielte. Er weiß es, dachte ich. Er weiß, dass mein Bestes nicht gut genug ist.
Rasch drehte ich den Kopf weg und hob Josh von seinem Stuhl auf mein Knie. Er lehnte das Gesicht an meine Schulter und steckte den Daumen in den Mund. Der Junge war völlig erledigt und musste ins Bett.
Ich schaute zu Marcus, konnte jedoch keinen Blickkontakt aufnehmen.
»Was machen Sie denn beruflich?«, fragte er Dave.
»Ich bin in der Baubranche«, antwortete dieser und straffte den Kiefer.
Marcus erkundigte sich nicht nach Einzelheiten. Vermutlich ging er von Maurer oder Dachdecker aus und respektierte Daves Versuch, seinem Job eine gewisse Würde zu verleihen.
»Und Sie?«, sagte Dave.
Marcus erklärte, er sei im »Krisenmanagement« tätig.
»Und was soll das sein?«
»Presse- und Öffentlichkeitsarbeit«, warf ich ein, ehe Marcus antworten konnte. Er neigte nämlich dazu, seinen Beruf hochzujubeln und ihn komplizierter erscheinen zu lassen, als er war. Ein Abwehrmechanismus, allerdings einer, der hier nicht mit Wohlwollen aufgenommen werden würde. »Das machen wir beide. So haben wir uns auch kennengelernt.«
»Ich helfe Kunden, ihr Image aufzubessern«, fuhr Marcus fort, ohne auf mich zu achten. »Mit ihren Geschichten.«
Dave schnappte sich ein Stück Pommes von Traceys Teller und tunkte es in Tsatsiki. »Meiner Erfahrung nach geht es nicht darum, was man tut, sondern für wen man arbeitet«, verkündete er.
Marcus nickte weise.
»Haben Sie einen guten Vorgesetzten? Einen vernünftigen Chef?«
Ich starrte meinen Mann an und betete, er möge nicht verraten, dass er der Boss war.
»Ich arbeite für viele verschiedene Leute«, sagte er, sah mich an und klopfte mit den Fingern auf die Tischkante. »Ich berate eine große Bandbreite von Firmen in den unterschiedlichsten Branchen. Einige sind sympathisch, andere absolute Wichser.«
»Wichser gibt es überall«, meinte Dave. »Wer ist Ihr größter Kunde?«
Marcus knabberte an einem Kotelettknochen, um Zeit zu schinden.
Ich räusperte mich warnend. In diesem Punkt musste er verschwiegen sein. Immerhin war das in seinem Beruf die Hälfte der Zeit Voraussetzung.
Keine Ahnung, warum er das ignorierte. Ich glaube nicht, dass es Arroganz war oder weil er vor dem Mann, der gerade sein Kind gerettet hatte, prahlen wollte. Wahrscheinlich wollte er einfach nicht abweisend wirken, sondern offen sein. Informationen über sich selbst, mehr hatte er nicht zu geben.
Er legte den Knochen weg und erzählte Dave in einem gekünstelt vertraulichen und freundschaftlichen Ton von dem Rennbahnbesitzer mit dem Alkoholproblem, von der Make-up-Diva, die nur norwegisches Voss-Wasser mit einer Temperatur von zehn Grad trank, und dem russischen Ölbaron, der Medientraining wollte, aber eher Training in den Grundlagen des zwischenmenschlichen Miteinanders brauchte. Außerdem schilderte er in groben Zügen seine Zusammenarbeit mit einem »irischen Hersteller von schwerem Gerät«, der sich vor Kurzem einen lukrativen Vertrag im Nahen Osten gesichert hatte. Und »drücken wir es einmal so aus, er sieht es mit Recht und Gesetz nicht so eng«.
»Iren!« Dave verdrehte die Augen.
»Letztendlich hat jedes große Unternehmen seine Geheimnisse. Mein Job ist es zu verhindern, dass sie ans Licht kommen.«
Wenigstens hat er keine Namen erwähnt, dachte ich.
Marcus bestellte Eis und Kaffee. Der Wirt servierte Metaxa »auf Kosten des Hauses«. Als wir endlich vom Tisch aufstanden, schlug Dave eine Partie Fußball vor.
»Na dann«, stimmte Marcus zu. »Lange her, seit ich zuletzt gekickt habe.«
Er stand im Tor. Zumindest bewachte er den Sand zwischen den beiden Eimern. Als er den ersten Ball durchließ und Carl vor Freude johlend auf die Knie fiel, stöhnte er theatralisch. Er ging wieder auf Position, leicht vorgebeugt, die Ellbogen aufgestützt und die Unterlippe zwischen die Zähne geklemmt. Unbeobachtet von allen außer von mir, wippte er hin und her und machte sich verlegen bereit. Gequält wandte ich den Blick ab. Es ist nicht peinlich, schlecht in einer Sportart zu sein. Man darf sich nur nicht anmerken lassen, dass es einem etwas ausmacht.
Ich saß, den schlafenden Josh auf dem Schoß, zwischen Maureen und Tracey auf einem Handtuch. Kurz schloss ich die Augen. Wut und Mitleid mit ihm mischten sich mit meiner eigenen Scham.
Er
Ich hatte gehofft, dass alles in Ordnung sein würde, wenn wir endlich allein waren. Dass die traumatische Erfahrung die Missstimmung zwischen Tessa und mir wegfegen und unsere gemeinsame Erleichterung uns wieder einander annähern würde. Wir würden über dieses Mittagessen lachen können so wie früher nach einer Dinnerparty oder einer Kundenbesprechung, unsere Eindrücke austauschen (war Sherry seine Frau?) und die peinlicheren Momente Revue passieren lassen. Ich spielte das Gespräch in Gedanken durch. »Also hat Maureen etwas gegen Muslime! Und hast du seine abfällige Bemerkung über Iren gehört?« »So ein Blödmann«, würde sie antworten. »Ja, ein absolutes Arschloch, aber immerhin hat er unseren Sohn gerettet«, würde ich erwidern. Wir würden beide lachen.
Doch wir schwiegen auf der Bootsfahrt nach Hause. Sie war vor mir eingestiegen und beobachtete, wie Dave und ich eine Männerumarmung tauschten.
»Wir sehen uns«, sagte ich.
»Ich halte Ausschau nach Ihnen«, meinte er.
Tessa sog scharf die Luft ein.
Der Wind hatte die Richtung gewechselt. Stavros, der Bootsvermieter, hatte uns davor gewarnt. Sobald wir die Landzunge umrundet hatten, schlugen uns heftige Wellen entgegen. Das Boot durchbrach sie, sodass Meerwasser über den Bug und in unsere Gesichter sprühte. Tessa, aufgebläht durch ihre Schwimmweste, klammerte sich mit weiß verfärbten Fingerknöcheln fest und drückte Josh an ihre Schulter. Ihre Miene war finster. Mit der freien Hand schützte sie Joshs Kopf, als ob die kleinste Erschütterung ihn umbringen könnte. Sie übertrieb es, doch nach meiner tragischen Fehleinschätzung von vorhin konnte ich nichts dazu sagen.
Stavros erwartete uns am Hafen und half uns, das Boot zu vertäuen. Als ich ans Ufer kletterte, packte er mich am Arm. Offenbar glaubte er, ich würde sonst ins Wasser fallen. Tessa wartete mit Josh im Auto, während ich in dem kleinen Supermarkt fürs Abendessen einkaufte: eine Packung Nudeln, ein paar Tomaten, Schafskäse und eine Basilikumpflanze mit kleinen, spitzen Blättern. Dann gingen wir den Hügel hinauf zu der modernen Siedlung am Stadtrand, wo sich auch unser Haus befand. Am späten Nachmittag erschien es mir noch stickiger und beengter. Eine Weile spielte ich mit Josh im Pool, während Tessa in dem bisschen Schatten kauerte, das der einzige Sonnenschirm hergab. Nur ein Zaun trennte uns vom Nachbarhaus. Es wurde von einem Paar bewohnt, vielleicht ein wenig jünger als wir, keine Kinder. Ich hörte das Scharren ihrer Liegestühle auf der mit unserer identischen Betonterrasse, freundliche Bitten, die Sonnenbrille oder noch ein Bier herüberzureichen, und Besteckgeklapper aus ihrer Küche.
Ich kochte die Nudeln, Tessa brachte Josh ins Bett, und später saßen wir mit den iPads draußen, um unsere E-Mails zu lesen. Ich würde die Stimmung gern als gelöst bezeichnen, doch sie war tatsächlich angespannt. Unsere Nachbarn waren ausgegangen. Ich stellte mir vor, wie sie gemeinsam am Hafen zu Abend aßen und sich mit einer Flasche Retsina betranken. Nervös horchte ich auf die Geräusche ihrer Rückkehr. Würden wir hören, wie sie Sex hatten? Vorhin hatte die Frau gekichert. Ein Geräusch wie von einem Motor vor dem Anspringen. Ich redete mir ein, sie würde genauso klingen, wenn sie kam.
Voll hoffnungsloser Qual dachte ich an die vor uns liegende Woche. Noch sechs Tage distanzierter Höflichkeit. Wir würden miteinander reden, wenn es nötig war, einzig und allein verbunden durch die Pflicht, Josh zu versorgen. Ein Tagesablauf würde sich einpendeln, und wir würden uns daran halten: ein täglicher Spaziergang zum Strand, immer zur selben Stelle; Mittagessen in einer Taverne am Hafen. Vielleicht würden wir ja eine entdecken, die uns am besten gefiel, und dabei bleiben. Alltag. Auf Nummer sicher gehen. Die Nachmittage würden wir am Pool verbringen. Wir würden Bücher lesen. Ich würde Abendessen kochen. Wir würden ins Bett gehen.
In der erstickenden Hitze unseres Schlafzimmers kehrte Tessa mir beim Ausziehen den Rücken zu. Sie beugte die Schultern vor, als sie den BH abstreifte und sich ein T-Shirt überzog. Dann legte sie sich aufs Bett und griff nach ihrem Buch. Früher war sie völlig unbekleidet im Haus umhergegangen und auf erotische Weise mit ihrem Körper im Reinen gewesen. (Sie hatte einen Bikini besessen. Erbsengrün mit einem weißen Streifen quer über dem Oberteil. Was war aus ihm geworden?) Seit Joshs Geburt hatte sich alles geändert. Wenn ich ihr sagte, dass ich ihren weicher gewordenen Bauch, die tiefer angesetzten Brüste und ihre Narben liebte, wenn ich beteuerte, sie sei perfekt, schüttelte sie den Kopf, als würde ich lügen. Unser Sexleben litt darunter, besserte sich mit der Zeit ein wenig, war in letzter Zeit jedoch wieder eingeschlafen. Meine Schuld? Die Arbeit? Ich war nicht sicher.
Ich legte mich neben sie und schlang vorsichtig den Arm um ihre gerundete Schulter. Ihr T-Shirt roch nach Koffer, muffig und ein wenig nach Chemie. Ich hatte zwar geduscht, war aber schon wieder verschwitzt. Meine Haut klebte am Stoff. Ich wollte ihr das T-Shirt ausziehen und ihre Haut spüren.
Es war schon eine Weile her. Monate. Der aufregende Tag und das Durcheinander hatten mich offenbar in einen Zustand bedürftiger Erregung versetzt.
»Nicht«, sagte sie.
»Bitte«, erwiderte ich. »Ich weiß, dass ich dich enttäuscht habe, und es tut mir wirklich, wirklich leid.«
»Vergiss es.«
»Sprich mit mir, Tessa. Schrei mich an. Irgendetwas. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es meine Schuld war. Schau mich an. Ich fühle mich wirklich elend.«
Sie ließ ihr Buch sinken. »Hätten wir dieses Gespräch nicht schon viel früher führen können? Früher gehen? Musste dieses Mittagessen sein?«
»Das war doch das Mindeste. Wir konnten uns nicht einfach verdrücken.«
»Aber den ganzen Tag. Mussten wir so lange bleiben?«
»Er war nett. Er war freundlich. Er hat unseren Sohn gerettet.«
»Ich weiß. Er war sehr freundlich. Es ist nur …« Sie klappte das Buch zu und markierte die Stelle mit dem Finger.
»Tessa, ich habe wegen dieser Sache ein schrecklich schlechtes Gewissen.«
»Ich war ja kaum weg. Nur ein paar Minuten. Ich musste das Klo suchen. Vielleicht hat es ein wenig länger gedauert, als ich gesagt habe. Aber nicht so viel länger. Es war doch nicht zu viel verlangt, dass du deinen eigenen Sohn im Auge behältst.« Ihre Stimme zitterte.
»Ich bin einfach so erschöpft. Doch das ist kein Grund. Ich habe einen schweren Fehler gemacht.«
Noch während ich mich entschuldigte, verspürte ich einen Anflug von Erleichterung. Zumindest sprachen wir über meine mangelnde Aufmerksamkeit, nicht über die darauf folgenden endlosen und peinlichen Minuten, in denen ich daran gescheitert war, unseren Sohn zu retten.
»Tessa.« Ich beugte mich über sie und nahm ihr das Buch aus der Hand. Dann küsste ich ihren Mundwinkel, legte mich auf sie und bemerkte, dass sie sich verkrampfte, sich gegen mich sträubte und schließlich nachgab. Mit fest geschlossenen Augen wandte sie den Kopf zur Seite. Ich schmiegte das Gesicht an ihren Hals, erschauderte und kam beinahe sofort.
Sie tätschelte meinen Rücken und sagte, es sei in Ordnung. Aber es hatte sich bereits etwas verändert. Ich fühlte ihre Verachtung, nicht wegen dieses unbedeutenden sexuellen Versagens, sondern wegen meiner Unfähigkeit, als unser Sohn in Lebensgefahr geschwebt hatte. In diesem wichtigen Moment, als alles auf dem Spiel gestanden hatte, hatte ich die Ziellinie ganz klar verpasst.
STUFE ZWEI
Sie
»Und wie war der Urlaub?«
»Wunderbar.«
Ohne mich aus den Augen zu lassen, hob er seinen Espresso an den Mund. »Schönes Wetter?«
Ich lächelte. »Das Wetter war auch wunderbar, danke.«
»Und der Flug?«
»Ja.« Ich nickte langsam und sah ihn weiter an. »Der Flug war ebenfalls angenehm.«
»Freut mich zu hören.«
Sein Kaffee war in einem kleinen Glas serviert worden, mit einem winzigen Henkel, den er zwischen Daumen und Zeigefinger hielt. Das zierliche Glas und der Henkel ließen seine Hand noch größer und männlicher wirken. Muskeln und Sehnen traten beim Zugreifen hervor. Die Härchen auf seinen Fingern bildeten zarte goldene Bogen auf seiner gebräunten Haut.
»Und was ist mit dir?«, fragte ich. Ich tunkte den Finger in den Schaum meines Cappuccinos und tupfte ihn auf die Zungenspitze, wo er sich prickelnd auflöste. »Was hast du so getrieben?«
Eine Franchise-Expansion, ein Marketing-Problem, ein Meeting in Genf. Doch ich nahm nur meinen Atem, die Bewegungen meiner Augen und jedes Erbeben meines Mundes wahr. Als ich mir auf die Lippe biss, schien auch er zu merken, worum es eigentlich ging: fast unmerkliche Gesten, die wie unsichtbare Schnüre straff gespannt zwischen uns verliefen.
Er war verstummt. Es war laut hier. Musik und Stimmengewirr. Das Klappern, Zischen und Dröhnen der Kaffeemaschine. Stühle scharrten. Ein Hund bellte. Eine Frau drängte sich an mir vorbei zur Theke. Am Nebentisch tippte ein Mann mit vogelartigen Bewegungen auf einem MacBook Air herum.
»Hast du mich vermisst?«, fragte er.
Sein Fuß ruhte auf meinem, er hatte den Schuh abgestreift.
Durch seine Seidensocke spürte ich, wie seine Zehen meine nackte Wade hinaufglitten.
Ich öffnete den Mund, um zu verneinen. Diesmal war ich hier, um Schluss zu machen. Wir waren bereits zu weit gegangen. Jener erste Morgen im Urlaub, als ich seine Stimme hatte hören wollen und deshalb um Haaresbreite alles verloren hätte … Nein. Es war vorbei. Wer wen vermisst hatte, war nicht mehr das Thema.
Sein Fuß erreichte mein Knie, wanderte weiter den Schenkel hinauf und schob meinen Rock hoch. Ein Knopf öffnete sich.
Meine Wangen begannen zu glühen.
Er lächelte.
Seine Zehen tasteten sich weiter und streiften die Innenseite meines Oberschenkels.
Ich wandte den Blick ab und biss mir auf die Lippe. »Ja, habe ich.« Mein Atem wurde schneller.
»Wie ist dein Kaffee?«
»Lecker.«
»Möchtest du wirklich nichts essen?«
Ich schüttelte den Kopf.
Er griff nach der Speisekarte und tat, als studierte er sie, während sein Fuß sanft mein Höschen zur Seite schob. »Avocadomus? Vollkorntoast mit Mandelbutter?«
Ich brachte kaum ein Wort heraus. »Du Mistkerl«, stieß ich nach einem Moment hervor.
Er legte die Speisekarte weg und stellte den Fuß auf den Boden. »Komm«, sagte er und bückte sich, um seinen Schuh wieder anzuziehen. »Lass uns von hier verschwinden.«
Während er bezahlte, wartete ich draußen auf dem Gehweg neben dem bellenden Hund. Es war ein Cockapoo, flauschig, blond und ziemlich verzweifelt. Als ich seinen Kopf kraulte, zerrte er an der Leine, um mir die Hand zu lecken. Sein Maul war plötzlich offen und feucht, und er wedelte mit dem Schwanz. Da geht es uns ganz ähnlich, dachte ich.
Er kam heraus und steckte eine Karte in die oberste Tasche seiner Jacke. Auf dem Weg um die Ecke zu seinem Auto berührten wir uns nicht. Diesmal hatte er sich Dulwich ausgesucht, ein Wohnviertel einige Kilometer von meiner Adresse entfernt. Eigentlich hätte es weit weg genug von zu Hause sein sollen, um sich sicher zu fühlen. Und dennoch waren die geografische Beschaffenheit und die Anordnung der Straßen zu vertraut. Der Befehlston der Vorstadt mit ihrem Anwohnerparken und den eingeschränkten Halteverboten. Die viktorianischen Villen mit ihren Privatparkplätzen und den umgebauten Souterrains. Die gewaltigen, mit Sicherheitsnetzen ausgestatteten Trampoline in den Gärten, die durch große Wohnzimmer zu sehen waren. Ich war überzeugt, dass ich beobachtet wurde, und spürte vibrierende Blicke auf meinem Rücken. Die Schlafzimmerfenster jedes Hauses strahlten.
Richard kümmerte das nicht. Allmählich hatte ich den Verdacht, dass ihn zum Teil gerade das reizte: die Vorstadt und das Risiko. Bei seinem Auto, einem schwarzen Mercedes mit getönten Scheiben, drückte er mich an die Beifahrertür und küsste mich leidenschaftlich. Mit den Händen breitete er meine Arme aus, sodass sein Jackett auseinanderklaffte. Seine Krawatte war bereits gelockert. Er presste sich an mich, bis ich glaubte, dass ich entweder kommen oder in Ohnmacht fallen würde. Dann öffnete er mit einem Klicken die Tür und schob mich hinein. Es folgte ein komischer Moment, als wir am Sitz herumfummelten, um ihn zurückzuklappen. Und dann war er auch im Wagen. Die Tür wurde geschlossen, mein Rock zur Seite gezerrt und seine Hose aufgemacht. Meine Hände steckten unter seinem gestärkten weißen Baumwollhemd. Unter dem Sitz klickte und klapperte ein weiterer Knopf. Mein Ellbogen stieß gegen den Schalthebel. Mein Kopf wurde in einem Winkel zurückgebeugt, der vermutlich unangenehm war, nur dass ich keine Schmerzen mehr spürte. Ich bemerkte die halb offene Autotür. Wir setzten uns den Blicken der Öffentlichkeit aus, und ich sollte etwas dagegen unternehmen. Aber ich tat es nicht. Ich ließ mich in Qual, Lust, eine Explosion der Sinne und die völlige Hingabe fallen. In diesem Moment spielte nichts, weder Angst noch Unglück, eine Rolle. Nur das hier.
Ich kannte Richard Taylor seit acht Jahren und schlief seit drei Monaten mit ihm. Er war einer der ersten Kunden bei Ekelund gewesen. Ich hatte bei der Gründung seiner ersten Bio-Pizzeria geholfen, lange bevor sie sich zu der erfolgreichen Kette von heute entwickelte. Unser Verhältnis war von Anfang an kompliziert. Weniger erotisch knisternd als verkrampft. Ich stand auf ihn, obwohl er nicht mein Typ war. Zu groß, zu breitschultrig, zu sehr Alphamännchen. Offenbar bevorzugte ich Männer mit Neurosen. Dennoch hatte etwas an seinem Selbstbewusstsein und der Art, wie er seine Macht spielerisch einsetzte (ständig saß er auf der Kante von irgendjemandes Schreibtisch), dazu geführt, dass ich für ihn schwärmte. Meine Assistentin Ruby hatte mich vor ihm gewarnt. Er habe, was Frauen anginge, einen schrecklichen Ruf. Er verursache nur Probleme. Und obwohl ich ihn ein paarmal dabei ertappt hatte, wie er mich nachdenklich musterte, wurde mir erst klar, dass die Anziehungskraft auf Gegenseitigkeit beruhte, als er mich zur Feier meiner Verlobung einlud, sein Glas hob und auf »das, was hätte sein können«, anstieß.
Als er mich im März anrief und mich auf ein Gespräch in sein Büro einlud, fühlte ich mich geschmeichelt. Endlich jemand, so dachte ich, der sich an meine Herangehensweise in Sachen digitale Vermarktung erinnerte. Ich brachte meine alte Hose von Joseph in die Reinigung, kaufte mir ein neues Oberteil, um das zu eng gewordene Taillenbündchen zu tarnen, staubte mein Notebook ab und machte mich auf den Weg ins West End.
Es passierte nicht beim ersten Mal. Auch nicht beim zweiten oder dritten Treffen. Das muss ich ihm zugutehalten. Er spielte mit meiner Unsicherheit, half meinem Selbstbewusstsein auf die Sprünge und tat, als lausche er meinen Vorschlägen. Bei jeder Besprechung kamen wir einander ein Stück näher. Ein bisschen weniger Arbeit, bessere Beleuchtung, mehr Alkohol. Er ging mit mir ins Nobu und fragte mich, ob ich glücklich sei.
»Ja, natürlich.«
»Du klingst nicht so. Bei dir habe ich immer das Gefühl … Nein, schon gut, ich sollte so was nicht sagen.«
»Was?«
»Als ob etwas fehlt.«
Ich versuchte, nicht zu angestrengt nachzudenken. »Stimmt, ich vermisse die Arbeit und das Büro.«
»Warum fängst du nicht wieder an? Ekelund würde dich sofort einstellen.«
»Für mich ist es wichtig, zu Hause zu sein. Ich möchte, dass mein Sohn eine möglichst glückliche und perfekte Kindheit erlebt.«
»So wie deine?«
Ich antwortete nicht.
»Meiner Ansicht nach wird Perfektion überbewertet.«
Als er mich später eindringlich ansah und mir mitteilte, er wolle mit mir ins Bett, lachte ich, als hätte er einen Witz gemacht. Ich erklärte ihm, ich könne meinen Körper nicht einmal meinem Mann zeigen, geschweige denn einem anderen.





























