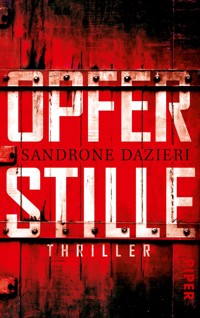2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dante Torre besitzt eine besondere Gabe. Er kann Menschen lesen. Aber er hat teuer dafür bezahlt. Elf Jahre war er eingesperrt in ein Betonverlies und darauf angewiesen, die kleinste Regung seines Entführers zu deuten. Als Jahre nach seiner Befreiung ein kleiner Junge verschwindet, weiß Dante Torre, dass der Mann, den er Vater nennen musste, dahintersteckt. Doch der Vater gilt längst als tot. Nur Colomba Caselli glaubt Dante. Sie ist jung, gerade vom Dienst suspendiert und hat nichts zu verlieren bei dieser Ermittlung fern von allen Regeln. Dantes Spürsinn bringt die traumatisierte Frau auf eine Fährte: Jahrelang sind unzählige Kinder entführt worden – mit dem Ziel, ihre Erinnerung auszulöschen und sie zu neuen Menschen zu machen. Jetzt wird Colomba Caselli endgültig von ihrer Vergangenheit eingeholt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Olga, die standgehalten hat
Übersetzung aus dem Italienischen von Claudia Franz Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Uccidi il padre« bei Mondadori.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2015
ISBN 978-3-492-96935-2
© 2014 Sandrone Dazieri Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 2015 Published by agreement with Grandi & Associati Covergestaltung: Cornelia Niere, München Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
I
Die Welt ist eine gewölbte Wand aus grauem Beton. Die Welt ist von gedämpften Geräuschen und Echos erfüllt. Die Welt ist ein Kreis, den er mit ausgebreiteten Armen halb ausmessen kann. Das Erste, was der Junge in dieser kreisförmigen Welt gelernt hat, sind seine beiden neuen Namen. Sohn ist ihm der liebere. So darf er heißen, wenn er alles richtig macht, wenn er gehorcht, wenn seine Gedanken klar und flink sind. Sonst lautet sein Name Vieh. Wenn er Vieh heißt, wird der Junge bestraft. Wenn er Vieh heißt, muss der Junge frieren und hungern. Wenn er Vieh heißt, stinkt es in der kreisrunden Welt.
Wenn der Sohn nicht zum Vieh werden will, muss er sich merken, wo die ihm anvertrauten Dinge hingehören, und sie pfleglich behandeln. Der Eimer für die Notdurft muss immer am Balken hängen, damit er jederzeit geleert werden kann. Der Wasserkrug muss immer mitten auf dem Tisch stehen. Das Bett muss immer sauber und gemacht sein, die Bettdecke ordentlich festgesteckt. Das Essenstablett muss immer neben der Luke stehen.
Die Luke ist das Zentrum der kreisrunden Welt. Der Junge fürchtet und verehrt sie wie eine launische Gottheit. Die Luke kann sich unvermittelt öffnen oder auch tagelang verschlossen bleiben. Durch die Luke gelangen Essen, saubere Kleidung, Decken, Bücher und Stifte herein, aber auch Strafen werden durch die Luke erteilt.
Fehler werden immer bestraft. Bei kleinen Fehlern droht Hunger, bei größeren Kälte oder unerträgliche Hitze. Einmal war ihm so heiß, dass er nicht einmal mehr schwitzte. Er brach auf dem Beton zusammen und dachte, er müsse sterben. Irgendwann bekam er einen Schwall kaltes Wasser über den Körper gekippt, und er war wieder der Sohn. Er durfte auch wieder trinken und den Eimer säubern, um den schon unzählige Fliegen schwirrten. Die Strafe in der kreisrunden Welt ist hart und gnadenlos. Es gibt kein Entrinnen.
Das dachte er zumindest, bis er herausfand, dass die kreisrunde Welt doch nicht vollkommen ist. Die kreisrunde Welt hat einen Riss. Der ist so lang wie sein Zeigefinger und hat sich gebildet, wo der Balken mit dem Eimer in der Betonwand verankert ist.
Wochenlang traute sich der Junge nicht, ihn von Nahem zu betrachten. Er wusste einfach, dass er da war. Der Riss lauerte am Rande seines Bewusstseins und brannte wie Feuer. Dem Jungen war klar, dass es zu den verbotenen Dingen zählte, den Riss anzuschauen. In der kreisrunden Welt ist alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, verboten. Eines Nachts setzte sich der Junge darüber hinweg. Zum ersten Mal seit langer Zeit, dieser absolut gleichförmigen Zeit seiner Welt, überschritt er eine Grenze. Vorsichtig, langsam und mit Bedacht. Er stieg aus seinem Bett und gab vor zu stürzen.
Du dummes Vieh. Du absolut unfähiges Vieh. Er tat so, als müsste er sich an der Wand abstützen, und näherte sich für einen winzigen Moment mit dem linken Auge dem Riss. Erkennen konnte er nichts, nur Finsternis, aber die Ungeheuerlichkeit seiner Tat trieb ihm den Schweiß aus allen Poren. Stundenlang wartete er auf die Strafe, auf Schmerz und Kälte und Hunger, aber es geschah nichts. Das war unfassbar. In jenen Stunden des Wartens, in einer schlaflosen Nacht und einem durchfieberten Tag, begriff der Junge, dass nicht alles, was er tat, bemerkt wurde. Nicht alles, was er tat, wurde erwogen und beurteilt. Nicht alles, was er tat, wurde belohnt oder bestraft. Mit einem Mal fühlte er sich so einsam und verlassen wie in den ersten Tagen in der kreisrunden Welt, damals, als die Erinnerung an ein Davor, in dem die gewölbte Wand noch nicht existiert und er einen anderen Namen als Vieh oder Sohn gehabt hatte, noch wach gewesen war. Der Junge spürte, wie seine Gewissheiten zerbrachen. Er wagte einen zweiten Blick durch den Riss. Dieses Mal hielt er das Auge für eine ganze Sekunde daran. Beim dritten Mal für die Länge eines Atemzugs. Und plötzlich sah er etwas. Er sah Grün. Er sah Himmelblau. Er sah eine Wolke in Form eines Schweins. Er sah das rote Dach eines Hauses.
Jetzt sieht der Junge schon wieder hinaus. Er balanciert auf den Zehenspitzen und stützt sich mit den Händen am kalten Beton ab. Draußen bewegt sich etwas, in einem Licht, das der Junge für die Morgendämmerung hält. Es ist ein dunkler Schatten, der immer größer wird. Im nächsten Moment begreift der Junge, dass er einen gewaltigen Fehler begeht. Dass er sich etwas absolut Unverzeihliches zuschulden kommen lässt.
Der Mann, der über die Wiese geht, ist der Vater, und er selbst steht da und beobachtet ihn. Als hätte er seine Gedanken erahnt, beschleunigt der Vater den Schritt und kommt direkt auf ihn zu.
Er hält ein Messer in der Hand.
II
DER STEINKREIS
1Das Grauen begann um fünf Uhr nachmittags an einem Samstag Anfang September, als ein Mann in Shorts mit den Armen herumfuchtelte, um ein Auto anzuhalten. Zum Schutz gegen die Sonne hatte er sich ein T-Shirt über den Kopf gelegt, an den Füßen trug er ausgelatschte Flip-Flops.
Als er seinen Kollegen bat, am Rand der Landstraße anzuhalten, dachte der ältere Polizist, dass es sich bei dem Mann in Shorts um einen Irren handeln müsse. Nach siebzehn Jahren im Dienst und ein paar Hundert Trunkenbolden und anderen Wirrköpfen, die es durch gutes Zureden und hartes Durchgreifen zu besänftigen galt, erkannte er Irre auf den ersten Blick. Und dieser Typ war mit Sicherheit einer.
Als die beiden Polizisten ausstiegen, kauerte sich der Mann in Shorts auf den Boden und brabbelte etwas. Er war mit den Kräften am Ende und vollkommen dehydriert. Der junge Polizist ließ ihn aus dem Fläschchen, das er im Seitenfach der Fahrertür aufbewahrte, einen Schluck Wasser trinken. Den angeekelten Blick seines Kollegen ignorierte er.
Allmählich war auch zu verstehen, was der Mann in Shorts ihnen mitteilen wollte. »Ich habe meine Frau verloren«, sagte er. »Und meinen Sohn.« Er hieß Stefano Maugeri und war am Morgen mit seiner Familie zu einem Picknick aufgebrochen, ein Stück weiter oben in den Pratoni del Vivaro, der Hochebene in den Albaner Bergen. Nach dem Essen war er im sanften Wind eingeschlafen. Und als er wieder aufgewacht war, hatte er seine Frau und seinen Sohn nirgends mehr entdecken können.
Drei Stunden hatte er erfolglos nach ihnen gesucht, bis er die Orientierung verloren hatte und schließlich auf der Landstraße gelandet war. Kurz vor einem Sonnenstich, hatte er sich am Straßenrand entlanggeschleppt. Der ältere Polizist, dessen Gewissheit ins Wanken geriet, wollte wissen, warum er seine Frau nicht auf dem Handy angerufen habe. Maugeri erklärte, das habe er ja getan, aber es habe immer nur die Mailbox geantwortet. Und dann sei der Akku leer gewesen. Der ältere Polizist betrachtete Maugeri schon etwas weniger skeptisch. Frauen, die verschwanden und ihre Kinder mitnahmen, hatte er im Bereitschaftsdienst zuhauf erlebt, obwohl noch keine ihren Mann auf einer Wiese zurückgelassen hatte. Nicht lebendig jedenfalls.
Die Polizisten brachten Maugeri zum Ort des Picknicks zurück. Kein Mensch war zu sehen. Die anderen Ausflügler waren bereits aufgebrochen, und der graue Bravo stand einsam an der kleinen Straße, nicht weit von einer pinkfarbenen Decke mit Essensresten und einer Plastikfigur des kindlichen Helden aus Ben 10, der die Macht hatte, sich in die unterschiedlichsten Aliens zu verwandeln.
Ben schwirrte wahrscheinlich längst als eine Art Riesenfliege über die Pratoni, um die Vermissten zu suchen. Den beiden Polizisten hingegen blieb nichts übrig, als in der Leitstelle anzurufen und Alarm zu schlagen, womit sie eine der spektakulärsten Suchaktionen auslösten, die man in den Pratoni erlebt hatte.
Das war der Moment, in dem Colomba ins Spiel kam. Es würde ihr erster Arbeitstag seit Langem sein, und er sollte sich ohne jeden Zweifel als einer ihrer schlimmsten erweisen.
2Um die grünen Augen herum wirkte sie älter als zweiunddreißig, aber mit ihrem muskulösen Körper, den breiten Schultern und den hohen, kräftigen Wangenknochen war Colomba immer noch eine imposante Erscheinung. Sie habe das Antlitz einer Kriegerin, die ohne Sattel dahinpresche und ihren Feinden mit dem Krummschwert den Kopf abschlage, hatte einst einer ihrer Liebhaber gesagt. Sie hatte gelacht, um sich im nächsten Moment auf ihn zu schwingen und ihn zu reiten, dass ihm Hören und Sehen verging.
In ihrem momentanen Zustand hatte sie allerdings wenig von einer Kriegerin. Sie saß auf dem Badewannenrand und starrte aufs Display ihres Handys, das den Namen von Alfredo Rovere anzeigte. Rovere war der Leiter der Squadra Mobile – einer übergeordneten Spezialeinheit der Kriminalpolizei von Rom–, Colombas Mentor und offiziell immer noch ihr Chef. Jetzt rief er schon zum fünften Mal in drei Minuten an, weil sie einfach nicht abnahm.
Colomba hatte geduscht und trug noch ihren Bademantel. Sie hatte sich breitschlagen lassen, an einem Abendessen bei Freunden teilzunehmen, und war schon viel zu spät dran. Seit ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus hatte sie die meiste Zeit alleine verbracht und trat nur selten vor die Tür. Oft verließ sie das Haus nur morgens, häufig schon bei Sonnenaufgang. Dann zog sie ihren Trainingsanzug an, um am Tiber zu joggen, der unter den Fenstern ihrer Wohnung in der Nähe des Vatikans entlangfloss.
Auf dem Uferweg zu laufen schulte das Reaktionsvermögen; es galt, den Schlaglöchern und Hundehaufen auszuweichen und manchmal einer Ratte, die aus dem verrottenden Müll hervorschoss. Colomba störte das weniger als die Abgase oben auf der Straße. Das war Rom, und die Stadt gefiel ihr gerade deshalb, weil sie schmutzig und verschlagen war, auch wenn die Touristen das nie begreifen würden. Alle zwei Tage besuchte Colomba nach dem Joggen den Laden der zwei Singhalesen um die Ecke, um das Nötigste zu besorgen, und samstags wagte sie sich sogar bis zu den Buchständen an der Piazza Cavour vor. Dort füllte sie ihre Leinentasche mit gebrauchten Büchern, die sie im Laufe der Woche lesen würde: Klassiker, Krimis, Kitschromane, alles wild durcheinander. Die wenigsten von ihnen las sie zu Ende. Bei den allzu komplizierten Handlungen verlor sie den Faden, und bei den allzu simplen überkam sie die Langeweile. Es gelang ihr einfach nicht, sich auf irgendetwas zu konzentrieren. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass ihr alles entglitt.
Sah man von den Verkäufern ab, vergingen ganze Tage, an denen Colomba mit keiner Menschenseele sprach. Klar, da war ihre Mutter, aber der konnte sie zuhören, ohne je selbst den Mund aufzumachen. Und dann gab es die Freunde und Kollegen, die hin und wieder noch anriefen. In den seltenen Momenten, in denen sie in sich hineinhorchte, wusste Colomba, dass es so nicht weiterging. Der springende Punkt war nicht, dass sie nicht allein sein konnte – damit hatte sie noch nie Probleme gehabt–, sondern dass ihr der Rest der Welt gleichgültig war. Natürlich war ihr bewusst, dass das eine Folge dessen war, was sie erlebt hatte. Die große Katastrophe. Aber sosehr sie sich auch bemühte, sie konnte die unsichtbare Hülle, die sie vom Rest der Menschheit trennte, nicht zerreißen. Auch deshalb hatte sie sich gezwungen, die Einladung an diesem Abend anzunehmen. Lust hatte sie nicht im Mindesten, und während ihre Freunde sicher schon beim dritten Aperitif waren, hatte sie noch nicht einmal entschieden, was sie anziehen sollte.
Sie wartete, bis das Klingeln verstummte, und griff wieder zur Bürste. Im Krankenhaus hatte man ihr die Haare kurz geschoren, aber mittlerweile hatten sie fast schon wieder die alte Länge. Gerade als sie ein paar graue Haare entdeckt hatte, klingelte es an der Tür. Sie blieb mit der Bürste in der Hand sitzen und hoffte, sich verhört zu haben, aber es klingelte erneut. Sie ging zum Fenster und sah, dass unten auf der Straße ein Streifenwagen parkte. Scheiße, dachte sie, schnappte sich das Handy und rief Rovere an.
Der meldete sich beim ersten Klingeln. »Der Wagen ist da«, sagte er zur Begrüßung.
»Ja, verdammt«, erwiderte Colomba.
»Ich wollte es dir sagen, aber du bist nicht drangegangen.«
»Ich stand unter der Dusche. Außerdem bin ich zum Essen eingeladen und habe schon eine Wahnsinnsverspätung. Tut mir leid, aber sagen Sie dem Kollegen, er soll dahin zurückkehren, wo er hergekommen ist.«
»Willst du denn gar nicht wissen, warum ich ihn geschickt habe?«
»Nein.«
»Ich erzähle es dir trotzdem. Du müsstest mal kommen und einen Spaziergang durch die Pratoni del Vivaro machen.«
»Was gibt es da zu sehen?«
»Ich möchte dir nicht die Überraschung verderben.«
»Sie haben mir doch schon eine bereitet.«
»Das da ist viel besser.«
Colomba schnaufte. »Dottore … ich bin beurlaubt, falls Sie das vergessen haben sollten.«
Roveres Stimme wurde ernst. »Habe ich dich in all der Zeit je um etwas gebeten?«
»Nein«, gab Colomba zu.
»Habe ich je Anstalten gemacht, dich vor Ablauf der Zeit zurückzuholen? Oder dich bequatscht, dass du bei uns bleiben sollst?«
»Nein.«
»Dann kannst du mir die Bitte kaum ausschlagen.«
»Einen Scheißdreck kann ich.«
»Ich brauche dich, Colomba, wirklich.«
An seinem Tonfall war zu erkennen, dass es ihm bitterernst war. Eine Weile sagte Colomba gar nichts. Sie fühlte sich in die Ecke gedrängt. »Muss das wirklich sein?«, fragte sie schließlich.
»Offenbar.«
»Und Sie wollen mir nicht mitteilen, worum es geht?«
»Ich möchte dich nicht beeinflussen.«
»Sehr freundlich von Ihnen.«
»Also, ja oder nein?«
Das ist das letzte Mal, dachte Colomba. »Okay. Aber sagen Sie dem Kollegen, er soll aufhören, Sturm zu läuten.«
Rovere legte auf, und Colomba starrte auf ihr Handy. Irgendwann wählte sie die Nummer ihres Gastgebers, der schon die Hoffnung aufgegeben hatte, und sagte ab. Seine Proteste klangen halbherzig. Sie zog eine ausgefranste Jeans und ein Angry-Birds-Sweatshirt an, Sachen, die sie im Dienst nie tragen würde, aber genau so sollte es sein.
Als sie die Schlüssel aus der Kommode am Eingang nahm, tasteten ihre Finger automatisch nach dem Gürtelholster, aber sie griffen ins Leere. Im selben Moment fiel ihr ein, dass ihre Pistole natürlich seit ihrem Krankenhausaufenthalt im Waffenschrank der Polizei lag. Das Gefühl war unangenehm, als wäre sie über eine Stufe gestolpert, die es eigentlich nicht gab. Unwillkürlich musste sie daran denken, wie sie zum letzten Mal nach ihrer Waffe gegriffen hatte. Die Erinnerung löste schlagartig einen Anfall aus. Ihre Lunge krampfte sich zusammen, und das Zimmer füllte sich mit fliehenden Schatten. Schreienden Schatten, die an den Wänden und am Boden entlangglitten und sich ihrem Blick entzogen. Aber sie lauerten am Rande ihres Gesichtsfelds und waren aus den Augenwinkeln immer zu sehen. Colomba wusste, dass sie nicht real waren, aber sie spürte ihre Gegenwart mit jeder Faser ihres Körpers. Sie hatte Angst, eine blinde, erbarmungslose Panik, die ihr den Atem raubte und sie zu ersticken drohte. Rasch tastete sie nach der Kante der Kommode und knallte den Handrücken dagegen. Der Schmerz explodierte in den Fingern und schoss wie bei einem Stromstoß den Arm hoch. Leider klang er zu schnell wieder ab. Sie schlug noch einmal zu, und noch einmal, und riss sich die Haut am Handknöchel auf, bis der elektrische Schlag ihre Lunge reaktivierte wie ein Defibrillator ein Herz bei einem Infarkt. Sie keuchte und sog Luft ein, bis sie wieder gleichmäßig atmen konnte. Die Schatten lösten sich auf. Von der Angst blieb nichts als der eiskalte Schweiß im Nacken.
Sie lebte. Sie lebte. Sie blieb auf dem Boden knien und sagte sich diese Worte so lange vor, bis sie selbst daran glaubte.
3Colomba saß noch weitere fünf Minuten auf dem Boden und atmete kontrolliert ein und aus. Seit der letzten Panikattacke waren Tage vergangen. Wochen. Die Anfälle hatten direkt nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus begonnen. Man hatte sie darauf vorbereitet, dass so etwas passieren konnte – es sei sogar zu erwarten, nach dem, was sie erlebt habe–, aber sie hatte sich auf ein leichtes Zittern und gelegentliche Schlafstörungen eingestellt. Doch der erste Anfall hatte sie wie ein Erdbeben erschüttert, und der zweite war noch schlimmer gewesen. Sämtliche Sinne waren durch den Sauerstoffmangel erloschen, und sie hatte sich dem Tod nahe geglaubt. Immer häufiger waren die Anfälle aufgetreten, bis zu drei-, viermal am Tag. Ein Geräusch oder ein Geruch reichte, um sie auszulösen. Rauchgeruch zum Beispiel.
Der Krankenhauspsychologe hatte ihr seine Nummer gegeben, damit sie ihn anrufen konnte, falls sie Unterstützung brauchte. Er hatte sie sogar eindringlich darum gebeten. Aber Colomba hatte weder mit ihm noch mit sonst jemandem darüber gesprochen. Sie hatte sich in einer Männerwelt durchgesetzt, und es gab dort nicht wenige, die sie lieber mit einer Tasse Kaffee als mit einer Pistole in der Hand sähen. Folglich hatte sie gelernt, Schwächen und Probleme vor ihren Mitmenschen zu verbergen. Außerdem dachte sie in ihrem tiefsten Innern, dass sie es verdient hatte. Als Strafe für die große Katastrophe.
Während sie sich ein Pflaster auf den Handknöchel klebte, dachte sie darüber nach, ob sie Rovere anrufen und zum Teufel schicken sollte, aber das widerstrebte ihr aus irgendeinem Grund. Sie würde die Begegnung auf das Nötigste beschränken, und wenn sie erst ihren guten Willen unter Beweis gestellt hätte, würde sie heimkehren und das Kündigungsschreiben, das bereits in der Küchenschublade lag, in den Briefkasten werfen. Danach würde sie sich Gedanken darüber machen, was sie mit ihrem Leben anstellen sollte. Sie hoffte, dass sie nicht so werden würde wie diese pensionierten Kollegen, die um das Präsidium, die Questura, herumschlichen und sich immer noch als Teil der Familie fühlten.
Draußen entlud sich jetzt ein Gewitter, das die Erde in ihren Grundfesten zu erschüttern schien. Colomba zog eine Regenjacke über ihr Sweatshirt und verließ die Wohnung.
Am Steuer des Streifenwagens saß ein junger Polizist, der trotz des Regens ausstieg, um sie zu begrüßen. »Alberti Massimo, Dottoressa Caselli.«
»Steig ein, sonst wirst du nass.« Sie setzte sich auf den Beifahrersitz. Ein paar Nachbarn waren im Schutz ihrer Regenschirme stehen geblieben und beobachteten die Szene neugierig. Colomba war erst kürzlich eingezogen, und nicht alle wussten, was sie beruflich machte. Wahrscheinlich wusste es niemand, wenn man bedachte, wie selten sie mit jemandem sprach.
Colomba war der Streifenwagen so vertraut wie die eigene Wohnung. Das reflektierende Blaulicht in der Windschutzscheibe, das Knistern des Funkgeräts und die Fotos der Vermissten, die an der Sonnenblende hingen, begrüßten sie wie alte Bekannte, die sie lange nicht mehr gesehen hatte. Bist du wirklich bereit, hierauf zu verzichten? Nein, war sie nicht. Aber es gab keine Alternative.
Alberti schaltete die Sirene an und fädelte sich in den Verkehr ein. Colomba schnaubte. »Mach die aus«, sagte sie. »Wir haben es nicht eilig.«
»Ich habe Anweisung, Sie so schnell wie möglich hinzubringen, Dottoressa«, erwiderte Alberti, kam ihrer Bitte aber nach.
Der junge Mann war etwa fünfundzwanzig und hatte helle Haut mit einem Anflug von Sommersprossen. Sein Rasierwasser gefiel ihr, aber für die Tageszeit roch es ziemlich intensiv. Vielleicht hatte er den Flakon dabei und sich extra noch einmal eingesprüht, um Eindruck zu schinden. Auch die Uniform war erstaunlich sauber.
»Bist du neu?«, erkundigte Colomba sich.
»Ich habe vor einem Monat die Polizeischule beendet, Dottoressa, nach dem freiwilligen Wehrdienst. Ursprünglich komme ich aus Neapel.«
»Du hast spät angefangen.«
»Wenn man mich letztes Jahr nicht genommen hätte, wäre ich zu alt gewesen. Ich habe es gerade noch so geschafft.«
»Na, dann mal herzlichen Glückwunsch«, murmelte sie.
»Darf ich Sie etwas fragen, Dottoressa?«
»Schieß los.«
»Wie kommt man zur Squadra Mobile?«
Colomba verzog das Gesicht. Fast alle Kollegen von der Streife wollten zur Squadra Mobile. »Das läuft nur auf Empfehlung. Stell bei deinem Vorgesetzten einen Antrag und mach einen gerichtspolizeilichen Lehrgang. Falls du das vorhast, solltest du dir aber klarmachen, dass die Arbeit nicht so toll ist, wie man sich das immer vorstellt. Dienst nach Vorschrift kannst du vergessen.«
»Darf ich fragen, wie Sie es geschafft haben?«
»Nach der Ausbildung in Mailand war ich zwei Jahre in der Questura, dann war ich bei der Droge in Palermo. Als Dottor Rovere vor vier Jahren nach Rom gegangen ist, bin ich seine Vize geworden.«
»Bei der Mordkommission.«
»Wenn ich dir einen Rat geben darf: Sag niemals Mordkommission, wenn nicht alle merken sollen, dass du ein Pinguin bist.« So nannten sie die Neuen. »Die Mordkommission gibt es nur im Fernsehen. Bei uns handelt es sich um die dritte Abteilung der Squadra Mobile, okay?«
»Entschuldigung, Dottoressa«, sagte Alberti. Wenn er rot wurde, traten die Sommersprossen noch deutlicher hervor.
Colomba hatte keine große Lust, über sich selbst zu reden. »Wie kommt es, dass sie dich alleine in der Gegend herumfahren lassen?«
»Normalerweise fahre ich mit einem älteren Kollegen, aber ich habe mich freiwillig für die Suchaktion gemeldet, Dottoressa. Mein Kollege und ich waren es, die Maugeri heute auf der Landstraße aufgegriffen haben.«
»Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du überhaupt redest.«
Und nun erfuhr Colomba von den verschwundenen Ausflüglern und dem Mann in Shorts.
»Letztlich habe ich mich aber gar nicht an der Suche beteiligt. Ich bin zur Wohnung gefahren, wo man mich als Wachtposten zurückgelassen hat«, schloss Alberti.
»Zur Wohnung der Familie?«
»Ja. Sollte die Frau davongelaufen sein, hat sie jedenfalls nichts mitgenommen.«
»Und was sagen die Nachbarn?«
»Nichts Brauchbares, Dottoressa, nur ein Haufen Geschwätz«, sagte Alberti und lächelte. Dass er sich nicht zwang, an der bierernsten Miene der Pinguine festzuhalten, sprach für ihn.
Unwillkürlich musste Colomba ebenfalls lächeln. Das tat fast weh, weil sie es nicht mehr gewöhnt war. »Wo fahren wir eigentlich hin?«
»Das Koordinationsteam hat im Reitzentrum von Vivaro Posten bezogen. Wir sind dort, dann die Carabinieri, die Feuerwehr und der Zivilschutz. Und eine Menge Menschen, die ein gewaltiges Spektakel veranstalten. Die Sache hat sich rumgesprochen.«
»Das bleibt nicht aus«, kommentierte Colomba missmutig.
»Vor drei Stunden kam Hektik auf. Ich habe gesehen, wie zwei Land Rover in Richtung Monte Cavo aufgebrochen sind, zwei Offiziere und ein Staatsanwalt. Dottor De Angelis. Kennen Sie den?«
»Ja.«
Das gefiel ihr überhaupt nicht. Staatsanwalt Franco De Angelis ließ keine Gelegenheit aus, um in die Medien zu kommen. Bis zu seiner Pensionierung waren es nur noch ein paar Jahre hin, und es hieß, er strebe einen Posten im Obersten Gerichtsrat an und würde dafür sogar seine Großmutter verkaufen.
»Wie weit liegt der Monte Cavo von der Stelle entfernt, wo die Familie gepicknickt hat?«, erkundigte Colomba sich.
»Zwei Kilometer durch den Wald, zehn auf der Straße. Interessiert Sie das Informationsblatt? Auf dem Armaturenbrett liegt ein Ausdruck.«
Das Blatt zeigte auch zwei Fotos, die man auf Facebook gefunden hatte. Lucia Balestri, Maugeris Frau, hatte schwarzes, gewelltes Haar und sah älter aus als neununddreißig. Der Junge war pummelig und trug eine Brille aus Glasbausteinen. Auf dem Foto saß er in der Schulbank und schaute nicht in die Linse. Sechseinhalb Jahre. Sein Name war Luca.
»Wenn sie bis zum Monte Cavo gelangt sind, müssen sie eine schöne Strecke zurückgelegt haben, er und seine Mutter. Und niemand hat sie gesehen?«
»Soweit ich weiß, nicht.«
Wieder prasselte Regen auf sie herab, und der Verkehr geriet ins Stocken. Mithilfe des Blaulichts teilten sie die Blechlawine wie Moses das Rote Meer und erreichten nach einer halben Stunde die Abfahrt. Colomba konnte bereits die Einsatzwagen und Transporter sehen, die vor der Umzäunung des Reitzentrums zu einer kompakten Masse verschmolzen. Die Anlage selbst bestand aus einer Ansammlung verlassener einstöckiger Gebäude, die um eine Trabrennbahn herum errichtet worden waren.
Im Schritttempo fuhren sie über die Landstraße, die von Streifenwagen, Zivilfahrzeugen, Bussen der Carabinieri, Krankenwagen und Löschfahrzeugen verstopft wurde. Auch zwei Übertragungswagen mit Satellitenschüsseln auf dem Dach hatten sich eingefunden, außerdem eine fahrbare Feldküche, aus der dichter Qualm aufstieg. Fehlen nur noch die Jahrmarktsstände und eine Schießbude, dachte Colomba.
Alberti parkte hinter einem Camper. »Wir sind da, Dottoressa. Dottor Rovere erwartet Sie in der Einsatzzentrale.«
»Warst du hier schon?«, fragte Colomba.
»Ja, Dottoressa.«
»Komm mit, dann geht es schneller.«
Alberti zog die Handbremse an und führte sie an den leeren Gebäuden vorbei. Colomba hörte das Wiehern der Pferde hinter der Mauer und hoffte, nicht plötzlich vor einem Tier zu stehen, das wegen des Gewitters durchgegangen war. Ihr Ziel war eines der kleineren Gebäude, vor dem zwei uniformierte Polizisten Wache hielten. Sie nickten Alberti zu und ignorierten Colomba, die nur eine Zivilistin sein konnte.
»Warte hier«, bat sie ihn und öffnete, ohne zu klopfen, die Tür mit dem Zettel: »STAATSPOLIZEI – bitte erst anmelden«.
Sie gelangte in ein altes Archiv mit Aktenschränken an den Wänden. Ein halbes Dutzend Polizisten in Uniform und Zivil saßen an vier großen Schreibtischen in der Raummitte und telefonierten oder sprachen in ihr Funkgerät. Vor einer Landkarte, die man auf einem der Tische ausgebreitet hatte, stand Alfredo Rovere, ein kleiner Mann um die sechzig, die wenigen grauen Haare sorgfältig zurückgekämmt. Colomba fiel auf, dass seine Schuhe und Strümpfe bis hoch hinauf voller Schlamm waren.
Ein Polizist, der in der Nähe des Eingangs saß, erkannte sie. »Dottoressa Caselli!«, rief er und sprang auf. Colomba erinnerte sich nicht an seinen Namen, sondern nur an sein Kürzel, Argo 03, das er benutzte, wenn er in der Einsatzzentrale Dienst hatte. Sämtliche Anwesenden starrten sie an und unterbrachen ihre Gespräche.
Colomba rang sich ein Lächeln ab und bedeutete ihnen, an die Arbeit zurückzukehren. »Macht weiter, bitte.«
Argo 03 schüttelte ihr die Hand. »Wie geht's, Dottoressa? Sie haben uns gefehlt.«
»Ihr mir nicht«, entgegnete sie, um einen Scherz bemüht. Der Mann kehrte ans Telefon zurück, und der Geräuschpegel schwoll wieder an. Aus den Brocken, die sie aufschnappte, schloss Colomba, dass man an der Landstraße Kontrollposten aufgestellt hatte. Merkwürdig. Das war nicht gerade das übliche Vorgehen, wenn jemand verschwunden war.
Rovere trat auf sie zu. Er nahm sie sanft bei den Schultern und blickte ihr in die Augen. Sein Atem roch nach Zigaretten. »Du siehst gut aus, Colomba. Wirklich.«
»Danke, Dottore«, antwortete sie. Für sich dachte sie, dass er müde und gealtert wirkte. Er hatte Tränensäcke unter den Augen, und sein Bart wucherte wild. »Was ist los?«
»Neugierig?«
»Nicht im Geringsten. Aber wo ich schon einmal hier bin…«
»Du wirst es gleich sehen.« Er nahm sie am Arm und schob sie in Richtung Tür. »Wir müssen nur noch einen Wagen organisieren.«
»Der Streifenwagen steht am Eingang.«
»Wir brauchen aber einen Jeep.«
Als sie den Raum verließen, nahm Alberti, der an der Wand gelehnt hatte, Haltung an.
»Du bist immer noch hier?«, fragte Rovere.
»Ich hatte ihn gebeten zu bleiben«, erklärte Colomba. »Es wird ja wohl hoffentlich nicht so lange dauern.«
»Kannst du einen Geländewagen fahren?«, erkundigte sich Rovere bei Alberti.
»Ja, Dottore.«
»Geh zum Ausgang und besorg einen«, befahl Rovere. »Wir warten hier.«
Alberti eilte hinaus. Rovere steckte sich direkt unter dem Rauchverbotsschild eine Zigarette an.
»Fahren wir zum Monte Cavo?«, fragte Colomba.
»Ich gebe mir Mühe, dich im Unklaren zu lassen, und du weißt trotzdem alles«, gab er zur Antwort.
»Dachten Sie, ich würde nicht mit dem Fahrer reden?«
»Wäre mir nicht unrecht gewesen.«
»Und was erwartet uns dort?«
»Das wirst du schon früh genug sehen.«
Ein Land Rover Defender kam im Rückwärtsgang auf den Hof gefahren und konnte im letzten Moment eine Kollision mit einem Motorrad der Verkehrspolizei verhindern.
»Endlich.« Rovere nahm Colombas Arm, um sie nach draußen zu schieben.
Sie entzog sich ihm. »Haben wir es eilig?«
»Ja. Spätestens in einer Stunde werden wir nicht mehr erwünscht sein.«
»Warum?«
»Ich wette, du kommst selbst drauf.«
Rovere hielt ihr die Wagentür auf, aber Colomba stieg nicht ein. »Ich denke ernsthaft darüber nach, sofort wieder umzudrehen, Dottore. Ratespielchen habe ich schon als Kind gehasst.«
»Dann hättest du einen anderen Beruf ergriffen.«
»Genau das hab ich vor.«
Er seufzte. »Bist du dir sicher?«
»Absolut.«
»Darüber sprechen wir nachher. Komm, steig ein.«
Colomba rutschte resigniert auf die Rückbank.
»Vorbildlich«, sagte Rovere und setzte sich nach vorn.
Auf seine Anweisung verließen sie das Reitzentrum in Richtung Vivaro, folgten für etwas weniger als fünf Kilometer der Landstraße, bogen in die Straße zu den Seen ab und erreichten schließlich über die Staatsstraße Rocca di Papa. Als sie an den letzten Häusern vorbeikamen, sahen sie unter der Pergola einer Trattoria ein paar Polizisten sitzen, die Kaffee tranken und rauchten. Es schien, als hätten sich die normalen Bürger alle verzogen, um den Uniformierten und den Militärfahrzeugen das Feld zu überlassen. Sie fuhren noch einen Kilometer und nahmen dann die Straße, die auf den Monte Cavo hinaufführte.
Als sie anhielten, war außer ihnen niemand zu sehen. Hinter den Bäumen am Ende des Wegs bemerkte Colomba den Widerschein von Blitzlichtern, die die Dunkelheit zerrissen.
»Ab hier müssen wir zu Fuß gehen, der Weg ist zu schmal«, erklärte Rovere. Er öffnete den Kofferraum und holte zwei Stabtaschenlampen heraus.
»Machen wir eine Schnitzeljagd?«
»Wäre gar nicht schlecht, wenn uns jemand gelegentlich ein paar Indizien hinstreuen würde«, erwiderte Rovere und reichte ihr eine Taschenlampe.
»Indizien wofür?«
»Immer mit der Ruhe.«
Der Weg war auf beiden Seiten mit Bäumen bestanden, deren verschlungene Äste eine Art grünen Korridor bildeten. Jetzt, da es zu regnen aufgehört hatte, herrschte fast vollkommene Stille. Der Geruch nach Feuchtigkeit und welkem Laub erinnerte Colomba daran, wie sie früher mit einem längst verstorbenen Onkel in die Pilze gegangen war. Ob sie je welche gefunden hatten, wusste sie allerdings nicht mehr.
Rovere steckte sich eine weitere Zigarette an, obwohl sein Atem schon schwer ging. »Wir befinden uns übrigens auf dem heiligen Pfad.«
»Soll heißen?«
»Der Weg führte zu einem römischen Tempel. Er hat sogar noch die ursprüngliche Pflasterung, siehst du?« Rovere richtete den Strahl der Taschenlampe auf die grauen, verwitterten Basaltplatten. »Einer der Suchtrupps ist vor drei Stunden diesen Weg zur Aussichtsplattform gegangen.«
»Was für eine Aussichtsplattform?«
Rovere leuchtete mit der Taschenlampe auf die Baumreihe vor ihnen. »Dahinter.«
Colomba bückte sich unter einem Gewirr von Ästen hindurch und erblickte eine große Felsenterrasse mit einem Metallgeländer. Von dieser Aussichtsplattform schaute man auf eine Lichtung hinab, die etwa zehn Meter tiefer lag und mit Kiefern und Steineichen bewachsen war. Zwischen einem Fahrweg und den Bäumen standen zwei Land Rover und ein Lieferwagen, den die Polizei für den Transport von technischem Gerät benutzte. Man hörte Stimmengewirr und das Brummen des Dieselgenerators für die Blitzlichter der Polizeifotografen.
Rovere trat zu ihr, schnaufend wie eine Dampflokomotive. »Bis hierher ist der Suchtrupp gekommen. Es war reiner Zufall, dass man sie entdeckt hat.«
Colomba hielt die Taschenlampe über das Geländer und leuchtete in die Richtung, in die Rovere zeigte.
Im Schatten eines vereinzelten Felsens auf der Lichtung sah man einen hellen Schimmer. Zunächst dachte Colomba, dass sich in dem Busch dort eine Plastiktüte verfangen hatte, aber als sie den Lichtkegel gezielter ausrichtete, erkannte sie, dass es sich um ein Paar blau-weiße Turnschuhe handelte. Sie hingen an dem Busch und drehten sich langsam im Kreis. Selbst aus dieser Entfernung war zu erkennen, dass sie sehr klein waren. Es waren die Turnschuhe eines Kindes.
»Ist der Junge hier runtergestürzt?«, fragte Colomba.
»Schau genau hin.«
Sie tat es und stellte fest, dass die Schuhe nicht im Busch hängen geblieben, sondern mit den Schnürsenkeln daran festgebunden worden waren. Colomba drehte sich um und sah Rovere an. »Jemand hat sie in den Busch gehängt.«
»Genau. Und das hat den Suchtrupp dazu veranlasst, zur Lichtung hinabzusteigen. Hier geht's lang.« Rovere zeigte auf einen Pfad. »Aber pass auf, der Weg ist steil. Ein Kollege hat sich schon den Knöchel verstaucht.« Rovere ging voran, und Colomba folgte ihm. Gegen ihren Willen war sie jetzt doch neugierig. Wer hatte die Schuhe dort hingehängt? Und warum?
Eine heftige Böe blies ihr Regentropfen ins Gesicht. Colomba erschrak, und sofort krampfte sich ihre Lunge zusammen. Für heute reicht es mit Anfällen, schimpfte sie. Wenn ich wieder daheim bin, von mir aus. Dann kann ich schön ins Kissen heulen, aber jetzt bitte nicht. Mit wem sie da sprach, wusste sie selbst nicht. Sie wusste nur, dass die Atmosphäre an ihren Nerven zerrte und sie so schnell wie möglich von hier verschwinden sollte.
Nachdem sie die Bäume hinter sich gelassen hatten, erreichten sie eine abschüssige Erhebung, auf der Gestrüpp und Brombeeren wucherten. Große, zu einem Halbkreis angeordnete Felsen erhoben sich daraus. An einem dieser Felsen hatten sich etwa zehn Leute versammelt, darunter auch Staatsanwalt Franco De Angelis und Vicequestore Marco Santini vom SIC, dem Servizio Investigativo Centrale. Zwei Männer in weißen Overalls fotografierten am Fuß des Felsens, aber Colomba konnte nicht erkennen, was. Auf den Overalls war das Kürzel der Verbrechensanalyse zu lesen, UCV, und Colomba begriff, was sie im Grunde längst gewusst hatte. Sie trat näher heran. Der Felsen warf seinen scharfkantigen Schatten auf eine am Boden zusammengesunkene Gestalt. Lass es nicht das Kind sein, dachte Colomba, und ihr Flehen blieb nicht unerhört.
Es war die Leiche der Mutter.
Man hatte sie enthauptet.
4Die Leiche lag mit dem Bauch auf dem Boden. Die Beine waren angewinkelt, ein Arm klemmte unter dem Körper. Der andere Arm war waagerecht ausgestreckt, die Handfläche schaute nach oben. Der Hals war glatt durchtrennt worden. Die Wunde leuchtete violett im Scheinwerferlicht, und der weiße Knochen glänzte feucht. Der Kopf lag einen Meter weiter auf der Wange und schaute zum Körper zurück.
Colomba blickte von der Leiche auf und merkte, dass alle sie anstarrten.
Santini, ein durchtrainierter Typ um die fünfzig mit einem schmalen Oberlippenbart, wirkte stinksauer. »Wer hat dich denn hergebeten?«
»Ich«, mischte sich Rovere ein.
»Und warum, bitte schön?«
»Fortbildungsmaßnahme.«
Santini rang die Hände und verzog sich.
Colomba schüttelte dem Staatsanwalt die Hand. »Schön, schön«, sagte der zerstreut, um sich im nächsten Moment unter einem Vorwand zu entfernen und Rovere mit sich zu ziehen. Colomba sah sie in gebührender Entfernung diskutieren.
Die übrigen Anwesenden, die Colomba entweder vom Sehen kannten oder zumindest von ihr gehört hatten, blieben stehen und beobachteten sie verstohlen. Plötzlich trat Mario Tirelli aus dem Schatten und gesellte sich zu ihr. Der Rechtsmediziner war ein großer, dürrer Mann mit einem Fischerhut auf dem Kopf. Er kaute auf einer der Süßholzwurzeln herum, die er in einem silbernen Zigarettenetui, das genauso alt war wie er selbst, immer mit sich trug.
»Wie geht's?«, fragte er, als er mit seinen eiskalten Händen ihre Rechte schüttelte. »Du hast mir gefehlt.«
»Du mir auch«, sagte Colomba wahrheitsgemäß. »Ich bin allerdings immer noch beurlaubt, freu dich also nicht zu früh.«
»Und was machst du dann hier in diesem Sumpf?«
»Aus irgendeinem Grund scheint es Rovere wichtig zu sein. Sag du mir lieber, was diese Leute hier machen.«
»Sprichst du vom SIC oder von der UCV?«
»Von beiden. Die sind doch für organisierte Kriminalität und Serienmörder zuständig, und ich sehe nur eine einzige Leiche.«
»Rein theoretisch können sie sich auch um vermisste Katzen kümmern, wenn der Staatsanwalt sie hinzuzieht.«
»Santini ist natürlich ein Freund von De Angelis…«
»…und sie kratzen sich gerne wechselseitig den Rücken, genau. Offenbar vertraut Santini der Spurensicherung nicht und hat diese Idioten im weißen Overall angeschleppt. Wenn sie etwas finden, kann er die ganze Ehre alleine einstreichen.«
»Und wenn nicht?«
»Dann wird er euch die Schuld geben.«
»Schöne Scheiße.«
»Das Übliche. Du solltest dich lieber schonen, als ihm auf die Füße zu treten.«
»Danke gleichfalls. Bist du nicht längst in Pension?«
Tirelli lächelte. »Nun, ich arbeite jetzt als Berater. Zu Hause bleiben und Krimis lesen ist nichts für mich, und für Kreuzworträtsel bin ich zu blöd.« Tirelli war Witwer und hatte keine Kinder. Selbst im Moment seines Ablebens würde er das Skalpell noch in der Hand halten. »Soll ich dir etwas über die Frau erzählen, oder willst du weiterhin so tun, als würde dich das Ganze nicht interessieren?«
»Schieß los.«
»Geköpft mit einer Stichwaffe mit gebogener Klinge. Der Mörder musste mindestens vier-, fünfmal zuschlagen, um den Kopf vom Körper zu trennen, und zwar zwischen dem zweiten und dem dritten Wirbel. Der erste Hieb war sehr wahrscheinlich tödlich. Er hat sie direkt unterhalb des Hinterkopfs getroffen, als sie noch stand.«
»Von hinten?«
»Der Richtung des Hiebs nach zu urteilen, ja. Eintritt des Todes innerhalb der ersten Minute, sofortiger Verlust des Bewusstseins. Die Totenstarre deutet darauf hin, dass es heute Nachmittag passiert sein muss, aber bei dem Regen ist der genaue Zeitpunkt schwer zu bestimmen. Zwischen dreizehn und achtzehn Uhr, würde ich sagen. Du wirst aber sehen, dass die von der UCV es auf die Sekunde genau wissen«, fügte er sarkastisch hinzu.
»Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sie sich verteidigt hat«, ergänzte Colomba. »Sie hat dem Mörder vertraut, sonst hätte sie sich doch vor dem Mord zu ihm umgedreht.«
»Er hat sie überrascht und ihr am Boden den Rest gegeben.«
Dass Santini und die anderen sich von der Leiche entfernt hatten, nutzte Colomba, um einen genaueren Blick auf die Frau zu werfen. Tirelli folgte ihr.
»Die Kleider wurden nicht ausgezogen und später wieder angezogen«, stellte Colomba fest. »Keine sexuelle Gewalt nach Eintreten des Todes.«
»Das denke ich auch.«
Sie betrachtete den Kopf aus der Nähe. Die Augen waren unversehrt. »Kein Anzeichen für Penetration an Mund und Ohren.«
»Gott sei Dank…«
»Hat der Junge es mitbekommen?«
»Das weiß man nicht. Wir haben ihn noch nicht gefunden.«
»Hat der Mörder ihn mitgenommen?«
»Das wäre naheliegend.«
Colomba schüttelte den Kopf. Es gefiel ihr nicht, wenn Kinder im Spiel waren. Wieder betrachtete sie den Tatort. »Um Sex ging es nicht. Und er hat den Körper auch nicht verstümmelt.«
»Den Kopf abzuhacken, würdest du nicht als Verstümmelung bezeichnen?«
»Sonst sind keinerlei Spuren von Gewalt zu erkennen. Man sieht nicht einen einzigen blauen Fleck.«
»Vielleicht reichte ihm, was er getan hat.«
Bevor Colomba etwas entgegnen konnte, richtete sich der Kriminaltechniker im Gestrüpp auf. »Kommt mal her!«, rief er.
Alle eilten in seine Richtung, auch Colomba, die schon wieder unwillkürlich in alte Verhaltensmuster zurückfiel. Der Techniker hatte ein Sichelmesser aus dem Busch gezogen und hielt es mit seiner behandschuhten Hand hoch. Santini beugte sich vor, um es aus der Nähe zu betrachten. »Die kleinen Scharten in der Klinge könnten vom Knochen herrühren.«
»Du solltest dich als Scherenschleifer bewerben«, sagte Colomba.
Santini spannte den Kiefer an. »Immer noch hier?«
»Vielleicht leidest du ja an Halluzinationen.«
»Fass bloß nichts an. Von deinen Eskapaden haben wir die Schnauze voll.«
Colomba spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. Sie trat einen Schritt vor und ballte die Fäuste. »Sag das noch einmal, du Arschloch.«
Der Techniker, der das Sichelmesser in der Hand hielt, hob den Arm. »Hallo? Sind wir hier im Kindergarten?«
»Die ist übergeschnappt, nicht ich«, entgegnete Santini. »Das ist ja wohl offensichtlich.«
Tirelli legte Colomba eine Hand auf den Arm. »Leg dich nicht mit ihm an«, flüsterte er.
Sie ließ sämtliche Luft aus ihrer Lunge heraus. »Leck mich, Santini. Mach deine Arbeit und kümmere dich einfach nicht um mich.«
Santini sann krampfhaft nach einer scharfen Replik. Als ihm nichts einfiel, zeigte er auf das Sichelmesser und wandte sich zu Tirelli. »Könnte das die Tatwaffe sein, Dottore?«
»Möglich«, antwortete der.
Der Techniker strich mit einem Wattestäbchen über die Klinge, und die Baumwolle wurde dunkelblau: Blut. Er steckte das Messer in einen Beweismittelbeutel und beschriftete ihn. Im Labor würde man das Blut von der Klinge mit der DNA des Opfers abgleichen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht übereinstimmte, war nicht sehr groß, dachte Colomba. Tirelli folgte dem Techniker, während Santini von einem Uniformierten herbeigerufen wurde und Richtung Zufahrtsweg verschwand. Colomba blieb alleine vor dem Strauch stehen. Während sie darüber nachdachte, ob sie zum Wagen zurückkehren und diese Meute zum Teufel schicken sollte, hörte sie es zwischen den Bäumen neben ihr rascheln. Das Scheinwerferlicht erfasste das bleiche, verschwitzte Gesicht von Alberti, der sich mit einem Papiertaschentuch den Mund abwischte.
Es war offensichtlich, warum er sich zurückgezogen hatte, und Colomba bereute es, ihn alleine gelassen zu haben. »Alles okay?«
Er nickte. »Ja, Dottoressa.« Aber sein Tonfall ließ eher aufs Gegenteil schließen. »Ich musste…«
»Das glaub ich gern. Mach dir keine Gedanken, das passiert. Ist das deine erste Leiche?«
Alberti schüttelte den Kopf. »Nein. Aber das hier … Wie lange haben Sie gebraucht, um sich an so etwas zu gewöhnen?«
Bevor Colomba etwas erwidern konnte, hörte sie, wie Rovere ihren Namen rief. »Komm schnell, sonst verpasst du noch den letzten Akt des Spektakels.«
Colomba klopfte Alberti auf die Schulter. »Bleib ruhig hier.« Sie ging zu ihrem Chef, der neben einem Felsen weit weg von der Leiche stand. »Was für ein Spektakel?«
Die Ermittlergruppe war zu der Toten zurückgekehrt und schien auf etwas zu warten. De Angelis lächelte nervös ins Leere.
»Der Ehemann kommt«, sagte Rovere.
Ein paar Sekunden später wurde hinter den Bäumen ein Motor ausgestellt. Santini kehrte zurück, zusammen mit zwei Uniformierten und einem Mann in Shorts und schmutzigem T-Shirt, der sich verwirrt umschaute.
Stefano Maugeri. Allem Anschein nach hatte er die Gegend seit dem Verschwinden seiner Frau nicht mehr verlassen. »Ja, sind die denn verrückt geworden, ihn hier anzuschleppen?«, empörte sich Colomba. »Die Identifizierung können sie doch im Leichenschauhaus vornehmen, wenn sie die Frau wieder zusammengesetzt haben.«
»Es geht nicht um die Identifizierung«, antwortete Rovere.
Santini und die beiden Polizisten führten Maugeri zum Steinkreis. Colomba sah, dass er einen Moment zögerte. »Was soll ich denn hier bei den Steinen?«, hörte sie ihn fragen.
Er ist vollkommen ahnungslos, um Himmels willen, dachte Colomba.
Santini bat Maugeri, näher zu treten, aber er wehrte sich wie ein Tier, das ahnt, dass es zur Schlachtbank geführt wird. »Nein, ich gehe keinen Schritt weiter, wenn Sie mir nicht sagen, was mich da erwartet. Ich gehe da nicht hin. Ich weigere mich.«
»Ihre Frau ist dort, Signor Maugeri.« Santini beobachtete ihn.
Maugeri schüttelte den Kopf, als ihm allmählich dämmerte, was ihn erwartete. »Nein
5»Lass uns aufbrechen«, sagte Rovere. Es war kurz vor elf Uhr. Maugeri war, von zwei Polizisten gestützt, zum Wagen zurückgebracht worden, und soeben wurde der Leichnam seiner Frau in einen Leichensack gepackt. Colomba, Rovere und Alberti gingen zu ihrem Jeep.
Colomba war die Erste, die das Schweigen brach. »Was für eine Schweinerei«, murmelte sie.
»Dir ist aber klar, warum sie es gemacht haben, oder?«, erkundigte sich Rovere.
»Dafür muss man nicht sonderlich intelligent sein«, gab Colomba zurück. Sie hatte Kopfschmerzen und fühlte sich so müde wie schon seit Monaten nicht mehr. »Sie haben sich ein Geständnis erhofft.«
Rovere klopfte Alberti auf die Schulter. »Halt mal an.«
Sie waren an der Trattoria, die ihnen schon auf der Hinfahrt aufgefallen war. Unter der Pergola war jetzt nur noch der Wirt zu sehen, der damit beschäftigt war, Tische und Stühle hereinzuholen.
»Du kannst sicher einen Kaffee gebrauchen, Colomba, oder?«, fragte Rovere. »Oder würdest du gerne etwas essen?«
»Ein Kaffee wäre gut«, log sie. Eigentlich wollte sie nur nach Hause und alles vergessen. Sie wollte sich wieder dem Buch widmen, das sie aufgeschlagen auf dem Wohnzimmertisch hatte liegen lassen – eine alte Ausgabe von Giovanni Vergas Don Gesualdo –, und die angebrochene Flasche Primitivo aus dem Kühlschrank austrinken. Ganz normale Dinge, die nicht nach Blut und Schlamm stanken.
Der Wirt empfing sie, obwohl er gerade schließen wollte. Die alte Trattoria roch nach Chlorbleiche und saurem Wein und war mit Holzbänken und Holztischen möbliert. Im Gastraum war es noch kälter als draußen. Es war erst Anfang September, aber der Sommer schien sich längst verabschiedet zu haben, dachte Colomba. Das Gefühl, in der Nähe von Rom zu sein, hatte man jedenfalls nicht.
Sie setzten sich an einen Tisch neben der Speisevitrine. Rovere bestellte einen verlängerten Espresso und starrte Colomba an, ohne sie wirklich wahrzunehmen.
»Warum denkt man, dass es der Ehemann war?«, erkundigte sie sich.
»Erstens«, begann Rovere, »hat niemand Maugeri mit seiner Frau und dem Jungen in den Pratoni gesehen. Alle Zeugen, die sich gemeldet haben, wollen ihn immer nur alleine gesehen haben.«
»An einen Vater, der verzweifelt nach Frau und Sohn sucht, erinnert man sich eher als an eine Familie beim Picknick.«
»Stimmt schon, aber die Zeugenaussagen deuten alle in dieselbe Richtung.« Er klopfte sich mit dem Löffelstiel an die Lippe. »Zweitens war Blut im Kofferraum.«
»Tirelli sagt, dass die Frau am Tatort umgebracht wurde«, entgegnete Colomba. »Für gewöhnlich faselt er kein dummes Zeug.«
»Das Blut ist von dem Jungen. Wenige Spuren, die nur oberflächlich beseitigt wurden. Der Vater hat keine Erklärung dafür.«
»Was noch?«, fragte Colomba.
»Maugeri hat seine Frau geschlagen. Die Nachbarn haben schon dreimal die Polizei gerufen, weil sie Schreie gehört haben. Und vor einem Monat wurde die Frau mit einer gebrochenen Nasenscheidewand ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hat behauptet, sie sei in der Küche gestürzt.«
Colomba spürte, wie die Kopfschmerzen schlimmer wurden. Je länger sie sich über diese Geschichte unterhielt, desto stärker wurde sie hineingezogen. »Und was noch? Warum zum Teufel bin ich hier?«
»Denk doch mal nach. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sich die Frau gewehrt hat.«
Colombas Geist lichtete sich einen Moment. »Sie wusste, dass der Ehemann zur Gewalt neigt. Trotzdem hat sie ihm den Rücken zugewandt und ist nicht geflohen.« Colomba dachte einen Moment nach und schüttelte dann den Kopf. »Das ist merkwürdig, da gebe ich Ihnen recht. Das ist aber noch kein Grund, ihn zu entlasten. Dafür kann es tausend Erklärungen geben.«
»Mit wie vielen Mördern, die man als Psychopathen oder Soziopathen einstufen würde, hattest du es schon zu tun?«, fragte Rovere.
»Das kam schon mal vor«, antwortete Colomba ausweichend.
»Und wie viele von denen, die ein Familienmitglied ermordet haben, waren am Ende geständig?«
»Manche nie.«
»Hatten sie dann etwas an sich, das dir das Gefühl eingeflößt hat, sie seien schuldig, obwohl sie hartnäckig geleugnet haben?«
Colomba nickte widerstrebend. »Lügen will gelernt sein. Aber Gefühle machen sich in einem Polizeibericht nicht gut.«
»Und vor Gericht nützen sie überhaupt nichts. Die Reaktion dieser Menschen ist trotzdem nicht ganz normal. Sie sagen etwas Falsches oder reißen einen Witz, wenn sie eigentlich weinen sollten. Oder sie weinen, wenn sie sich eigentlich aufregen sollten. Selbst denen, die den Mord verdrängt haben, unterlaufen Fehler.« Er machte eine Pause. »Hast du bei Maugeri so etwas feststellen können, als er seine tote Ehefrau entdeckt hat?«
Colomba massierte sich die Schläfen. Was war hier los? »Nein, aber ich habe auch nicht mit ihm gesprochen. Ich habe nur gesehen, wie er sich aufgeführt hat.«
»Ich war bei der ersten Vernehmung dabei, als man noch nichts von dem Mord wusste. Er hat nicht gelogen.«
»Okay, dann ist er also der falsche Mann. Santini und De Angelis werden das irgendwann auch begreifen und sich auf die Suche nach dem wahren Täter machen.«
Rovere durchbohrte sie fast mit seinem Blick. »Und der Sohn?«
»Meinen Sie, er lebt noch?«, fragte Colomba.
»Ich halte es zumindest für möglich. Wenn der Vater unschuldig ist, wurde das Kind vom Mörder verschleppt. Für das Blut im Kofferraum könnte es eine andere Erklärung geben.«
»Vielleicht ist der Junge aber auch auf der Flucht in einen Graben gefallen.«
»Dann hätten wir ihn längst gefunden. Wie weit kann ein Kind ohne Schuhe in dieser Gegend schon kommen?«
»Santini wird ihn trotzdem suchen lassen«, erwiderte Colomba. »So dämlich ist er schließlich auch nicht.«
»Santini und De Angelis haben bereits ihre Erklärung. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Indizien, die ihrer Hypothese widersprechen, überhaupt als solche in Betracht ziehen? Und zwar bald und nicht erst in einer Woche oder einem Monat?«
»Eher gering«, gab Colomba zu.
»Und was wird solange aus dem Kind?«
»Was interessiert Sie das überhaupt?«
Rovere zog eine Grimasse. »Ich bin doch kein Roboter.«
»Aber auch kein Anfänger.« Colomba beugte sich zu ihm vor. »Sie sind Chef der Squadra Mobile geworden, weil Sie ein guter Polizist sind, aber auch, weil Sie nicht unangenehm auffallen. Und wenn man die Nase in anderer Leute Ermittlungen steckt, fällt man verdammt unangenehm auf.«
»Niemand hat behauptet, dass ich es bin, der die Nase irgendwo reinsteckt.«
Colomba schlug mit der Hand auf den Tisch. »Sie wollen mich den Wölfen zum Fraß vorwerfen?«
»Ja«, sagte Rovere ungerührt.
Colomba hatte schon einige Sträußchen mit ihm ausgefochten, sie hatten sich angeschrien und mit den Türen geknallt, aber noch nie hatte sie sich derart verraten gefühlt. »Diesen Ausflug heute hätten Sie mir ersparen können.«
»Du hast selbst gesagt, dass du dich aus dem Job zurückziehen willst. Du hast nichts zu verlieren. Und für den Jungen könntest du eine gute Tat vollbringen.«
Colomba hielt es nicht mehr auf ihrem Platz. Sie sprang auf und kehrte Rovere den Rücken zu. Durchs Fenster sah sie Alberti am Land Rover lehnen und wie ein Löwe gähnen.
»Du bist mir etwas schuldig, Colomba«, sagte Rovere.
»Warum tun Sie mir das an?«
Er seufzte. »Weißt du, wer der Chef des SIC ist?«
»Scotti. Falls er es noch ist.«
»Er geht nächstes Jahr in Pension. Und weißt du, wer in den Startlöchern hockt, um sich die Stelle unter den Nagel zu reißen?«
»Es könnte mir nicht gleichgültiger sein.«
»Santini. Und weißt du auch, wer vorher einmal der aussichtsreichste Anwärter war?«
Colomba drehte sich um und starrte ihn an. »Sie?«
»Ich. Seit der Sache, die dir zugestoßen ist, habe ich einen kleinen Salto rückwärts gemacht. Wenn ein Tüchtiger den Posten bekommen würde, könnte ich mich ja damit abfinden, aber Santini ist eine Fehlbesetzung.«
»Und nun soll ich Santini für Sie in die Scheiße reiten«, sagte Colomba angewidert. Rovere schien sich unter ihren Augen in jemand anderen zu verwandeln. Diese Seite hatte sie noch nie an ihm wahrgenommen, ja, mehr noch, sie hätte es nicht für möglich gehalten, dass er eine solche Seite überhaupt besaß. »Um Ihrer Karriere auf die Sprünge zu helfen?«
»Wenn es gut läuft, rettest du ein Kind, vergiss das nicht.«
»Wenn es nicht in der Zwischenzeit stirbt.«
»Die Schuld würde denjenigen treffen, der die Ermittlungen verbockt hat.«
»De Angelis wird nicht begeistert sein, wenn ich meine Nase in seine Angelegenheiten stecke.«
»Normalerweise würde er dich suspendieren oder versetzen. Unter den gegebenen Umständen hat er aber keine Handhabe gegen dich, solange du nicht gegen das Gesetz verstößt. Im Falle eines Falles behauptest du einfach, dass du auf eigene Faust gehandelt hast, weil dir Santini auf die Nerven geht.«
Colomba ließ die Schultern sacken. Sie verspürte Ekel gegen sich selbst und ihren Chef gleichermaßen. In einem Punkt hatte Rovere allerdings recht: Sie war es ihm schuldig. Sie war es ihm schuldig, weil er nach der großen Katastrophe der Einzige gewesen war, in dessen Augen sie nie auch nur den Schatten eines Verdachts oder mangelnden Vertrauens gesehen hatte. Nur Mitgefühl. »Ich soll also als Privatperson herumschnüffeln?«, wollte sie wissen.
»Deinen Dienstausweis hast du ja noch. Benutze ihn, wenn es sein muss. Wirbel aber möglichst keinen Staub auf. Und wenn du etwas brauchst, komm zu mir.«
»Und wenn ich etwas finde?«
»Dann werde ich es De Angelis unauffällig unterjubeln.«
»Und sobald De Angelis wittert, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat…«
»Wird er das Pferd wechseln.«
Colomba presste die Hand an die schmerzende Schläfe. »Das wird nicht funktionieren. Allein schaffe ich das nicht.« Rovere zögerte, aber Colomba wusste, dass er die Antwort schon parat hatte. Er hat an alles gedacht, um mich in seinen elenden Krieg schicken zu können.
»Es gäbe da jemanden, der dir helfen könnte«, sagte Rovere. »Jemanden, dem du als Polizistin mit Karriereambitionen niemals zu nahe kommen dürftest. Vermutlich würde er das auch gar nicht zulassen. Aber in deinem Fall…«
»Wer?«
Rovere steckte sich eine Zigarette an. »Hast du schon einmal von dem Jungen aus dem Silo gehört?«
III
Das junge Ehepaar am Tisch in der Raummitte unterhält sich am lautesten. Sie sind gekommen, um ihren ersten Hochzeitstag in diesem Restaurant zu feiern, und sind diesen Luxus überhaupt nicht gewöhnt. Sie hält unentwegt nach irgendeinem Promi Ausschau, während er sich vor allem bemüht, nicht ständig an die exorbitante Rechnung zu denken, die man ihnen unweigerlich präsentieren wird. Er hat natürlich um die gesalzenen Preise gewusst – das Restaurant liegt in der obersten Etage eines Edelkaufhauses, in das Leute wie sie nie einen Fuß setzen würden (na ja, seine Frau schon, immerhin schaut sie sich dort immer die neue Kollektion an)–, aber was er auf der Speisekarte gesehen hat, übertrifft seine schlimmsten Befürchtungen. Allerdings möchte er seine Frau auch nicht bitten, sich bei der Bestellung zurückzuhalten. Seit einer Woche redet sie von nichts anderem mehr und hat sich alle Mühe gegeben, aus ihren bei Zara im Ausverkauf erworbenen Kleidungsstücken eine angemessene Kombination auszuwählen.
Er ist siebenundzwanzig, sie neunundzwanzig.
Wenige Meter weiter sitzt ein deutscher Staatsbürger vor einem Sushiteller. Er liest die amerikanische Ausgabe von Der Knochenjäger und stellt irritiert fest, dass sich sein Englisch in den letzten Jahren verschlechtert hat. Die Lektüre bereitet ihm Mühe, obwohl er den Roman schon einmal auf Deutsch gelesen hat. Vielleicht sollte er wieder Privatunterricht nehmen, auch wenn ihm schon die Idee schlechte Laune bereitet. Er fühlt sich zu alt fürs Lernen und fürchtet außerdem, dass sein Gedächtnis nachlässt. Da er Sushi liebt, isst er einmal die Woche in diesem Restaurant, meistens alleine.
Er ist soeben sechzig geworden.
An dem großen, runden Tisch am Fenster, das diskret mit weißem Nessel verhängt ist, sitzt ein DJ mit seiner Freundin, seinem Agenten und einem Discobesitzer aus dem Umland. Sie lauschen dem Kellner, der sie über mögliche Allergien auf die angebotenen Gerichte belehrt, bevor er die Speisekarte austeilt. Der DJ erklärt, dass er gegen rohen Fisch allergisch sei, aber der Kellner, der diesen Witz mindestens einmal am Tag zu hören bekommt, kann schon nicht mehr darüber lächeln. Der DJ war mal Sänger einer Boygroup, die vor drei Jahren einen Top-Ten-Hit hatte. Jetzt arbeitet er an ungefähr zweihundert Abenden im Jahr in angesagten Nachtklubs. CDs verkaufen sich nicht mehr. Sein jetziger Job ist der Beruf der Zukunft.
Das Mädchen hält seine Hand, an der so viele Ringe stecken wie an der Hand der Madonna von Lourdes (alles an dem DJ ist ein bisschen überkandidelt, einschließlich des Tribal-Tattoos im Nacken und der gebleichten Haare). Sie hofft, dass er dieses Mal wenigstens übers Wochenende bleibt oder sie mitnimmt. Sie ist nicht seine offizielle Freundin, sondern nur die Frau, die er anruft, wenn er einen Abend in der Stadt ist, aber sie weiß, dass sie füreinander geschaffen sind. Das spürt sie einfach. Nachdem sie am Nachmittag in seinem Hotel miteinander geschlafen hatten, war er so albern wie ein Kind und hat gelacht und gescherzt. Hätte er das getan, wenn es sich nur um einen flüchtigen Fick gehandelt hätte? Er hat ihr sogar anvertraut, dass er sich demnächst einen neuen Agenten suchen wird. Das ist doch eine sehr vertrauliche Information, oder?
Der fragliche Agent lebt nicht hinter dem Mond, sondern ahnt schon, was ihm blüht. Während er sich nach einer Zigarette sehnt, sucht er in Gedanken verzweifelt nach dem Titel des Films, in dem Woody Allen einen Agenten spielt und ständig von irgendwelchen Künstlern gefeuert wird. Seit einiger Zeit äußert sich der DJ nur noch ausweichend über zukünftige Projekte, und das ist ein verdammt schlechtes Zeichen. Er will sich aus dem Staub machen, ausgerechnet jetzt, wo er dank des Engagements seines Agenten die ersten Erfolge einheimst. Millionen von Telefonaten hat der getätigt, gelegentlich sogar gebettelt und gedroht, um dem DJ mehr Aufträge zu verschaffen. Wer war es denn, der ihn bei den MTV Europe Music Awards untergebracht hat? Oder ihm einen festen Sendeplatz im Radio besorgt hat? Der Agent wird wohl nach dem Auftritt ein paar Worte mit dem DJ wechseln müssen, auch wenn ihm der Gedanke an die Antwort schon jetzt auf den Magen schlägt.
Der Discobesitzer beteiligt sich nicht groß an dem Gespräch, das sich im Wesentlichen in einem Monolog des DJs über die neuesten musikalischen Entwicklungen erschöpft, die dieser Idiot natürlich alle vorhergesehen haben will. Er hofft einfach, dass das Essen nicht allzu lange dauert. Was ihn betrifft, hält er The Dark Side of the Moon für das schönste Album der Musikgeschichte, während sämtliche DJs zusammengenommen nicht annähernd an die Klasse der alten Rockgarde herankommen. Das kann man aber jemandem, den man soeben für zweitausend Euro bar auf die Kralle engagiert hat, weil er die Säle füllt, kaum mitteilen. Stattdessen bedenkt der Discobesitzer das Mädchen mit einem Lächeln und befindet, dass es rattenscharf ist, mit diesem Modelkörper und seiner Unschuldsmiene. Er sieht es förmlich vor sich, wie sie mit diesem Gesichtchen irgendwelche Schweinereien anstellt. Sobald sich der DJ wieder aus dem Staub gemacht hat, wird er sie anrufen und ihr vorschlagen, in seinem Klub aufzutreten. »Das ist eine gute Gelegenheit, sich im Showmilieu zu etablieren, und erzähl mir nicht, dass du nicht heimlich davon träumst. Überlass das einfach mir.«
Der DJ ist neunundzwanzig, der Agent neununddreißig, der Discobesitzer fünfzig, das Mädchen siebzehn, der Kellner zweiundzwanzig.
Am Tisch neben dem Eingang wartet ein älteres Ehepaar auf das Dessert: Eis aus grünem Tee für ihn und eine Auswahl an Soja- und Bohnengebäck für sie, die von den anderen Gängen kaum etwas angerührt hat. Sie waren die Ersten, die gekommen sind, als es im Speisesaal noch leer und ruhig war. Der Ehemann hat sich ein paarmal erkundigt, ob irgendetwas nicht stimme, aber sie hat nur gelächelt und darauf beharrt, dass alles in Ordnung sei und sie einfach keinen Appetit habe. Sie leben schon fast ein halbes Jahrhundert zusammen. Er hat sich im Staatsdienst hochgearbeitet, bevor er in Pension gegangen ist, und sie hat zwei Söhne großgezogen, die sich an den Feiertagen blicken lassen. Sie hat seine sporadischen Seitensprünge ertragen und mittlerweile fast vergeben und vergessen, und er ihre psychisch labilen Phasen, in denen sie kaum aus dem Bett kam und die Rollläden geschlossen hielt, weil sie das Sonnenlicht nicht ertrug. Die Zeit hat die Unterschiede zwischen ihnen aufgehoben, hat die Ecken und Kanten abgeschliffen, bis sie eins waren und voneinander abhängig. Deswegen weiß sie auch nicht, wie sie ihm beibringen soll, dass die Untersuchungsergebnisse Anlass zur Beunruhigung geben: Zwischen den Stirnhöhlen wurde zweifelsfrei Tumorgewebe festgestellt. Was ihr am meisten Angst einjagt, ist nicht der Tod, sondern dass sie ihren Mann alleine lassen muss. Sie fragt sich, was er ohne sie anfangen soll.
Er ist zweiundsiebzig, sie fünfundsechzig.
Zwei Tische weiter, an einem weiteren runden Tisch, sitzen vier albanische Mädchen und ein Mann mit klassischem Profil. Die Mädchen sind Models, und der Mann ist ihr offizieller Begleiter von ihrer Agentur. Vor den wichtigen Modeschauen mit ihnen essen zu gehen gehört zu seinem Job. Er umsorgt sie, hilft ihnen und achtet darauf, dass sie keinen Unsinn machen, weshalb er ihnen auch ein Gramm Kokain besorgt hat. Jetzt picken die Mädchen lustlos in ihrem Essen herum. Er selbst macht sich nichts aus Drogen. Er nimmt keine und würde die Dealer am liebsten an die Wand stellen. Allerdings weiß er, dass es sinnlos wäre, den Mädchen den Drogenkonsum zu verbieten. Wenn er ihnen nichts gäbe, würden sie sich bei denen eindecken, die mit ihrem Cayenne und den Tütchen vor dem Hotel stehen, und wenn er sie in ihrem Zimmer einsperren würde, sprängen sie aus dem Fenster. Sie schaffen es auch ohne ihn, sich zu zerstören. Zu den Proben erscheinen sie mit verquollenen Augen und aufgedunsenen Gesichtern. Durch das Kokain verspüren sie keinen Hunger und verlieren die Angst, nicht schön oder gut genug zu sein. Bevor er sich verabschiedet, wird er ihnen noch ein Gramm geben, das sollte hoffentlich reichen.
Das Gespräch bei Tisch ist ziemlich sprunghaft. Die Mädchen sprechen nur gebrochen Englisch, lachen aber gern. Auf Albanisch fragen sie sich, ob er schwul ist oder mit einer von ihnen ins Bett will. Beides ist falsch. Er ist nicht schwul, aber Models gefallen ihm nicht. Er findet sie langweilig und dumm und kann sie nicht einmal auseinanderhalten. Eigentlich machen sie ihn vor allem traurig.
Er ist fünfunddreißig. Zwei Mädchen sind neunzehn, eines ist achtzehn, eines zwanzig.