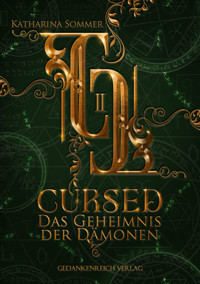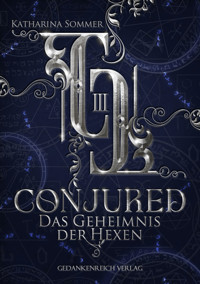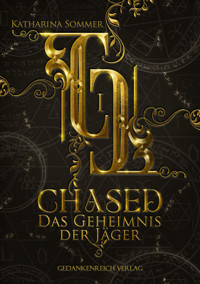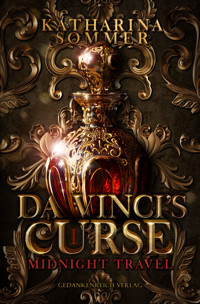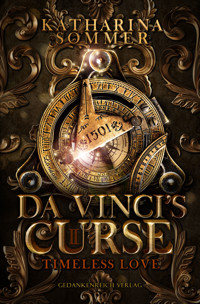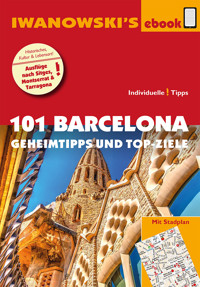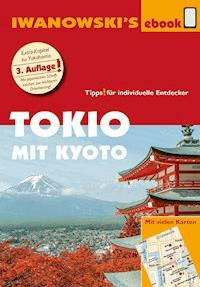4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GedankenReich Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal führt ungleiche Gefährten zueinander. Doch die Elemente spielen selten nach festen Regeln. Vor Zara liegt die Flucht ihres Lebens. Sie ist der Sklaverei entkommen und will in einem freien Land neu anfangen. Doch dann fällt ihr ein Drachenei in die Hände und plötzlich ist die gesamte königliche Garde hinter ihr her. Unter ihnen ist auch Tristan, ein Pfleger magischer Wesen, der das Ei um jeden Preis zu seinem König zurückbringen will. Aber er ist nicht der Einzige, der Interesse daran hat. Denn dieser Drache wird über das Schicksal aller Länder entscheiden. Dabei ahnt niemand, dass Zaras Weg untrennbar mit seinem verbunden ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Danksagung
Über die Autorin
GedankenReich Verlag
Denise ReichowHeitlinger Hof 7b30419 Hannover
www.gedankenreich-verlag.de
INDIGO - BEIM LEBEN DES DRACHEN
Text © Katharina Sommer, 2019
Cover & Umschlaggestaltung: Marie Graßhoff
Lektorat & Korrektorat: Marie Weißdorn
Satz & Layout: Phantasmal ImageeBook: Grittany Design
Bilder: Depositphotos
(eBook) ISBN 978-3-947147-41-0
© GedankenReich Verlag, 2019
Alle Rechte vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Das Schicksal führt ungleiche Gefährten zueinander.
Doch die Elemente spielen selten nach festen Regeln.
Vor Zara liegt die Flucht ihres Lebens. Sie ist der Sklaverei entkommen und will in einem freien Land neu anfangen.
Doch dann fällt ihr ein Drachenei in die Hände und plötzlich ist die gesamte königliche Garde hinter ihr her.
Unter ihnen ist auch Tristan, ein Pfleger magischer Wesen, der das Ei um jeden Preis zu seinem König zurückbringen will.
Aber er ist nicht der Einzige, der Interesse daran hat. Denn dieser Drache wird über das Schicksal aller Länder entscheiden.
Dabei ahnt niemand, dass Zaras Weg untrennbar mit seinem verbunden ist …
KATHARINA SOMMER
indigo
Beim Leben des Drachen
DAS DRACHENEI
Tristan
Mit gerecktem Hals kämpfte sich Tristan durch die Menge. Im Thronsaal der Hauptstadt Dehnariens hatten sich Hunderte Schaulustige versammelt und versuchten wie er einen Blick auf die Eröffnungszeremonie zu erhaschen.
Gerade als er einen guten Platz gefunden hatte, sprang ihm übermütig eine kleine Wüstenelfe auf die Schulter. Ungehalten fegte er sie mit einer Hand von sich, woraufhin das lästige Geschöpf weiter nach vorne flatterte. Tristan verdrehte entnervt die Augen, denn nun brachte es die tasmanische Königin ins Straucheln. Die aus dem Norden stammenden Gäste waren mit den Gepflogenheiten des südländischen Feuervolkes nicht vertraut und der Königin war der Ärger über das rüde Verhalten der Elfe deutlich anzusehen. Das zarte Flügelwesen war zwar nicht viel größer als eine Fliege, verhielt sich jedoch genauso nervig und sonnte sich in der allgemein angespannten Atmosphäre.
»Es ist mir eine Ehre, Euch kennenzulernen«, grüßte der dehnarische König Scąr die Gäste und küsste der tasmanischen Königin freundschaftlich die Hand.
Die Sprachbarriere überbrückte er sowohl mit weitläufigen Gesten als auch mit einem abnormal breiten Lächeln, zu dem er sich unter normalen Umständen niemals herabgelassen hätte. Der heutige Tag war jedoch alles andere als normal. Denn der Besuch des nördlichen Königshauses musste glatt über die Bühne gehen, da das Reich die Allianz mit den Tasmanen dringend brauchte. Die Hochzeit von Scąrs ältestem Sohn Joschua und der tasmanischen Prinzessin Izabel würde Frieden und Stabilität über die Länder bringen.
Fasziniert verfolgte Tristan die Willkommenszeremonie. Das Leben am Hof hatte ihn schon immer beeindruckt. Während der letzten Jahre seiner Lehre außerhalb des Palastes war jeder Besuch wie das Abtauchen in eine fremde Welt gewesen. Bunt schillernd, wahrlich magisch und aufregend. Nun, da er die vergangenen fünf Wochen hier verbracht hatte, war die Begeisterung für den Palast allerdings verflogen.
Bedauerlicherweise neigte sich seine Ausbildung als Pfleger für magische Wesen dem Ende zu und er wollte sich nicht eingestehen, was das für seine Zukunft bedeuten würde. Die letzten Jahre hatte er in den königlichen Wäldern verbracht und mit faszinierenden Tieren wie Golem, Nymphen und Drachen gearbeitet, aber er ahnte, dass seine Familie nun von ihm erwarten würde, dem Wald den Rücken zu kehren.
Dabei reizte ihn die Lust des Abenteuers und er wollte viel lieber alle Länder Godsquanas bereisen. Bisher hatte er Dehnarien noch nie verlassen und er brannte darauf, auch das tasmanische und kopanische Reich zu erkunden und mit den dortigen magischen Wesen vertraut zu werden. Allerdings hatte er in dieser Hinsicht wenig Mitspracherecht. Man würde von ihm verlangen, dass er die Pflichten eines erwachsenen Mannes annahm, und keine Rücksicht auf seine Wünsche nehmen.
Sein Blick schweifte zu Moné, die neben ihrem Halbbruder Prinz Joschua auf der Empore stand. Er sollte sich glücklich schätzen, mit ihr verlobt zu sein. Doch nachdem sie ihm die Pläne ihres Vaters anvertraut hatte, wollte sich einfach keine Zufriedenheit einstellen. Es war eine Ehre, dass der König ihn und Moné nach ihrer Hochzeit in den Süden schicken wollte, um die dortigen Aufstände zu beruhigen.
Die Menschen begehrten gegen die Sklaverei auf, wollten die Monarchie endgültig aus dem Land vertreiben und den König stürzen. Deshalb brauchte König Scąr sie vor Ort in Yehl als Repräsentanten der Königsfamilie. Aber Tristan war zum Pfleger magischer Tiere ausgebildet worden, nicht zum Statthalter.
»Als Zeichen meines Segens gegenüber dieser Verbindung habe ich ein Verlobungsgeschenk für die Braut vorbereitet«, erläuterte der König, während ein Übersetzer den tasmanischen Gästen leise seine Worte vermittelte.
Scąr reckte selbstbewusst die Brust, sodass der purpurne Mantel im Licht der glühenden Sonne, das durch die hohen Buntglasfenster leuchtete, majestätisch schillerte wie die Schuppen eines Drachen.
Die Atmosphäre im prunkvoll geschmückten Thronsaal war geladen vor Spannung und alle Anwesenden streckten die Hälse. Auch Tristan lehnte sich gespannt nach vorne. Nun würde der Sohn des Königs der Prinzessin das Geschenk präsentieren. Gleichermaßen nervös wie freudig erregt betrachtete Tristan die Schatulle, in welcher das wertvolle Stück gebettet auf Seidenkissen lag. Weder ein Ring noch eine Kette oder ein Juwel könnte je an seinen Wert heranreichen.
Es war das Ei eines Wasserdrachen.
Tristan höchstpersönlich hatte die letzten Monate für die Pflege des kostbaren Dracheneis gesorgt. Es erfüllte ihn mit Stolz, dass ausgerechnet ihm diese wichtige Aufgabe anvertraut worden war. Schließlich gehörten die Wasserdrachen zu den seltensten und kostbarsten Tieren dieser Welt. Hinzu kam die Bedeutung, die an den rauen Schuppen des Dracheneis klebte wie Pech an Schwefel. Denn sie galten in ganz Godsquana als Friedenssymbol. Eine wichtige Geste in der momentanen Konfliktsituation zwischen den Königreichen.
Feierlich überreichte ein Page dem Prinzen die Schatulle, während der ruhige Gesang eines Wasserhorns für musikalische Untermalung sorgte. Diese heiligen Geister der Göttin Godsqua zählten in der freien Wildbahn zu scheuen Tieren. Daher war es nicht weiter verwunderlich, dass das Gesicht des Wasserhorns zu einer angespannten Maske verzogen war, welche der des Prinzen auf fatale Weise glich.
Der junge Mann wirkte nervös und unbeholfen. Als er auf die in jeder Hinsicht bezaubernde Prinzessin zuging, stolperte er beinahe über den roten Teppich. Tristans Mundwinkel zuckten, als das aufgesetzte Lächeln des Königs bei diesem Anblick immer mehr zu einer Grimasse wurde. Doch er verstand die unverhohlene Bewunderung, die der Prinz der Prinzessin entgegenbrachte. Mit ihren langen blonden Haaren, die sich wie flüssiges Gold über ihren Rücken ergossen, war Izabel wirklich wunderschön.Hier im Süden hatte der Großteil der Bevölkerung dunkles, beinahe schwarzes Haar und gebräunte Haut – nun so einen blassen Engel vor sich zu sehen, kam Tristan unwirklich vor.
Mit geröteten Wangen trat Prinz Joschua vor und öffnete die Schatulle. Voller gespannter Vorfreude betrachtete Tristan das Gesicht der Prinzessin. Er war auf ihre Überraschung und vor allem ihre Freude ganz erpicht, ohne Zweifel erwartete er ein strahlendes Lächeln und ein begeistertes Glitzern in ihren blauen Augen. Doch nichts dergleichen geschah. Stattdessen sah die Prinzessin betreten von einem zum anderen.
Tristan verlagerte unruhig das Gewicht auf das linke Bein und hielt vor Anspannung den Atem an. Da stimmte etwas nicht. Am liebsten wäre er sofort nach vorne gestürmt und hätte ihr die Schatulle entrissen, um sich eigens vom Wohlbefinden des Dracheneis zu überzeugen.
»Die Truhe ist leer«, sagte die Prinzessin in unbeholfenem Dehnarisch. Sie sah vom Prinzen zum König, als wartete sie darauf, dass sie die leere Schatulle als einfachen Scherz enttarnten.
»Das kann nicht sein.« Der König verengte die dunklen Augen zu Schlitzen.
Mit der auffallenden Narbe, die sich über seine linke Wange zog, erschien er geradezu furchterregend, als er nach vorne stürzte und der Prinzessin grob die Schatulle entriss. Überrascht taumelte Izabel wenige Schritte zurück.
»Nein. Nein, das darf nicht wahr sein!«, rief der König auf Dehnarisch.
Sein südländischer Akzent verlieh den Worten die Härte eines Knurrens. Kein Wunder, dass die tasmanische Königin zusammenzuckte und entsetzt die Hand vor den Mund schlug. In Tasmanien herrschten andere Sitten vor.
»Nein!« Das unter dem dunklen Bart versteckte Gesicht des Königs lief vor Zorn rot an. Jegliche Fassade brach. »Das Drachenei, es ist weg!«
Obwohl ihm bewusst sein musste, dass er auf die tasmanische Königsfamilie keinen guten Eindruck machte, warf er die Schatulle mit einem wütenden Schrei vor die Füße der Umstehenden. Somit war es auch allen tasmanischen Gästen klar.
Das Drachenei – es war verschwunden.
Innerhalb eines Herzschlages kippte die Atmosphäre im Thronsaal. Niemand regte sich, selbst das Wasserhorn war verstummt und auch Tristan schluckte schwer. Der Zorn des Königs war allerdings nicht der Grund. Nachdem er die Launen des Königs über die Jahre hinweg gewöhnt worden war, beeindruckte Scąr ihn kaum. Dafür stieß ihm das Verschwinden des Dracheneis übel auf.
Das kostbare Ei war keine Sekunde unbewacht gewesen!
Tristan brach der kalte Schweiß aus. Es konnte doch nicht einfach verschwunden sein. Im Gegensatz zum König sorgte er sich einzig und allein um das Wohl des schutzlosen Wasserdrachen. Dieses schöne und seltene Geschöpf war einzigartig und zudem von unvorstellbar hohem Wert, sowohl materiell als auch symbolisch. Für Tristan stand fest, dass es hierbei nicht mit rechten Dingen zuging.
Es musste gestohlen worden sein – doch von wem?
Zara
Schwüle Hitze trieb mir den Schweiß auf die Stirn und laugte mich immer weiter aus. Ich war hohe Temperaturen gewöhnt, jedoch nicht die stechende Hitze nahe dem Äquator. Als Sklavin eines kopanischen Landherren hatte ich im Nordosten Godsquanas unter extremen Bedingungen auf den Plantagen die Wolle von Feuerspinnen geerntet. Aber die Feldarbeit hatte mich augenscheinlich nicht genügend abgehärtet, sonst hätten mir auch die viel höheren Temperaturen hier im Südwesten des kopanischen Reiches nichts ausgemacht.
Bisher war ich noch nie so weit gegangen. Die Luft flirrte geradezu vor Hitze und der Durst verzehrte mich von innen heraus. Kein Wunder, dass jeder mit Kopanien – dem Land voller Sand – nur dessen Wüsten in Verbindung brachte. Ein Lächeln schlich sich auf meine Lippen.
Das Land voller Sand.
Dieses Kinderlied hatte meine Mutter uns Kindern immer vorgesungen. Damals hatte ich nicht wirklich begriffen, dass das zauberhafte Wunderland dasselbe Reich war, in dem ich lebte. Denn obwohl wir auf den Plantagen im Osten genauso mit Trockenheit und Dürre kämpften, hatte ich noch nie eine Wüste gesehen. Ich hatte von dem aufregenden, fremden Land aus den wunderbaren Geschichten meiner Mutter geträumt und mir immerzu gewünscht, eines Tages selbst in die weite Welt hinauszuziehen.
Nun war ich in der bitteren Realität angekommen und wollte nur noch zurück in meine Kindheit. Auch wenn ich schon in die Sklaverei geboren worden war, so war es mir damals wenigstens nicht bewusst gewesen. Aber eine Flucht bot nun mal nicht die beste Basis für einen Abenteuerurlaub.
Ich trat aus dem Schatten der Häuser und strebte den öffentlichen Trinkbrunnen am Marktplatz der kopanischen Hauptstadt an. Doch als mein Blick auf die dort stationierten Stadtwachen fiel, war mir augenblicklich sonnenklar, dass ich hier zu keinem Trinkwasser kommen würde. Mit der armen Unterschicht hatten die Soldaten kein Mitleid und Bettler waren in der Innenstadt nicht gern gesehen. Außerdem hatte ich kein Geld.
Ich verfluchte diesen scheußlichen Tag, der schlimmer gar nicht mehr werden konnte. Ein verdammter Dieb hatte mir meine Tasche und damit wortwörtlich mein Leben geklaut, denn darin befanden sich die offiziellen Papiere, die meine Freiheit bestätigten. Unter einem leeren Metallflachmann, einer in ein Tuch gewickelten alten Scheibe Brot und einer dehnarischen Rorange versteckt, lagen die zusammengefalteten Dokumente.
Der Gedanke an die saftige Rorange, die mir ein Bauer auf meiner Durchreise aus Freundlichkeit oder Mitleid – das war mir gleich – geschenkt hatte, ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen und mein Magen knurrte. Diese Region war für das außergewöhnliche Rot dieser seltenen Frucht bekannt. Es war so satt und leuchtend wie das Blut an meinen wundgetretenen Füßen und glich dem glühenden Feuerball am Himmel, dessen Strahlen jeden Tag meiner Reise durch das Land beinahe unerträglich gemacht hatten.
Ich verzehrte mich danach, die saftige Frucht zu essen. Normale Orangen gab es auch im Osten in Fülle, allerdings konnte ich an einer Hand abzählen, wie oft ich ein Stück davon hatte kosten können. Solche Kostbarkeiten standen den Sklaven nicht zu. Natürlich hatte ich wahrlich größere Probleme als den Verlust dieser einfachen Frucht, aber meine Gedanken waren erschöpft und wirr.
Mein ramponiertes Aussehen und das Erkennungsmal an meinem Unterarm enttarnten mich unweigerlich als Unfreie. Spätestens das Fehlen der Lebensarmreifen, wie sie von freien Bürgern im Süden getragen wurden, würde jegliche Zweifel der Wachen ausräumen. Nichts an mir zeugte vom Gegenteil – ich war als Sklavin geboren. Einzig meine Papiere hätten bewiesen, dass mich mein Herr vor seinem Tod freigelassen hatte.
Zähneknirschend zog ich weiter über den Markt. Geld für Essen hatte ich natürlich keines mehr und auf Mitleid war hier in der Hauptstadt Kopa auch nicht zu hoffen. Nun blieb mir nichts anderes übrig, als die Stadt zu verlassen und in der Weite des ausgetrockneten Landes nach einem Fluss und Nahrung zu suchen.
Die Sonne stand schon hoch am Himmel und glühte erbarmungslos auf mich herunter. Ohne Zweifel würde es noch ein anstrengender Tag werden. Und eine anstrengende Nacht, schließlich wusste ich nicht, ob und wo ich einen Unterschlupf zum Schlafen finden würde.
Frustriert setzte ich meine Schritte fester auf den trockenen Lehmboden auf. Was sollte ich tun? Ohne das Geld, welches mir mein Herr kurz vor seinem Tod überreicht hatte, hatte ich keine Chance auf eine Überfahrt nach Tasmanien.
Gut zwei Wochen war ich nun schon auf der Reise in den Westen. Mein Zuhause lag weit im Osten und Kopa, die Hauptstadt, im westlichen Teil Kopaniens. Von hier aus wollte ich nun weiter in den Norden. Ignis war die Hauptstadt Tasmaniens und das Ziel meiner halsbrecherischen Flucht. In jenem fruchtbaren Land im Norden hatten auch ehemalige Sklaven einen Funken an Hoffnung auf ein normales Leben als freie Menschen. Nun stand in Frage, ob ich den Süden überhaupt lebend verlassen würde.
Heiße Tränen der Verzweiflung sammelten sich in meinen Augenwinkeln und ich blinzelte sie schnell weg. Ich durfte meinen Kampfgeist nicht verlieren. Er war alles, was mir noch blieb. Ich war schon so weit gekommen. Es wäre auch zu ironisch gewesen, zwischen unzähligen Händlern auf dem Marktplatz zu verhungern, doch so war das Leben in diesem grausamen Land und der gefürchtete König Aréolan dachte gar nicht daran, etwas zu ändern.
Stolz präsentierten die Verkäufer die saftigen Früchte aus dem untersten Süden Kopaniens, selbst aus Dehnarien hatten sie Waren importiert. Konnte man allerdings nicht zahlen, ließen sie die Menschen vor ihren Füßen sterben. Als ich die Plantagen in meiner Heimat verließ, hatte ich gedacht, der Hölle entkommen zu sein. Doch der Weg in die Freiheit würde eine Tortur werden, steinig und schwer.
Mit gestrafften Schultern und gehobenem Kinn kämpfte ich mich durch die Menge. Sobald ich die Verkaufsstände umrundet hatte, war in den Gassen etwas mehr Platz. Kinder tollten vor mir über die Straße und ich musste aufpassen, niemanden niederzustoßen.
Mit einem Mal kam mir die Menschenmasse in Kopa unglaublich drückend vor. So hatte ich mir die Freiheit nach siebzehn Jahren als Sklavin nicht vorgestellt. Ich empfand keine überschwängliche Freude, nicht mal ein laues Glücksgefühl. Da war einzig die Angst, den morgigen Tag nicht zu erleben.
Und all das nur, weil mir ein dummer Tandos die Tasche gestohlen hatte. Ein Tandos, ein elender Schuft! Kalte Wut braute sich in meinem Magen zusammen, aber davon wurde ich auch nicht satt. Es war Zeit für einen Plan!
Zielsicher wanderte ich über den Marktplatz. Gaukler versuchten die Aufmerksamkeit der Umstehenden auf sich zu ziehen, doch mich konnte ihre Unterhaltung nicht weiter beeindrucken. In der Mitte, zwischen zahlreichen Ständen und mit Wagen herumziehenden Verkäufern, thronte eine Marmorstatue unserer Göttin Godsqua.
Ihr Antlitz funkelte in der Mittagssonne und ich schickte ein stummes Gebet zu ihr.
Ich war verloren – nun konnten mir einzig die Götter beistehen. In Gedanken betete ich zu Schmar, dem Gott des Überflusses, und zu Zetta, der Göttin der Früchte. So würde ich womöglich sogar noch an meine Rorange kommen.
Doch meine Gebete wurden nicht erhört und auf Mitgefühl und Hilfe konnte man in dieser Stadt bis in alle Ewigkeit warten. Am großen Wollmarkt, auf welchem wir im Herbst jedes Jahr in der nächstgelegenen Stadt die kostbare Feuerspinnenwolle verkauft hatten, hatte ich nicht nur einmal einen verhungerten Bettler auf der Straße gesehen. Herr Salamon hatte mich jedes Mal dazu gedrängt, wegzusehen, der Anblick war zu verstörend für ein kleines Kind.
Ich hatte mich gefragt, ob es meinem Vater genauso ergangen war, nachdem er von seinem Herren – ein grauenvoller Mann, der uns an Herrn Salamon verkauft hatte – und uns davongelaufen war. Ohne Zweifel, um ein besseres Leben anzufangen, auch wenn es so etwas für Sklaven wie uns nicht gab. Ich hätte die Chance gehabt. Nichtsdestotrotz waren meine Papiere weg und meine Zukunft gleich mit.
Einer der Gaukler sprang mir in den Weg. Er wedelte mit einer Büchse vor meiner Nase herum, ich hörte die Goldstücke klirren. Ganz offensichtlich wollte er Geld. Da konnte ich mich ihm nur anschließen.
»Ich habe nichts«, fauchte ich ärgerlich und drängte mich unwirsch an ihm vorbei.
Meine harsche Abwehr verstimmte ihn wohl, denn plötzlich wurde er ungemütlich und rief mir etwas auf Kopanisch hinterher. Die Umstehenden lachten. Schnell tauchte ich in der Menge unter.
In meinem Kopf nahm einfach kein Plan Form an. Verzweifelt hielt ich am Rand des Marktplatzes in den Schatten der Hausmauern inne. Mein Blick schweifte über den Platz, bis er bei einem großen Mann hängen blieb. Sein kurz geschorenes, schwarzes Haar glänzte in der Sonne, Schweiß stand auf seiner Stirn. Er saß an einem Tisch vor einer Schänke und setzte einen Krug an die Lippen. Wer sich hier etwas zu trinken leisten konnte, bekam nur das Beste vom Besten. Vermutlich ein delikater Zwergenwein aus dem Norden.
Das lumpige äußere Erscheinungsbild des Mannes ließ darauf schließen, dass es sich um einen armen Schlucker handelte, der erst kürzlich zu einigen Goldstücken gekommen war und diese nun versoff. Sofort glitt mein Blick zu seinem Handgelenk, an dem lediglich drei Lebensarmreifen baumelten. Immer noch drei mehr als bei Sklaven wie mir, aber damit war er nicht mehr als ein gewöhnlicher Stadtbewohner. Um das alles zu unterstreichen, war sein Benehmen laut und rüpelhaft.
Ich sah der hübschen Bedienung an, dass sie sich unwohl fühlte, als er ihr in den Ausschnitt glotzte. Stutzig machten mich allerdings weder sein ungewöhnlich trainiertes Aussehen noch sein auffallendes Verhalten – sondern vielmehr die graue Tasche, die er lässig über seine Schulter gelegt hatte. Fassungslos starrte ich ihn an, während die unterschiedlichsten Gefühle und Gedanken durch mich hindurchrauschten.
Schlussendlich blieb nur eine Erkenntnis: Er hatte meine Tasche!
Leichtfüßig pirschte ich mich an den Dieb heran. Ich kniff die Augen zusammen, als ich den grauen Stoffbeutel fokussierte. Mein Herr hatte mir dieses teure Stück anvertraut, als er am Sterbebett lag und mir die Freiheit schenkte. Die Verschlüsse bestanden aus Silberknöpfen, die nun in der prallen Mittagssonne wie Sterne funkelten.
Unverkennbar, es war meine Tasche. Würde ich den Mann nun in der Öffentlichkeit als Dieb beschuldigen, hatte ich als augenscheinliche Sklavin keine Chance. Die Bürger würden sich sofort auf seine Seite stellen. Immerhin hatte er das Geld und Geld regierte bekanntlich die Welt. Ahnungslos drehte der Dieb einen Silberdior zwischen seinen dreckverkrusteten Fingern und betrachtete das Geldstück mit einem verschleierten Lächeln. Er war bereits betrunken. Gut so!
Ich verschmolz mit der vorbeiströmenden Menschenmasse und hatte ihn schnell erreicht. Als ich mich an seinem Tisch vorbeidrängte, griff ich ohne zu zögern nach dem Träger der Tasche. Der Dieb hatte gerade den Weinbecher an seine Lippen gesetzt, als er bemerkte, wie ich ihm mein Eigentum entwendete.
»He!«, brüllte er aus vollem Hals und donnerte den Holzbecher mit einer Wucht auf den Tisch, dass der Henkel abbrach und sich die Splitter in seine Hand gruben.
Vor Schmerz und Wut gleichwohl schreiend, stürzte er mir nach. Doch da war ich bereits in der Menschenmasse verschwunden.
»Haltet sie! Haltet die Diebin!«
Unruhe kam auf. Waren Händler, Bettler, Bewohner und Kinder zuvor in ruhigem Gleichklang nebeneinander über den Platz geschwebt, so stockte dieser Fluss nun. Einige blieben stehen und brachten die Folgenden ins Straucheln. Wie aus einer Trance erwacht, sahen sich die Leute plötzlich um und begannen aufgeregt zu reden.
»Haltet sie auf!«, fielen weitere in das Gebrüll mit ein.
Wunderbar. Nun bestraften mich die Götter dafür, dass ich so impulsiv reagiert hatte, auch wenn ich keine Wahl gehabt hatte. Kalter Angstschweiß trat mir auf die Stirn.
Plötzlich griff jemand nach mir und mich rettete allein die Tatsache, dass der Fremde sich nicht so flink durch das Getümmel schlängeln konnte. Meine Beine bewegten sich wie von selbst, bis ich endlich in eine der Gassen abtauchte. Donnernd hallten meine Schritte von den aus Sandstein erbauten Wänden wider.
»Da! Da ist sie«, erklang eine keuchende Stimme hinter mir.
Als ich einen kurzen Blick zurück riskierte, erkannte ich die bronzefarbene Uniform der Stadtwache von Kopa.
»Verdammt«, fluchte ich laut. Ein Viehwagen stand mitten in der Gasse und versperrte mir den Durchgang. Augenblicklich war mir klar, dass die Flucht ausweglos war.
»Haltet sie auf!«, schrie eine der Stadtwachen dem verwirrten Bauern zu, der sich mir sofort in den Weg warf. Aber so schnell würde ich nicht aufgeben. Meine Tasche war zurück und mit ihr die Möglichkeit, nach Tasmanien zu gelangen. Das würde ich mir nicht kaputt machen lassen.
Während des Laufens zog ich mir den Träger der Tasche über den Kopf, sodass ich die Hände frei hatte. Dann machte ich eine abrupte Wendung und sprang auf ein am Gassenrand stehendes Fass. Unter meinem Gewicht begann es zu schwanken, doch bevor es umkippte, griff ich nach dem darüber liegenden Fenstersims und zog mich hoch. Das Fass flog polternd um und rollte den zwei Soldaten entgegen.
»Ihr nach«, schrie der Größere der zwei.
Sie waren mir dicht auf den Fersen, aber mit ihrer metallenen Rüstung waren sie deutlich ungelenker und konnten mir unmöglich über die Außenfassade des alten Hauses folgen. Stattdessen traten sie die Holztür des Hauses rücksichtslos auf und stürmten ins Innere. Die Bewohner schrien vor Schreck und ich bekam es ebenfalls mit der Angst zu tun. Meine Arme zitterten, als ich über die Mauervorsprünge die Fassade hinaufkletterte und mich auf das Dach vorkämpfte. Meinen halben Oberkörper hatte ich bereits hochgestemmt, da erklang der triumphierende Schrei eines Soldaten.
»Ich hab sie!«, hörte ich ihn rufen, da spürte ich auch schon, wie jemand meinen Knöchel packte.
Schreiend trat ich wild um mich und verlor beinahe den Halt. Ich rutschte gefährlich weit das Ziegeldach hinunter, als der Soldat immer kräftiger zog. Fluchend biss ich die Zähne zusammen. Die raue Oberfläche schrammte schmerzhaft über meine Unterarme. Verzweifelt krallte ich mich fest, schlug ein weiteres Mal mit dem Fuß aus, dann traf ich seinen Kopf und schüttelte ihn endlich ab. Während er aufschrie, hievte ich mich keuchend das letzte Stück hoch und rappelte mich auf. Im Westen waren die Dächer flacher gebaut und so lief ich geduckt über die leichte Schräge.
Erst als ich das Öffnen einer Dachluke vernahm, packte mich erneut ein Adrenalinschub und ich beschleunigte meine Schritte. Die Tasche fest an mich gepresst, schlitterte ich über die Dächer davon. Drei Häuser weiter wandte ich mich um und sah, dass die zwei Soldaten mir mit Mühe, aber auch verbissener Beharrlichkeit folgten. In ihren schweren Schuhen rutschten sie auf den glatten Ziegeln umher und konnten sich kaum halten. Mir entschlüpfte ein erleichterter Seufzer.
»Hat mich gefreut, euch kennenzulernen!«, schrie ich ihnen zu, dann hob ich lächelnd zum Abschied die Hand und sprang.
Tristan
Auch Stunden nach der Öffnung der leeren Truhe war das gesamte Schloss noch in Aufruhr. Tristan verstand die Welt nicht mehr. Es war absolut unmöglich, dass das Drachenei gestohlen worden war.
Er hatte es bis heute Morgen gehütet wie seinen Augapfel! Nun war er wie betäubt.
Für den tasmanischen König musste es wirken, als würde König Scąr ihn mit diesem Fauxpas verhöhnen, und auch die Sprachbarriere tat nicht gerade zur Versöhnung bei. Nur dem Geschick der Diplomaten war es zu verdanken, dass die Königsfamilie noch nicht abgereist war.
Prinzessin Izabel hingegen war erstaunlich gefasst. Die missglückte Begrüßung und die damit einhergehende Beleidigung schienen ihr nicht so wichtig. Das faszinierte Tristan. Bisher hatte er wenig gute Erfahrungen mit dem Temperament der dehnarischen Königsfamilie gemacht und hätte instinktiv erwartet, jede Monarchenfamilie würde sich in ihrer überlegenen gesellschaftlichen Stellung so verhalten. Er war erstaunt, wie sanft die Prinzessin aus dem Norden war.
Ihre Eltern wirkten allerdings misstrauisch. Dass die Rebellen im Süden König Scąr einige Probleme bereiteten, war allgemein bekannt und nun kam auch noch das Fiasko mit dem verschwundenen Verlobungsgeschenk hinzu. Tristan hatte manche Tasmanen flüstern hören, Scąr sei nicht mehr fähig, sein Land zu regieren. Die Berichte über die Geschehnisse der letzten Monate waren durch das Gerede der Leute selbst bis nach Tasmanien vorgedrungen und es war kein Geheimnis, dass die Lage im dehnarischen Königreich momentan sehr instabil war.
Inzwischen machte man im Schloss eben jene Rebellen aus dem Süden Dehnariens für den Diebstahl verantwortlich. Für Tristan klang das nach ausgemachtem Unsinn.
Der Hass zwischen den drei Großmächten Dehnarien, Tasmanien und Kopanien bestand seit Jahrhunderten und niemand erwartete, die Hochzeit – so unheilvoll sie auch schon startete – könnte vom einen auf den anderen Tag etwas an der tiefen Feindschaft ändern. Doch die zwei Königreiche brauchten ein starkes Bündnis. Sowohl Dehnarien als auch Tasmanien hatte nicht nur gegen äußere Bedrohungen, sondern genauso gegen Feinde im eigenen Land zu kämpfen.
Waren in Dehnarien die Rebellen aus dem Süden ein Problem, so versetzte der selbsternannte Schattenkönig aus dem Norden die tasmanische Bevölkerung in Angst und Schrecken. Tristan faszinierte schon das Können einfacher Elementbändiger, aber wie jemand Schatten manipulieren und manifestieren sollte, war für ihn unbegreiflich.
In Zeiten wie diesen mussten die Völker über ihre Differenzen, ausgelöst durch Neid und Habgier, hinwegsehen. Niemand profitierte davon, für ein wertvolles Diamantengebiet zu kämpfen, wenn das eigene Land nicht versorgt werden konnte. Jedes Königreich hatte besondere Ressourcen oder Rohstoffe zu bieten, doch keines konnte alles haben, und so würde es für immer ein aussichtsloser Kampf bleiben.
Das tasmanische Königspaar hatte sich in seinem Stolz gekränkt zurückgezogen, während König Scąr voller Wut eine Truppe an Soldaten einberufen hatte. Es herrschte Chaos im Schloss und Tristan wusste nicht viel mit sich anzufangen. Obwohl ihm alles daran lag, das Drachenei zu finden, hatte er keine Anhaltspunkte und so wartete er gespannt, bis ihn einer der Offiziere informieren würde. Irgendwann konnte er nicht länger stillsitzen und streifte ziellos durch den Palast. Er verharrte erst, als er einen Blick in den Innenhof warf.
Plötzlich waren seine rasenden Gedanken wie weggeweht und Ruhe hüllte ihn ein. Prinzessin Izabel saß im Garten des Innenhofes und hielt mit einem Lächeln ihr Gesicht der Sonne entgegen. Im Gegensatz zu ihren vier Hofdamen versteckte sie sich nicht unter dem Baldachin, sondern saß etwas abseits auf einer Bank zwischen zwei Rosenbüschen. So war sie dem glühenden Sonnenball, der alle Aufmerksamkeit auf sie zog, vollkommen ausgeliefert.
Ihre blasse Haut strahlte alabasterweiß und ihr blondes Haar fiel wie ein goldener Vorhang in sanften Wellen über ihre Schultern. Sie war wahrlich eine faszinierende Frau und Tristan war nicht der Einzige, dem sie es angetan hatte. Ihr eilte der Ruf der Prinzessin der Herzen voraus. Selbst in Dehnarien, wo die tasmanische Königsfamilie verhasst war, verfielen die Menschen scharenweise ihrer Schönheit und Anmut.
Tristan dachte im Stillen, dass sie vermutlich als Einzige die Differenzen zwischen den Königreichen wenigstens in den Augen der Öffentlichkeit überbrücken konnte. Für ihn war aber nicht ihre Schönheit das Ausschlaggebende, sondern ihre Ruhe. Die eiserne Gelassenheit, welche sie selbst nach dieser grauenvollen Eskapade zur Schau stellte, als würde die Unruhe einfach von ihr abprallen. Unweigerlich fragte er sich, ob sie tatsächlich so ruhig oder lediglich eine gute Schauspielerin war, die ihre wahren Gefühle zu verstecken wusste. Diese offenen Fragen machten die Prinzessin in Tristans Augen nur noch interessanter.
»Pass auf, dass du nicht zu sabbern beginnst«, ertönte eine vertraute Stimme hinter Tristan.
Wie von einem Fomori gebissen, schreckte er auf.
»Moné. Was tust du hier?«, rief er überrascht aus und sah seinem hübschen Gegenüber mit wild klopfendem Herz entgegen. Er fühlte sich ertappt.
»Ich habe von dem Diebstahl gehört und wollte sicherstellen, dass es dir gut geht«, antwortete die junge Frau und beäugte ihn aus dunklen Augen.
Sie war eine wahre Schönheit, beinahe so außergewöhnlich wie die Prinzessin, und doch unterschieden sie sich wie Sonne und Mond. Anstatt der blonden Haarpracht hatte Moné rabenschwarzes, glänzendes Haar, welches ihr bis zur Hüfte reichte, und die olivfarbene Haut verstärkte den Kontrast zu ihrer weißen Tunika, die ihre weiblichen Kurven betonte. Die sinnlichen Lippen waren meist zu einem Schmollmund verzogen. Tristan wollte nicht bestreiten, dass sie zum Küssen einluden, dennoch versuchte er stets, sich ihrem Bann zu widersetzen. Warum, konnte er nicht sagen.
»Danke, das ist sehr zuvorkommend.« Selbst in seinen Ohren klangen die Worte gestelzt, also atmete er tief durch. »Aber bei mir ist alles in Ordnung, du brauchst dir keine Sorgen zu machen.«
Tristan zwang sich zu einem warmen Lächeln, obwohl er innerlich vor Sorge aus allen Nähten platzte. Das Drachenei war weg. Natürlich ging es ihm nicht gut, so sehr er sich auch abzulenken versuchte.
Normalerweise hätte Moné nun bei seinem Lächeln dahinschmelzen müssen. Ihm war bewusst, welche Wirkung er auf die Damenwelt hatte, doch Moné war anders. Sie durchschaute ihn.
»Du trägst keine Schuld«, sagte sie ruhig.
Obwohl Tristan wusste, dass sie recht hatte, veränderte sich nichts an seiner gedrückten Stimmung. Das Drachenei war monatelang in seiner Obhut gewesen und er fühlte sich noch immer verantwortlich.
»Vater glaubt, die Rebellen aus dem Süden haben das Ei gestohlen«, sprach sie weiter, als er nicht antwortete.
»Tatsächlich?«, fragte er nachdenklich, obwohl er schon davon gehört hatte.
Moné war die uneheliche Tochter des Königs, somit stellte er ihre Aussage nicht in Frage … und er konnte auch nachvollziehen, warum die Rebellen verdächtigt wurden. Sie waren dehnarische Landsleute wie er selbst. Für sie wäre es leichter, sich in den Hof einzuschleichen, als es beispielsweise für einen Kopanen gewesen wäre. Gerade, da in den letzten Tagen besonders viele Fremde aufgrund der Feierlichkeiten angereist waren.
Außerdem hatten die Rebellen nach den Ausschreitungen im Süden definitiv ein Motiv. Sie wollten König Scąrs Machtposition schaden, um die Königsfamilie endgültig zu stürzen und die Sklaverei in Dehnarien abzuschaffen. Die Rebellen aus dem Süden bereiteten schon seit Monaten Probleme.
Tristan verstand ihre Beweggründe und auch ihre Wut darüber, dass König Scąr die Aufstände niederschlagen ließ. Dennoch hielt er eine Rebellion für falsch. Trotz ihrer Motive bezweifelte Tristan, dass jemand aus den eigenen Reihen das Friedensbündnis mutwillig zerstören würde.
»Ja, aber das sollte nicht deine Sorge sein. Der General kümmert sich darum und das Drachenei wird bestimmt bald gefunden«, antwortete Moné.
Tristan sah ihr an, wie ungern sie über solche vertraulichen Informationen sprach. Sie wusste nicht, dass Tristan bereits mit General Loyd gesprochen hatte. Aus einem Impuls heraus hatte er sich freiwillig für den Suchtrupp gemeldet. Obwohl er als Pfleger magischer Wesen selten mit dem Militär zu tun gehabt hatte, hatte er das Bedürfnis, nicht nur abzuwarten, sondern selbst zu handeln. Schlussendlich musste sich jemand um das Ei kümmern, sobald es gefunden wurde.
»Ich habe dich die letzten Wochen kaum gesehen«, wechselte Moné das Thema. »Jetzt, da deine Ausbildung zu Ende ist, hatte ich gehofft, du würdest wieder mehr Zeit mit mir verbringen.«
Wachsam musterte sie seine Reaktion. Misstrauen und Skepsis sprachen aus ihren Augen. Als Tristan nicht antwortete und sein Blick nachdenklich wurde, seufzte sie.
»Ich vermisse dich«, sagte sie mit leiser Stimme und näherte sich ihm einen Schritt.
Tristan wusste, dass es sie viel Überwindung kostete, sich ihm gegenüber so verletzlich zu zeigen. Seit klar war, dass ihre Familien eine Verbindung zwischen ihnen beiden wünschten, hatte sie immer wieder mit Eifersucht zu kämpfen. Sie waren noch nicht einmal verheiratet, und Moné – und der ganze Hof – wusste, dass Tristan ihr nicht treu war. Es war nicht fair, aber während seiner Zeit außerhalb des Schlosses hatte er versucht, zu verdrängen, welche Pflichten ihn zu Hause erwarteten.
Es ärgerte ihn, sein ganzes Leben schon von anderen durchgeplant zu wissen. Seine Familie bestimmte über seine Zukunft und Moné erinnerte ihn mit jedem Wort daran. Daher vergnügte er sich gerne mit anderen Frauen, flirtete und lebte sein Junggesellenleben – solange er noch konnte. Sein Freiheitsdrang war einfach größer als das schlechte Gewissen.
Hätte Moné sich ebenso verhalten, wäre ihr Ruf unweigerlich dahin gewesen. Aber das Schlimmste war, dass sie es gar nicht gewollt hätte. Tristan wusste wie der ganze Hofstaat, dass sie in ihn verliebt war und alles dafür geben würde, dass er ihre Gefühle endlich erwiderte.
Er wusste, dass er sie verletzte. Tag für Tag.
Die Hochzeit würde geschehen, egal wie er dazu stand. Das war ihm durchaus bewusst. König Scąr wollte die Verbindung zwischen den zwei Familien, denn er liebte seine Mätresse mehr als seine Frau und wollte sein Goldstück Moné in einer hochangesehenen Bändiger-Familie wissen. Zwar war Tristan selbst kein Bändiger, aber seine Mutter und die kleinen Schwestern, weshalb die Familie als Feuerbändiger am Hof einen hohen Status innehatte. Und einem König verwehrte man solch einen Wunsch bekanntlich nicht.
»Lass uns heute ausgehen«, schlug Tristan halbherzig vor. »Oder ein Essen mit den Familien, ganz wie du möchtest.«
Ein Lächeln erschien auf ihrem schönen Gesicht. Kokett strich sie sich eine lange, schwarze Haarsträhne hinters Ohr.
»Ich hätte da schon eine Idee, wie wir die Nacht verbringen könnten«, flüsterte sie ihm mit einem verführerischen Augenaufschlag zu und schmiegte sich an ihn.
Ihr Atem kitzelte seine Wange. Beinahe wäre er der Versuchung und der Verlockung in ihrer Stimme erlegen, doch dann schüttelte er den Kopf.
»Du weißt, dass das keine gute Idee ist.«
Sein Blick schweifte zu Prinzessin Izabel, welche noch immer in der Sonne saß. Für einen Moment dachte er, sie hätte ihn beobachtet, aber da hatte sie schon wieder den Kopf abgewandt und Tristan drehte sich seufzend Moné zu.
»Warum nicht?« Ihre Augen funkelten verärgert. »Wir sind einander versprochen. Wir …«
»Tristan! Da bist du ja endlich. Ich habe dich überall gesucht«, unterbrach sie eine Stimme.
Schwer atmend kam General Loyd auf die zwei zugeeilt. Tränen glitzerten in Monés dunklen Augen, doch schnell verbarg sie ihre Enttäuschung hinter einer wohlgeübten Maske.
»Da bin ich«, antwortete ihm Tristan, wobei er seinen Unwillen nicht ganz verbergen konnte.
Eigentlich sehnte er sich nach Ruhe, aber Loyd gab ihm immerhin die Möglichkeit, Moné zu entgehen. Außerdem hatte er nur auf Nachrichten des Generals gewartet.
»Was gibt es?«, fragte er, während Moné betrübt die Arme vor der Brust verschränkte.
»Es geht um das Drachenei. Kann ich dich kurz unter vier Augen sprechen? Es ist wichtig.«
DIE FLUCHT
Zara
Schwer landete ich im getrockneten Heu des Viehwagens unter dem Dach und holte einen Moment lang Luft. Schnell richtete ich mich auf und kletterte von dem Karren. Immer noch zitternd klopfte ich mir das Heu von der Kleidung und lauschte in die Gasse. Es war erstaunlich ruhig …
»Was machst du da?«, ließ mich eine Stimme zusammenfahren. Wild rauschte das Blut durch meine Adern. Vor mir stand ein junger Knecht, der sich den Schweiß von der Stirn wischte und meinen Sprung offenbar gesehen hatte.
»Hab mich wohl zu weit aus dem Fenster gelehnt«, gab ich möglichst unbeschwert von mir, drehte mich um und stolzierte davon.
»Aber was …?«, rief der blonde Hüne noch vollkommen verwirrt aus, doch er folgte mir nicht.
Mit federnden Schritten lief ich Richtung Hafen. Das Adrenalin in meinem Körper hatte Hunger und Durst vorübergehend verdrängt und ich fühlte mich seltsam beflügelt. Endlich war ich frei. Frei und glücklich. Nach einem Leben in Gefangenschaft ging es letztendlich bergauf. Im Norden würde ich mir eine Zukunft aufbauen. Weit fort von der tyrannischen Herrschaft der kopanischen Königsfamilie, weg von den Plantagen. Ich war nicht länger eine Sklavin – ich war frei.
Das Hafengebiet war deutlich ruhiger als das Zentrum Kopas. Der Fischmarkt war zu Mittag wie ausgestorben, folglich begegnete ich auf meinem Weg nur einer Handvoll Menschen. Die Fähre, welche am Dreiländereck vorbei nach Tasmanien fuhr, würde gegen Nachmittag vom Hafen auslaufen. Der hohe Stand der Sonne trieb mich zur Eile und ich lief, so schnell mich meine Füße trugen.
Abgesehen von der Fähre nach Tasmanien lagen lediglich ein paar Fischerboote im Hafen der Hauptstadt vor Anker. Die Handelsbeziehungen zwischen den drei Reichen waren aufgrund all der Konflikte seit Langem wie eingefroren und die Einreisebestimmungen immer strenger geworden, weswegen der Export sich kaum auszahlte und die Schifffahrtsunternehmen eingingen. Ich konnte mich glücklich schätzen, das heutige Schiff noch zu erreichen. Andernfalls könnte es Wochen dauern, bis eine andere Fähre den Weg in den Norden antrat, und diese Zeit hatte ich nicht. In einer Woche konnte viel passieren. Angefangen bei einem schnellen Hungertod oder dem Arrest wegen Diebstahls.
Als ich das Dock erreichte, ragten die Masten des Schiffes bereits hoch in meinem Sichtfeld auf. Einige Passagiere waren schon an Bord, es wurden lediglich noch die Waren für den Transport im Frachtraum verstaut.
»Halt!«, schrie ich und legte einen Zahn zu. Als ich vor einem mies gelaunten Kartenverkäufer schlitternd zum Stehen kam, war ich vollkommen außer Puste. »Ich muss mit. Ich muss auf dieses Schiff«, keuchte ich und stemmte die Hände in die Hüften. Beißendes Seitenstechen nahm mir die Luft zum Atmen, mein Herz raste.
Widerwillig sah der miesepetrige Junge von seiner Zeitung auf. »Geht nicht«, antwortete er und rümpfte missmutig die Nase. »Du bist zu spät.«
»Ich sehe doch, dass noch Karten da sind«, entgegnete ich aufgebracht und warf einen anklagenden Blick auf den Ticketstapel vor ihm.
»Geht nicht«, wiederholte er und kratzte sich die pickelige Stirn.
»Geht doch!« Wut prickelte in meinem Inneren. »Ich muss auf dieses Schiff. Wirklich.« Eindringlich sah ich ihn an, aber das beeindruckte den Jungen herzlich wenig.
»Ich mache gleich Feierabend, glaubst du, das interessiert mich?« Gelangweilt wandte er sich wieder seiner Zeitung zu.
»Bitte, ich flehe dich an! Ich muss auf dieses Schiff.« Verzweifelt warf ich jeglichen Stolz über Bord und versuchte es mit der Mitleidsmasche. Mit großen Augen sah ich zu ihm auf.
»Du nervst«, erwiderte der Junge, legte jedoch raschelnd die Zeitung zur Seite. »Nur Hinfahrt oder auch zurück?«
Erleichterung durchströmte mich. Beinahe wären mir die Tränen gekommen. Hoffentlich hatte der Trunkenbold, der meine Tasche gestohlen hatte, nicht das ganze Geld ausgegeben. Erstmals, seit ich sie wiederbekommen hatte, griff ich in die Tasche, um eine Handvoll Silberdiore herauszufischen.
»Nur Hinfahrt«, antwortete ich schnell. Auf eine emotionale Dankesrede hatte er vermutlich ohnehin keine Lust.
»Das Schiff läuft gleich aus, also beeile dich«, brummte er und reichte mir die Fahrkarte zur Freiheit.
Kalte Luft fuhr durch meine Haare und fröstelnd schlang ich die Arme um meinen Oberkörper. Ich trug nichts Wärmeres bei mir als den blauen Schal, den meine Mutter mir vor Jahren geschenkt hatte.
Auf den Plantagen war es das ganze Jahr über warm, kein Herr würde seinen Sklaven einen Wintermantel kaufen. Hier am Meer hingegen wehte eine frische Brise, die das Gefühl von Freiheit nur noch untermalte.
Ich musste mir schleunigst wärmere Kleidung zulegen, wenn ich den Norden erreichte. Das würde teuer werden. Nachdem der Dieb meiner Tasche bereits einiges an Geld vergeudet hatte, konnte ich mich glücklich schätzen, sollte ich die nächsten Wochen über die Runden kommen.
»Wir brauchen einen Pfleger hier drüben. Einer der Dragis macht Probleme. Warum haben diese hochgezüchteten Viecher auch alle Platzangst?«, rief einer der Tierwärter fluchend zu seinem Freund.
Dem Gebrüll nach zu urteilen, war einer der Hausdrachen eines reichen Passagiers unruhig. Eigentlich waren die Tiere mehr Schoßhündchen als Drachen und wenn man bedachte, dass sie nur hochgezüchtete Mischungen aus Squa und Amphib waren, weit weniger gefährlich, als auf den ersten Blick zu vermuten. Mit kaum einem Prozent Drachenblut waren sie nichts Besonderes, aber anstrengend und biestig.
Ich hatte auf den Plantagen zur Genüge mit übellaunigen Ghulen zu kämpfen gehabt, daher konnte ich die Frustration des Wärters gut verstehen, der nun verzweifelt versuchte, das hübsche Tier zu beruhigen. Die braune Farbe seiner Schuppen zeichnete ihn als Erddragi aus. Diese Art lebte vor allem in Dehnarien, dem Land der Erd- und Feuerbändiger, und hatte somit kaum gefährliche Eigenschaften. Die meisten Exemplare waren von ruhigem Gemüt – zumindest, wenn sie nicht gerade Platzangst hatten.
Ich kicherte vergnügt und trat wieder an die Reling. Hier auf dem Schiff ergriff mich eine wunderbare Leichtigkeit.
Nach einiger Zeit nahm meine Aufregung überhand. Die Überfahrt würde nicht lange dauern, in wenigen Stunden würden wir die tasmanische Küste erreichen. Es war das erste Mal, dass ich den Ozean überquerte und Kopanien verließ. Nervös lief ich die Reling auf und ab.
Sobald Land in Sicht kam, füllte sich das Deck mit neugierigen Passagieren, die die Aussicht genossen. Diese Gegend war für ihre Wasserfälle bekannt und diese nun in Wirklichkeit zu sehen, überwältigte mich vollkommen. Ich war absolut hingerissen von der atemberaubenden Landschaft. Irgendwann wurde es mir jedoch zu voll und ich zog mich unter Deck zurück.
Gemächlich schlenderte ich durch den beinahe menschenleeren Frachtraum voller Wagen, Drachen, Pferden und Squas. Am liebsten beobachtete ich die ruhigen Squas, eine beeindruckende Mischung aus Drache und Pferd.
Sobald ich mich sicher und allein fühlte, kauerte ich mich in einer Ecke auf den Boden und öffnete die Tasche. In der Öffentlichkeit hatte ich mich nicht getraut, nachzuzählen, wie viel Geld der Dieb bereits ausgegeben hatte – doch ich konnte nicht mehr länger warten. Meine Finger zitterten, als ich die Knöpfe öffnete. So viel hing davon ab, wie viele Gold- und Silberdiore ich für den Start in mein neues Leben zur Verfügung hatte. Ich versicherte mich noch mal, allein zu sein, dann zog ich die Tasche auf und blickte hinein.
Ich zählte jeden Dior und stellte überrascht fest, dass es mehr waren als angenommen. Mehr als zuvor. Mehr als zu dem Zeitpunkt, als ich die Tasche überreicht bekommen hatte. Verwirrt runzelte ich die Stirn.
Wie war das möglich? Der Dieb hatte das Geld verprasst, ich hatte es mit eigenen Augen gesehen. Woher kamen nun die vielen Münzen? Und wo waren die Papiere? Die Papiere, die meine Freiheit bezeugten? Ohne sie hatte ich keinerlei Beweise, dass ich tatsächlich freigegeben wurde!
Hektisch grub ich tiefer. Am Grund der Tasche ertastete ich etwas Schwereres. Verwirrt legte ich die Hand um den runden Gegenstand, bei dem es sich offenbar nicht um die ersehnte Rorange handelte, und zog ihn heraus. Es fühlte sich hart wie ein Stein an, allerdings zu rau, um einer zu sein. Ich neigte den Kopf zur Seite und betrachtete das Ei-förmige Etwas, das Herr Salamon mir ganz bestimmt nicht gegeben hatte.
Irritiert warf ich erneut einen Blick in die nun leere Tasche. Wo waren meine Papiere und warum trug der Taschendieb ein Ei bei sich? Meine Biologiekenntnisse hielten sich in kläglichen Grenzen. Es war zumindest zu groß für ein Hühnerei. Die kalte Schale fühlte sich sonderbar an, überraschend rau und robust, als könnte man sie nicht so leicht zerstören.
Als ich einen näheren Blick auf das Ei warf, erkannte ich, dass es viel zu schön war, um von einem einfachen Nutztier zu stammen. Die Schale schillerte in einem wunderschönen Blauton und kunstvolle Einkerbungen verfingen sich zu einem beeindruckenden Muster. Es hatte Andeutungen von Schuppen, jedoch keine scharfkantigen wie die Squas. Sofort schloss ich auch die Möglichkeit aus, es könnte sich um das Ei eines Dragis handeln, denn deren Eierschalen waren so braun wie die Schuppen ihrer Haut.
Plötzlich vernahm ich Schritte und Stimmengewirr. Hektisch packte ich das Geld und das Ei zurück in die Tasche und hechtete die Mauer entlang, bis ich eine Tür erreichte. Im letzten Moment zog ich sie auf und schlüpfte hindurch. Leise fiel sie hinter mir ins Schloss. Mein Atem rasselte, als ich mich mit dem Rücken gegen die Wand presste, als könnte ich so mit ihr verschmelzen und unsichtbar werden.
»Wir sollen ein ganzes Schiff abriegeln? Wie soll das gehen?«, hörte ich eine unwirsche Stimme.
Ich befand mich in einem kleinen, metallenen Treppenhaus, welches wohl nur für die Besatzung gedacht war. Die Stufen knarrten beachtlich unter dem Gewicht der hinaufgehenden Männer.
»Wir sind auf dem offenen Meer. Ist ja nicht so, als könnte sie einfach abhauen«, antwortete sein Begleiter.
»Aber nicht mehr lang. Wir erreichen jeden Moment den Hafen … Und da sollen wir die Passagiere nicht von Bord lassen, nur weil diese dummen Dehnaren nicht auf ihre Sachen aufpassen können?«
Ein ungutes Gefühl beschlich mich und spätestens mit dem nächsten Satz verwandelte sich die anfängliche Unruhe in ausgewachsene Panik.
»Gut, dass uns die Boten-Elfe vor unserer Ankunft in Tasmanien erreicht hat«, sagte der eine und mir wurde ganz kalt ums Herz.
»Dennoch knapp. Ewig können wir die Passagiere nicht hinhalten, sollte sie sich verstecken.«
»Ein Grund, uns zu beeilen. Wer ist so dumm, ein so kostbares Drachenei zu stehlen? Kein Mensch wird ihr das abkaufen, solange das ganze Land nach ihr und dem verdammten Ei sucht …«
Heiß lief mir die Erkenntnis den Rücken hinab. Nun, da die Männer es ausgesprochen hatten, war mir sonnenklar, worum es sich bei dem Gegenstand in meiner Tasche handelte: ein Drachenei.
Die Tasche, die ich trug, war nicht meine. Ich hatte sie gestohlen und das Drachenei gleich mit. Eilig griff ich nach dem Türgriff und drückte ihn hinunter. Aber die Tür ging nicht auf. »Nein, nein, nein.«
Panisch rüttelte ich an der Tür, doch anstatt nachzugeben, brach der Griff einfach ab. Mein Herz raste.
»Verdammt«, fluchte ich. Ein kurzer Blick den Schacht hinunter genügte, um zu sehen, dass die zwei Wärter nur noch wenige Stockwerke unter mir waren und immer näher kamen. Hektisch stopfte ich den Griff in meine Tasche, dann nahm ich die Beine in die Hand und sprintete die Treppen weiter nach oben.
Tristan
»Ich wollte nicht stören, aber es ist wirklich wichtig«, begann Loyd.
Tristan winkte ab. Eigentlich war er sogar froh, Monés Verhör entgangen zu sein. Es war nicht so, dass er ihre Gesellschaft nicht mochte, doch in seinem Inneren sträubte sich etwas gegen die bald anstehende Vermählung.
Er war bereits zwanzig Jahre alt und konnte die Hochzeit mit dem Ende seiner Ausbildung nicht länger aufschieben. Moné war zwei Jahre jünger als er und der ganze Hof tratschte über die ungewöhnlich lange Verlobungszeit. Die meisten Töchter reicher Männer wurden bereits mit fünfzehn, spätestens siebzehn verheiratet. Dementsprechend hob sich Moné stark hervor, noch dazu als Tochter des Königs und seiner Mätresse.
Tristan wusste, dass es sie schmerzte, so im Mittelpunkt des Tratsches zu stehen. Sie konnte nichts dafür, als uneheliches Kind geboren zu sein. Vermutlich hatte sie immer darauf gehofft, eine gute Heirat würde sie in den Augen der anderen gleichwertig machen. Doch das Gegenteil war der Fall und einzig Tristan war daran schuld. Warum missfiel ihm die Hochzeit nur so sehr?
»Keine Sorge, du bist genau zur rechten Zeit gekommen«, sagte er an Loyd gewandt und beobachtete, wie Moné hinter der nächsten Ecke verschwand. »Was hast du mir zu sagen?«
»Hast du Pläne für heute Abend?« Für einen Moment sah Loyd Tristan vielsagend an, setzte allerdings nach: »Dann blas sie ab. Wir haben einen Tipp, wo das Drachenei sein soll, und brechen sofort auf.«
Tristan zog überrascht Luft ein. »Also ist es wirklich gestohlen worden?«
»Natürlich. Dracheneier lösen sich nicht einfach in Luft auf«, erwiderte General Loyd forsch.
»Wer hat es gestohlen? Kennen wir den Dieb? Ist es ein gesuchter Radikaler?«