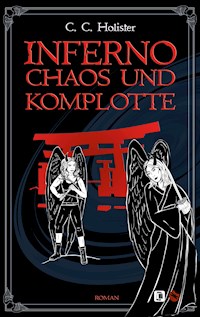8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Periplaneta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Edition Drachenfliege
- Sprache: Deutsch
Nachdem Cay und ihre Freundin Mia sich aus Versehen in die Luft gejagt haben, landet Cay in der Hölle. Statt sie aber in die ewige Verdammnis zu schicken, macht der Herr der Finsternis Cay das Angebot, sie in eine Dämonin zu verwandeln. Verlockend – zumal der CEO der Hölle verdammt gut aussieht. Kaum hat sich Cay ihrem neuen Dasein und ihrem neuen Boss angenähert, verschwindet der auf einer ominösen Party. Plötzlich steht Mia wieder auf der Matte und jetzt will auch noch der Oberste Seelenzuteiler die Herrschaft an sich reißen. Kann man denn nicht mal nach dem Tod seine Ruhe haben? Die Dämoninnen Mia und Cay haben durch C. C. Holisters Demon’s Diaries schon viele Fans und Sympathisanten im Dieseits gewinnen können. Dies ist nun endlich die heiß ersehnte Vorgeschichte in Romanlänge und damit der perfekte Einstieg in Holisters Unterwelt-Universum.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
periplaneta
C. C. HOLISTER: „Inferno für Anfänger“ 1. Auflage, März 2019, Periplaneta Berlin, Edition Drachenfliege
© 2019 Periplaneta - Verlag und Mediengruppe Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin www.periplaneta.com
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig.
Lektorat & Projektassistenz: Hilke Grabenkamp Erstlektorat: Anja Koda Cover & Illustrationen: NOH Hamburg (https://n-o-h.net/) Satz, Layout Projektleitung: Thomas Manegold
print ISBN: 978-3-95996-128-8 epub ISBN: 978-3-95996-129-5
C. C. Holister
INFERNO
für Anfänger
periplaneta
Ich bin der Weg in’s wehevolle Tal,
Ich bin der Weg zu den verstoßnen Seelen,
Ich bin der Weg zur Stadt der ew’gen Qual.
Mich schuf mein Meister aus gerechtem Triebe:
Ich bin das Werk der göttlichen Gewalt,
Der höchsten Weisheit und der ersten Liebe.
Dante, Göttliche Komödie, Hölle, dritter Gesang, Vers 1-6
Prolog
Eine Druckwelle, die mich fortreißt und meinen Kopf mit Schwung gegen einen schweren Gegenstand schleudert, ist das Letzte, das ich spüre. Mein Blick erfasst noch einmal die Flammen, die im Bruchteil einer Sekunde wie aus dem Nichts entstanden sind. Dann verschwimmen sie vor meinen Augen. Die Schreie verstummen. Alles wird schwarz und ruhig.
Mit unbeschreiblicher Leichtigkeit gleite ich davon, fühle mich, als wäre ich nie hier gewesen. Ziehe mich zurück in mich selbst. Spule längst vergessene Erinnerungen ab: mein erster Urlaub, Szenen meiner Schulzeit, Erlebnisse mit Freunden, insbesondere …
… diese Zwanzigster-Geburtstags-Feier bei dem Kumpel eines Bekannten nur ein paar Monate zuvor. Ich kannte fast niemanden und die Musik war ziemlich mies. Dafür gab es Bier und billigen Wodka in rauen Mengen. Ich sehe es förmlich vor mir, wie ich an jenem Abend nach einem zweifelhaften Sortiment fuselig-süßer Mixgetränke relative Nüchternheit und Selbstbeherrschung in einer Sofaecke vortäuschte. Ich versuchte gerade gezielt, die sich ankündigenden Kopfschmerzen mit einem dilettantisch gemixten Cosmopolitan zu übertünchen, als meine Freundin Ankie sich neben mir in einen Sessel fallen ließ.
Sie wirkte aufgelöst. Geradezu panisch.
Mit einem zwischen Paranoia und Verzweiflung schwankenden Gesichtsausdruck lehnte sie sich zu mir herüber. »Cay … ich muss dir was sagen.«
»Was ist los, Ankie? Ist der Wodka alle?«
»Nein, es ist … wir werden alle in der Hölle landen!«
Die Erinnerung an die Skurrilität von Ankies Auftritt lässt mich innerlich schmunzeln. Damals fand ich ihn allerdings alles andere als witzig. Ansagen mit erhobenem Zeigefinger schätzte ich in diesen alkoholgetränkten Momenten gar nicht. Noch dazu verknüpft mit einer abstrusen Religionsschiene, die eigentlich nicht zu meiner Freundin passte. Das Klügste wäre vermutlich gewesen, einfach nicht auf den absurden Einwurf einzugehen. Doch ich tat es trotzdem. »Wie kommst du denn auf den Quatsch? Nur weil wir feiern?«
»Die … die Sauferei, die Drogen, der ganze Exzess und so …« Mit bedeutungsvollem und zugleich mahnendem Blick beugte sie sich ein weiteres Stück zu mir nach vorne. »Cay, ich sag das nur ungern, aber diese Party ist verflucht!«
»Verflucht? Drehst du jetzt völlig ab?«
»Ich hab es im Spiegel gesehen.«
Bei aller üblichen Verrücktheit – diese Art von seltsamen Anwandlungen war neu bei Ankie. Ich fragte mich, ob sie nur betrunken war oder womöglich irgendwas Komisches genommen hatte.
»Was hast du in welchem Spiegel gesehen?«
»Hinter dir«, flüsterte sie. Ich drehte mich um. In der Tat lehnte dort ein hoher, schmaler Spiegel an der Wand. In ihm zeichnete sich das uns umgebende Partychaos ab: tanzende, saufende, kiffende, exzessiv feiernde Menschen.
»Da war eben noch eine Gestalt«, fuhr sie fort. »Eine dunkle Gestalt mit Flügeln … und mit Hörnern.«
»Ernsthaft, Ankie?« Ich sah sie mitleidig an. »Hast du diese abgedrehten Tabletten von Pete eingeschmissen?«
»Das sind nicht die Pillen! Er war wirklich da. Und er hat uns beobachtet.«
»›Er‹? Der Teufel etwa?«
Sie warf erneut einen angsterfüllten Blick zum Spiegel und anschließend in meine Richtung. »Er war da! Ich schwöre es.«
»Sah er wenigstens heiß aus?« Ich konnte sie in diesem Zustand einfach nicht ernst nehmen.
»Du ziehst das ins Lächerliche, aber wenn wir erst in der Hölle …«
»Woher willst du überhaupt wissen, dass es eine Hölle gibt?«, unterbrach ich ihre Paranoia-Attacke.
»Warum sollte es sie nicht geben? Das da im Spiegel spricht immerhin dafür!«
Ein weiterer Blicktest folgte. Die Bestätigung von Ankies Vision blieb jedoch auch dieses Mal aus.
»Du hast halluziniert, verdammt! Das kann bei dem dubiosen Zeug von Pete schon mal vorkommen.«
»Aber …«
»Ehrlich, Ankie, es gibt keine Hölle. Das ist nur ein pädagogischer Kniff, eine Vereinfachung, um alles in eine aufgesetzte Gut-Böse-Moral pressen zu können.«
»Wer sagt denn, dass es kein Gut und Böse gibt? Schau dich doch mal um in der Welt!« Sie breitete die Arme aus, als würde sie gerade ein Schlussplädoyer vor dem Obersten Gerichtshof halten.
Nun gut, dieser Ort war sicher nicht das Musterbeispiel auserlesener Tugendhaftigkeit. Allein Pete mit seinem fragwürdigen illegalen Stoff … und das Mädel, das eben volltrunken mit dem Typ im Badezimmer verschwunden war, war höchstens sechzehn. Dennoch. Für mich sah das alles ziemlich nach Grauzone aus.
»Das ist so furchtbar eindimensional!«, hielt ich ihrem dramatischen Statement entgegen. »Glaubst du wirklich, es gibt da diese dunkle lavadurchströmte Höhle auf der einen Seite und auf der anderen … Blumenwiesen und Schmetterlinge? Und meinst du, in dieser Höhle taucht dann der Teufel auf und sagt: ›Also, mit der Feierei hast du es ja ganz schön übertrieben und überhaupt das maßlose Gesaufe … Hier ist dein Pfuhl der ewigen Qualen.‹«
»Als wenn du die Wahrheit kennen würdest!«
Mittlerweile war das Gespräch auf einem rasanten Abwärtskurs angelangt, auf dem ich unnützerweise nochmals Gas gab. »Ich sag dir, was wahrscheinlich ist«, brauste ich auf. »Du stirbst und bist tot. Aus. Ende. Kein Himmel, keine Hölle. Was dich aber nicht weiter interessieren dürfte, weil du ja tot bist!«
Ich sah Ankie schweigend nach, wie sie beleidigt in die Küche wankte. Vermutlich, um sich etwas stark Alkoholisches zu trinken zu holen. Noch einmal drehte ich mich zum Spiegel um, auf dem zwischenzeitlich irgendein Nerd die kryptischen Worte ›FATUM TE DUCIT1‹ mit Edding geschmiert hatte. Latein, schätzte ich. Was auch immer das zu bedeuten hatte …
In meinem Kopf machte sich indes ein Dröhnen breit, das Ankies Höllen-Aussage zumindest auf kurze Sicht bestätigen wollte.
Seltsam. Wieso kommt mir das gerade jetzt in den Sinn?
1 Das Schicksal führt dich.
I
Verdammt, dieses Dröhnen! Von irgendwo aus der Ferne kommend bohrt es sich in meinen Schädel und verdrängt die Szene aus Erinnerung und Traum aus meinem Bewusstsein. Die Leichtigkeit ist verschwunden. Stattdessen stechender Kopfschmerz … und dumpfe Taubheit.
Benommen öffne ich die Augen. Der grelle Schein einer Neonröhre blendet mich und ich schließe sie sofort wieder. Lausche erneut dem undefinierbaren Gebrumme. Es scheint lauter zu werden, aber ich kann nicht ausmachen, aus welcher Richtung es kommt, geschweige denn, was es sein könnte.
Blinzelnd erkunde ich die Umgebung: ein gefliestes Gewölbe mit grellgrünen Plastikbänken. Vier Stück, plus einer Fünften, von der ich schwerfällig meinen verkaterten Körper aus seiner zusammengekauerten Pose aufrichte. Von einem Großbrand oder sonstigen Verheerungen keine Spur. Dafür Schienen, die ich hinter einer abfallenden Kante erkenne.
Nach und nach rappele ich mich weiter auf, mache ein paar Schritte auf die Kante zu und werfe einen verunsicherten Blick in den Tunnel dahinter. Eine U-Bahn? Ich runzele die Stirn. Die nächste größere Stadt, die eine solche besitzt, ist über fünfzig Kilometer entfernt. Wie lange muss ich bewusstlos gewesen sein? Und dann die Flammen? Ein Krankenzimmer würde mir jedenfalls logischer erscheinen als dieser Ort.
Noch während ich in die Finsternis des Tunnels starre, wandelt sich das ferne Dröhnen in ein sich zügig näherndes Rattern. Ehe ich mich versehe, flackern Lichter auf. Ein Zug rast aus der Dunkelheit auf den Bahnsteig zu, rauscht jedoch ohne zu halten an diesem vorbei. Wie ein Phantom taucht er wieder in die gegenüberliegende Schwärze ein.
»Was zur …«
Ich schreite auf das Ende des Gewölbes zu, an dem der letzte Waggon soeben verschwunden ist. Aufmerksam scanne ich die Wände nach Anzeigetafeln oder Schildern, die mir einen Hinweis darüber liefern könnten, wo ich hier gelandet bin.
Was um alles in der Welt tue ich hier? Ich war doch eben noch … ja, wo eigentlich? In Gedanken gehe ich diverse Orte durch, die das Potenzial für eine bedrohlich-chaotische Situation enthalten und die überdies eine Begründung für meinen kolossalen Kater bieten würden.
Ad hoc kommt mir unsere alte Stammkneipe in den Sinn. Die eine oder andere Gedächtnislücke würde sich damit schon erklären lassen. Bin ich nicht vor allzu langer Zeit erst dort gewesen? Doch!
Ich trat durch die schäbige Eingangstür mit den bierbefleckten Stufen, die mich in die vertraute Kelleratmosphäre führten. Eine willkommene Zuflucht für Tageslichtverweigerer, die, genau wie ich, die Mischung aus irischer Gastlichkeit, rustikaler Einrichtung und billigen Drinks zu schätzen wussten.
Ich besorgte mir einen Cider an der Bar und schob mich an einigen Tischen mit bekannten Gesichtern vorbei – Protagonisten eines vergangenen Lebensabschnitts. Zu jenen zählten Esoterik-Freak Tara, die an ihrer Kräuterbrause nuckelte, ein paar Jungs aus der Schulband, mit denen ich früher gerne abgehangen hatte, Mode- und Frisurenpüppchen ›Barbie‹, die ihren Schulabschluss weniger ihrer Intelligenz als ihrer sexuellen Aufgeschlossenheit verdankte, und Pete, der Schuldealer. Überrascht war ich lediglich, unsere ehemalige Chemielehrerin Frau Dr. Schmidt auf einem der Barhocker zu sehen, vertieft in ein sicherlich hochphilosophisches Gespräch mit Mike, dem Barkeeper, und einem Kerl in Motorradkluft.
Meine Freundschaft mit Mia gehörte zu den Beziehungen, die jene verquere Phase unserer Schulzeit trotzig überdauert hatten, und wie damals saß sie zusammen mit Ankie in unserer bevorzugten Nische gegenüber der Theke. Mia wirkte niedergeschlagen; entsprechend hatte Ankie ihr solidarisch eine Hand auf die Schulter gelegt, obgleich sie in diesem Augenblick eher auf die Anbahnungskonversation zwischen Barbie und Pete am Nachbartisch konzentriert war.
»Cay, was machst du denn schon hier?«, begrüßte sie mich aufgedreht. »Hattest du nicht ’ne Verabredung?«
»Ja, richtig.« Mia kam ein Stück aus ihrer leidenden Pose und blickte mich interessiert an. »Sven oder so, nicht wahr?«
»Tom.«
»War nicht so berühmt?« Sie grinste, wie nur jemand grinsen konnte, der mich einfach zu gut kannte.
Müde lächelte ich zurück. »Sagen wir, er war stets bemüht, den ihm gestellten Aufgaben Verständnis entgegenzubringen.«
»Und dann hast du dir überlegt, das Jimmy’s könnte dafür Alternativkandidaten bieten?«
»Ich wollte nur Toms Probezeit nicht unnötig verlängern.« Unvermittelt fielen meine Augen auf den Motorradtypen an der Bar, nur damit ich sie gleich darauf abwehrend zusammenkniff. Nein – keine Experimente mehr! Zumindest nicht heute. Ich schüttelte den Kopf wie zur Bekräftigung meines spontanen Entschlusses und ließ mich neben die beiden auf die Bank fallen. Ich nahm einen tiefen Zug aus meinem Glas mit dem Vorsatz, den Erinnerungen an das misslungene Date noch mit vielen weiteren Gläsern entgegenzuwirken.
»Komisch, du hast immer so’n Pech mit den Typen«, stellte Ankie mit künstlichem Bedauern fest und animierte mich so direkt zu Schluck Nummer zwei.
Sie hatte recht. Die durchschnittliche Haltbarkeit meiner Exfreunde betrug gerade mal vier Wochen. Komplettdebakel wie Tom nicht mitgerechnet.
»Vielleicht sind meine Ansprüche zu hoch …«, hob ich an, doch ein schriller Klingelton aus Barbies Jacke übertönte den Erklärungsansatz für meine gescheiterten Beziehungsversuche.
Wo ist eigentlich mein Handy?
Gegebenenfalls gibt mir das GPS eine nähere Auskunft, wo ich hier gelandet bin. Gründlich prüfe ich sämtliche Taschen, aber es ist nicht da. Überhaupt sind jene weitgehend leer, bis auf zwei angelaufene Münzen, die ich in meiner Jeans finde.
Ein Gedanke durchstreift beiläufig und doch unheilvoll meinen schmerzenden Kopf: Womöglich wurde es aus dem Bus geschleudert?
Ein Bus? Bin ich damit hergekommen? Gar geflohen? Oder ist das Inferno, das so schemenhaft in meinem Kopf herumgeistert, etwa das Ergebnis eines missglückten Drogentrips gewesen?
Meine pochenden Schläfen massierend hocke ich mich erneut auf eine der Bänke und ein mögliches Szenario aus Horrortrip, falschem Nachtbus und plötzlichem Koma kommt mir in den Sinn. Unwahrscheinlich ist es nicht. Halb schließe ich die Augen und verfolge das gleichmäßige Pochen in meinem Schädel, gepaart mit jenen wirren Gedankengängen.
Beides wird nach einer Weile von einem herannahenden Trippeln überlagert. Hinter einer dunklen Nische hallt es hervor und offenbart sich als zu einer gehetzt aussehenden älteren Dame gehörend. Unversehens taucht sie zwischen zwei Sitzreihen auf, ganz so, als sei sie gerade aus der Wand hervorgeschritten. In unentschlossener Manier läuft sie das, was ich soeben als Bahnsteig identifiziert habe, auf und ab.
»Ist die Bahn schon weg?«, krächzt sie mir entgegen.
»Ja! Äh, das heißt …« Ich bemühe mich, nachdenklich zu schauen und abermals eine Anzeigetafel oder Ähnliches zu entdecken, was mir mittlerweile ziemlich idiotisch vorkommt.
Die Dame stört meine Unkenntnis offenbar wenig. Trotz des Überangebots an Platzalternativen lässt sie sich auf dem Sitz direkt neben mir nieder. Selbst für eine alte Frau wirkt sie ungewöhnlich fahl. Ihre Haut ist farblos, nahezu transparent. Mit glaskugelhaften und durch dicke Brillengläser bizarr vergrößerten Augen mustert sie mich ausgiebig. »Na, Kindchen, dann haben wir unsere Bahn wohl verpasst«, wispert sie mir mit dünner Stimme zu. »Aber keine Sorge, die nächste fährt bestimmt bald.«
»Oh, ich hab die Bahn nicht verpasst«, versuche ich höflich zu erwidern. »Ich bin einfach nur so hier.«
»Das glaube ich kaum, Kindchen!«
Ich starre sie ungläubig an, unsicher, was mich mehr irritiert: das aufdringliche Interesse an meinem wie auch immer gearteten Bestimmungsort oder die Unverschämtheit, mich mit knapp einundzwanzig Jahren mit ›Kindchen‹ anzureden.
Trotz meines konsternierten Blicks lehnt sie sich noch ein Stück zu mir herüber. »Ich wette, der nächste Zug ist deiner!« Sie grinst breit und ihr säuerlicher Atem schlägt mir entgegen.
Damit ist meine Toleranzgrenze endgültig überschritten. »Entschuldigen Sie mich bitte!« Überstürzt stehe ich auf, um die unheimliche Unterhaltung abzubrechen.
»Warte besser nicht zu lange!«
Ich ignoriere ihr Gebrabbel und schreite durch den neuentdeckten Durchgang, mit dem festen Vorsatz diesen Ort genau auf dem Weg zu verlassen, auf dem sie gekommen ist.
Ein weiterer Bahnsteig erstreckt sich hier vor mir, exakt wie auf der anderen Seite: gefliestes Gewölbe, grüne Plastikbänke … nur von einem Ausgang keine Spur. Eventuell sollte ich meine merkwürdige Begegnung doch noch mal konsultieren.
»Sorry, können Sie mir vielleicht sagen, wo wir hier …«, hebe ich auf dem Weg zurück zu meinem Ausgangspunkt an, aber die Dame ist weg. Auch ihr Trippeln ist nirgends mehr zu hören. Dafür vernehme ich dumpf das Heulen von Sirenen, vermischt mit dem Gewirr angstverzerrter Stimmen.
Ich drehe mich um, schaue den Bahnsteig hinunter und zucke ob des Anblicks zusammen. Menschliche Körper, teils in grotesken Posen, teils verstümmelt, sind dort verstreut. Zwischen den Bänken liegen Metallteile und Fragmente von Trümmern. Scherben stecken in manchen der leblosen Leiber. Dazwischen Flammen. Bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Gegenstände verschmolzen mit ebenso verkohlten Leichnamen.
»Scheiße, was …?«
Ich kneife die Augen zu, blende das Schlachtfeld vor mir aus. Ein verdammter Flashback? Was zum Teufel habe ich genommen? Es wäre nicht die abgefahrenste Halluzination, die ich je erlebt habe. Unvermittelt muss ich an Pete und seine ›Spezialangebote‹ denken. Hat er mir dieses Teufelszeug angedreht? Eventuell bei meinem Besuch im Jimmy’s? Konzentriert versuche ich, mir die Szene in mein Gehirn zurückzuholen und dabei das Horrorszenario am Bahnsteig bestmöglich zu verdrängen. Wie war das noch?
Barbie hatte inzwischen das eingehende Telefonat entgegengenommen und nervte nun ihren neuen Gesprächspartner mit Details zu ihrem letzten Frisörbesuch. Pete saß ihr nach wie vor gegenüber. Ausnahmsweise mal nicht mit Geschäftlichem befasst, stocherte er mit einem Cocktailrührer in den Resten seines Mojitos herum, sichtlich froh über die unverhoffte Konversationspause.
»Und welches Drama hat dich getroffen?«, wandte ich mich an Mia, um von meinem Missgriff mit Tom abzulenken. »Wieder ein vergeigtes Bewerbungsgespräch?«
Sie schüttelte den Kopf und atmete tief durch. »Diesmal nicht.«
»Doch nicht Stone?!«
Keine direkte Antwort, nur ein vielsagender Blick. Auch ich kannte sie zu gut. Gut genug, um zu wissen, dass sie Stone mitsamt seinem Motorrad, der klischeemäßig passenden Lederjacke, Totenkopftätowierung und seinem breiten Grinsen längst vor die Tür gesetzt hätte, wäre da nicht der gemeinsame Hund Sammy. Und eventuell der Fakt, dass Stone als Türsteher ihres Lieblingsclubs uns so manches Gratiskonzert bescheren konnte.
»Er hat sie für so ’ne Tussi von der Garderobe sitzen lassen«, übernahm Ankie unterdessen die Erläuterung näherer Umstände. »Lief wohl schon länger so. Klamotten gepackt und Tschüss. Und er hat Sammy mitgenommen.«
»Dieses Arschloch!«, zeterte Mia. »Hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Konnte mich nicht mal von Sammy verabschieden!«
»Zeig ihn doch an! Wegen Hundesentführung oder so.«
»Das hatten wir bereits«, ergriff Ankie erneut das Wort, »aber wie es aussieht, dürfte das keine großartigen Konsequenzen haben. Juristisch gesehen gelten Hunde als Sachen …«
»Ja, ja, ist gut. Ich glaub dir auch ohne Referat.« Ich schwieg und leerte mein Glas. »Wie wär’s denn mit Rache?«, steuerte ich schließlich einen konstruktiven Vorschlag zur Trauerbewältigung bei.
Mia zeigte sich direkt begeistert. »Genau, ich zünde sein Scheißmotorrad an!«
»So wie damals den Laptop von deinem Stiefvater?«
»Na ja, diesmal würde der Brandbeschleuniger vor dem Flammenwerfer zur Anwendung kommen – man lernt ja dazu.«
»Und vielleicht würdest du ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen? So wie: geschlossene Räume vermeiden, Schutzbrille, Handschuhe …«
»Ach, Ankie, wo bleibt denn da der Nervenkitzel?«, fiel Mia ihr grinsend ins Wort.
Ich beschloss daraufhin, das leidige Brandstiftungsthema besser zu beenden. »Möglicherweise fällt uns ja was Subtileres ein.«
»Ihr könntet ihm ja welche von euren halluzinogenen Keksen verabreichen«, schlug Ankie vor.
»Und dem Arsch auch noch einen Gratistrip bescheren? Nee!«
Es folgten mehrere alkoholreiche Runden, kombiniert mit dem Austausch über diverse Vergeltungsmaßnahmen aus den Kategorien absurd bis hochgradig strafbar, bis ein lautes Poltern an der Bar ein für Ankies Geschmack viel zu detailreiches Folterszenario unterbrach. Verursacherin des Getöses war ausgerechnet unsere ehemalige Lehrkraft. Erschrocken klammerte sie sich an die Theke, nachdem ihr Hocker rücklings auf das Parkett gekippt war. Als der erste Schock verklungen war, richtete sie sich langsam wieder auf und arrangierte Sitzgelegenheit samt Mantel in ihren Ursprungszustand, bevor sie sich der peinlichen Situation mit einem Gang zur Damentoilette entzog. Der Typ im Lederoutfit war inzwischen um die Ecke abgeschwirrt.
Trotz ihres Rauschzustands schien Mia die Szene genau analysiert zu haben. Kaum war Frau Schmidt im Waschraum verschwunden, stieß sie mich von der Seite an.
»Cay, hols’ du uns noch ’ne Runne?« Sie schenkte mir einen konspirativen Blick. »Und wenn du anner Theke stehst, nimm den Schlüss’l aus ihrer Jacke mit, okay?«
Tatsächlich hing der Schlüsselbund halb aus der Manteltasche.
»Mia, ich kann doch nicht den kompletten Schlüssel …«, tat ich meine aufkeimenden Skrupel kund, doch sie fiel mir ins Wort.
»Nur den von’ner Chemiesammlung. Den rot’n.«
»Ja, und dann?«
»Ach, Cay, mach doch einfach! Details komm’n später.«
Ein durch den fortgeschrittenen Alkoholkonsum gehemmtes Scham- und Risikoempfinden ließ mich schließlich zur Bar hinübergehen. Nervös war ich dennoch. Ich wartete ab, bis Mike mit unseren Getränken beschäftigt war, und griff nach dem klimpernden Bündel. Mein Herz klopfte dabei bis zum Hals und überschlug sich nahezu. Ich war nicht gut in solchen Dingen, schon gar nicht bei angehendem Vollrausch, aber irgendwie klappte es. Noch ehe unsere Drinks auf dem Tresen standen, hatte ich den roten Schlüssel aus dem Verbund herausgefriemelt und abgeklippst.
Das verdiente Triumphgefühl stellte sich allerdings nicht ein, stattdessen die Empfindung, als würden strafende Blicke aus der Tiefe des Raums mich bis zu unserem Tisch zurückverfolgen.
»Da hast du ihn.« Ich reichte Mia ihr Objekt der Begierde. »Hoffe, mein halber Herzinfarkt war’s dir wert.«
Sie grinste breit. »Oh ja, das war’s!«
Was war das?
Es kommt mir fast so vor, als klänge Mias Stimme aus meinen Gedanken nach. Bevor ich mich fragen kann, wo sie jetzt wohl sein könnte, steht sie plötzlich neben mir. »Hey! Hätte nicht erwartet, dass ich dich hier treffen würde. Bin wie blöd dahinten rumgeirrt.«
Ich kann kaum glauben, sie zu sehen. Zugleich weist der Bahnsteig zu meiner großen Erleichterung keine kriegsähnlichen Szenarien mehr auf.
»Bin ich froh …«, platzt es aus mir heraus. »Ich dachte …«
Was genau hatte ich denn gedacht?
»Was sagtest du gerade?«
»Ich sagte: ›Das war’s dann wohl.‹ Die Explosion, du weißt schon.«
»Explosion? Tja …«, murmele ich mehr fragend als wissend. In meinem Kopf materialisiert sich die dumpfe Erinnerung an einen sich rasant ausbreitenden Feuerball. Kreischende Menschen, umherfliegende Glasscherben … und das dumme Gefühl, irgendwas damit zu tun gehabt zu haben.
Sofort bildet sich ein Kloß in meinem Hals, der mir andeutet, dass die verstörende Vision von vorhin der Realität entsprochen haben könnte.
»Oh fuck, Mia, es … Das ist so furchtbar«, brabbele ich, ohne dass mir die näheren Hintergründe dazu präsent sind. »Die Explosion … diese Leute …«
»Cay?« Sie sieht mich mit besorgter Miene an. »Dir ist doch klar, dass wir tot sind, oder?«
Außer einem wirren Blick vermag ich ihr nichts zu entgegnen. Tot? Ich? Die Vorstellung erscheint mir grotesk, geradezu verrückt. Schließlich bin ich doch hier. Kann mich bewegen. Fühle meinen schmerzenden Kopf!
Auf einmal ist das Dröhnen wieder da und wird zunehmend lauter. Aus dem Dunkel des Tunnels blitzen erneut Scheinwerferlichter auf und drei graue Waggons rattern in Richtung Bahnsteig. Diesmal kommen sie quietschend zum Stehen.
»Mia, warum denkst du, dass wir tot sind?« Nach wie vor bin ich wie erstarrt, schwankend zwischen Panik und Hilflosigkeit. Bevor eins von beiden überhandnehmen kann, zieht sie mich am Ärmel.
»Na los, wir steigen da jetzt ein!«
»Ach ja? Meinst du nicht, wir sollten vorher prüfen, wo die Fahrt überhaupt hingeht?«
»Nö, wieso?« Sie schreitet entschlossen auf eine der Türen zu und drückt sie auf. »Soweit ich das sehe, geht’s von den Bahnsteigen hier doch sowieso nicht weiter.«
Also gut.
Im Innern eröffnet sich uns das Bild eines konventionellen U-Bahn-Waggons. Ein grau-beige-melierter Boden und rote Kunstledersitze glänzen uns unter kaltgrünen Halogenstrahlern an. Auf den Bänken sitzen vereinzelt schattenhafte Gestalten wie Statisten in einem Traum. Ich schenke ihnen nur einen flüchtigen Blick und folge Mia in den hinteren Teil des Abteils, wo wir uns in einer der Vierergruppen platzieren.
Während ich noch über ihre Worte von vorhin nachdenke, begutachte ich ihre Erscheinung: löcherige Jeans, Nirvana-T-Shirt, grüne Cordjacke. Sie sieht aus wie immer. Im Gegensatz zu mir scheint sie erstaunlich fit zu sein, und ihre blauen Augen funkeln verschwörerisch durch die rotblonden Locken.
Stirnrunzelnd schaue ich ebenfalls an mir hinab, kann aber keine Spuren eines gewaltsamen Todes erkennen. Ich betrachte mein rot-schwarzes Streifenshirt und die alte rostfarbene Lederjacke darüber. Keine Risse, keine Brandflecke, nicht mehr Dreck als sonst. Dennoch wirkt unsere Haut eigenartig fahl, wie mir an Mias Gesicht auffällt. Ich nehme die Hände aus den Taschen und wende sie in dem grünlichen Licht. Die Handlinien fehlen.
Wir sind wirklich tot.
»Mia, wir …«, beginne ich zögerlich, »ich meine, wenn wir tot sind, was tun wir dann hier? Was soll das Ganze?«
»Keine Ahnung. Hauptsache, wir tun irgendwas.«
»Ist das alles, was dir dazu einfällt?«
»Cay, was soll ich sagen … vielleicht bin ich vorher noch nie gestorben?!«
»Und dass du gestorben bist, irritiert dich so gar nicht?«
Sie sieht mich forschend an, als könne sie meinen Einwurf nicht recht nachvollziehen. »Schätze, meinem verkorksten Leben nachzutrauern, macht die Sache nicht besser, oder?«
Okay, was habe ich auch für ein Statement erwartet? Letztendlich ist sie nie der Typ gewesen, der sich groß über ihre Vergangenheit Gedanken gemacht hat. Oder ihre Zukunft. Ein tiefer Seufzer entweicht mir und ich blicke zu Boden. Möglicherweise ist die typische Mia-Einstellung in unserer Situation sogar die einzig richtige. Letztlich ist es erstaunlich genug, dass wir überhaupt etwas tun können.
Dennoch lässt mich die Frage nicht los, wie es eigentlich dazu kam. Offenbar scheint sich Mia zumindest an die näheren Umstände unseres irdischen Ablebens zu erinnern.
»Diese komische Explosion …«, sinniere ich in der Hoffnung, dass sie den Ansatz weiterführt. »Wir haben doch nicht etwa das Jimmy’s in die Luft gejagt, oder?«
»Scheiße, du weißt es echt nicht mehr, was?!«
»Ich weiß nur, dass wir im Jimmy’s waren.«
»Du erinnerst dich nicht an die ganze bescheuerte Aktion mit dem Einbruch?«
›Einbruch‹? Ich sehe sie verunsichert an und krame weitere Erinnerungsfetzen hervor.
Nach dem gelungenen Schlüsseldiebstahl waren noch einige Runden dazugekommen. Irgendwann startete bei der Bühne eines jener spontanen Dartturniere, in das wie üblich sämtliche anwesende Kneipenbesucher gewollt oder ungewollt eingebunden wurden. Auch ich durfte mein fehlendes Talent für diese Sportart unter Beweis stellen. In meinem Zustand kam es in etwa Barbies Verständnis für Astrophysik gleich, und entsprechend schnell war ich raus aus dem Match.
Es folgte ein Herbe-Niederlage-Cocktail, während ich der nächsten Kandidatin beim Versagen zusah. Tara, im XXL-Elfen-Shirt und mit diversen Perlen und Federn behängt, schmiss die Pfeile, als würde sie gerade einen Fruchtbarkeitstanz aufführen. Im Gegensatz zu ihr hatte ich zumindest die Scheibe getroffen.
Sie orderte auf die verdiente Blamage hin nur eine Kräuterbrause und stellte sich direkt neben mich in die Loser-Ecke. Ein bisschen zu direkt, wie ich fand.
»Hallo, Cay«, begann sie nach einer Weile. »Ich hab vorhin gesehen, wie du den Schlüssel von Frau Schmidt geklaut hast.«
»Ach?« Etwas Besseres fiel mir nicht ein. Interessanterweise schien Tara jedoch keinen persönlichen Vorteil aus der Kenntnis der brisanten Information ziehen zu wollen.
»Was habt ihr denn damit vor?«, kam bloß die unbekümmerte Frage. »In die Chemiesammlung einbrechen?«
Ich schwieg peinlich berührt und wünschte mir, dass einer ihrer typischen Gedankensprünge den Konversationsversuch beenden würde. Ein anerkennendes Grölen im Raum kündigte derweil an, dass Mia es in die nächste Runde geschafft hatte.
»Mein Bruder und sein Kumpel haben in der Zwölften mal Sprengstoff hergestellt …«, fuhr Tara entgegen meiner Hoffnung plaudernd fort.
»Sprengstoff? Dein Bruder?«
Ich erinnerte mich: Sie war die Schwester von Tom, was mich zu der Schlussfolgerung brachte, dass das völlige Fehlen von Feinmotorik und Treffsicherheit wohl in der Familie liegen musste. Meine unbedarfte Nachfrage animierte Tara indes zu einer näheren Erläuterung.
»Ja, ja. Sie hatten sogar den kompletten Schlüsselbund bei ihrem Lehrer aus der Tasche stibitzt – ich glaube, Herr Roth war das … Nachts haben sie den Sprengstoff dann in der Chemiesammlung zusammengemixt – heimlich natürlich. Tom hatte so eine Anleitung aus dem Internet. Und in Chemie war er ja immer gut. Den Schlüssel haben sie Herrn Roth am nächsten Tag einfach in den Briefkasten geworfen und er hat nie rausgefunden, wer es war. Das hat Tom zumindest so gesagt.«
Er sagte auch, er sei ein guter Liebhaber …
»Bestimmt hat er das«, brummte ich mit ironischem Unterton in der Stimme, obgleich ich Taras konfusen Ausführungen nur halb gefolgt war. »Und was haben sie mit dem Zeug gemacht? Haben sie es heimlich ins Lehrerklo gekippt?«
»Nein, nein – das wäre zu gefährlich gewesen. Sie haben es erst mal in der Sammlung versteckt. Weil dann auch die Zeit knapp wurde und so. Danach sind sie nur nie wieder dazu gekommen, es da rauszuholen. Und Tom wusste auch nicht mehr genau, wo er es hingestellt hatte.«
»Natürlich!«
»Doch wirklich, irgendwann fliegt noch mal die ganze Schule in die Luft!«
Ich ignorierte Taras Katastrophenszenario und hoffte insgeheim, ihr Bruder erinnerte sich wenigstens daran, mir meinen BH bei Gelegenheit wiederzugeben. Glücklicherweise setzte ein enttäuschtes »Oahhh!« von den Dartautomaten weiteren bizarren Schilderungen ein verdientes Ende. Auch Ankie war raus.
»Cay?«, holt mich Mia aus meinen Gedanken. »Hast du mir zugehört?«
»Was?«
»Ich fragte, ob du dich erinnerst, wie wir durch das Fenster in den Kunstraum geklettert sind?«
»Ähh, Kunstraum? Den von unserer alten Schule?«
»Oh Mann!« Sie rollt mit den Augen. »Wir sind aus dem Jimmy’s raus, nach dem Turnier …«
Ich nicke. Ja, da läutet was. Auch wenn ich mich nicht ganz entsinne, ob die Idee mit dem Kunstraum von Mia oder mir stammte.
»Dann sind wir zur Schule rüber«, fährt sie fort. »Ich hab auf dem Weg noch gekotzt.«
»Aha …«
»Okay, schätze, daran musst du dich nicht unbedingt erinnern. Auf jeden Fall sind wir ewig ums Gebäude getigert, bis Ankie meinte, dass beim Kunstraum ja immer ein Fenster offen ist – wegen der Ausdünstungen.«
»Aber ich hab draußen gewartet, oder?«
Mias Idee. Eindeutig. Langsam wird die Erinnerung klarer: In meinem strapazierten Zustand hatte ich mich freiwillig zum Schmiere stehen gemeldet. Hätte ich ebenfalls die Kletterpartie durch das Fenster mitgemacht, wäre mein Magen der nächste gewesen, der sich vermutlich in einen der Töpferversuche aus der Mittelstufe entleert hätte. Also wartete ich auf den Stufen vor dem Haupteingang, dass Mia und Ankie die Mission ›Chemiesammlung‹ erfolgreich zu Ende brachten.
»Doof war, dass mir erst, als wir drin waren, einfiel, dass wir ja gar keinen Schlüssel für den Haupteingang hatten«, referiert Mia ein zusätzliches Detail. »Also ist Ankie los zum Hausmeisterbüro und ich bin zur Sammlung.«
»Ach so, daher das Licht!«
Ich hatte mich schon gewundert, dass mit einem Mal das Erdgeschoss unserer ehemaligen Schule in bester Festbeleuchtung erstrahlte. Irgendjemand schien im Hausmeisterbüro zu sein, und in meiner Betrunkenen-Logik konnte es sich auf keinen Fall um Ankie oder Mia handeln.
Panisch kramte ich nach meinem Handy. Ich brauchte gefühlte Stunden, um Mias Nummer zu finden. Weitere endlose Sekunden verstrichen, bis sie sich meldete.
»Cay? Was ist los? Ich bin gerade in der Sammlung.«
»Mia, da ist jemand im Haus! Seht zu, dass ihr da raus kommt!«
»Scheiße, was?!«
Sie legte auf. Etwa zur selben Zeit ging das Licht aus. Bis auf das im Hausmeisterbüro. Kurz darauf stürmte Ankie aus dem Haupteingang, den sie gleich wieder hinter sich verschloss.
»Wir müssen auf Mia warten!«
»Nein, komm mit!« Sie zerrte mich am Arm von den Stufen und halb um das Gebäude herum zu unserem alten Raucherplatz. Auf den Bänken dort hatten wir schon so manchen ausgearteten Kneipenabend ausklingen lassen. Erst jetzt begriff ich den Grund ihrer Aufregung. Eine Gestalt bog jäh um die Ecke.
»Ist das nicht …«
»Unser Ex-Sportlehrer«, ergänzte Ankie. »Hab bereits von innen gesehen, wie er aus der Turnhalle kam.«
»Und was tut der um diese Zeit hier?«
»Keine Ahnung. Hab mal gehört, er fertigt heimlich Überwachungsvideos aus den Mädchenumkleiden an und sammelt sie in seinem Büro.«
»Igitt.«
Ich hoffte, dass er nicht noch woanders Überwachungskameras platziert hatte. Und dass Mia sich ruhig verhalten würde, solange der Kerl im Erdgeschoss umherschlich.
Das Licht erlosch und wir hielten beide den Atem an. Die Eingangstür ging erneut auf und schloss sich wieder. Von den Stufen aus traf uns der grelle Schein einer Taschenlampe.
»Heee!«, bölkte ich ein wenig unüberlegt, merkte aber im nächsten Moment, dass die Ablenkung gar nicht so dumm war. »Nicht in die Augen!«
Mit übertriebener Gestik hob ich den Arm.
»Was macht ihr zwei denn hier?« Halb überrascht und halb belustigt schritt unser ehemaliger Lehrer auf uns zu. »Wart ihr das mit dem Licht?«
»Nee, das war schon an, als wir kamen«, log ich inbrünstig.
»Wir sitzen einfach nur hier«, fügte Ankie halbwegs überzeugend hinzu.
»Vermisst ihr die Schule so sehr?«
»Und Sie?«, lallte ich zurück. »Bohnern Sie den Hallenboden für die erste Stunde morgen?«
»Ich könnte euch auch anzeigen, das wisst ihr.«
»Ach, kommen Sie, wir sauen hier schließlich nicht alles zu wie die Abiturienten, die sonst hier rumhängen«, startete Ankie einen Beschwichtigungsversuch, aber ihn schien etwas anderes zu interessieren.
»Habt ihr was dabei?«
Ich musste schmunzeln. Darauf lief es also hinaus. Offenbar reichten die Videos für den den letzten Kick nicht aus. Ein Gedankenblitz kam mir und ich wühlte in meiner Handtasche.
»Keks?« Ich streckte ihm eine alte Plastiktüte entgegen, in der ich das eigenwillige Backwerk dilettantisch verpackt hatte. Er grinste breit und griff sich gleich eine Handvoll aus der Tüte.
»Dachte ich es mir doch. Ich denke, damit sind wir quitt.« Generöses Kopfnicken folgte einer ersten Geschmacksprobe. »Na dann, Mädels …«
Beschwingt zog er in Richtung Turnhalle ab und wir atmeten auf.
»Sind das nicht eure ›2.0‹-Kekse?«, bemerkte Ankie stirnrunzelnd.
»Na klar! Schätze, die spezielle Pilzmischung erwartet er nicht. Auf jeden Fall sollte er heute keine schweren Maschinen mehr bedienen.«
»Hoffen wir’s.«
Von weitem erspähte ich Mia, wie sie über den Schulhof auf uns zuhastete.
»Und? Hast du was gefunden?« Ankie sah sie erwartungsvoll an. Mia holte tief Luft und nickte, wenn auch etwas verhalten. Ich blickte derweil nervös zur Uhr am Hauptgebäude.
»Verschieben wir die Beutebegutachtung auf später!«, drängte ich und sprang auf. »Wenn wir uns beeilen, schaffen wir noch den Nachtbus beim Jimmy’s.«
»Wie bist du eigentlich rausgekommen?«, fällt mir unvermittelt ein.
»Es gibt doch diesen Seitenausgang bei den Tischtennisplatten.«
»Ach ja, der!«
Mia starrt eine Weile in die Dunkelheit des Tunnels. »Scheiße, Mann«, seufzt sie.
»Was?«
»Na ja, die ganze Aktion war doch totaler Irrsinn. Ich meine, es grenzt an ein Wunder, dass das geklappt hat. Und dann …« Ehe sie den Gedanken zu Ende bringen kann, wird die Schwärze plötzlich von einem Lichtschein durchbrochen: eine weitere Station!
Verunsichert blicken wir nach draußen. Soll unsere Reise etwa hier schon zu Ende sein? Der Zug scheint indes nicht langsamer zu werden, sondern lediglich durch die vermeintliche Haltestelle hindurchrauschen zu wollen, ähnlich wie an dem Bahnsteig vorhin.
Dann jedoch, kurz bevor wir wieder in den gegenüberliegenden Tunnel eintauchen, durchzieht ein Ruck den Wagen. Bremsen quietschen und Mia, die in Fahrtrichtung sitzt, stürzt mir entgegen, während ich mich an meinem Sitz festklammere. Stockend kommt der Waggon zum Stehen.
»Verdammt, was war das denn gerade?«
Mia rappelt sich Stück für Stück auf. Statt auf meine panische Frage zu reagieren, deutet sie aus dem Fenster. »Schau mal: Ankie!«
Tatsächlich!
Sie klopft wie wild an die Scheibe und einen Moment später schaut Ankie in unsere Richtung. Kurzentschlossen eilen wir zu einer der Türen und ziehen sie auf. Direkt dahinter werden wir von unserer ebenfalls winkenden Freundin in Empfang genommen.
»Hey! Das ist ja eine Überraschung! Wie schön!«
Sie schenkt uns eine aufgeregte Umarmung. Die Station, an der sie uns begrüßt, unterscheidet sich kaum von der letzten.
»Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich so ›schön‹ ist«, bemerke ich nicht ganz so euphorisch, doch Ankies Freude ist ungebrochen.
»Doch, klar! Besonders, da ich jetzt nicht allein hier losziehen muss. Die anderen sind bereits alle fort.«
»Die ›anderen‹? Leute?« Ich blicke in Richtung der Zugtüren. Von unseren schemenhaften Mitreisenden scheint sonst niemand den Zug verlassen zu wollen.
»Ja, ja. Ich wäre eigentlich längst weg, aber so eine alte Dame hat mich aufgehalten. Hatte ihren Zug wohl verpasst. Als eure Bahn einfuhr, war sie wieder verschwunden.«
»Die alte Dame? Hier …?«
»Bist du denn auch an ’nem anderen Gleis aufgewacht und dann in die erstbeste Bahn gestiegen?«, unterbricht Mia mein Gemurmel.
»Na, ich habe schon auf die richtige Bahn gewartet.«
»Die ›richtige‹?«
»Wie konntest du sicher sein, dass es die richtige Bahn war?«, will ich von Ankie wissen.
»Ich wusste es einfach.« Sie zuckt mit den Schultern. »So wie ihr ja wahrscheinlich auch.«
»Äh, ja … und wo sind die anderen hin?« Ich schaue mich um. An diesem Bahnsteig ist ebenfalls kein Ausgang zu erkennen. Unser Zug steht derweil nach wie vor hinter uns. Fast, als würde er auf uns warten.
»Oh, die sind hier lang«, kommt zugleich Ankies Antwort aus einem Wanddurchgang, von dem ich schwören könnte, dass er eben noch nicht da gewesen ist.
Mia und ich folgen ihr auf die andere Seite, und die Aussicht, die sich dort auftut, lässt mich aufatmen. Keine Bahnstation. Stattdessen ein riesig wirkender, heller Raum, den eine zehn oder fünfzehn Meter hohe Kuppel überspannt. Türen und Fenster gibt es keine und auch sonst ist die Ausstattung spärlich. Kein Dekor, keine Schilder, keine Möblierung. Allein zwei messingfarbene Rolltreppen und ein Marmorblock sind an seiner Kopfseite zu sehen.
»Sieht aus, als seien deine Mitfahrer schon alle eine Ebene weiter«, merke ich an, während wir auf das Ensemble zusteuern. Beim Näherkommen zeigt sich, dass die linke Treppe nach unten und die rechte nach oben führt. Der Marmorblock entpuppt sich ferner als eine ovale Theke mit Glasplatte. Ein Schalter womöglich?
»Hey, seht mal!« Mia platziert sich kurzerhand in Barkeepermanier hinter dem merkwürdigen Objekt. »Eure Bestellungen bitte!«
»Ach, Mia.« Seufzend versuche ich mich an einem tadelnden Gesichtsausdruck.
»Was ist los, Cay?«, feixt sie. »Du bist irgendwie so humorlos, seit wir tot sind.«
Hilfesuchend blicke ich zu Ankie, die aber nur mit den Schultern zuckt. »Sie hat recht, Cay. Sei ein bisschen locker! Was soll uns denn jetzt noch passieren?«
»Und ihr zwei seid seitdem echt seltsam«, entgegne ich angesäuert. »Mia, sag uns lieber, ob vielleicht hinter dem Tresen irgendwelche Hinweise darauf versteckt sind, wo wir hier gelandet sind!«
»Nö.« Prüfend schaut sie in die Runde. »Hier ist nichts.«
»Nicht mal Zeichen, dekorative Symbole oder so?«
Ihr Gesichtsausdruck sagt mir, dass keins von beidem dort zu finden ist. Genau wie in der gesamten verfluchten Halle hier.
Ankie hat sich indes vor den zwei Rolltreppen positioniert. Ein bestimmtes Ende lässt sich bei keiner von ihnen ausmachen. Abwechselnd blickt sie nach rechts und links in das diffuse, grelle Licht, in dem die messingfarbenen Stufen nach und nach verschwinden. »Also, wir können nach oben fahren oder nach unten«, fasst sie das Offensichtliche zusammen.
»Ist auf jeden Fall eher eine One-Way-Geschichte«, füge ich kritisch hinzu. »Oder seht ihr eine Rolltreppe zurück?«
»Wahrscheinlich ist es gar nicht vorgesehen, hierher zurückzukommen.« Ankies Blick schweift durch den Raum.
»Und wenn man sich für die falsche Treppe entscheidet, was dann?«
»Dann darf man sich wohl nicht für die falsche Treppe entscheiden!«
»Ach, Ankie, das ergibt doch keinen Sinn!«
»Leute, was ergibt hier überhaupt Sinn?«, grätscht Mia in unsere Diskussion. »Immerhin sind wir tot! Oder wir haben doch irgendwie überlebt und das hier ist so’n kranker Komatraum! Vermutlich findet das alles gerade gar nicht wirklich statt!«
»Cay, was glaubst du denn, wo diese Treppen enden?« Ankie schaut mich herausfordernd an.
»Keine Ahnung. Vielleicht nirgendwo oder in der nächsten Halle. Oder im Jenseits, beziehungsweise Diesseits?«
»Wir sind bereits im Jenseits!«
»Ich meine so ein endgültiges Jenseits, ohne U-Bahnen und Wartehallen«, erwidere ich ärgerlich auf ihre Wortklauberei.
»Oder wir werden wiedergeboren«, fällt Mia noch eine Alternative ein. »Davon habe ich mal gelesen.«
»Hmm, und wie soll das funktionieren? Du kommst am Ende der Treppe als Embryo raus? Oder als befruchtete Eizelle?«
»Argh, hört auf!«, echauffiert sich Ankie über unsere Theorieversuche. »Ich glaube eher, die rechte Treppe führt in den Himmel und die linke …«
»Zugegeben, das wäre schon ziemlich flach«, unterbricht Mia ihre Ausführungen und ich verschränke die Arme.
»Zumal es unsinnigerweise eine Glaubensrichtung über alle möglichen anderen stellen würde!«
»Und wenn genau die aber nun stimmt?« Neugierig lugt sie hinauf in das gleißende Licht.
»Ankie, ich weiß nicht, ob ich hier und jetzt mit dir weitere religiöse Grundsatzdiskussionen führen möchte.«
Seit einer gewissen ›verfluchten‹ Party mit kopfschmerzlastigem Ausgang habe ich mir geschworen, mit Ankie oder überhaupt gläubigen Menschen nie wieder über Religion und sonstige Glaubensfragen zu diskutieren. Allein, was den Punkt der Existenz einer potenziellen Jenseitsdestination betrifft, muss ich zugeben, dass ich mich damals wohl geirrt habe, wenn man unsere jetzige Situation bedenkt.
Trotzdem. Nichts hat bisher an diesem Ort auf eine Symbolik hingewiesen, die eine theologische Deutung in Ankies Sinn nahelegen würde.
»Verdammt, wir stehen in einer Bahnhofshalle im Nirgendwo!«, wiederhole ich meine Bedenken nochmals laut. »Steht das etwa in der Bibel?«
»Meine Güte, Cay, du musst hier ja nicht gleich ’nen Aufstand machen«, weist mich ausgerechnet Mia zurecht.
Ankie wirkt ebenfalls gereizt. »Aber deine komische Diesseits-Jenseits-Theorie findest du plausibler?!«
»Ja, ich finde das in der Tat ziemlich logisch. Dieses Himmel-Hölle-Paradigma ist doch viel zu undifferenziert! Da macht selbst Mias Ansatz mehr Sinn.«
Genau! Letztlich ist alles eine Illusion, erzeugt aus den Reminiszenzen unseres Unterbewusstseins, das sich nun diese bizarre Umgebung mit ihren Erscheinungen zusammenfabuliert. Wer weiß, woher die Referenzen dieser Gebilde stammen? Hatte ich nicht mal eine ähnliche Halle in einem Traum gesehen? Und der Bahnsteig? Ein Symbol?
Vermutlich findet dieses Gespräch gerade wirklich nicht statt! Mia und Ankie sind nur Bilder aus den Tiefen meiner Psyche so wie alles hier. Aber wenn es mein Unterbewusstsein noch gibt, bin ich womöglich nicht wirklich tot. Ja! Diese Zwischenwelt dient allein meiner Entscheidung zwischen Jenseits und Diesseits. Zurück ins Leben oder die totale Auflösung …
»Also, ich habe meine Entscheidung getroffen«, unterbricht Ankie meine Gedanken. »Ich nehme die Treppe nach oben.«
»Na, dann nehmen wir halt die!«, springt ihr Mia einmal mehr zur Seite. »Was auch immer uns da erwartet. Hauptsache, wir kommen hier endlich mal vom Fleck! Cay, was ist mit dir?«
Ich sehe die Abbilder meiner Freundinnen abwägend an. Sie wirken so real wie ich selbst. Alles wirkt so real. Und dennoch …
Abermals kommt ein Anflug schlechten Gewissens auf, wie vorhin am ersten Bahnsteig. Ich war doch irgendwie für diese Explosion verantwortlich gewesen, und wahrscheinlich haben Mia und Ankie sie nicht überlebt. In meiner Vision tauchen sie nun als Geister auf. Etwa zum Abschied? Ja. Das ergibt Sinn.
»Sorry, ihr beiden«, höre ich mich murmeln.
Mia sieht mich entsetzt an. »Häh, was? Willst du hierbleiben?«
»Sie ist beleidigt, weil ich ihr nicht recht gebe«, bemerkt Ankie nur kühl.
»Ich bin nicht beleidigt! Ich denke nur, dass euer Weg vermutlich nicht mein Weg ist.«
»›Euer‹ Weg?« Nun verliert auch Mia die Geduld mit mir. »Ich dachte, wir ziehen das hier zusammen durch!«
»Ist das jetzt wieder deine Bindungsparanoia oder was? Sind wir dir nicht mehr wert als irgendwelche komischen Typen nach dem zweiten Date?«
»Ankie, ich habe dir schon hundertmal gesagt …« Ich lasse den Satz unvollendet. Was bringt es, mit einem Geist zu diskutieren, der offenbar nichts Besseres zu tun hat, als mir meine menschlichen Unzulänglichkeiten unter die Nase zu reiben?
Halb bewusst, halb unbewusst setze ich einen Fuß auf die Rolltreppe nach unten. Ankie schiebt sich daraufhin demonstrativ auf die rechte Rolltreppe, was bei Mia zu einer kurzzeitigen Panik führt. »WAS? Was soll das denn jetzt?«
Ich zögere kurz, ziehe dann aber den anderen Fuß nach. »Es tut mir leid, dass ich euch darin verwickelt habe. Aber ich will, glaube ich, zurück.«
Ankie fährt bereits nach oben. »›Zurück‹? Es gibt kein Zurück!«
»Vielleicht nicht für dich«, erwidere ich scharf.
»Mann, Cay, du bist so stur!«, schreit Mia mich ungehalten und gleichsam verzweifelt an. »Komm sofort wieder hier hoch!«
Nein, auch ich habe meine Entscheidung getroffen.
Durch die gläserne Verkleidung der Rolltreppe schaue ich ein letztes Mal zu den beiden Geistern auf. »Es tut mir wirklich leid!«, rufe ich ihnen nochmals zu, bekomme aber keine Antwort mehr. Ich sehe noch, wie Mia mit dem Kopf schüttelt und Ankie nach oben folgt. Als sie ebenfalls verschwunden ist, drehe ich mich endlich weg vom Anblick der Halle, nach vorne zum Licht.
Knapp zehn Meter kann ich durch das grelle Leuchten, durch das mich die Stufen nach unten tragen, gerade so hindurchsehen. Dabei offenbart sich auch nach mehreren Minuten immer nur derselbe Ausblick aus Treppe und weißem Lichttunnel. Genauso wenig wie das Ende dieser Fahrt lässt sich erahnen, was mich dort überhaupt erwarten wird.
Vielleicht wache ich einfach auf. In einem Krankenhaus, komplett einbandagiert, so wie man das aus Filmen kennt. Ein Pfleger wird freudig etwas ausrufen wie: ›Sie ist bei Bewusstsein!‹, ein besorgter Arzt wird vor meinem Bett auf und ab rennen und Werte auf Maschinen checken, an die ich angeschlossen bin.
Eigentlich keine besonders tolle Vorstellung. Vermutlich werde ich höllische Schmerzen haben. Oder entstellt sein! War es wirklich die richtige Entscheidung, runter zu fahren?
In meiner Vision sagt mir der Arzt oder eine Schwester, was für ein wahnsinniges Glück ich doch gehabt habe, diese Explosion zu überleben, und dass die meisten Passagiere des Busses tot seien.
Der Bus! Genau!
Nun kommt auch diese Erinnerung zurück, obwohl ich nicht weiß, ob ich sie nicht lieber wieder verdrängen möchte.
Es war der letzte Nachtbus. Nur ein paar Leute saßen hier und da auf den siffigen, vollgekritzelten Kunststoffbänken. Ein Großteil der Nachtschwärmer waren alte Bekannte aus dem Jimmy’s. Ungeachtet der üppigen Auswahl an Sitzplätzen zogen wir es vor, im hinteren Ende nahe den Türen einfach stehen zu bleiben. Der Adrenalinschub infolge der Einbruchaktion hatte bei uns für allgemeine Nüchternheit gesorgt.
»Was hast du denn nun mitgenommen?«, fragte Ankie neugierig.
»Hatten wir nicht Salzsäure gesagt?«, fügte ich hinzu. »Als Treibstoffersatz für Stones Motorrad. Oder hast du etwas Besseres gefunden?«
»Äh … nun ja, ich weiß es nicht.«
»Wie, du weißt es nicht?«
Während Mia herumdruckste, gesellte sich ausgerechnet Tara zu uns, die ungewöhnlicherweise leicht angetrunken wirkte. Offenbar hatte sie es länger als sonst im Jimmy’s ausgehalten. »Du, Cay«, tippte sie mich an, »ich verspreche, das mit dem Schlüssel nicht Frau Schmidt zu verraten, wenn du mir mein gelbes Glückspony zurückgibst, das ihr mir bei der Abschlussfahrt geklaut habt.«
Ich musste kurz an das Viech denken, dessen Kopf Mia auf einen Brieföffner gespießt hatte, wobei der Körper daneben auf ihrem Schreibtisch als Gelegenheitsaschenbecher diente.
»Tara, möchtest du einen Keks?«, wich ich dem spontanen Erpressungsversuch aus.
»Au ja!«
Ich reichte ihr die Tüte aus meiner Tasche und sie griff gierig zu. Die erste Portion hatte sie einen Moment später bereits heruntergeschlungen. Mit einem »Mmh, lecker!«, nahm sie direkt noch mal nach.
»Okay, Tara, behalt die Tüte doch einfach«, reagierte ich kurzentschlossen auf ihre Fressattacke. »Aber geh damit doch vielleicht … ans andere Ende vom Bus!«
Die Ablenkung schien zu funktionieren. Tara zog mampfend von dannen und ich wandte mich wieder unserer Lagebesprechung zu. »Es dürfte eventuell auch ›HCl‹ draufgestanden haben.«
»Nee, das war’s, glaube ich, nicht.« Mia kramte ein verkorktes Glasfläschchen aus ihrem Rucksack. Mit aufforderndem Gesichtsausdruck drückte sie es mir zur näheren Untersuchung in die Hand.
»Hmm, ziemliches Gekritzel. ›TMs feines C3HSN3O3‹? Was soll das denn sein? Das ist doch auch keine von den Standardflaschen.«
»Salzsäure ist auf jeden Fall nicht gelb«, gab Ankie ferner zu bedenken. »Das Letzte ist außerdem keine Drei, sondern ’ne Neun … das ›S‹ ist ’ne Fünf … und wer oder was ist TM?«
»Ich dachte, das wäre ein Markenzeichen oder so.«
»Die Formel ist überhaupt relativ lang«, bemerkte ich abschließend und drehte das Fläschchen nochmals prüfend zwischen den Fingerspitzen.
»Mann, nervt mich nicht!«, stöhnte Mia eingeschnappt. »Die meisten coolen Sachen waren weggeschlossen. Habe sogar die Rumpelkammer durchwühlt. Als du anriefst, hab ich von da dann das Erstbeste aus einer dunklen Ecke geschnappt. Musste ja schnell gehen.«
Ein empörtes Grölen durchzog plötzlich den Bus, was nicht an Tara lag, die inzwischen mit wiegenden Armen durch den Gang taumelte. Irgendein Idiot war bei Rot aus einer Seitenstraße auf die Fahrbahn geprescht und stand nun quer vor uns. Der Busfahrer machte eine jähe Vollbremsung, um das Schlimmste zu verhindern, was uns mit voller Wucht nach vorne schleuderte. Ich hatte noch dieses ungute Gefühl, als mir die Flasche aus der Hand glitt und vor uns auf den Boden flog.
Scheiße.
Wir waren die Ersten, die von der Druckwelle der Explosion erfasst wurden. Genauso gut hätten wir uns alle einen Sprengstoffgürtel umbinden können, wie es in manchen Fundamentalistenkreisen heutzutage ja so üblich ist.
Erst jetzt wird mir die Konsequenz dieses Umstands bewusst. Es gibt wirklich kein Zurück. Die unbeschwerten Tage zwischen Zukunftssorge und Planlosigkeit, die ich einst mein Leben nannte, sind endgültig vorbei. Keine Feiern mehr, keine Kneipen, keine Typen. Keine der Personen, die mir je etwas bedeutet haben, werde ich wiedersehen. Wenn ich sie nicht sowieso gerade mit in die Luft gesprengt habe! Und als wäre jene Erkenntnis meines unrühmlichen irdischen Abgangs nicht frustrierend genug, habe ich es nun auch noch geschafft, meine Situation im Jenseits zu versauen! Habe, statt gemeinsam mit meinen Freundinnen diese letzte Reise anzutreten, mich von meiner verqueren Logik auf den direkten Weg in ewige Einsamkeit leiten lassen.
Schmerzerfüllt blicke ich die Rolltreppe hinauf, sehe aber nur den hellen Widerschein der Lichter von oben. Trotzig steige ich einige Stufen gegen die Fahrtrichtung hoch, doch ich scheine mich auf der Stelle zu bewegen. Wille und Kraft verlassen mich nach einer Weile und ich gebe auf. Zumindest darin hatte ich recht: Es ist eine One-Way-Geschichte.
Umso schwerer fällt es mir, diese Endgültigkeit zu akzeptieren. Hätten wir uns nur mehr Zeit genommen! Warum musste Ankie auch so überstürzt reagieren? Als würde sie ihre Bestimmung kennen! War sie sich deshalb mit der bescheuerten Rolltreppe so sicher gewesen? Und dass sie in den richtigen Zug gestiegen war? Hätten wir unseren Zug wirklich nehmen müssen? Dann die Station – hätten wir einfach weiterfahren können? Und was sollen überhaupt diese ganzen Optionen?
Der schreckliche Gedanke kommt mir, es schon viel früher versaut zu haben. Die Züge, die Bahnsteige, die Halle – sie alle sind nur Teile eines viel größeren Ganzen! Einer riesigen jenseitigen Zwischenwelt, die vermutlich für jeden seine Vision von dem, was nach dem Tod mit seiner Seele passiert, hinter einem von Dutzenden Gleisen bereithält.
Nur, falls dies tatsächlich so ist, bin ich hier völlig falsch! Wenn ich auch keine genaue Jenseitsvorstellung besitze, so weiß ich doch, dass es nicht die von Ankie ist. Aber was bedeutet es, wenn ich hier falsch bin? Fahre ich nun bis in alle Ewigkeit nach unten?
Eine sich verändernde Aussicht lässt die Panik ein wenig abflauen. Der Lichtschein, in dem die Stufen der Rolltreppe enden, wird plötzlich schwächer und geht stattdessen in ein gelbliches Flimmern über. Als sich nach und nach sogar ein Boden unter der diffusen Beleuchtung abzeichnet, rücke ich endgültig von der Endlosen-Treppenfahrt-Theorie ab.
Ich steige ein Stück hinunter und erkenne einen runden, etwa vier Meter hohen Raum, der mit grau-glänzendem Granit ausgekleidet ist. Die Wand gegenüber der Rolltreppe ziert ein prachtvolles Portal, auf das ich, am Ende der Stufen ankommend, förmlich zugespült werde.
Das grelle Licht aus dem Treppenschacht lässt die Reliefs aus Formen und Figuren auf seinen beiden Flügeln silbrig erstrahlen. Ein Torbogen aus in sich verschlungenen, mit Ranken und Blättern geschmückten Säulen verleiht dem Ensemble einen majestätischen Rahmen. Bis auf die hässliche Fratze eines Gargoyles vielleicht, die oberhalb des Bogens zwischen dem steinernen Blattwerk hervorragt.
Jene passt dafür ganz gut zu dem Rest dieses eigenartigen Vorraums. Trotz der edlen Materialien ist der Gesamteindruck schmuddelig. Die Bodenplatten kleben. Überall liegen Coladosen und Zigarettenstummel verstreut.
Ich kicke einige der Dosen beiseite, als ein längliches Objekt in ihrer Mitte meine Aufmerksamkeit auf sich zieht: ein metallischer Stab mit einem Griff. Sein Ende ist spitz, der Knauf reich verziert. Neugierig hebe ich ihn auf. Er lässt an einen primitiven Degen oder an einen angespitzten Schürhaken denken. In dieser bahnhofstoilettenähnlichen Szenerie wirkt er jedenfalls reichlich fehl am Platz. Bis auf den Aspekt, dass er eventuell eine solide Waffe gegen aufdringliche Bahnhofspenner abgeben würde.
Von dem Stab in meiner Hand schweift mein Blick zurück zur Rolltreppe. Könnte ich es nicht doch schaffen, gegen die Laufrichtung anzusteigen? Wie lange ich wohl bei dieser Höhe und Geschwindigkeit brauchen würde? Möglicherweise steht oben ja sogar noch der Zug!
Ein Knall lenkt mich von meinen konfusen Überlegungen ab, das heißt, eher ein Klatschen. Ganz als sei gerade ein Körper vor dem Tor auf dem kalten Granitboden aufgeschlagen. Und tatsächlich: Es handelt sich um den vermeintlichen Gargoylekopf, dessen physische Erscheinung vollständiger ist, als ich dachte.
Umständlich richtet sich das Wesen auf. Seine Haut ist grau und ledrig. Es besitzt krallenartige Finger und Fledermausschwingen. Aus seinem Kopf ragt ein vereinzeltes, schiefes Horn. Benommen kneift es seine glasiggrünen Augen zusammen und gibt einen lauten Rülpser von sich, woraufhin ich angewidert ein paar Schritte zurücktrete.
Der Gargoyle scheint dagegen geradezu hocherfreut zu sein, mich zu sehen. »Sieh an! Ein neues Seele!« Enthusiastisch flattert er mit den knitterigen Flügeln. »Wie schön! So langes Zeit ist nichts mehr angekommen! Wollte schon oben nach das Charon schauen, ob es sein Arbeit richtig macht. Aber hier ist es nun! Es kommt jetzt mit, ja?«
»Mit? Wohin mit?« Einen Sicherheitsabstand beibehaltend blicke ich mich nach einem eventuellen Fluchtweg um, aber es gibt nur das Tor und die Rolltreppe.
»Natürlich durch das Höllentür!«, frohlockt er.
Ich kann seine Begeisterung kaum teilen. »Hölle?! Äh … nein.«
»Wie ›Nein‹? Was meint es mit ›Nein‹? Es wurde doch hierher geschickt!« Nervös schaut er sich um, als würde er nach etwas suchen.
»Nun, das war ein Irrtum.« Ich hebe die spitze Stange in meiner Hand ein wenig an, sodass er sie sehen kann.
»Irrtum? Es hat … oh Mist!« Seine Freude lässt schlagartig nach. Stattdessen verzieht er sein hässliches Gesicht in absoluter Fassungslosigkeit und Überforderung.
Wie eine Lanze strecke ich den Stab von mir, begleitet von einer ernsten, entschlossenen Miene, um meiner Aussage nochmals Nachdruck zu verleihen. »Ganz richtig, es war ein Irrtum. Überhaupt bin ich an der falschen Station ausgestiegen. Ich sollte gar nicht hier sein.«
Meine erläuternden Worte scheinen nicht dazu beizutragen, die Verwirrung der Kreatur zu mildern. »Aber …«, setzt sie an und stammelt von ›Schicksal vorgegeben‹ und ›Es macht nie Fehler!‹
»Ich weiß nicht, wer ›es‹ ist«, erwidere ich energisch. »Nur anscheinend hat es doch einen Fehler gemacht. Wie gesagt, ich bin bereits am völlig falschen Bahnsteig gelandet.«
»Das kann nicht sein.«
»Ist es aber. Oder stehe ich auf der Gästeliste?«
»Öh, Moràthechis weiß nichts von das Liste. Vielleicht weiß Chef.«
»Na, dann sag deinem Chef, dass er mal nachschauen soll! Und am besten fragst du ihn auch gleich, wie ich zum Bahnsteig zurückkomme!«
Gequält druckst der Gargoyle herum. »Das, äh … Moràthechis weiß nicht …«
»Hast du eine bessere Lösung?«
»Es könnte einfach mitkommen!« Er macht einen taumeligen Satz auf mich zu und grapscht nach meiner Hand mit dem Stab, doch den Versuch hätte selbst ein koordinationsschwaches Faultier abgewehrt. Ich hole aus und gebe ihm vorsichtshalber einen weiteren unangenehmen Pikser in den Arm mit.
»Könnte es hierlassen …«, murmelt er vor sich hin, während er schwerfällig zurückweicht und sich die schmerzende Gliedmaße reibt. »Aber was, wenn Chef mitbekommt? Oh! Wahrscheinlich weiß schon!«
Ein zeitweises Zucken verrät, dass er unschlüssig ist, ob er nicht doch einen Vorstoß wagen sollte. Umso entschlossener richte ich weiterhin das spitze Stabende auf ihn.
Die Drohgebärde zeigt Wirkung. Schließlich gelangt er wohl zu der Einsicht, dass er in seinem desolaten Zustand hier nichts auszurichten vermag, und windet sich in Richtung Portal.
»Okay«, meldet er sich noch einmal zu Wort, bevor er sich hindurchschiebt, »es wartet hier ein Augenblick und Moràthechis holt Chef, ja?« Spricht’s und zieht das Höllentor hinter sich zu.
II
Eine Weile stehe ich einfach da und betrachte das reich verzierte Portal. Es trägt eine lateinische Inschrift, von der mir ein Ausschnitt seltsamerweise bekannt vorkommt. ›Fatum te ducit‹, heißt es dort. Übersetzen kann ich es nicht. Latein hatte ich nie und so sind die Buchstaben, die aus kleinen Figuren in verdrehten Posen bestehen, für mich das eigentlich Interessante. Groteske Höllenwesen in allen möglichen Variationen. Eines davon, ein fledermausartiger Dämon mit dümmlichem Gesicht, erinnert mich stark an meine seltsame Begegnung von eben.
Ob der widerliche Gargoyle wohl wirklich mit seinem Chef sprechen wird? Allerdings müsste er ja irgendwann wieder an seinem Arbeitsplatz (wenn man das hier so nennen kann) erscheinen. Insofern dürfte ihm eventuell schon daran gelegen sein, das mit seinem Vorgesetzten …
Moment. Könnte es sein?
Nun wird mir doch mulmig zumute. Vielleicht ist es nicht gerade der Satan persönlich, aber möglicherweise könnte gleich ein deutlich mehr Autorität ausstrahlendes und furchteinflößenderes Wesen durch dieses Tor stolzieren. Eines, das sich nicht von ein paar energischen Worten und einer unbeholfenen Drohgebärde abschrecken lässt.
Unweigerlich ziehen einige besonders monströse Figuren im Torrelief meine Aufmerksamkeit auf sich. Mit behaarten Körpern, messerartigen Zähnen, Klauen und Hörnern winden sie sich ineinander. Wie realistisch diese Darstellungen wohl sind?
Ich balle meine Hand um den Stab und schreite nervös vor dem Portal hin und her. Das siffige Foyer bietet keinerlei Möglichkeit, sich zu verstecken. Der einzige Ausweg ist – ich muss schlucken – das Tor.
Mein Blick fällt auf den massigen Eisenring, an dem es der Gargoyle vorhin aufgezogen hat. Schwergängig sah es nicht aus. Ich wage einen Versuch, öffne zunächst nur einen schmalen Spalt. Ein grauer, steiniger Boden kommt dahinter zum Vorschein. Zögerlich schiebe ich meinen Kopf durch die Öffnung, hinter der sich eine öde Ebene auftut, überzogen von Felsbrocken und gehüllt in Dunstschwaden. Nur hier und da bohren sich stacheldrahtähnliche Dornengewächse durch die spröde Erde. Trostlos. Aber zumindest keine von Lava durchströmte Höhle. Gleichsam versprechen die Felsbrocken einen geeigneten vorübergehenden Unterschlupf.
Soll ich wirklich … in die Hölle? Oder soll ich nicht eventuell doch noch mal die Rolltreppe … Nein. Bei meiner Kondition würde mich selbst der Gargoyle in kürzester Zeit eingeholt haben.
Ich atme tief durch, umklammere einmal mehr den spitzen Stab und schlüpfe auf die andere Seite. Zu meiner Verwunderung steht das Portal hier ohne jegliche Umgrenzung inmitten der Ödnis. Aus der Ferne weht ein eisiger Wind.
Probeweise durchquere ich das Tor erneut, trete in das siffige Foyer und wieder zurück auf die Ebene. Sehr gut! So kann ich auf jeden Fall zurückkehren, sobald sich die Situation mit dem Gargoyle und seinem Vorgesetzten geklärt hat. Ein rascher Blick und ich husche hinter den nächstbesten größeren Felsbrocken, nur wenige Meter vom Höllentor entfernt, sodass es sich gut beobachten lässt.
Kaum habe ich den Posten eingenommen, höre ich eine vertraute Stimme. Mit einem langgezogenen »Aber …« nähert sie sich dem Portal. »Es sprach von falsches Station. Wie kann das sein?«
Offenbar habe ich den kleinen Widerling nicht richtig eingeschätzt. Zumindest was seine Kommunikationswilligkeit betrifft. Dennoch wirkt er recht gequält. »Nein. Nein. Charon würde niemals … Gut, Moràthechis wartet.«
Die Stimme seines Gegenübers, falls dieses tatsächlich existiert, vernehme ich nicht. Auch zusätzliche Schritte lassen sich nicht ausmachen. Behutsam blinzele ich um den Stein herum, um mir Klarheit zu verschaffen. Außer dem Gargoyle ist niemand zu sehen. Mittlerweile steht er direkt vor dem Tor, eine Hand auffällig ans Ohr gepresst. Ein Handy?!
Bevor ich mich eingehender über die technischen Errungenschaften dieser Jenseitssphäre wundern kann, schallt ein lautes »Mist! Verfluchtes Seele!« aus dem Foyer zu mir herüber, das höchstwahrscheinlich mit meinem spontanen Standortwechsel zu tun hat.
Ich nutze die Gelegenheit für einen weiteren. Eine Formation von drei mittelgroßen Felsen erscheint mir geeignet, meinen Sicherheitsabstand zur Höllenpforte zu vergrößern, besonders, solange sie noch geöffnet ist. Zunächst sprinte ich hinter einen kleineren Geröllhaufen und gehe erneut in Deckung. Erst jetzt bemerke ich, dass die Szenerie nicht gänzlich unbelebt ist. Zwischen einigen der Steinbrocken sammeln sich verkrümmte Gestalten. Mit größter Anstrengung, allerdings ohne erkennbaren Grund, mühen sie sich ab, die Brocken vor sich herzuschieben. Vage erinnern diese Figuren an Menschen, jedoch mit eingefallenen Körpern und bräunlicher Haut, wie lebende Mumien. In Kombination mit dem gelblichen Licht der Umgebung muss ich an Zombie-Apokalypse-Filme denken. Nur ohne den bequemen Sessel, aus dem man aufstehen könnte, wenn der Abspann beginnt.
Gerade, als ich weiterlaufen will, fällt mir ein Schatten auf, der über die Ebene streift. Ein flüchtiger Blick gen Himmel enthüllt das große, behaarte Wesen mit den ledrigen Schwingen und stierartigen Hörnern – und es ist nicht das einzige. Mindestens vier ähnlich monströse Kreaturen sind in der Höhe über dem Areal zu erkennen.
»Fuck!« Panisch schaue ich mich um. Die von mir angepeilte Felsformation ist zu weit weg. Der Teufel hätte mehr als genug Zeit, mich zu entdecken, um mich dann in den nächstbesten Höllenschlund zu tragen.
Was habe ich mir auch dabei gedacht? Schließlich dürften hier ständig unglückliche Seelen durch das Portal stiefeln. Und irgendjemand wird sie wohl aufsammeln müssen.
Ich warte, bis sich der Schatten ein paar Meter entfernt hat, und hechte los. Erst, als ich die halbe Strecke zurückgelegt habe, wird mir bewusst, dass der Felsbrocken nicht mehr verfügbar ist. Ein Pulk der zombieartigen Gestalten hat sich auf ihn gestürzt und müht sich nun schnaubend ab, ihn um das Tor herumzuschieben.
Schon höre ich die Flügelschläge näherkommen. Etwas Großes bewegt sich gezielt auf mich zu. Ich renne weiter, suche verzweifelt nach einer Deckungsalternative, wobei der Wind, der mir permanent meine langen Haare ins Gesicht weht, die Suche zusätzlich erschwert. Ein kurzer unaufmerksamer Moment und ich gerate ins Straucheln, stolpere über einen Stein, verliere mein Gleichgewicht und pralle seitlich auf ein Dornengewächs am Boden. Den Schmerz fühle ich kaum. Dafür einen kalten Schauer, der meine Brust durchfährt. Panik macht sich breit. Geistesgegenwärtig schaffe ich es zumindest, mich halbwegs aufzurichten. Ich drehe mich um und stoße den Metallstab in die Luft. Hinsehen kann ich nicht.