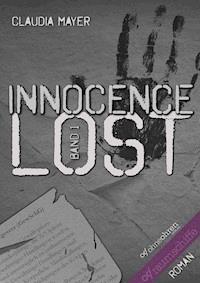
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag OHNEOHREN
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Imperia – Hauptstadt der Union, Zentrum einer modernen Gesellschaft ohne Gewalt. Der große Krieg ist vorüber. Schwere Verbrechen gehören der Vergangenheit an, seit der Staatenbund der Union potenzielle Gewalttäter bereits präventiv euthanasieren lässt. Kinder sind es, die gesetzlich angeordnet ihr Leben lassen müssen, um das Dasein anderer Menschen zu schützen. Kinder, denen Gewalt angetan wurde. Leslie Evans ist Kinderärztin. Nicht nur die Behandlung ihrer kleinen Patienten gehört zu ihren Pflichten, sondern auch das Beenden von kurzen Leben, die von den Auswirkungen des Gewaltschutzgesetzes betroffen sind. Bis Leslie eines Tages erkennt, dass sie ihrer Aufgabe nicht mehr in der staatlich verordneten Weise nachkommen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INNOCENCE LOST
Band 1
Wege nach Greenvale
Die Deutsche Bibliothek und die Österreichische Nationalbibliothek verzeichnen diese Publikation in der jeweiligen Nationalbibliografie. Bibliografische Daten:
http://dnb.ddp.de
http://www.onb.ac.at
© 2016 Verlag ohneohren, Ingrid Pointecker, Wien
www.ohneohren.com
ISBN: 978-3-903006-46-1
1. Auflage
Autorin: Claudia Mayer
Coverillustration: freepik.com
Lektorat, Korrektorat: Verlag ohneohren
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und/oder des entsprechenden Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Alle Personen und Namen in diesem E-Book sind frei erfunden.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Prolog
Gewaltschutzgesetz (GewSchG)
§1 Behandlung von Gewaltopfern
(1) Minderjährige, die zu Opfern gewalttätiger Handlungen werden, sind unverzüglich zu euthanasieren.
(2) Gewalttätige Handlungen sind:
1. Körperliche Misshandlungen, die Schädigungen an Leib und/oder Seele verursachen.
2. Sexuelle Handlungen, bei denen eine Person über achtzehn Jahren mit einem Kind unter vierzehn Jahren den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind oder sexuelle Handlungen, die eine Person über vierzehn Jahren an einem Jugendlichen ohne dessen Einwilligung durchführt oder durchführen lässt.
3. Demütigendes Verhalten, mit dem Ziel, die Psyche des Minderjährigen nachhaltig zu schädigen.
4. Kriegshandlungen und mit Waffengewalt ausgetragene Konflikte, die der Minderjährige als Zeuge oder Opfer erlebt.
(3) In Ausnahmefällen kann bei Säuglingen unter sechs Monaten auf ein positiv ausfallendes psychologisches Gutachten hinsichtlich der Resozialisierungsfähigkeit hin die Euthanasie ausgesetzt werden.
(4) Die Euthanasie ist von kindermedizinisch ausgebildetem Personal durchzuführen.
(5) Wer eine Euthanasie verhindert oder durch Manipulation der Mittel scheitern lässt, macht sich als Gewalttäter strafbar.
(6) Der Versuch ist strafbar.
Auszug aus einer Rede des Präsidenten der Union anlässlich des 25. Jahrestags des Kriegsendes: […] Gewalt war schon immer eine Geißel der Menschheit. Und Wissenschaftler haben schon vor vielen Jahrzehnten herausgefunden, dass Gewalt immer neue Gewalt hervorbringt.
Vor fünfundzwanzig Jahren endete ein Krieg, der unsere Welt zu der gemacht hat, die sie heute ist. Wir haben uns hier versammelt, um all jenen Opfern zu gedenken, die Jahrzehnte der entfesselten Gewalt gefordert haben. Dieser Krieg hat uns gelehrt, dass Gewalt von überallher kommen kann. Dieser Krieg hat uns gezeigt, dass wir im Falle eines Ausbruchs der Gewalt vor niemandem sicher sind.
Wir alle, die den Krieg noch erlebt haben, erinnern uns an das Massaker von Nevermore, wo eine ganze Garnison von Soldaten von den Todesschwadronen einiger Kinderbanden niedergemetzelt wurde. Wir alle kennen die Bilder von den neben den Leichen posierenden Kindern.
Und spätestens damals dämmerte es auch jenen Menschen, die zuvor die Augen verschlossen haben, dass Gewalt die wahre Geißel der Menschheit ist und vor niemandem haltmacht.
Aus diesem Grund wurde vor zwanzig Jahren das Gewaltschutzgesetz erlassen. Und dieses Gesetz besagt, dass Kinder, die Opfer von Gewalt werden, unverzüglich euthanasiert werden müssen. Denn, wie Statistiken schon vor dem Krieg besagten, Gewaltopfer haben eine mehrfach höhere Gewaltbereitschaft als andere Menschen.
Dieser Schritt ist uns nicht leichtgefallen, denn schließlich brachten wir uns damit um einen Teil unserer Zukunft. Und so sind meine Gedanken an diesem Tag nicht nur bei den Gefallenen des Krieges, sondern auch bei all jenen, die uns durch ihre Arbeit vor der Gefahr, die von Kindern, die Gewalt erfahren haben, ausgeht, beschützen. Bei alljenen Ärzten und Polizisten, die jedes Mal das Gemeinwohl über ihre eigenen Gefühle stellen.
Und meine Gedanken sind bei den Eltern, die aufgrund von Gewalttaten ihre Kinder verloren haben.
Die Union ist in Gedanken bei ihnen!
Wir können stolz sein. Es ist uns gelungen, einen seit achtzig Jahren tobenden Krieg zu beenden. Wir hungern nicht mehr und die Wirtschaft hat sich erholt. Das Wichtigste ist jedoch etwas anderes: Seit fünfundzwanzig Jahren herrscht Frieden! Und das, obgleich die Ressourcen seitdem immer noch zu knapp sind, um wirklich alle Menschen ausreichend zu versorgen. Doch wir sind auf dem Weg nach vorne, und wenn es uns gelingt, Gewalttäter und damit auch Kriegstreiber auszumerzen, wird die Union bald wieder prosperieren!
Die Opfer, die bis dahin noch zu bringen sind, werden schmerzhaft sein, das will ich nicht bestreiten. Aber wir müssen den Blick nach vorne richten, denn an der Vergangenheit ist nichts mehr zu ändern! Wir werden gemeinsam in eine friedliche und damit gesicherte Zukunft gehen. Unsere Enkel werden dann in einer vollkommen gewaltfreien Welt aufwachsen und den Krieg nur noch aus ihren Schulbüchern kennen!
Kapitel 1
Ein Tablett, ausgelegt mit weißem Papier, eine Spritze mit Nadel und eine kleine, unscheinbare Ampulle sowie ein weiches Klettband. Das waren die schlichten Gegenstände, mit denen dem Gesetz Folge geleistet wurde.
An diesem Tag wäre die Schallisolierung des kleinen, fensterlosen Raumes unnötig gewesen. Das Kind, das sich darin befand, war ruhig. Trotz der Wärme in dem Zimmer zitterte das auf der Behandlungsliege sitzende Mädchen.
„Keine Angst, Kleines, es wird alles gut!“ Ganz vermochten diese Worte das verschüchterte Geschöpf nicht zu beruhigen, aber das Zittern wurde ein bisschen schwächer.
In der Zwischenzeit hatte die Ärztin die Spritze aufgezogen.
Das Kind zuckte zurück, als sie vor die Liege trat, ließ sich aber erneut so weit beruhigen, dass die Ärztin die Nadel in die Armvene einführen konnte. Ein kurzes Zucken, als die Spitze die Haut durchstieß, war die letzte Abwehr eines kleinen Mädchens im irdischen Leben.
Bald darauf schloss das Kind die Augen. Die Kurve auf dem EKG, an das das Mädchen angeschlossen war, wurde schwächer und bald darauf nur noch eine Linie. Der Apparat piepte warnend, wurde aber sofort zum Schweigen gebracht. Dieser Tod war beabsichtigt. Dem Gesetz war Folge geleistet worden.
Die Haustür fiel ins Schloss. Das Geräusch war scharf wie ein Schuss. Erschöpft lehnte die junge Frau sich gegen das kühle Metall und schloss für einen Moment die Augen.
Dann, als nehme sie die Kälte eben erst wahr, stieß sie sich wieder von der Tür ab und zog fröstelnd die Schultern hoch.
Die Kälte, die Leslie Evans befallen hatte, kam jedoch nicht von der Tür und war auch nicht durch das Reiben ihrer Arme zu lindern. Es war die Art von Kälte, die nach einem Tag, der gründlich falsch gelaufen war, in einem aufstieg. Es war die Kälte des Grauens.
Die dunkelhaarige Frau wischte sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und ging in die Küche, um den Wasserkocher einzuschalten.
Die Maschine sprang an und bald darauf begann das Wasser leise zu zischen und zu blubbern.
Leslie setzte sich derweil an den Küchentisch und rieb sich mit beiden Händen über das Gesicht. Sie fühlte sich weit erschöpfter, als es nach einer Schicht eigentlich der Fall sein sollte. Aber der Arbeitstag hatte ihr auch alles abverlangt.
Daran, dass sie als Ärztin manchmal Patienten verlor, hatte Leslie sich schon während des Studiums gewöhnen müssen. Dass es einen Kinderarzt meistens noch härter traf, weil die Patienten noch so jung waren, auch das war sie gewohnt. Aber es machte einen Unterschied, ob man Patienten verlor, weil man einfach nichts mehr für sie tun konnte, oder ob man sie verlor, weil man sie selbst tötete.
Es mochte ja Gesetz sein, aber das Wissen, dass sie gesetzestreu gehandelt hatte, vertrieb den angstvollen Blick des Kindes nicht aus ihrem Bewusstsein.
Mit einem Klacken signalisierte der Kocher, dass das Wasser heiß genug war. Und Leslie stand auf und goss das Wasser in eine Teetasse.
Während der Tee zog, durchmaß sie die geräumige Wohnküche mit großen, abgehackten Schritten. Sie wusste, dass sie versuchen musste, zur Ruhe zu kommen, aber sie war zu aufgeschreckt dafür.
Leslie wartete nur eben, bis der Tee fertig gezogen hatte, dann trank sie den ersten Schluck und verbrannte sich prompt die Zunge. Aber das war ihr gleich. Hauptsache, der schale Geschmack des falschen Lächelns verschwand. Sie spürte es immer noch in ihren Mundwinkeln, das verlogene, beruhigende Lächeln, das das Letzte gewesen war, was ein kleines Mädchen in seinem irdischen Leben gesehen hatte.
Wie auf Dauerschleife gestellt, hörte Leslie sich immer wieder sagen: „Keine Angst, Kleines, es wird alles gut!“
Nun, sie konnte sich eigentlich nichts vorwerfen, sie hatte keine andere Wahl gehabt, als das Kind zu euthanasieren. Zum einen war es Gesetz, zum anderen war die Kleine vergewaltigt worden. Das bedeutete, dass sie später höchstwahrscheinlich selbst übergriffig werden würde. Und die Polizei, die ihr das Kind gebracht hatte, würde auch sie überwachen, auch das war ihr wohl bewusst.
Aber das Wissen, nicht nur richtig, sondern auch gezwungenermaßen so gehandelt zu haben, nahm ihr nicht die Schuldgefühle.
Denn für das kleine Mädchen war nichts gut geworden. Die Spritze hatte dem Kind weder die Angst genommen, noch die Schmerzen, sondern ihm den Tod gebracht. Und es waren Leslies Hände gewesen, die die Spritze geführt hatten.
Stöhnend vergrub sie ihr Gesicht in den Händen. Warum mussten diese Bilder sie ständig verfolgen? Womit hatte sie das verdient?
Wieder sah sie die angstvoll aufgerissenen Augen des Mädchens vor sich. Ein blonder Engel, dem man die Unschuld so brutal geraubt hatte. Dieser Anblick allein zerriss einem ja schon das Herz, ohne, dass man auch noch selbst Hand an das Kind legen musste!
Gefangen in ihren düsteren Gedanken bemerkte Leslie gar nicht, dass noch jemand die Wohnung betreten hatte, bis eine besorgte Männerstimme die quälende Stille durchbrach: „Schatz, was ist los? Ist dir nicht gut?“
Leslie zuckte zusammen: „Rick! Ich hab gar nicht gehört, dass du reingekommen bist …“
Der hochgewachsene, sportliche Mann, der im Rahmen der Küchentür stand, trat hastig ein paar Schritte auf Leslie zu: „Was hast du denn? Du bist ganz bleich!“
Leslie schluckte und rang den Drang zurück, aufzuspringen und sich in die Arme ihres Mannes zu werfen: „Nein … Alles in Ordnung … Ich musste heute nur ein Kind behandeln und …“ Sie brach ab. Das alles in Ordnung hatte zwar nur implizieren sollen, dass sie körperlich unversehrt war, aber es erschien ihr so falsch, diese Worte auszusprechen. Was war denn schon in Ordnung, wenn man ein Kind getötet hatte?
Rick verstand jedoch auch so, was sie sagen wollte. Er trat noch einen Schritt näher und legte einen Arm um sie: „Oh Schatz, das tut mir so leid!“
Leslie biss sich auf die Lippen. Ricks Mitleid brachte sie beinahe aus der Fassung. Doch zugleich ärgerte es sie auch. Wieso hatte man Mitleid mit ihr? Sie hatte das Kind doch getötet!
„Rick … ich … scheiße!“ Die Tränen ließen sich nun doch nicht länger zurückhalten.
Rick setzte sich neben sie auf die Bank, nahm sie in den Arm und drückte sie fest an sich: „Schon gut, lass es raus!“ Seine Stimme war leise und besorgt und seine liebevollen Berührungen taten Leslie gut.
„Verdammt, warum?“, würgte sie schließlich hervor. „Warum müssen die Kinder sterben?“
Rick streichelte ihr Haar: „Weil sonst noch mehr Menschen sterben müssen, Leslie! Ein schwacher Trost, ich weiß, aber mehr kann ich dir leider auch nicht sagen!“
Er meinte es gut. Aber seine Worte ärgerten Leslie trotzdem. Er sorgte sich immer noch nur um sie, nicht darum, dass Tag für Tag so viele Kinder sterben mussten!
Leslie machte sich los, obwohl sie sich eigentlich immer noch nach Nähe sehnte. Aber sie ertrug sie zugleich gerade auch nicht. „Rick … bitte, ich brauche ein bisschen Zeit für mich!“
Rick trat zurück: „Ist gut … Ich bin nebenan, wenn du mich brauchst. Versprich mir, dass du mich rufst, sobald du dich noch schlechter fühlst, okay?“
Leslie nickte matt, Rick küsste sie auf die Stirn und verließ die Küche.
Und Leslie lehnte sich zurück und schloss die Augen. Sie sollte Rick rufen, sobald es ihr noch schlechter ging? War das überhaupt möglich?
Ein bitteres Lächeln zuckte um ihre Mundwinkel. Wie konnte ein Mann, der als Chirurg tagtäglich Leben rettete, nicht verstehen, wie nahe es ihr wirklich ging, dass sie Kinder umbringen musste?
Für einen Moment stieg Neid in Leslie auf. Es war nicht gerecht! Rick rettete Leben, erntete dafür dankbare Blicke und musste, wenn überhaupt, damit klarkommen, dass seine Kunst versagt hatte, wenn ein Mensch starb. Und sie selbst, die sich um Kinder kümmerte, um jene Menschen, die die dezimierte Weltbevölkerung so dringend brauchte, um fortbestehen zu können, musste nicht nur hin und wieder die Hilflosigkeit erleben, nichts tun zu können, sondern diese kleinen Menschen auch aktiv umbringen!
Sie rang diesen Neid jedoch wieder nieder. Rick hatte es nicht verdient, dass sie ihm die Schuld daran gab, dass es ihr schlecht ging! Er hatte das Gesetz, das Ärzte dazu zwang, Kinder, die Gewaltopfer geworden waren, zu euthanasieren, nicht vorgeschlagen, nicht unterschrieben und auch sonst nicht unterstützt. Es wäre nicht gerecht gewesen, ihn stellvertretend für die Politik schlecht zu behandeln.
Aber er würde es auch nicht verstehen, dass mit jeder neuen Euthanasie die Angst ihre Klauen tiefer in Leslie schlug. Sie und Rick wünschten sich Kinder. Würden sie aber nun eines haben, würde sie für dieses dann die Mutter sein können, die ein Kind verdient hatte? War es nicht Doppelmoral und widerlich, wenn sie auf der einen Seite einem Kind die liebevolle Mutter war und auf der anderen Seite andere umbrachte, die einfach nur das Pech hatten, die falschen Verwandten zu haben, oder zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein?
Sie stand auf und trat ans Fenster. Ihr Blick schweifte über den kleinen Garten. Bis vor einigen Jahren wäre die Blumenpracht darin für sie unerschwinglich gewesen. Doch dann hatte es Firmen gegeben, die die Sehnsüchte der Menschen sehr wohl erkannt hatten und seither mit Hochdruck daran arbeiteten, Blumensamen wieder zu einem erschwinglichen Preis züchten zu können.
Und Leslie liebte diesen Garten. War sie ehrlich, war ihr das Haus völlig egal gewesen, als Rick und sie es vor zwei Jahren gekauft hatten. Sie hatte sich nach der Besichtigung nicht einmal mehr daran erinnern können, wie das Gebäude ausgesehen hatte. Sie hatte nur den üppig blühenden Garten gesehen und gewusst, dass er das Haus zehnmal aufwiegen würde, selbst wenn es sich als Bruchbude entpuppen sollte. Der Garten gab ihr die Ruhe zurück, die ihr in ihrem Job so oft abhandenkam. Er war das Einzige, was an Tagen wie diesem nicht stumpf und grau wurde. Auch jetzt zauberte er ihr ein Lächeln auf das Gesicht.
Leslie öffnete die Hintertür und trat hinaus. Blumenduft umfing sie. Langsam schritt sie den kleinen Weg zwischen den Beeten entlang und setzte sich dann auf die Hollywoodschaukel, die Rick ihr zu ihrem letzten Geburtstag geschenkt hatte. Sie schloss die Augen, atmete tief die vom Blumenduft gesättigte Luft ein und versuchte, zur Ruhe zu kommen.
Sie bemerkte beinahe nicht, dass Rick ebenfalls herausgekommen war. Erst, als er sich neben sie setzte und damit die Schaukel zum Schwingen brachte, bemerkte sie ihn.
Doch was auch immer er hatte sagen wollen, es blieb ungesagt, denn ein schrilles Piepsen zerriss die Stille: Ricks Pager. Er stieß einen halblauten Fluch aus, warf einen Blick auf das Display und fluchte lauter: „Eine Massenkarambolage, viele Verletzte, das wird eine lange Nacht für mich, Schatz! Und ich muss los!“
Er küsste Leslie rasch zum Abschied und eilte davon.
Leslie blieb sitzen und fragte sich, ob das, was sie empfand, Erleichterung oder Enttäuschung war.
Kapitel 2
„Ich weiß einfach nicht, was ihm fehlt, er weint dauernd und ist unruhig!“ Die Frau sah Leslie hilflos an.
Diese betrachtete den Jungen genauer. Er war gut genährt und wirkte nicht wirklich krank, aber er quengelte auch, als sie ihn hochnahm. Sie wandte sich wieder an die Mutter: „Wie alt ist er denn jetzt? Vier Monate, nicht?“
Die Frau nickte.
Leslie wandte sich wieder dem Kind zu und sah ihm in den Mund. Das Zahnfleisch war geschwollen, und als sie mit dem Finger vorsichtig über den Kiefer strich, spürte sie die durchbrechenden Zähne. Sie nickte und sah die besorgte Mutter an: „Sie müssen sich keine Sorgen machen, Jimmy bekommt Zähne. Das tut weh, deshalb ist er gereizt.“
„Jetzt schon?“, fragte die Frau erstaunt. „Ich dachte, das kommt erst mit sechs Monaten!“
„Die Zähne fangen an, durchzubrechen, wenn das Kind ungefähr drei Monate alt ist. Und dann kommen sie schubweise. Das ist wie mit dem Wachsen, bei einigen Kindern geht es schneller als bei anderen. Jimmy ist einfach ein bisschen früher dran als der Durchschnitt“, erklärte Leslie lächelnd. „Sonst ist alles in Ordnung.“
Die Frau atmete auf. „Wissen Sie, Jimmy war immer so ruhig und lieb, da habe ich mir einfach Sorgen gemacht, als er ständig weinte!“
Leslie nickte: „Das ist verständlich und nur gut! Es heißt ja, dass Sie Jimmy aufmerksam beobachten, dass es Ihnen auffällt, dass er sich anders verhält als sonst. Und das ist die beste Gesundheitsvorsorge, die ein Kind haben kann!“ Sie lächelte aufmunternd. Vor allem ältere Mütter hatten ständig Angst, etwas falsch zu machen und außerdem war es ihnen peinlich, wenn sie wegen harmloser Dinge zum Arzt gingen. Das hatte Leslie schon oft beobachtet und so bemühte sie sich, der Mutter ihres kleinen Patienten einen Teil ihrer Besorgnis zu nehmen.
Die Frau zog dem Baby wieder das Jäckchen an, während Leslie die Diagnose in den Computer eingab. Als die Frau Jimmy wieder in seine Trage gelegt hatte und das Behandlungszimmer schon verlassen wollte, hielt Leslie sie noch einmal auf: „Beißringe aus Gummi helfen häufig gegen die Schmerzen im Zahnfleisch. Und das Zahnen ist Schwerarbeit, es kann sein, dass Jimmy ein wenig fiebrig wird, weil sein Immunsystem arbeitet. Das ist kein Grund, sich Sorgen zu machen, solange es bei leichtem Fieber bleibt.“
Die Frau nickte und verabschiedete sich und Leslie blieb für einen Moment an ihrem Schreibtisch sitzen. Sie liebte ihren Beruf dafür, dass sie für so viele Menschen etwas tun konnte. Aber manchmal gab es Momente, in denen sie es hasste, ständig an ihre eigene Kinderlosigkeit erinnert zu werden.
Es war für sie Erfüllung und Folter zugleich, als Kinderärztin zu arbeiten. Aber aufzuhören kam für sie nicht infrage. Sie hatte ein Händchen für Kinder, das sagten alle. Und die Kinder brauchten sie! Umso mehr, wenn es ans Sterben ging. So sehr sie es hasste, sie konnte die Kleinen so beruhigen, dass sie wenigstens bei ihrem Tod nicht auch noch litten.
Hastig sprang Leslie auf, um den nächsten Patienten hereinzuholen. Diese Gedanken konnte sie nun wirklich nicht gebrauchen!
Da öffnete sich die Tür ihres Sprechzimmers und ihre Kollegin Helen steckte den Kopf herein: „Leslie, kannst du vielleicht meine kleine Patientin übernehmen? Sie hat Angst vor Spritzen und ich bekomme sie einfach nicht beruhigt!“
Leslie nickte: „Ich kann’s versuchen. Übernimmst du dann hier?“
„Du bist ein Schatz, Leslie! Danke!“ Erleichtert wandte Helen sich dem Stapel an Patientenakten zu, die auf Leslies Schreibtisch lagen.
Und Leslie steuerte ein weiteres Sprechzimmer am Ende des Ganges an.
Die athletische, quirlige Helen besaß ein großes Wissen über Krankheiten, aber es fiel ihr schwer, die Ruhe auszustrahlen, die ein ängstliches Kind brauchte.
Leslie ahnte schon, wo das Problem lag. Meistens waren es gar nicht die Kinder, die sich wirklich vor den Spritzen fürchteten. Es waren viel häufiger die Eltern, die Angst davor hatten, dass ihre Kinder Angst hatten. Und wenn das geschah, übertrug sich die Angst auf die Kinder. Die Eltern zu beruhigen, war häufig schon die halbe Miete.
Als sie das Sprechzimmer betrat, sah sie ihre Vermutung bestätigt. Das Mädchen, das sich scheu an seine Mutter gekuschelt hatte, wirkte nicht halb so hilflos wie die junge Frau, die versuchte, ihre Tochter zu trösten.
„Guten Tag!“, grüßte Leslie. „Ich bin Leslie Evans, meine Kollegin hat mich gebeten, hier zu übernehmen.“ Sie achtete darauf, dass sie nicht helfen sagte. Die Frau musste das Gefühl bekommen, selbst Herrin der Lage zu sein.
Dann sah sie zu der Kleinen. „Hallo, wie heißt du denn?“
Das Mädchen drehte den Kopf weg und Leslie bemerkte, dass die Mutter Luft holte, um ihre Tochter vorzustellen, weshalb sie schnell fortfuhr: „Ich bin mir ganz sicher, dass du mir das sagen kannst.“
Dieser einfache Satz führte dazu, dass das Mädchen sie zunächst ein wenig verwirrt ansah und dann murmelte: „Liza.“
„Liza? Ein schöner Name! Setzt du dich bitte da drüben hin?“, sie deutete auf die Behandlungsliege.
Liza schüttelte heftig den Kopf und verschwand hinter ihrer Mutter: „Ich will keine Spritze!“
Leslie machte nicht den Fehler, dem Kind in seinen Rückzugsbereich zu folgen. Sie fischte stattdessen eine Einwegspritze aus dem Kasten an der Wand und hielt sie dem Mädchen hin: „Schau mal, Liza, magst du dir die Spritze hier mal ansehen?“
Liza schwieg, aber Leslie sah, dass das Kind den Hals reckte. „Die kannst du ruhig in die Hand nehmen, Liza“, ermutigte sie das Mädchen noch einmal und wurde damit belohnt, dass sich die Kleine Zentimeter für Zentimeter hinter der Mutter hervortastete.
Endlich griff das Mädchen vorsichtig nach der Spritze und betrachtete sie eingehend von allen Seiten. Es entdeckte, wie man diese aufzog, und erfreute sich eine Weile an dem leisen Plopp, das erklang, wenn die in der Spritze eingesogene Luft auf einmal herausgedrückt wurde.
Leslie ließ Liza Zeit, ehe sie nach einem Wattetupfer griff und ihn mit Desinfektionsmittel befeuchtete. „Das ist jetzt ein bisschen kalt“, informierte sie das Mädchen und desinfizierte die Stelle an Lizas Arm, an der sie die Spritze ansetzen wollte.
Liza kicherte. „Das kitzelt!“
Erleichtert zog Leslie die Spritze auf. „Okay, das piekst ein bisschen, aber das ist nicht schlimm.“
Liza nickte nur und beschäftigte sich erneut damit, die Spritze genauer zu betrachten. Sie zuckte kaum, als Leslie den Impfstoff injizierte. „Super, ganz tapfer!“, lobte Leslie das Kind und bedeckte den einzelnen Blutstropfen mit einem bunten Pflaster. „Du hast es geschafft, Liza!“
Sie lächelte die Mutter an, die ihre Tochter erleichtert an der Hand nahm. Liza hatte jetzt gespürt, dass Spritzen nichts Schlimmes waren, sie würde vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr ganz so ängstlich sein, aber das hing auch von ihrer Mutter ab. Wenn sie es geschafft hatte, dieser die Furcht zu nehmen, würde Liza auf jeden Fall ruhiger sein.
Leslie atmete kurz durch, zog das rutschende Haargummi wieder stramm und trat dann auf den Flur hinaus, um den nächsten Patienten aufzurufen.
„Tante Leslie!“ Eine helle Kinderstimme hallte durch den Flur und ein kleines, rothaariges Mädchen mit wilden Locken rannte auf sie zu.
Unwillkürlich lächelte Leslie. „Hi, Kayleigh!“
„Sie wollte dich unbedingt besuchen“, erklärte Leslies Schwester Annie, die hinter ihrer Tochter herkam.
Leslie lächelte. „Das ist aber lieb von dir, Kayleigh. Ich habe nur leider nicht viel Zeit, heute ist viel los hier.“
Kayleigh zog eine enttäuschte Schnute. „Kommst du dann wenigstens am Wochenende?“
Leslie nickte. „Wenn es keinen Notfall in der Klinik gibt, dann ja.“ Sie wandte sich an ihre Schwester: „Bei euch sonst alles klar?“
Annie nickte. „Ich denke doch.“
Diese Antwort beruhigte Leslie sehr, denn sie wusste, dass ihre Schwester sich oft überfordert fühlte. Sie war noch beinahe zu jung für ein Kind gewesen, als sie schwanger geworden war. Dass ihr damaliger Freund sie sitzen gelassen hatte, als sie ihm erklärt hatte, schwanger zu sein, hatte ihrem Selbstbewusstsein nicht gerade zu neuen Höhenflügen verholfen. Und ihr Job als Büroangestellte tat das auch nicht, denn sie war nicht mehr als ein ersetzbares Rädchen im Getriebe eines großen Betriebs. Leslie machte sich deshalb immer wieder Sorgen um sie.
Kayleigh war ein lebhaftes, liebes Kind und das hatte Leslie insofern beruhigt, als dass Annie nicht völlig überfordert war, aber Kayleighs Lebhaftigkeit war manchmal einfach zu viel für Annie. Nicht zuletzt deshalb bemühte sich Leslie, an den Wochenenden dafür zu sorgen, dass Kayleigh sich ein wenig austoben konnte.
Sie nickte ihrer Schwester noch einmal zu, dann rief jemand ihren Namen und sie konnte nur noch winken und eilte zu dem Sprechzimmer, aus dem sie gerufen worden war.
In dem Sprechzimmer war kein Patient, sondern nur ihre Stationsärztin Josie Richmond, die Leslie prüfend musterte, als sie eintrat. „Wie geht’s?“
„Ganz gut.“ Leslie fragte sich, was Josie von ihr wollte, denn es war nicht die Art ihrer Vorgesetzten, Smalltalk zu halten.
„Sicher? Mir ist beim Durchgehen der Akten gestern aufgefallen, dass man dir in letzter Zeit einiges aufgeladen hat. Auch unangenehme Fälle. Und da wollte ich sichergehen, dass es dir nicht zu viel wird.“
Leslie zuckte zusammen. Unangenehme Fälle, das hieß übersetzt getötete Kinder. Darüber wollte sie nicht nachdenken!
Aber Schonung bei unangenehmen Themen gab es bei Josie nicht. Sie hatte ihr Medizinstudium noch im Krieg als Militärärztin absolviert und die Schonungslosigkeit der alten Soldatin war ihr geblieben. Kurz vor der Rente stehend hatte Josie immer noch mehr Energie als die meisten ihrer jüngeren Kollegen. Und im Krankenhaus war sie auch eine feste Größe, deren Fachwissen bei schwierigen Fällen auch von Ärzten anderer Fachrichtungen eingeholt wurde.
Sie stellte eine Autorität dar, das hieß für Leslie jedoch, dass sie sich nicht um eine Antwort auf Josies Worte drücken durfte. „Mir geht es wirklich gut. Angenehm werden diese Fälle nie sein, Josie!“
Die Ältere schnaubte. „Natürlich nicht. Ich will von dir einfach nur wissen, ob du dir nicht zu viel auflädst. Nicht, dass ich nicht verstehen würde, warum du das tust, aber darum geht es schließlich auch nicht.“
Leslie schüttelte den Kopf. „Mache ich nicht!“
Josie zog die Augenbrauen hoch, erwiderte aber nichts weiter, sondern verabschiedete sich.
Und Leslie wusste, dass ihrer Vorgesetzten klar war, dass Leslie sie angelogen hatte. Jede einzelne Euthanasie war zu viel für eine Ärztin wie Leslie, der ihr Beruf die Welt bedeutete. Aber um der Kinder willen verbot sie sich, eine Euthanasie zu verweigern, wie es ihre Kollegen bisweilen taten, wenn sie glaubten, das Limit erreicht zu haben.
„Das war schön, Tante Leslie, können wir das bald wieder machen?“ Kayleigh hatte zerkratzte Knie und Ellbogen, aber sie strahlte. Leslie hatte mit ihr an diesem Tag eine Geländetour gemacht und ihr all die Plätze gezeigt, an denen die Mutproben ihrer eigenen Kindheit stattgefunden hatten. Zusammen waren Tante und Nichte durch enge Felstunnel gekrochen, steile Hänge hinaufgeklettert und hatten die Aussicht von den Hügeln genossen.
Kayleigh war zerkratzt und müde, aber sie war auch restlos glücklich. Und Leslie spürte zwar Muskeln, von denen sie ohne den Anatomieunterricht im Studium gar nicht gewusst hätte, dass sie an dieser Stelle lagen, aber sie vibrierte geradezu vor Lebendigkeit.
„Wenn es nicht regnet und deine Mutter nichts dagegen hat, können wir das nächstes Wochenende gerne noch einmal machen“, sagte sie und zwinkerte Kayleigh zu.
Annie zuckte zusammen, nickte dann aber. Sie hatte Angst um ihre Tochter ausgestanden, das wusste Leslie sehr gut. Aber ein Kind wie Kayleigh ließ sich nun einmal nicht einsperren.
Annie schickte Kayleigh ins Bett und die beiden Schwestern setzten sich auf die Terrasse, um den lauen Abend zu genießen. Doch Leslie fiel auf, dass ihre Schwester etwas bedrückte. „Annie, was ist los? Du schaust so bekümmert.“ Erneut machte sich Besorgnis in Leslie breit. Ihre Schwester kämpfte nicht selten mit Selbstzweifeln. Seit Kayleighs Vater sie auf unschöne Weise verlassen hatte, war Annies Selbstbewusstsein dahin.
Annie seufzte. „Wenn ich Kayleigh sehe, wie sie von den Ausflügen mit dir zurückkommt, frage ich mich, ob ich nicht eine lausige Mutter bin …“
Leslie lehnte sich ein wenig vor, um ihrer Schwester in die Augen sehen zu können. „Das bist du ganz sicher nicht, Annie! Du bist anders als Kayleigh, aber das macht dich auf keinen Fall zu einer schlechten Mutter.“
Annie rang sich ein Lächeln ab: „Ich habe manchmal das Gefühl, dass du auch mein Leben meistern musst, Leslie.“
„Quatsch! Annie, nur weil du nicht die gleiche Draufgängerin bist wie ich manchmal, heißt das doch nicht, dass du dein Leben nicht im Griff hast.“
Leslie wollte es nicht zeigen, aber die Worte ihrer Schwester erschreckten sie. Annie hatte manchmal Phasen, in denen sie an allem und jedem zweifelte, aber dass sie so davon überzeugt war, ihr eigenes Leben nicht mehr im Griff zu haben, geschah selten. War etwas vorgefallen?
„Annie, ist auf der Arbeit irgendwas passiert, oder hat dich wieder mal jemand angegraben?“, fragte Leslie vorsichtig nach. „Du machst den Eindruck, dich im nächsten Loch verstecken zu wollen!“
Annie schüttelte den Kopf und stand auf. Sie lehnte sich gegen das Geländer der Terrasse: „An sich ist alles in Ordnung. Ich weiß, es ist seltsam, dass ich mich so verhalte, aber es ist einfach so, dass mich die letzten Tage nachdenklich gemacht haben …“
„Warum denn?“
Annie sah sie an und Leslie erschrak über die Mutlosigkeit in ihren Augen: „Kayleigh hat aus der Schule wieder einmal die Bilder mitbekommen, die die Kinder malen mussten und unter anderem gab es ein Bild zum Thema Was ich einmal werden will und das hat mich eben wieder daran erinnert. Weißt du, Kayleigh redet schon seit Jahren ständig davon, dass sie auch einmal Ärztin werden will, am liebsten Kinderärztin, wie du. Sie spielt mit ihren Freunden immer Doktorspiele und ist dabei immer die Ärztin … Sie bewundert dich! Und ich frage mich, ob ich ihr genügen kann … Jetzt natürlich noch, aber später, wenn sie älter wird, wird ihr dann die kleine Büroangestellte, die nicht einmal die Beziehung mit dem Kindsvater aufrechterhalten konnte, genügen?“
Leslie bekam ein schlechtes Gewissen. Dass sie Kayleigh verwöhnte, wusste sie selbst. Dass ihre Nichte bewundernd zu ihr aufsah, auch. Aber dass das Annie so zu schaffen machte, hatte sie nicht bemerkt!
Sie fasste nach der Hand ihrer Schwester: „Annie, du bist Kayleighs Mutter und du wirst das immer bleiben! Warum solltest du ihr nicht genügen? Konflikte gibt es immer, aber das heißt doch nicht, dass du nicht genügst … Und ich bin Kayleighs Tante, ich verwöhne sie, das weiß ich. Aber dafür sind Tanten schließlich da und nicht die Mütter …“
Annie seufzte. „Ich weiß … Aber manchmal glaube ich trotzdem, dass da etwas falsch gelaufen ist. Ich wollte gar nicht schwanger werden und Kayleighs Geburt war für mich mehr ein Schock denn etwas anderes. Und du wünschst dir seit Jahren verzweifelt ein Kind und bekommst keines …“
Leslie schluckte. Mit den letzten Worten hatte ihre Schwester voll ins Schwarze getroffen. Dass ihre wachsende Verzweiflung darüber, einfach nicht schwanger zu werden, ihrer Schwester nicht verborgen geblieben war, damit hatte Leslie gerechnet. Annie besaß zwar kein großes Selbstbewusstsein, aber sie hatte schon immer sehr feine Antennen gehabt.
Leslie lehnte sich neben sie an das Geländer, so dicht, dass sich ihre Schultern berührten: „Annie, das hat nichts miteinander zu tun. Du darfst kein schlechtes Gewissen haben, weil ich nicht schwanger werde! Du kannst doch nichts dafür! Und du bist keine schlechte Mutter für Kayleigh, glaub mir das.“
Glaubte Annie ihr? Leslie konnte es nicht wirklich erkennen. Aber immerhin blickte ihre Schwester nicht mehr ganz so mutlos drein. „Danke.“
Den restlichen Abend sprachen sie über Belangloses. Annies Zweifel wurden von beiden nicht mehr erwähnt. Aber Leslie grübelte unablässig darüber nach. Was quälte ihre Schwester wirklich? War es das Gefühl, als Mutter nicht zu genügen? War es Neid, weil Leslie als erfolgreiche Kinderärztin mehr Aufmerksamkeit bekam? War es Angst, ihre Tochter an die Schwester zu verlieren?
Leslie wusste es nicht, aber sie nahm sich vor, in nächster Zeit sehr genau auf das zu achten, was ihre Schwester sagte. Annie sollte nicht das Gefühl haben müssen, dass sie als Mutter nicht genügte und sie sollte erst recht nicht das Gefühl haben müssen, dass Leslie Kayleigh zu sich locken wollte, nur weil sie das Mädchen verstand und verwöhnte, wie eine kinderlose Tante es eben tat.
Kapitel 3
Leslies Hände zitterten, als sie die Verpackung aufriss und das ärgerte sie. Warum machte sie so viel von einer Schwangerschaft abhängig? Sie war noch jung genug, dass es durchaus noch klappen konnte, auch wenn sie jetzt wieder nicht schwanger war.
Warum hatte sie eigentlich einen Schwangerschaftstest gekauft, wenn sie doch genau wusste, dass sie ein erneut negatives Ergebnis kaum verkraften würde und deshalb auch gar nicht wissen wollte?
Leslie atmete tief durch. Brachte es etwas, wenn sie sich der Gewissheit verweigerte? Es gab eben Dinge im Leben, bei denen es nur Ja oder Nein gab und an denen man nicht rütteln konnte!
Entschlossen riss sie die Verpackung endgültig von dem Stäbchen ab und tauchte es in den Becher, in dem sie Urin aufgefangen hatte. Ihre Hand zitterte schlimmer als die eines Rauchers auf Nikotinentzug.
Während sie einige Sekunden verstreichen ließ, zwang sie sich, das Stäbchen nicht anzusehen.
Ihr Herz schlug so hart, dass es richtiggehend wehtat. Das war keine Nervosität mehr, das war Angst. Leslie schüttete den Becher aus, spülte und legte den Teststreifen weg. Sie konnte ihn nicht ansehen!
Sie ging ins Wohnzimmer, setzte sich auf das Sofa und versuchte, ihr wild schlagendes Herz zu beruhigen. Wovor ängstigte sie sich denn so? Wenn sie schwanger war, würde auch der Blick auf den Teststreifen nichts daran ändern. Und wenn sie nicht schwanger war, hatte sie ohnehin nichts verloren.
Sie erhob sich und ging dann doch wieder am Badezimmer vorbei in den Garten. Vielleicht würde sie dort ruhiger werden.
Als Rick nach Hause kam, saß Leslie immer noch in der Hollywoodschaukel und schimpfte stumm mit sich selbst.
Rick suchte ihren Blick. Er fragte nicht, aber Leslie las die stumme Frage in seinem Blick. „Ich weiß es nicht …“, sagte sie leise. „Ich habe mich nicht getraut, das Ergebnis anzuschauen.“ Gute Güte, ihre Stimme klang so schwach und piepsig, wie die einer hilflosen Jungfer, die gerade von einem strahlenden Helden gerettet werden musste! Das war doch nicht sie!
Rick setzte sich zu ihr und nahm sie in den Arm. „Schatz, mach dich doch damit nicht so fertig! Ich liebe dich nicht weniger, wenn es nicht klappt.“
Leslie versuchte zu lächeln, doch es wurde nur eine klägliche Grimasse daraus. „Aber ich hasse mich dann …“ Sie wusste selbst nicht, ob es hatte scherzhaft klingen sollen oder nicht, aber es klang definitiv sehr ernst.
Ernst genug, dass Rick sie fester an sich zog: „Leslie, bitte, das darfst du nicht sagen!“
„Ich meine es aber so, Rick!“, erwiderte Leslie. „Ich weiß, das verstehst du nicht, aber ich wünsche mir einfach nichts mehr als das.“
Rick streichelte ihr über das Haar: „Leslie, ich wünsche mir auch ein Kind, aber ich würde niemals dich dafür verantwortlich machen, wenn es nicht klappt. Und du darfst das auch nicht. Du kannst doch nichts dafür.“
Leslie seufzte. Sie wusste ja, dass Rick versuchte, ihr Mut zu machen und ihr zu verstehen geben wollte, dass er sie liebte, wie sie war, ohne Ansprüche zu stellen. Aber wie konnte sie das beruhigen, wenn sie an sich selbst eben Ansprüche stellte?
„Rick … Kannst du vielleicht für mich nachsehen? Ich schaff es nicht!“
Rick nickte. „Wenn du das möchtest, tue ich das. Aber bist du sicher, dass ich es vor dir wissen soll?“
Leslie nickte. Sie hatte an diesem Tag zur Genüge ausgetestet, dass sie den Schneid nicht hatte, sich den Schwangerschaftstest anzusehen.
Rick stand auf. „Im Badezimmer?“
Leslie nickte erneut.
Kurze Zeit später kam Rick wieder heraus. Den Teststreifen hielt er so, dass seine Hand ihn fast völlig verbarg. „Sollen wir nicht zusammen nachsehen, wie das Ergebnis ist?“
Leslie war ihm dankbar dafür, dass er versuchte, ihre Angst zu verstehen. Und so nickte sie.
Rick setzte sich wieder neben sie und legte einen Arm um ihre Schultern. Das gab ihr ein wenig Halt. Und doch, als Rick den Teststreifen umdrehte, um das Ergebnis zu präsentieren, flohen Leslies Blicke wieder gen Horizont.
Erst, als sie Ricks Aufschrei hörte, wagte sie es, einen Blick zu riskieren. Klar und deutlich sichtbar prangten zwei Streifen auf dem Teststreifen. Zwei Streifen! Positiv!
Ihr Herz setzte für einen Moment aus, um dann umso heftiger weiterzuschlagen und Tränen schossen ihr in die Augen. Sie konnte ihrer Freude nicht wie Rick durch einen Schrei Ausdruck verleihen. Stumm lehnte sie sich gegen ihn und streckte die Hand nach dem Test aus.
Rick umarmte sie stürmisch. „Leslie! Der Test ist positiv! Wir bekommen Nachwuchs!“
Leslie lehnte stumm ihre Stirn gegen die seine. Endlich! Ihre stets wachsende Verzweiflung beim Anblick Schwangerer und anderer Mütter hatte ein Ende. Sie würde nun selbst Mutterglück erfahren dürfen.
Sie verbannte das medizinische Wissen aus ihrem Kopf, dass ein Schwangerschaftstest auch fälschlicherweise positiv sein konnte. Es durfte nicht sein, dass sie noch einmal enttäuscht wurde! Es musste einfach wahr sein!
Rick schwang sie einmal im Kreis: „Leslie, wir haben es wirklich geschafft!“
Leslie nickte. „Ich weiß nur nicht, was ich sagen soll, Rick. Es ist so wunderbar, dass ich keine Worte dafür habe.“ Sie schmiegte sich wieder an ihren Mann, der ihr die Tränen abwischte. So entspannt und glücklich hatte sie schon lange nicht mehr sein dürfen.
Zweifel, Ängste und all die negativen Gefühle, die werdende Eltern bisweilen überfielen, hatten an diesem Abend keine Macht über Leslie.
„Annie, der Test war positiv, ich bin endlich schwanger!“
Es war zwar schon spät am Abend, aber Leslie hatte ihrer Schwester unbedingt noch mitteilen müssen, welches Glück ihr zuteilgeworden war.
„Ich freue mich für dich, Leslie. Wenn ich es jemandem gönne, dann dir.“ Auch Annie klang nicht nur freudig überrascht, sondern schien die Zufriedenheit, die über Leslie gekommen war, zu teilen.
„Ich werde morgen meinen Kollegen so auf die Nerven gehen!“ Leslie bemerkte selbst, wie überdreht sie war. „Ich werde es ihnen nämlich dauernd erzählen!“
Annie lachte. „Deine Kollegen sind Kinderärzte, wenn die dich nicht verstehen können, wer dann?“
„Da hast du auch wieder recht.“
„Hör mal, Leslie, ich würde echt gerne noch länger mit dir telefonieren, aber ich muss morgen wieder um halb fünf raus und habe gestern Nacht schon viel zu wenig geschlafen.“
„Dann gute Nacht, Annie. Ich will dich bestimmt nicht vom Schlafen abhalten.“
„Gute Nacht, Leslie. Und genieß das Gefühl, bis die Morgenübelkeit kommt.“
Morgenübelkeit war etwas, das Annie unheimlich gequält hatte. Aber an solche Dinge konnte und wollte Leslie noch nicht denken. Sie schwebte wie auf Wolken.
„Leslie, du bist heute so gut gelaunt, hast du einen Topf voller Gold gefunden, oder wie?“ Helen lachte und stieß sie freundschaftlich an. Es war ihr nicht entgangen, dass Leslie schon den ganzen Morgen vor sich hinsummte.
„Nein, nur ein Goldstück“, lachte Leslie und legte eine Hand auf ihren Bauch.
Helen, die in einer kinderreichen Familie aufgewachsen war, entging diese Bewegung nicht. „Soll das heißen, du bist schwanger?“
Leslie nickte.
Helen quietschte begeistert und umarmte sie. „Herzlichen Glückwunsch! Wie toll ist das denn!“
In diesem Moment streckte Josie den Kopf zur Tür herein: „Was ist denn hier los?“
„Leslie kriegt ein Baby!“, platzte Helen heraus, noch ehe Leslie selbst etwas sagen konnte.
Josie reagierte daraufhin nicht halb so überschwänglich wie Helen, aber das hätte Leslie auch mehr als nur verwundert. Sie klopfte Leslie nur auf die Schulter: „Herzlichen Glückwunsch! Auch wenn ich sagen muss, dass es mir gar nicht passt, dich als Kollegin zu verlieren.“
„Noch bin ich ja im Dienst, Josie“, erwiderte Leslie. „Und außer den hochinfektiösen Sachen kann ich alles machen.“
Josie lachte. „Na das will ich doch hoffen! Wir brauchen dich bei den ängstlichen Patienten.“
Die nächsten Tage vergingen für Leslie wie im Traum. Sie schien zu schweben. Kein Kind konnte sich ihrer veränderten Ausstrahlung entziehen und ebenso wenig die Eltern.
Sie verbrachte die Wochenenden mit Kayleigh und schien dabei endlose Energie zu haben. Sie schaffte es sogar, dass Kayleigh vor ihr schlappmachte.
Rick und sie verhielten sich wieder wie Jungverliebte. Der Alltag, der Leslie bisweilen erschöpft und lustlos gemacht hatte, vermochte ihr nun nichts mehr anzuhaben. Es war, als habe sie mehr Energie, als sie jemals in ihrem Leben besessen hatte.
Kapitel 4
Ein Druck auf den Lichtschalter erweckte die Deckenlampe zu sekundenlangem Flackern, bis sie sich doch dazu entschied, dauerhaft zu leuchten. Ein Glück, es gab nur wenig, das beim Arbeiten mehr störte als eine flackernde Lampe. Gordon Taylor setzte sich an seinen Arbeitsplatz.
Von außen betrachtet war das Redaktionsgebäude der New Union Times ein imposanter Bau mit seiner verglasten Front voller Zitate berühmter Persönlichkeiten. Aber in den muffigen Büros vieler Journalisten war die Moderne nicht angekommen. Auch in seinem eigenen Büro nicht. Er legte zwar, im Gegensatz zu manchen seiner Kollegen, Wert auf regelmäßiges Lüften und rauchte auch nicht, aber seiner Lampe sah man mittlerweile die vielen Leuchtstunden an. Er würde demnächst wohl die Leuchtstoffröhre wechseln müssen.
Gewaltsam richtete Gordon Taylor seine Gedanken wieder auf die Arbeit. An Tagen wie dem heutigen hasste er sein Ressort. Gewiss, Politik war immer interessant, und anders als Journalisten, die in anderen Bereichen tätig waren, konnte er nie über ein Sommerloch klagen. Aber es gab Tage, da musste man über Dinge schreiben, die einem zutiefst verhasst waren. Und es gab Tage, da hätte Gordon am liebsten bösartige Polemik zu Papier gebracht. Dass er es nicht tat, war nur der Tatsache geschuldet, dass er sich als relativ vernünftig betrachtete.
Politik lebte von Jahrestagen, zumindest teilweise. Und wäre es der Jahrestag des Kriegsendes gewesen, hätte er gerne darüber geschrieben. Auch über das Regierungsjubiläum von Präsident Silas Lowell hätte er noch etwas zustande gebracht, ohne zu murren. Aber darüber schreiben zu müssen, dass das Gewaltschutzgesetz seit zwanzig Jahren in Kraft war, ohne darüber zu schreiben, wie dieses Gesetz Familien zerstörte und Menschen brach, war von einem Journalisten, der seinen Beruf ernst nahm, viel verlangt. Von einem Vater, dessen beide Kinder diesem Gesetz um ein Haar zum Opfer gefallen wären, war es jedoch mehr verlangt, als dieser zu geben bereit war.
Aber außer ihm hatte offensichtlich niemand den Mut, dieses Thema anzusprechen und schließlich war das auch die Möglichkeit, das Gesetz nicht als Normalität, gut und richtig betrachtet stehen zu lassen. Man konnte schließlich auch Kritik so verpacken, dass sie nicht offensichtlich war.
Noch einmal stand er auf, um sich an dem Automaten im Gang einen Kaffee zu holen, dann schloss er seine Bürotür und startete sein Schreibprogramm. Er würde den Artikel am besten schnell verfassen, ehe sich doch zu viel Bitterkeit einschlich.
Gordon schloss für einen Moment die Augen, atmete tief durch und begann zu schreiben. Er arbeitete schnell, Zeile um Zeile füllte sich. Und als einige Zeit später seine Kollegin aus dem Büro nebenan den Kopf durch die Tür streckte und fragte, ob sie kurz an seinen Computer dürfe, weil ihre Internetverbindung zusammengebrochen war und sie ihre Artikel abgeben musste, war Gordon Taylor mit seiner Arbeit ebenfalls fertig. Er bat die Kollegin, noch einen Moment zu warten, damit er seinen Artikel Korrektur lesen könne, und las noch einmal, was er geschrieben hatte.
Umstrittenes Jubiläum: Das GewSchG wird 20
Heute vor zwanzig Jahren trat ein Gesetz in Kraft, das in dieser Form noch nie zuvor existiert hat: das Gewaltschutzgesetz (GewSchG). Dieses Gesetz war und istjedoch nicht unumstritten. Kritiker bezeichnen es als unmenschlich und nutzlos. Befürworter halten dagegen, dass die Kriminalitätsrate seit dessen Einführung stetig gesunken ist.
Als vor fünfundzwanzig Jahren der Dritte Weltkrieg zu Ende ging und die Union sich bildete, waren die Erwartungen an die neue Generation der Machthaber hoch. Die Regierung um Silas Lowell sollte die völlig am Boden liegende Wirtschaft wieder aufrichten und auch den Menschen, die im Krieg Unaussprechliches erlebt hatten, Sicherheit bieten. Man kann sagen, dass die Regierung durchaus viel leistete, um nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern auch die Wurzel des Übels auszureißen. Wissenschaftler arbeiteten unter Hochdruck daran, Gründe für Gewalt zu finden. Ein Punkt wurde sehr bald deutlich: Gewalttäter hatten zu einem sehr hohen Prozentsatz selbst Gewalterfahrungen gemacht, häufig in deren Kindheit. Das gab den Ausschlag für das wohl umstrittenste Gesetz der Union, das GewSchG.
Beinahe jedes Gesetz, das in Kraft gesetzt wurde, musste sich die Sinnfrage gefallen lassen, ebenso wie es immer Kritik an der Umsetzung gegeben hat, oder Kritik an der Verfolgung jener, die gegen dieses Gesetz verstoßen haben. So auch beim GewSchG.
Insbesondere seit dem Ende des Kriegs wurde immer wieder die Forderung laut, Journalisten müssten objektiv sein. Deshalb werde ich nun Fakten auflisten.
Die Kriminalitätsrate ist rückläufig. Insbesondere Gewaltverbrechen wie Mord und Misshandlung haben abgenommen. Die Zahl von Kindern, die euthanasiert wurden, hat zugenommen. Ob die Zunahme von Euthanasien das Sinken der Kriminalitätsrate mit sich gebracht hat, lässt sich ohne wissenschaftliche Untersuchungen nicht mit Sicherheit sagen. Das sind die objektiven Fakten.
Im Laufe meiner Berufsjahre habe ich jedoch gelernt, dass die Objektivität dort enden muss, wo Unrecht geschieht, wo Menschenleben in Gefahr sind. So wage ich nun, zwanzig Jahre später, die Frage, wie viele Kinder, die euthanasiert wurden, wirklich Gewalttäter geworden wären. „In dubio pro reo“, fordert der Grundsatz, nach dem die Justiz zu urteilen hat. Ein Grundsatz, der das Leben zahlloser Unschuldiger gerettet hat. Aber was geschieht, wenn es vielleicht den „dubio“ aber nicht den „reo“ gibt? Denn die Kinder, die euthanasiert werden, sind nie formell angeklagt worden. Sie hatten nie einen Verteidiger und über ihren Tod wurde nicht im Einzelfall von der Justiz entschieden.
Ich kann und will das GewSchG nicht anzweifeln, denn dazu fehlen mir die entsprechenden Informationen. Aber als Mensch mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn erscheint es mir seltsam, dass Menschen, die ein Verbrechen begehen, mehr Schutz erfahren als ihre Opfer. Während ein Verbrechen zweifelsfrei bewiesen sein muss, um den Verbrecher zu bestrafen, reicht bei den Kindern ein begründeter Verdacht. „In dubio pro reo“, sagt auch aus, dass man lieber einen Schuldigen freilässt, als einen Unschuldigen zu bestrafen. Ein Grundsatz, der bei den Kindern, die das GewSchG betrifft, ins Gegenteil verkehrt wird. Da bei keinem der Kinder zweifelsfrei zu beweisen ist, dass es später einmal gewalttätig werden wird, wäre hier grundsätzlich „dubio“ anzunehmen.
Kapitel 5
„Leslie, hilf mir, das Kind dreht durch!“ Helens Stimme in Leslies Kopfhörer verriet ihr, dass ihre Kollegin ebenfalls nahe daran war, selbiges zu tun. Im Hintergrund hörte sie zudem die Schreie eines völlig panischen Kindes.
Die Panik des Kindes verriet ihr, worum es sich handelte. „Ich komme!“ Im Reflex hatte sie diese Worte ausgesprochen, ohne daran zu denken, dass sie eigentlich keine Euthanasien mehr durchführen sollte, um ihr Ungeborenes nicht zu gefährden. Schwangeren Ärztinnen riet man im Allgemeinen, dem seelischen Stress, den Euthanasien verursachten, aus dem Weg zu gehen. Aber die Schreie des Kindes und die Hilflosigkeit ihrer Kollegin ließen auch gar keine anderen Worte zu als eben jene.
Leslie sprang auf und eilte den Gang hinunter. Durch die schalldichten Wände drangen die Schreie des Kindes nicht, Leslie hatte sie nur über die Kopfhörer gehört. Aber die beinahe gespenstische Stille in den langen Krankenhausgängen ließ die Kinderschreie in Leslies Kopf nur noch lauter werden.
Sie hatte keinerlei Möglichkeit, zu erkennen, ob das Kind wusste, was mit ihm geschehen sollte, oder einfach nur in der allgemeinen Anspannung in Panik geraten war.
Leslie spürte, wie ihr Herz zu rasen begann. Eine Stimme der Vernunft schrie, dass das nicht gut war. Sie durfte ihr Baby nicht gefährden! Aber Leslie konnte nicht auf die Vernunft achten. Der Drang zu helfen war größer. Zu laut waren die Schreie in ihrem Kopf. Sie sah sich noch einmal um, als sie die Tür erreichte. Es wäre fatal, wenn gerade jetzt ein kleiner Patient den Gang betrat und das Schreien hören konnte.
Aber der Gang war leer und still. Leslie öffnete die Tür. Von einem Augenblick auf den anderen verschwanden die Stille und Ordnung des Krankenhauses und Leslie fand sich in einem Chaos aus Schreien, Tränen und Zappeln sowie verzweifelten Bändigungsversuchen wieder.
Helen hatte den kleinen Jungen hochgenommen und versuchte, ihn mit einem Arm gegen ihren Oberkörper zu pressen, um ihn zu fixieren. Das hatte bei dem vollständig panischen Kind jedoch keine Wirkung, außer dass Helen mehrere Tritte kassierte.
Ein Blick in ihr Gesicht verriet Leslie, dass ihre Kollegin den Tränen nahe war. Immerhin waren keine Polizisten anwesend. Das Kind gewaltsam zu fixieren hätte zwar wohl den gewünschten Erfolg gebracht, aber weder sie noch Helen hätten das verkraftet.
Leslie schloss für einen Moment die Augen und zwang ihr rasendes Herz zur Ruhe: „Helen, geh raus!“ Sie sprach bestimmt und deutlich. Sie war die Herrin der Lage, zumindest mussten das alle glauben können.
Helen warf ihr einen Blick zu, der irgendwo zwischen Dankbarkeit und Verzweiflung lag, und eilte davon.
Und Leslie wandte sich dem Jungen zu, der sich in eine Ecke geflüchtet hatte. Er kauerte an der Wand, heftig atmend und zitternd wie ein kleines Tier. Sein Blick, gehetzt und wild, machte Leslie richtiggehend Angst. Sie konnte für einen Augenblick vor ihrem inneren Auge sehen, wie er sie ansprang, wie ein in die Enge getriebenes Tier.
Dann hatte sie sich wieder unter Kontrolle. Ihn jetzt berühren zu wollen, hatte in seinem Zustand keinen Sinn.
So ging Leslie noch an der Tür in die Hocke, lehnte sich mit dem Rücken gegen das Metall und begann, auf den Jungen einzureden: „Du musst keine Angst haben. Du bist hier im Liberty Hospital, da bist du sicher.“
Das oft geübte Lächeln auf ihrem Gesicht spürend fuhr sie fort: „Wenn du mich jetzt kurz an dich heranlässt, hast du es auch gleich überstanden. Ich gebe dir eine Spritze, damit dir nichts mehr wehtut und dann darfst du auf der Wiese spielen gehen.“
Sie fuhr fort, die Wiese zu beschreiben: Sanfte Hügel, so weit das Auge reichte, Höhlen, die prima Verstecke abgaben. Hohes Gras, das ein Kind an der Hüfte kitzelte. Strahlender Sonnenschein und zirpende Heupferdchen. Wunderschöne, bunte Schmetterlinge tanzten über der Wiese. Jeder Winkel durfte betreten und Blumen gepflückt werden, so viele man tragen konnte, denn die Wiese war übervoll davon.
Auf den Hügelkuppen fanden sich Klettertürme und Rutschen und in mehreren der alten Bäume Baumhäuser mit allem, was man sich für ein Baumhaus wünschen konnte. Roller, Rollschuhe und Skateboards waren in den Hütten dazwischen aufgereiht und auch Sandflächen, in denen es sich vortrefflich Burgen bauen ließ. Burgen groß genug, um sie als Kind auch betreten zu können.
Und das alles war sauber und zwang kein Kind dazu, Atemschutzmasken zu tragen oder gewisse Teile der Wiese zu meiden.
Im Laufe ihrer Erzählung hatte sich der Junge langsam beruhigt. Als Leslie sich langsam in seine Richtung bewegte, hatte das keinen erneuten Panikanfall zu Folge.
„Setz dich mal auf die Liege und dann erzähl mir doch, was du auf der Wiese machen möchtest!“, ermunterte sie ihn. Den Ekel über sich selbst und die Verzweiflung, die in ihren Eingeweiden wühlten, musste sie ignorieren können.
Der Junge gehorchte und begann von einer Sandburg zu erzählen, die er bauen wollte. Einer Sandburg, so groß wie er selbst, mindestens, wenn nicht sogar so groß wie ein ganzes Haus.
Leslie zog in der Zwischenzeit die Spritze auf. Jedes einzelne Wort des Jungen war wie ein Messer, das sich in sie bohrte, ohne dass sie zeigen durfte, dass es schmerzte.
Der Junge war viel zu beschäftigt, mit seinen Beschreibungen der Sandburg und seiner Begeisterung für das Werk, das er schaffen wollte, um der in seine Armvene eingeführten Nadel große Beachtung zu schenken.
Das hoch dosierte Medikament sorgte dafür, dass es nicht lange dauerte, bis der Junge die Augen schloss und sein Körper erschlaffte. Leslie legte ihn ordentlich hin und ergriff seine Hand. Er sollte nicht allein gehen müssen, auch wenn er das wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen würde.
Tränen liefen ihr über die Wangen, Tränen der Hilflosigkeit und der Schuld. Sie tat nichts dagegen. Er würde nicht mehr bemerken, dass sie weinte.
Einige Zeit später, wohl kaum mehr als ein paar Minuten, hörte der Junge auf zu atmen und kurz darauf setzte auch sein Puls aus.
Leslie schloss ihn an das EKG an und ging damit sicher, dass er tatsächlich tot war. Das EKG zeigte nichts mehr. Die Qualen dieses Kindes hatten ein Ende gefunden und Leslie konnte nur hoffen, dass sie nicht gelogen hatte und er sich nun tatsächlich auf einer wunderschönen Wiese wiederfand.
Sie schaltete das EKG aus und ließ sich dann haltlos schluchzend an der Wand zu Boden gleiten. Sie fühlte sich so elend wie schon lange nicht mehr. Eigentlich hätte sie nun das Kind in die Leichenhalle bringen müssen, aber sie hatte die Kraft dazu nicht. Sie konnte sich nur den keuchenden Schluchzern überlassen, die ihren ganzen Körper schüttelten.
Ihr Körper krümmte sich. Und erst jetzt bemerkte Leslie, dass das, was in ihren Eingeweiden wühlte, nicht nur Schuldgefühle, sondern tatsächliche Krämpfe waren. Und zwischen ihren Schenkeln war es feucht. Als sie nach unten blickte, zuckte sie erschrocken zusammen. Ihre weiße Hose war zwischen den Beinen rot.
Das hat nichts zu bedeuten! Das darf nichts zu bedeuten haben!, flehte die werdende Mutter in ihr, die das Furchtbare nicht wahrhaben wollte, aber die Ärztin wusste, dass es zu spät war. Das Kind, das sie sich so sehr gewünscht hatte, verließ sie bereits wieder.
Schluchzend wühlte sie in ihren Taschen und fand ihr Funkgerät. Sie wählte Josie an. „Josie … Das Baby …“ Mehr brachte sie nicht heraus, als ihre Stationsärztin sich meldete. Aber an ihrem Schluchzen musste die erfahrene Ärztin bereits erkannt haben, was geschehen war. Denn als Leslie Schritte hörte und schwach versuchte, sich aus ihrer Ecke aufzurichten, hielt eine kräftige Hand sie zurück und im nächsten Moment spürte sie einen Stich am Arm und die Welt verschwand.
Als sie die Augen wieder aufschlug, lag sie in einem Bett. Rick saß bei ihr und hielt ihre Hand. Und an seinem traurigen Blick sah Leslie, dass es wirklich keine Hoffnung mehr gab. Gewaltsam zerbiss sie die erneut aufwallenden Tränen. „Rick … Das wollte ich nicht …“
Rick zuckte zusammen. „Schh, es wird alles wieder gut.“ Er beugte sich über sie und küsste sie zärtlich auf die Stirn. „Wir schaffen das zusammen!“ Er streichelte ihre Hand.
Er meinte es nur gut und versuchte, ihr zu helfen, aber Leslie ertrug seine Zärtlichkeit nicht. Es wäre für sie einfacher gewesen, wenn er ihr die Schuld daran gegeben hätte, dass ihr Kind tot war. Denn dann hätte sie ihm zustimmen können. Der rasende Schmerz in ihrem Inneren ließ keine Erleichterung durch Mitgefühl zu. Leslie entzog Rick ihre Hand und drehte sich von ihm weg, wobei sie ihren ganzen Körper anspannte, um nicht zu weinen. Er sollte gehen!
Rick ging um das Bett herum, um sich vor ihr hinzuhocken. „Leslie … Ich würde jetzt gerne bei dir bleiben. Aber … ich habe Schicht und ich kann die nicht einfach tauschen. Nicht jetzt …“
Nicht jetzt, wo gleich drei Ärztinnen in Mutterschutz gegangen sind. Taktvoll vermied er es, das auszusprechen.
Leslie nickte. „Geh nur … Ich komm schon zurecht.“
„Bist du sicher, Schatz? Soll ich Annie anrufen?“
„Nein!“, schrie Leslie auf. „Ich will einfach nur meine Ruhe, Rick.“
Rick nickte, schluckte und stand auf.
Leslie hielt den Atem an, bis er endlich verschwunden war, dann vergrub sie ihr Gesicht im Kopfkissen und weinte. Sie hatte an diesem Tag zwei Kinder getötet. Warum war sie dann noch am Leben? Richtete man Menschen, die Kinder töteten, nicht hin? Und mindestens ihr eigenes Kind hatte sie auf dem Gewissen. Sie hätte es doch besser wissen müssen! Die Stimme der Vernunft, die ihr sagte, dass Fehlgeburten nun einmal vorkamen, drang nicht durch den rasenden Schmerz.
Sie bemerkte gar nicht, dass sowohl Josie als auch Helen nach ihr sahen und sie zu trösten versuchten. Kein Mensch konnte die Mauer ihres Leids durchdringen.
Als sie keine Tränen mehr hatte, rollte Leslie sich auf den Rücken und blieb so liegen. Sie reagierte nicht auf die Pflegerinnen, die sie ansprachen, sie reagierte auch nicht auf die Ärzte. Sie ließ die Untersuchungen über sich ergehen, aber sie bekam kaum mit, was um sie herum geschah.
„Leslie?“ Diese Stimme durchdrang ihre Apathie doch. Es war Annie, die schüchtern ihren Namen rief.
Leslie drehte den Kopf. Tatsächlich! Ihre Schwester stand vor ihrem Bett. „Hi“, antwortete Leslie, ihre Stimme schwach und heiser.
Annie trat näher zu ihr, ihre Augen schwammen vor Tränen. „Oh Leslie, ich weiß nicht, was ich sagen soll.“
„Nichts“, erwiderte Leslie bitter. „Es ist vorbei …“
„Kann ich irgendwas für dich tun?“
Annie versuchte ihr Bestes, um ihr zu helfen, das wusste der vernünftige Teil Leslies. Aber dennoch ärgerten sie die Worte ihrer Schwester nur. „Es ist nichts mehr zu tun, Annie!“, erwiderte sie unwillig. „Außer, dass du jetzt gehst und dich um Kayleigh kümmerst.“
Annie zuckte zusammen. Und Leslie sah, dass sie ihrer Schwester wehgetan hatte. Annie versuchte, Leslies Worte ihrem Zustand anzulasten, das konnte ihr Leslie selbst in ihrem betäubten Zustand noch vom Gesicht ablesen.
Aber anders als sonst hatte sie weder die Kraft, noch den Willen, ihre Worte abzumildern. „Du hast mich gehört!“
Annie schluckte, nickte, drückte ihr noch einmal die Hand und verschwand.
Das Glas des Fensters, an das sie ihre Stirn gelehnt hatte, war kühl und weigerte sich hartnäckig, ihre Körperwärme anzunehmen.
Leslies Blick schweifte ziellos über den Garten, suchte nach der Schönheit, die sie dort einst gesehen hatte, und fand sie doch nicht mehr. Es war, als wäre jede Empfindung für Schönes in ihr gestorben, als ihr Kind sie wieder verlassen hatte.
Sie begann zu zittern, eine Kälte geboren aus Einsamkeit, die kein lebender Mensch durchdringen konnte, durchdringen sollte, suchte sich ihren Weg durch Leslies Adern. Hilflos schlang sie die Arme um sich, aber das konnte der Kälte ihres leeren Leibs nichts entgegensetzen.
Ihr Blick schweifte über die Grenzen des Gartens hinaus, verlor sich in der Landschaft dahinter. Plötzlich zuckte sie zusammen. Den Hügel, den ihr Blick eben gestreift hatte, kannte sie. Sie hatte ihn vor einigen Tagen im Traum gesehen. Vor einigen Tagen, in der nun so fern scheinenden Zeit, als ihr Kind noch sicher und geborgen unter ihrem Herzen gelegen hatte.
In diesem Traum rannte sie über den Hügel, den Wind im Haar und so leicht, als wäre sie selbst wieder ein Kind. Doch ihre Hände umfassten sicher Kinderhände. Links neben ihr lief Kayleigh, lachend und unbeschwert. Vertrauensvoll lag die Rechte ihrer Nichte in Leslies Hand. Und rechts neben ihr lief ein anderes Kind. Ein kleines Mädchen von vielleicht vier Jahren, dessen dunkle Haare im Wind flogen und das sie aus dunkelblauen Augen ansah, die an Rick erinnerten. Ihre Tochter. Ihre Finger waren so fest mit denen Leslies verflochten wie auch die Herzen von Mutter und Tochter. Ihre Tochter lachte unbeschwert und vibrierte vor Lebendigkeit. Und Leslie wusste, dass dieses Glück ihr gehörte!
Dieser Traum war tot. Sie hatte ihn getötet, hatte zugelassen, dass man ihn mit ihrem toten Baby aus ihr herausriss. Ein hoher, geisterhafter Laut, den Leslie nicht als ihren eigenen Schrei erkannte, erfüllte die Luft. Er wurde immer lauter und schriller, bis Leslies Stimme versagte. Schluchzend fiel sie auf die Knie.
Und so fand Rick sie, als er nach Hause kam. Die volle Einkaufstüte ließ er achtlos fallen, ohne sich darum zu kümmern, dass Glas darin zerbrach. Mit einigen großen Schritten war er bei Leslie und umarmte sie fest.
Leslie wehrte sich gegen seine Arme. „Lass mich los! Lass mich in Ruhe!“
Doch Rick ließ sie nicht los. Er hielt sie fest, gab sie auch nicht frei, als sie mit den Fäusten gegen seine Brust trommelte. Er zog sie nur enger an sich. Und schließlich brach Leslies Widerstand. Haltlos weinend sackte sie zusammen und ließ sich von Rick festhalten.
Er streichelte sie, küsste sie und murmelte all die sinnlosen Zärtlichkeiten, die Menschen in solchen Situationen murmelten.
Da schien er die unberührten Eisentabletten auf dem Esstisch zu bemerken. „Schatz, ich weiß, du willst nicht, aber du musst deine Eisentabletten nehmen!“ Er hob Leslies Kinn an und sah sie an. „Schatz, bitte! Wenn du dich selbst krankmachst, bringt das unser Baby auch nicht zurück!“
Für einen Moment wollte Leslie seine Fürsorge zulassen, wollte einfach akzeptieren, was Rick ihr sagte und sich von ihm halten lassen. Doch diese Regung wurde von erneut aufwallender Wut überdeckt. Was dachte Rick sich dabei, sie zu behandeln wie eine Patientin, die nicht wusste, wozu Tabletten gut waren? Konnte er nicht begreifen, warum sie die Eisentabletten nicht nehmen wollte? Sie wollte den Blutverlust nicht einfach ausgleichen, als sei nichts gewesen! Es war nicht nichts gewesen! Ihr Kind war tot! Und die Schuld daran trug ganz allein sie!
„Verdammt, Rick, kannst du einmal Mensch sein und kein verdammter Arzt?“, fauchte sie Rick an.
Er sah sie erschrocken an. Noch nie, nicht einmal wenn sie sich gestritten hatten, hatte Leslie ihm seinen Beruf vorgeworfen, denn sie war ebenso in ihrem aufgegangen.
„Leslie, ich denke an dich. Was willst du denn, dass ich tue?“
Mich hassen und die Wahrheit sagen!,





























