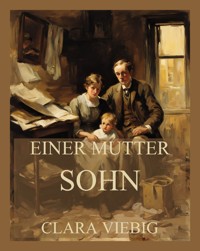Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hans von Pfahl, Sohn eines strengen Majors, erträgt nach dem Tod seiner Freundin, die sich das Leben genommen hat, sein Elternhaus nicht mehr und verlässt es kurz vor dem Abitur. Zunächst schlägt er sich in Berlin mit verschiedenen Beschäftigungen durch und kann seinen Lebensunterhalt notdürftig bestreiten. Dann geht er zur See und verbringt zwei abenteuerliche Jahre in großer Einsamkeit als Wächter des Blinkfeuers auf einer Robbeninsel im subantarktischen Meer. Nach sieben Jahren erst kehrt er wieder heim und versöhnt sich mit den Eltern, die inzwischen weit im Osten nahe der polnischen Grenze leben. Bald will er wieder fort, doch dann lernt er Magdalena kennen und lieben ...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Insel der Hoffnung
Saga
Insel der HoffnungCopyright © 1933, 2019 Clara Viebig und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711466940
1. Ebook-Auflage, 2019 Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Erster Teil
1. Kapitel
Major von Pfahl lachte nur mehr selten, und wenn er einmal lachte, so war es kein Lachen, das wohltat, ihm nicht, seiner Frau nicht und auch dem langen Jungen, seinem Sohn nicht. Es war Hans-Joachim am liebsten, wenn er seinem Vater ausreichen konnte. Der fand immer zu tadeln: „Halte dich besser! Aufrecht! Kopf hoch, Brust raus! Im Turnen auch miserabel — kein Elan, kein Schwung. Niemals kämst du nur mit einem Handaufstützen in den Sattel.“
Die Mutter fand nicht, dass Hans-Joachim schlecht turnte; da der Turnplatz öffentlich war, hatte sie auch einmal von fern zugesehen. Von all den jungen schlanken Turnern gefiel er ihr am besten. Welchen Schwung hatte er am Reck, die grosse Welle war ihm ein Garnichts. Und beim Springen! Vier Schüler stellten sich nebeneinander, die Rücken gebeugt, er nahm keinen Anlauf, er sprang aus dem Stand über sie weg. Ach, ihr schöner frischer Junge! Sie sah oft voll stumm besorgter Zärtlichkeit in sein Gesicht; es war ihr manches Mal, als hätten sie ihm etwas abzubitten, sie und ihr Mann. Denn dem Major von Pfahl, einstmals im Kadettenkorps erzogen, erschien solche Erziehung als die einzig erspriessliche und zum Mann machende; er empfand es wie einen unersetzlichen Verlust, dass sein Sohn die nun nicht haben konnte. Aber Krieg verloren, Deutschland Republik — alles verloren — er selber verabschiedet ohne höhere Charge. Ein paar Orden, die jetzt nichts mehr bedeuteten, und eine Pension, die knapp war. Die Reichswehr hätte ihn vielleicht übernommen: tüchtiger Offizier, noch nicht zu alt. Aber er würde doch nicht in eine Armee eintreten, die den Treueid nicht mehr dem angestammten Herrscherhaus leistete — einem Haufen von Revolutionären, niemals! Grollend zog er sich in Untätigkeit zurück.
Mochte seine Frau zusehen, wie sie mit dem, was er ihr wöchentlich gab, auskam. Von dem, was er für sich zurückbehielt, sparte er: erstens für eine standesgemässe Beisetzung mit allem Drum-und-Dran, und zweitens für seinen Sohn. Wenigstens ein untergeordneter Kommis sollte der nicht zu werden brauchen. Er bemühte sich, dem Jungen immer wieder und wieder klarzumachen und zu beweisen, wie unhaltbar die jetzige Neuordnung der Republik sei. Er verlor sich dabei in bittere Ausfälle und verdüsterte Grübeleien und bemerkte weder die verlegene Miene und die unruhigen Blicke seiner Frau, noch die gesenkte Kopfhaltung und die Stummheit des Sohnes.
Mag er sich nur einmal recht ausschimpfen, dachte Hans-Joachim. Von seinem Standpunkt aus mochte der Vater in manchem recht haben, aber es war nicht angenehm, das mit anzuhören, es bedrückte. Und eigentlich ging einem selber auch die Lust an allem dabei verloren. Er warf unter gesenkten Lidern einen Blick nach der Mutter hin: auch sie sah bedrückt aus und schwieg.
Gertrud von Pfahl hatte früher eine strahlende Blondheit gehabt und eine glatte Stirn. Als sie den Mann ihrer Liebe endlich heiraten konnte — sie hatten warten müssen — war sie so glücklich gewesen, dass sie glaubte, ihr Glück kaum tragen zu können. Es dünkte sie wie eine starke Festung gegen all das, was das Leben etwa bringen könnte an Feindlichen. Die Festung war gefallen, ein einziges Fort nur noch übrig — der Sohn. Sie hätte oft manches anders für ihn gewünscht: mehr Selbständigkeit, eigenes Bestimmungsrecht, den Hausschlüssel, Theaterbesuch, Freiheit an Freuden der Jugend, wie Ruderverein, Schülerklub, Tanzstunde. Aber ihr Mann sagte stets: „Allotria“ oder: „Es kostet zuviel.“ Zeigte Hans-Joachim es nur nicht, oder vermisste er es wirklich nicht? Die Mutter war sich darüber nicht klar. Sie selber hatte eine heitere Jugend gehabt, aber da sie ihm eine solche jetzt doch nicht schaffen konnte, hielt sie es für am besten, nicht weiter zu fragen. Einziges Kind, einziger Sohn, das ist immer schwer. Wenn es nach ihr gegangen wäre, sie hätten mehr Kinder gehabt — Kinder, zwei, drei, vier, fünf — aber nun war es ja gut, dass sie nur diesen einzigen hatten. Nun langte die Pension, aber knapp, denn uach sie hielt vom Wochengeld zurück: Groschen, wenn es hoch kam eine Mark. Sie sparte am Essen, sparte an der eigenen Kleidung, sparte für den Sohn. Wenn er das Abiturium hinter sich hatte, dann sollte er davon einen richtigen lustigen Kneipabend haben mit Bierzeitung und allem, was dazugehört: Zigaretten in Menge, belegte Butterbrote in Massen, ein ganzes Fässchen Bier, und war das leer, noch ein zweites. Einmal, ehe er in die Welt ging, sollte er das haben, was andere Abiturienten auch haben: einen sorglos genossenen Abend und — ein fröhliches Elternhaus.
Dann würde sie sich drüben aus der Rosenvilla Frau Frieda Seehoff zu Hilfe holen, die verstand es ausgezeichnet, Geselligkeit zu arrangieren und Frohsinn um sich zu verbreiten. „Ihr Herr Gemahl tut mir immer so leid“, sagte Frau Frieda Seehoff, wenn die Majorin bei ihr am Kaffeetisch sass. „Ein so stattlicher Mann! Es muss schrecklich für ihn sein, noch in der Vollkraft und sich dann brachgelegt zu sehen. Ich könnte das gar nicht aushalten.“
Ich kann es auch nicht, dachte die Offiziersfrau, aber ich muss ja. Und mit einem tapfern Lächeln sagte sie: „Oh, es ist nicht so schlimm. Er teilt eben das Los aller vom alten Regime. Und dann hat er ja auch noch viele andere Interessen.“
Was ist die Majorin doch für eine guterzogene Frau, dachte die andere. An die vielseitigen anderen Interessen des Majors glaubte sie keinen Augenblick.
Die Einladungen zu Frau Seehoff, die ein sehr gastfreies Haus hatte, waren Gertrud von Pfahl eigentlich immer schwer. Und doch ging sie hin. Die Räume drüben so hübsch, so hell — sie hatte kein einziges so behagliches Zimmer — und der Kuchen gut, der Kaffee stark und sogar Schlagsahne dazu.
Major von Pfahl liebte diese Einladungen noch viel weniger, Gertrud kam jedesmal so gedrückt zurück, dass selbst er es merkte. Er ging dann um den Tisch herum, auf dem zum Abendbrot schon die Teekanne stand, das bisschen Aufschnitt, etwas Brot und Butter, und küsste seine Frau auf die Stirn. Es war das wie eine Entschuldigung, dass er es ihr nicht so schön, nicht so reichlich, nicht so gutschmeckend bieten konnte, wie die da drüben. Der Ärger fasste ihn: „Eine alberne Person!“
„Gar nicht“, verteidigte die Frau. „Ich wünschte, ich könnte so sein wie die Seehoff: liebenswürdig, immer bei Laune, und heiter.“
„Lässt sich gut heiter sein, wenn man einen Bruder über See hat, der ein Warenhaus besitzt, das Millionen einbringt.“ Er zuckte die Achseln. „Er nimmt ihr jede Existenzsorge ab.“
„Dafür erzieht sie ihm ja auch seine Tochter, und das ist gar nicht so leicht. Ein merkwürdiges Kind, nicht wie andere Kinder.“ Und mit dem Instinkt der Mutter sagte Frau von Pfahl noch: „Ob das Mädchen Heimweh hat? Die Seehoff ist übrigens reizend zu ihr.“
„Wird sich hüten, nicht reizend zu sein. Dann nimmt er ihr das Mädel einfach weg, und die Goldquelle versiegt.“ Und als gerade jetzt der Sohn ins Zimmer trat, fuhr er den an: „Warum nicht pünktlicher? Wo warst du?“
Keine Antwort.
„Na ja, weiss schon, ihr seid ja beide wie nach drüben gebannt. Dolores, Ines, Juanita — oder wie heisst die grüne Jöre?“
„Louisa“, sagte der junge Mensch und setzte sich. —
So viel, wie der Vater glaubte, lag ihm gar nicht daran, herüberzugehen, er konnte es ebensogut lassen. Aus Louisa selbst machte er sich überhaupt nichts. Sie hatte nur ein gewisses Interesse für ihn, weil sie aus Cochabamba stammte. Bolivien, unbekanntes Land! Die Hauptstadt La Paz, die höchstgelegene Stadt der Erde, höher als das Jungfraujoch in der Schweiz. Und Zuckerrohr, Reis, Kaffee, Bananen und Drangen, alle Wunderernten der Tropen im Tal. Und Gold, Kupfer, Silber und Zinn in den Bergen. Und Indianer, die bemalten Rothäute seiner Kindheit, mit denen er auf den Kriegspfad geschlichen war, die gab es heute leibhaftig noch da. Aber sie hatten die Friedenspfeife geraucht mit dem weissen Mann, sie arbeiteten, lebten und liebten da. — ein Land der Wunder! Wenn Louisa nur mehr davon erzählen könnte! Schade, sie war noch zu klein gewesen, als sie dort fortkam.
Was wusste sie von jenem Wunderland und von jenen Kordilleren, deren Gipfel bis in die Wolken reichten. Eine starrende Mauer himmelhoher, drohender Berge trennte jenes Zauberland vom Ozean, vom Hafen Antofagasta. Man musste ein starkes Maultier besteigen, nur die Mulas klettern noch da, wo die Alpakas letzte Grashalme rupfen und die Lamas scheu fliehen, wo die Kondore kreischen und nur darauf warten, dass Maultier und Reiter schwindelnd abstürzen vom kaum fussbreiten Felsensteig. Ausgebrannte Vulkane mit ewigem Schnee auf dem Haupt, Sümpfe und Salzseen auf der Hochfläche der Puna, undurchdringliche Urwälder im Gebiet des Rio Grande. Von all dem wusste sie nichts, im Kinderschlaf, vom Arm des Vaters gehalten, hatte sie alles verträumt.
Señor Riccardo hatte sie vor neun Jahren, als sie erst fünf Jahre alt war, herübergebracht, um sie seiner Schwester zu übergeben. Ein deutsches Mädchen sollte seine Tochter werden, nur in Deutschland verstand man ja richtig zu erziehen: „Gebildet, fleissig und häuslich. Ich weiss Bildung zu schätzen — gerade drüben, wo sie nicht so ganz selbstverständlich ist wie hier in Deutschland. Ich bitte dich, tu dein Bestes, Friedel, lass ihr den besten Unterricht geben.“ —
Aber, so jung Louisa damals auch gewesen war, sie erinnerte sich noch. Wenn sie nachts in ihrem Bette lag, oftmals nicht schlafen konnte, dann hörte sie eine Stimme. So hatte noch keiner zu ihr gesprochen — „Mein Töchterchen, mein kleiner Liebling, wirst du mich auch niemals vergessen? Wirst du deinen armen Papa, der sich so sehr nach dir sehnen wird, auch immer lieb behalten? Und wenn er dich dann eines Tages wieder zu sich herüberholen kann, wenn du schön und klug geworden bist, eine grosse Tochter, die ihm das Haus führt, so wie man es in Deutschland tut, dann schenke ich dir ein munteres Pferdchen, auf dem reitest du neben mir her, wenn ich hinauf in die Berge muss — du kennst kein Bangen, mein Weg ist dein Weg, und dein Weg ist mein Weg. Wir zwei allein, wir zwei sind immer zusammen.“
Oh, wie gern sie das wollte, immer mit ihm zusammen sein, nur mit ihm allein! Dann würde sie nicht mehr weinen, wie hier so oft. Wenn Tante Friedel es merkte, schalt die, die verstand es ja nicht, weswegen. Die sagte dann gleich etwas von ,verdrossen und ungezogen‘. Ach, sie war doch nicht ungezogen und auch nicht verdrossen, sie fühlte sich nur fremd hier, niemals zu Hause. Ohne Heimat — das ist schrecklich! Tante Friedel lachte sie freilich aus, nannte sie übers spannt — Flausen, kindische Ängste. „Ohne Heimat, lächerlich! Du hast mich doch!“ Dann konnte sie doch nicht erwidern: „Ich habe nichts von dir. Du bist du, und ich bin ich.“
„Ach, wenn ich doch einen Freund hätte!“ Und unwillkürlich, ohne viel zu suchen — er wohnte ja so nah — glitten des Mädchens Wünsche zu Hans-Joachim hinüber. Aber ach, er machte sich ja nichts aus ihr! Das fühlte sie, wohl, und das vergrösserte noch ihre Sehnsucht: fort von hier, fort nach drüben, nach Cochabamba! Heimat, Heimat! Sie krankte an einem Heimweh, das doch kein richtiges Heimweh war, denn die Heimat war ihr ja auch fremd.
2. Kapitel
Nun hatte Louisa einen Freund — Hans-Joachim von Pfahl.
Mit einer Plötzlichkeit, deren Warum er sich nicht klar machte, war die Beziehung zu Louisa gekommen. Liebte er dieses Mädchen denn? Dass sie ihn liebte, das war klar. Sie hing ihm am Halse, bei jedem Abschied küsste sie ihn, dass ihm dies Küssen fast lästig war. Denn er hätte zu ihr nicht anders sein können wie zu einer Schwester — sie war ja erst vierzehn! Aber trotzdem war es herrlich, mit ihr zusammen zu sein. Aus der Eintönigkeit seines dunklen Parterres zu ihr herübergeschlichen, hing er sich mit aller Sehnsucht einer Jugend, die zu verkümmern drohte, mit aller Kraft seiner Phantasie an ihre Phantasie. Zuweilen kamen ihm Zweifel: war es auch wirklich alles wahr, was sie da erzählte? Hatte sie vielleicht schon die Begabung einer Dichterin und erfand sich etwas? Wenn er das zu ihr sagte, weinte sie und war gekränkt, Dann beeilte er sich, sie zu versöhnen, denn wenn er seine kleine Freundin nicht mehr hätte, würde ihm viel, sehr viel fehlen — alles. Und es war doch auch in seiner Freundschaft so etwas von Liebe. Dazu kam die Heimlichkeit. Heimlichkeit hätte gar nicht nötig getan, sie fanden oft genug Gelegenheit, sich zu sprechen. Doch so heimlich die Stunden zu stehlen, das war ja gerade besonders schön. Wenn er zum Fenster seines Zimmerchens heraussprang, dann lange geduckt stand, spähend, ob auch niemand um den Weg war, und dann herüberschoss, wo auch sie geduckt hinter den Rosen stand, den Finger an den Lippen, so war das ein romantisches Abenteuer. Sie hatten ihren Zufluchtsort, ihr Buen retiro, in einem verwahrlosten Gartenhäuschen; nur altes Gartengerät und Gerümpel wurde da untergestellt, sie wurden nie gestört. Sie hatten den Laden vor dem kleinen Fenster zugemacht, sassen im dämmernden Zwielicht. Er sass auf einer alten Kiste, sie hockte vor ihm auf den Fersen. „So sitzen die Indianerweiber bei uns“, sagte sie und sah von unten zu ihm auf mit ihren ganz schwarz erscheinenden, undurchdringlichen Augen.
Sie erzählten sich wieder von dem, was sie so beschäftigte, dass nichts anderes dagegen in Betracht kam. Sie war nicht mehr allein die, die sich etwas zusammenphantasierte von einem Lande, das ein Paradies war und das sie eigentlich doch kaum kannte, auch er, angesteckt von ihrer Begeisterung, war voll fiebernder Sehnsucht. Bolivien — Cochabamba! Und wenn es doch dort vielleicht auch nicht ganz so sein sollte wie in seinen kühnen Träumen, tausendmal schöner war’s doch dort und tausendmal besser als hier. Sie klagten sich gegenseitig ihr Leid. Er sehnte sich fort von einem Vater, bei dem sein Zuhause nichts als Bedrückung war; in einem dumpfen Gefühl der Auflehnung gegen die väterliche Autorität übersah er die Liebe der Mutter. Und was Hans-Joachim noch niemandem gesagt hatte, seiner Mutter nicht, keinem seiner Altersgenossen, was er sich selbst noch nicht eingestanden hatte in mancher Stunde, in der er mit sich rang, um eine Empörung gegen den Vater loszuwerden, die fast Hass werden wollte, das sagte er jetzt seiner Freundin. Sie klagten sich gegenseitig ihr Leid; es wuchs dadurch und wurde fast unerträglich, indem sie sich’s klagten.
„Ich habe schon einmal daran gedacht, Schluss zu machen“, sagte er ganz leise.
Entsetzt fuhr sie auf, warf sich an seinen Hals, ihn umklammernd: „O nein, nein, das darfst du nicht!“
„Aber Louisa, doch so nicht!“ Er löste ihre Arme von seinem Hals. „Sei ruhig, Kind! Fortlaufen wollte ich. Ich hab’s satt zu Hause.“
„Ach ja, wir wollen allem entfliehen“, sagte Louisa. — —
Sie gingen weit miteinander in die Felder hinaus. Noch waren die kahl, kein Hälmchen jungen Grases zeigte sich, nur die Wintersaat stand hartgrün, von ein wenig vermehtem Schnee bedeckt, und fror. Auch Louisa fror.
„Ich habe mir noch keinen neuen Mantel gekauft“, sagte sie und zitterte. „Mein Vater hat mir zwar Geld geschickt, ich hatte ihn darum gebeten; ich will es aber nicht für den warmen Mantel, ich hebe es auf. Wir brauchen Geld, wenn wir fort wollen. Ich muss tüchtig sparen. Fort lassen sie uns ja gutwillig nicht.“ Sie hatte ja auch schon lange mit dem Gedanken gespielt und nun sich alles ausgedacht, wie sie es machen wollten. Bis Hamburg kamen sie jedenfalls, das Geld reichte auch da noch eine Weile. Sie telegraphierte aber von dort dann gleich an den Vater: „Überweise mir Reisegeld Hamburg —“ Genaue Adresse konnte sie da erst angeben. Und dann fuhren sie mit dem nächsten Dampfer nach Antofagasta. Zwischendeck, nicht erste Kajüte; dann reichte es auch für zwei.
Nun überlegten sie gemeinsam: bis Hamburg würden sie wandern, fuhren dazwischen auch streckenweise, gerade wie es sich am besten machte, um rasch und ungesehen vorwärtszukommen. Auf alle Fälle mussten sie bemüht sein, ihre Spur zu vermischen. In Hamburg war es dann so leicht zu verschwinden, Hamburg so gross, die Hafengegend voller Schlupfwinkel, da fand sie kein Mensch. Und so rasch wie möglich gingen sie dann aufs Schiff. Südamerikadampfer fuhren immerwährend, den ersten nach Valparaiso nahmen sie; von da nach Antofagasta, dem Hafen für Cochabamba, zu kommen, war’s eine Kleinigkeit. Nur der Tag, an dem sie fort wollten, stand noch nicht fest.
Zur Zeit lag Schnee und alles war noch zugefroren. Im Winter war es leider zu schwierig, sie mussten noch warten, erst mussten die Tage wenigstens länger und die Nächte kürzer sein, und wärmer, wärmer. Erst musste es Frühling werden.“
„Und dann —“, Hans-Joachim sagte es nachdenklich, und er war bleich, als er es sagte — „dann müssen wir doch erst einen Anlass haben, einen schwerwiegenden, unwiderleglichen Anlass, der uns einfach zwingt, alles hinter uns zu lassen.“
Alles hinter sich lassen?! Was liess Louisa zurück? Nichts. Aber Hans-Joachim verliess eine Mutter. Und dieser Gedanke presste ihm zuweilen Tränen aus, wenn er sich in der Nacht ruhelos warf. Er schlief schlecht; aber seine Träume waren noch schlechter, er schreckte oft aus ihnen auf über den eignen lauten Schrei. — — —
Das Umherwandern draussen hatte sich nun doch den ganzen Winter über nicht mehr durchführen lassen. Schon mehr als einmal war ihnen jemand begegnet und hatte ihnen verwundert nachgesehen: was suchte das junge Pärchen draussen bei solch einem Wetter, das man lieber im Zimmer abwartete? Was liefen die zwei auf Wegen, tief hinten im Park, wo das gefallene Laub fusshoch lag, oder gar weit draussen in der Öde der Felder, wo der Wind pfiff? Sie fielen auf. Und auch dunkle Abendstunden würden sie nicht mehr schützen vor neugierigen Blicken. Da kam Louisa auf den Gedanken, ihn einzulassen, wenn die Tante im Theater oder in Gesellschaft war und ihr Ausgehen auch von der Köchin gern benutzt wurde. Sie redete der vielleicht noch pflichtbewusst Zögernden eifrig zu: warum denn nicht gehen? Sie selber legte sich ja zu Bett, zog die Decke über die Ohren und würde gleich einschlafen. Wovor sollte sie sich denn fürchten? Aber kaum war das Mädchen fort, so öffnete sie das Fenster; ihr leiser Pfiff drang in die Nacht hinaus, ihm antwortete ein anderer, und bald darauf kletterte Hans-Joachim über die Pforte. Sie führte ihn ins warme Zimmer, er war ganz verklammt, schon lange hatte er draussen stehen müssen. Sie freute sich bedenkenlos, sie hatten ja nun zwei Stunden vor sich, noch mehr. Aber er kam zu keiner inneren Ruhe, schon nach einer Stunde ging er wieder, schlich fort, schwer beladen mit der Angst: komme ich auch wieder ungesehen und ungehört in meine Stube? Nicht die Angst vorm Vater allein war es, die ritterliche Angst um Louisa war viel grösser. Zehnmal sagte er ihr: „Es ist besser, ich komme nicht mehr.“ — — —
Hatte das Mädchen sie verraten? Oder warum war die Tante früher nach Hause gekommen? Die musste leise gegangen sein, plötzlich stand sie in der Stubentür.
Das junge Mädchen sass im Sofa, der junge Mann in einem Sessel, sie waren sich nicht verfänglich nah, und doch war Hans-Joachim so entsetzt, dass er kein Wort hervorbringen konnte, nur aufsprang und einen Kratzfuss scharrte.
Es war für die Erfahrene genug gewesen: dies konnte sie denn doch nicht länger geschehen lassen. Sie wartete ab, bis sie den Major zu seiner täglichen Promenade fortgehen sah, und dann ging sie hinüber, um doch lieber erst einmal mit der Majorin allein zu sprechen. Wäre Frau Frieda Seehoff selber Mutter gewesen, so wäre sie vielleicht noch schonsamer vorgegangen, sie bekam selber einen Schrecken über den Schreck, den die arme Mutter bekam.
Frau von Pfahl verlor alle Farbe, sie zitterte: „Wenn das mein Mann erfährt, o Gott, wenn das mein Mann erfährt! Er schlägt den Jungen — o mein Gott!“
— — — — — — — — — — — — — — — —
Nun war der Anlass gekommen, der sie unwiderruflich forttrieb. Jetzt war der Tag da — der Tag? Nein, die Nacht. Der junge Mensch, der ein paar Sachen hastig in seinen Rucksack warf, murmelte zwischen den Zähnen: „Ihr habt’s ja nicht anders gewollt.“ Kein schmerzlicher Gedanke an seine Mutter war mehr in ihm, nur Hass, Empörung, wilde Empörung gegen seinen Vater. Der hatte ihn in seiner Ehre gekränkt, ihn beleidigt, hatte ihn, der demnächst Primaner wurde, gezüchtigt wie einen dummen Jungen. Gewiss, es war unpassend gewesen, zumindesten ungewöhnlich, bei nachtschlafender Zeit in anderer Leute Wohnung bei einem jungen Mädchen zu sitzen — aber was war denn Unrechtes geschehen? Nichts, gar nichts.
Er kramte hastig in seinen paar Sachen: Papiere, halt, ihn ausweisende Papiere, die würde er wohl auch haben müssen! Er hatte keine. Nur den Konfirmationsschein. Die Mutter hatte den mit einem gestickten Rähmchen versehen und ihm übers Bett gehängt; er brach ihn aus der Umrahmung, besser als nichts. Auch seine Schulzeugnisse waren da, er steckte sie ein. Das würde wohl genügen, sich auszuweisen. Lächerlich, geradezu lächerlich kam ihm das vor. Er sah sich mit verwirrten Augen um: wie schrecklich war dies alles, wie schrecklich! Er hatte diese Stube mit ihren Kerkerwänden immer verabscheut, nun kam es ihm entsetzlich vor, sie verlassen zu müssen.
Einen Revolver! Wenn er nur einen Revolver hätte! Man musste doch irgendeine Schutzwaffe haben, wenn es galt, sich zu verteidigen. Und wer weiss, ob er sich nicht verteidigen musste, sich und Louisa gegen Landstreicher, Diebe, Mörder, gegen all das Gesindel, das auf der Strasse herumlief. Hatte der Vater nicht eine Schutzwaffe? Ja, einen alten Armeerevolver; er lag in dem Schreibtisch, der im Esszimmer stand. Linke Seite, unteres Schubfach.
Ob der Schlüssel steckte? Schon war er drüben. Er war auf Strümpfen geschlichen, er hatte Glück. Die Eltern waren im Bett, er hörte ihre Stimmen im Schlafzimmer. Es interessierte ihn nicht, was sie sprachen. Die flehende Stimme der Mutter machte keinen Eindruck auf ihn, er hörte nur das Pulsen des eigenen Blutes. Er steckte den Schlüssel ins untere linke Schubfach — da war der Revolver — da auch ein Schächtelchen mit Munition. Er nahm beides. In wilder Freude schlich er dann in sein Zimmer zurück: nun konnte ihm keiner mehr etwas antun! —
Zu gleicher Stunde packte drüben Louisa. Sie war ein Mädchen, sie packte mit mehr Bedacht. Ein wenig Wäsche, Kamm, Seife, Bürste und ein Spiegelchen, aus dem ihr bleiches Gesicht mit den übernächtigen Augen sie jetzt seltsam ansah. Hatte sie Geld genommen, war sie jetzt eine Diebin? Sie lächelte trotz aller Verstörung: nein, o nein, es war ja ihr eigenes Geld, das Geld ihres Vaters, das er gerade gestern an die Tante geschickt hatte, die Pension für ein Vierteljahr und Geld für alle Ausgaben. In überall geltenden guten Dollars. Viel Geld! Aber sie hatten ja auch Geld nötig. Triumphierend steckte sie es in ein Täschchen und barg das in den kleinen Handkoffer, den sie mitnehmen wollte. Leichtes Gepäck, und doch war ihre ganze Zukunft darin.
Sie hörte einen leisen Pfiff wie den unheimlich klagenden Ruf des Käuzchens — so pfiff das zuweilen in der einsamsten Nacht — aber jetzt war er es. Er! Sie kletterte aus dem Fenster, rutschte an einem Baum herab, der unter dem Fenster ihres Zimmers im ersten Stockwerk stand. Es ging ganz gut und ganz rasch. Sie kletterte über den Zaun, die entblätterten Rosenranken suchten sie festzuhalten, aber sie riss sich los. Sie lachte, sie stand auf der Strasse.
3. Kapitel
Der vorsitzende Richter mit klugen Augen in einem schon müden, aber jetzt gespannt aufmerksamen Gesicht fixierte ihn beständig: „Von Pfahl“ — er sagte nicht Angeklagter — „also Sie bleiben dabei, dass Sie keine Ahnung davon gehabt haben, dass die Louisa Bender sich erschiessen wollte?“
„Ja.“
„Sie merkten keine Absicht? Sie bemerkten auch! vorher niemals an ihr eine Exaltation, die sich bis zum Selbstmord steigern könnte?“
„Keine.“
„Nicht nur, als Sie da zusammen verlassen und hilflos im Busch lagen, sondern auch schon vorher, in den ersten Tagen Ihrer Flucht?“
„Nein.“
„Auch noch früher, als Sie noch zu Hause waren und miteinander verkehrten, hat da die Bender niemals eine diesbezügliche Äusserung getan? Hat sie Ihnen nicht etwa vorgeschlagen, dass, falls die verabredete Flucht vereitelt werden, oder wenn sich Ihnen unterwegs irgend etwas hindernd entgegenstellen sollte und sie zur Unmöglichkeit wurde, dass Sie beide sich dann erschiessen wollten?“
„Nein.“
„Besinnen Sie sich einmal gut, von Pfahl. Sie sind augenblicklich noch sehr geschwächt durch die Verwundung, die Sie sich beigebracht haben, verwirrt von Jammer und Entsetzen, als das Mädchen tot lag. Sie haben ein langes und schweres Krankenlager hinter sich. Es wird Ihnen vielleicht noch schwer werden, Ihre Gedanken zu ordnen, aber denken Sie einmal nach, sagte Ihre Freundin nicht: ,Erst erschiesst du mich, und dann erschiesst du dich?‘ Hören Sie gut zu: ,Erst mich. Und dann dich.‘ Kat sie nicht so gesagt?“
„Nein.“
„Und als Sie dann doch nicht wollten, und sie dann selber den Revolver nahm, konnten Sie da das Unglück nicht noch verhindern, indem Sie ihn ihr aus der Hand rissen?“
„Nein.“
„Der Angeklagte sagt immer nur ,Nein‘, höchstens einmal „Ja‘“, bemerkte jetzt der erste Beisitzer, der nicht die Geduld des Richters besass. Er gähnte verstohlen. „Er soll uns doch endlich einmal der Reihe nach erzählen, wie eigentlich die ganze Sache vor sich ging.“
„Also bitte!“ Der Richter machte eine auffordernde Handbewegung zu dem jungen Menschen hin, der schneebleich und vornübergeknickt auf seinem Stuhle mehr hing als sass. „Stehen Sie auf! Und nun erzählen Sie uns einmal.“
„Ich kann nicht.“ Hans-Joachim schüttelte sich wie in Grausen. Noch einmal das erzählen, was er schon mehrmals hatte erzählen müssen? „Ich kann nicht!“ Er zitterte.
„Nun, nun!“ Der Richter beschrichtigte. „Erregen Sie sich nicht so. Lassen wir das für später. Sagen Sie mir jetzt nur, wie kamen Sie eigentlich zu der Idee, mit Ihrer Freundin fortzulaufen? Sie hatten ein angenehmes Zuhause, eine Sie liebende sorgsame Mutter, Lehrer, die Sie als fähigen Schüler schätzten — ohne Ausnahme haben die Herren Ihnen ein gutes Zeugnis ausgestellt —, Sie hätten auch unter Ihren Mitschülern Freunde haben können, wenn Sie nur wollten, und vor allem, Sie haben einen hochachtbaren Vater, früheren Offizier, allererste Familie, wie konnten Sie diesem Manne, gerade solchem Vater, das antun?!“
Hans-Joachim hob mit heftigem Ruck das Gesicht aus den Händen: sollte er es nun sagen, gerade herausschreien in Hohn und Empörung: ja, solchen Vater! Einen ganz anderen Vater, wie Sie ihn sich denken, Herr! Hochachtbar — mag sein vor der Welt. Lieben will aber ein Sohn den Vater, und Liebe von ihm haben — ich liebe meinen Vater nicht, und er liebt mich nicht. Ich hasse ihn — ja, ich hasse ihn. Er hat mir meine Jugend verekelt mit seiner ewigen Unzufriedenheit und Nörgelei, er hat mir jede harmlose Freude vergällt, er hat durch seine eigene Bitterkeit, mit der er Menschen und Dinge — alles — verachtete, verspottete, die Schwingen, die andere in meinem Alter haben, gebrochen. Und ich wollte doch so gern fliegen. Sollte er das sagen? Den Vater so anklagen, daraus erklären, was ihn, den Sohn, zum Fortlaufen gebracht hatte? Ein angenehmes Zuhause?! Hatte der Vater nicht das Haus unerträglich gemacht, ihm und der Mutter? Wie oft hatte er deren heimliche Tränen gesehen — ach, seine arme Mutter! Schon öffnete Hans-Joachim den Mund — Zorn, Hass, Wut waren übergross —, aber er schloss ihn doch wieder. Nein, das konnte er seiner Mutter nicht antun! Vor diesen fremden gleichgültigen Menschen nicht auskramen, was verschlossen bleiben musste — geheimes Leid, das niemandem etwas angeht. Er presste die Lippen zusammen und sagte kein Wort.
„Es muss doch etwas Unwiderstehliches gewesen sein, was Sie mit dem Mädchen forttrieb?“
„Wir fühlten uns unglücklich.“
„Aber warum denn unglücklich?“
„Ich weiss es nicht.“
„Natürlich wissen Sie es, Sie wollen es nur nicht sagen. Sie können sich aber ruhig hier aussprechen, junger Mann, ohne Scheu. Ich sowie die beiden Herren Schöffen und hier die Dame vom Jugendamt, unsere bewährte Beisitzerin, wir alle haben Verständnis. Ich habe zudem Söhne, ungefähr so alt wie Sie — Sie werden demnächst siebzehn, nicht wahr? — ich weiss, dieses Alter birgt Gefahren in sich, darum sagen Sie mir offen: Sie haben für das junge Mädchen andere Gefühle gehabt, als nur rein freundschaftliche. Und jene für Sie auch. Nun strebten Sie beide danach — etwas strebte in Ihnen mit Gewalt danach — einander restlos anzugehören. Und das trieb Sie fort. War es nicht so?“ Die klugen Augen forschten.
In Hans-Joachims krankes blasses Gesicht stieg es rot: Scham. Es wurde auf einmal heiss, glühend heiss im Saal, vorher hatte es ihn sehr gefroren. Wie einen Ausweg suchend, sah er sich um: nackte Bänke ohne jegliche Polsterung, Gesichter voll nackter Neugier, nackte Seelen, bar jeder Schamhaftigkeit — nein, er konnte nicht antworten. Sollte, müsste er dann nicht sagen, dass Louisa sich verlangend an ihn geschmiegt hatte in jener Nacht zu zweien in dem einsamen Zimmer? Konnte er das? Krampfhaft fingerten seine Hände an der Hosennaht, er öffnete den Mund, als möchte er etwas sagen, und schloss ihn doch wieder. Er renkte den Kopf und schlug die Augen nieder.
„Sehen Sie mich doch an“, sagte der Richter, aber er sagte es nicht streng. Dieser blasse junge Mensch, den seelische Qual zu foltern schien, tat ihm leid. Und als fühle der Angeklagte dieses Leidtun, so hob er jetzt den Blick. Augen, tiefdunkel vor Traurigkeit, sahen den Richter an, suchten voller Hilflosigkeit in dessen Augen. Es wurde dem Erfahrenen klar, dass er auf dem richtigen Wege war. Dieses zögernde Verstummen, dieses Ausbleiben der Antwort, diese ganze Verlegenheit liessen es ja erkennen, der junge Mensch wollte nicht antworten, um das Mädchen nicht zu verraten; in einer gewissen Ritterlichkeit es nicht dulden, dass des Mädchens Keuschheit in Frage kam. Anständig von dem Jungen! Der sah ja auch anders aus als die meisten, die sonst hier vor ihm standen, verkümmert oder verkommen. Stumpfe, auch freche Gesichter. Dieses Gesicht war durchaus sympathisch: ein gutgeschnittenes Gesicht mit einer schönen intelligenten Stirn unterm düster beschattenden Haar. So schuldig, wie man anfänglich gedacht, war der junge Mensch sicherlich nicht. Vielleicht war sie, obgleich die jüngere, doch die treibende Kraft gewesen, war ihm mehr entgegengekommen als er ihr. Er holte vorsichtig aus:
„Nun weiter, Pfahl! Also Sie fühlten sich unglücklich und verabredeten sich, zu fliehen. Louisa Bender hat einen reichen Vater in Südamerika, Sie hofften nach drüben zu kommen, nicht wahr?“
Der Verhörte nickte stumm.
„So schlichen Sie also, als alle Angehörigen schliefen, sich fort, wanderten die Nacht und den ganzen Tag — bis wohin?“
„Wir kamen in ein Dorf, da schliefen wir.“
„Wo denn? Nahmen Sie sich ein Zimmer?“
„Ich kroch auf den Heuboden, Louisa bekam ein Bett bei der Tochter von der Frau, die die kleine Wirtschaft hatte.“
„Na, da ging es Ihnen also noch ganz gut. Und dann — erzählen Sie weiter!“
„Dann gingen wir weiter, immer weiter.“
„Ja, sahen Sie denn nicht, wie sinnlos, wie planlos das alles war?“
„Wir wollten nach Bolivien. Wir dachten uns das so wunderschön. Wir hatten uns ganz da hineingeträumt, wir dachten und sprachen lange schon von nichts anderem mehr. Wir suchten an die Eisenbahnstrecke nach Hamburg zu kommen. Da wollten wir dann aufs Schiff. Cochabamba, da wohnt Louisas Vater. Sie wollte gleich ein Kabel an ihn schicken von Hamburg.“
„Und Geld, woher hatten Sie denn das für die Überfahrt nötige Geld?“
„Louisa hatte das Geld dazu“, sagte Hans-Joachim, und der Richter setzte nicht hinzu: ,von der Tante gestohlen‘, obgleich er das wusste. Das hätte den Angeklagten ja auch sofort verstummen lassen, und er war doch froh, dass dieser jetzt endlich erzählte. So sagte er nur: „Kamen Sie denn nun an die rechte Station?“
„Ja, am Abend. Aber mir hatten kein Glück.“ Es klang sehr traurig. „Der Zug ging gerade fort, wir hörten noch aus der Ferne sein Pfeifen. Wir mussten bleiben, Louisa war schon sehr müde. Es war ein Gasthof da ,Zur letzten Ecke‘ — eine grauenhafte Spelunke. Und da —“ Er stockte. Es war, als schnüre ihm etwas den Hals zu.
„Also da blieben Sie nun. Und nahmen zwei Zimmer — zwei oder eins?“ Es kam keine Antiport. „Also eins“, fuhr unerbittlich der Frager fort, aber freundlich, als fände er das so ganz in der Ordnung. „Und wieviel Betten waren in diesem einen Zimmer — zwei oder eins?“
„Zwei“, kam jetzt schnell eine Antwort. „Aber ich wollte nicht bleiben, heruntergehen, in der Gaststube sitzen die Nacht. Louisa wollte das aber nicht, sie stellte sich vor die Tür, sie liess mich nicht geben, sie war böse — sie hatte auch Angst.“
„Und da blieben Sie denn — blieben ganz gern, nicht wahr?“ Eine plötzliche Bewegung liess den Richter aufmerken, in das bleiche Gesicht des jungen Mannes schoss ein brennendes Rot. „Sie brauchen diese Frage mir gar nicht übel zu nehmen, es wäre ja wider die Natur, wenn Sie es nicht gern getan hätten. Ein junger Mann, ein junges Mädchen — dass es dann zu Vertraulichkeiten kam, das ist auch nur natürlich. Louisa liebte Sie sehr, nicht wahr?“
Stumm bejahendes Nicken.
„Und als sie sich dann zärtlich an Sie schmiegte, Sie küsste —?“
Plötzlich stand das grosse öde Zimmer ohne Gardinen, in der Mitte ein Tisch mit einem Waschbecken, zwei Stühlen und den beiden Betten, vor Hans-Joachims innerem Auge. Er glaubte wieder schlaflos in dem Bett an der einen Wand zu liegen und von der gegenüberliegenden Wand, von dem Bett da drüben, Louisa seufzen zu hören. Und dann flüsterte sie:
„Ich kann gar nicht schlafen. Unten johlten sie so. Du hast geschlafen. Du hast wohl auch nicht gehört, dass hier immer was huschte. Es kraspelte, mir war es, als wäre es hier drinnen — ich fürchte mich so, ach Gott, ach Gott!“ All ihr Mut schien sie verlassen zu haben.
Weinte sie? Reuevoll stieg es in ihm auf: ob er hinüberging, sich an ihr Bett setzte, ihre Hand nahm, die tröstend hielt? Noch überlegte er, da war sie schon bei ihm.
Sie schlüpfte zu ihm ins Bett, ihre nackten Füsse so kalt, ihr ganzer Körper wie Eis. Sie zitterte: „Hier ist es furchtbar, ganz furchtbar. Hier ist eine Mörderhöhle, glaube ich. Behalte mich bei dir, o ich fürchte mich so, ich fürchte mich so!“ Sie schmiegte sich enger an ihn.
Er fühlte ihre kalten glatten Beine; ihre kalten glatten Arme umschlangen ihn, er fühlte ihren Mund an seinem Ohr, trotz ihrer Kälte waren die Lippen so heiss. Sie glühten jetzt an seiner Wange, und da blieben sie haften.
Stunden verrannen, aber wie langsam! Ewigkeiten, sie quälten ihn. Er hatte den einen Arm um ihren Hals gelegt, mit der freien Hand streichelte er ihr das Haar. Das beruhigte sie. Sie seufzte, seufzte mehrmals, dann schlief sie ein. Aber er schlief nicht, lag stumm, wagte kaum zu atmen, hielt sich so, steif und regungslos, bis der Morgen graute — — —
„Es ist nicht so, wie Sie sich das denken, Herr, nicht so!“ stiess der Angeklagte plötzlich heraus, rauh, abgerissen, jedes Wort wie zerhackt. Und er schrie es fast, dass es laut im leeren Saal widerhallte: „Ich habe Louisa als Kamerad angesehen, als Schwester, ich habe Louisa nicht angerührt!“
Stille im Saal. Nur ganz hinten in einer entfernten Nische ein leises Sichregen.