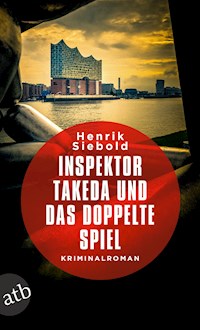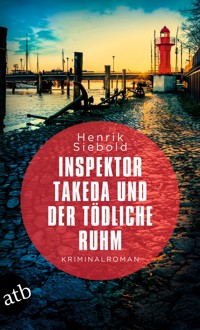9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Takeda ermittelt
- Sprache: Deutsch
Mordfälle ohne Motiv?
Eigentlich scheint der Fall klar. Ein junger Mann hat eine Frau auf einem Hamburger S-Bahnhof vor einen Zug gestoßen. Er leugnet jedoch, und plötzlich sind die Zeugen unsicher. Inspektor Kenjiro Takeda und seine Kollegin Claudia Harms müssen den siebzehnjährigen Simon wieder gehen lassen. Doch wo immer er auftaucht, passieren weitere Todesfälle. Claudia ist verzweifelt, weil es niemals sichere Beweise gibt, doch Takeda, ganz intuitiver Ermittler, hat eine andere Vermutung. Jemand benutzt Simon, um seine eigenen Taten zu verdecken ... Inspektor Takeda, begnadeter Saxophonist und Jazzliebhaber, muss an seine Grenzen gehen – und noch ein Stück darüber hinaus.
»Besticht durch seinen richtig guten Plot, seine interessanten Figuren und die politische Dimension des Geschehens.« General-Anzeiger.
»Inspektor Ken Takeda ... für mich einer der interessantesten, eigenwilligsten und attraktivsten Kommissare, die momentan in der deutschen Krimiszene unterwegs sind.« Cornelia Hüppe, Krimibuchhandlung Miss Marple, Berlin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über das Buch
Mordfälle scheinbar ohne Motiv.
Eigentlich scheint der Fall klar. Ein junger Mann hat eine Frau auf einem Hamburger S-Bahnhof vor einen Zug gestoßen. Er leugnet jedoch, und plötzlich sind die Zeugen unsicher. Inspektor Kenjiro Takeda und seine Kollegin Claudia Harms müssen den siebzehnjährigen Simon wieder gehen lassen. Doch wo immer er auftaucht, passieren weitere Todesfälle. Claudia ist verzweifelt, weil es niemals sichere Beweise gibt, doch Takeda, ganz intuitiver Ermittler, hat eine andere Vermutung. Jemand benutzt Simon, um seine eigenen Taten zu verdecken.
Inspektor Takeda, begnadeter Saxophonist und Jazzliebhaber, muss an seine Grenzen gehen – und noch ein Stück darüber hinaus.
»Besticht durch seinen richtig guten Plot, seine interessanten Figuren und die politische Dimension des Geschehens.« General-Anzeiger
Über Henrik Siebold
Henrik Siebold ist Journalist und Buchautor. Er hat unter anderem für eine japanische Tageszeitung gearbeitet sowie mehrere Jahre in Tokio gelebt. Bisher erschien im Aufbau Taschenbuch: »Inspektor Takeda und die Toten von Altona«, »Inspektor Takeda und der leise Tod« und »Inspektor Takeda und das doppelte Spiel«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Henrik Siebold
Inspektor Takeda und der lächelnde Mörder
Kriminalroman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Impressum
Prolog
Über Hamburg wölbte sich ein hoher, strahlend blauer Herbsthimmel. Ein kühler Morgenwind fegte abgefallene Blätter über die Straßen, und in der Luft lag der modrig süße Duft der Fäulnis. Die Erinnerung an ein paar überraschend warme Oktobertage war kaum verblasst, doch mit dem November waren die Nächte kalt geworden und die meisten Tage grau.
Im Hamburger Dammtorbahnhof nahm kaum jemand Notiz vom Wandel der Jahreszeiten, hier herrschte hektische Morgenstimmung. Berufspendler, Studenten, ein paar Reisende drängelten sich auf dem S-Bahnsteig. Eine junge Frau redete zu laut am Handy über intime Erlebnisse am Vorabend. Unweit deckte ein telefonierender Geschäftsmann den Mund mit der freien Hand ab, als befürchtete er, ein Lippenleser könnte Firmengeheimnisse ausforschen. Aus Coffee-to-go-Bechern stieg Dampf auf, eine Büroangestellte trank mit sinnlich geschlossenen Augen. Ein paar Meter weiter stand eine größere Schülergruppe, die zu einer Exkursion aufgebrochen war. Die Schüler, sechzehn, siebzehn Jahre alt, redeten durcheinander, lachten, schubsten sich gegenseitig, machten Fotos und Videos mit ihren Handys. Ihr Lehrer ermahnte sie mit müdem Blick, andere Fahrgäste nicht zu stören, aber er rechnete offenbar nicht damit, gehört zu werden.
Die ganz normale Szenerie eines Morgens, der so oder ähnlich an unzähligen Orten in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt stattfand.
Aber war dieser Morgen wirklich normal? War da unter der Oberfläche des Alltags nicht ein leises Knirschen zu hören, ein dumpfes Splittern, ausgelöst durch Verschiebungen in den tiefliegenden Fundamenten der Gesellschaft?
Baute sich unter der Oberfläche dieses so alltäglichen Morgens nicht eine Spannung auf, die sich bald schon mit voller Wucht entladen könnte?
Wo aber war das Problem? Waren es die Flüchtlinge, die sich ebenfalls auf dem Bahnhof aufhielten? Oder vielleicht der hustende Angestellte mit dem schon am Morgen überspannten Gesichtsausdruck? Was war mit den Touristen, die sich in einer unbekannten osteuropäischen Sprache unterhielten? Oder ging etwa von der Schülergruppe, die doch so verspielt und unschuldig wirkte, Gefahr aus?
Die Stimme des Bahnhofssprechers legte sich über das Gemurmel der Menge, kündigte die nächste S-Bahn an. Sekunden später fuhr der Zug mit hoher Geschwindigkeit in den Bahnhof ein.
Der Geschäftsmann hörte auf zu husten, die Flüchtlinge erhoben sich von der Bank, auf der sie saßen, die Touristen nahmen ihr Gepäck auf. Die Schüler drängelten weiter nach vorne wie unruhige Atome in einem sich erhitzenden Gasgemisch. Der einfahrende Zug war nur noch wenige Meter entfernt. Ein Schüler, hochgewachsen und blass, stand weit vorne an der Bahnsteigkante. Er war stiller als die anderen, wirkte in sich gekehrt, beteiligte sich nicht an den Neckereien seiner Klassenkameraden. Eine Geschäftsfrau im figurbetonten Business-Dress lief mit klackernden Absätzen am Bahnsteig entlang, blieb jetzt genau vor dem stillen Schüler stehen. Der Zug raste heran, ließ sein ohrenbetäubendes Horn erklingen wie immer bei der Einfahrt in einen überfüllten Bahnhof. Drei Meter, zwei, einer. Der blasse Junge hebt den Kopf, ein Lächeln erscheint auf seinem Gesicht. Im nächsten Moment strauchelt die Frau im Kostüm, kämpft mit dem Gleichgewicht, rudert mit den Armen. Der Zug ist fast da. Die Frau stürzt in rasender Langsamkeit nach vorne. Hinter der Frontscheibe des Zuges verzerrt sich das Gesicht des Fahrers. Die Frau fällt. Die Umstehenden wollen nicht glauben, was sie sehen. Nur der Junge, er lächelt. Die Bremsen des Zuges kreischen, der Triebwagen schlittert auf den Schienen. Es geht um Zentimeter. Es könnte klappen. Aber nein, die Frau fällt, schreit, wird mit einem kurzen, klatschenden Geräusch vom Zug erfasst. Blut spritzt über die Bahnsteigkante, der Klang splitternder Knochen brennt sich in die Seelen der Umstehenden. Der Tod ist jäh in den Morgen eingebrochen.
Dann ist es vollkommen still.
Nichts rührt sich.
Nur das Blut fließt zäh über den Bahnsteig.
Erst mit Verzögerung entsteht eine kleine, zarte Bewegung. Die Schüler ziehen sich zurück wie das Meer von einem Strand, lassen einen Halbkreis der Leere zurück. In dessen Zentrum steht ihr blasser, hochgewachsener Klassenkamerad. Er starrt auf seine Hände, die Handflächen zu sich gewandt. Hände, die ihm bis gerade eben noch nutzlos erschienen waren, so nutzlos wie sein ganzes Leben. Nun waren diese Hände zu mächtigen Instrumenten geworden, die über Leben und Tod entschieden hatten.
Dann zerreißt der Schrei eines Mädchens die Stille. Es zeigt mit dem Finger auf den blassen Jungen, ihren Mitschüler. Das Mädchen schreit immer weiter mit sich überschlagender, hysterischer Stimme.
Ein Schüler tritt aus dem Kreis heraus, geht auf den hageren Jungen zu und sagt: »Du Mörder!«
Der Junge blickt auf, nickt seinem Klassenkameraden zu und lächelt voller Glückseligkeit.
1.
Zwei Stunden später herrschte im Trakt der Mordkommission im Hamburger Polizeipräsidium ein heilloses Durcheinander. Nervöse Beamte hasteten durch die Korridore, verstörte Schüler warteten auf den Bänken, um ihre Aussagen zu machen, wurden eingerahmt von weinenden Müttern und drohenden Vätern. Simon Kallweit, der mutmaßliche Täter, saß unter Bewachung eines uniformierten Beamten in einem Dienstzimmer und sah seiner ersten Vernehmung entgegen. Markus Tellkamp, der Leiter der Spurensicherung, rief quer über den Flur und gab die neuesten Ergebnisse durch. Die Kollegen von der KTU drängelten genervt durch die Menge, wieder einmal konnte nichts schnell genug gehen, DNA-Tests, Blutgruppenuntersuchung, Zeitdiagramme, vergleichbare Zugunfälle, wieder einmal sollten sie das Unmögliche möglich machen. Und ständig klingelte ein Telefon, die Staatsanwaltschaft, die Presse, Politiker, besorgte Bürger, die ersten Trittbrettfahrer, die Bahn, die endlich den regulären Betrieb aufnehmen wollte.
Inmitten dieses polizeilichen Wirbelsturms saß ein Japaner mit untergeschlagenen Beinen auf seinem Schreibtischstuhl und war vollkommen still. Inspektor Kenjiro Takeda. Er hatte die Augen geschlossen, atmete langsam. Nur die kleine Stirnfalte verriet seine Konzentration. Er war der Fels in der Brandung, ein Buddha in der Großstadt, der Inbegriff der totalen Ruhe, obwohl er doch, gemeinsam mit seiner Kollegin Claudia Harms, der leitende Ermittler im Fall des S-Bahn-Schubsers war.
Niemand wagte es, den Inspektor zu stören. Niemand sprach ihn an, fragte nach Instruktionen, gab Ermittlungsergebnisse an ihn weiter. Im Gegenteil, die Kollegen sorgten sogar dafür, dass Takeda nicht gestört wurde.
Glaubten sie also, dass sich der Inspektor in eine tiefe Meditation über den Fall versenkt hatte? Dass er, der aus dem Land des Zen-Buddhismus stammte, in tiefer Kontemplation war und die spirituellen Tiefen des schrecklichen Verbrechens auslotete?
Eher nicht.
Schließlich kannten die deutschen Kollegen Takeda inzwischen. Sie wussten also, dass er vermutlich nicht meditierte, sondern einfach nur schrecklich verkatert war. Das erklärte auch die kleinen Opfergaben, die sie in aller Stille vor dem Inspektor auf dem Schreibtisch aufgebaut hatten: Aspirin-Röhrchen, Thomapyrin-Tabletten, Alka-Seltzer-Packungen …
Es ging Takeda wirklich nicht gut. Seine Schläfen pochten, sein Mund fühlte sich pelzig an, und anstatt über den Fall nachzudenken, stellte er sich immerfort eine einzige Frage, nämlich warum er in der vergangenen Nacht nach dem vielen Bier auch noch unbedingt hatte Whisky trinken müssen.
Andererseits, bereute er es wirklich? Nicht im Geringsten! Schließlich hatte ihm der vorangegangene Abend einige aufschlussreiche Erkenntnisse beschert, über sich selbst, über Deutschland, über seine japanische Heimat.
Alles hatte mit einem Abendessen mit zwei japanischen Geschäftsleuten begonnen, Ichirō Kogawa und Atsuto Kawamura. Gemeinsam waren sie im Gröninger eingekehrt, einem traditionellen Hamburger Brauereirestaurant in einem Gewölbekeller an der Willy-Brandt-Straße. Während die Kellnerin die ersten Biere brachte, fand Takeda sich in einem Gespräch wieder, das ihn überraschte und schon nach wenigen Minuten in eine melancholische Stimmung versetzte. Kogawa und Kawamura, beide waren in ihren Dreißigern und zugleich auf eigentümlich japanische Art alterslos, erzählten von ihren Firmen, Dienstwagen, ihren Hamburger Wohnungen, von Ausflügen nach Lüneburg, Lübeck und auf die Insel Sylt. Sie lobten die Pünktlichkeit der deutschen Bahn, die Beflissenheit der deutschen Bevölkerung, die Präzision der Handwerker, den formidablen Zustand der Straßen und die unübertroffene Qualität der Autos. Als die Kellnerin das Essen brachte, Schweinshaxe, Rostbratwürste und eine Aufschnittplatte, nahmen die beiden demonstrative Bissen, kauten mit konzentrierter Miene, brachen dann in begeisterte Umai-Umai-Rufe aus! Köstlich! Köstlich!
Takeda? Er nickte höflich, schwieg und lächelte feinsinnig. Eine pünktliche Bahn? Hatte er in Deutschland noch nicht erlebt. Geflissentliche Einheimische? Nun ja. Handwerker? Eine Katastrophe. Die Straßen? Voller Schlaglöcher! Deutsche Autos? Sicher, die waren spitze, sah man einmal von den Diesel-Betrügereien ab … Nein, das Deutschland, in dem er lebte, hatte offenbar wenig mit jenem Märchenland zu tun, in dem Kogawa und Kawamura sich wähnten.
Das sollte natürlich nicht heißen, dass Takeda sich in Deutschland nicht wohlfühlte. Im Gegenteil! Er war nach dem knapp halben Jahr, das er nun hier war, so ausgeglichen und zufrieden wie lange nicht mehr. Und dieses chaotische, improvisierte, ja geradezu orientalische Land, in das Deutschland sich verwandelt hatte, gefiel ihm gut – viel besser, als es das traditionelle, ordentliche, fleißige, spießige Deutschland getan hätte.
Takeda spürte Freiheit, Leben, Leidenschaft. Er war dank des Austauschprogramms der Polizeiorganisationen, das ihm den Aufenthalt in Hamburg ermöglicht hatte, auf eine tiefe, fast spirituelle Art … glücklich.
Aber – und das war wohl der Unterschied zu Kogawa und Kawamura – er machte sich eben auch keine Illusionen. Seine neue Heimat entsprach nun einmal nicht dem Bild, das die Reiseführer entwarfen und in dem Deutschland immer noch das Land der Fachwerkhäuser und Handwerksmeister, der Erfinder und Ingenieure, der Dichter und Denker war. Das Bild, an das Kogawa und Kawamura sich klammerten und das sich offenbar auch durch keine reale Erfahrung erschüttern ließ, war überholt. Aber sie liebten es so sehr, dass sie um jeden Preis daran festhielten.
Die Melancholie des Inspektors setzte ein, als seine Landsleute über ihre bevorstehende Rückkehr nach Japan sprachen, der sie – trotz dieses wunderbaren Deutschlands – entgegenfieberten. Schließlich sei es für einen Japaner nicht empfehlenswert, allzu lange der Heimat fernzubleiben. Ein Jahr im Ausland sei in Ordnung, auch zwei und zur höchsten Not auch drei. Danach aber würde die Rückkehr schwierig, denn die fremde Umgebung beginne das Innere zu verändern, das Wesen, die Seele. Wer zu lange in der Fremde bleibe, füge sich anschließend nicht mehr nahtlos ins dichte Geflecht der japanischen Gesellschaft ein, wäre dazu verdammt, ein wurzelloses, schwebendes Leben zu führen … Kogawa und Kawamura sprachen von ihrem Auslandsaufenthalt fast so, als handele es sich um eine infektiöse Krankheit, und ihr Hauptaugenmerk bestand darin, sich möglichst nicht anzustecken mit diesem Virus des Fremden, des Neuen, des Anderen.
Nachdem Takeda sich von den Geschäftsleuten verabschiedet hatte – alle drei torkelten nach etlichen Bieren aus dem Gröninger auf die Straße –, winkte er sich ein Taxi heran. Der Inspektor ließ sich allerdings nicht nach Hause fahren, sondern ins Bird’s, seinem inzwischen angestammten Jazzclub in Hamburg-Eimsbüttel. Dort stand er dann gegen Mitternacht auf der Bühne und improvisierte mit seinem Yanagisawa-Saxophon leidenschaftlich zu einem Thema von John Coltrane. My favourite things. Er wurde begleitet von ein paar Studenten, von denen einer aus der Türkei stammte und ein anderer aus Ghana. Deutsche. Neue Deutsche. Keine Fachwerkhäuser mehr, keine blonden Haare, keine deutsche Disziplin. Das hier, das unordentliche, das bunte, das verwirrende Deutschland, war das Land, das Takeda zu lieben gelernt hatte. Ja, er hatte sich mit dem Virus des Fremden angesteckt, und er bereute es nicht im Geringsten.
Dumm nur, dass er seine euphorische Stimmung mit reichlich Whisky begoß.
Inspektor Kenjiro Takeda öffnete schlagartig die Augen, war wieder in der Gegenwart, war wieder im Präsidium. Die Stimme von Claudia Harms, seiner Team-Partnerin bei der Mordkommission, hatte ihn aus seinen Gedanken gerissen. Sie steckte den Kopf in ihr gemeinsames Dienstzimmer, betrachtete ihn amüsiert und fragte: »Zen? Oder Hangover?«
»Beides«, antwortete der Inspektor lächelnd.
»Dann werfen Sie mal ein Aspirin ein und kommen in die Hufe. Es gibt Arbeit!«
»Kein Problem. Jetzt geht es mir gut.«
Claudia war am Morgen direkt von zuhause zum Dammtorbahnhof gefahren und hatte die Ermittlungen vor Ort koordiniert, während Takeda hier im Präsidium die Stellung gehalten hatte. Nun war auch sie hier, sagte: »Kommen Sie. Der Psychologe hat grünes Licht gegeben, wir können Simon Kallweit vernehmen.«
Takeda stand auf und drückte das Kreuz durch. »Vielleicht können wir uns vorher noch einen Kaffee besorgen. Der Junge läuft uns ja nicht weg.«
Claudia lächelte. »Sie machen Fortschritte, Ken. Besonders in Ihrer Arbeitseinstellung. Bei Ihrer Ankunft hätten Sie so etwas noch nicht gesagt.«
»Finden Sie?«
»Klar. Sie sind nicht mehr ganz so japanisch.«
Takeda sah sie verunsichert an. »Ist das ein Kompliment?«
»Worauf Sie einen lassen können.«
2.
Claudia betrat mit Takeda die Cafeteria im Erdgeschoss des Präsidiums. Ein paar der zivilen Angestellten und einige Uniformierte saßen an den Tischen, tranken Kaffee und aßen belegte Brötchen. In der Luft hing schon der Duft des Mittagessens, das wegen der Schichtdienstler bereits ab dem späten Vormittag ausgegeben wurde. Claudia tippte auf Gulasch und Linseneintopf. Beide Gerüche halfen ihr nicht unbedingt dabei, die Übelkeit zu überwinden, die sie seit dem Morgen, genauer gesagt, seit dem Moment, als sie den Bahnsteig im Dammtorbahnhof betreten hatte, verspürte.
Im Laufe ihrer Dienstjahre hatte Claudia schon so manchen Mist und manche Abscheulichkeit erlebt. Axtmorde, Säureattentate, Leichenhäcksler. Nichts davon war leicht zu ertragen. Aber ein Teenager, der aus einer reinen Laune heraus eine ihm völlig fremde Frau vor die S-Bahn stieß? Und zwar offenbar nur, weil ihm langweilig war und sich gerade die Gelegenheit bot? Das war selbst für sie zu viel.
Immerhin würden sie die Sache schnell vom Tisch bekommen. An der Täterschaft des Jungen bestand kein Zweifel. Simon Kallweit – er war siebzehn Jahre alt – hatte bisher zwar kaum etwas gesagt. Aber zumindest hatte er die Tat gestanden. Außerdem gab es unzählige Zeugen, Simons Mitschüler, andere Fahrgäste, die das Geschehen auf dem Bahnsteig beobachtet hatten.
Auf die bevorstehende Vernehmung war Claudia dennoch nicht scharf. Es würde sie sicherlich ihre ganze Selbstbeherrschung kosten, dem Jungen nicht rechts und links ein paar Ohrfeigen zu geben. Sie hatte Kallweit vorhin am Dammtorbahnhof schon einmal kurz gesehen. Er hatte in einem Polizeibulli gesessen und auf ihre Frage, ob er die Tat zugebe, lächelnd geantwortet: »Sicher.«
»Sicher? Das ist deine Antwort?«
»Sie haben doch gefragt.«
»Findest du das hier lustig?«
»Nein. Wieso?«
»Soll ich dir einen Spiegel geben?«
»Ich wüsste nicht, wieso.«
Claudia war daraufhin ins Freie gesprungen, hatte die Tür des Bullis zugeworfen und etwas gesucht, woran sie ihre Wut auslassen konnte. Ein Papierkorb musste dran glauben, gegen den sie mit aller Macht trat. Es trug ihr ein paar verwunderte Blicke von Schaulustigen ein, war aber dennoch eine große Erleichterung.
Bevor sie dem Jungen nun hier im Präsidium erneut gegenübertreten musste, wollte sie noch einmal zur Ruhe kommen. Sie sah Takeda neugierig an und fragte: »Erzählen Sie mal. Was war gestern Nacht los? Waren Sie wieder einmal im Hotoke und haben die Geheimnisse des Single-Malt-Whiskys ergründet?«
Claudia wusste, dass Takeda in dem kleinen japanischen Restaurant im Hamburger Hafen Stammgast war. Er hatte dort sogar eine persönliche Flasche Whisky, auf der sein Name in japanischen Zeichen stand. Er trank möglichst nur Suntory Yamazaki, achtzehn Jahre alt. Er kostete über dreihundert Euro die Flasche, was Takeda aber nicht davon abhielt, an gut gelaunten Abenden mehr als eine davon zu leeren.
Takeda schüttelte lachend den Kopf. »Nein, nein. Ich war nicht im Hotoke. Aber mit dem Whisky haben Sie leider dennoch recht.« Er kniff die Augen zusammen und drückte sich demonstrativ mit den Zeigefingern auf die Schläfen. »Aber was ist mit Ihnen? Wie haben Sie den Abend verbracht?«
Claudia lächelte. »Ich war joggen und bin früh ins Bett gegangen. Keine nächtlichen Ausflüge, kein Alkohol. Ich war ein braves Mädchen.«
Takeda senkte schüchtern den Blick. Vermutlich war ihm nicht ganz klar, ob sich hinter dem Ausdruck braves Mädchen etwas Anzügliches verbarg. Mit Claudias immer mal wieder leicht anzüglichen Bemerkungen konnte er nicht gut umgehen. So deutsch war er dann doch noch nicht.
In diesem Falle aber waren Claudias Worte nichts als die Wahrheit. Sie war wirklich brav gewesen, wie schon in den ganzen zurückliegenden Tagen und Wochen. Keine Partynächte, keine Männergeschichten, nicht einmal ein ordentliches Besäufnis mit ihrer Freundin Gudrun. Ihr war einfach nicht danach. Es überraschte sie selbst am meisten. Noch vor wenigen Monaten hätte sie so ein Leben – ohne Exzesse, ohne verrückte Abenteuer, ohne One-Night-Stands – nicht ausgehalten. Besser gesagt, sie hätte sich selbst nicht ausgehalten.
Aber die Dinge hatten sich verändert. Sie hatte sich verändert. Warum? Wegen Takeda? Eine gewisse Rolle spielte er auf jeden Fall dabei.
Claudia genoss es, mit dem Inspektor zusammen zu sein, im Dienst, aber auch abseits der Polizeiarbeit. Sie waren in den zurückliegenden Wochen ein paar Mal gemeinsam abends unterwegs gewesen, waren in Jazzclubs, im Kino, auf Konzerten gewesen. An den Wochenenden hatten sie lange Spaziergänge am Elbstrand von Övelgönne unternommen. Erst vor zwei Tagen waren sie dort gewesen. Ein kalter Wind wehte über den Fluss, und Takeda trug zu seinem Trench eine FC-St.-Pauli-Pudelmütze, die die Kollegen ihm geschenkt hatten. Claudia lachte ihn von Herzen aus. Er lief rot an und stopfte die Mütze verschämt in die Manteltasche. Claudia bat ihn inständig, sie wieder aufzusetzen.
»Aber Sie lachen über mich!«, sagte der Inspektor.
»Doch nur, weil sie so süß damit aussehen.«
»Süß?«
»Kawaii«, erklärte sie. Das Wort hatte sie noch vor Takedas Ankunft in ihrem Wie-ticken-Japaner-Seminar gelernt, das sie in Vorbereitung auf ihre Zusammenarbeit besuchen durfte. »Kawaii heißt doch süß, oder?«
Takeda nickte und sagte gepresst: »Kawaii ist eigentlich … also es ist mehr ein Wort für Mädchen oder junge Frauen. Finden Sie, dass ich …«
»Unsinn«, fiel Claudia ihm ins Wort. »Was ich sagen wollte, ist …« Sie räusperte sich, fuhr dann fort: »Einen schönen Mann kann nichts entstellen.«
Takedas und ihr Blick begegneten sich, er lächelte, sie lächelte.
Claudia leerte ihren Kaffeebecher und schüttelte die Erinnerungen ab. Zu mehr als Komplimenten war es zwischen ihnen nicht gekommen. Und das war auch gut so. Schließlich waren sie in erster Linie eben doch Kollegen, mussten tagtäglich zusammenarbeiten. Es lief ganz gut. Warum die Dinge also unnötig verkomplizieren?
»Kommen Sie, Ken. Fahren wir wieder hoch und knöpfen uns diesen Simon Kallweit vor.«
Claudia und Takeda traten gerade aus dem Lift im vierten Stock des Präsidiums, als die Stimme von Holger Sauer, dem Leiter der Mordkommission, durch den Korridor hallte: »Kollegin Harms, einen Moment bitte.«
»Was ist denn? Wir sind wirklich verdammt busy, Chef.« Claudia gab sich keinerlei Mühe, die Genervtheit in ihrer Stimme zu kaschieren. Sauer wusste sowieso, was sie von ihm hielt: nicht viel. Die Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit.
»Offenbar hatten Sie Zeit genug, ausführlich mit dem Kollegen Takeda Kaffee zu trinken.«
»Ausführlich? Es waren gerade einmal …«
»Vierzehneinhalb Minuten«, sagte Takeda mit einem demonstrativen Blick auf seine Uhr. Zugleich machte er eine zackige, fast schon militärisch anmutende Verbeugung in Richtung Holger Sauer, wie er es immer tat, wenn er ihrem Vorgesetzten gegenübertrat. Und wie immer hätte Claudia dabei am liebsten laut herausgelacht.
»Außerdem war es kein Kaffeetrinken, sondern die dienstlich gebotene Vorbesprechung, um die Verhörstrategie festzulegen«, sagte sie.
Holger Sauer strich sich über seinen angegrauten Schnauzbart, eine Geste, bei der Claudia ein kalter Schauer über den Rücken lief. Der Kommissionsleiter wollte etwas sagen, wandte sich dann aber zunächst an Takeda: »Warum gehen Sie nicht schon einmal rein und unterhalten sich mit dem Jungen, Inspektor. Ich muss noch kurz eine Sache mit der Kollegin Harms klären.«
»Selbstverständlich«, sagte Takeda. Er verbeugte sich erneut, ging dann den Flur hinab in Richtung des Zimmers, in dem der Teenager festgehalten wurde.
Claudia wartete ein paar Sekunden, wandte sich dann an Sauer: »Was ist denn jetzt so wichtig, Herr Sauer? Ich finde es nämlich keine gute Idee, Takeda das Verhör mit dem Jungen alleine machen zu lassen.«
Sauer machte eine dämpfende Handbewegung, fragte dann mit überraschend angespannter Stimme: »Hat bei Ihnen eigentlich nichts geklingelt, als Sie seinen Namen gehört haben? Simon Kallweit?«
»Nein, wieso?«
»Sie sind auch nicht auf die Idee gekommen, einmal nachzuforschen?«
Claudia kniff die Augenbrauen zusammen, sagte mit einem unguten Gefühl: »Kommen Sie schon, Sauer. Worum geht es?«
Der Kommissionsleiter ließ ein erschöpftes Seufzen hören, setzte gerade zu einer Erklärung an, als Claudia sagte: »Sagen Sie jetzt nicht … ist der Junge etwa der Sohn von dem Kallweit.«
»Genau so ist es. Und Kallweit senior sitzt jetzt mit seiner Frau und seinem Anwalt in meinem Büro.«
»Ach du Scheiße!«
»Es kommt selten vor, dass wir einer Meinung sind, Frau Harms. Aber in diesem Fall teile ich Ihre Einschätzung vollkommen.«
3.
Takeda blickte sich noch einmal um, bevor er den Raum mit dem Beschuldigten betrat. Am anderen Ende des Korridors sah er Claudia im Gespräch mit Holger Sauer. Offenbar regte sie sich sehr über etwas auf. Takeda hatte keine Ahnung, ob es mit ihrem Fall zu tun hatte und warum Sauer ihn offenbar nicht mit ins Vertrauen ziehen wollte.
Der Inspektor legte die Hand auf die Türklinke, holte noch einmal Luft, bevor er den Raum betrat. Ihm war klar, dass es bei der folgenden Vernehmung nicht darum ging, den Verdächtigen seiner Tat zu überführen, ihn zu ungewollten Aussagen zu drängen oder in Widersprüche zu verwickeln. Es ging allein darum, sich ein Bild des Jungen zu machen, seine Motive zu ergründen und die Tatumstände aktenfest zu machen, wie die deutschen Kollegen es nannten. Die Sache würde wohl recht schnell bei der Staatsanwaltschaft und dann vor Gericht landen.
Trotzdem verspürte der Inspektor ein gewisses Zögern. Vermutlich lag es am jugendlichen Alter des Täters. Er hatte bisher nur wenig mit jungen Deutschen zu tun gehabt. Ihm war klar, dass sie ihm gleich in zweifacher Hinsicht fremd waren. Sie stammten nicht nur aus einem anderen Land, einer anderen Kultur, sie gehörten auch einer anderen Generation an. Beides zu überbrücken war eine ziemliche Herausforderung.
Takeda öffnete die Tür und betrat den Raum. Der uniformierte Kollege, der Kallweit bewachte, stand behäbig von seinem Stuhl auf, tippte sich mit dem Finger an die Stirn und sagte, offenbar mehr in Richtung des jungen Simon Kallweit: »Hast Glück gehabt, Junge, unser Samurai kümmert sich um dich. Solltest du als Ehre betrachten.«
Während der Junge hochsah und von Takedas Anblick überrascht schien, zeigte das Gesicht des Inspektors ein müdes Lächeln. Er fragte sich, wann sich die Kollegen wohl endlich an seine Anwesenheit gewöhnen würden und keine seltsamen Späße mehr machten. Das mit dem Samurai war ja noch harmlos. Er hatte auch schon mitbekommen, dass sie ihn hinter seinem Rücken Pokemon oder Sushi-Cop nannten.
Zu dem Uniformierten sagte Takeda: »Ich muss Ihnen leider sagen, dass es in Japan keine Samurais mehr gibt. Stellen Sie mich doch nächstes Mal besser als Godzilla oder Hello Kitty vor.«
»Was? Wen?«
Takeda lächelte. »Sehen Sie, Sie haben keine Ahnung.«
»Tut mir leid, Kollege. War nicht böse gemeint.«
Der Inspektor winkte ab. »Schwamm drüber.«
Ihm war nicht entgangen, dass Simon Kallweit dem kurzen Geplänkel aufmerksam gefolgt war. Sein Gesicht zeigte ein noch größeres Erstaunen, als ihm offenbar klar wurde, dass Takeda wirklich Japaner war. Der Inspektor wusste natürlich nicht, was der Junge mit dem Land oder der Tatsache, dass er von dort stammte, verband, aber es ließ ihn offenbar nicht kalt.
Zu seinem Kollegen gewandt sagte der Inspektor: »Ich würde mich jetzt gerne mit dem jungen Mann alleine unterhalten. Wenn Sie daher vielleicht …«
»Verstehe schon. Allerdings … Er ist nicht gesichert. Soll ich ihm nicht lieber eine Acht anlegen, bevor Sie alleine mit ihm sind?«
Takeda schüttelte lächelnd den Kopf. Er wusste, dass mit der Acht Handschellen gemeint waren. »Das ist kein Problem. Ich komme gut zurecht.«
Der Beamte grinste. »Weiß ich doch, Sensei. Mit unserem S-Bahn-Schubser hier werden Sie spielend fertig! Seit Sie im Polizeisportverein trainieren, hat die Aikido-Sparte mehr als doppelt so viele Mitglieder bekommen … Sie sind Legende, Mann. Eben doch ein Samurai. Ich weiß Bescheid!«
Takeda kommentierte den Spruch des Kollegen mit einem stummen Lächeln. Der lag mit seinem Sprüchen näher an der Wahrheit, als ihm vermutlich klar war, schließlich stammte Takeda tatsächlich aus einem altehrwürdigen Samurai-Geschlecht, dessen Ursprünge bis in die Kamakura-Zeit vor fast eintausend Jahren zurückreichten. Verschiedene Zweige des Takeda-Clans hatten während aller Perioden der japanischen Geschichte, die seitdem gefolgt waren, immer wieder bedeutende Rollen gespielt … aber nun war wirklich nicht die Zeit, sich darüber auszulassen. Es gab Wichtigeres zu tun.
Nachdem der Uniformierte den Raum verlassen hatte, nahm Takeda einen Stuhl und stellte ihn so hin, dass er Simon Kallweit direkt gegenübersaß.
Anstatt dem Jungen nun Fragen zu stellen, tat er zunächst aber nichts. Er schwieg. Denn anders als die meisten Deutschen wusste Takeda sehr gut, dass man Gespräche, mitunter sogar die besten und vielsagendsten, durchaus ohne Worte führen konnte. Nichts anderes galt für Verhöre. Keine Fragen, keine Antworten. Alles blieb stumm. Und doch erfuhr man eine ganze Menge.
Deswegen dachte der Inspektor gar nicht daran, den Jungen auf klassische Weise zu verhören. Noch nicht. Stattdessen blieb er auf seinem Platz sitzen und betrachtete Simon Kallweit, nahm die kleinen Gesten und unwillkürlichen Körperbewegungen wahr.
Simon Kallweit war groß gewachsen, bestimmt einen Kopf größer als Takeda, hatte schmale Schultern und dünne Arme. Seine Hände waren feingliedrig und sensibel. Die Hände eines Musikers, dachte Takeda, er tippte auf Klavier. Vielleicht auch Geige. Er trug hellbraune Jeans, Sneakers, ein Sweatshirt, das zu Takedas Erstaunen das Konterfei einer recht bekannten Manga-Figur zeigte, mit der der Inspektor sogar den Vornamen teilte: Ken Kaneki.
Je länger das Schweigen dauerte, desto nervöser wurde Simon Kallweit. Er begann an den Fingernägeln zu kauen, sah Takeda immer wieder kurz an, senkte aber sofort wieder den Blick. Auf die Weise vergingen gute zehn Minuten, und schließlich war es Simon Kallweit, dem offenbar so mulmig zumute wurde, dass er die Stille nicht länger ertrug. Er fragte: »Sind Sie wirklich Japaner?«
»Ja.«
»Und … äh, was machen Sie dann hier?«
»Was denkst du, was ich mache?«
»Keine Ahnung. Praktikant oder so?«
Takeda musste unwillkürlich lächeln. »Hospitant würde es vermutlich besser treffen. Aber auch das stimmt nicht ganz. Ich bin im Rahmen eines Austauschprogramms in Hamburg, aber ich bin vollwertiges Mitglied der deutschen Polizei. Eigentlich arbeite ich beim Keishichō in Tokio, das ist …«
»Ich weiß, das Polizeihauptquartier. Dieses riesige dreieckige Gebäude gegenüber vom Kaiserpalast.«
»Du kennst dich gut aus. Warst du einmal in Tokio?«
Simon zeigte ein kurzes, schüchternes Lächeln, schüttelte den Kopf. »Nein, leider nicht. Aber im Keishichō arbeitet doch Inspektor Megure. Sie wissen schon, der von Conan Edogawa. Habe ich gelesen, als ich klein war.«
Takeda nickte. Inspektor Megure war eine Figur in der berühmten Manga-Serie um den jugendlichen Detektiv Conan. Er arbeitete ebenfalls im Tokioter Polizeipräsidium. Während der junge Conan ein wahres Genie war und die kniffeligsten Fälle löste, kam Megure recht tollpatschig daher, war aber alles in allem sympathisch. Übrigens waren die Namen beider Figuren nicht wirklich japanisch, es waren Anspielungen auf ihre europäischen Vorbilder. Während der Inspektor nach Inspektor Maigret benannt war, war Conans Name von dem berühmten Arthur Conan Doyle abgeleitet, dem Schöpfer des in Japan ungeheuer populären Sherlock Holmes.
»Dann interessierst du dich wohl für Manga?«, fragte Takeda.
»Mehr als für alles andere.«
»Welche magst du besonders?«
»Alles mögliche. Zum Beispiel Welcome to the NHK oder Rurōni Kenshin. Black Jack finde ich auch gut.«
»Black Jack mag ich auch. Ein Meisterwerk von Osamu Tezuka.«
Simon grinste und sagte: »Ja, die alte Fassung ist nicht übel, aber die Neo-Ausgabe gefällt mir besser. Der Zeichenstil ist moderner.«
Takeda wusste, dass Manga inzwischen auf der ganzen Welt und besonders auch in Deutschland populär waren, zumindest bei der jüngeren Generation. Darum war er nicht allzu verwundert, in Simon Kallweit einen Fan der japanischen Comic-Kultur zu finden. Im Prinzip hätte er auch gerne weiter mit dem Jungen über Manga gesprochen, zumal er zu seiner eigenen Überraschung eine gewisse Sympathie für Simon empfand. Nun aber war es an der Zeit, die Strategie zu ändern.
Daher sagte der Inspektor unvermittelt: »Du hast einen Menschen getötet, Simon. Die Frau heißt Tatjana Gebers, ist neununddreißig Jahre alt und Mutter von zwei Kindern. Ihre Einzelteile, denn mehr ist von ihr nicht übrig, liegen in der Rechtsmedizin. Vielleicht sollten wir gemeinsam dorthin fahren und sie uns ansehen.«
Takedas Worte schnitten in die gerade noch so gelöste Atmosphäre, trafen den Jungen völlig unvorbereitet. Er zuckte regelrecht zurück, nahm eine in sich versunkene, ängstliche Körperhaltung ein.
»Möchtest du nichts dazu sagen?«, fragte Takeda.
Er erhielt keine Antwort und wiederholte seine Frage, doch der Junge blieb stumm. Takeda beobachtete ihn. Simon begann wieder, an seinen Nägeln zu knibbeln, steckte nun sogar einen Finger in den Mund und biss ein Stück Nagelhaut ab.
»Kann ich mein Handy haben?«, fragte er schließlich.
Takeda war überrascht, ließ sich aber nichts anmerken. »Warum?«
»Weiß nicht. Whatsapp checken und so.«
Der Inspektor schloss kurz die Augen. »Ich befürchte, du wirst dein Handy sehr lange nicht zurückerhalten. Das ist dir doch klar, oder? Du wirst ins Gefängnis kommen.«
Simon hob nun doch den Kopf, sah Takeda an, und der eingeschüchterte Ausdruck auf seinem Gesicht wich dem euphorischen Lächeln, von dem Claudia ihm schon erzählt hatte. »Sie glauben, ich komme ins Gefängnis?«
»Ganz bestimmt sogar.«
Simon Kallweit stieß ein kurzes Lachen aus, von dem Takeda nicht ganz sicher war, was es zu bedeuten hatte. Es klang ungläubig, vielleicht sogar eine Spur verächtlich. Die kurze Sympathie, die er gerade noch für den Jungen empfunden hatte, verflog schlagartig.
»Warum hast du es getan?«, fragte Takeda.
»Sie meinen das mit der Frau?«
»Warum?«
Simon Kallweit senkte den Blick, schien nachzudenken. Dann zuckte er mit den Schultern. »Weiß nicht.«
»Kanntest du sie?«
»Nein.«
»Hat sie dich vielleicht an jemanden erinnert?«
»Sie meinen zum Beispiel an meine Mutter? So ein Ödipus-Ding oder so?«
»Sag du es mir. Ist es so?«
»Nein.«
»Warum also?«
Wieder ließ sich der Junge Zeit mit seiner Antwort. Dann hob er den Kopf und zeigte wiederum sein eigentümliches Lächeln. Schließlich sagte er mit seltsam kehliger Stimme. »Ore wa Ghouru da!«
»Wie bitte?«
»Ist mein Japanisch so schlecht? Dann sage ich es halt auf Deutsch. Ich habe es getan, weil ich ein Ghoul bin!«
Takeda blickte den Jungen irritiert an. Er hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit.
4.
Als Claudia Holger Sauers Dienstzimmer betrat, war ihr klar, dass dieser Fall sich anders entwickeln würde, als sie und Takeda es noch vor wenigen Minuten erwartet hatten. Es würde kompliziert werden. Viel komplizierter, als es der so eindeutige Tathergang nahelegte.
Simon Kallweit war, wie sie jetzt wusste, der Sohn von Hartmut Kallweit. Und der war der amtierende Hamburger Justizsenator.
Als Sauer sie darauf aufmerksam gemacht hatte, hatte Claudia zunächst einen schwachen Versuch unternommen, die Dinge herunterzuspielen: »Und? Ändert das etwas? Auch Senatorensöhne begehen Verbrechen.«
Sauer verdrehte die Augen. »Seien Sie nicht naiv, Frau Harms. Wir haben es nicht mehr einfach nur mit einer Straftat zu tun, ganz egal, wie schrecklich die ist. Es geht jetzt um Politik. Das hier wird Wellen schlagen. Es ändert alles.«
Ausnahmsweise hatte Holger Sauer recht.
Es änderte alles.
Claudia trat hinter ihrem Vorgesetzten in das großzügige Dienstzimmer am Ende des Traktes, in dem die Mordkommission untergebracht war. Vierter Stock, Eckzimmer, großer Schreibtisch, viel Licht, Blick über den nahen Alsterlauf, Sofaecke. Vor dem bodentiefen Fenster stand eine Frau, vermutlich Astrid Kallweit, die Frau des Senators, Simons Mutter. Sie war schätzungsweise Ende vierzig, schlank, schön, ausdrucksvoll. Sie trug ein elegantes Kostüm und ursprünglich auch gut aufgetragenes Make up, das inzwischen von ihren Tränen verwischt war. Mitten im Raum standen zwei Männer, beide um die fünfzig, beide mit stoischen Mienen. Sie unterhielten sich leise miteinander. Claudia kannte Hartmut Kallweit von Fotos, ein großgewachsener Mann mit einem schütteren Haarkranz und einer unvorteilhaft großen Nase. Durch den gedeckten Anzug, die biedere Krawatte, das kultivierte, großbürgerliche Auftreten hätte man ihn wohl instinktiv eher in der CDU vermutet als bei den Sozialdemokraten. Aber das war natürlich Unsinn, denn wie alle, die in Hamburg etwas zu sagen hatten, gehörte Kallweit der SPD an. Ansonsten wusste Claudia nicht viel über ihn. Kallweit war in seiner Behörde beliebt, auch weil er selbstbewusst war und sich für seine Leute stark machte.
Der andere Mann im Raum war klein, untersetzt, glatzköpfig, die Wangen seines runden Gesichts fingen an herabzuhängen. Auch ihn kannte Claudia. Er hieß Lothar Röhler und war einer der renommiertesten Strafverteidiger der Hansestadt. Niemand, mit dem man sich streiten wollte. Besser gesagt, niemand, mit dem man überhaupt etwas zu tun haben wollte. Claudias Kollege Horst Kröger hatte mal gesagt, er wäre lieber mit einem Schwarm Piranhas in einer Badewanne als mit Röhler in einem Raum.
Holger Sauer nahm eine kurze Vorstellungsrunde vor. Claudia streckte ihre Hand aus, Astrid Kallweit, die Mutter des jungen Mörders, ergriff sie, ihr Mann hingegen beachtete sie nicht, bellte stattdessen: »Ich möchte meinen Sohn sehen. Auf der Stelle!«
Claudia wechselte einen kurzen Blick mit Sauer, der blinzelte ihr überraschend kumpelhaft zu, sagte zu Kallweit: »Aber selbstverständlich, Herr Senator. Ich kümmere mich sofort darum.«
Claudia führte die Begrüßung fort, und Röhler wiederum umschloss ihre ausgestreckte Hand mit seinen beiden kleinen, schwitzigen Händen und ließ sie nicht wieder los. Ihr stieg eine Duftwolke aus kaltem Zigarrenrauch und scharfem Rasierwasser in die Nase. Mit einem giftigen Lächeln sagte Röhler: »Ich hoffe für Sie, dass es bisher keinerlei Befragung von Simon Kallweit gegeben hat, die über die Feststellung seiner Personalien hinausging. Sollte es doch der Fall sein, hätten Sie dem Jungen das Recht auf anwaltlichen Beistand vorenthalten. Dann können Sie alles, was bisher gesagt wurde, sowieso vergessen, da es vor Gericht keinerlei Bestand haben wird. Und eine Dientaufsichtsbeschwerde gibt es gleich hinterher. Verstehen wir uns?«
Claudia lächelte zuckersüß, aber nicht weniger giftig. »Ich freue mich auch, Sie kennenzulernen, Herr Röhler.«
Sie konnte es überhaupt nicht leiden, wenn sie jemand so direkt anging, obwohl man noch nicht einmal Guten Tag gesagt hatte. Aber immerhin weckte so ein Verhalten ihre Verteidigungsreflexe. Kein Problem, mit diesem schleimigen Gollumverschnitt würde sie schon fertig.
Röhler lächelte unbeirrt und sagte mit penetrant leiser Stimme: »Sie sollten meine Worte nicht auf die leichte Schulter nehmen, Frau Harms. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass in diesem Fall der Draht zu Ihren Vorgesetzten, und damit meine ich die oberste Etage, kurz ist.«
Diesmal schaffte Claudia es nicht mehr zu lächeln. »Hören Sie doch mit den albernen Andeutungen auf, Herr Röhler. Sie reden vom Innensenator? Bitte, rufen Sie ihn an. Da steht ein Telefon, falls Sie kein Handy dabei haben. Die Presse wird begeistert sein, wenn sie erfährt, dass der Justizsenator versucht, die Ermittlungen gegen seinen Sohn zu beeinflussen, und für diese Zwecke einen Amtskollegen einspannt.«
Eins zu null für mich, wie Claudia schadenfroh registrierte. Röhler lief rot an, murmelte etwas von infamen Unterstellungen, drehte sich von ihr weg. Kallweit selbst ballte die Hände, bis seine Knöchel weiß hervortraten. Seine Frau brach erneut in Tränen aus.
Holger Sauer machte eine beruhigende Handbewegung und bemühte sich um einen versöhnlichen Tonfall. »Kollegin Harms, reißen Sie sich doch bitte zusammen. Und Sie, Herr Röhler, darf ich daran erinnern, dass wir das hier gütlich über die Bühne bekommen wollen, oder etwa nicht? Ich glaube im Übrigen nicht, dass Herr und Frau Kallweit es wirklich auf eine Auseinandersetzung anlegen«, womit er sich zum Ehepaar Kallweit umdrehte und fortfuhr: »Es ist schlimm genug, was Sie als Eltern durchmachen müssen … Also setzen Sie sich doch bitte erst einmal hin und trinken einen Kaffee. Ihrem Sohn geht es übrigens den Umständen entsprechend gut. Ich lasse sofort feststellen, in welchem unserer Gewahrsamsräume er sich befindet. Und selbstverständlich ist noch nichts geschehen, was über die erkennungsdienstliche Behandlung hinausgeht. Das stimmt doch, Frau Harms, oder?«
Claudia nickte stumm und musste sich eingestehen, dass sie ausnahmsweise von Holger Sauer beeindruckt war. Die erste Befragung von Simon Kallweit Takeda zu überlassen war ein geschickter Schachzug. Schließlich könnte Sauer immer behaupten, dass der Japaner lediglich dazu abgestellt war, um den Jungen zu bewachen und nicht, ihn zu befragen. Sollte Röhler dagegen vorgehen, ließe sich zur Not behaupten, dass Takeda nicht mit der deutschen Strafprozessordnung und den polizeilichen Dienstvorschriften vertraut sei. Das war zwar nicht nett gegenüber dem Inspektor, in diesem Fall aber dennoch hilfreich, das musste Claudia zugeben.
Die Atmosphäre beruhigte sich ein wenig, und tatsächlich nahmen die beiden Kallweits in der Sitzecke Platz. Der Anwalt trat vor das bodentiefe Fenster, blickte nach draußen, tat abgelenkt. In Wahrheit ließ er sich natürlich nicht eine Silbe von dem entgehen, was gesprochen wurde. Eine Assistentin brachte Mineralwasser und eine Kaffeekanne, Sauer schenkte höchstpersönlich ein, übersah dabei aber geflissentlich Claudias Tasse, so dass sie sich selbst einschenken musste. Blöder Affe!
Bevor die Assistentin den Raum verließ, wies Sauer sie an, den Tatverdächtigen ausfindig zu machen und ihn dann in einen Raum zu bringen, der sich für die Begegnung mit den Eltern und dem Anwalt eignete. »Ach so, und gehen Sie doch bitte vorher kurz runter zu den Kollegen von der KTU und fragen nach, ob die Bilder von der Bahnhofskamera schon ins System gespielt sind.«
»Aber …«
»Sofort, bitte.«
Die Assistentin verzog die Mundwinkel und verließ den Raum. Sie war beleidigt, weil Sauer das Ganze natürlich auch selbst per Telefon hätte erfragen können. Aber erneut war Claudia beeindruckt, denn Sauer ging es um nichts anderes, als die Begegnung der Eltern mit dem Jungen noch ein wenig hinauszuzögern und Takeda so mehr Zeit für sein Gespräch zu verschaffen. Sauer war genau wie ihr selbst klar, dass Röhler, sobald er mit Simon gesprochen hatte, sofort jede Aussage des Jungen unterbinden würde.
Nachdem alle Anwesenden einen Schluck Kaffee getrunken hatten, räusperte Hartmut Kallweit sich. Mit etwas versöhnlicherer Stimme fragte er: »Was genau ist denn jetzt überhaupt passiert? Der Beamte, der uns angerufen hat, hat zwar schon gesagt, dass … dass Simon eine Frau vor die S-Bahn gestoßen haben soll. Aber Sie verstehen sicherlich, dass wir das einfach nicht glauben können. Nicht unser Simon!«
»Niemals …«, fügte Astrid Kallweit mit brüchiger Stimme hinzu. Sie war kaum zu verstehen. »Simon würde niemals einem Menschen etwas antun. Er ist ein so … zarter Junge.«
Sauer nickte verständnisvoll. »Dass die Sache Sie sehr schockiert, ist nur zu verständlich. Ich befürchte allerdings, dass der Sachverhalt recht eindeutig ist. Am besten schildert uns die zuständige Hauptkommissarin, die die Ermittlungen leitet, was als gesichert gelten kann. Frau Harms, würden Sie dann bitte …«
Claudia räusperte sich und sagte: »Wie es aussieht, war Ihr Sohn, Herr und Frau Kallweit, heute morgen mit seiner Schulklasse und einem Lehrer, einem Herrn Brunkhorst, im Dammtorbahnhof. Die Schüler unternahmen eine Exkursion zum Botanischen Garten in Klein Flottbek, um dort eine pflanzenkundliche Ausstellung zu besuchen. Während die Klasse auf die Bahn wartete, hat Ihr Sohn eine ebenfalls wartende Frau von hinten so gestoßen, dass sie vor den einfahrenden Zug stürzte. Die Frau wurde dabei getötet. Aus dem der Tat folgenden Verhalten Ihres Sohnes müssen wir schließen, dass er mit Absicht und wohl auch mit Einsehen in die tödlichen Folgen seines Tuns gehandelt hat.«
»Was meinen Sie damit? Welches Verhalten? Was wollen Sie denn damit sagen, um Himmels willen«, fragte Hartmut Kallweit in einer Mischung aus Wut und Verzweiflung.
Claudia schloss kurz die Augen, rief sich in Erinnerung, was Simons Mitschüler den Beamten gesagt hatten, die als Erste vor Ort gewesen waren. Simon Kallweit hatte nach dem tödlichen Vorfall auf seine Hände gestarrt und gelächelt – dasselbe Lächeln, das er später dann auch ihr gegenüber gezeigt hatte. Reue? Zweifel? Gewissensbisse? Nichts davon.
»Ihr Sohn scheint stolz auf das zu sein, was er getan hat. So stellt es sich uns zurzeit dar«, sagte Claudia knapp. »Auch ich habe vorhin kurz mit Simon gesprochen, was aber selbstverständlich nicht als offizielle Vernehmung gilt … Jedenfalls hat Simon zugegeben, dass er die Frau gestoßen hat. Und auch ich konnte nicht erkennen, dass er sein Verhalten in irgendeiner Form bereut.«
Im Raum herrschte für einige Sekunden eine gespannte Stille. Dann sagte Hartmut Kallweit: »Sie sagen nicht weniger, als dass mein Sohn ein kaltblütiger Mörder ist. Verstehe ich das richtig?«
Claudia wechselte einen kurzen Blick mit Sauer, sagte: »Ob es sich um Mord handelt, ist letztlich eine juristische Einschätzung. Das wissen Sie doch genau. Ich würde allerdings tatsächlich sagen, dass Ihr Sohn wissentlich und mit voller Absicht den Tod eines Menschen herbeigeführt oder zumindest in Kauf genommen hat.«
Astrid Kallweit begann erneut aufzuschluchzen, ihr Mann und der Anwalt wechselten stumme Blicke. Lothar Röhler setzte gerade zu einer Wortmeldung an, als Kallweit herrisch die Hand hob und ihn zum Schweigen brachte. Der Senator stand von seinem Sitz auf, machte ein paar Schritte durch den Raum, drehte sich dann zu Sauer und Claudia um.
»Ich sage Ihnen, was hier los ist. Es geht hier nicht um meinen Sohn. Es geht um mich. Mir soll hier etwas angehängt werden! Merken Sie das denn gar nicht? Mein Sohn, ein Mörder? Unsinn! Niemals! Aber das ist egal, verstehen Sie? Wenn das einmal in der Welt ist, dann bin ich erledigt! Meine politische Karriere – vorbei! Dann kommt nur noch Rücktritt in Frage! Dann bin ich tot. Politisch tot.«
Im Raum herrschte eine betäubte Stille, auch wenn die Anwesenden wohl aus unterschiedlichen Motiven schwiegen. Lothar Röhler, weil er die Reaktion der Polizisten abwarten wollte, Astrid Kallweit, weil sie vor Trauer nicht mehr sprechen konnte. Hartmut Kallweit, weil ihm die eigene Erregung die Kehle zuschnürte, Holger Sauer, weil er zu feige war, etwas zu sagen. Und Claudia Harms, weil sie erst einmal verdauen musste, dass dieser Mann die Stirn hatte, sich zum Opfer einer Tat zu machen, die sein Sohn begangen hatte und bei der eine unschuldige Frau ums Leben gekommen war.
Schließlich war Claudia es dann auch, die das Schweigen brach. Sie sagte: »Ich habe volles Verständnis für Ihren Zorn, Herr Kallweit. Für Ihre Verzweiflung. Es ist nur leider so, dass Ihr Sohn, wie schon erwähnt, seine Tat vollumfänglich gesteht. Außerdem gibt es unzählige Zeugen, die ihn beobachtet haben. Bald werden wir auch die Kameraaufzeichnung aus dem Bahnhof haben. Vielleicht gibt es zudem Handy-Aufzeichnungen von Simons Mitschülern. Sie werden sich leider damit abfinden müssen, dass die Dinge genauso sind, wie ich sie dargestellt habe. Ihr Sohn hat einen Menschen getötet. Es hat nichts mit Ihnen oder ihrem politischen Amt zu tun. Ich wünschte, ich könnte Ihnen etwas anderes sagen. Aber das kann ich nicht.«
Plötzlich redeten alle durcheinander. Hartmut Kallweit, der Claudia erneut der Lüge, zumindest aber eines tragischen Irrtums bezichtigte. Lothar Röhler, der auf Sauer einredete und alle Aussagen von Simon Kallweit, mit denen er möglicherweise die Tat zugegeben haben könnte, für nichtig erklärte. Holger Sauer, der um Ruhe bat und vorschlug, erst einmal den weiteren Gang der Ermittlungen abzuwarten. Claudia, die ihre Darstellung verteidigte und ihr Bedauern wiederholte.
Dann aber ließ ein langgezogener, ohrenbetäubender Schrei den Lärm verstummen. Das Geräusch erinnerte an ein sterbendes Tier, war ein Laut existentieller Verzweiflung. Alle im Raum starrten auf Astrid Kallweit, die sich taumelnd von ihrem Sitz erhoben hatte und mit schmerzverzerrtem Gesicht schrie, einfach nur noch schrie.
Erst als Hartmut Kallweit seine Frau umarmte – es war die erste Berührung des Ehepaares, seit sie hier im Raum waren –, beruhigte sie sich etwas. Sie atmete hechelnd, und ihr Schreien ging in ein Wimmern über. Schließlich sagte sie mit schwacher Stimme: »Ich will meinen Sohn sehen. Er hat niemandem etwas getan. Ich will ihn sehen und nach Hause bringen, ich bin doch seine Mutter!«
Claudia schluckte. Das hier war mal wieder einer von diesen richtig beschissenen Momenten in ihrem Job. Dachten die Täter, die Mörder, die Vergewaltiger, Einbrecher eigentlich niemals daran, dass sie mit ihren Taten noch viel mehr Opfer produzierten als die, gegen die sie ihre Taten richteten? War ihnen klar, dass sie Ehepartner, Freunde, Eltern ebenfalls etwas antaten? So viele blieben auf der Strecke, nur weil ein Einziger auf die Regeln schiss.
Claudia war dankbar, dass Holger Sauer es übernahm, Astrid Kallweit sanft, aber unmissverständlich auf die Realität aufmerksam zu machen. Mit vorsichtiger Stimme erklärte er: »Sie können Ihren Sohn nicht mitnehmen, Frau Kallweit. Simon wird dem Haftrichter vorgeführt, und der wird entscheiden, was mit ihm geschieht. Aber wir gehen davon aus, dass Ihr Sohn vorerst in Gewahrsam bleibt. So ist es nun einmal bei Tötungsdelikten, auch wenn der Beschuldigte im Jugendalter ist.«
Aus dem Körper der Frau wich alle Spannung. Sie schien sich kaum noch auf den Beinen halten zu können. Hartmut Kallweit sagte zu seinem Anwalt: »Lothar, bring Astrid bitte vor die Tür. Notfalls holst du einen Krankenwagen. Ich komme nach, ich möchte noch kurz …«
»Aber, Hartmut, wäre es nicht besser, wenn ich mit den Beamten …«, sagte der Anwalt.
»Sofort, Lothar!«
Röhler gehorchte, legte nun seinerseits den Arm um Astrid Kallweit und führte sie hinaus.
Erst als die Tür des Raumes wieder geschlossen war, sagte Hartmut Kallweit mit nun erstaunlich gefasster Stimme: »Die Dinge werden sich aufklären, so oder so. Ich habe nur eine Bitte, Frau Harms, Herr Sauer. Halten Sie unseren Namen aus den Medien heraus. Den von Simon sowieso, aber auch meinen und den meiner Frau. Zumindest bis wir wissen, was wirklich passiert ist.«
»Selbstverständlich, Herr Senator. Ihr Sohn ist siebzehn Jahre alt, und bei minderjährigen Tätern gibt es ohnehin ein Abkommen mit der Presse, keine Namen zu nennen. Ich denke, da müssen Sie sich keine Sorgen machen.«
Kallweit schnaubte abschätzig. »Sie kennen die Medien nicht … aber egal, tun Sie einfach alles, was in Ihrer Macht steht. Das hier ist für uns alle weiß Gott nicht einfach. Aber wenn es an die Öffentlichkeit dringt, dann ist es fast egal, ob mein Sohn wirklich etwas verbrochen hat oder nicht. Dann ist es vorbei. Die Konsequenzen, die es für mich hat, sind im Grunde ganz egal. Ich kann notfalls damit klarkommen. Aber mein Sohn hat sein Leben noch vor sich. Auf ihn müssen wir achtgeben.«
Zum ersten Mal spürte Claudia so etwas wie Sympathie für den Mann. Hinter der so professionellen Fassade erkannte sie Fürsorglichkeit, erkannte sie Verletzlichkeit.
Sauer nickte verständnisvoll. »Sie können sich auf uns verlassen, Herr Senator. Das verspreche ich Ihnen.« Dann blickte er zu Claudia und sagte: »Das ist auch bei Ihnen angekommen, Frau Harms?«
»Ich bin nicht taub, Chef.«
5.
Am nächsten Morgen um kurz nach acht Uhr saß Inspektor Takeda an seinem Schreibtisch im Polizeipräsidium und las in einem Manga, in einem Band von Tokyo Ghoul. Er hatte dunkle Ringe unter den Augen, war unrasiert und sah insgesamt ziemlich übernächtigt aus, was daran lag, dass er tatsächlich kaum geschlafen hatte. Er hatte die Nacht in seinem Dienstzimmer verbracht, war zwar hin und wieder eingenickt, hatte aber alles in allem genau das getan, was er auch jetzt tat, nämlich Manga gelesen.
In Japan wäre beides nicht wirklich ungewöhnlich gewesen, also weder dass ein Angestellter oder Beamter die Nacht hindurch arbeitete, noch dass er ein Buch mit Bildergeschichten las.
In Japan waren Manga nun einmal Teil der Kultur, wurden weder belächelt, noch als Lektüre für Kinder und Ungebildete abgetan. Im Gegenteil, der Anblick berufstätiger Männer und Frauen, die in den Bahnen, den Cafés oder eben am Schreibtisch im Büro ein Manga lasen, war völlig normal. Manga-Bücher und -magazine erzielten Millionenauflagen. Animes, also die Adaptionen als Fernsehserien oder Kinofilme, waren Kassenschlager. Berühmte Zeichner wie Osamu Tezuka, der sogenannte Gott des Manga, galten als hochverehrte Repräsentanten der japanischen Kultur. Für das Werk von Tezuka gab es sogar ein eigenes Museum.
Die Frage, warum Manga in Japan derart populär waren, war schwierig zu beantworten. Zum einen fanden sich schon in der alten japanischen Kultur mangaähnliche Produkte wie die Emaki-Bildrollen oder die berühmten Kibyōshi aus der Edo-Zeit. Aber natürlich spielte der Einfluss der amerikanischen Comics, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, eine große Rolle. Hinzu kam, dass die Japaner aufgrund ihrer komplizierten Schriftzeichen ohnehin keine so scharfe Trennlinie zwischen Text und Bild zogen, wie es in den westlichen Kulturen üblich war.
Inzwischen war es nicht übertrieben, zu sagen, dass Manga von Japan ausgehend zu einem weltweit verbreiteten Medium geworden waren, auch wenn sie außerhalb Japans in erster Linie Kinder und Jugendliche ansprachen. In jeder Buchhandlung gab es inzwischen Regale voller Manga, die zum Teil sogar von deutschen Autoren und Zeichnern produziert wurden. Künstlerisch hochwertige Anime lockten auch Erwachsene in die Kinos. Chihiros Reise ins Zauberland von Hayao Miyazaki hatte sogar einen Oscar gewonnen.
Takeda selbst las normalerweise Sport-Manga, also Serien wie One Outs oder Kaze no Daichi, deren Geschichten in der Welt des Baseballs oder Golfs angesiedelt waren. In nostalgischen Momenten griff er auch zu alten Serien wie Dr. Slump oder Lupin III, die ursprünglich vor Jahrzehnten erschienen waren, aber immer noch populär waren.
Im Laufe der zurückliegenden Wochen waren so einige Manga, die der Inspektor aus Japan mitgebracht hatte, aus seiner Wohnung hier ins Präsidium gewandert und füllten die unterste Schublade seines Schreibtisches. Immer wenn er sich für einige Augenblicke entspannen wollte, zog er eines der Bücher hervor. Als Claudia ihn einmal dabei beobachtet hatte, konnte sie sich eine spöttische Bemerkung nicht verkneifen. »Sie lesen Manga? Was kommt als Nächstes? Füttern Sie Ihr Tamagotchi?«
»Nein, ich zeige Ihnen den Hello-Kitty-Sticker, den ich auf meine Dienstmarke geklebt habe.«
»Jetzt mal im Ernst, Ken. Sie sind ein so kultivierter Mann. Sie machen Teezeremonie, spielen Saxophon, sind Kampfkunstmeister – und dann lesen Sie so einen Quatsch?«
»Jetzt mal im Ernst, Claudia«, entgegnete Takeda lächelnd. »Sie sind Polizistin, arbeiten bei der Mordkommission, sind eine tolle Frau – und Sie kümmern sich morgens als Erstes um Ihre Tiere in Ihrem Online-Zoo, gucken im Internet immer die neueste Folge von Rote Rosen und unterhalten sich mit Ihren Zimmerpflanzen?«
Claudia brach in schallendes Gelächter aus, fragte dann: »Woher wissen Sie das von Rote Rosen?«
»Ich hab gehört, wie Sie mit Christine Meltendorf von der KTU darüber gesprochen haben.«
Claudia zuckte mit den Schultern. »Wir haben halt alle unsere kleinen Schwächen.«
»Eben«, sagte Takeda und lächelte.
In der vergangenen Nacht hatte der Inspektor keines seiner alten, mitgebrachten Manga gelesen. Er hatte sich stattdessen Tokyo Ghoul auf sein Smartphone geladen, denn natürlich gab es Manga auch als elektronische Version. Er kannte die Serie nicht, auch wenn sie ihm aufgrund ihrer weltweiten Popularität ein Begriff war. Worum es in ihr ging, war ihm bisher jedoch nicht so recht klar.
Simon Kallweit selbst hatte ihn darauf gebracht, nicht nur durch das Sweatshirt, das er trug und das Ken Kaneki, die Hauptfigur der Serie, zeigte, sondern besonders durch den Satz, mit dem er sich von Takeda verabschiedet hatte, sogar auf Japanisch: Ore wa Ghouru da! Ich bin ein Ghoul!
War der Satz der makabre Scherz eines aus dem Ruder gelaufenen Teenagers? Immerhin hatte er damit Takedas Frage nach dem Motiv beantwortet, warum er die Frau vor die S-Bahn gestoßen hatte.
Hatte Simon also mit dem Hinweis auf das Manga tatsächlich seine Beweggründe für die Tat offengelegt?
Im Laufe der Nacht hatte Takeda erfahren, dass Tokyo Ghoul eine Mischung aus Horror-Manga und Fantasy war, obwohl die Geschichte durchaus in der realen Welt spielte. Unter den normalen Menschen in Tokio lebten sogenannte Ghoule, eine Mischung aus Zombie und Vampir. Sie töteten Menschen, um sich von deren Fleisch zu ernähren, begingen aber immer wieder auch aus purer Mordlust Verbrechen. Ken Kaneki ist ein junger Student, der durch einen Unfall in einen Halb-Ghoul verwandelt wird. Obwohl er sich dagegen wehrt, muss auch er fortan Menschenfleisch essen, da er wie alle Ghoule normale Nahrung nicht mehr verträgt. Kaneki wird also zum Mörder. Er schließt sich einer Gruppe anderer Ghoule an, die versuchen, möglichst ohne Fleischverzehr zu überleben, was ihnen aber nicht immer gelingt. Außerdem werden sie von einer Spezialtruppe der Menschen-Polizei gejagt, die die blutrünstigen Wesen bekämpft. Und es kommt immer wieder zu erbitterten Kämpfen zwischen den Ghoulen, die untereinander im Krieg liegen.
Das Besondere an dem Manga war, dass er eine melancholische Stimmung erzeugte, der auch Takeda sich nicht entziehen konnte. Die Hauptfigur war ein nachdenklicher Einzelgänger, der sich für Literatur interessierte und mit dem sich viele Teenager sicherlich identifizieren konnten.
Offenbar auch Simon Kallweit.
Ging seine Identifikation aber wirklich soweit, dass er, um seinem Vorbild Ken Kaneki zu gleichen, Menschen tötete?
Takeda verspürte einen tiefen Schrecken, als ihn dieser Gedanke überkam. Denn wenn es wirklich so war, würde es bedeuten, dass Japan nicht nur Manga zu einem weltweiten Exportschlager gemacht hatte – sondern auch deren dunkle Seite.
Manga, wie man in Japan schon seit längerem wusste, konnten süchtig machen, konnten dazu führen, dass sich vor allem junge Leser von der Außenwelt abwandten und nur noch in der Welt der Manga lebten.
Dann waren sie sogenannte Otaku, was übersetzt einfach nur Haus bedeutete. Was es meinte, war die Sorte von Manga-, Anime- oder Videospiel-Nerds, die nur noch für ihr Hobby lebten und zunehmend den Kontakt zur Wirklichkeit verloren.
Otaku hatten in Japan nicht zuletzt durch eine Reihe von grausamen Verbrechen auf sich aufmerksam gemacht.
Angefangen hatte es in den späten achtziger Jahren mit dem Fall von Tsutomu Miyazaki, der als Otaku-Mörder und Kannibale von Saitama ins Gedächtnis der Japaner einging. Er hatte mehrere junge Mädchen ermordet und teilweise verspeist. Nach seiner Verhaftung stellte sich heraus, dass er zurückgezogen in einer Wohnung hauste, wo er seine Zeit mit Manga und Videofilmen verbrachte.
Aber auch andere grausame Verbrechen wurden, zu recht oder unrecht, mit Otaku in Verbindung gebracht, und zwar vor allem dann, wenn die Täter jung waren, sich von der Außenwelt abgewandt hatten und exzessiv Manga und Spiele konsumierten.
Heutzutage war der Begriff nicht mehr wirklich negativ. Neuerdings galten Otaku als Individualisten, die furchtlos ihren speziellen Interessen frönten und auf diese Weise den oftmals so rigiden Zwängen der japanischen Gesellschaft trotzten.
Aber die düstere Seite der Otaku war keineswegs vergessen, und so fragte Takeda sich, ob das vielleicht die Erklärung war für das, was am gestrigen Morgen auf dem Dammtorbahnhof geschehen war.
War Simon Kallweit ein Otaku? Oder genauer ein deutscher Otaku-Mörder?
Tatsächlich empfand Inspektor Takeda bei dem Gedanken eine tiefe Scham, denn wenn es wirklich so war, dann hieße das, dass er selbst, ein Japaner, ein Repräsentant der japanischen Kultur, eine gewisse Mitschuld an dem Geschehen des Vortages trug.
6.
Der Inspektor wurde jäh aus seinen Gedanken an Manga, Ghoule und entsprechende Verbrechen gerissen, als die Tür zum Dienstzimmer aufsprang. Es war Claudia, wer sonst? Seine Kollegin klopfte nämlich nie an oder öffnete die Tür zunächst nur vorsichtig einen kleinen Spalt, bevor sie eintrat, wie es eine Japanerin getan hätte. Claudia stürmte einfach in den Raum, als wäre sie auf der Flucht vor irgendetwas, und dass sie dadurch andere Leute furchtbar erschreckte, bemerkte sie überhaupt nicht.
Claudia knallte ihre Winterjacke auf die Ablage und warf sich in ihren Schreibtischstuhl, wo sie dann wortlos und mit verkniffenem Gesichtsausdruck sitzen blieb.
Takeda blickte sie verunsichert an. »Ist alles in Ordnung?«
»Sehe ich so aus?«
»Um ehrlich zu sein, nein.«
»Was ist los?«
»Nichts.«
Takeda nickte ernsthaft. Er war es inzwischen gewohnt, dass Claudia launisch sein konnte, und zwar besonders früh am Morgen und bevor sie drei oder vier Tassen Kaffee getrunken hatte. Aber sie war halt Deutsche, sagte Takeda sich. Deutsche hatten ihre Gefühle oft nicht im Griff, so viel war ihm inzwischen klar geworden. Oder nein, es war sogar schlimmer, denn sie glaubten, das Recht zu haben, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Das war mitunter immer noch recht irritierend für ihn. Obwohl er es ein Stück weit auch bewunderte und sogar die ersten Versuche gestartet hatte, sich ebenfalls so zu verhalten.
So zum Beispiel jetzt. Er sagte mit einer bemüht kratzigen Stimme: »Ich finde diesen Morgen auch beschissen. Was meinen Sie, soll ich uns erst mal einen Kaffee zubereiten?«
Claudia sah Takeda verblüfft an und brach in ein lautes Gelächter aus. Mit schon viel fröhlicherer Stimme sagte sie: »Ich hatte schon mehr als einen, danke.«
»Sagen Sie mir einfach, was los ist.«
»Das ist los«, sagte Claudia und warf eine Zeitung auf Takedas Schreibtisch.
Es war eine knallig aufgemachte Boulevardzeitung, deren Titelseite fast zur Gänze von einer riesigen Überschrift eingenommen wurde:
Senatoren-Sohn stößt Frau vor S-Bahn
Darunter befand sich ein Foto, das zwar stark vergrößert und aufgepixelt war, auf dem Simon Kallweit aber dennoch ohne weiteres zu erkennen war. Daran änderte auch der schwarze Balken nichts, der über seinen Augen lag. Das Foto zeigte, wie er auf dem S-Bahnsteig im Dammtorbahnhof stand und glückselig lächelnd auf seine eigenen Hände starrte. Der kurze Textkasten darunter nannte den Nachnamen des Jungen zwar nur als Initial, doch die mehr oder weniger sehr direkte Job-Beschreibung des Vaters ließ keinen Zweifel daran aufkommen, um wen es sich handelte.
Takeda sog zischend die Luft zwischen den Zähnen ein, kratzte sich am Hinterkopf und sagte: »Wir stecken in der Scheiße, oder?«
Claudia gelang erneut ein Lachen. »Das haben Sie schön gesagt, Ken. Es trifft die Sache auf den Punkt.«
Der Inspektor nahm die Zeitung zur Hand, führte sie dicht vor sein Gesicht und kniff die Augen zusammen. »Das Foto ist ein Ausdruck von dem Bahnsteig-Video, das uns auch vorliegt. Winkel und Ausschnitt sind eindeutig.«
»Was Sie nicht sagen.«
»Es bedeutet, dass jemand von dem Bahnhofspersonal mit der Presse zusammengearbeitet hat.«
Claudia schnaubte. »Es bedeutet, dass jemand vom Bahnhofspersonal später den Arsch aufgerissen bekommt, und zwar von mir höchstpersönlich.«
Takeda errötete leicht und sagte: »Sie meinen, Sie werden ihm gehörig den Marsch blasen?«
»Exakt. Obwohl mir der Ausdruck zu milde vorkommt. Aber wie auch immer, all das setzt voraus, dass Sie und ich später überhaupt noch am Leben sind. Also, nachdem Holger Sauer mit uns fertig ist.«
»Sie meinen, er macht uns hierfür verantwortlich?« Takeda hielt die Zeitung in die Höhe.
»So sicher wie das Amen in der Kirche.«
»Aber wir können doch nichts dafür, oder?«
»Natürlich nicht. Aber das wird Sauer kaum interessieren. Ich war dabei, wie er gegenüber dem Senator absolute Diskretion zugesagt hat. Irgendwelche Köpfe werden rollen, und ich wette darauf, dass es unsere beiden sein werden.«
7.
Kurz darauf begann die große Lagebesprechung der Mordkommission, und Takeda und Claudia rechneten fest mit ihrer augenblicklichen Suspendierung. Aber wie schon am Vortag war auch heute Holger Sauer für eine Überraschung gut.