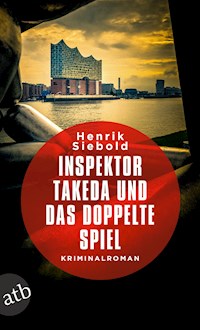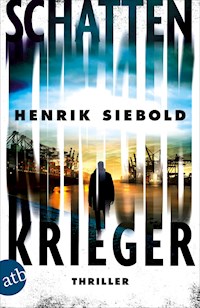9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Takeda ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der Tote aus der HafenCity. Kenjiro Takeda, eigentlich Inspektor der Mordkommission in Tokio, fremdelt immer noch ein wenig – mit dem Wetter in Hamburg und den deutschen Umgangsformen. Seine Kollegin Claudia Harms teilt keineswegs seine Vorliebe für Jazz und Teezeremonien, aber beide sind hervorragende Ermittler. Als ein gefeierter Star der Internetszene tot aufgefunden wird, sind sie besonders gefordert: Markus Sassnitz wurde nicht nur überfahren, sondern auch noch erstickt. Er hatte offenbar viele Feinde, doch ein Person gerät sofort ins Visier der Fahndung: seine Ehefrau. Sie übt allerdings auf Takeda eine besondere Faszination aus ... Ein japanischer Ermittler in Hamburg – er liebt amerikanischen Jazz, europäische Frauen und arbeitet mit ganz eigenen Methoden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Henrik Siebold
Henrik Siebold ist Journalist und Buchautor. Er hat unter anderem für eine japanische Tageszeitung gearbeitet sowie mehrere Jahre in Tokio gelebt. Unter seinem Namen Daniel Bielenstein hat er bisher zahlreiche Romane und Jugendbücher veröffentlicht. Er lebt in Hamburg.
2016 erschien bei Aufbau Taschenbuch sein Kriminalroman »Inspektor Takeda und die Toten von Altona«.
Informationen zum Buch
Der Tote aus der HafenCity
Kenjiro Takeda, eigentlich Inspektor der Mordkommission in Tokio, fremdelt immer noch ein wenig – mit dem Wetter in Hamburg und den deutschen Umgangsformen. Seine Kollegin Claudia Harms teilt keineswegs seine Vorliebe für Jazz und Teezeremonien, aber beide sind hervorragende Ermittler. Als ein gefeierter Star der Internetszene tot aufgefunden wird, sind sie besonders gefordert: Markus Sassnitz wurde nicht nur überfahren, sondern auch noch erstickt. Er hatte offenbar viele Feinde, doch eine Person gerät sofort ins Visier der Fahndung: seine Ehefrau. Sie allerdings übt auf Takeda eine besondere Faszination aus.
Ein japanischer Ermittler – er liebt amerikanischen Jazz, europäische Frauen und arbeitet mit ganz eigenen Methoden
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Henrik Siebold
Inspektor Takeda und der leise Tod
Kriminalroman
Inhaltsübersicht
Über Henrik Siebold
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Impressum
1.
»Verzeihung … äh Entschuldigung!«
Inspektor Kenjiro Takeda reckte den Arm in die Höhe, er schnippte sogar mit dem Finger. Es nützte nichts. Er wurde einfach nicht beachtet.
Es war herzzerreißend.
Offenbar hatte dem Polizisten aus Japan noch niemand erklärt, dass eine Kellnerin in Deutschland vieles im Sinn hatte, aber nicht unbedingt, sich um ihre Gäste zu kümmern.
Takeda war nun einmal nicht mehr in Japan, wo eine Heerschar dienstbarer Geister sich aufopfernd um jeden Gast kümmerte, ihm ungefragt ein Glas Wasser brachte, dazu ein feuchtes Tuch, um Gesicht und Hände zu reinigen, und danach unter Verbeugungen und einem höflichen Kashikomarimashita die Bestellung entgegennahm.
Er war nun in Deutschland. Hier lebte er, hier arbeitete er.
Es war Samstagvormittag, und in dem Straßencafé in Hamburg-Winterhude herrschte reges Treiben. An den Tischen rundherum saßen einige ergraute Intellektuelle und studierten die Wochenendzeitungen. Daneben klapperte ein Student auf seinem Laptop, und noch ein Stück weiter saß eine Gruppe junger Mütter, die munter durcheinanderplapperte und mit ihren Kinderwagen den Bürgersteig und die Durchgänge zwischen den Kaffeehaustischen blockierte.
Takeda schloss die Augen und lauschte dem Stimmengemurmel, dem Zeitungsgeraschel, dem Gelächter. Dann spürte er in sich hinein, und ihn überkam ein Gefühl der Überraschung.
Obwohl er noch nicht allzu viel Koffein im Blut hatte, schlief er nicht auf der Stelle ein! Das war wirklich bemerkenswert! Im heimatlichen Tokio, wo er auch gerne in einem Café saß, zumeist in einer Filiale von Doutor oder Tully’s, wäre er bereits nach kurzen Minuten in einen Dämmerzustand versunken. Die Erschöpfung der langen Arbeitsstunden und der viel zu wenige Schlaf hätten ihren Tribut gefordert.
Hier in Deutschland aber fühlte er sich frisch und ausgeruht. Es war fast ein wenig beunruhigend!
Der Inspektor hatte die seltsame Veränderung schon einige Male in den zurückliegenden Wochen bemerkt. Sie gefiel ihm, aber sie verunsicherte ihn auch.
In Japan war sein Leben fast vollständig dem Polizeidienst gewidmet gewesen, Tag wie Nacht, wochentags wie am Wochenende. Den Arbeitstagen im Keishichō, dem Tokioter Polizeipräsidium, folgten die allabendlichen Essen mit den Kollegen, anschließend alkoholselige Karaoke-Runden oder auch ein Besuch in einer Hostessen-Bar. Kehrte er mitten in der Nacht in seine Wohnung im Stadtteil Meguro zurück, warteten dort zumeist neugierige Journalisten auf ihn, um bei einem Bier oder einem Sake den Ermittlungsstand in aktuellen Fällen zu erfahren. Vielleicht besuchte er auch seinerseits nachts einen Yakuza-Paten, um bei einer guten Flasche Whisky in jenen stundenlangen, sehr ausbalancierten Austausch von Informationen einzutreten, der dem beiderseitigen Vorteil diente.
Takeda kam nie vor drei, vier Uhr morgens ins Bett. Schlafen und Wachsein verschmolzen zu einem ewigen, ununterbrochenen Kreislauf.
Nun aber war er seit gut zwei Monaten in Deutschland, ein Austauschprogramm der Polizei hatte es ihm ermöglicht, und zum ersten Mal seit vielen Jahren hatte er das Gefühl, sich selbst zu gehören. Besser konnte er es nicht ausdrücken. Genau wie die deutschen Kollegen machte er meistens um siebzehn Uhr Feierabend, genoss verlässlich die Wochenenden, wurde mit Nachdruck aufgefordert, die ohnehin wenigen Überstunden auch wirklich abzubummeln.
Natürlich, während der heißen Ermittlungsphasen arbeiteten auch die deutschen Kollegen rund um die Uhr. Danach aber folgten Phasen der Erholung, in denen man gehalten war, sein Privatleben zu pflegen. So hielt es zurzeit auch Takeda. Er trainierte regelmäßig im Dojo des Polizeisportvereins, besuchte die Hamburger Jazzclubs und traf sich zwei- oder dreimal in der Woche mit Sachiko, einer jungen Japanerin, die ebenfalls in Hamburg lebte und mit der er ein leidenschaftliches Verhältnis begonnen hatte.
Takeda war sich nicht sicher, ob es klug war, sich so schnell wieder auf eine Frau einzulassen, schließlich kämpfte er innerlich immer noch mit den Nachwehen seiner Scheidung von Makiko. Andererseits war die Sache mit Sachiko unkompliziert. Sie genossen den Sex und stellten darüber hinaus keine Ansprüche aneinander. Was sprach also dagegen, es einfach laufen zu lassen?
»Na? Was darf’s denn sein?«
Die Stimme der Kellnerin riss Takeda aus den Gedanken. Er öffnete die Augen und blickte dem vielleicht fünfundzwanzigjährigen Mädchen ins Gesicht. Sie war gute ein Meter fünfundsiebzig groß, damit einige Zentimeter größer als er selbst, schlank, hatte ein schmales, von dunkelblonden Locken eingerahmtes Gesicht. In ihrer Oberlippe glitzerte ein metallenes Piercing. Ihr T-Shirt war so kurz, dass ihr flacher, durchtrainierter Bauch nackt vor Takedas Augen glänzte.
Der Inspektor räusperte sich irritiert und sagte: »Ich hätte gerne einen Espresso und ein Croissant.« In seiner eigentümlichen, japanischen Intonation klang die Bestellung ungewohnt, aber durchaus verständlich: Einen Essupuresso undu ein Kuruasson. Er sprach fließend Deutsch, schließlich hatte er die Sprache studiert und das Land bereits einige Male bereist. Zudem war sein Vater ein großer Bewunderer Deutschlands. Er hatte Ken schon früh mit der deutschen Kultur vertraut gemacht.
»Geht klar. Alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte die Kellnerin.
»Ja, danke schön. Alles in Butter.«
Die Kellnerin lachte über Takedas Formulierung. Sie wollte gerade ins Innere des Cafés zurückkehren, als eine der beiden Frauen, die am Nachbartisch saßen, sie zurückhielt. Mit ungeduldiger Stimme sagte sie: »Könnten wir jetzt endlich zahlen! Wir haben schon vor über einer Viertelstunde um die Rechnung gebeten.«
Die Kellnerin lächelte übertrieben süß und sagte: »Jetzt mal nicht quengeln, das macht nämlich Falten! Ihre Rechnung kommt schon noch.« Dann verschwand sie mit federnden Schritten im Inneren des Cafés.
Takeda blickte ihr amüsiert nach. Er mochte Deutschland von Tag zu Tag mehr. Besonders gefiel ihm diese überraschende Entspanntheit, dieses Laisser-faire, dieses Ungezwungene. Die preußischen Zeiten waren wirklich vorüber. Das war wunderbar!
2.
Kriminalhauptkommissarin Claudia Harms starrte auf ihr Telefon. Es war Samstagabend, und sie war unausgeglichen, um es milde auszudrücken. Eigentlich war sie gereizt, nervös, wütend, und zwar auf alles und jedes. Besonders auf sich selbst. Was nicht ganz ungewöhnlich für Claudia war.
Sie starrte auf das Telefon, aber der kabellose Apparat, der auf dem Couchtisch im Wohnzimmer lag, verweigerte ihr den Gefallen zu klingeln.
War es denn wirklich zu viel verlangt? Ein einfacher Anruf? An einem Samstagabend? Sollte wieder einmal sie selbst diejenige sein, die zuerst anrief?
Nein, unmöglich, dachte Claudia. Das konnte sie nicht mit ihrer Würde vereinbaren, mit ihrer Selbstachtung. Es hätte ihre Niederlage offensichtlich gemacht. Ihre Abhängigkeit. Ihre Schwäche. Und vor allem hätte es bestimmt nicht dazu geführt, dass sie am anderen Ende der Leitung von einer freudigen Stimme begrüßt worden wäre …
Claudia blickte auf die Wohnzimmeruhr, einen altmodischen Kasten mit vergilbtem Zifferblatt und Pendel, den sie von ihrer Großmutter geerbt hatte. Er wirkte fremd in der ansonsten modern und stylisch eingerichteten Wohnung. Sie mochte die Uhr, sie erinnerte sie an ihre Kindheit, an die Stille im Haus ihrer Oma in Blankenese, an lange Sommernachmittage, deren Stille nur von dem regelmäßigen Ticken der Uhr unterbrochen wurde.
Es war kurz nach zehn Uhr am Abend. Vermutlich war das die Uhrzeit, zu der sich andere Frauen den Anruf eines Mannes ersehnten. Claudia nicht! Weiß Gott, nein! Sie wünschte sich, dass ihr Arbeitgeber anrief, die Hamburger Polizei, genauer die Mordkommission. Claudia hoffte, dass sie unverzüglich zu einem Einsatz gerufen wurde. Es musste nicht einmal ein Mord sein. Eine schwere Körperverletzung, ein Unfall, eine Schlägerei mit Tötungsabsicht würde genügen. Hauptsache, sie konnte hier verschwinden, konnte raus, konnte sich ablenken. Konnte ihrem Privatleben entfliehen.
»Claudia? Kommst du auch mal zurück? Ich warte auf dich.« Eine Stimme rief aus ihrem Schlafzimmer. Sie klang tief und sonor, sehr männlich, sympathisch. Die Sorte bäriger Typ, den eine Frau sich an einem Samstagabend eben wünschte.
Claudia? Eher nicht.
Warum eigentlich? Keine Ahnung. Vermutlich weil sie einfach eine Macke hatte. Weil sie nie zufrieden war und immer etwas auszusetzen hatte. Sie fühlte sich schon eingeengt, wenn andere Leute noch von Kennenlernen und ersten Zeichen des Vertrauens sprachen. So war sie nun einmal.
»Bin gleich da. Sekunde noch«, rief Claudia. Sie warf dem Telefon einen letzten, vorwurfsvollen Blick zu, zögerte aber, ins Schlafzimmer zurückzukehren. Sie war übrigens nackt, hatte sich nicht einmal ein Tuch umgebunden. Warum auch? Sie konnte sich sehen lassen.
»Mach nicht zu lange. Sonst schlaf ich noch ein. Oder ich mach den Fernseher an«, rief die Stimme aus dem Schlafzimmer.
Claudia lachte. »Wag es nicht. Sonst fliegst du sofort raus. Ich bin gleich bei dir und treib dir solche Flausen aus.«
»Na, hoffentlich.«
Andreas. Sie war jetzt seit vier Wochen mit ihm zusammen, was für Claudias Verhältnisse lang war. Fast schon rekordverdächtig. Bei allen anderen Versuchen in den zurückliegenden Jahren war schon nach einem Tag Schluss gewesen, besser gesagt nach einer Nacht. Und immer war sie diejenige gewesen, die nicht mehr angerufen hatte. Warum? Weil es sinnlos war. Es erschien ihr viel klüger, sich selbst und dem jeweiligen Typen alle Illusionen zu ersparen. Früher oder später wäre sowieso Schluss. Und dann eben lieber früher.
Claudia hätte ihre Beziehungslegasthenie, wie sie es selbst nannte, am liebsten darauf geschoben, dass sie nun einmal ein Bulle war. Der Job ließ Beziehungen nicht zu, das wusste doch jeder. Bullen arbeiteten zu chaotischen Zeiten, hatten eine schussbereite Waffe im Nachtschrank und blickten regelmäßig in menschliche Abgründe. Welche Ehe, welche Beziehung, welche auch nur etwas längere Affäre sollte so etwas aushalten?
Claudia stand immer noch im Wohnzimmer, schüttelte den Kopf, schnaubte. Alles, was sie sich da zusammendachte, war nicht ganz falsch. Aber die Wahrheit war es auch nicht. Eigentlich lag es nur an ihr. Sie kriegte es einfach nicht hin, das mit den Männern.
Sie hatte Andreas an einem Abend im Borchers kennengelernt, einer Kneipe im feinen Eppendorf. Sie hatte mit ihrer Freundin Gudrun am Tisch gesessen, er mit einem Kumpel nicht weit entfernt. Schon vor dem ersten Wort, das sie wechselten, war eigentlich alles klar gewesen. Eine Verabredung mit stummen Blicken. Er war ein gutaussehender Typ, groß, schlank, übertrieb es aber nicht mit der Lässigkeit. Mit seinem Kumpel redete er auf ernsthafte Art, was hieß, dass er nicht völlig unterbelichtet war. Was soll man da noch quatschen? Gudrun war die Flirterei natürlich nicht entgangen.
»Fängst du schon wieder damit an?«, hatte sie halb spöttisch, halb vorwurfsvoll gefragt.
»Womit?«
»Einen Kerl abzuschleppen.«
»Ist das jetzt verboten?«
»Natürlich nicht. Aber es bringt dich nicht weiter, Claudi.«
Claudia prustete. »Ich will nicht weiterkommen, ich will einen Typen im Bett. Und zwar heute Nacht.«
»Ach, Claudia.«
Vielleicht lag es an Gudruns Sprüchen, ihrem Augenrollen, ihrem Seufzen. Sie beschloss, sich mit Andreas Mühe zu geben. Mehr als sonst. Aus einer Nacht wurden viele Nächte, aus einem Wochenende ein ganzer Monat. Zum ersten Mal seit langem konnte Claudia sich etwas vorstellen. Ziemlich überraschend. So kannte sie sich nicht. Aber einfach war es auch nicht. Es gefiel ihr mit Andreas, aber in ihr tobte es. Schien eines ihrer Talente zu sein: das zu zerstören, was ihr guttat.
Andreas trat ins Wohnzimmer, ebenfalls nackt. Sie sahen sich in die Augen, mussten beide lächeln.
»Wenn du nicht freiwillig kommst, dann muss ich dich wohl holen«, sagte er mit gespielter Strenge. Er trat an Claudia heran, legte seine Arme um sie. Sie schloss die Augen und gab ein wohliges Seufzen von sich. »Wir könnten auch einfach hierbleiben. Ich habe ein Sofa, einen Teppich, einen Tisch …«
»Klingt alles verlockend. Aber wenn ich ehrlich bin, dann bevorzuge ich doch das Bett.«
Claudia lachte. Sie schob Andreas ein Stück von sich fort, musterte ihn demonstrativ vom Scheitel bis zu Sohle. »Du musst mich gar nicht holen. Ich komme freiwillig mit. Schließlich weiß ich, was ich will.«
»Ach ja? Was denn?«
»Das wirst du gleich sehen.«
Sie streckte die Hand aus und zog ihn mit sich in Richtung Schlafzimmer.
Es war weit schon nach Mitternacht. Andreas schlief, eingerollt wie ein kleiner Junge. Claudia lag wach. Sie konnte nicht schlafen, wie so oft. Gehörte irgendwie auch zum Polizisten-Dasein. Genau wie zu ihrem ganzen Seelenchaos. Sie verschränkte die Hände hinter dem Kopf und starrte an die Decke. Seltsamerweise musste sie an Takeda denken. Es lief ganz gut mit ihnen, was Claudia selbst mit am meisten überraschte. Sie hatte es nicht erwartet. Das Austauschprogramm zwischen Tokio und Hamburg war ihr anfangs unsinnig erschienen. Ein japanischer Polizist in Deutschland – wie sollte das klappen? Aber Takeda hatte sich als guter Bulle erwiesen. Er war konzentriert, scharfsinnig, umsichtig. Und er war nett. Interessant. Na ja, zumindest soweit sie es beurteilen konnte. So ganz schlau wurde Claudia nämlich nicht aus ihm. Ken, wie sie ihn nannte, hatte seltsame Angewohnheiten, eine ganze Menge sogar. Er machte sich zum Beispiel ständig Notizen, über alles Mögliche. Notierte sich Beobachtungen, aber auch die Schimpfworte, die Claudia gerne und häufig benutzte. Er schloss in Meetings die Augen und schien zu schlafen, sogar wenn Holger Sauer, der Leiter der Mordkommission, gerade redete. Wenn man dem Inspektor etwas erzählte, nickte er die ganze Zeit und brummte bestätigend. Oder wie er ihren Namen aussprach. Kuraudia …
Claudia lächelte, als sie den Klang von Takedas Stimme in ihrer Erinnerung hörte. Was war eigentlich mit ihm und Sex? Hatte er welchen? Und wenn ja, mit wem? Soweit sie wusste, war er ja geschieden. Und eine Freundin hatte er, soweit sie wusste, auch nicht. Aber vielleicht legten Japaner ja gar keinen Wert auf Sex? Obwohl, dafür gab es zu viele von ihnen. Hundertdreißig Millionen, das hatte sie irgendwo gelesen. Vielleicht vermehrten sie sich ja per Zellteilung?
Claudia musste laut auflachen, blickte dann mit schlechtem Gewissen hinüber zu Andreas. Aber der schlief tief und fest und streckte ihr seinen nackten, knackigen Hintern entgegen. Sollte sie ihn wecken? Nein, für heute Nacht reichte es.
Das Telefon ließ Claudia aufschrecken. Sie blickte auf den Wecker. Es war halb drei Uhr in der Nacht. Sie war wohl doch eingeschlafen. Sie wollte aufstehen, war aber zu langsam. Das Klingeln brach ab. Kurz darauf läutete ihr Handy. Es lag auf dem Nachttisch. Claudia fühlte sich benebelt. Sie nahm den Apparat, stand auf, schlurfte ins Wohnzimmer und nahm das Gespräch an. Es war das Präsidium.
Genau das hatte sie sich den ganzen Abend gewünscht. Ein Einsatzbefehl. Jetzt kotzte es sie an. Bullenschicksal. Miese Bezahlung, miese Arbeitszeiten, mieses Image. Der Kollege am anderen Ende der Leitung nahm keine Rücksicht darauf. Er redete einfach los und gab die wenigen Details des Falles durch, die bisher bekannt waren. Claudia hörte zu und spürte Übelkeit in sich aufsteigen. »Okay, hab’s verstanden … Ja, ich mache mich sofort auf den Weg … Nein, den rufe ich selbst an. Ja, natürlich ist der in Bereitschaft, genau wie ich. Ja, danke und Ende.«
Sie beendete das Gespräch, schüttelte den Kopf. Viele Kollegen wollten immer noch nicht glauben, dass Takeda ein vollwertiger Kollege war, mit allen Rechten, allen Pflichten. Aber so war es. Er durfte eine Waffe tragen, er durfte nachts geweckt werden. Das ganze Programm.
Claudia drückte ein paar Tasten ihres Handys und wählte die Nummer des Inspektors. Takeda meldete sich nach dem zweiten Klingeln. Offenbar hatte er auch nicht geschlafen.
3.
Die Nacht war mild und roch nach Kastanienlaub. Inspektor Takeda trat vor die Tür und meinte, eine Note von Herbst in der Luft zu spüren. Dabei war es erst Ende August. Und doch, er täuschte sich nicht. Das Ende des Sommers war zu spüren, zumindest eine Ouvertüre davon.
Er hatte gehört, dass die Hamburger die Zeit, die nun begann, den Altweibersommer nannten – den Sommer der alten Frauen. Aber Horst Kröger, ein älterer Kollege, hatte ihn aufgeklärt. Das Wort hatte nichts mit alten Frauen zu tun, jedenfalls nicht direkt, obwohl auch die meisten Deutschen das dachten. Als Weiben wurden früher vielmehr die Spinnweben bezeichnet, die um diese Jahreszeit oft im glitzernden Sonnenlicht dahinschwebten und die an das graue Haar älterer Frauen erinnerten.
In Japan endete allmählich die große Sommerhitze und die Tage versprachen mildere Temperaturen. Recht besehen begann erst jetzt die wirklich angenehme Zeit des Sommers.
Von der herbstlichen Melancholie, die Takeda erfüllte, während er durch die noch dunkle Straße zu seinem Auto ging, wäre in Japan um diese Zeit noch nichts zu spüren.
Der Inspektor stieg in seinen dunkelblauen BMW, den das LKA ihm zur Verfügung gestellt hatte, klemmte das Behelfsblaulicht auf das Dach, scherte auf die Straße aus und trat das Gaspedal durch. Mit einem feinen Lächeln im Gesicht beschleunigte er den Wagen auf achtzig Stundenkilometer. Er bog schlingernd um die Ecke zur Alsterdorfer Straße, überfuhr, wenn auch etwas vorsichtiger, die rote Ampel am Ring 2 und bog nach links in Richtung Westen ab. Die Straße war nun vierspurig und übersichtlich. Es war kurz vor drei Uhr morgens, kaum ein Wagen unterwegs. Takeda beschleunigte erneut. Hundert, dann hundertzwanzig. Aus dem Bordradio erklang Miles Davis’ Kind of Blue. Sehr entspannt, genau wie Takeda. Er fuhr gerne schnell.
Nötig war die Raserei natürlich nicht. Der Einsatz war zwar dringend, darüber hatte Claudia am Telefon keinen Zweifel gelassen, aber es war keine Gefahr in Verzug. Aber wenn er schon einmal die Gelegenheit dazu hatte …
Der Inspektor lenkte den Wagen weiter über den Ring 2 und unter der Bahnbrücke hindurch, hielt sich dann nach rechts in Richtung Nedderfeld, schoss an Baumärkten und Autohäusern vorbei.
Das wenige, das Claudia ihm über den Fall gesagt hatte, klang nicht gut, auch wenn sie selbst noch kaum Details kannte. Machen Sie sich auf etwas gefasst, Ken. Es wird ziemlich beschissen. Er war gespannt.
Lokstedt, Stellingen, die Volksparkstraße. Das Navigationsgerät zeigte ihm an, dass er sein Ziel in zwölf Minuten erreichen würde. Takeda griff in seine Brusttasche und klopfte eine Zigarette der Marke Mild Seven aus der Packung. Er zündete sie mit dem Zigarettenanzünder an und inhalierte tief.
Als Claudia vorhin angerufen hatte, lag er wach im Bett und hatte auch da eine Mild Seven im Mundwinkel gehabt, dazu ein Glas Whisky in der Hand. Im Hintergrund lief Karl Segem, ein norwegischer Jazz-Saxophonist, den er jüngst entdeckt hatte. Sein Blick ruhte auf Sachiko, die neben ihm lag und schlief. Ihre weiße Haut schimmerte in der Dunkelheit, ihr langes, seidenschwarzes Haar lag wie flüssiger Teer auf dem Laken. Während er sich anzog, musste er jedoch an Makiko denken. Wie oft hatte er sie, mit der er zwölf Jahre verheiratet gewesen war, mitten in der Nacht zurückgelassen, um zu einem Einsatz zu fahren. Makiko hatte immer darauf bestanden, ebenfalls aufzustehen, ihm einen Tee zuzubereiten und ihn zur Tür zu begleiten. Seit zwei Jahren war es vorbei damit, damals hatten sie sich auf sein Drängen hin getrennt. Er hatte eingesehen, dass er sie nicht liebte und sie um das Glück betrog, das sie verdient hatte.
Aber dann, nach der Scheidung, waren ihm Zweifel gekommen. Hatte er wirklich die richtige Entscheidung getroffen? War das, was er für mangelnde Liebe hielt, nicht einfach seine Unfähigkeit gewesen, eine Entscheidung zu treffen? Seine Sehnsucht nach etwas, das er nicht benennen konnte?
Er wusste es nicht.
Die Straße, die Claudia ihm genannt hatte, befand sich am Osdorfer Born, einer Großsiedlung am westlichen Rand von Hamburg. Um 1970 erbaut, Heimstadt für über zehntausend Menschen.
Takeda hatte über die Siedlung gelesen, war sogar an einem beschäftigungslosen Nachmittag mit dem Wagen hingefahren. Die Kollegen hatten ihm dazu geraten. Früher oder später würde er ja sowieso hinmüssen. Dienstlich. Weil man am Osdorfer Born nicht gut leben, aber sehr gut sterben könne.
Der Inspektor war überrascht gewesen, weil er die Siedlung als überraschend angenehm empfunden hatte. Natürlich, die gewaltigen Siedlungshäuser, die fünfzehn, fast zwanzig Stockwerke in die Höhe ragten, waren einschüchternd. Die Mauern waren mit Graffiti beschmiert, Müll lag auf den Straßen, hier und dort sah er eine mutwillig zerstörte Bushaltestelle. Auf den Straßen ging es bunt und laut zu, viele Kids mit dunkler Hautfarbe, der Klang von Rapmusik in den Häuserschluchten, die Luft, die nach Cannabis, Urin und Dreck roch.
Trotzdem war es friedlich gewesen, und während er durch die Grünanlagen spaziert war, hatte er sich nicht unwohl gefühlt.
Nun sollten die Kollegen also doch recht behalten. Ein guter Ort zum Sterben.
Takeda reduzierte die Geschwindigkeit und holte das Blaulicht ein. Er bog in die Straße, in der der Tatort liegen sollte. Im Schritttempo fuhr er weiter, hielt nach Claudia und den Kollegen von der Spurensicherung Ausschau, konnte aber nichts entdecken. Erst hinter einer weiteren Ecke wusste er, dass er sein Ziel erreicht hatte.
Gleich mehrere Einsatzwagen standen mit rotierendem Blaulicht an der Straße, ein weiterer Wagen parkte in einer Grünanlage zu Füßen eines Hochhauses. Im flackernden Lichtkegel des Wagens sah Takeda eine für die nächtliche Uhrzeit erstaunlich große Menschenmenge rund um die Fläche, die von den Kollegen mit rotweißem Flatterband abgesperrt worden war. Es herrschte eine ohrenbetäubende Geräuschkulisse, obwohl die Polizeiwagen keine Martinshörner eingeschaltet hatten. Er hörte grölende Männerstimmen, Gelächter, Musik, immer wieder das Klirren berstenden Glases.
Erst als Takeda ausgestiegen war und sich der Absperrung näherte, sah er, dass aus der Menge heraus immer wieder Flaschen und andere Dinge in Richtung der Polizisten flogen. Zwischendurch dröhnte die mahnende Stimme eines Beamten aus einem Megaphon, doch bitte nach Hause zu gehen und die Polizei ihre Arbeit machen zu lassen.
Die Ansage blieb ohne erkennbare Wirkung.
Takeda, im Anzug, aber ausnahmsweise ohne Krawatte, zuckte mit den Schultern. Claudia hatte ihn gewarnt. In manchen Gegenden von Hamburg erzeugten Uniformen keinen Respekt, sondern Wut.
Der Inspektor drängte sich durch die Menge der Schaulustigen. Der uniformierte Kollege, der unmittelbar hinter dem Flatterband stand, kannte ihn zwar nicht, hatte aber offenbar von ihm gehört. Er tippte sich an die Mütze und sagte: »Sie sind bestimmt Takeda-San? Immer herein in die gute Stube.«
»Die gute Stube?« Der Inspektor sah ihn fragend an.
Der uniformierte Beamte winkte ab. »Nur so ein Ausdruck. Ihre Kollegin finden Sie da vorne bei den Büschen. Die Spurensicherung ist auch schon da. Nur die Rechtsmedizin ist noch unterwegs. In einer Samstagnacht dauert es halt. Da haben wir ja wohl alle etwas Besseres zu tun.«
»Ich verstehe. Vielen Dank.«
Der Beamte nickte. Takeda tauchte unter dem Absperrband hindurch, das den Bereich zwischen einem Schotterweg und dem Gebüsch unmittelbar unterhalb eines der Wohntürme abgrenzte. Das Gebäude ragte fast zwanzig Stockwerke in die Höhe. Die Fassade wirkte durch die versetzt angebrachten, dreieckigen Balkone wie ein zerklüfteter Felsen.
Takeda wollte gerade zum eigentlichen Tatort gehen, als ein Gegenstand nur knapp über seinem Kopf hinwegsauste und mit lautem Klirren auf dem Boden aufschlug. Es war eine leere Flasche, nun in unzählige Scherben zerborsten. Irgendwo weiter hinten in der Menschenmenge schrie eine Männerstimme: »Scheißbullen, verpisst euch!«
Eine zweite Stimme kam hinzu: »Haut bloß ab! Ihr habt hier nichts verloren.«
Takeda erkannte den brüchig-melodiösen Slang, den er inzwischen gut von jungen Deutschtürken kannte. Die Schreie steigerten sich weiter, wurden nun auch von Pfiffen begleitet, verloren sich dann in einem höhnischen Gelächter.
Als der Inspektor sich umdrehte und in die Richtung der Schreihälse blickte, sah er tatsächlich ein paar jüngere Türken, aber auch einige ältere Bewohner der Siedlung, zumeist Deutsche. Sie trugen unter ihren Jacken ihre Nachtwäsche, waren offenbar von dem Lärm und dem Blaulicht angelockt worden.
Der Inspektor fand Claudia unmittelbar vor dem Siedlungshaus, wo sie inmitten einiger Rhododendronbüsche stand. Sie hatte den Kopf in den Nacken gelegt und blickte an der Fassade empor. Takeda machte sich mit einem Hüsteln bemerkbar. Claudia, ohne sich ihm zuzuwenden, sagte: »Was für eine Scheiße, Ken.«
»Ich weiß, dass Sie dieses Wort mögen.«
Claudia schaffte nur ein halbes Grinsen. »Diesmal meine ich es ernst.«
»Erklären Sie mir, was passiert ist.«
»Klar.«
Claudia löste sich vom Anblick der Fassade und drehte sich zu ihm um. Takeda merkte sofort, dass etwas nicht mit ihr stimmte. Sie wirkte nicht einfach nur müde, sondern zutiefst erschöpft, auch sehr angefasst. Es wunderte ihn, denn bisher hatte er Claudia als selbstbewusst und durchaus robust erlebt. War der Fall, der sie hier erwartete, so schlimm?
In der Menge brandeten erneut laute Rufe auf, weitere Flaschen, diesmal aber auch Steine, flogen in ihre Richtung.
Claudia schüttelte missmutig den Kopf. »Wenn das so weitergeht, müssen wir bald mit Helm zum Einsatz.«
»Junge Männer sind oft wütend. Das liegt in ihrer Natur«, sagte Takeda beschwichtigend.
»Junge Männer sind oft Arschlöcher …«, erwiderte Claudia.
»Ich kann Ihnen leider nicht widersprechen.«
Sie sahen sich an und grinsten. Es tat gut.
»Der Krawall hat übrigens angefangen, weil ein paar von den Idioten mit ihren Handys Videos vom Tatort drehen wollten. Ich habe ihnen gut zugeredet, half aber nichts. Als die Kollegen sie dann etwas rabiater nach hinten gedrängt haben, ging es mit den Steinen und Flaschen los.«
»Vielleicht sind nicht junge Männer das Problem, sondern Smartphones?«
Claudia rollte nur mit den Augen. »Ich würde sagen, die Kombination aus beidem.« Dann räusperte sie sich und sagte mit leiserer, ernster Stimme: »Kommen Sie, ich zeige Ihnen, womit wir es zu tun haben.«
Sie führte den Inspektor zu einer Stelle im Gebüsch, wo eine weiße Schutzdecke ausgebreitet war, darunter Konturen, die Takeda zunächst nicht zu deuten vermochte.
Claudia ging in die Hocke, schlug die Decke zurück. Takeda blickte auf die Leiche eines Kleinkindes, eines Jungen, höchstens ein Jahr alt.
»Ist er gestürzt? Ein Unfall?«
»Nein. Er ist hinuntergeworfen worden. Mord.«
4.
Claudia war schlecht. Es lag nicht an der Uhrzeit, nicht an ihrer Müdigkeit, nicht an der grölenden Menge.
Es lag daran, dass es Einsätze gab, bei denen ihr Fell einfach nicht dick genug war, um sie zu schützen.
Sie war weiß Gott nicht zartbesaitet. Massaker, Menschenfresser, Frauenmörder. Sie hatte vor genug Leichen gestanden, bei denen man kotzen wollte, die ausgeräumt und mit Hundescheiße vollgestopft waren. Sie hatte Tote aus dem Wasser gezogen, denen die Aale aus den Augenhöhlen krochen, hatte abgetrennte Arme, Beine, Köpfe zusammengesetzt wie Puzzlestücke. All das war weit jenseits der Grenze dessen gewesen, was ein normaler Mensch aushielt. Sie hielt es aus.
Aber das hier, ein Kind, war etwas anderes.
Auch, weil es schon wieder passierte.
Schon wieder in Hamburg.
Was war nur los mit der Stadt? Mit ihrer Stadt? Mit den Menschen? Warum traf es schon wieder ein Kind, das doch, verdammt noch mal, niemandem etwas getan hatte?
Und warum musste ausgerechnet sie Bereitschaftsdienst haben und sich darum kümmern?
Es berührte etwas in ihr, das sie tief in sich vergraben hatte. Etwas, das sie so gut vor sich selbst versteckte, dass es ihr auch jetzt gar nicht wirklich bewusst war. Was es war? Vielleicht die Tatsache, dass sie keine Kinder hatte? Möglich. Obwohl sie das eigentlich in Ordnung fand. Aber vielleicht ja auch doch nicht. Und dann musste sie mitansehen, wie Menschen das Geschenk, das ein Kind war, einfach wegwarfen …
Der Junge lag auf dem Rücken. Sie schätzte ihn auf zwölf, höchstens achtzehn Monate. Er war klein, ja zierlich, eine süße, viel zu magere Puppe. Die dunklen Haare wirkten selbst jetzt, wo der Junge schon kalt war, verschwitzt. Sein einer Unterschenkel war um fast neunzig Grad abgewinkelt, der Kopf unnatürlich zur Seite gedreht, der kleine Brustkasten in sich verkrümmt, als wären die Rippen, vielleicht die ganze Wirbelsäule gebrochen. Sein Gesicht aber war friedlich, die Augen geschlossen, als würde er schlafen. Er trug einen blauen Strampler mit Bärenmuster, fleckig, verdreckt, darunter eine Windel, die offenbar schon viel zu lange nicht gewechselt worden war.
Claudia trat zwei Schritte zurück, starrte wieder nach oben. Ihre Augen kletterten von Balkon zu Balkon, fünf, zehn, fünfzehn Stockwerke hinauf.
Irgendwo von dort oben war der Junge hinabgeworfen worden. Wer tat so etwas? Wie brachte derjenige es fertig? Sie hatte als Polizistin gelernt, alles für möglich zu halten, sich bis zu einer gewissen Grenze in alles hineinversetzen zu können.
Hier konnte sie es nicht.
Bisher gab es keinen Zeugen für die Tat. Aber sie hatten einen anonymen Anrufer, der sich vor inzwischen fast zwei Stunden in der Notrufzentrale gemeldet hatte. Claudia hatte vorhin, während sie auf Takeda wartete, in der Zentrale angerufen und sich den Mitschnitt des Gesprächs vorspielen lassen. Der Anrufer, männlich, vermutlich älter, seine Identität wurde gerade mit Hilfe der Telefongesellschaft ermittelt, hatte nichts unmittelbar gesehen. Ein Knallzeuge, wie sie das nannten. Nichts gesehen, aber alles gehört. Er gab an, von lautem Kindergeschrei geweckt worden zu sein, Gebrüll, Weinen, Schreien. Offenbar hatte jemand das Kind auf den Balkon gelegt, hatte es ausgesperrt. Kurz darauf sei die Stimme eines Mannes zu hören gewesen, er habe gedroht, das Kind hinabzuwerfen, wenn es nicht aufhöre zu weinen. Dann sei es ruhig geworden, gab der Anrufer zu Protokoll. Er habe geglaubt, dass das Kind wirklich still geworden sei, vielleicht eingeschlafen. Als er aber später auf den Balkon getreten sei, ja, er könne nachts halt nicht schlafen, er habe eine Zigarette rauchen wollen, da habe er den Jungen unten im Gebüsch liegen sehen.
Die Notrufzentrale hatte einen Streifenwagen vorbeigeschickt, um die Angaben zu überprüfen. Die Kollegen hatten die Leiche gefunden und dann sofort weitere Einsatzkräfte beordert. Schließlich wurde auch die Mordkommission alarmiert.
Claudia zuckte zusammen, als sie Takedas Hand auf ihrer Schulter spürte. Sie drehte sich um, ihre Blicke trafen sich, und der Japaner sagte: »Es tut mir leid. Ich wollte Sie nicht erschrecken.«
»Schon gut, Ken. Kein Problem.«
Er sah sie lange an, nachdenklich, besorgt. Er sah ihr nicht einmal in die Augen, und dennoch sah er in sie hinein. Claudia kannte das schon von ihm. Es war, als hätte Takeda einen weiteren, unsichtbaren Sinn, mit dem er in sie hineinspüren konnte. War wohl irgendetwas Japanisches. Die konnten so etwas offenbar. Zumindest er, Ken, konnte es.
Claudias Körper straffte sich, sie kappte die Verbindung zu Takeda und sagte mit geschäftsmäßiger Stimme: »Fangen wir an. Je schneller wir das hier hinter uns haben, desto besser.«
»Natürlich.«
Claudia wandte sich an einen der nahestehenden Uniformierten und bat ihn, ihr und Takeda Kaffee zu besorgen, einer der Kollegen hätte doch bestimmt eine Thermoskanne im Wagen. Dann besprachen sie sich mit Markus Tellkamp, dem Leiter der Spurensicherung. Für ihn und seine Leute gab es im Moment nicht viel zu tun. Sie machten Fotos der Leiche und der Umgebung, ansonsten blieben sie in Bereitschaft.
Claudia sagte: »Mach uns bitte zwei Polaroids von dem Jungen, Markus. Wir müssen so schnell wie möglich herausfinden, wer der Kleine ist. Vielleicht kann uns einer der flaschenwerfenden Idioten weiterhelfen. Ist schon komisch genug, dass hier nicht längst einer von selbst aufgetaucht ist, um zu helfen.«
Die Polaroids waren wenige Minuten später fertig. Claudia nahm eines entgegen und begutachtete es. Erst jetzt, aufgehellt durch den Blitz des Fotoapparates, fielen ihr die blauen Flecken und Blutkrusten im Gesicht des Jungen auf. Sie waren bereits älter und abgeheilt, konnten also nicht von dem Sturz herrühren.
Claudia reichte Takeda eine der Aufnahmen, sagte: »Versuchen wir unser Glück, Ken. Fragen wir herum. Aber vorsichtig, bitte.«
»Sie meinen, weil wir keine Helme tragen?«
Takeda lächelte, schaffte es, dass auch sie lächelte.
Die aggressive Stimmung unter den Zuschauern ebbte schnell ab, als sich die Nachricht vom Tod des Kleinkindes herumsprach. Zur erhofften Kooperationsbereitschaft führte es allerdings nicht. Die meisten der jüngeren Männer zogen es vor, zu verschwinden. Die Polizei beschimpfen – immer gerne. Ihr helfen, und sei es für eine gute Sache? Fehlanzeige! Die älteren Nachbarn blieben, betrachteten das Bild, zuckten aber mit den Schultern. Einige bestätigten immerhin, den Jungen schon einmal gesehen zu haben. Eine ältere Frau – sie trug einen Morgenmantel und hatte eine Dose Bier in der Hand – meinte sich zu erinnern, dass der Junge Pascal hieß. Wer die Eltern waren oder in welcher Wohnung sie wohnten, wusste sie allerdings nicht.
Takeda war ähnlich erfolglos. Er stellte Fragen und zeigte das Foto, erntete aber nur Schulterzucken und Missmut. Claudia ahnte, was das bedeutete. Sie würden von Wohnung zu Wohnung gehen müssen, in der Hoffnung, entweder direkt die richtige Adresse zu finden oder zumindest jemanden, der den Jungen identifizieren konnte. Es könnte gut und gern die ganze Nacht dauern.
Claudia kehrte zu Tellkamp zurück und bat ihn, weitere Polaroids anzufertigen, damit sie damit die uniformierten Kollegen ausstatten könnte. Gerade als Tellkamp seine Kamera zückte, bahnte sich ein Wagen hupend seinen Weg durch die Gaffer.
Es war ein Citroёn. Claudia nickte erleichtert und sagte: »Na, endlich. Das wurde aber auch Zeit.«
Der Wagen gehörte Dr. Angelika Reimann, einer Mitarbeiterin von Ludger Terzian, dem Leiter des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin. Claudia war sich nicht sicher gewesen, wer in dieser Nacht für die Rechtsmedizin im Einsatz war, war aber froh, dass es Reimann war. Sie kannten sich von früheren Fällen. Claudia mochte die Ärztin.
Sie begrüßte Dr. Reimann, die sie duzte und Angelika nannte. Sie stellte ihr Takeda vor, die beiden gaben sich die Hand. Die Medizinerin, eine gutaussehende Mittvierzigerin mit einer wallenden Lockenpracht, die nicht wirklich zu ihrer Profession passte, schenkte dem Inspektor ein Lächeln. »Ludger Terzian hat mir viel von Ihnen erzählt, Herr Takeda. Anscheinend haben Sie beide sich ja richtig angefreundet. Er schwärmt von Ihnen.«
Takeda lächelte verkrampft. In seiner Erinnerung keimten Bilder mehrerer Abende auf, die er gemeinsam mit Terzian im Hotoke verbracht hatte, seinem japanischen Stammlokal im Hamburger Hafen. Der so intelligente wie exzentrische Mediziner war ein begeisterter Japan-Fan. Er betrieb in seiner Freizeit Kyūdō, das japanische Bogenschießen, und besaß ein besonderes Interesse für die Tötungstechniken der alten Samurai. Außerdem war Terzian ein Freund der japanischen Küche, inklusive der Trinksitten. Sie hatten jedes Mal unzählige Fläschchen warmen Sake und anschließend mindestens eine Flasche Whisky geleert, um sich dann gemeinsam im Karaoke-Raum des Hotoke zu verausgaben, sehr zum Leidwesen der übrigen Gäste. Anders als bei Takeda hielt sich Terzians Gesangstalent in sehr engen Grenzen.
»Ja, das ist korrekt. Herr Terzian und ich haben sehr interessante Gespräche geführt«, sagte Takeda und deutete eine Verbeugung an.
Dr. Reimann grinste. Dann aber räusperte sie sich, wurde dienstlich: »Worum geht’s denn überhaupt?«
Claudia setzte sie ins Bild. Reimann, die auch im Kinderkompetenzzentrum der Rechtsmedizin arbeitete und zahllose Misshandlungsfälle begleitet hatte, hörte mit ernstem Gesichtsausdruck zu. Schließlich seufzte sie und sagte: »Bitte nicht schon wieder …«
»Das war auch mein erster Gedanke.«
»Ich weiß jetzt schon, was morgen … nein, übermorgen in den Zeitungen stehen wird.«
Claudia schnaubte. »Das ist im Moment meine kleinste Sorge. Hör zu, mir geht es um Folgendes …«
Claudia bat die Rechtsmedizinerin, aus den Verletzungen des Jungen eine ungefähre Prognose darüber anzustellen, aus welcher Höhe er gefallen war. Es würde die Suche nach dem Täter erheblich erleichtern, da sie die in Frage kommenden Wohnungen eingrenzen könnten.
Dr. Reimann verzog den Mund. »Ich weiß nicht, ob ich das auf die Schnelle kann. Vermutlich bräuchte ich dafür Röntgenaufnahmen, vermutlich sogar ein Schichtbild. Morgen früh …«
»Vergiss morgen früh! Versuch es wenigstens. Du hast genug Erfahrung in solchen Dingen. Es hilft mir doch schon, ob wir über zwanzig oder fünfzig Meter sprechen, über den dritten, den zehnten oder den fünfzehnten Stock.«
»Kennt denn keiner von den Leuten, die hier herumstehen, den Jungen?«
»Fehlanzeige. Oder sie wollen nichts sagen.«
»In Ordnung, ich sehe mir den Jungen an.«
»Danke.«
Claudia führte die Rechtsmedizinerin zu der Leiche. Dr. Reimann kniete sich hin und schlug das Tuch zurück, mit dem der Junge wieder zugedeckt worden war.
Doch zu Claudias Überraschung begann die Ärztin nicht mit einer Untersuchung. Sie kniete regungslos vor der Leiche, starrte sie an, untersuchte sie aber nicht. Sie wirkte ähnlich fassungslos, wie Claudia es vorhin gewesen war. Der Fall war sogar für eine hartgesottene Rechtsmedizinerin keine Routine.
»Angelika, ich möchte dich nicht zur Eile drängen, aber …«
Die Ärztin blickte zu Claudia hoch und sagte: »Der Junge heißt Pascal Rüthers, ist etwas älter als ein Jahr. Er wohnt bei seiner Mutter, Melanie Rüthers, und deren Lebensgefährten …«
»Du kennst den Jungen?!«
Dr. Reimann nickte. »Ich habe den Kleinen vor drei, vier Monaten zur Begutachtung in der Sprechstunde gehabt. Er wurde uns vom Jugendamt zugewiesen, Verdacht auf Kindesmisshandlung. So wie der Junge aussah, war das Wort Verdacht ein Witz.«
»Was war los?«, fragte Claudia.
Die Ärztin schüttelte den Kopf, seufzte. »Der Kleine war derart unterernährt, dass er wohl seit Wochen nichts oder zu wenig zu essen bekommen hatte. Außerdem war er dehydriert. Gerade in dem Alter kann das schreckliche Folgen haben. Wenn ich ihn mir jetzt ansehe, scheint sich nichts daran geändert zu haben. Außerdem war er geschlagen und wohl auch geschüttelt worden. Das Schlimmste haben wir aber erst durch eine toxikologische Untersuchung festgestellt.«
»So etwas macht ihr bei einem Kleinkind?«
»Wenn wir etwas ahnen, schon. Hat sich dann auch bestätigt. Die Eltern haben dem Jungen Alkohol, Schlafmittel und wohl auch Drogen verabreicht, um ihn ruhigzustellen. Das muss über Monate gegangen sein. Bot sich wohl auch an, das Kind dürfte allein vor Hunger ständig geschrien haben.«
»Wer macht so etwas?« Claudia stellte die Frage nur halblaut, doch Dr. Reimann zögerte nicht mit der Antwort. »Nach allem, was ich weiß, die Eltern, oder besser gesagt die Mutter und ihr Lebensgefährte. Er ist nicht der leibliche Vater, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben damals empfohlen, den Jungen sofort aus der Familie zu nehmen. Aber ob es dann auch geschieht, entscheiden das Jugendamt und die Gerichte.«
»Pascal Rüthers«, wiederholte Claudia leise. Erneut blickte sie an der Hausfassade empor. Dann wandte sie sich an Takeda: »Kommen Sie, Ken. Vielleicht können wir das hier wirklich schneller hinter uns bringen, als wir erwartet haben. Ich hätte weiß Gott nichts dagegen.«
Die Haut über Takedas Wangen war gespannt, seine Brauen waren zusammengekniffen. Mit heiserer Stimme sagte er: »Ich auch nicht.«
5.
Shabu!
Das Wort schoss Takeda durch den Kopf, unmittelbar nachdem er mit Claudia die Wohnung von Melanie Rüthers und Marco Niemann betreten hatte.
Das Paar, neunundzwanzig und zweiunddreißig Jahre alt, bewohnte eine Wohnung im vierzehnten Stock. Drei Zimmer, Küche, Bad.
Balkon.
Melanie Rüthers hatte geöffnet, nachdem Claudia und Takeda immer wieder geklingelt und an die Tür gehämmert hatten. Sie war angezogen, trug Jeans und T-Shirt, schien aber geschlafen zu haben. Ihr Haar war zerzaust und stellenweise sogar verfilzt, die Zähne schlecht, der Blick glasig. Sie zitterte, machte fahrige Bewegungen, brauchte einige Anläufe, um zu sprechen, fragte dann, was sie wollten. Die Frau hatte getrunken, das konnte man riechen, aber Takeda sah sofort, dass Alkohol nicht das Einzige war, das sie in diesen Zustand versetzt hatte.
Immerhin ließ sie Claudia und ihn bereitwillig in die Wohnung treten.
Der Blick ins Wohnzimmer bestätigte Takedas Verdacht. Shabu. Unordentliche Kleiderhaufen auf dem Fußboden, verkrustetes Geschirr, stinkende Mülltüten, volle Aschenbecher, leere Flaschen. Dazu Brandlöcher im Teppich, Uringeruch in der Luft, ein paar abgestorbene Zimmerpflanzen auf der Fensterbank. Statt eines Vorhangs verdeckte ein dunkles Tuch die große Fensterscheibe, hinter der wohl der Balkon lag. Der Fernseher lief in ohrenbetäubender Lautstärke. Auf dem Sofa lag Marco Niemann und schlief. Er wachte nicht einmal auf, nachdem erst Melanie Rüthers, dann Claudia ihn zu wecken versucht hatten. Ihn umwehte ein noch stärkerer Alkoholgeruch als sie. Vermutlich war er ohnmächtig, hatte aber dennoch ein entrücktes Lächeln auf den Lippen.
Dann sah Takeda das Tütchen mit Resten des kristallweiß glänzenden Pulvers. Crystal, wie sie es in Deutschland nannten.
Shabu, wie es in Japan hieß.
Eigentlich war Shabu ein onomatopoetisches Wort im Japanischen und bildete ein Geräusch ab, ein Platschen oder Zischen. Was es meinte: Methamphetamin. Crystal Meth.
In Japan war die Droge seit langem verbreitet. Seitdem die Yakuza, aber auch chinesische und koreanische Banden, vor allem mit Verbindungen nach Nordkorea, ihr wirtschaftliches Potential erkannt hatten, gewann sie rasend schnell an Bedeutung, zog eine Spur der Verwüstung durch die Szeneviertel von Tokio und Osaka. In Deutschland war Crystal ebenfalls auf dem Vormarsch, das wusste Takeda aus Gesprächen mit den Kollegen von der Drogenfahndung. Europas offene Grenzen, dazu die Armut und die organisierten Banden in den osteuropäischen Ländern … Das zusammen sorgte dafür, dass Deutschland mit Crystal Meth überschwemmt wurde. Die Droge war einfach herzustellen und versprach satte Gewinne.
So gesehen durfte es Takeda nicht wundern, dass er nun hier in Hamburg mit Shabu konfrontiert wurde. Und genauso mit den Untaten, die die Droge bewirkte.
Doch das war es nicht allein, was den Inspektor beschäftigte. Auch Heroin, Kokain, sogar Haschisch zerstörten Leben, führten zu Verbrechen und Elend. Keine dieser Drogen war harmlos. Shabu aber führte auf verwirrende Weise in die gemeinsame Historie Deutschlands und Japans.
Methamphetamin war zum ersten Mal 1893 synthetisiert worden, von seinem japanischen Landsmann Nagayoshi Nagai. Die Droge, oder besser gesagt der Wirkstoff, war sozusagen eine japanische Erfindung, wenn auch mit deutscher Unterstützung. Nagai, der aus einem ländlichen Samuraigeschlecht auf Shikoku stammte, der kleinsten der japanischen Hauptinseln, war im Jahr 1871 als erster japanischer Student überhaupt von der neuen Meiji-Regierung ins kaiserliche Deutschland geschickt worden. Zu jener Zeit saugte seine fernöstliche Heimat das westliche Wissen auf wie ein trockener Schwamm. Die Motive dafür waren sicherlich Neugier und Wissensdrang, vor allem aber wollte Japan seine Freiheit gegen die überlegenen westlichen Kolonialmächte verteidigen. Nagai sollte in Berlin westliche Medizin studieren, wandte sich aber unter dem Einfluss berühmter deutscher Professoren der Pharmakologie zu. Er wurde promoviert und leistete wichtige Forschungsarbeit. Zurück in Japan wurde er ein Pionier der entstehenden japanischen Pharmaindustrie. Und er fand einen Weg – als erster Wissenschaftler überhaupt –, Ephedrin, einen wichtigen medizinischen Grundstoff, zu isolieren. Daraus stellte er dann später auch Methamphetamin her.
Es war, als hätte Nagai die Droge erfunden, auf die Deutschland und Japan gewartet hatten. Methamphetamin wurde zunächst als medizinisches Präparat eingesetzt, begleitete dann aber beide Mächte in ihre aggressiven Eroberungen im Zweiten Weltkrieg. Meth, nun als so genannte Panzerschokolade verabreicht, hielt die deutschen Soldaten wach auf ihren Eroberungen im Osten, und es betäubte die jungen japanischen Todesflieger auf ihren Kamikaze-Einsätzen gegen die Schiffe der amerikanischen Pazifikflotte. Als beide Länder nach 1945 am Boden lagen, half die Droge der darbenden Bevölkerung dabei, Hunger und Armut zu ertragen, später dann die Mühen des Wiederaufbaus. Für einige Jahrzehnte verschwand Shabu – Crystal – dann von der Bildfläche, zumal inzwischen seine grausamen Nebenwirkungen bekannt geworden waren. Doch seit einigen Jahren nun setzte der Stoff zu einem noch viel größeren Siegeszug an, fraß sich wie ein Krebsgeschwür durch zahllose Länder in Asien, Europa, den USA.
Ken Takeda wusste gut, welche Folgen der Konsum von Crystal Meth haben konnte. Die Panzerfahrerdroge, die Kamikaze-Droge. Sie verwandelte Menschen binnen Monaten in ausgebrannte Wracks, machte sie aggressiv und unberechenbar, so dass sie schon bei nichtigen Anlässen außer Rand und Band gerieten, sich und andere in Gefahr brachten, völlig entfesselt waren. Der Rausch beseelte sie und gab ihnen das Gefühl der Unverwundbarkeit, und gerade darum waren sie todgeweiht. Nach intensivem Konsum, der die Süchtigen oft tagelang nicht schlafen ließ, blieb ihnen zumeist nur noch die Möglichkeit, sich mit exzessivem Alkoholkonsum zu betäuben, um Ruhe zu finden.
Er vermutete, dass das die Phase war, in der sich Melanie Rüthers und Marco Niemann befanden. Aufgeputscht vom Shabu, betäubt vom Alkohol.
Es konnte dennoch jederzeit sein, dass sie schlagartig erwachten, dann möglicherweise von Sinnen gerieten und gefährlich waren. Er hatte es in Tokio mehr als einmal erlebt.
Der Inspektor schüttelte seine Gedanken ab, beugte sich zu Claudia und flüsterte: »Wir müssen vorsichtig sein. Das hier könnte gefährlicher sein, als es scheint.«
»Sie meinen, die Zombies erwachen zum Leben und gehen auf uns los?«
»Ja, genau das meine ich.«
Sie sah ihn fragend an, er nickte nachdrücklich. Für lange Erklärungen fehlte die Zeit. Claudia verstand es. »In Ordnung.«
Melanie Rüthers saß inzwischen auf einem Sessel und hatte die Beine an den Körper gezogen. Sie war barfuß, der Nagellack an ihren Zehen war zum größten Teil abgesplittert. Sie rauchte eine Zigarette, kaute zwischendurch an den Nägeln. Trotz ihrer Verwahrlosung war ihre ehemalige Schönheit immer noch zu erkennen. Eine Tragödie. Ob sie die Anwesenheit der Polizisten wirklich realisierte, war nicht ganz klar.
Marco Niemann lag immer noch regungslos auf dem Sofa, gefangen im Delirium. Sogar als Claudia ihn noch einmal rüttelte, reagierte er nicht.
Takeda hockte sich vor die Frau, so dass sie auf Augenhöhe waren, fragte mit ruhiger Stimme: »Wo ist Ihr Sohn, Frau Rüthers?«
Eine Reaktion blieb aus. Melanie Rüthers blickte auf den Fernseher, dessen Ton Claudia inzwischen abgestellt hatte.
»Frau Rüthers? Hören Sie mich?«
Takeda tippte die Frau an. Die reagierte mit einem übertrieben erschrockenen Zucken, schrie dann sofort los: »Was? Was wollen Sie überhaupt von mir? Was soll das? Wer sind Sie?«
»Wir sind von der Polizei, das haben wir Ihnen doch gesagt. Also noch einmal, wo ist Ihr Sohn? Wo ist Pascal?«, fragte Takeda, die Stimme immer noch ruhig und beherrscht.
»Schläft.«
»Sind Sie sicher?«
»Klar. Was soll die blöde Frage?«
Takeda warf Claudia einen Blick zu. Die zuckte sachte mit den Schultern. Log die Frau? Wusste sie wirklich nicht, was passiert war? Oder waren die Dinge ganz anders, als sie vermuteten, und der Junge war vielleicht gar nicht aus dieser Wohnung in den Tod geworfen worden?
»Wo ist das Zimmer des Jungen?«, fragte der Inspektor.
»Flur runter.«
»Darf ich einen Blick hineinwerfen?«
»Warum?«
»Es gibt Gründe. Bitte begleiten Sie mich.«
Melanie Rüthers stand mühsam aus dem Sessel auf, zündete sich die nächste Zigarette an. Dann schlich sie mit zittrigen Schritten den Flur hinunter. Takeda folgte ihr. Claudia blieb im Wohnzimmer, wo sie Marco Niemann im Auge behalten und den Balkon untersuchen wollte.
Der Wohnungsflur war ebenfalls verwahrlost. Kleider lagen herum, halbleere Pizzaschachteln, Coffee-to-go-Becher. Außerdem eine ganze Batterie leerer Flaschen, möglicherweise aus den Mülleimern der Umgebung zusammengesammelt. In der Luft hing der Geruch von Schimmel, Exkrementen, schalem Bier.
Melanie Rüthers blieb vor der Tür am Ende des Flurs stehen, drehte den von außen steckenden Schlüssel nach links. Die Bewegung erfolgte natürlich und unbewusst. Die Tür zum Kinderzimmer schien also immer abgeschlossen zu sein, konstatierte Takeda.
»Sehen Sie selbst«, sagte Melanie Rüthers, wies in das dunkle Kinderzimmer.
Takeda trat durch die Tür. Im Inneren war es dunkel. Erst nach und nach wurde die Energiesparbirne, die nackt an der Zimmerdecke hing, heller. Es stank unerträglich nach Kot und Urin. Takeda sah im Zwielicht einige verstreut liegende Spielsachen, ein Gitterbett, dessen einer Fuß fehlte, so dass es schräg stand. Auch hier war ein dunkles Laken vor das Fenster gespannt.
Takeda blickte sicherheitshalber in alle Zimmerecken, sagte dann: »Ihr Sohn ist nicht da, Frau Rüthers.«
»Was?«
»Er ist nicht da.«
Sie zögerte, sagte dann: »Ja, kann sein.«
Takeda wartete auf eine Erklärung, doch die blieb aus. Die Frau zog an ihrer Zigarette, ließ die Asche achtlos zu Boden fallen. Der Inspektor wusste, dass Meth-Süchtige unter schweren Gedächtnisstörungen litten, mitunter desorientiert waren, leicht in psychotische Zustände abrutschten. Nichts davon wollte er bei Melanie Rüthers ausschließen.
»Wann haben Sie Pascal das letzte Mal gesehen?«
»Ich weiß nicht.«
»Denken Sie nach. Wann?«
»Warum fragen Sie das?«
»Ich glaube, Sie wissen, warum.«
Sie stützte sich an der Wand ab, sank dann in die Hocke, blieb reglos sitzen. Takeda war klar, dass hier kein Drängen half. Er bückte sich und zog einen Plastikschemel zu sich heran, auf den er sich niederließ. Er zündete sich eine Mild Seven an, bot der Rüthers eine an, die ihre erste Zigarette an der Wand ausgedrückt hatte. Der Inspektor gab erst ihr, dann sich selbst Feuer. Er benutzte seine hohle Hand als Aschenbecher, während sie achtlos auf den Boden aschte.
»Erzählen Sie mir etwas über Ihren Sohn, Frau Rüthers.« Er lächelte aufmunternd. Sie lächelte zurück, zeigte dabei ihre völlig zerstörten Zähne, auch das eine unweigerliche Folge eines exzessiven Crystal-Konsums.
»Pascal ist ein ganz Lieber. Mein kleiner Fratz. Glauben Sie mir, er hat eine bessere Mutter als mich verdient.«
»So etwas sollten Sie nicht sagen.«
Melanie Rüthers stieß ein verächtliches Schnauben aus. »Gucken Sie sich doch um. Finden Sie, das ist eine gute Umgebung für einen Jungen?«
»Warum tun Sie nichts dagegen?«
Sie überhörte Takedas Frage, sagte: »Die wollten ihn mir schon ein paarmal wegnehmen. Aber nicht mit mir. Ein Kind gehört zu seiner Mutter.«
»Der Meinung bin ich auch.«
»Echt?«
»Ja, echt«, sagte Takeda.
Sie weinte, wischte sich dann mit dem Arm unter der Nase entlang. »Als der Kleine geboren wurde, dachte ich, dass alles anders wird. Dass ich es schaffe, die Kurve kriege. Damals hatte ich Arbeit, es ist alles schiefgelaufen. Pascal ist schwierig, war es von Anfang an. Er schreit viel. Ich kann ihn nirgendwohin geben. Will ich auch gar nicht.«
»Was ist mit Ihrem Freund? Ich glaube, Sie sind nicht verheiratet, oder?«
»Sie meinen Marco? Nee, wir sind nicht verheiratet. Wollten wir mal, aber … Hat was mit Geld zu tun.«
»Ich weiß, was Sie meinen, denke ich.«
Sie sah ihn mit einem überraschend wachen Blick an und feixte. »Nein, wissen Sie nicht. Der Anzug, den Sie tragen, was kostet der? Ach, ist auch egal. Sie haben keine Ahnung.«
Takeda nickte, wie er es immer tat, wenn er jemandem zuhörte. »Wie ist das Verhältnis von Marco zu Ihrem Sohn?«
»Die mögen sich. Sonst wäre ich nicht mit ihm zusammen. Ein Kerl, der mit mir zusammen sein will, muss meinen Kleinen genauso lieben wie mich, verstehen Sie?«
»Was ist mit Pascals leiblichem Vater?«
Melanie Rüthers zuckte mit den Schultern. »Weg. Der kümmert sich einen Scheiß. Ist besser so. Ich will den gar nicht sehen.«
»Gab es Probleme zwischen Marco und Pascal? Sie sagten selbst, dass der Junge nicht einfach ist. Manche Männer haben wenig Geduld mit Kindern.«
Wenn Melanie Rüthers nicht an ihrer Zigarette zog, kaute sie an den Fingernägeln. Takeda fiel es darum schwer, sie zu verstehen, zumal ihre Aussprache ohnehin durch den Alkohol und die Drogen verwaschen klang.
Melanie Rüthers schnaubte verächtlich. »Scheiße. Kennen Sie einen, der es mag, wenn so ein Kleiner schreit?«
»Ein lautes Kind kann sehr ärgerlich sein. Gerade wenn es krank oder hungrig ist. Ich denke, dass man als Eltern sehr leicht an Grenzen geraten kann«, sagte Takeda.
»Wenn Sie es sagen.«
»Spielt es für Marco eine Rolle, dass er nicht der Vater ist? Vielleicht hat ein solcher Mann noch weniger Geduld für ein Kind?«
»Kann sein. Fragen Sie ihn doch selbst.«
»Das werde ich.«
»Marco ist ein Guter, glauben Sie mir. Aber er kann auch ausrasten, das schon. Ich meine, Sie wissen doch, was mit uns los ist, oder? Gucken Sie mal hier.« Melanie Rüthers öffnete den Mund und erlaubte Takeda einen Blick auf ihre braunen Zahnstümpfe. Sie stieß ein heiseres Lachen aus. »Scheiße, ja? Wenn nichts zu rauchen oder zu trinken da ist, wird’s schwierig. Marco ist dann nicht er selbst.«
»War in der letzten Nacht nichts zu rauchen oder trinken da?«
»Was soll das eigentlich? Warum fragen Sie den ganzen Scheiß?«
Takeda entging nicht, dass sich Melanie Rüthers’ Blick veränderte, nach und nach wacher wurde. Vielleicht auch berechnender. Sie sah sich nun erneut in dem Zimmer um, auf eine unbeholfene Art verstohlen, so als glaube sie, dass Takeda es nicht bemerken würde. Anscheinend wurde ihr erst jetzt klar, dass ihr Sohn nicht da war und dass es an der Zeit war, sich darüber Gedanken zu machen.
Mit einer ruckartigen Bewegung drehte sie sich wieder zu Takeda, fragte mit einer plötzlich klaren, festen Stimme: »Was ist los? Was ist mit Pascal passiert? Warum sind Sie hier?«
Takeda wollte gerade antworten, als aus dem vorderen Bereich der Wohnung eine brüllende Männerstimme zu hören war, dann das Splittern von Glas, dann Claudias laute Aufforderung, stehen zu bleiben.
Takeda sprang auf die Beine, rannte durch den Flur nach vorne ins Wohnzimmer.
Claudia stand auf der einen Seite des Zimmers, Marco Niemann, inzwischen aufgewacht, stand schwankend vor dem Sofa. In seiner Hand glänzte der aufgeschlagene, scharfkantige Hals einer Bierflasche. Er schrie und spuckte, offenbar völlig von Sinnen: »Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Wollt ihr Geld? Ich mach euch fertig!«
Claudia bemühte sich um eine ruhige Stimme. »Legen Sie die Flasche weg, Herr Niemann. Mein Name ist Claudia Harms, ich bin von der Polizei. Das ist mein Kollege Takeda.«
»Polizei? Was soll das? Warum seid ihr hier? Wegen der Scheißdrogen? Nichts mehr da, ihr kommt zu spät.«
»Legen Sie die Flasche weg, Herr Niemann. Sofort«, wiederholte Claudia.
Im nächsten Augenblick drängte sich Melanie Rüthers an Takeda vorbei und stürzte ins Zimmer. Sie blickte zwischen ihrem Lebensgefährten und den Polizisten hin und her. Dann stolperte sie auf Claudia zu, rüttelte an ihrem Arm: »Sagen Sie mir, wo Pascal ist! Was ist mit ihm passiert?«
Claudia wechselte einen kurzen Blick mit Takeda. Der schüttelte den Kopf. Claudia räusperte sich und sagte: »Ihr Sohn ist tot, Frau Rüthers. Er ist vierzehn Stockwerke in die Tiefe gefallen. Und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ein einjähriges Kind alleine über die Balkonbrüstung geklettert ist.«
Melanie Rüthers starrte Claudia an. Das Glasige, Verschwommene verschwand endgültig aus ihrem Blick, machte einem nüchternen, klaren Erkennen Platz.
Lange Sekunden schien nichts zu geschehen. Dann ging Melanie Rüthers auf Marco Niemann zu. Ihr Gesicht verzerrte sich wie in Zeitlupe, ihre Stimme schwoll zu einem hysterischen Crescendo an: »Was hast du getan? Sag es mir! Was hast du mit meinem Jungen gemacht, du Schwein, du Mörder, du Drecksau?«
Auch Marco Niemanns Blick klärte sich, sein Gesicht war nun von Entsetzen gezeichnet. »Ich … gar nichts. Wirklich gar nichts.«
»Ach ja? Und was ist dann mit Pascal passiert?«
Claudia warf Takeda einen kurzen Blick zu, eine Rückversicherung, sagte dann: »Ein Nachbar hat gehört, wie Sie gedroht haben, den Jungen hinabzuwerfen, wenn er nicht still ist, Herr Niemann. Kurz darauf wurde er tot unten im Gebüsch gefunden. Äußern Sie sich mal dazu.«
Alle Kraft wich aus Marco Niemanns gerade noch überspanntem Körper. Er starrte Claudia an, die Augen geweitet, verwirrt, in sich nach Erinnerungen tastend. Dann traten Tränen in seine Augen. Kopfschüttelnd sagte er: »Ich wollte es nicht. Wirklich nicht. Er hat geschrien, immer weitergeschrien. Ich wollte ihm doch nur Angst machen … und da ist er … er ist …«
Marco Niemann zitterte am ganzen Körper, war offenbar kurz davor, endgültig die Kontrolle zu verlieren.
Dann geschah alles in rasender Geschwindigkeit. Melanie Rüthers schrie erneut auf, stürzte dann schreiend auf ihren Lebensgefährten zu. Claudia versuchte, sie zurückzuhalten, doch sie riss sich los. Marco Niemann hob im gleichen Moment die Hand mit der zerbrochenen Flasche, so dass Melanie Rüthers, getrieben vom eigenen Schwung, in die Scherben hineinrannte. Doch als merkte sie das gar nicht, schlug sie auf Niemann ein, schrie, beschimpfte ihn. Plötzlich wankte sie, blickte an sich selbst hinab, sah Blut aus ihrem Bauch quellen, fiel rückwärts zu Boden. Marco Niemann schüttelte den Kopf, schrie Unverständliches. Sein Gesicht war nun endgültig vom Wahnsinn gezeichnet. Claudia hatte ihre Dienstwaffe gezogen, forderte ihn energisch auf, sich nicht zu bewegen.
Niemann lachte, blickte auf die Mündung der Waffe, sagte: »Schießen Sie! Na, los! Sie tun mir einen Gefallen.«
Er machte einen Schritt nach vorne. Claudia entsicherte und nahm die Waffe in Anschlag. »Keinen Schritt weiter!«
Marco Niemann blieb stehen, lachte auf, ließ die blutverschmierte Flasche fallen.
Dann drehte er sich in einer blitzschnellen Bewegung um und rannte durch die geschlossene Balkontür, deren Glas in Scherben zersprang.
Claudia sah entsetzt, wie der Mann blutüberströmt versuchte, über das Balkongeländer zu klettern, um sich in die Tiefe zu stürzen.
Takeda sprang mit kraftvollen Schritten vor, tauchte durch die zerbrochene Tür nach draußen, schnitt sich dabei in Arme und Gesicht, schaffte es aber, Marco Niemann im letzten Moment zu packen und zurück auf den Balkon zu ziehen.
Claudia ließ ihre Waffe sinken.
6.
Es ging auf acht Uhr morgens zu. Sonntag. Die Sonne schien durch die grünen Zweige der Bäume, die auch hier am Osdorfer Born überall die Straßen säumten. Rentner führten ihre Hunde aus, ein einsamer Jogger drehte seine Runden. Hinter dunklen Vorhängen hämmerte eine Musikanlage, in der Hoffnung, die Nacht auf die Art verlängern zu können. Rund um den kleinen Backshop, in dem Claudia und Takeda saßen, roch es verführerisch nach Kaffee und frischen Brötchen.
Claudias Augen wurden von tiefen, violetten Ringen untermalt. Ihr Blick ruhte auf Ken Takeda, so als fände sie in seinem Anblick Versöhnung und Sicherheit. Sie fragte: »Was würden Sie am liebsten tun, wenn Sie die freie Wahl hätten? Beruflich meine ich. Und sagen Sie jetzt nicht, Bulle. Das würde ich Ihnen nicht glauben. Nicht nach so einer Nacht.«
Takeda ließ sich Zeit mit der Antwort. »Ich würde gerne einen Yatai-Stand betreiben. Das wäre das Richtige für mich.«
»Einen was?«
»Einen Yatai-Stand, eine Art fahrbares Mini-Restaurant. Es gibt in Japan immer noch viele davon, auch wenn ihre Zahl allmählich abnimmt. Meistens sind es kleine Karren aus Holz mit einem Kohleofen. Sie bieten Nudelsuppe, Süßkartoffeln oder Oden an, eine Art Eintopf. Der Platz reicht nur für wenige Gäste, aber oft kann man dort vorzüglich speisen.«
»Ein Restaurant. Überraschend. Was reizt Sie daran?«
Er zuckte mit den Schultern. »Die Menschen müssen essen, immer und überall. Mit einem guten Gericht kann man sie glücklich machen.«
»Das stimmt wohl.«
»Was ist mit Ihnen? Was wäre Ihr Traumberuf, wenn Sie die Wahl hätten?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht etwas mit Gartenbau. Oder Floristin. Sich um Blumen und Pflanzen zu kümmern erfordert Hingabe. Sie können Menschen glücklich machen.«
Takeda lachte. »Ich hätte von selbst drauf kommen können. Unser Dienstzimmer im Präsidium. Der Dschungel …«