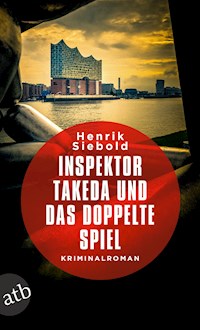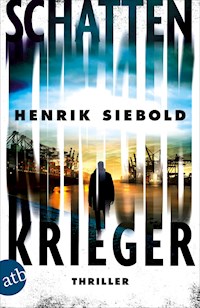9,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Takeda ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein kunstvoller Tod.
Inspektor Takeda ist zu Besuch in einem Herrenhaus auf dem Land. Gastgeberin ist Ernestine von Remsau, eine vermögende Witwe, die in Hamburg eine Kunsthandlung betreibt. Mit weiteren Gästen soll es ein Wochenende voll interessanter Gespräche über Japan, Kunst und Antiquitäten werden. Am nächsten Morgen ist Ernestine von Remsau tot, offenbar hat sie sich erhängt. Doch Takeda kommen leise Zweifel, und dann stellt sich heraus, dass alle Anwesenden im Haus gute Gründe hatten, die alte Dame zu töten – und dass das berühmteste Bild Japans, »Die große Welle vor Kanagawa«, eine wichtige Rolle in diesem Kriminalfall spielt ...
Inspektor Takeda, kunstsinniger Jazzliebhaber, und ein rätselhafter Todesfall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Inspektor Takeda freut sich auf ein ruhiges Wochenende auf einem Herrenhaus abseits von Hamburg. In einem ausgesuchten Kreis, den die vermögende Ernestine von Remsau eingeladen hat, soll es um Kunst, Antiquitäten und Japan gehen. Am nächsten Morgen aber ist die Gastgeberin tot – sie hat sich offenbar nachts in ihrem Zimmer erhängt. Da ein Unwetter alle Wege unpassierbar gemacht hat, muss Takeda allein ermitteln und stößt auf viele Ungereimtheiten. Wer ist nachts durch das Haus geschlichen? Warum sind die Reifen an einigen Autos zerstochen? Und welche Rolle spielt ein berühmter japanischer Farbholzschnitt? Zur selben Zeit muss Claudia in Hamburg den Mord an einem zwielichtigen Privatdetektiv aufklären. Und dann kommt ihr bei den Ermittlungen der Verdacht, dass beide Fälle zusammenhängen und Takeda in höchster Gefahr schwebt.
Über Henrik Siebold
Henrik Siebold ist Journalist und Buchautor. Er hat unter anderem für eine japanische Tageszeitung gearbeitet sowie mehrere Jahre in Tokio verbracht. Er lebt in Hamburg und unternimmt oft ausgedehnte Reisen nach Japan.
Bisher erschienen als Aufbau Taschenbuch »Inspektor Takeda und die Toten von Altona«, »Inspektor Takeda und der leise Tod«, »Inspektor Takeda und der lächelnde Mörder«, »Inspektor Takeda und das doppelte Spiel«, »Inspektor Takeda und die stille Schuld« sowie »Inspektor Takeda und das schleichende Gift«. Außerdem hat er den Thriller »Schattenkrieger« verfasst. Alle seine Bücher liegen auch in Audiofassungen vor.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Henrik Siebold
Inspektor Takeda und der schöne Schein
Kriminalroman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84. — Eine Woche später
Nachwort
Impressum
Wer von diesem Kriminalroman begeistert ist, liest auch ...
1.
Die große Welle vor Kanagawa war zweifellos eines der berühmtesten Bilder Japans. Es zeigte drei schmale Fischerboote, die von einer gigantischen Welle begraben wurden – so gigantisch, dass das Wasser gleich auch den heiligen Berg Fuji im Hintergrund zu verschlingen schien.
Inspektor Kenjiro Takeda hatte den Farbholzschnitt von Katsushika Hokusai bereits unzählige Male gesehen, und er wusste, dass das Bild nicht nur zahllose japanische Künstler inspiriert hatte, sondern ebenso die europäischen Impressionisten, dazu auch Komponisten und Dichter wie Debussy und Rilke. Inzwischen zierte es sogar eine japanische Banknote und die Reisepässe seiner Heimat, und es gab ein Emoji, das nach dem Vorbild der Welle gestaltet war.
Und doch empfand Takeda ein gewisses Gefühl der Enttäuschung, als sein Blick auf das berühmte Ukiyo-e fiel. Es hing, zu seiner Überraschung, an der Stirnseite des großen Salons von Gut Hohenforst und dominierte auf diese Weise den gesamten Raum.
Der Inspektor befand sich nicht in Hamburg, sondern im nördlichen Schleswig-Holstein, auf dem Land. Genauer, er war auf einem einstmals adeligen Landsitz, in den er mit anderen Gästen über das Wochenende eingeladen war. Gräfin Ernestine von Remsau, die Hausherrin, plante zwei Tage der Geselligkeit und der guten Gespräche, nicht zuletzt über Kunst und über Japan, weswegen sie darauf bestanden hatte, dass auch Takeda die gesamte Zeit bis zum Sonntag blieb.
Der Inspektor war erst kurz zuvor angekommen. Es war Freitagnachmittag. Er hatte sein Gepäck auf das ihm zugewiesene Zimmer im ersten Stock gebracht und war anschließend in den großen Salon im Erdgeschoss getreten. Dort war ihm Hokusais Meisterwerk sofort aufgefallen.
»Was sagen Sie, mein lieber Kenjiro? Ist es nicht ein atemberaubendes Kunstwerk? Hat man nicht das Gefühl, selbst von der Welle mitgerissen zu werden? Ich habe das Bild erst vor Kurzem erworben und bin sehr stolz darauf.«
Ernestine von Remsau, trotz ihrer sechsundsiebzig Lebensjahre eine schöne Frau mit schlanker Figur und einem ausdrucksvollen, fein gezeichneten Gesicht, trat neben den Inspektor und blickte mit ihm auf den Farbholzschnitt. Obwohl sie beim förmlichen Sie blieb, nannte sie Takeda beim Vornamen und wollte ihrerseits Ernestine genannt werden.
Der Inspektor lächelte und sagte mit leiser Stimme: »The Gureito Weibu … aber ja, es ist ein ausgesprochen faszinierendes Werk.«
Takeda benutzte die auch in Japan nicht unübliche englische Bezeichnung für den Holzschnitt, the Great Wave. Wie bei nicht wenigen Dingen war es in Japan zu noch größerem Ruhm gelangt, nachdem es so enormen Widerhall im Westen gefunden hatte.
Von Remsaus wache Augen nahmen ein spitzbübisches Funkeln an. »Dennoch scheinen Sie Vorbehalte zu haben, Kenjiro. Oder täusche ich mich?«
Takeda fühlte sich ertappt. »Sagen wir, ich bin einfach ein wenig überrascht.«
»Überrascht? Aber warum? Erklären Sie es mir.«
Takeda legte den Kopf schief, kratzte sich im Nacken und stieß einige nachdenkliche Brummlaute aus. Ihm war selbst nicht so recht klar, was seine Gefühlslage verursachte. Vermutlich lag es nicht an dem Ukiyo-e selbst, denn das war ohne jeden Zweifel meisterlich. Der Grund waren wohl eher die vielen übrigen Kunstgegenstände, die sich in dem Salon im Erdgeschoss des Herrenhauses befanden. Sie alle gehörten der Gräfin, die seit Jahrzehnten in Hamburg eine auf Asien spezialisierte Kunsthandlung betrieb. Takeda sah – neben goldgerahmten europäischen Ölgemälden, die wohl seit Generationen hier hingen – japanische Bildrollen und Schnitzereien, kostbare chinesische Tuschzeichnungen und ehrwürdige Buddhastatuen.
Im Gegensatz zu diesen Kostbarkeiten, allesamt Unikate, erschien die Große Welle seltsam gewöhnlich. Letztlich handelte es sich nur um einen Druck, den es in tausendfacher, ja vermutlich millionenfacher Auflage gab. Die Welle war, auch wenn der Gedanke Takeda schmerzte, ein Stück Gebrauchskunst und nicht mehr.
Mit einem leisen Seufzen erklärte er: »Angesichts all der anderen Meisterwerke wundere ich mich, dass Sie einer schlichten Reproduktion einen so prominenten Platz einräumen.«
Die alte Dame lachte heiter auf. »Eine schlichte Reproduktion, mein lieber Ken? Das mag für die meisten Exemplare gelten, die es auf der Welt gibt. Aber was Sie hier sehen, ist weit mehr als das.«
»Tatsächlich? Was macht es so besonders?«
Die Gräfin kicherte erneut, wirkte dabei trotz ihres Alters mädchenhaft. »Ich werde es Ihnen später erklären. Erst einmal aber möchte ich Sie meinen übrigen Gästen vorstellen. Kommen Sie! Alle brennen darauf, den berühmten Inspektor aus Japan kennenzulernen.«
Die Hausherrin hakte sich bei Takeda ein und zog ihn sanft, aber bestimmt durch die offenstehende Verandatür hinaus in den Garten. Auf der großen, erhöht gelegenen Terrasse befand sich eine von Sonnenschirmen beschattete, weiß gepolsterte Möbellandschaft. Wasserkaraffen sowie zartes, sicherlich wertvolles Kaffee- und Tee-Porzellan waren aufgedeckt, dazu Etageren mit Gebäck und Sandwiches. Fünf Personen, sommerlich leicht und doch stilvoll gekleidet, saßen beisammen, tranken Tee oder Kaffee und plauderten.
Nun aber erhoben sie sich und blickten in Richtung der Tür. Den drei Männern und zwei Frauen war anzusehen, dass sie sich in der Tat darauf freuten, dem Polizisten aus Japan vorgestellt zu werden.
Obwohl … nahm Takeda in den Zügen des einen oder anderen nicht eine überraschende Anspannung wahr? Oder war es sogar Angst?
2.
Während der Inspektor Hokusais Meisterwerk auf Gut Hohenforst betrachtete, stand auch Kriminalhauptkommissarin Claudia Harms vor einem Bild. Es hatte sogar eine gewisse Ähnlichkeit mit der Großen Welle, zumindest was die Farbgebung anging. Das Motiv hingegen war völlig anders, das Bild zeigte zwei stilisierte, comic-haft dargestellte Menschen, von denen einer einen Hut trug. Über ihren Köpfen stand in tanzenden, bunten Buchstaben: Zwei wie wir.
Es war ein Likörell, ein Bild, das mit alkoholischen Getränken gemalt war, und da es wohl nur einen Künstler auf der Welt gab, der diese Technik anwandte, ließ sich ohne Weiteres sagen, von wem das Bild stammte: Udo Lindenberg.
Claudia befand sich zuhause in Hamburg-Winterhude. Genauer, sie war in der Wohnung, in der Takeda seit nunmehr über einem Jahr lebte und in die sie vor wenigen Tagen ebenfalls eingezogen war. Ihre eigene Wohnung hatte sie durch Kündigung verloren. Ken hatte ihr daraufhin angeboten, zu ihm zu ziehen, schließlich stand ihm eine große Altbauwohnung in bester Lage zur Verfügung, die ihm das japanische Generalkonsulat stellte. Er brauche nicht so viel Platz, hatte er Claudia versichert, er nutze ein Zimmer lediglich zum Wäschetrocknen und ein anderes gar nicht. Ob sie beide nicht einfach eine Wohngemeinschaft gründen wollten? Ganz ohne Hintergedanken. Claudia hatte trotz seines großzügigen Angebots gezögert. Natürlich hatte sie das. Die Vorstellung, gemeinsam mit Ken unter einem Dach zu wohnen, war ihr verlockend und zugleich völlig absurd erschienen. Nach allem, was zwischen ihnen geschehen war … erst ihr holperiges Kennenlernen, dann ihr allmähliches Zueinanderfinden, ihre kurze Leidenschaft und ihre anschließende Trennung, für die er nichts, sie aber alles konnte. Wie sollte da ein Leben in gemeinsamen vier Wänden funktionieren? Egal, ob als Paar oder als Wohngemeinschaft?
Schließlich aber hatte Claudia zugestimmt. Es lag nicht daran, dass sie sonst obdachlos geworden wäre. Irgendetwas hätte sich schon ergeben, zumal sie zur Not auch bei ihren Eltern hätte Unterschlupf finden können. Nein, sie hatte an einem Punkt einfach aufgehört, nachzudenken. Sie war ins kalte Wasser gesprungen, hatte zugesagt. Ohne zu wissen, was daraus entstehen würde.
Vielleicht war es die einzige Art, wie jemand wie sie Glück finden konnte. Indem sie einfach handelte. Ohne Fallschirm, ohne Plan.
Sicherlich hatte ihr Entschluss auch mit ihrem letzten Fall zu tun gehabt. Damals war sie in die Hände eines verrückten Sadisten geraten, der sie in einem Erdloch gefangen hielt und töten wollte. Es war nicht dazu gekommen. Claudia wehrte sich. Sie überwältigte ihren Peiniger und befreite sich.
Aber folgenlos war das Ganze nicht geblieben. Sie kam äußerlich mit ein paar Schrammen davon. Innerlich aber saßen die Wunden tief. In ihr war das Gefühl gereift, dass das Leben zu kurz und zu zerbrechlich war, um sich von Ängsten regieren zu lassen. Um Dinge nicht zu tun, die sich vielleicht als etwas Gutes herausstellen könnten.
Darum hatte sie sich drauf eingelassen.
Jetzt war sie also hier.
In ihrem neuen Zuhause.
Claudia war nun zum ersten Mal allein in der Wohnung. Takeda war auf dem Land, er war der Einladung einer alten kunst- und asieninteressierten Dame gefolgt, die offenbar einen Narren an Ken gefressen hatte. Es war Claudia nicht unrecht. Vor ihr lagen ein Abend und zwei lange Tage, an denen sie endlich ungestört ihre Sache auspacken konnte.
Außerdem hatte sie sich vorgenommen, ein wenig Wohnlichkeit in die Räume zu bringen. Dafür schien der ansonsten so feinsinnige Ken kein Gespür zu haben. Er lebte auch nach einem Jahr in Hamburg immer noch mehr oder weniger aus dem Koffer, hatte kaum Möbel und schlief auf einem Futon auf dem Fußboden.
An der Kargheit seines Zimmers würde sie nichts ändern, das war seine Sache. Aber für ihr gemeinsames Wohnzimmer galt etwas anderes. Und auch für den Flur.
Den hatte Claudia sich als Erstes vorgenommen und einige ihrer geliebten Bilder aufgehängt. Dazu zählten Werke unbekannter Maler, aber auch ein Horst Janssen, ein farbenfroher Klee und sogar ein echter Chagall.
Sicher, diese Kunstwerke waren wertvoll. Aber das war Claudia nicht wichtig. Für sie waren die Gemälde Erinnerungen an Fälle, an deren Aufklärung sie mitgearbeitet hatte. Fälle, die sie berührt, aufgewühlt, vielleicht auch hatten verzweifeln lassen.
Fälle, die Narben hinterlassen hatten.
Fälle, die für immer ein Teil ihres Lebens bleiben würden.
Das galt auch für das Likörell von Lindenberg, das sie nun im Flur aufgehängt hatte und das ihr – trotz aller düsteren Erinnerungen – ein Lächeln entlockte.
Es lag nicht nur an der fröhlichen Stimmung, die das Bild verbreitete, sondern auch an Takedas Reaktion darauf, als er es zum ersten Mal gesehen hatte.
»Es ist toll, wirklich faszinierend«, hatte Ken gesagt. »Aber der Maler, dieser Herr Lindenberg, der sollte besser nie nach Japan fahren.«
»Warum nicht?«
»Man würde über ihn lachen.«
»Wieso?«
»Weil er genauso heißt wie ein berühmtes Nudelsuppengericht. Udon Lindenberg …«
Claudia, nachdem sie sich die Lachtränen aus den Augen gewischt hatte, hatte Takeda einen Kuss auf die Wange gedrückt. »Ach Ken, ab und zu bist du echt niedlich. Der Mann heißt nicht Udon, er heißt Udo. Ohne N. Also ohne Nudeln, sozusagen. Aber dein Missverständnis ist köstlich. Ich hoffe, dass er eines Tages davon erfährt.«
3.
»Inspektor, das ist Peter Kemper, der berühmte Schriftsteller. Er war bereits einige Male in Ihrer Heimat und hat in seinen Romanen über Japan geschrieben«, erklärte Ernestine von Remsau. Sie wies mit der Hand auf einen hageren Mann mit langem, leicht strähnigen Haar, der Takeda durch eine randlose Brille hindurch entgegenblickte, dabei kränklich und gedankenschwer wirkte. Der Inspektor schüttelte seine Hand, wobei er sich zugleich ein wenig verbeugte. Die in Japan übliche Art der Begrüßung steckte tief in ihm drin.
»Ihre Heimat ist sehr inspirierend«, erklärte Kemper. »Zuletzt bin ich die berühmte Pilgerstrecke der achtundachtzig Tempel auf Shikoku entlanggewandert. Ich denke, mein nächster Roman wird darum kreisen. Sind Sie die Strecke schon einmal gegangen?«
»Bedauerlicherweise noch nicht.«
»Sollten Sie, Inspektor. Die Kultur Ihrer Heimat ist faszinierend und die Natur wunderschön. Es ist schade, dass Ihre Landsleute immer nur arbeiten und darüber vergessen, in was für einem wunderbaren Land sie leben. Wir finden sicherlich im Laufe des Wochenendes eine Gelegenheit, und ich erzähle Ihnen mehr darüber …«
Takeda verbeugte sich erneut und erklärte: »Ich freue mich jetzt schon darauf, von Ihnen noch mehr über meine Heimat zu lernen, Herr Kemper.«
Der Schriftsteller stutzte, setzte zu einer Erwiderung an, doch Ernestine von Remsau drängte Takeda mit mütterlicher Bestimmtheit weiter. Eine Frau, schlank und attraktiv in einem edel wirkenden Kostüm, streckte Takeda ihre fein manikürte Hand entgegen. Neben ihr stand ihr Mann, der offenbar um einige Jahre jünger war als sie. Die Bermudashorts und das T-Shirt, das er trug, waren im Vergleich zu ihrer Kleidung wie der aller anderen Gäste erstaunlich leger, brachten aber seinen muskulösen, durchtrainierten Körper zur Geltung.
»Das sind Simone von Kalf und ihr Mann Sascha. Simone arbeitet in der Chefetage einer kleinen, aber feinen Privatbank in Hamburg. Wenn Sie etwas über Finanzen wissen möchten, sie kennt die Antwort. Auf mein bescheidenes Vermögen hat sie jedenfalls ein wachsames Auge. Und Sascha ist … nun ja, Sportlehrer, wenn ich es richtig verstanden habe.«
Sascha von Kalf lachte mit strahlend weißen Zähnen. Von Remsaus ironischer Unterton schien ihm zu entgehen, und er erklärte mit ungetrübter Fröhlichkeit: »Personal Trainer, bitte, Ernestine! Und glauben Sie mir, Herr Takuka …«
»Takeda.«
»Ja, ja … jedenfalls werden bei meinem Stundensatz sogar Rechtsanwälte und Wirtschaftsberater neidisch, glauben Sie mir. Zu meinen Klienten zählen Stars und Politiker. Richtige Promis. Erste Liga!«
Seine Frau unterbrach ihn. »Du brauchst nicht anzugeben mit deinen prominenten Klienten, Schatz. Das ist peinlich.«
»Mir nicht«, erwiderte er wiederum in gut gelauntem Tonfall. Dann sagte er mit theatralisch geweiteten Augen in Takedas Richtung: »Frauen … es geht nicht ohne sie, aber mit ihnen ist es auch kein Spaß.«
Simone von Kalf schnalzte mit der Zunge, sagte ihrerseits zu Takeda: »Schönheit geht nicht immer mit Klugheit einher, das gilt leider auch für Männer. Am besten hören Sie Sascha gar nicht zu.«
Bevor der Inspektor antworten konnte, zog Ernestine von Remsau ihn erneut weiter und sagte mit unbekümmerter Stimme: »Ein harmonisches Eheleben ist nicht allen vergönnt. Aber wie auch immer, ich darf Ihnen Egbert Saemann vorstellen. Er ist mein Architekt und Berater in so mancher Lebenslage. Er sorgt verlässlich dafür, dass Gut Hohenforst auch nach dreihundert Jahren noch ein ansehnliches Heim ist. Mein viel zu früh verstorbener Mann – er hieß Karl – und Egbert kannten sich noch aus ihrer Studentenzeit. Sie waren Freunde, so wie Egbert und ich es heute sind.«
Takeda schätzte den Mann auf Mitte siebzig, womöglich auch einige Jahre älter. Dennoch wirkte er gesund und agil. Er trug einen modisch-hellen Sommeranzug und dazu eine passende Krawatte und ein Einstecktuch. Saemann streckte Takeda die Hand entgegen und sagte: »Ja, der alte Kalle und ich … er ist in der Tat viel zu früh von uns gegangen … kannten uns seit dem ersten Semester. Leider waren wir seinerzeit nicht in derselben Verbindung. Daher verdanke ich ihm dieses kleine Andenken.«
Saemann fuhr sich lachend mit dem Finger an die Wange, auf der eine tief eingekerbte Narbe zu erkennen war.
»Ich verstehe, ein Schmiss«, erklärte Takeda. »Sie waren beide in fechtenden Burschenschaften.«
Saemann nickte anerkennend. »Respekt, Inspektor. Sie kennen sich aus. Wobei wir nicht von Fechten, sondern von Schlagen sprechen, einfach weil …«
Saemann wollte zu einer weitergehenden Erläuterung ansetzen, doch Ernestine hob gebieterisch die Hand. Sie sagte sanft, aber bestimmt: »Verzeih, Egbert, du und Kenjiro findet sicherlich noch genügend Zeit, um über das Verbindungsleben zu sprechen. Erst einmal möchte ich den guten Kenjiro weiter vorstellen. Inspektor, das ist Ulrike Vogler, die Geschäftsführerin meiner Hamburger Kunsthandlung. Es gibt kaum jemanden in Deutschland, der mehr über asiatische Kunst weiß als sie. Sie hat übrigens auch den Ankauf der Großen Welle für meine Privatsammlung getätigt, wofür ich ihr sehr dankbar bin.«
Takeda schätzte Vogler auf Mitte vierzig. Sie irritierte ihn durch ihre durchgängig schwarze Kleidung, ihr gelocktes, schwarzes Haar und ihren ebenfalls schwarzen Lidstrich, der in starkem Kontrast zu ihrer blassen Haut stand. Für einen Moment überlegte der Inspektor, ob es angebracht wäre, zu kondolieren, doch dann wurde ihm klar, dass Vogler sich einfach nur auf eine Art kleidete, die in kunstinteressierten Kreisen nicht unüblich war.
»Ulrike wird uns später noch einiges zu Hokusais berühmtem Werk erläutern. Sie hat einen kleinen Vortrag vorbereitet, auf den ich selbst sehr gespannt bin.«
Voglers ernsthaftes Gesicht zeigte Anflüge eines Lächelns. »Ich habe mich viele Jahre mit den großen Ukiyo-e-Künstlern Ihrer Heimat beschäftigt, Takeda-San. Besonders mit Hiroshige, Kuniyoshi und natürlich mit Hokusai.«
»Ich bin sehr auf Ihre Ausführungen gespannt«, erklärte Takeda, erneut mit einer Verbeugung.
Ernestine von Remsau blickte in die Runde und sicherte sich mit einem Räuspern die Aufmerksamkeit aller. »Wir sind nun nahezu vollständig, meine Lieben. Die Einzige, die noch fehlt, ist meine Nichte Alexa. Aber wen könnte das wundern? Pünktlichkeit ist für die jungen Menschen eine unbekannte Tugend … obwohl, so jung ist sie gar nicht mehr. Aber gut, sie wird schon noch kommen. Bis dahin bedienen Sie sich bitte an den Kleinigkeiten auf dem Tisch. Aber essen Sie nicht zu viel, im Anschluss an Ulrikes Vortrag gibt es ein gemeinsames Abendessen. Ich weiß, dass Sie alle ganz versessen darauf sind, sich weiter mit Kenjiro zu unterhalten. Aber da muss ich Sie ein wenig vertrösten. Erst einmal gehört der Inspektor ganz allein mir.«
Takeda sah die Gastgeberin fragend an, und von Remsau erklärte: »Ich dachte, wir unternehmen einen kleinen Spaziergang, Kenjiro. Später soll es regnen, und ich möchte Ihnen zuvor unbedingt den Garten und unseren entzückenden Teepavillon zeigen. Einverstanden?«
»Natürlich, Gräfin. Eine wunderbare Idee.«
Von Remsau hakte sich erneut bei Takeda ein und führte ihn über die breite Freitreppe hinab auf die große Wiese unterhalb der Terrasse. Die erstreckte sich bis zu einem kleinen Bach, wurde zur rechten Seite von einer Pferdekoppel begrenzt, auf der allerdings keine Tiere zu sehen waren. Zur Linken war eine baumbestandene Parklandschaft nach englischem Vorbild zu sehen. Zwischen zwei hochgewachsenen Eichen war das spitze Dach des Teepavillons zu erkennen, von dem Ernestine Takeda bereits in Hamburg erzählt hatte. Mit der Einladung zum Wochenende war ihre Bitte verbunden gewesen, dass Takeda dort eine Teezeremonie abhielte, was er selbstverständlich bereitwillig zugesagt hatte.
4.
Vielleicht würde es auch gar nicht klappen. Das mit der WG. Claudia dachte es in dem Moment, als sie Takedas Musikanlage im Wohnzimmer anstellte und ein quietschender Klang aus den Boxen quoll.
Zerbrochenes Geschirr, Autos in der Schrottpresse, Kreide auf einer Tafel …
Nein, die Anlage war nicht kaputt. Es war eine CD von Ornette Coleman, die da lief. Free Jazz. So nannte man das wohl.
Es war schwer vorstellbar, aber Ken stand auf solche Musik. Sie half ihm beim Nachdenken, beim zur Ruhe kommen. Obwohl sie bei normalen Menschen das Gegenteil bewirkte, nämlich, dass sie die Wände hochgehen wollten.
Ken aber konnte angeblich beim Zuhören sogar Fälle lösen. Falls er auf seinem Saxophon nicht gerade ähnlichen Lärm machte, was er ebenfalls ziemlich gut konnte. Als Claudia ihn einmal um eine Erklärung gebeten hatte, meinte er, dass Jazz ganz ähnlich wie Kriminalistik sei. Lose verstreute Teile fügten sich nach und nach zu etwas Sinnvollem zusammen, zu einer Erzählung, zu einer höheren Art von Harmonie, zu einer Erkenntnis. Nicht einfach, nicht süß. Schon gar nicht schön.
Aber dennoch erleuchtend.
Claudia musste lächeln, als sie an Takedas Worte dachte. Vielleicht hatte er gar nicht nur über Musik gesprochen. Sondern auch über sie beide. Über die kurzen, hart erkämpften Momente ihrer Harmonie. Ihres Glücks. Das sich so schnell wieder in etwas anderes verwandelt hatte … aber in was eigentlich? In Unglück? Nein. Was dann? Claudia wusste es nicht. Sie hatte keine Worte dafür. Noch nicht.
Sie stellte die Anlage wieder aus, wollte sich die nächste Kiste zum Auspacken vornehmen. Dann aber merkte sie, dass sie Hunger hatte. Sie ging hinüber in die Küche. Zwar hatte sie noch keine Zeit gefunden, etwas einzukaufen, aber bestimmt fand sich unter Kens Vorräten etwas Essbares.
Claudia öffnete den Kühlschrank und lugte neugierig hinein, nahm dann eine Plastikpackung mit seltsamen Schriftzeichen darauf zur Hand. Sie löste den Deckel und schnupperte an dem Inhalt. Roch nach Verwesung. Und sah eigentlich auch so aus. Es war eine seltsame, braune Paste, die sie nach einiger Überlegung als Miso identifizierte, fermentiertes Sojabohnen-Mus. Was machte man noch einmal damit? Schmierte man es sich aufs Brot? Würzte man damit Gebratenes? Oder kochte man daraus Suppe?
Claudia wusste es nicht. War aber auch egal. Das Zeug war sowieso nicht ihr Ding.
Sie war norddeutsch, und zwar durch und durch. Sie aß gerne schlichte Dinge. Brot und Butter. Salat. Pommes. Wenn’s denn etwas Exotisches sein musste, wusste sie trotzdem ganz gerne, was sie auf dem Teller hatte.
In einer Tupperbox fand sie sogar einen Rest Salat. Sah nicht schlecht aus, roch aber überraschenderweise nach Meer und Fisch. Claudia angelte einige Blätter hervor und stellte fest, dass der Salat in Wahrheit aus Algenblättern bestand.
Danke. Aber nein, danke.
In weiteren Schalen entdeckte sie fermentierte Natto-Bohnen, Kamaboko-Fischkuchen, kalten Reis, salzig eingelegtes Gemüse, Takuan, Tsukemono.
Super, Ken. Kein Wunder, dass du so schlank bist. Wenn du dich ausschließlich von Dingen ernährst, die kein normaler Mensch hinunterbekommt, ist das ja keine Kunst.
Claudia schloss den Kühlschrank und seufzte. Sie würde sich einfach eine Pizza bestellen. Und morgen früh ging sie einkaufen und füllte den Kühlschrank mit Dingen, von denen sie wusste, dass man sie gefahrlos essen konnte. Jetzt rauszugehen kam nicht infrage. Es hatte zu regnen begonnen, dicke Tropfen prasselten laut gegen das Fenster.
Sie wollte gerade ihr Handy greifen, um den Pizzadienst anzurufen, als das Gerät zu klingeln begann. Schon auf dem Display sah sie, dass es das Präsidium war.
Claudia nannte ihren Namen, lauschte dann dem Kollegen, der die wichtigsten Fakten runterrasselte.
Eine männliche Leiche, offenbar gewaltsam ums Leben gekommen. Claudia solle sich am besten sofort auf den Weg machen. Der genaue Fundort des Toten wäre …
»Stop!«, unterbrach Claudia den Redefluss. »Ich habe keinen Dienst und bin nicht einmal in Bereitschaft. Was geht mich das also an? Kann es sein, dass du dich verwählt hast, Kollege?«
»Nein, kann nicht. Preuß ist krank, und Surbach hat Urlaub.«
»Dann hol den einen aus dem Bett und den anderen von wo auch immer.«
»Geht nicht. Der eine hat Salmonellen, der andere Seychellen.«
»Wie bitte?«
»War ein Witz. Preuß geht’s wirklich nicht gut, er hat sich den Magen verdorben. Und Surbach ist wirklich dort … Indischer Ozean, wenn ich mich nicht täusche.«
Claudia stöhnte auf. »Da wäre ich jetzt auch gerne.«
»Bist du aber nicht. Tut mir leid, du musst übernehmen.«
»In Ordnung, ich sehe es ein. Schick mir eine SMS mit den genauen Ortsangaben. Ich mache mich auf den Weg.«
»Danke, Claudi. Ich wusste, dass auf dich Verlass ist.«
Während sie sich anzog, fand Claudia zu einem Lächeln zurück. Ein Abend allein in einer neuen, stillen Wohnung war sowieso nicht ihr Ding.
Dann doch lieber eine Leiche.
5.
Ernestine von Remsau und Takeda – sie war immer noch bei ihm eingehakt – schlenderten langsam durch den großzügigen Landschaftsgarten von Gut Hohenforst. Es war früher Abend geworden, und noch schien die Sonne. Die dunklen Wolken am Horizont kündigten allerdings bereits das Unwetter an, das für die kommenden Stunden vorhergesagt worden war.
Sie schritten plaudernd einen schmalen, sandbestreuten Weg entlang. Zwischen den Bäumen entdeckte Takeda immer wieder Skulpturen und Statuen, darunter Repliken von Rodin oder Originale von Giacometti, genauso aber japanische Steinlaternen, chinesische Wächterlöwen oder indonesische Garudas. Sie waren auf malerische Art verwittert und mit Moos bewachsen, und entsprachen ganz dem japanischen Ideal des Wabi-Sabi, jenem eigentümlichen Kunstgeschmack, der von der Patina der Vergänglichkeit beseelt war und dessen höchste Ideale sich in Einsamkeit und Vergänglichkeit ausdrückten.
»Das Gutshaus wurde im ausgehenden achtzehnten Jahrhundert von meinem Vorfahren Eugen von Remsau erbaut«, erklärte die Gräfin. »Aber das ist nur die offizielle Version. Tatsächlich war unsere Familie zu jener Zeit verarmt, und das Geld für den Neubau, wie Sie ihn jetzt noch sehen, brachte seine Frau Amalie Charlotte als Mitgift in die Ehe ein. Sie entstammte einer Kaufmannsfamilie, war so gesehen von niederem Stand, verfügte aber dank ihres Vaters über einen enormen Reichtum …«
Takeda, der spürte, dass schon die wenigen Schritte die Gräfin erschöpft hatten, blieb stehen. Er drehte sich um und blickte zurück auf das großzügige, im klassizistischen Stil errichtete Herrenhaus. Es hatte einen schlichten Grundriss in Form eines langgezogenen Rechtecks. Die Fassade war schmucklos und weiß. Die vielen Fenster waren im Erdgeschoss bodentief, im ersten Stock schon kleiner und im ausgebauten Dachstuhl winzig klein. Vom Inneren des Hauses hatte er bisher nur einen kurzen Eindruck erhalten. Die Gesellschaftsräume im Erdgeschoss hatten ihn mit ihrer Größe und Pracht beeindruckt. Demgegenüber schienen die oberen Zimmer, wo er und auch die übrigen Gäste untergebracht waren, erstaunlich klein zu sein, waren zudem über schmale, verwinkelte Korridore verbunden. Der großzügige zentrale Treppenaufgang war nur eine Möglichkeit, in den ersten Stock und zu den Dienstzimmern im Dachstuhl zu gelangen. Es gab darüber hinaus an beiden Enden des Hauses schmale, knarzende Holztreppen, die in früheren Zeiten vermutlich nur von Dienstboten genutzt wurden. Dennoch strahlte jede Ecke und jeder Winkel des Hauses eine alte Würde aus, nicht zuletzt, weil überall Ölgemälde hingen, die Jagdgesellschaften, bäuerlichen Fleiß oder auch Mitglieder des weit verzweigten Geschlechts der von Remsaus darstellten.
Ernestine, dankbar für die kurze Rast, wandte ihr Gesicht der Sonne zu und schloss die Augen. Seufzend erklärte sie: »Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht, Kenjiro, ich bin sogar hier geboren worden. Ich weiß natürlich, dass eine solche Ortstreue altmodisch erscheint. Aber ich bin dankbar dafür. Es gibt keinen anderen Ort auf dieser Welt, an dem ich lieber wäre.«
»Ich kann Sie gut verstehen, Gräfin. Es ist wunderschön. Eine wahre Idylle.«
Von Remsau lehnte sich vertrauensvoll an Takeda und sagte leise: »Ich werde all das vermissen, wenn ich eines Tages nicht mehr bin. Wer weiß, ob die Generationen nach mir überhaupt noch ein Interesse haben, Haus und Garten für die Zukunft zu erhalten.«
»Sagen Sie so etwas nicht, Gräfin. Gerade hier in Deutschland legen die Menschen viel Wert darauf, historische Gebäude und Denkmäler zu bewahren. Der Sinn für ihre Bedeutung ist verbreitet. Das wird doch sicherlich auch bei den Mitgliedern Ihrer Familie der Fall sein.«
Die Gräfin lachte leise. »So viele sind es nicht mehr, Kenjiro. Ich habe keine Kinder, und bei meiner Nichte bin ich mir nicht sicher, ob sie einen Sinn für Altes und Tradiertes hat. Die Dinge verändern sich rasant. Die Menschen verändern sich. So ist der Lauf der Zeit.«
»Ja, da haben Sie sicherlich recht.«
Takeda war ein wenig überrascht von der melancholischen Stimmung der Gräfin. Zwar hatte er sie bisher nur wenige Male getroffen, doch war sie ihm stets lebhaft und fröhlich erschienen. Bei ihrer ersten Begegnung anlässlich einer Ausstellungseröffnung in Hamburg war sie neugierig auf ihn zugekommen. Sie hatten ein langes Gespräch über Japan und die japanische Kunst geführt, und die alte Dame hatte sich dabei als klug und belesen erwiesen, zudem voller Neugier auf Dinge wie Menschen.
Sie schlenderten weiter und erreichten den kleinen Teepavillon. Auch er war wie das große Haupthaus ein architektonisches Kleinod. Das Gebäude, ebenfalls Jahrhunderte alt, war im chinesischen Stil errichtet, mit einem geschwungenen Dach und rundherumlaufenden Säulen, die mit exotisch anmutenden Schnitzereien verziert waren. Die Kassettenfenster waren bodentief und erlaubten einen Blick ins Innere. Takeda konnte sehen, dass Ernestine eigens für die Teezeremonie, die er am nächsten Tag abhalten sollte, japanische Bodenmatten – Tatami – gekauft hatte.
Sie wollten gerade durch die Tür in den Pavillon treten, als sie eine rufende Stimme hörten: »Huhu! Tante Erni! Ich bin da-a!«
Von Remsau sah Takeda an und verdrehte in theatralischem Leiden die Augen. »Alexa, meine Nichte. Seien Sie achtsam bei ihr. Sie verschlingt Männer wie Sie, Kenjiro. Früher hat sie mich übrigens nie so genannt. Erni. Furchtbar …«
Angesichts ihrer bisherigen Beschreibungen hatte Takeda mit einem jungen, vielleicht gerade einmal volljährigen Mädchen gerechnet. Tatsächlich aber tauchte auf dem Weg eine Frau von vielleicht Ende zwanzig auf – eine ausgesprochen attraktive Frau, wie Takeda im Stillen feststellte. Ihre blonden Haare waren zu Dreadlocks verflochten und mit allerlei Perlen und bunten Bändern verziert, ihre Haut war sonnengebräunt, und in ihrer Nase glitzerte ein silberner Stecker. Zudem ließ ihr eng sitzendes T-Shirt ihren wohlgeformten, sportlichen Körper zur Geltung kommen.
Sie näherte sich schnell, trat dann dicht an Takeda heran und sah ihn in aufreizender Direktheit an. »Sie sind der Bulle aus Japan, richtig? Meine Tante ist ja regelrecht vernarrt in Sie! Aber wissen Sie was? Ich kann Erni verstehen. Sie sind ja echt eine Schnitte.«
»Aber Alexa! Was redest du denn da!«, entfuhr es Ernestine von Remsau voller Entrüstung.
Takeda winkte lächelnd ab. »Schon gut, Gräfin. Ihre Nichte hat ja völlig recht, ich bin tatsächlich ein Bulle, und ich bin auch wirklich aus Japan. Das andere kann ich natürlich nicht beurteilen.«
Alexa von Remsau klang nun spöttisch. »Meine Tante meint immer noch, mich erziehen zu müssen. Ich warte auf den Tag, an dem sie einsieht, dass es sinnlos ist.«
Sie lachte laut und herzlich auf. Ernestine von Remsau hingegen seufzte ergeben. »Kenjiro und ich haben es gerade erst festgestellt, meine liebe Alexa. Die Zeiten ändern sich und die Menschen ebenso. Die dezente Zurückhaltung, für die unsere Kreise einmal berühmt waren, ist der jungen Generation unbekannt.«
»Na, mir auf jeden Fall. Aber entspann dich, Erni. Ab und zu spricht nichts dagegen, ganz direkt auszusprechen, was man denkt.«
Der Inspektor musterte die junge Frau für einige Momente, bemerkte dann mit einem feinen Lächeln: »Oder man sagt etwas, damit gerade niemand weiß, was man denkt.«
Alexa von Remsau kniff die Augen zusammen. Für einen kurzen Moment wirkte sie verunsichert. »Wieso? Wie meinen Sie das?«
»Ich wollte nur sagen, dass uns Japanern genau das immer wieder nachgesagt wird. Angeblich verbergen wir unsere wahren Gedanken hinter höflichen Floskeln. Ganz falsch ist das nicht. Wir unterscheiden zwischen Honne und Tatemae, zwischen unserem wahren Empfinden und dem, was wir nach außen zeigen. Es nicht zu tun gilt als unhöflich. Eben darum sind wir gut darin, ganz ohne Worte zu spüren, was in unserem Gegenüber vor sich geht.«
Sie hob feixend die Augenbrauen. »So? Dann sagen Sie doch mal, was in mir vorgeht. Na los!«
Takeda lachte auf. »Das ist nicht schwer. In erster Linie sind Sie besorgt und ungeduldig.«
»Glauben Sie?«
»Aber ja. Ich kenne auch den Grund. Sie möchten uns zurück zum Haupthaus holen, bevor der Regen einsetzt, richtig?«
»Volltreffer.«
»Einen Blick in Ihre Seele musste ich dafür nicht werfen. Es genügte mir, zu sehen, dass Sie drei Regenschirme in der Hand halten und immer wieder in Richtung Himmel sehen.«
Sie lachte. »Es geht wirklich jeden Moment los. Also los, ihr zwei, sonst werden wir pitschnass. Und was den Blick in meine Seele angeht … den dürfen Sie gerne später am Abend werfen, Kenjiro. Ich freue mich darauf.«
»Einfach nur Ken, bitte.«
»Umso besser. Ken ist unkomplizierter. Ich mag es unkompliziert.«
Sie schenkte Takeda einen weiteren koketten Blick, der für seinen Geschmack ein wenig zu direkt war.
Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zurück zum Haupthaus. Schon auf halber Strecke fielen die ersten, schweren Regentropfen, die sich binnen weniger Augenblicke in einen heftigen Wolkenbruch verwandelten. In letzter Sekunde schafften sie es trockenen Fußes unter den Schutz des großen, säulenbestandenen Portikus an der Frontseite des Hauses.
6.
Claudia erinnerte sich an etwas, dass Takeda ihr einmal erzählt hatte. Angeblich gab es in der japanischen Sprache unendlich viele Ausdrücke, um den Regen zu beschreiben. Es waren lautmalerische Worte, und soweit sie sich erinnerte, hießen sie zāzā und shitoshito, potsupotsu oder parapara, und sie drückten aus, wie Regen sein konnte, zart oder heftig, mit dicken oder feinen Tropfen, als Dauerregen oder plötzlicher Schauer.
Claudia steuerte ihren Peugeot durch das Hamburger Schietwetter und dachte, dass das Deutsche in dieser Hinsicht auch nicht gerade arm an Ausdrücken war. Es konnte gießen und schütten und pieseln und schiffen und pläddern und pissen. Der Himmel konnte seine Schleusen öffnen, es konnte Bindfäden regnen, wie aus Eimern schütten oder Petrus es gut mit den Bauern meinen.
Aber wie auch immer man es ausdrückte, es blieb dabei, dass es zum Kotzen war. Absolutes Mistwetter! Die Vorstellung, aus dem Auto aussteigen zu müssen, war gruselig.
Claudia folgte den Anweisungen ihres Navis und gelangte zum Hamburger Volkspark im Westen der Stadt. Dort war der Tote gefunden worden. Sie ließ die Arenen, also das Fußballstadion und die Konzerthalle, rechts liegen und folgte der Nansenstraße, die in einen Teil des Parks führte, der hügelig war und an einen dichtgewachsenen Wald erinnerte. Der Regen war inzwischen so stark geworden, dass sie sogar mit der stärksten Stufe der Scheibenwischer die Umgebung nur undeutlich erkennen konnte. Obwohl es noch nicht wirklich dunkel war, musste sie die Scheinwerfer einschalten, um überhaupt etwas zu sehen. Sie drosselte das Tempo, fuhr kaum schneller als Schrittgeschwindigkeit, wusste aber, dass andere Idioten im Zweifel trotzdem rasten. Konnten sie ja auch tun. Hauptsache, sie zogen niemand anderen in Mitleidenschaft.
Schließlich erreichte Claudia den kleinen Parkplatz in der Nähe eines Ausflugslokals, den der Kollege ihr am Telefon beschrieben hatte. Das Lokal war geschlossen, was entweder an der Uhrzeit oder am Wetter lag. Ein kleiner Minigolfplatz war nicht weit entfernt, hatte aber ebenfalls zu.
Claudia fuhr vorsichtig durch einige tiefe Pfützen, steuerte den Wagen dann an den Rand des Parkplatzes und stellte den Motor aus. Sie sah, dass bereits mehrere Einsatzwagen vom 25. Kommissariat vor Ort waren, außerdem ein Bulli der Spurensicherung, ein Fahrzeug der Rechtsmedizin sowie ein Leichenwagen. Ein paar Kollegen standen dicht gedrängt unter der geöffneten Heckklappe eines Einsatzbullis, die aber auch nur dürftigen Schutz vor dem Unwetter bot.
Claudia öffnete die Tür und blickte hinüber zu den Kollegen beim Bulli. Die blickten feixend zurück oder hoben die Achseln. Sie wussten, dass die wenigen Meter, die Claudia bis zu ihnen zurücklegen musste, genügten, um patschnass zu werden.
Sie hatte nicht einmal einen Schirm im Wagen. Schön doof. Andererseits würde ein Schirm ohnehin nicht viel nützen. Es goss derart heftig, dass die Tropfen nicht nur von oben nach unten fielen, sondern auch von rechts nach links und von unten nach oben.
Himmelherrgott, dann wurde sie halt nass. Es war Spätsommer und immer noch erstaunlich warm, sie würde sich schon nichts einfangen.
Claudia wollte gerade aussteigen, als einer der uniformierten Kollegen sich von der Gruppe löste und zu ihr herüberrannte. Winkend bedeutete er ihr, im Wagen sitzen zu bleiben. Als er sie schließlich erreichte, hielt er ihr ein kleines, zusammengefaltetes Paket entgegen. Es stellte sich als Einmal-Regenmantel aus Plastik heraus. Ökologisch eine Sünde, aber ungemein praktisch. Claudia entfaltete ihn und schlüpfte so gut es ging im Sitzen hinein.
Natürlich riss dabei schon eine erste Naht auf. Na toll. Gut gemacht, Claudia.
Sie stieg aus und ging hinüber zu den Kollegen. Sie spürte sofort, wie an der zerrissenen Stelle und auch am Kragen des Plastikmantels Wasser hineinlief und in Rinnsalen unter ihre Kleider kroch. Fühlte sich fast noch ekelhafter an, als wenn sie direkt im Regen stünde.
Die Kollegen beim Bulli schienen trotz des Regens gute Laune zu haben.
»Ganz allein, Claudi? Wo hast du denn deinen Samurai gelassen?«
»Ist wohl nicht regenfest, der Gute?«
»Vielleicht hat er Angst einzulaufen?«
Claudia schüttelte ungläubig den Kopf. »Das sagt ausgerechnet ihr, die ihr euch wie ein Rudel Pinguine unter das Bullidach quetscht?«
Die Antwort bestand in fröhlichem Gelächter und nachgemachten Vogellauten. »Stimmt auch wieder. Aber quetsch dich ruhig dazu. Für eine Pinguinin ist immer noch Platz.«
»Heißt es nicht Pinguneuse?«, fragte ein anderer.
»Pinguin-Dame, so höflich wollen wir doch sein«, meinte ein dritter.
Und ein vierter sagte: »Pingu:innin! Wir wollen doch niemanden außen vor lassen.«
Alle lachten. Claudia nicht. »Seid ihr endlich fertig? So witzig ist es nicht. Aber um eure Frage zu beantworten, Takeda ist gerade nicht verfügbar. Das macht aber nichts. Ich sehe mir die Sache erst einmal allein an.«
Tatsächlich hatte Claudia kurz mit dem Gedanken gespielt, Ken anzurufen und ihn über den Einsatz zu informieren. Er wäre zwar nicht verpflichtet gewesen, nach Hamburg zurückzukehren, aber so wie sie ihn kannte, hätte er auf der Stelle alles stehen und liegen gelassen und sich auf den Weg gemacht. Darum hatte sie ihn gar nicht erst kontaktiert. Er sollte sein Wochenende auf dem Land genießen. Sie wollte wirklich erst einmal checken, womit sie es überhaupt zu tun hatten. Danach konnte sie immer noch entscheiden, ob sie ihn brauchte.
Claudia wandte sich an den ranghöchsten der uniformierten Kollegen, ein Kriminalhauptmeister, der Klaus Wenger hieß. »Bring mich doch mal auf den neuesten Stand, Klaus.«
Der Kollege schürzte die Lippen. »Klar. Ist ohnehin nicht viel. Männliche Leiche. Stichverletzung im Oberkörper. Er liegt ungefähr dreißig Meter von hier im Gebüsch. Der oder die Täter haben offenbar versucht, ihn zu verbuddeln, haben sich aber nicht viel Mühe dabei gegeben. Soll heißen, er lag nicht besonders tief.«
»Haben wir einen Namen?«
»Negativ. Der Tote trägt keine Papiere bei sich und auch sonst nichts, womit wir seine Identität feststellen könnten. Aber ein Kollege sitzt schon vorne im Wagen und checkt die Vermisstendatenbank. Vielleicht landen wir anhand der körperlichen Merkmale einen Treffer.«
»Eine Vermisstenmeldung? Dann liegt der nicht erst seit Kurzem hier, oder?«
»Ziemlich sicher nicht. Mindestens eine Woche, dem Augenschein nach. Wie lange genau, wissen wir noch nicht. Die Kollegin von der Rechtsmedizin sieht ihn sich gerade an. Vielleicht kann sie dir Genaueres sagen.«
»Wer hat ihn eigentlich gefunden?«
Wenger grinste. »Er heißt Nero, ist sechs Jahre alt und ein Labrador.«
»Und Neros Herrchen?«
»Der heißt Böhme, Gerhard.«
»Gott, wer führt denn bei so einem Wetter seinen Hund aus?«
Wenger zuckte mit den Achseln. »Böhme sitzt vorne im Peterwagen und wärmt sich bei einem Kaffee. Eine Kollegin ist bei ihm und redet ihm gut zu.«
»Steht er unter Schock?«
»Er ist auf jeden Fall mitgenommen. Wir werden später entscheiden, ob wir ihn nach Hause gehen lassen oder lieber in eine Klinik bringen.«
»Okay, ich möchte auf jeden Fall noch mit ihm sprechen. Aber erst einmal will ich mir den Fundort ansehen.«
Wenger wies mit dem Arm ins Unterholz. »Die Richtung, und dann immer weiter durchs Gebüsch. Eine Machete würde helfen, aber leider haben wir keine da.«
»Schon gut. Ich werd’s schon finden.«
Claudia schob sich unter ein paar tiefhängenden Zweigen hindurch ins Unterholz. Der Boden war aufgeweicht und matschig, und sie fragte sich, warum sie nicht daran gedacht hatte, Gummistiefel oder wenigstens alte Schuhe mitzunehmen. Die Pumps, die sie trug, würde sie im Zweifel wegwerfen können. Außerdem hatte ihr Regenmantel schon den zweiten Riss, so dass immer mehr Wasser unter das Plastik drang.
Nach etwa zwanzig Metern tat sich hinter den Regenschleiern eine weiße Fläche auf, unter der die Kegel mehrerer Lichtstrahler und Taschenlampen zu sehen waren. Als Claudia näher kam, identifizierte sie das Weiß als Dach eines Schutzzeltes mit freien Seitenwänden. Die Kollegen der Spurensicherung hatten es über dem Fundort der Leiche aufgebaut.
Allerdings entfaltete das Zelt nicht sonderlich viel Wirkung, dazu regnete es einfach zu stark.
Claudia trat unter das Zeltdach, murmelte einen Gruß an die Kollegen der Spusi in ihren weißen Schutzanzügen. Die Erwiderungen nahm sie kaum zur Kenntnis, ihre Aufmerksamkeit gehörte schon dem Toten.
Der Mann lag auf dem Rücken und starrte aus toten Augen in die Höhe. Er trug lediglich eine Jeans. Der Oberkörper und die Füße waren nackt, die ursprünglich blasse Haut war durch die bereits eingesetzte Verwesung an vielen Stellen dunkel verfärbt. Claudia schätzte ihn auf etwa vierzig, vielleicht ein wenig älter. Sein Haar fiel ihm bis auf die Schultern, die Farbe war wegen der Nässe und dem Schlamm nicht auszumachen. Dunkelblond, brünett. Er trug einen Vollbart, für den dasselbe galt. Der Mann war deutlich übergewichtig, und auf seinem durch Fäulnisgase zusätzlich aufgequollenen Oberkörper erkannte sie verschiedene Wundmale, wobei nicht zu sagen war, ob sie mit seinem Tod in Zusammenhang standen. Claudia sah langgezogene Striemen, dazu rundliche Brandmale, die von Zigaretten stammen könnten. War der Mann gefoltert worden? Außerdem sah sie Verfärbungen am Hals, möglicherweise Würgemale. Obwohl, könnte man die nach einigen Tagen überhaupt noch sehen? Im Grunde war es egal, denn das Opfer war ohnehin nicht erwürgt worden. Der uniformierte Kollege, Wenger, hatte es ja gesagt. Der Mann war erstochen worden. Es war in der Tat offensichtlich. Etwa in Herzhöhe war eine klaffende Stichwunde mit ausgefransten Rändern zu erkennen, aus der gerade jetzt, als Claudia näher hinsah, ein Tausendfüßler hervorkroch und windend das Weite suchte.
Claudia wartete, bis sich ihre Übelkeit gelegt hatte. Dann hockte sie sich neben die Leiche, versuchte den Verwesungsgeruch zu ignorieren und sah sich noch einmal die verschiedenen Verletzungen an. Sie nahm auch die Tätowierungen des Toten in Augenschein. Ein Tribal an der Schulter, ein mit Ornamenten verzierter Jesus am Kreuz, eine große Rosenblüte.
»Kannst du schon etwas sagen?«, fragte Claudia in Richtung der Rechtsmedizinerin, die vermutlich bei ihrem Wagen gewesen war und nun ebenfalls wieder unter das Zeltdach trat.
»Ich bin es, Claudia. Angelika.«
Die Medizinerin lächelte, und erst jetzt erkannte Claudia sie. Es war Angelika Reimann, eine Mitarbeiterin von Ludger Terzian, dem Leiter des Instituts für Rechtsmedizin. Claudia kannte Angelika von vielen früheren Einsätzen, sie schätzte sie als zuverlässige und kluge Kollegin.
Sie trug wie Claudia einen Plastikmantel, war aber dennoch völlig durchnässt. Ihre Haare klebten ihr im Gesicht, deshalb hatte Claudia sie auch nicht sofort erkannt.
Reimann schüttelte den Kopf und erklärte: »Angesichts der Bedingungen kann ich eigentlich noch gar nichts sagen. Zu nass, zu matschig, zu alles.«
»Ich weiß. Trotzdem … ganz grob, das reicht mir.«
»Dann ohne Anspruch auf Belastbarkeit … also, eine Stichverletzung durch einen scharfen Gegenstand, vermutlich ein Messer. Dürfte genau das Herz getroffen haben. Entweder wusste der Messerstecher, was er tut, oder er hat Glück gehabt, und der erste Stich saß.«
»Was ist mit den Striemen und den Brandmalen? Auch am Hals?«
Reimann schüttelte den Kopf. »Das ist alles alt. Ist unschön, aber nicht todesursächlich.«
»Kannst du etwas über den Todeszeitpunkt sagen? Dass er hier nicht erst seit gestern liegt, sehe ich natürlich auch.«
»Es ist echt schwer, etwas zu sagen … aber gut, ich würde schätzen, etwa zehn Tage. Eher etwas weniger. Ich werde ihn mir sofort morgen früh im Institut auf den Tisch holen, dann hast du spätestens am Vormittag genauere Informationen.«
»Danke.«
Claudia erhob sich und drehte sich um. In Richtung eines Mitarbeiters der Spurensicherung, der am Rand des Partyzeltes die Erde untersuchte, fragte sie: »Was ist mit euch? Habt ihr etwas gefunden?«
Der Kollege wischte sich mit dem Handrücken die nassen Haare aus der Stirn, die unter der Kapuze seines weißen Schutzanzuges hervorlugten. Er schaffte ein Grinsen. »Gleiche Antwort wie die Kollegin: Bei den Bedingungen? Vergiss es.«
»Wirklich gar nichts?«
»Ebenfalls ohne Garantie, aber du kannst davon ausgehen, dass er hier nur abgelegt wurde. Rundherum ist nichts, das auf einen Kampf hindeutet. Aber wir haben Reste von Schleifspuren gefunden. Wer immer ihn hergebracht hat, kann nicht ganz schwach gewesen sein. Das Opfer bringt locker seine hundertzwanzig, hundertdreißig Kilo auf die Waage.«
»Und sonst?«
Der Kollege schüttelte den Kopf. »Wenn der, der ihn gefunden hat …«
»Der Hundebesitzer?«
»Genau. Wenn der auch nur zwei Stunden früher hier gewesen wäre, also vor dem Regen, hätten wir eine Chance gehabt. Schuppen, Haare, Fußspuren, Reifenspuren, irgendetwas. Aber jetzt? Vergiss es. Es ist alles verloren. Wir werden trotzdem eimerweise Erde von hier mitnehmen und im Labor durchsieben. Aber du solltest auf nichts hoffen. Es schüttet einfach zu sehr. Es ist alles weggespült.«
Claudia blickte nach draußen in den Regen, wo andere Spusi-Mitarbeiter im Schein ihrer Taschenlampen die weitere Umgebung absuchten. Sie hatten bereits damit begonnen, Erde abzutragen und in Plastikwannen zu schichten.
Aus Richtung des Parkplatzes rief jemand nach ihr. Die Stimme ging im pläddernden Regen fast unter. »Frau Harms? Claudia? Kannst du mich hören?«
Wenn Claudia sich nicht täuschte, war es die Stimme von Wenger. »Laut und undeutlich … was ist?«
»Wir haben einen Treffer bei den Vermisstenfällen.«
»Ich komme!«