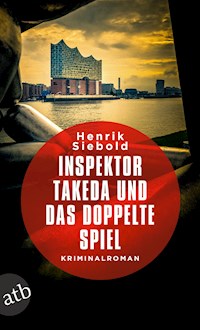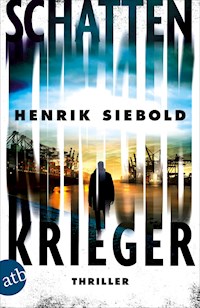
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er ist klug und weise – und ein Auftragsmörder.
Hamburg, ein Imbiss auf St. Pauli. Hier steht ein stiller, sanftmütiger Mann, von dem niemand weiß, wer er in Wahrheit ist: Vor Jahren war Manuel Jessen ein Elitesoldat in Afghanistan, dann wurde er aus einer langen Gefangenschaft befreit und lebte mit seiner Geliebten Yūko ein ruhiges Leben in Japan. Aber kaum glaubte er, seinen Frieden gefunden zu haben, forderte sein amerikanischer Retter den Lohn für seine Befreiung ein. Manuel wird zu einem Auftragsmörder für den Geheimdienst. Bis er verraten wird und sich in die falsche Frau verliebt ...
Vom Autor der Erfolgsromane über Inspektor Takeda – ein Thriller voller Spannung und Weisheit, voller Abgründe und unerwarteter Wendungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Nacht für Nacht steht Manuel Jessen hinter dem Tresen seines Imbisses auf St. Pauli und bemüht sich voller Hingabe darum, seine Gäste perfekt zu bewirten. Sein Stammpublikum ist begeistert. All die seltsamen Kiezgestalten sitzen dort, essen und trinken. Ganz nebenbei rätseln sie, was es mit Jessen auf sich hat. Denn dass er ein Geheimnis hat, steht für sie außer Frage.
Manuel hat seine ganz besondere Geschichte; er war ein Elitesoldat, dann ein Gefangener der Taliban, später Schüler bei einem japanischen Zen-Meister – und nun ist er ein Auftragsmörder für das Netzwerk, dem er seine Befreiung aus Afghanistan verdankt. Er erledigt seine Arbeit, so wie er seine Gäste bedient – still und leise. Bis er einen Auftrag bekommt, der sich als Hinterhalt erweist – und ja, bis er sich in eine Frau verliebt, was er niemals wieder tun wollte.
Über Henrik Siebold
Henrik Siebold ist Journalist und Buchautor. Er hat unter anderem für eine japanische Tageszeitung gearbeitet sowie mehrere Jahre in Tokio gelebt. Unter einem Pseudonym hat er mehrere Romane veröffentlicht. Er lebt in Hamburg.
Bisher sind als Taschenbuch und Hörbuch erschienen: „Inspektor Takeda und die Toten von Altona“, „Inspektor Takeda und der leise Tod“, „Inspektor Takeda und der lächelnde Mörder“, "Inspektor Takeda und das doppelte Spiel", "Inspektor Takeda und der leise Tod" sowie „Inspektor Takeda und das schleichende Gift“.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Henrik Siebold
Schattenkrieger
Thriller
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Impressum
Wer von diesem Thriller begeistert ist, liest auch ...
1
»Zwei Curry! Einmal mit Pommes, einmal ohne!«
»Für mich nur Pommes.«
»Zwei Bier.«
»Hey, ich war zuerst dran!«
»Heul doch.«
Samstagnacht im St. Pauli Curry, einer winzigen Imbissbude auf dem Hamburger Kiez. Die Bestellungen flogen nur so dahin. Die Gäste drängelten sich vor dem schwartig glänzenden Tresen. Touristen und Nachtschwärmer, dazu die alten Kizianer: Nutten, Luden, Verlorene. Sie liebten das Curry. Ohne Touristen wär’s noch besser. Aber was sollte man machen?
»Eine Wurst to go! Ein Alsterwasser!«
»Drei Pommes, drei Bier!«
»’ne Curry extra scharf!«
Es roch nach Schweiß, nach Essen, nach zu vielen Menschen auf zu engem Raum. Die Stimmung war gut, ausgelassen. Sommer in der Stadt.
Der Einzige, dem der Trubel und der Geschrei nicht das Geringste auszumachen schien, war der Mann hinter dem Tresen. Er stand an der Bratfläche, sprach wenig, war hochkonzentriert.
Ein junger Gast, fünfziger Oberarme, Tribal-Tattoo am Hals, Gelhaare, schob sich nach vorne und schlug mit der Hand auf den Tresen. Er schrie in Richtung des Mannes am Herd: »Hey, du Penner! Ich habe schon vor einer halben Stunde bestellt. Vielleicht könntest du endlich mal …«
Manuel Jessen, Betreiber des Curry, drehte sich um. Sehr langsam. Richtete sich zu seinen sehnigen ein Meter neunzig auf. Kein Gramm Fett, eine Narbe am Kinn, Augen wie ein klarer Winterhimmel.
Im Imbiss kehrte schlagartig Stille ein. Die Gäste hielten den Atem an.
Plötzlich kam die Situation dem jungen Motzer komisch vor. Er war zum ersten Mal hier, kannte die Regeln nicht. War vielleicht keine gute Idee, so herumzunörgeln.
Manuel sah den jungen Mann stumm an. In der Regel reichte das. War jetzt nicht anders.
»Also, äh, ich wollte nur … ich hatte wie gesagt bereits vor längerem bestellt, und da dachte ich, ich sage einfach einmal Bescheid.«
Manuel Jessens furchiges Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. »Dauert noch einen kleinen Moment. Hab Geduld.«
»In Ordnung. Tut mir leid.«
»Kein Grund, dich zu entschuldigen.«
Manuel drehte sich wieder um und widmete sich der Arbeit. Der Lärmpegel im Imbiss schwoll erneut an. Kiezgespräche. Die besten Clubs, die besten Drogen. Musik. Fußball. Der Hafen. Die Stadt.
Manuel hörte nicht hin. Er konzentrierte sich ausschließlich auf seine Speisen. Egal, was du tust, tu es ganz. Die neue Ladung Würste war noch nicht soweit. Die brauchten noch eine, vielleicht zwei Minuten. Es war wichtig, dass sie auf den Punkt gebraten waren. Gut durch, aber nicht trocken. Saftig, aber keinesfalls im Inneren roh.
Neuerdings hatte er zwei verschiedene Sorten im Angebot. Schwein und Lamm. Das war auf St. Pauli wichtig. Es gab immer mehr Gäste, die kein Schwein aßen. Trotzdem sollten sie erfahren, dass nichts so glücklich machte wie eine Currywurst. Jedenfalls eine gute. Und hier, bei ihm, gab es die beste.
Natürlich waren die Pommes genauso wichtig. Auch die machte Manuel selbst. Er hatte es mit Tiefkühlware versucht, aber das Ergebnis hatte ihn nicht zufriedengestellt. Seitdem verarbeitete er ausschließlich frische Knollen. Früh im Jahr Zorba. Danach Bintje oder Laura. Er schälte sie, schnitt sie mit dem großen Küchenmesser in Streifen, frittierte sie, ließ sie abtropfen, salzte sie. Dafür verwendete er ausschließlich Yukishio, Schneesalz. Er bestellte es in Japan. Merkte jemand den Unterschied? Wahrscheinlich nicht. Aber ihm bedeutete es etwas.
Das Wichtigste von allem war die Currysauce. Auch hier leistete Manuel sich etwas, bei dem jedem Betriebswirt schwindelig würde angesichts des Verhältnisses von Aufwand und Ertrag. Er kochte den Ketchup selbst, alle vierzehn Tage. Aus frischen Tomaten. Außerdem suchte er eigenhändig die Gewürze aus, mischte und mörserte sie, rührte sie aufmerksam in die rote Sauce ein, kochte dann alles so lange, bis der Ketchup nicht mehr flüssig, aber auch nicht wirklich fest war. Die Konsistenz war wichtig. Ein Gast hatte ihm einmal erklärt, dass Ketchup ein thixotroper Stoff sei, ein nicht-newtonsches Fluidum, das weder fest noch flüssig sei. Manuel hatte interessiert genickt und sich wieder seiner Arbeit zugewandt.
Kurz darauf war es soweit. Die Würste waren kross und glänzend, die Pommes goldbraun, der Ketchup leuchtend rot. Manuel arrangierte die Portionen auf Papptellern, ökologisch abbaubar. Zwei davon schob er zu dem jungen Muskelmann hin. »Zwei Curry mit Pommes.«
Der Gast rang sich ein Lächeln ab. »Tut mir leid wegen gerade. Wollte dich nicht hetzen, Mann.«
»Vergiss es. Du bist jederzeit willkommen. Jetzt lass es dir schmecken.«
Der Gast ließ einen Schein auf den Tresen segeln. »Rest für dich.«
»Nicht nötig.« Manuel gab heraus. Er wollte kein Trinkgeld. Was seine Arbeit wert war, bestimmte er selbst.
Der junge Kerl zuckte mit den Schultern. Er wollte noch etwas sagen, aber da hatte Manuel sich schon wieder umgedreht, stand vor der Fritteuse. So konzentriert, als würde er meditieren.
Der Gast steckte die Münzen ein, blickte auf Manuels durchtrainierten Rücken. Seltsamer Typ. Nett, aber auch undurchschaubar. Man wollte keinen Streit mit ihm haben.
Dann probierte er von der Wurst, den Pommes, dem Curry-Ketchup.
Scheiße, war das gut.
So etwas Köstliches hatte er noch nie gegessen.
Ein wahrer Meister.
Aus einem Grund, den er selbst nicht kannte, verneigte sich der junge Muskelmann in Manuels Richtung. Der sah das nicht einmal, hatte ihm ja den Rücken zugedreht. Obwohl, er nickte dennoch kurz. Als hätte er es eben doch gesehen.
2
Es war das Jahr 2010. September. Sie waren in der Provinz Badachschan, etwa fünfzig Kilometer nordöstlich von Faizabad. Die Nacht war kalt. Aber das merkten die sechs Männer nicht.
Ralf Keppler, einer der sechs, dachte dasselbe wie alle im Kommando. Es fühlte sich gut an, draußen zu sein. Sie konnten beweisen, dass sie nicht umsonst das jahrelange Training abgelegt hatten. Sie konnten zeigen, warum ausgerechnet sie aus Hunderten Bewerbern ausgewählt worden waren. Die Besten der Besten, die Härtesten der Harten. Die Klügsten der Klugen. Sonst wären sie nicht hier. Sonst würden sie nicht dazu gehören, keiner von ihnen.
Der Krieg am Hindukusch war zu diesem Zeitpunkt knapp zehn Jahre alt. Der scheinbare Erfolg der Operation Enduring Freedom, die frühen Siege bei Tora Bora und im Shahi-Kot-Tal waren längst vergessen. Nüchtern betrachtet galt für OEF dasselbe wie für ISAF: Die Strategie war gescheitert. Die Taliban waren nicht besiegt, sie waren einfach nur in tausend kleine Gruppen zersprengt.
Und damit noch gefährlicher.
Die vergangenen Monate hatten es bewiesen. Vor allem das deutsche Kontingent im Norden des Landes hatte hohe Verluste hinnehmen müssen. Warum? Weil die Deutschen als schwach galten. Nette Menschen, auch gute Ingenieure. Aber militärisch unerfahren und damit angreifbar. Die Taliban rechneten sich aus, mit Deutschland ein erstes Glied aus der Kette der Allianz sprengen zu können. Der Rest würde dann auch schnell kollabieren.
Also musste ein klares Signal gesendet werden: Ihr täuscht euch in uns. Oberst Klein hatte den Anfang gemacht mit dem Air Strike von Kundus. Blutig, aber wirkungsvoll. Halmazag, die geplante Offensive, würde ein Übriges tun.
Aber das waren nur die offiziellen Operationen.
Es gab auch andere. Solche, von denen niemand etwas mitbekommen sollte.
Darum waren sie jetzt hier draußen. Kampferprobte Männer, die das taten, was in Deutschland keiner hören wollte: Krieg führen.
Ralf Keppler zog sein Halstuch höher. Es war das einzige zivile Kleidungsstück, das er trug. Jetzt in der Nacht rauschte ein schneidender Gebirgswind über die umliegenden Berghänge und ließ die wenigen, niedriggewachsenen Büsche zittern. Im Vergleich zu der elenden Sommerhitze war es ein Fortschritt. Die Luft war eisig, aber auch kristallklar. Der silberne Mond schien auf den Gebirgskamm, der sich wie eine gigantische, glitzernde Wand vor ihnen auftürmte. Es war ein berauschender Anblick. Vielleicht auch deshalb, weil es jede Sekunde mit ihnen vorbei sein konnte. Die Schönheit strahlte am hellsten, wenn der Tod nicht weit war. Und in diesem Land, in dem seit hundertfünfzig Jahren Krieg herrschte, war der Tod immer nah.
Hatte er Angst?, fragte Keppler sich. Sicher. Ließ er sich davon beirren? Nicht im Geringsten. Er war Gebirgsjäger gewesen, in Mittenwald stationiert, bevor er sich zum Kommando beworben hatte. Er war vorher schon gut gewesen. In Calw hatte man ihm den letzten Schliff verpasst. Er wusste, was er konnte. Er wusste, was er tat.
Amerikanische Blackhawks hatten sie vor zwei Stunden abgesetzt. Seitdem harrten sie bewegungslos aus und beobachteten die Umgebung. Hier draußen war Talibanien, vom Feind kontrolliertes Gebiet. Der Drop-off galt als einer der riskantesten Momente, schließlich waren die Hubschrauber in der kargen Landschaft kilometerweit zu hören. Aber sie hatten Glück. Nichts geschah.
Schließlich gab Jürgen Stork, der die Führung hatte, das erlösende Signal. Er machte eine kreisende Bewegung mit dem Zeigefinger. Zeit für den Aufbruch. Wie aus Lehm erschaffene Geister standen die Männer auf, bewegten sich, wurden wieder sichtbar. Stork blickte von einem zum anderen, fragte dann mit einem Grinsen: »Bereit für einen kleinen Spaziergang, Männer?«
»Na, sicher doch. Ein bisschen Bewegung kann nicht schaden«, antwortete Timur Cicek, halber Türke, immer für einen Spruch zu haben. Die anderen stimmten zu. Weitere Sprüche folgten. Leises Gelächter. Keppler nickte nur. Er war ein stiller Typ.
»Dann marsch, vorwärts. Gesprochen wird nur, wenn’s nötig ist. Und, Männer: Augen auf! Wir meinen es ernst. Aber die anderen auch.«
Sie gingen los, einer hinter dem anderen. Drei Halbtrupps, sechs Mann, davon fünf Kampfspezialisten, ein Sanitäter. Es galt striktes Funkverbot. Sie waren auf sich allein gestellt und durften nur in äußerster Notlage Kontakt mit Kundus aufnehmen. Dann würden Hubschrauber aufsteigen und sie herausholen. Vorausgesetzt, sie lebten noch.
Von ihrem Ausgangspunkt aus lag mindestens ein Tagesmarsch vor ihnen, vielleicht auch zwei. In Wahrheit waren es Nachtmärsche, was die Sache nicht einfacher machte. Aber sie hatten keine Wahl. Tagsüber und bei guter Sicht wären sie den Taliban, den Syndikaten, den Clans, oder wer auch immer es auf sie abgesehen hatte, gnadenlos ausgeliefert. Aus dem gleichen Grund hatten sie sich von den Hubschraubern nicht näher ans Zielgebiet bringen lassen. Der Lärm der Maschinen hätte sie viel zu lange im Voraus angekündigt und ihre Mission vereitelt.
Worum es ging? Irgendwo in diesem unwegsamen Gelände ein Gehöft ausfindig zu machen, das auf keiner Karte eingezeichnet war. Angeblich traf sich dort eine Gruppe Talibankommandeure, um das Vorgehen einzelner Gruppen abzustimmen. Der Auftrag der sechs: die feindlichen Kämpfer lokalisieren, identifizieren und dann festsetzen.
Lautlos bewegten sie sich durch das feindliche Land. Schnell, aber nicht zu schnell. Ganz vorne ging Tommi Hoffmann, der einen guten Tritt hatte und die beste Spur im schwierigen Gelände fand. Hinter ihm kamen Timur Cicek und Grunert, der Sani. Beide trugen Nachtsichtgeräte. Gut, um Feinde aufzuspüren, aber schlecht, um im Gebirge vorwärtszukommen. Stork, ihr Anführer, ging direkt hinter ihnen und lotste sie mit nahezu lautlosen Kommandos. Als vorletzter folgte Bojan Mijatovic, den sie Jato nannten. Und schließlich Keppler. Er machte meistens den Schlussmann, das lag ihm. Er beobachtete das rückwärtige Gelände, aber er behielt auch die anderen im Blick. Nicht, dass er den Jungs nicht vertraute. Er wusste so gut wie sie alle, dass hier draußen niemand allein überlebte, dass man nur als Team den Kopf auf den Schultern behielt. Aber ein Stück weit blieb er trotzdem ein Einzelgänger. So war er schon als Kind und als Jugendlicher gewesen, und seitdem hatte sich nichts daran geändert.
Zwei Stunden lang folgten sie einem Pfad, der sie parallel zu einer Felswand in nördlicher Richtung führte. Mit der Ausrüstung und den Waffen konnte nicht wirklich von einem Spaziergang die Rede sein. Aber keiner beschwerte sich. Sie taten genau das, wofür sie ausgebildet worden waren.
Schließlich erreichten sie eine Anhöhe, von der aus sie über ein langgezogenes Tal blicken konnten. Als der Mond durch die Wolken brach, sahen sie, wie Tausende von Mohnblumen im Wind schaukelten.
»Seit wann bauen sie das Zeug so weit im Norden an?«, fragte Grunert.
»Spielt das eine Rolle? Das Zeug ist etliche Tausend wert. Es wird Wachen geben«, erwiderte Tommi, Storks Buddy.
»Aber sie werden nichts von uns mitkriegen. Und wenn doch, ihr Pech.«
Stork klopfte auf sein G36. Weiß aufblitzende Zahnreihen im Mondlicht.
Keppler, etwas abseits von den anderen, sparte sich jeden Kommentar. Der Mohn, die Drogen, das Geld, nichts davon interessierte ihn. Aber dieser Blick, der war zum Heulen schön. Für einen Augenblick vergaß er, dass er und sie alle in diesem gottverdammten Land nichts verloren hatten. Dass sie eines Tages wieder von hier verschwänden und dass sich dann nichts geändert haben würde. Alles würde wieder wie vorher sein.
Aber das war nicht sein Problem. Der Augenblick zählte. Die Nacht, die Landschaft, das Licht. Er fühlte sich lebendig, auch wenn er unterwegs war, um den Tod zu bringen.
3
In manchen Nächten hatte Manuel Jessen Unterstützung im Imbiss auf St. Pauli. Dann ging ihm Mamdouh Abdel-Haq zur Hand. Mamdouh war klein und schmächtig, hatte schwarze Locken, trug immer teure Turnschuhe. Er behauptete, aus Tunesien zu stammen, aber wer wollte das wissen? Fest stand, dass er dort, wo er herstammte, nicht hatte bleiben können.
Im Gegensatz zu Manuel war Mamdouh redselig. Fußball, Frauen, Essen, Kino, sein Großvater, Hollywood, Lyrik, Gott, Haustiere, Sternbilder. Es gab nichts, das vor Mamdouhs Meinung sicher war. Er konnte ganze Nächte hindurch vor sich hinplappern, wobei es schien, als müsste er nicht einmal Luft dabei holen. Vielleicht hatte er das Gefühl, er müsste für Manuel mitreden. Weil der halt meistens schwieg. Und doch waren die beiden sich auf sonderbare Weise ähnlich. Der eine redete viel, der andere kaum, und doch verrieten beide nichts über sich selbst und schon gar nicht die Wahrheit.
Letztlich spielte es keine Rolle. Mamdouh quasselte. Manchen gefiel es, anderen ging es gehörig auf die Nerven.
Das Curry hatte immer nur nachts auf, vom späten Nachmittag bis in die frühen Morgenstunden. So war’s auf dem Kiez, die Menschen schliefen tagsüber und lebten nachts.
Jetzt war es drei Uhr morgens, die ruhige Zeit zwischen dem ersten Ansturm und dem letzten großen Schwung am frühen Morgen. Der Imbiss war gut besucht, wenn auch nicht überfüllt. Die meisten Gäste waren Stammkunden, die auf den wenigen Hockern vor dem schmalen Tresen Platz genommen hatten. Mamdouh plapperte, und Manuel schwieg.
Er versuchte, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Etwas Salz, etwas Sauce. Ein Sonderwunsch hier, eine Außer-Haus-Bestellung dort.
Aber wie, verdammt, sollte man das hinkriegen, wenn ein dauerplappernder Araber neben einem stand und einem den letzten Nerv raubte? Wie? Selbst der größte, erleuchteteste Zenmeister könnte es nicht. Es war unmöglich!
Beschwerte Manuel sich also? Nicht er, niemals. Er schüttelte nur sanft den Kopf und vertiefte sich umso entschlossener in die Arbeit. Würste wenden, Pommes goldbraun frittieren, Sauce dazugeben. Dann alles auf dem Teller arrangieren, eine Gabel dazu, servieren, fertig.
Mamdouh hatte entschieden, dass heute nicht Fußball, sondern Handball ein gutes Thema wäre. Nicht, dass er etwas davon verstand. Aber es hielt ihn nicht davon ab, sich darüber auszulassen. Er stand vorne am Tresen, ignorierte die Schlange der Laufkundschaft und plapperte in Richtung der Stammgäste munter drauf los. »Mal ehrlich, Leute, Handball! Was für ein idiotischer Sport! Jeder Bauer, der eine Tomate pflücken kann, kann auch Handball spielen. Wo ist die Kunst? Man nimmt den Ball, läuft übers Spielfeld und schmeißt ihn ins Tor. Und dafür jubelt jemand?«
Karolis, der Litauer, zwanzig Jahre zur See gefahren, ein Gesicht wie eine Felsenlandschaft, tippte sich mit dem Finger gegen die Stirn. »Du spinnst, Mamdouh! Es gibt Regeln! Es ist nicht so einfach, wie du denkst.«
»Und ob es das ist! Fußball, das ist Kunst! Aber Handball? Jeder Schimpanse könnte mitspielen!«
Juliette, die am Hans-Albers-Platz anschaffen ging und im Curry ihre Pause verbrachte, mischte sich ein. »Blödsinn, Mamdouh. Mein Bruder hat Handball gespielt. Es ist ein rauer Sport. Die meisten Fußballer wären zu weich dafür.«
Mamdouh sah sie entsetzt an. »Wie kannst du so etwas sagen? Manuel, hast du das gehört? Schmeiß sie raus! Sofort! Juliette beleidigt den Fußball.«
Ein anderer Gast meldete sich zu Wort, er sprach mit einem tiefen, dröhnenden Bass. »Kann mal jemand diesem Idioten das Maul stopfen? Das hält man ja im Hirn nicht aus!« Dacian Georgescu, über zwei Meter groß, ein Kreuz wie ein Kleiderschrank und Augen wie Bette Davis. Tief darin das Echo von Dingen, die er getan hatte, Dinge, die sich die meisten Menschen nicht einmal vorstellen konnten.
Mamdouh grinste ihn an. »Du hast ein Hirn, Dacian? So gut wie du versteckt es keiner! Respekt!«
Dacian lachte dröhnend auf. Er wandte sich an Manuel. »Manuel! Hast du etwas dagegen, wenn ich den Araber nehme und in zwei Teile reiße?«
Manuel drehte sich um, lächelte kurz, sagte nichts und widmete sich wieder seiner Arbeit.
Mamdouh winkte ab. »Wenn du mich in zwei Hälften reißt, rede ich stereo. Lass es lieber!«
»Wieso? Spricht dann dein Hintern?«
Sasikarn, ein thailändischer Kathoey, ein Ladyboy, die früher in einem der Etablissements gearbeitet, sich inzwischen mit ihrer Webcam selbstständig gemacht hatte, prustete. »Ihr seid widerlich, Jungs. Hört auf damit.«
»Man muss dieser quasselnden Küchenhilfe eine Lektion erteilen!«, beharrte Dacian trotzig.
»Ich bin keine Küchenhilfe, du rumänische Missgeburt. Ich bin Chef de Salle! Der wichtigste Mann im Lokal. Abgesehen von Manuel, natürlich. Stimmt doch, oder? Manu, sag’s ihm!«
Manuel, dessen Sinne immer wach waren, spürte, dass es diesmal nicht gutgehen würde. Mamdouh ging zu weit. Dacian war ein friedlicher Mann, aber es gab Seiten in ihm, die man nicht hervorkitzeln sollte. Es war Zeit, einzugreifen.
Manuel blickte auf die Riege der Gäste hinter dem Tresen. Der hundertjährige Olaf, der blaue Klaus. Kizianer seit Jahrzehnten. Versoffen, krank, liebenswert. Daneben saß Ursula, die Flaschensammlerin, die sich Nacht für Nacht ihr Essen abholte. Sie war die Richtige, und Manuel fragte: »Ursula, könntest du den Tresen übernehmen? Mamdouh und ich machen einen kleinen Spaziergang.«
»Einen Spaziergang? Warum denn? Ich unterhalte mich doch gerade so nett mit Dacian«, erklärte Mamdouh empört.
»Klappe! Du kommst mit.«
Manuel schob ihn unter dem freien Segment der Theke hindurch und geradewegs aus dem Curry hinaus auf die Straße. Dacian saß immer noch da und zitterte vor Wut. Manuel rief zu Ursula: »Gib dem Rumänen ein Bier aufs Haus!«
»Ist gut. Und lasst euch Zeit. Ich kümmere mich um alles.« Ursula war schon bei der Arbeit und hauchte Manuel einen Kuss zu. Was für ein seltsamer Mann, dachte sie. Keiner wusste etwas über ihn. Nicht einmal, wie alt er war. Vielleicht Mitte vierzig? Und auch sonst – nur Fragezeichen. Er war vor einigen Jahren auf dem Kiez aufgetaucht, hatte das Curry eröffnet und arbeitete seitdem Nacht für Nacht hier. Selten war er mal nicht da. Urlaub machte er nie. Was er tagsüber trieb? Wovor er geflohen war? Wohin es ihn eines Tages trieb? Wer wollte das wissen?
4
Aus dem einen geplanten Nachtmarsch wurden am Ende nicht zwei, sondern drei. Die Höhenluft kostete Kraft, das Gelände war schwieriger als erwartet. Hinzu kamen Orientierungsprobleme, trotz GPS. Und immer wieder, beim kleinsten verdächtigen Geräusch mussten sie Deckung suchen. Dann hieß es warten, die Lage klären, kein unnötiges Risiko eingehen. Kostbare Zeit verging. Trotzdem war es besser so. Egal, wen man hier traf, im Zweifel war er bewaffnet und bereit zu schießen.
Die sechs Kommandosoldaten marschierten jeweils bis knapp vor Sonnenaufgang, dann suchten sie einen Unterschlupf im Gebüsch oder hinter größeren Felsbrocken. Die Stunden am Tag vergingen qualvoll langsam. Es gab nichts zu tun. Sie mussten warten, konnten sich erholen und hoffen, dass die Dämmerung schnell anbräche.
Zugleich waren es gute Stunden, halb Traum, halb Wirklichkeit. Die Sonne schien, der Wind blies. Die Luft roch nach dem Salz der Berge und dem Staub der Ebenen. Sie waren im Krieg. Eines Tages, wenn sie längst wieder zuhause wären, würden sie an diese Zeit hier zurückdenken. Anders als die meisten könnten sie dann sagen, dass sie nicht nur im Lager gehockt hatten, sondern wirklich draußen gewesen waren. Sie hatten etwas erlebt. Klar, nach außen hin mussten sie die Klappe halten. Nichts von dem, was sie hier taten, war für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber die jüngeren Kameraden würden begierig ihren Erzählungen lauschten. Denn sie gehörten dann zu denen, die wussten, was es hieß, zu kämpfen.
Den letzten Tag verbrachten sie in der Nähe eines Wasserlochs, verborgen in einer Senke zwischen dornigem Gestrüpp und einer grauen Felsnase, die über ihnen aufragte. Zeit totschlagen. Details ihrer Mission durchgehen. Möglicherweise gehörte zu der Gruppe, die sie aufbringen sollten, ein Mann namens Mujtaba Afridi. Er war ein Talibankommandant, der sich einer Platzierung unter den Top Twenty der JPEL, der Hitliste der meistgesuchten feindlichen Kämpfer, rühmen konnte. Die Begegnung mit einem Kaliber wie ihm könnte heiß werden. Schreckte sie das ab? Nicht wirklich.
Darum quatschten sie lieber über zuhause, über ihre Familien, ihre Autos, Urlaubspläne, Heiratspläne. Grunert schwärmte von dem Webergrill, den er sich für die Zusatzprämie kaufen würde. Er malte es für sie alle aus. Sommernachmittag im Garten, Verwandtenbesuch. Die Kinder plantschen im Aufblasbecken, er wendet die Nackensteaks und die Paddys für die Burger. Die Frauen tragen Bikinis und reiben sich gegenseitig mit Sonnenmilch ein. Tommi lachte. Er stand auf und gab eine pantomimische Vorstellung, tat so, als stünde der Webergrill direkt vor ihm, hier an den Hängen des Hindukusch. Warum tun wir es nicht einfach?, fragte Timur. Jetzt mal ehrlich, Leute, warum schnappen wir uns nicht eine von den verdammten Ziegen, die hier rumlaufen? Ein kleines Barbecue kann doch nicht verkehrt sein? Alle waren begeistert. Ein glimmendes Feuer, ein saftiges Stück Fleisch. Fehlte nur das kalte Bier dazu … Es war mehr als verlockend. Tommi, der eine verdammte Kampfsau war, schlug eine Abstimmung vor. Stork riss daraufhin der Faden. Der Tod ist ein zu teurer Preis für ein verdammtes Stück Fleisch, meint ihr nicht? Schon gut, Jürgen. Entspann dich. Wir träumen doch nur.
Nur Minuten, nachdem Stork sie zur Ordnung gerufen hatte, passierte es. Plötzlich stand da dieser Junge auf einem Felsen über ihnen. Strubbelhaare, dreckiges Gesicht, barfuß, eine Rute in der Hand. Ein Ziegenhirte, vielleicht zehn, zwölf Jahre alt. Er blickte stumm auf die Soldaten, die es sich im Geröll bequem gemacht hatten und in einer fremden Sprache redeten.
»Ich glaube, wir haben Besuch«, sagte Jato. Er sagte es ganz ruhig, nahm sein Gewehr in Anschlag und zielte auf den Jungen. Die anderen folgten seinem Beispiel. Ein Zehnjähriger da oben, sechs Elitesoldaten hier unten.
Der Junge blieb seltsam regungslos. Vielleicht war er es gewöhnt, dass Waffen auf ihn gerichtet waren.
»Keiner schießt«, knurrte Stork. »Tommi, Timur, ihr zwei holt ihn runter. Dirk und Jato, ihr steigt auf den Felsen und sichert die Umgebung. Keppler, du siehst dich um, ob er allein ist. Los!«
Es war Routine. Gelände sichern, Umgebung auskundschaften, Feindbewegung ausmachen. Stumme Signalsprache. Profis bei der Arbeit. Ein geöltes Räderwerk. Präzise und tödlich.
Ein paar Minuten später trat so etwas wie Entspannung ein. Wie es aussah, war der Junge allein. Nur, was sollten sie jetzt mit ihm machen? Laufen lassen? Mitnehmen? Fesseln und einfach liegenlassen? Nichts davon war wirklich gut.
Noch während sie diskutierten, tauschte Stork ein paar leise Sätze mit Tommi Hoffmann aus. Die beiden kannten sich schon aus ihrer Zeit bei der regulären Truppe. Schließlich stand Stork auf, packte den Jungen am Genick und verschwand zwischen den Felsen. Eine Viertelstunde später kam er zurück. Allein. »Das Problem ist gelöst. Und ich will nichts hören.«
»Aber …«
»Dem Kleinen ist nichts passiert, falls einer von euch das denken sollte. Ich hab’s von den Amis gelernt. Ist immer gut, ein paar Dollar in der Tasche zu haben. Wenn der Kleine das nächste Mal nach Hause kommt, sind wir schon längst nicht mehr hier.«
Alle waren beruhigt. Außer Ralf Keppler. Er sah den Blutstropfen, der aus Storks Messerscheide rann.
5
Die Sommernächte auf St. Pauli hatten einen einzigartigen Duft. Reifenabrieb und Cannabis. Nuttendiesel, Hundepisse.
Vier Uhr morgens. Manuel Jessen saß mit Mamdouh auf einer Bank auf dem Spielplatz in der Hein-Hoyer-Straße.
Er war … ja, glücklich. Er hatte sich ein Leben aufgebaut, in dem es sich aushalten ließ. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten hatte er das Gefühl, angekommen zu sein. Doch zugleich spürte er einen Stich. Alles war eine einzige Lüge. Irgendwann würde der Tag kommen, an dem er dies alles zurücklassen müsste. Unweigerlich. Weil dieser Tag bisher immer gekommen war.
Aber noch war es nicht soweit. Noch war er Teil dieser Welt. Er würde jede Sekunde davon genießen.
Mamdouh war ebenfalls erstaunlich still und nachdenklich. Es war schwer zu sagen, ob es an der Stimmung lag oder an dem Gras, das er und Manuel rauchten. Vermutlich an beidem.
Der Algerier – denn das war Mamdouh in Wahrheit; Manuel war einer der Wenigen, die es wussten – zog an der Tüte, reichte sie dann weiter. Manuel inhalierte tief und lächelte dabei. Von der nahen Reeperbahn wehte Partylärm herüber. Der Himmel leuchtete im orangefarbenen Widerschein der nahegelegenen Hafenanlagen. Tief im Osten waren die ersten Flecken Tageslicht zu sehen. Ein paar Jungs in einem Sportwagen röhrten mit zu viel PS und zu wenig Hirn die Simon-von-Utrecht-Straße entlang. Dann wurde es wieder still.
Mamdouh räusperte sich, blickte kurz zu Manuel und sagte dann mit verlegener Stimme: »Sag mal, Manu, findest du, dass ich zu viel rede?«
»Du? Wie kommst du denn darauf?«
»Ist so ein Gefühl. Manche von den Gästen sehen mich seltsam an. Als wenn ich ihnen auf die Nerven gehe. Tue ich das? Gehe ich den Leuten auf die Nerven?«
»Mach dir keine Gedanken, Mamdouh. Du bist in Ordnung, so wie du bist.«
»Nett, dass du das sagst.«
»Vergiss es.«
Augenblicke der Stille. Dann räusperte Mamdouh sich erneut. »Weißt du eigentlich, dass du mehr für mich bist als ein Chef, Manu? Du bist mein bester Freund. Mein Bruder.«
Seine Stimme war ernsthaft und aufrichtig. Manuel legte ihm die Hand auf die Schulter. »Ich fühle genauso. Daran wird sich niemals etwas ändern.«
»Danke, Mann. Es bedeutet mir eine Menge, dass du das sagst.«
Sie blieben noch eine ganze Weile sitzen, schwiegen und genossen die Nacht und den Frieden.
Manuel wusste, dass Mamdouh eben darum nach Hamburg gekommen war. Um Frieden zu finden. Er hatte nie allzu viel darüber gesprochen, und doch hatte Manuel eine Ahnung von dem Leben, das Mamdouh einmal geführt hatte. Krieg. Folter. Manuel tippte, dass er für den Präsidenten Bouteflika Oppositionelle und Islamisten bekämpft und getötet hatte. Vielleicht war es auch umgekehrt gewesen, und er hatte gegen das Regime und für die religiösen Fanatiker gekämpft. Es spielte keine Rolle. Wichtig war, dass der Funke des Krieges in ihm erloschen war. Es war vorbei. Er hatte das Kapitel abgeschlossen.
Wahrscheinlich musste Mamdouh deshalb so viel reden, er musste mit den Worten die Erinnerungen betäuben. Manuel konnte es nachfühlen. Es war nie wirklich vorbei. Für niemanden. Auch für ihn nicht.
6
In der dritten Nacht erreichten sie das Gehöft, das ihr Ziel war. Es bestand aus zwei unterschiedlich großen Lehmhütten, dazu einigen Schuppen und Unterständen. Sie näherten sich auf etwa vierhundert Meter und suchten Deckung im Schatten einiger Bäume. Hier würden sie den Tag, möglicherweise auch noch die nächste Nacht verbringen. Das Ziel beobachten, Risiken kalkulieren, das Vorgehen festlegen. Sorgfalt ging vor Schnelligkeit. Eine der wichtigsten Regeln beim Kommando.
Drei Mann konnten schlafen, während zwei der drei anderen das Ziel beobachteten. Der letzte Mann sicherte die Umgebung.
Drüben war keine Bewegung auszumachen. Die Bewohner schienen noch zu schlafen. Aus einem Fenster des vorderen, größeren Gebäudes war der schwache Wiederschein eines glimmenden Feuers zu sehen. Weiter hinten sahen sie eine Art Carport, eher ein grob aus Balken und Ästen gezimmerter Unterstand, aus dem das Heck eines Pick-ups ragte. Bis zum Morgen geschah nichts.
Als der östliche Himmel sich grau färbte, erwachte auf dem Gehöft das Leben. Ein Generator röhrte, Rauch stieg auf, Essensgerüche breiteten sich aus. Keppler hätte jetzt zu denen gehören sollen, die schliefen. Aber er war nicht müde, darum lag er vorne bei den Beobachtern. Niemand sagte etwas. In der Ferne hörten sie Lärm. Ein paar Kilometer entfernt war eine Staubwolke zu sehen. Ein Geländewagen näherte sich mit hoher Geschwindigkeit. Er erreichte das Gehöft. Männer stiegen aus und begannen, Gegenstände aus dem Kofferraum zu laden.
Stork, der das Ganze durch seinen Feldstecher beobachtete, schnalzte mit der Zunge. »Gefällt mir nicht.«
Er reichte das Glas an Tommi Hoffmann. Der sah eine ganze Weile hindurch, sagte dann: »Gasflaschen. Viele. Sie laden sie auf den Pick-up, der in dem Schuppen steht.«
»Ich schätze nicht, dass sie damit kochen oder heizen wollen.«
Stork und Tommi wechselten einen wortlosen Blick. Dann wandte sich der Truppführer an Keppler, der inzwischen das Fernglas hatte. »Was sagst du?«
»Der Wagen wird präpariert.«
»Sehe ich genauso. Aber noch sind sie nicht soweit.«
Zwei weitere Stunden vergingen. Drüben auf dem Gehöft wurde gearbeitet. Sie zählten insgesamt sieben Männer, von denen sechs anpackten. Einer stand daneben, gab Anweisungen, nickte schließlich zufrieden. Ob noch weitere Kämpfer in den Häusern waren, vielleicht auch Frauen oder Kinder, war nicht auszumachen.
Gegen Mittag legten die Männer am Gehöft eine Pause ein. Sie verschwanden in der Hütte. Nichts weiter geschah. Die Sonne stand hoch am Himmel, und obwohl das Jahr schon fortgeschritten war und der Sommer in den Herbst überging, wurde es heiß. In dieser Höhe musste man vorsichtig sein, sonst brannte einem die Sonne die Haut von den Knochen.
Stork und Tommi behielten das Gehöft im Auge. Die anderen drei schliefen. Keppler hatte sich ein paar Meter nach hinten zurückgezogen, wo er in einer Senke saß und sich mit dem Rücken gegen einen Baumstamm lehnte.
Alles Mögliche ging ihm durch den Kopf. Ihm gefiel das Ganze hier nicht. Es passte nicht zusammen.
In der Abenddämmerung kam die Zeit, aktiv zu werden. Alle waren jetzt wach. Keppler und die anderen, die es sich hinten bequem gemacht hatten, robbten nach vorne, lugten nacheinander durch das restlichtverstärkende Glas. Einer der Afghanen verließ das vordere Gebäude, ging hinüber zu dem Schuppen. Sie hörten das Geräusch eines startenden Automotors. Der Mann fuhr den Pick-up aus dem Schuppen hinaus und wendete ihn. Dann stellte er den Motor aus, stieg aus und verschwand wieder im Haus. Sie konnten sehen, dass die Ladefläche des Wagens hochbeladen und mit einer Plane abgedeckt war.
»Also, Jürgen. Was ist los? Du weißt doch was …«, fragte Keppler.
Der Kommandoführer grinste. »Erinnert ihr euch an den Typen, der heute Morgen in dem Geländewagen saß? Der mit dem weißen Pakol?«
»Klar.«
»Das war Mujtaba Afridi. Er ist also wirklich dabei. Glück für uns, Pech für ihn … Was wir tagsüber gesehen haben, ist euch allen klar, oder? Die bereiten einen Anschlag vor. Das genaue Ziel ist unklar, aber eines steht fest. Die Toten sollen deutsche Pässe haben. Mit anderen Worten, dieser scheiß Pick-up wird spätestens morgen früh in Richtung Kundus, Masar-e Sharif oder vielleicht auch Faizabad fahren.«
»Wird aber nicht passieren, richtig?«, fragte Jato.
»Exakt.« Stork grinste. »Die Gasflaschen habt ihr gesehen. Darunter dürfte eine satte Schicht Sprengstoff liegen. Zusammen reicht das für einen massiven Anschlag. Mit Dutzenden toter Kameraden.«
»Also lieber ein Dutzend tote Taliban«, sagte Cicek.
Keppler sah überrascht in die Runde. War er der Einzige, der nicht Bescheid wusste?
Er schloss für einen Moment die Augen, blickte dann zu Stork. »Wir sind also nicht hier, um jemanden festzunehmen?«
»Gut kombiniert, Keppler.«
»Darum auch keine ANP und keine Dolmetscher?«
»Wofür auch? Wir haben nicht vor, uns zu unterhalten.«
»Sondern?«
»Kannst du dir denken. Oder nicht?«
»Scheiße, Stork.«
»Krieg, Keppler. Oder glaubst du, wir sind hier, um nett zu sein?«
»Bestimmt nicht. Aber warum hast du nichts gesagt?«
»Weil ich nicht wusste, ob ich dir trauen kann. Aber wenn es dir nicht passt, kannst du ja gehen.«
Ralf Keppler sparte sich eine Antwort.
7
Sonntagmorgen, halb acht. Die Straßen auf dem Hamburger Kiez, dem Amüsierviertel, waren verlassen, die Musik war verstummt, die Leuchtreklamen waren ausgeschaltet. Ein Windhauch ließ ein paar Pappbecher über den Asphalt rollen.
Manuel Jessen beendete die letzen Aufräumarbeiten im Curry. Noch einmal über den Tresen wischen. Das Kochbesteck für den nächsten Tag bereit legen, die Getränkevorräte prüfen.
Schließlich schaltete er das Licht aus, trat vor die Tür. Instinktiv blickte er sich um. Ein paar Tauben am Straßenrand, Partymusik aus einem Dachfenster, ein früher Spaziergänger. Ein friedlicher Morgen.
Manuel ließ das Rollgitter hinab und hängte das Vorhängeschloss in die metallene Öse am Boden. Zeit, nach Haus zu gehen.
Manuel bewohnte eine Einzimmerwohnung im Stadtteil Rothenburgsort, nicht weit von St. Thomas entfernt. Es war ein schmuddeliger Straßenzug, der sich nicht einmal darum bemühte, etwas herzumachen. Hamburgs Hinterhof, jedenfalls einer davon.
Manuel war der Untermieter eines Untermieters, der die Wohnung in den achtziger Jahren bezogen hatte, aber längst schon irgendwohin verschwunden war. Seinen Namen kannte keiner mehr, vielleicht war er längst gestorben. Niemand fragte danach, nicht einmal der Eigentümer. Warum auch, solange die Miete pünktlich auf seinem Konto landete. Außerdem gab es auf die Art niemals Beschwerden wegen tropfender Wasserhähne oder undichter Fenster. Die Rechtlosen sind gefügig und machen selten Ärger.
Bei Can Babaoglu, der im Nachbarhaus einen Kiosk betrieb und auch am Sonntag geöffnet hatte, besorgte Manuel Milch, frische Brötchen, Katzenfutter. Er stieg das baufällige Treppenhaus hinauf ins oberste Stockwerk. Der Kater, der Manuels Rückkehr ahnte, begann zu schreien.
Bevor Manuel die Wohnung betrat, blickte er hinab zur unteren Kante der Tür. Die Sicherung war unversehrt. Er trat ein, strich dem Kater übers rostrote Fell. In der Küche öffnete er die Futterdose und füllte den Inhalt in den Napf. Er nahm sich ein Glas Wasser, setzte sich an den Küchentisch und sah dem Kater beim Fressen zu.
Dann ging Manuel hinüber ins einzige Zimmer der Wohnung. Es war karg möbliert. Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl. Nackte Wände. Ein paar Bücher, eine Kleiderstange.
Er war müde, legte sich dennoch nicht ins Bett. Stattdessen faltete er den Zabuton, setzte sich darauf, schlug die Beine unter, legte die Hände ineinander und versenkte sich in die große Stille.
8
Die letzten Geräusche auf dem Gehöft waren versiegt. Die Stille der afghanischen Nacht setzte ein. Kein Tierlaut war zu hören, nicht einmal das Summen von Insekten. Nur der Wind strich über die kargen Felsen.
Keppler, Stork und die anderen rückten vor. Timur Cicek, der ihr bester Schütze war, blieb zunächst zurück und sicherte. Die Aufständischen im Gehöft schliefen verteilt in den beiden Lehmhütten. Tür eintreten, Ziel lokalisieren und neutralisieren. Das war der ganze Plan. Einfach und schnell. Im besten Fall wäre alles binnen zehn Minuten vorbei.
Für die letzten Meter brauchten sie am längsten. Jetzt kam es darauf an. Im Schatten der Außenmauer des größeren Gebäudes sammelten sie sich. Auch Cicek schloss auf. Kein Wort fiel. Nur stumme Signale per Handzeichen.
Kurz darauf standen sie verteilt vor den Türen der beiden Gebäude. Sechs Männer, schwer bewaffnet, zu allem entschlossen.
Ein letzter Blickkontakt, ein kurzes Nicken. Sie schoben die Nachtsichtgeräte herunter. Für keinen von ihnen war es das erste Mal. Sie hatten getötet, würden es jetzt wieder tun. Es war ihr Job. Das, wofür sie ausgebildet worden waren.
Stork wollte gerade die Tür des ersten Gebäudes auftreten. Im gleichen Moment bellte ein Hund, laut und wütend. Keiner rührte sich. Das Gebell erstarb. Stille.
Sekunden, Minuten.
Ist es gutgegangen?
Im vorderen Gebäude sind Stimmen zu hören. Das Klicken von Waffen, die durchgeladen und entsichert werden. Was tun? Zurück? Kommt nicht in Frage. Jetzt ziehen sie es durch. Es würde nur ein bisschen gröber werden als ursprünglich geplant.
Stork gibt das Zeichen. Vorsicht, gleich wird’s laut. Er zieht eine Handgranate vom Gürtel, löst den Sicherungsring, tritt die Tür auf und wirft den Sprengkörper ins Innere.
Die Detonation ist ohrenbetäubend. Flammen lodern auf, panische Stimmen schreien durcheinander. Schüsse fallen. Rennende Gestalten, mehr Schüsse, mehr Schreie. Ordnung wird zu Chaos. Der Hund bellt die ganze Zeit. Im Rauch können sie kaum etwas sehen, trotz der Nachtsichtgeräte. Wer ist Freund, wer Feind? Das Rattern einer AK47. Die kurzen, ploppenden Schüsse des G36. Treffer, Querschläger, Tote, Verletzte. Auch der Köter fängt sich eine Kugel ein, er heult auf, winselt, stirbt.
Keppler dringt mit Tommi und Jato in das zweite, kleinere Gebäude vor. Das erste Zimmer ist leer, aber wieviel Zimmer gibt es überhaupt? Ein Schuss fällt, der aus dem Nirgendwo kommt. Tommi Hoffmann stößt einen unterdrückten Fluch aus, er ist an der Seite getroffen worden, knapp unterhalb der Weste. Nichts Ernstes. Los, weiter, alles okay.
Der Feind hat vom Nebenraum durch die Lehmwand geschossen. Jato macht dasselbe. Er stellt auf Dauerfeuer und setzt eine ganze Salve durch die Wand ab. Ob er damit Wirkung erzielt, bleibt unklar. Von draußen ist Kampflärm zu hören. Eine weitere Handgranate geht hoch. Schritte, die in ein Rennen übergehen. Ein Schuss, ein Schrei. Hier drinnen wird ebenfalls geschossen. Ein Schatten huscht vor ihnen an der Wand entlang, macht einen Satz nach vorne. Das Kohlefeuer, das gerade noch in der Zimmerecke geglimmt hat, verwandelt sich in einen Funkenregen. Keppler wirft sich auf die Erde und schießt. Ein Körper sackt zu Boden. Aber da ist immer noch Bewegung. Jato hat auch etwas abbekommen, er gibt einen unterdrückten Schmerzenslaut von sich. Keppler hat die P8 in der Hand, robbt vorwärts. Der hintere Raum ist nur durch einen Vorhang abgetrennt. Er rollt sich unter dem Stoff durch, zielt und schießt. Drei Schuss, drei Treffer. Geklärt und gesichert. Raus!
Draußen auf dem Hof herrscht ein einziges Durcheinander. Leichen liegen herum. Viel mehr Leute, als ihnen klar war. Alle tot. Sie müssen die ganze Zeit im Haus gewesen sein. Das große Gebäude steht lichterloh in Flammen. Zwei der Taliban haben sich hinter dem Pick-up verschanzt und schießen wild um sich. Schwer zu sagen, ob der Wagen ihnen Deckung geben soll oder ob sie es im Gegenteil darauf anlegen, dass die Deutschen auf sie zielen und alles zur Explosion bringen. Das darf nicht passieren. Wenn die Sprengsätze auf der Ladefläche hochgehen, wären sie alle tot. Stork und Cicek haben hinter einer Viehtränke Schutz gesucht. Wo Grunert ist, weiß keiner. Das Ganze hier läuft richtig beschissen. Sie können es besser. Aber was soll’s. Training ist eines, die Wirklichkeit etwas anderes.
Stork winkt Keppler zu und gibt ihm stumme Zeichen. Keppler versteht. Er dreht sich um und umrundet den rückwärtigen Schuppen, in dem Geräte für die Feldarbeit stehen. Er gelangt in den Rücken der beiden Männer hinter dem Pick-up. Zwei Schuss. Ende.
Plötzliche Stille. Sie warten ab, treten dann aus der Deckung, die Waffen immer noch im Anschlag, Blicke in alle Richtungen. Tommi hält sich die Seite, der Stoff seiner Hose ist blutdurchtränkt. Grunert taucht ebenfalls auf. Er war in die Flammen geraten und sieht aus wie ein verbrannter Toast. Aber er grinst, er ist in Ordnung. Jato humpelt, Durchschuss an der Wade. Er winkt ab.
Erleichterung macht sich breit. Kein Meisterstück. Aber es hätte schlimmer kommen können. Durchatmen.
Plötzlich hören sie einen langgezogenen Schrei. Ein Mann, eigentlich noch ein Junge, höchstens sechzehn Jahre alt, kommt aus dem dunklen Nichts der Nacht gerannt. Er reckt die Arme in die Höhe und hält in beiden Händen entsicherte Handgranaten. Sie schießen, sie treffen, aber der Junge rennt weiter wie ein geköpftes Huhn. Er erreicht den Pick-up. Stork brüllt nur ein einziges Wort: »Rennt!«
9
Entenwerder war eine Halbinsel auf der Elbe, nicht weit von Rothenburgsort entfernt. Früher Zollstation, dann Winterquartier für Schausteller, heute ein ausgedehnter Park. Wiesen, Pappeln, Grillplätze, umweht vom brackigen Geruch der Norderelbe.
Es war später Vormittag. Auf einer Wiese, abgeschirmt von einer wild gewachsenen Hecke, standen sich zwei Männer gegenüber. Die Blicke ineinander verbohrt. Der eine ernst, der andere lächelnd.
»Bist du soweit?«, fragte Manuel Jessen.
»Aber ja, Sensei.«
»Dann los! Versuche es! Lass dir etwas einfallen.«
Der Jüngere zögerte. Er trug genau wie Jessen einen grauen Gi und schwarze Hakama, den Hosenrock der klassischen japanischen Kampfkünste. »Ich bin mir nicht sicher. Was ist erlaubt?«
»Alles.«
»Alles?«
»Sicher.«
Mit vorsichtigen Schritten umkreisten sie einander. Simon, so hieß Jessens Deshi, sein Schüler, suchte nach einer Schwäche, nach einem Eingang in den Gegner. Wo ließ sich ein Schlag, ein Tritt, ein Wurf platzieren?
Er fand – nichts.
So ging es minutenlang. Ein Abtasten, ein Lauern. Immer wieder täuschte Simon einen Vorstoß an, machte einen Satz auf Jessen zu, deutete einen Schlag, einen Tritt, einen Griff an. Doch sogleich ließ er wieder davon ab. Auch wenn Jessen nur minimal reagierte, so genügte eine kleine Bewegung doch, um den beabsichtigten Angriff sinnlos erscheinen zu lassen.
Schließlich ließ Simon die Hände sinken, schüttelte seufzend den Kopf.
»Was ist los?«, fragte Manuel in ehrlicher Verwunderung.
»Es bringt nichts. Ich kann dich nicht angreifen.«
»Warum nicht?«
»Weil ich, noch bevor ich es wirklich tue, weiß, dass ich verlieren würde.«
Jessen lachte. »Es ist umgekehrt, Simon. Du verlierst, weil du es nicht wirklich versuchst. Stattdessen denkst du so laut, dass ich immer weiß, was du tun möchtest. Deine Blicke, deine Hände, deine Füße, alles verrät mir, was du vorhast. So kann ich dir antworten, noch bevor du deine Frage stellst.«
Der andere wirkte geknickt. »Was soll ich tun?«
»Sei im Moment! Lass deine Gedanken deinem Körper nicht vorauseilen.«
»Das sagt sich so einfach.«
»Weil es einfach ist. Einfach und unendlich schwierig zugleich. Versuche es!«
»Also gut.«
Simon schloss für einen Moment die Augen. Atmete. Konzentrierte sich. Dann schnellte er nach vorne, griff Manuel mit einem geraden Faustschlag an, hoffte auf eine instinktive Reaktion seines Sensei, die er in einen Wurf oder eine andere Aktion verwandeln könnte.
Es war längst zu spät. Simons Schlag traf ins Leere. Aber es war zugleich viel mehr als das, sein Angriff verlor sich in den Weiten des Universums. So fühlte es sich jedenfalls an. Bodenlos, endlos, undurchschaubar. Als würde er fallen, obwohl seine Füße noch am Boden waren.
Dann hob er tatsächlich ab, segelte in einem hohen Bogen durch die Luft und landete krachend auf dem Rücken.
Manuel Jessen lachte. »Das war gar nicht schlecht. Und jetzt noch einmal. Ich werde es dir leichter machen.«
Simon kam ächzend auf die Füße. »Leichter?«
»Aber ja. Versprochen.«
Sie verbeugten sich, standen dann wieder voreinander. Der Jüngere wirkte nun entschlossen. Er griff mit einem Shomen Uchi, einem Handkantenschlag auf den Kopf, an. Diesmal reagierte Manuel später, verschaffte seinem Gegner so die Illusion, wirklich treffen zu können. Im letzten Moment aber dehnte er erneut auf magische Art die Zeit. In tiefster Ruhe drehte Manuel sich aus, schmiegte sich an die Seite seines Angreifers, führte ihn, tanzte mit ihm, brachte ihn schließlich sanft und doch zwingend zu Boden.
»Besser.«
»Aber nicht gut genug.«
»Es gibt nie ein Genug.«
»Auch für dich nicht, Sensei? Hast du nicht die oberste Stufe erreicht?«
Manuel Jessen schmunzelte. »Es gibt keine oberste Stufe. Wenn du glaubst, sie erreicht zu haben, bist du längst schon auf dem Abstieg nach unten … und jetzt los! Noch einmal von vorne. Nicht denken, machen!«
Die beiden Männer schenkten sich nichts. Angriff um Angriff erfolgte, Schläge, Tritte, Würfe, Hebel. Unbarmherzig und doch auch von vollendeter Schönheit.
Tanzende Kraniche.
Wellen.
Wirbel.
Wind.
Dann lag Simon schwer atmend auf dem Boden. Es ging nicht mehr. Er fand nicht einmal mehr die Kraft, um aufzustehen.
Manuel Jessen nickte wohlwollend. »Dann soll es gut sein für heute.«
Nachdem sein Deshi, der Einzige, den er hatte, fort war, setzte sich Jessen im Blickschutz einiger Büsche an die Uferböschung. Er schenkte sich aus einer Thermoskanne einen Sencha ein. Er schlürfte von dem bittergrünen Tee und blickte auf die Elbe hinaus.
Er liebte die trägen Mittagsstunden an der Elbe. Das sanfte Rauschen des Stroms, das entfernte Stimmengewirr der Fußballspieler, der Grillrunden, der Musiker. Hoch oben das Geschrei der Möwen.
Frieden.
Bevor Simon gegangen war, hatte er Manuel gefragt, warum er keinen Dojo eröffnete. Einen Sensei wie ihn gebe es nicht noch einmal in Deutschland, eine große Schülerschaft sei ihm sicher.
»Wäre das nicht besser als dein Imbiss?«, fragte Simon.
»Vielleicht ist mein Imbiss nichts anderes. Ein Dojo. Ein Ort des Weges.«
»Schon klar. Aber du verschwendest deine Talente, Sensei …«
Manuel lachte. »Möglich, dass ich es eines Tages wirklich tue, Simon.«
»Was hält dich davon ab, es jetzt zu tun?«
»Es gibt Dinge, die ich erledigen muss.«
Simon wollte Näheres wissen, aber Manuel schüttelte den Kopf. Simon verstand. Er verbeugte sich, ging.
Manuel blickte hinaus auf die Elbe. Ein sanfter Sommerwind wehte.
10
Der amerikanische Chinook nahm sie im Morgengrauen auf, gute fünf Kilometer vom Einsatzort entfernt. Als sie an Höhe gewannen, konnte Keppler noch einmal auf die Folgen der letzten Nacht blicken. Die Ruinen des Gehöfts glimmten noch, und schwarzer Rauch stieg in den Himmel auf. Verkohlte Leichen lagen zwischen den Trümmern.
Stork sah ebenfalls nach draußen. Sein Gesicht hatte etwas Verklärtes, als schaute er auf die zerwühlten Laken eines Bettes, in dem er seine Unschuld verloren hatte. Es war ein wenig wild gewesen, ein wenig stürmisch. Aber er schien zufrieden zu sein.
Hatte Stork am Ende sogar recht? Keppler wusste es nicht. Er wusste gar nichts mehr. Außer, dass sie einigermaßen glimpflich aus der Sache herausgekommen waren.
Tommi Hoffmann hatte einen Streifschuss an der Hüfte abbekommen. Timur hatte einen Durchschuss am Arm, von dem er in der Nacht nicht einmal etwas gemerkt hatte. Jato hatte einen dicken Verband um die Wade, sie hatten ihn beim Marsch stützen müssen. Außerdem hatten sie alle Verbrennungen an den Armen, im Gesicht, am Körper. Müsste weh tun, tat es aber nicht. Adrenalin war eine Wunderdroge.
Der Heli flog flach übers Gelände. Die Ranger an Bord verteilten grinsend Coladosen. Alle an Bord waren wachsam. Die Taliban hatten vor nicht allzu langer Zeit einen Apache vom Himmel geholt.
Kepplers Blick reichte weit über die große, endlose Ebene, über die der Wind Wolken aus Staub und Dreck trieb. Es gab in diesem Land nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Menschen töten, um anderen Menschen das Leben zu retten. Es ergab keinen Sinn.
Oder doch, es ergab Sinn, und dieser Sinn hatte einen Namen: Krieg.
Vorhin, während ihres Marsches, hatte Stork sich zu ihm zurückfallen lassen. Sie waren eine Zeitlang schweigend nebeneinander gegangen, dann hatte Stork gesagt: »Du warst gut heute Nacht, Keppler. Besser als die anderen.«
»Wenn du es sagst.«
»Du bist sauer auf mich wegen dem Jungen, oder? Wegen diesem Ziegenhirten? Du weißt schon, am ersten Tag an der Wasserstelle.«
»Nein.«
»Sicher?«
Keppler blieb stehen und schloss kurz die Augen. »Ich bin sauer auf dich wegen der Scheiße, die du uns erzählt hast. Hieß es nicht einmal, dass Vertrauen das Wichtigste für uns ist? Dass man sich da draußen hundert Prozent auf seine Kameraden verlassen können muss?«
Stork senkte den Kopf und ließ Kepplers Worte wirken. »Du hast recht, Ralf. Es war nicht in Ordnung von mir. Ich habe auf Anweisung gehandelt, aber das hätte ich zurückweisen müssen. Wird nicht wieder vorkommen. Außerdem weiß ich jetzt, dass ich dir vertrauen kann. Euch allen.«
»Das heißt, es wird weitergehen?«
»Was denkst du denn? Schneller, als wir es uns wünschen.«
Keppler nickte nur stumm.
11
Der Mann hieß Müller, jedenfalls nannte er sich so. Er saß in einem Straßencafé in der Hamburger City, genoss einen Latte macchiato. Zum Schein las er in einer Zeitung, behielt in Wahrheit aber seine Umgebung im Auge. Kurz darauf entdeckte er in der Menschenmenge den großgewachsenen Mann, der sich dem Café näherte.
Wieder einmal musste Müller verwundert den Kopf schütteln. Er hatte im Laufe seiner Karriere mit manchen Männern zusammengearbeitet, die ungewöhnlich waren – wobei das Wort mal die Bedeutung von herausragend hatte, mal von absonderlich, gelegentlich auch von abartig. Für Manuel Jessen passte keiner dieser Begriffe. Er war eine Kategorie für sich.
Jessen war ihm einige Jahre zuvor empfohlen, man könnte auch sagen zugeführt worden. Müller erinnerte sich noch gut daran. Es war die Zeit im Sommer 2017 gewesen. Der vietnamesische Geheimdienst hatte kurz zuvor am helllichten Tage einen Landsmann entführt, mitten in Berlin. Der Vorgang an sich ließ sich verkraften, Trinh war nicht wirklich wichtig.
Aber die Dreistigkeit der Vietnamesen hatte einiges ausgelöst. Es war einfach zu viel gewesen. Ein Schlag ins Gesicht der deutschen Dienste. Die reinste Verhöhnung. Noch mehr ließ sich ein Land nicht vorführen.
Im Grunde aber hatte es schon viel früher angefangen. Irgendwann in den Zehner-Jahren. Die Russen, und zwar nicht nur die SWR, sondern auch GRU und FSB, begannen damals, immer hemmungsloser im Land zu agieren. Sondereinheiten machten Jagd auf Dissidenten, und zwar nicht nur auf dem Balkan oder im mittleren Osten. Sondern in Europa. In Deutschland. Der Tiergartenmord war da noch nicht geschehen, Skripal ebensowenig. Aber wer die Augen aufmachte, konnte all das ahnen.
Hinzu kam die massenhafte Einschleusung regimetreuer Tschetschenen. Nichts war sicher. Aber es gab Stimmen, die sagten, dass Moskau begonnen hatte, eine Untergrundarmee aufzubauen.
Die Türken machten genauso Sorgen. Ankara ließ seinem Geheimdienst MIT hierzulande eine immer längere Leine. Sie hatten es in erster Linie auf ihre eigenen Leute abgesehen. Aber machte es das besser? Hinzu kamen die Iraner, die Pakistanis, die so genannten Freunde aus den USA. Und natürlich China. Die beschränkten sich zwar noch weitgehend auf wirtschaftliche Ziele, warben Manager an, Wissenschaftler. Wissensabschöpfung, Industriespionage. Aber würde es dabei bleiben?
Das Prinzip dahinter war immer dasselbe. Globalisierung. Die betraf eben nicht nur die Wirtschaft, den Handel, die Kultur, sondern auch die weltweiten Kriege, im Inneren wie im Äußeren. Keine lokale Begrenzung mehr. Dort war hier, war überall. Besonders eben Deutschland. Berlin, Hamburg, München, sogar kleinere Städte wurden zum Tummelplatz ausländischer Dienste. Der Kalte Krieg des zwanzigsten Jahrhundert erschien im Vergleich wie ein Kindergeburtstag. Die Dreistigkeit der fremden Agenten sprengte alle Dimensionen. Warum auch nicht? Das Risiko, aufgehalten zu werden, war minimal. Jeder wusste, dass die Deutschen zahnlose Tiger waren. Weil sie als Einzige so etwas wie Fairplay versuchten. Die einen nannten es Recht und Gesetz. Die anderen grenzenlose Naivität. Wer sich im großen Spiel als Einziger an die Regeln hielt, war dem Untergang geweiht.
Dann passierte das mit den Vietnamesen. Danach war eine Handvoll Männer wie er, hoch spezialisiert und dafür zuständig, Deutschlands Sicherheit zu schützen, nicht mehr bereit gewesen, dem Treiben tatenlos zuzusehen. Ihre Haltung als Widerstand zu bezeichnen wäre pathetisch. Im Grunde wollten sie einfach nur ihren Job machen. Daraus war das entstanden, was bis heute nur Das Netzwerk genannt wurde.
Einen offiziellen Startschuss gab es nicht. Es ging eher mit vieldeutigen Blicken in der Cafeteria los, mit einem unterdrückten Stöhnen in der Runde im GTAZ, im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, einem Schnauben beim Rapport in der G10-Kommission. Bei den Beteiligten setzte eine Art kollektives Abtasten ein, um herauszufinden, zu welcher Seite der Kollegen man gehörte. Die, die weiter Dienst nach Vorschrift machen wollten. Oder die, die bereit waren, andere Saiten aufzuziehen.
Das erste – und in der vollständigen Besetzung auch einzige – Treffen fand im Winter desselben Jahres statt. Sie buchten ein abgelegenes Tagungshotel, reisten getrennt an, sprachen sich nicht mit Namen an. Es waren Vertreter aller Dienste. Eher die zweite als die erste Führungsebene. Über die Agenda brauchten sie nicht lange zu diskutieren. Erstens: Sie mussten schnellstmöglich einen Kanal zu den Briten und Amerikanern öffnen. Zweitens: Sie brauchten ein Werkzeug. Einen Mann oder auch eine Frau, um das auszuführen, was sie für nötig erachteten.