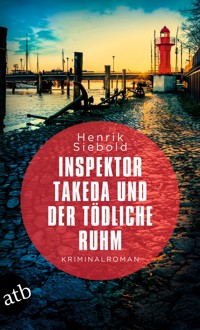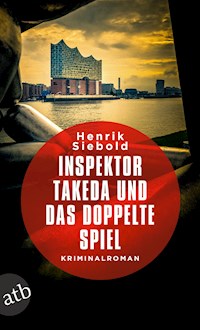
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Takeda ermittelt
- Sprache: Deutsch
Verschwörung auf Japanisch.
Inspektor Takeda, mittlerweile beinahe in Hamburg heimisch geworden, wird zu einem Fall gerufen, der ihn besonders erschüttert. In einem hässlichen Gewerbehof wird die Leiche eines Mannes gefunden, der brutal hingerichtet wurde. Und der Tote ist ein Landsmann und prominent obendrein: Ryūtarō Matsumoto ist ein Profifußballer, der beim HSV unter Vertrag steht. Takeda und seine Kollegin Claudia Harms vermuten zunächst ein Verbrechen im Fußballmilieu. Doch dann entdecken sie mysteriöse Dinge in der Vergangenheit des Spielers, die bis in hohe Yakuza-Kreise in Japan reichen. Und sie entschließen sich, gegen jede Vorschrift zu einer heimlichen Reise nach Japan ...
Klug, hellwach und warmherzig - Inspektor Takeda ist der ungewöhnlichste Held in der deutschen Krimiszene.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Henrik Siebold
Henrik Siebold ist Journalist und Buchautor. Er hat unter anderem für eine japanische Tageszeitung gearbeitet sowie mehrere Jahre in Tokio gelebt. Unter einem Pseudonym hat er mehrere Romane veröffentlicht. Zurzeit wohnt er in Hamburg.
Bisher erschienen als Aufbau Taschenbuch »Inspektor Takeda und die Toten von Altona«, »Inspektor Takeda und der leise Tod«, »Inspektor Takeda und der lächelnde Mörder« und »Inspektor Takeda und die stille Schuld«. »Inspektor Takeda und das doppelte Spiel« ist auch als Audio-CD lieferbar.
Informationen zum Buch
Verschwörung auf Japanisch.
Inspektor Takeda, mittlerweile beinahe in Hamburg heimisch geworden, wird zu einem Fall gerufen, der ihn besonders erschüttert. In einem hässlichen Gewerbehof wird die Leiche eines Mannes gefunden, der brutal hingerichtet wurde. Und der Tote ist ein Landsmann und prominent obendrein: Ryūtarō Matsumoto ist ein Profifußballer, der beim HSV unter Vertrag steht. Takeda und seine Kollegin Claudia Harms vermuten zunächst ein Verbrechen im Fußballmilieu. Doch dann entdecken sie mysteriöse Dinge in der Vergangenheit des Spielers, die bis in hohe Yakuza-Kreise in Japan reichen. Und sie entschließen sich, gegen jede Vorschrift zu einer heimlichen Reise nach Japan.
Klug, hellwach und warmherzig – Inspektor Takeda ist der ungewöhnlichste Held in der deutschen Krimiszene.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Henrik Siebold
Inspektor Takeda und das doppelte Spiel
Kriminalroman
Inhaltsübersicht
Über Henrik Siebold
Informationen zum Buch
Newsletter
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Teil 2
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Teil 3
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Nachwort
Impressum
Teil 1
1.
»Die fahren alle bei Rot.«
»Wer alle?«
»Alle halt. Und blinken tun sie auch nicht mehr. Ich finde, das steht für etwas.«
»Und für was?«
»Die Leute halten sich nicht mehr an die Regeln. Das Gefühl für die Gemeinschaft löst sich auf.«
»Du übertreibst.«
»Finde ich nicht. Aber fragen wir doch einfach Ken. Er hat den Blick von außen. Ken, was sagst du dazu?«
Inspektor Kenjiro Takeda löste seinen Blick nur widerwillig von dem köstlich nach Thymian und Rosmarin duftenden Lammkarree. Vor ihm auf dem Tisch standen außerdem Schüsseln mit Ofenkartoffeln, Gemüse und anderen Leckereien. Takeda hatte bisher nur gefrühstückt, hatte anschließend einen langen Tag auf dem Hamburger Polizeipräsidium verbracht. Vorhin war er noch im Dōjō des Polizeisportvereins gewesen und hatte zwei Stunden lang Aikido trainiert. Jetzt knurrte ihm der Magen. Doch gerade als Sandra Kamp, die Gastgeberin des Abends, das Essen auftragen wollte, war zwischen ihrem Mann Jochen und einem der anderen Gäste eine hitzige Diskussion über den Straßenverkehr ausgebrochen. Eigentlich ging es natürlich – wie so oft in letzter Zeit – um den Sittenverfall in Deutschland.
Volker Wegmann, der andere Gast, hatte nun ihm, Takeda, den Ball zugespielt. Der Inspektor brummte in seiner typisch japanischen Art und signalisierte damit tiefe Nachdenklichkeit. Dann nickte er entschlossen und sagte: »Einiges spricht sicherlich für deine Meinung, Jochen. Aber es gibt durchaus auch Argumente zugunsten deiner Position, Volker. Vielleicht sollten wir die Dinge so hinnehmen, wie sie sind, und einfach essen?«
Die übrigen Gäste sahen Takeda überrascht an, die Frauen zufrieden, die Männer enttäuscht. Konnte es sein, dass für Takeda damit alles gesagt war? Der eine hat recht – und der andere auch? Wie sollte man sich denn bitte schön bei so viel Ausgewogenheit gepflegt streiten?
Takeda spürte, dass er mit seiner Antwort kaum schneller zum Lammkarree kam, und fügte hinzu: »Meine Kollegen, die sich um Verkehrsdelikte kümmern, beklagen in der Tat das Verhalten auf der Straße. Einige Autofahrer wollen von Regeln nichts mehr wissen. Andererseits, wenn man Deutschland mit anderen Ländern vergleicht, dann geht es hier immer noch sehr gesittet zu, denke ich.«
»Ha!« Volker Wegmann blickte triumphierend zu seinem Kontrahenten. »Siehst du, Jochen, Ken gibt mir recht. Es gibt immer mehr Rowdies, und die Gesellschaft verfällt in Anarchie!«
Jochen Kamp schüttelte ärgerlich den Kopf. »Unsinn. Wenn überhaupt, gibt Ken mir recht. In anderen Ländern ist es viel schlimmer … so viele Rowdies sind es also gar nicht. Aber was ist eigentlich mit euch anderen? Was denkt ihr?«
Am Tisch saß neben den Gastgebern und dem befreundeten Paar, Volker und Susanne, noch eine weitere Frau. Sie war alleine gekommen. Sie hieß Angelika, war Mitte vierzig und mit ihren langen aschblonden Haaren und ihrem klugen, ausdrucksstarken Gesicht genau Takedas Typ. Eben darum war sie auch hier und saß, keineswegs zufällig, direkt neben dem Inspektor. Es hatte sich herumgesprochen, dass Ken geschieden und seitdem ungebunden war. Sandra, die Gastgeberin – sie war Journalistin und hatte Ken auf einer Pressekonferenz kennengelernt –, hatte es im Vorfeld der Essenseinladung nicht an entsprechenden Bemerkungen mangeln lassen. Angelika ist interessant, Ken. Sie war schon einmal in Japan. Und sie ist Single.
Jetzt lächelte Angelika charmant und sagte: »Also, ich finde die Aufregung über die angebliche Anarchie auf den Straßen übertrieben. Mal ehrlich, als wir jünger waren, haben wir uns doch immer gewünscht, dass die Deutschen mal etwas italienischer werden. Jetzt ist es soweit, aber das passt auch wieder niemandem. Was ist denn so schlimm daran, wenn man mal bei Rot fährt?«
»Was schlimm daran ist?«, wiederholte Volker und zog seine Worte in die Länge. »Das kann ich dir sagen. Rotfahrer gefährden das Leben anderer Menschen! Sie blockieren die Kreuzungen, erschrecken Fußgänger, sind ein Ärgernis für Radfahrer …«
»Ja, aber in Italien oder Frankreich findest du dieses Verhalten doch auch in Ordnung?!«
»Klar! Aber da bin ich ja auch im Urlaub!«
Alle lachten, und an der Tischrunde kehrte Entspannung ein. Jochen zerteilte das Lamm und portionierte es auf die Teller, die anderen Gäste reichten die Schüsseln mit den Beilagen herum. Die Themen blieben nun leichtfüßig und fröhlich, jedenfalls einigermaßen. Es ging um das Bienensterben, den amerikanischen Präsidenten und die gesundheitlichen Effekte der Mittelmeerküche.
Angelika rückte nach dem Hauptgang dichter an Takeda heran und wollte wissen, ob er schon einmal in Italien gewesen war. Takeda verneinte.
Sie sah ihn mit großen Augen an. »Das ist schade, Ken. Es ist herrlich dort. Besonders in der Toskana. Die Landschaft, die Menschen, die Plätze in den Städten.«
Takeda lächelte fein. »All das ist in Deutschland auch nicht übel. Die Landschaft, die Menschen, die Plätze …«
»Schon. Aber es ist nicht dasselbe.« Angelika erklärte, dass sie im Frühjahr wieder einige Wochen in das Ferienhaus ihrer Schwester in der Nähe von Siena fahre. Es gebe dort viele Zimmer, so dass durchaus noch Platz für weitere Gäste sei. Man könne lesen, faulenzen, in der toskanischen Landschaft spazierengehen oder sich im blickgeschützten Hof splitternackt in die Sonne legen. Dabei blickte sie Takeda tief in die Augen, woraufhin der verlegen lächelte. Angelika gefiel ihm, und sie roch nicht weniger verführerisch als das mit Thymian gespickte Lammkarree. Noch vor nicht allzu langer Zeit hätte der Inspektor nicht nur geschnuppert, sondern auch gekostet.
Aber das war vorbei. Das halbe Jahr, das er nun in Deutschland war, hatte ihm geholfen, Klarheit über sich und sein Leben zu gewinnen. Er hatte es endlich geschafft, die chaotische Zeit, die seiner Scheidung gefolgt war, hinter sich zu lassen. Keine durchzechten Nächte mehr, keine Frauengeschichten, die zu nichts führten. Er war nun in einer Zeit der Klärung, der Beruhigung. Vielleicht war er sogar schon darüber hinaus. Und während in Takedas Gedanken verschwommen das Bild seiner Kollegin Claudia Harms auftauchte, sagte er zu Angelika: »Ich glaube, meine nächste Reise führt eher in den Norden, vielleicht nach Schweden oder Norwegen.«
»Sicher. Ist auch schön. Aber kalt«, entgegnete sie.
»Das habe ich auch gehört. Und doch soll es faszinierend sein. Groß und klar, mit viel Natur. Mit Ruhe.«
»Ruhe?«
»Mmh.«
Angelika nickte tapfer, Takeda senkte den Blick. Sie plauderten noch ein wenig weiter, doch die Leichtigkeit ihres Gesprächs war dahin. Angelika hatte die Botschaft verstanden. Es tat Takeda leid. Und doch war er im Reinen mit sich selbst.
Es war schon fast Mitternacht geworden und damit viel später, als sie es für einen Sonntagabend geplant hatten. Sandra, ihre Gastgeberin, bestand dennoch darauf, den Nachtisch zu servieren. Auch der sah köstlich aus, und Takeda wollte gerade seinen Teller mit Tiramisu und Panna Cotta beladen, als sein Handy klingelte. Er entschuldigte sich bei den übrigen Gästen, nahm das Gespräch an und lauschte der Stimme am anderen Ende der Leitung. Dabei gab er immer wieder Laute der Bestätigung von sich. Sein Gesicht bekam einen ernsten Ausdruck. Schließlich steckte er das Telefon wieder in die Tasche und sagte: »Liebe Freunde, es tut mir leid. Aber ich muss sofort weg. Etwas Schreckliches ist geschehen …«
2.
»Er hört neuerdings Schlager«, sagte Kriminalhauptkommissarin Claudia Harms und gab ein verständnisloses Schnauben von sich.
»Takeda? Ich dachte, der mag Jazz«, entgegnete ihre Freundin Gudrun überrascht. Sie saßen gemeinsam in einem portugiesischen Restaurant am Hafen, genossen einen Vinho Verde und warteten auf ihr Essen. Es war ungefähr dieselbe Zeit, zu der Takeda über Rotfahrer und Verkehrsrowdies diskutierte.
»Tut er ja auch. Aber neuerdings läuft im Auto Andrea Berg. Er meint, es gäbe nichts Besseres, um die geheimen Sehnsüchte und verborgenen Wünsche der Menschen in Deutschland kennenzulernen.«
»Vielleicht hat er ja recht? Ich meine, wenn man mal darüber nachdenkt …«
Claudia prustete. »Die Gefühle haben Schweigepflicht! Zehntausend Mädchen– doch du hast mich verführt! Was, bitte schön, willst du aus solchen Sätzen über die Menschen lernen?«
Gudrun schenkte erst Claudia und dann sich selbst aus der Weinkaraffe nach, runzelte dabei die Stirn. »Zehntausend Mädchen? Das ist von Andrea Berg?«
»Nein, von den Flippers.«
»Okay, verstehe. Die Flippers. Dann hast du wirklich ein Problem!«
Claudia lachte. »Neulich haben wir uns deswegen sogar gestritten. Aber mit einem erstaunlichen Ergebnis.«
»Komm schon, spann mich nicht auf die Folter.«
»Ken und ich duzen uns jetzt.«
»Oh, das ist natürlich echt … intim.«
Gudrun setzte ein spöttisches Lächeln auf, aber Claudia verzichtete darauf zu protestieren. Ihr war klar, dass es für jemand Außenstehenden albern klingen musste. Aber sie wusste auch, dass es für Takeda ein ziemlicher Schritt war. Er war immer ein wenig distanziert. Japaner eben. Das Duzen war nichts, das er beiläufig tat. Es bedeutete ihm etwas, da war sie sicher. Und ihr bedeutete es auch etwas.
Gudrun riss Claudia aus ihren Gedanken und sagte: »Unser Essen kommt. Und dann erzähl mir doch mal, wie es dir sonst so geht. Schließlich haben wir uns ewig nicht gesehen.«
Der Kellner stellte zwei Teller mit Fischvariationen auf den Tisch, fragte dann, ob die Damen eine weitere Karaffe Wein wünschten. Sie sahen sich kurz an, nickten dann beide.
»Wie es mir sonst geht? Gute Frage. Gar nicht so leicht zu beantworten«, sagte Claudia.
Gudrun sah sie prüfend an. »Das klingt nicht unbedingt positiv.«
»So meine ich es nicht. Ich bin mir einfach nicht sicher, wie es mir geht. Alles in allem ist es in Ordnung. Nicht super, aber auch nicht mies. Irgendwo dazwischen.«
Gudrun kannte Claudia gut genug, um sich mit so einer Antwort nicht zufriedenzugeben. »Was ist los, Claudia?«
Claudia verschaffte sich Zeit, indem sie ihren Fisch zerteilte, sich ein Stück in den Mund schob und genießerisch die Augen schloss. Sie musste an den Nachmittag des gleichen Tages denken, als sie zum Schießstand gegangen war, um ihre Routine-Schießübung abzulegen. Ausgerechnet am Sonntag. Aber es war überfällig gewesen. Der Waffenwart im Präsidium hatte sich die Herausgabe der Patronen unterschreiben lassen, schließlich musste jeder abgegebene Schuss registriert werden. Claudia war auf die Schießbahn getreten, hatte sich den Gehörschutz aufgesetzt, einen festen Stand eingenommen. Sie fixierte die Waffe mit beiden Händen und drückte ab. Acht Schüsse, davon zwei wie vorgeschrieben auf die Beine, der Rest in die Brust. Einer in den Kopf. Allesamt Treffer. Eine tadellose Quote. Sie war eine gute Schützin, damals während ihrer Ausbildung, sogar die Beste ihres Jahrgangs. Und das, obwohl sie das Schießen hasste. Bisher hatte sie ihre Waffe noch nie im Ernstfall benutzen müssen. Obwohl, so ganz stimmte das nicht. Mehr als einmal hatte sie die Sig Sauer aus dem Schulterholster gezogen und auf einen Menschen gerichtet. Aber sie hatte nicht abgedrückt. Die Drohung war immer genug gewesen. Bei Takeda war das anders. Er hatte ihr schon vor längerem davon erzählt. Ein schiefgelaufener Einsatz in Tokio, die Erstürmung eines illegalen Bordells. Sein Vorgesetzter hatte ihm befohlen, abzudrücken, obwohl die Sicht schlecht war. Takeda hatte es nie wirklich ausgesprochen, doch wenn Claudia ihn richtig verstanden hatte, dann hatte er bei dem Einsatz ein Kind erschossen. Seitdem weigerte er sich, eine Waffe zu tragen, sogar wenn er dadurch sein eigenes Leben gefährdete.
Wie würde sie in einer lebensbedrohlichen Situation reagieren? Könnte sie abdrücken, wenn vor ihr eben keine künstliche Silhouette aus Pappe stünde, sondern ein echter Mensch? Sie wusste es nicht, und das war die ehrlichste Antwort, die sie geben konnte. Niemand wusste es, und zwar ganz egal, wie oft und wie realistisch man den Ernstfall probte … aber darum ging es eigentlich auch gar nicht. Es ging darum, dass allein die Möglichkeit, es vielleicht tun zu müssen, etwas mit ihr machte. Weil sie zum Beispiel jetzt und hier mit ihrer besten Freundin in einem Lokal saß, einen launigen Abend genoss, aber unter ihrem Blazer eben ihre Waffe trug. Sie war in Rufbereitschaft, weswegen sie eigentlich auch keinen weiteren Wein trinken sollte. Die Frage nach Leben und Tod spielte im Leben einer Polizistin immer eine Rolle. Nicht unbedingt bewusst, jedoch irgendwo im Hintergrund. Es gab Kollegen und Kolleginnen, die gut damit zurechtkamen. Das waren diejenigen, die neben dem Dienst ein ganz anderes, gewöhnliches Leben hatten. Familie, Kinder, Hund, ein Haus in der Vorstadt. In deren Leben gab es eine Balance zwischen dem Normalen und dem Unerträglichen, das ihr Beruf nun einmal mit sich brachte. Wie stand es um Claudias Balance? Hatte sie die? Eher nicht. Weil sie keine Familie hatte, keine Kinder, keinen Hund und kein Haus in der Vorstadt. Und um ehrlich zu sein, wollte sie das alles auch gar nicht. Aber was wollte sie dann? Einen Japaner, der sie oft genug auf die Palme trieb? Der Schlager hörte? Und der ihr immer wieder so fremd war, dass sie glaubte, nicht das Geringste über ihn zu wissen? Konnte er ihr zu einer Balance verhelfen, die er doch im Zweifel selbst nicht hatte?
»Ich habe das Gefühl, in einer Warteschleife zu sein. Aber ich weiß nicht genau, worauf ich eigentlich warte«, erklärte Claudia. Sie sah Gudrun an und bat sie mit stummen Blicken darum, ihre Antwort nicht zum Anlass zu nehmen, ihr wieder ins Gewissen zu reden.
Gudrun verstand es. Sie griff über den Tisch nach Claudias Hand. »Ist in Ordnung, Claudi. Viele Leute entscheiden sich zu früh für etwas, weil sie Angst haben, sonst leer auszugehen. Davor hast du keine Angst, das weiß ich. Tu mir nur den Gefallen, nicht zu lange zu warten.«
Claudia fand zu ihrer Selbstsicherheit zurück, sagte: »So gut solltest du mich kennen. Wenn ich es wirklich nicht mehr aushalte, nehme ich mir, was ich haben will.«
»Und das ist gut so«, sagte Gudrun.
Claudia hatte gerade einen Espresso zum Nachtisch bestellt, als ihr Telefon klingelte. Das Präsidium, Einsatzzentrale. Sie lauschte in den Hörer, nickte und sagte: »Verdammte Scheiße … Ja, ich sage ihm Bescheid. Bin unterwegs.«
Noch während sie Takedas Nummer wählte, sagte sie Gudrun: »Nimm es mir nicht übel, aber ich muss los.«
»Was ist passiert?«
Claudia schüttelte den Kopf. »Ich schätze mal, du wirst es morgen in der Zeitung lesen. Und zwar auf der ersten Seite.«
3.
Es war exakt zweiundzwanzig Minuten nach Mitternacht, als Inspektor Takeda mit seinem Dienstwagen auf einen Gewerbehof in Hamburg-Schnelsen einbog. Die Gegend war schmucklos, um diese Uhrzeit noch mehr als tagsüber. Handwerksbetriebe, Büros, Autowerkstätten, ein paar heruntergekommene Lagerhallen, umrahmt von ungepflegten Grünstreifen.
Takeda parkte den Wagen und stieg aus. Er entdeckte Claudias Peugeot, der vor einer Art Büro stand. Claudia selbst konnte er zunächst nicht sehen. Ihre Stimme hatte am Telefon angespannt geklungen. Sie hatte ihn gebeten, sich zu beeilen. Doch auf seine entsprechende Frage hin hatte sie sich keine näheren Informationen zum Geschehen entlocken lassen. Vielleicht weil sie selbst nichts wusste. Vielleicht aber auch, weil sie ihn nicht unnötig beunruhigen wollte. Letzteres war ihr allerdings nicht gelungen. Ganz im Gegenteil. Takeda hatte das unbestimmte Gefühl, dass das Verbrechen, für dessen Aufklärung er nun zuständig sein sollte, etwas mit ihm zu tun haben könnte.
Der Inspektor legte die letzten Meter zurück und erreichte den Parkplatz, der u-förmig von einem zweistöckigen Gewerbebau umschlossen wurde. Gerüche nach Müll, Öl, alter Farbe streiften seine Nase. Er blieb stehen und ließ die Szenerie auf sich wirken. Die Spurensicherung war offenbar schon vor Ort, hatte ihre hellen Scheinwerfer aufgebaut. In deren gleißendem Licht sah Takeda die Silhouetten der Kollegen wie in einem Schattenspiel. Sie eilten geschäftig hin und her, ein eingeübter, routinierter Ablauf. Markus Tellkamp, der Leiter der Spurensicherung, rief seinen Mitarbeitern Anweisungen zu, andere Kollegen stellten ihre durchnummerierten Wimpel zur Beweissicherung auf, im Hintergrund stand ein Ambulanzwagen mit geöffneter Heckklappe, direkt daneben ein Leichenwagen. Takeda entdeckte nun doch Claudia, die einen dampfenden Pappbecher in der Hand hielt und sich mit einem Mann unterhielt, der die Uniform einer Wachfirma trug. Eine Gruppe uniformierter Polizeibeamter stand etwas abseits, wartete offenbar auf Instruktionen durch die Kollegen von der Kripo. Immer wieder wurde die Szenerie zusätzlich durch das Blitzlicht des Tatortfotografen erhellt.
In dem Augenblick, in dem Takeda in den Lichtkreis der Scheinwerfer trat, veränderte sich die Szenerie schlagartig. All die hektische Bewegung, die der Inspektor gerade noch bewundernd beobachtet hatte, kam schlagartig zum Erliegen. Zeitlupenhaft richteten sich die Kollegen der Spurensicherung, die über den Boden gebeugt nach Indizien suchten, auf. Die Sanitäter, die tatenlos vor ihrem Wagen gestanden hatten, rückten mit langsamen Schritten näher. Claudia, gerade noch ins Gespräch vertieft, drehte sich mit besorgtem Blick in seine Richtung. Markus Tellkamp hob die Hand, wobei Takeda sich nicht sicher war, ob er ihm einen Gruß entrichtete oder ihn am Weitergehen hindern wollte.
Dann trat Takeda ins Zentrum des Geschehens, dorthin, wo die Lichtkegel der Scheinwerfer sich schnitten und eine Fläche von einigen Quadratmetern in gleißende Helligkeit tauchten. Ein Mitarbeiter der Rechtsmedizin, der am Boden hockte, stand als Letzter auf, so dass Takeda nun freie Sicht hatte.
Der Mann lag seitlich auf den alten Pflastersteinen des Hofes. Die Beine waren angewinkelt, sein Kopf verdreht, daher konnte Takeda zunächst nur seinen zertrümmerten Schädel sehen. Vermutlich ein seitlich aufgesetzter Kopfschuss durch eine großkalibrige Waffe, dachte er sofort. Vielleicht auch ein Schlag mit einem schweren Gegenstand, etwas aus Eisen, ein Wagenheber … aber, nein, die Wunde war zu groß, zu viel Knochenmaterial fehlte. Also doch ein Schuss. Eine dunkelrote, bereits eingetrocknete Blutlache ergoss sich über die Pflastersteine.
Takeda, dessen Augen sich allmählich an das helle Licht der Scheinwerfer gewöhnten, umrundete langsam die Leiche. All die vielen Kollegen standen in einem Kreis um ihn herum, waren inzwischen zu seinem Publikum geworden und beobachteten schweigend jede von Takedas Bewegungen.
Dann konnte der Inspektor das Gesicht des Toten sehen. Die schmalen, dunklen Augen, die feinen Lippen, das schwarze, zum Seitenscheitel gekämmte Haar, inzwischen an vielen Stellen blutverkrustet.
Takeda erkannte ihn sofort.
Ein Landsmann, ein Japaner.
Ryūtarō Matsumoto.
Matsu, wie sie ihn meistens riefen. Offensiver Mittelfeldspieler des HSV, Liga-Hoffnung der Mannschaft, Publikumsliebling hier in Hamburg und einer der populärsten Sportler in Japan. Dazu noch Werbe-Ikone, Stil-Ikone, Frauenschwarm, Vorbild für die Jugend, Mitglied der Nationalmannschaft.
Ein Superstar.
Erschossen und im eigenen Blut liegengelassen in einem Hamburger Hinterhof.
Takeda brauchte lange, um sich von dem Anblick loszureißen. Dann sah er hoch. Claudia kam auf ihn zu. Sie versuchte ein aufmunterndes Lächeln, das sie aber sogleich wieder einstellte, als sie seinen Gesichtsausdruck bemerkte. Stumm hielt sie ihm einen Kaffeebecher hin. Er nahm ihn, ohne zu trinken, blickte wieder auf den Toten. Die Linien, die Takedas fein geschnittenes Gesicht durchzogen, schienen in diesen Minuten tiefer zu werden. Claudia hatte ihn selten, nein, noch nie so erschüttert gesehen.
»Kanntest du ihn? Ich meine, persönlich?«
Es dauerte, bis er antwortete. »Kennen ist zu viel gesagt. Wir haben ein paar Mal miteinander gesprochen. Einmal haben wir sogar zusammen getrunken. Im Hotoke. Er war gerne dort.«
Claudia lächelte kurz. Das Hotoke war ein japanisches Lokal im Hamburger Hafen, in dem nicht nur Takeda regelmäßig speiste, sondern auch viele andere Japaner, die in der Hansestadt lebten.
»Das wird ganz schön für Aufruhr sorgen, oder? Ich meine, nicht nur hier in Hamburg. Sondern auch in deiner Heimat?«
Wieder dauerte es, bis Takeda antwortete. Dann war es mehr ein Flüstern, als spreche er mit sich selbst. »Stell dir vor, Thomas Müller würde erschossen. Boateng. Neuer. Das hier wird ein Erdbeben, Claudia.«
4.
Routine war wichtig. Routine war wie Medizin. Jeder Kollege von der Mordkommission wusste das. Routine hält dich davon ab, die Dinge an dich heranzulassen. Sie persönlich zu nehmen. Routine macht dir klar, dass du hier deinen Job erledigst und sonst nichts. Du bist nicht hier, um berührt zu sein. Du bist hier, um ein Verbrechen aufzuklären. Das machst du, so gut du es kannst, und dann hast du Feierabend und gehst nach Hause und denkst nicht länger darüber nach.
Claudia war klar, dass es diesmal anders sein würde. Vielleicht nicht für sie, aber ganz bestimmt für Takeda. So hatte sie ihn noch nie erlebt. Er stand kurz davor, die Fassung zu verlieren.
Nicht, dass Takeda etwas in der Richtung gesagt hätte. Aber sie kannte ihn inzwischen gut genug.
Der Tag, an dem sie ihn damals vom Flughafen abgeholt hatte, ihn zum ersten Mal gesehen hatte, lag nun über ein halbes Jahr zurück. Seitdem war viel geschehen. Sie hatten drei Fälle zusammen gelöst, hatten unendliche Stunden miteinander verbracht, hatten zusammen ermittelt, Zeugen befragt, Protokolle geschrieben. Doch sie waren auch zusammen im Kino gewesen, hatten Zeit verplempert, sich betrunken. Und sie hatten sich geküsst. Er hatte ihr das Leben gerettet.
Und jetzt stand Ken vor ihr und sein Gesicht war völlig versteinert. Nichts bewegte sich daran, nicht das kleinste Zucken, kein Zittern. Er war wie eingefroren, schien kaum zu atmen.
Was jetzt half? Routine.
Claudia rempelte Takeda freundschaftlich an, da kannte sie nichts. Sie sagte: »Der Tote ist von einem Wachmann gefunden worden, vermutlich hat der sogar den oder die Mörder gesehen. Ich habe vorhin schon kurz mit ihm gesprochen. Wir sollten ihn noch einmal ausführlicher vernehmen. Warten wir nicht zulange, noch ist die Erinnerung des Mannes frisch.«
Takeda trank nun doch von seinem Kaffee, trank mit großen, gierigen Schlucken. Dann zerknäulte er den Pappbecher und sah sich nach einer Möglichkeit um, ihn wegzuwerfen. Claudia nahm ihm wortlos den Becher aus der Hand, blickte sich kurz um, warf ihn dann durch die geöffnete Seitenscheibe in den Fußraum eines der abgestellten Streifenwagen. »Die Kollegen kümmern sich später drum.«
Immerhin, Takeda lächelte zum ersten Mal. Claudia. Bei jedem anderen Menschen würde so ein Verhalten tiefes Unverständnis in ihm auslösen. Missbilligung. Ach, bei ihr ja eigentlich auch. Aber trotzdem … sie war, wie sie war, und das war gut so. Überhaupt, es war gut, dass sie da war.
Der Wachmann hieß Rüdiger Stork. Er war Ende sechzig, bezog jedoch eine so kleine Rente, dass er seine Nächte damit verbrachte, durch Hamburg zu fahren und in Gewerbeimmobilien nach dem Rechten zu sehen. Dazu hatte man ihm eine Uniform verpasst, die wohl kaum jemanden beeindruckte, und eine Dienstmütze, die so groß war, dass sie ihm über die Augen rutschte und er sie ständig nach oben schieben musste.
»Meine Frau hatte einen Schlaganfall und war ein Pflegefall. Dafür ist unser Erspartes draufgegangen. Sie ist vor zwei Jahren gestorben. Seitdem steht es eh nicht gut um meinen Nachtschlaf. Also kann ich genauso gut im Auto sitzen und ein paar Euro dazu verdienen.«
»Ja, natürlich, Herr Stork. Das Grundstück liegt also auf Ihrer üblichen Strecke?«, fragte Claudia.
»Richtig. Zweimal in der Nacht fahre ich auf den Hof und sehe mich um. Ich steige aus und überprüfe die Türen und Fenster zu den Werkstätten.«
»Um wieviel Uhr sind Sie heute hier eingetroffen?«
Stork sah auf seine altmodische Armbanduhr. »Das muss so um zwanzig nach elf gewesen sein. Es war die erste Station meiner Runde.«
»Sie beginnen immer hier?«
Stork schüttelte den Kopf. »Die Touren ändern sich jeden Tag. Die Zentrale gibt mir die Reihenfolge vor. Sie wissen schon, damit wir nicht ausgespäht werden. An jedem Objekt gibt es ein Relais, vor das ich meinen Chip halte. Dann wissen die Chefs, dass ich hier war. Wenn ich auch nur ein bisschen zu spät bin, rufen sie mich auf dem Handy an und wollen wissen, was los ist. Gerade mal Mindestlohn, aber die totale Kontrolle. So funktioniert das.«
»In Ordnung, was genau ist passiert, als Sie hier waren?«
»Passiert? Gar nichts. Wenn ich es richtig sehe, war der schon tot, als ich ankam.«
»Aber Sie haben ein anderes Auto gesehen? Das haben Sie vorhin jedenfalls erwähnt.«
»Ja, da war ein anderer Wagen.«
Claudia rollte mit den Augen. Das hier würde zäh werden. Und Ken war nicht unbedingt eine Hilfe. Er wirkte immer noch wie benommen. Jetzt beugte sich der Inspektor sogar zu ihr, fragte, ob sie die Befragung doch allein vornehmen könnte.
»Klar, kein Problem. Bist du in Ordnung?, fragte Claudia.
»Ich bin okay. Ich möchte nur etwas ausprobieren. Es ist … ein Gefühl«, erklärte Takeda.
»Klar. Dann mache ich hier allein weiter.«
Er nickte ihr noch einmal zu, ging dann hinüber zur Mitte des Hofes, wo die Rechtsmediziner sich bereit machten, die Leiche abzutransportieren. Wenn Claudia es richtig beobachtete, signalisierte Takeda den Kollegen, damit noch zu warten. Sie wandte sich wieder an Stork. »Schildern Sie mir doch bitte noch einmal, wie das war, als Sie hier angekommen sind. Denken Sie auch an Kleinigkeiten, selbst wenn Sie Ihnen unwichtig vorkommen.«
»Sicher, mache ich. Aber vorher …« Stork warf einen Blick in Takedas Richtung. »Ist Ihr Kollege auch Japaner? Wie der Tote?«
»Ja.«
»Ist das neuerdings so bei der Polizei? Für jedes Land habt ihr den richtigen Kollegen, oder was? Wenn also ein Türke umkommt, holt ihr einen Türken?«
Claudia musste lachen. »Ganz so ist es nicht. Es ist ein Austauschprogramm mit Tokio. Aber lassen wir das, Herr Stork. Gehen Sie davon aus, dass Ihre Aussage wahrscheinlich die heißeste Spur ist, die wir haben. Es ist also wirklich wichtig, dass Sie sich konzentrieren.«
»Schon gut, min Deern. Ich bin also noch vor halb zwölf mit dem Wagen von der Straße auf den Hof gebogen. Da habe ich dann schon gesehen, dass da ein Auto mitten auf dem Gelände stand. Die Scheinwerfer waren angeschaltet. Ich dachte, der gehört jemandem, der in einer der Firmen hier Überstunden macht. Als ich dann selbst angehalten habe, hat der plötzlich Vollgas gegeben und ist an mir vorbeigerauscht. Hat mich zwar geärgert, aber ich hab mir nichts dabei gedacht. Da hatte es wohl einer eilig. Dann bin ich ausgestiegen und sehe ihn da liegen.«
»War Ihnen klar, dass der Mann tot war?«
»Zuerst habe ich ja nicht mal wirklich erkannt, dass das ein Mensch ist. War ja schon dunkel. Hätte ja auch ein Kleiderbündel sein können.«
»Was haben Sie als Nächstes gemacht?«, fragte Claudia. Sie sah hoch und beobachtete, wie Takeda drüben vor dem Toten stand, dann plötzlich das Gleichgewicht verlor und hinfiel. Claudia sprang auf die Beine, rief: »Ken? Ken! Ist alles in Ordnung?«
Auch die übrigen Kollegen starrten auf den Inspektor, der nun auf dem Boden lag, einige stürzten auf ihn zu, um ihn zu helfen. Auch Claudia wollte schon losspurten, aber Takeda hob die Hand und rief: »Es ist alles in Ordnung. Mir geht es gut. Es ist ein Experiment.«
Claudia schüttelte ungläubig den Kopf. So schlecht ging es ihm wohl doch nicht. Sie wandte sich wieder Stork zu: »Also, wie war das jetzt?«
»Ich bin näher rangegangen und hab die Taschenlampe eingeschaltet. Dann war mir klar, dass da eben doch einer lag. Und dass dem nicht mehr zu helfen war.«
»Sie haben dann unmittelbar die Polizei verständigt?«
»Ja. Das heißt, ich habe erst einmal in der Zentrale angerufen.«
»Ach. Und warum?«
»Dienstvorschrift. Ist vielleicht nicht offiziell, aber die Chefs erwarten es. Bei unvorhergesehenen Vorkommnissen sollen wir uns rückversichern.«
»Haben Sie überprüft, ob der Mann am Boden wirklich tot war? Er könnte ja auch noch gelebt haben. Haben Sie nicht darüber nachgedacht, ob Sie eine Ambulanz anrufen sollten?«
»Doch, habe ich. Ich habe mich runtergebeugt und ihn mir angesehen. Jetzt mal ehrlich, man muss kein Arzt sein, um zu sehen, dass da nichts zu machen war, oder?«
Claudia nickte und machte sich ein paar Notizen. Hinten war Takeda wieder auf die Füße gekommen, ging jetzt in die Hocke und ließ sich erneut fallen. Allmählich ahnte Claudia, was er da trieb.
»Tragen Sie eigentlich eine Waffe?«, fragte sie Stork.
»Keine Pistole, aber Pfefferspray. Und einen Gummiknüppel. Den lasse ich allerdings lieber im Wagen, wenn ich aussteige. Macht nicht so viel Eindruck, wenn ein fast Siebzigjähriger damit rumfuchteln würde, oder?«
»Nein, vermutlich nicht«, sagte Claudia. Sie musste lächeln und verspürte zum ersten Mal so etwas wie Sympathie für den alten Mann. »Wollen Sie eigentlich einen Kaffee?«
»Da sag ich nicht nein.«
Claudia rief zu einem der uniformierten Polizisten hinüber, dass er sich um das Getränk kümmern sollte. Der Kollege murrte, rief zurück, dass er kein Kellner sei, worauf Claudia erwiderte, dass sie dafür sorgen werde, dass er bald nur noch kellnern würde. Kurz darauf brachte der Kollege ein Tablett, nicht nur mit einem Kaffee, sondern gleich mit zwei. Claudia bedankte sich und entschuldigte sich für ihren Spruch. Der Kollege winkte ab. Sie nahm einen Schluck und sah, wie Takeda weiter über den Boden kugelte und in immer neuen Positionen zum Liegen kam.
»Ich will noch einmal auf den Wagen zurückkommen, der ja, wie Sie sagen, im Augenblick Ihres Eintreffens noch auf dem Hof stand, richtig?«, fragte sie den Wachmann.
»Das ist korrekt.«
»Wissen Sie, was es für ein Modell war? Erinnern Sie sich an die Farbe? Irgendwelche Details?«
»Nicht wirklich. Vielleicht war er so hellbraun. Oder beige. Der hatte ja die Lichter an, so richtig konnte ich ihn also nicht erkennen.«
»Groß? Klein? Kombi? Sportwagen? Kleinbus?«
»Es war ein größerer Wagen. Hätten wir früher wohl einen Jeep genannt. Heute nennen sie das Suff, glaube ich.«
»Sie meinen einen SUV, oder?«
»Genau.«
»Als der Wagen gestartet ist, konnten Sie da noch etwas erkennen? Wieviele Personen drinsaßen? Oder wer am Steuer war? Mann? Frau? Haarfarbe? Hautfarbe? Irgendetwas?«
»Nein, gar nichts. Der ist ja mit Vollgas an mir vorbeigerauscht.«
Claudia atmete tief ein und seufzend wieder aus. Takeda war drüben dazu übergegangen, auf dem Boden liegen zu bleiben und die Position des Toten zu imitieren. Es nötigte Claudia ein Lächeln ab, immerhin wusste sie, wie pingelig Ken mit seiner Kleidung war. Auch heute trug er einen Anzug, darüber seinen Trench. Den würde er morgen zur Reinigung bringen müssen. Falls er nicht ganz ruiniert war.
Claudia warf einen Blick auf ihre Notizen, sagte dann: »Sie haben vorhin gesagt, dass der Wagen zu dem Zeitpunkt, als sie auf den Hof fuhren, nicht in Bewegung war, sondern stand. Ist das richtig?«
»Ja.«
»Wie genau stand der Wagen?«
»Was?«
»Wie genau? Ich vermute ja, dass er so stand, dass Sie den Toten zunächst nicht sehen konnten.«
»Stimmt. Der Wagen stand davor. Den Matsu sah ich erst, als der Wagen weg war und ich zu Fuß über den Hof ging.«
»Haben Sie den Toten erkannt?«
»Sicher. Wer nicht? Ich lese die Zeitung. Auch den Sportteil.«
»Okay, gut. Aber noch mal zum Wagen. Der stand seitlich zu Ihnen, ist das richtig?«
Stork kaute nachdenklich auf der Unterlippe, nickte dann. »Ja, schräg, seitlich. Die Lichter waren an.«
»Haben Sie zu dem Zeitpunkt Personen auf dem Hof gesehen? Oder saßen welche im Auto?«
Der Wachmann überlegte kurz. »Da war niemand auf dem Hof. Oder wenn doch, dann haben sie hinter dem Auto gestanden. Ich habe jedenfalls niemanden gesehen.«
»Sie sagen sie, als wenn Sie sicher wären, dass es mehr als eine Person war. Wie kommen Sie darauf?«
Claudia spürte, dass Stork unter ihren Fragen zunehmend nervös wurde. Es half jedoch nichts. Sie konnte ihm das hier nicht ersparen. Oft erinnerten die Leute sich an mehr, als ihnen selbst bewusst war. Es kam darauf an, die richtigen Fragen zu stellen.
»Eine Person? Oder mehrere? Ich weiß es nicht, Frau Kommissarin. Ich habe ja niemanden gesehen. Und dann waren die oder der ja auch schon weg.«
Claudia machte sich erneut ein paar Notizen, nickte dann und sagte mehr zu sich selbst: »Es könnte gut sein, dass Sie den oder die Täter überrascht haben. Gut möglich, dass sie den Toten ansonsten gar nicht hier hätten liegen lassen. Und wir hätten ihn vermutlich erst in ein paar Tagen gefunden. Oder auch gar nicht.«
Der alte Mann sah Claudia ängstlich an, fragte: »Heißt das, ich muss vielleicht vor Gericht? Eine Aussage machen? Jemanden identifizieren und so etwas? Und die erfahren dann meinen Namen?«
Claudia schnaubte leise. »So weit sind wir noch lange nicht, Herr Stork. Und wenn es soweit ist, werden wir sehen, ob Ihre Aussage nötig ist. Aber kommen Sie bloß nicht auf die Idee, etwas zu verschweigen, nur weil Sie Angst haben.«
»Dann hätte ich doch von Anfang an die Klappe gehalten.« Stork blickte auf die Uhr, fragte dann: »Kann ich jetzt eigentlich los? Meine Runde weitermachen?«
Claudia blickte den alten Mann überrascht an, sah dann zu dem Sanitäter, der einige Meter weiter entfernt im Rettungswagen saß. Er hatte Stork vorhin untersucht, zuckte jetzt mit den Schultern. »Sie wollen heute Nacht noch arbeiten? Reicht es Ihnen denn nicht, was Sie erlebt haben?«
»Darauf können Sie einen lassen, dass mir das reicht. Aber wenn ich die Runde nicht zu Ende mache, gibt’s kein Geld für heute Nacht. Das kann ich mir nicht leisten.«
Claudia sah Stork kopfschüttelnd an. »Ich kann Ihnen gerne eine Bestätigung schreiben, dass wir Sie gebraucht haben.«
Stork lachte heiser. »Wird meine Chefs bestimmt beeindrucken … Nee, lassen Sie mal.«
»Wie auch immer, noch brauche ich Sie. Ich möchte noch einmal auf das Auto zu sprechen kommen. Sie sagten ja bereits, dass es ein SUV war. Fällt Ihnen noch irgendetwas dazu ein? Eine auffällige Antenne? Ein Spoiler? Eine Beschriftung oder irgendein anderes markantes Detail?«
Stork runzelte die Stirn, nickte dann langsam. »Jetzt, wo Sie es sagen. Da war eine Schrift auf der Seite des Wagens. Ich erinnere mich.«
»Was stand drauf?«
Stork presste die Lippen zusammen, dachte nach. »Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nicht drauf geachtet. Ging ja auch ganz schnell. Aber da war eine Schrift, da bin ich mir sicher.«
Claudia hörte die Stimmen der Kollegen von der Rechtsmedizin, die um Takeda herumstanden, dann kurz applaudierten. Claudia traute ihren Ohren nicht. Sie bedankte sich bei Stork und bat ihn, dem uniformierten Kollegen seine Personalien zu geben. Sie ging hinüber zu der Stelle, an der Takeda und die übrigen Kollegen standen. Der Inspektor, der sie kommen sah, sagte: »Sieh mal, Claudia. Wir haben da etwas.«
Takeda kniete sich hin, und zwar auf eine Art, wie sie es bei ihm bisher nur im Dōjō gesehen hatte. Er klemmte die Fersen unter sein Gesäß, drückte die Knie auseinander, so dass seine Oberschenkel eine Art Dreieck bildeten. Dann ließ Takeda einen der Kollegen hinter sich treten. Der simulierte einen von seitlich hinten abgegebenen Schuss mit aufgesetzter Waffe. Takeda bäumte sich auf, fiel nach vorne, blieb schließlich mit angewinkelten Beinen und leicht verkrümmtem Oberkörper liegen.
Genauso hatten sie Ryūtarō Matsumoto vorgefunden.
Takeda kam wieder auf die Füße, sagte dann mit einer Stimme, der seine ungeheure Anspannung immer noch anzuhören war: »Das hier war kein Raubüberfall, Claudia. Es war auch kein Zufall, kein tragisches Versehen oder sonst etwas. Es war eine Hinrichtung.«
5.
Als Takeda den Schlüssel seines Wagens herumdrehte, sprang der Motor an und in der gleichen Sekunde drang Musik aus den Boxen. Jazz. Charlie Parker.
Claudia, die auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte, wollte eine spöttische Bemerkung machen. Keine Schlagermusik? Kein Semino Rossi? Keine Vanessa Mai? Dann aber beschloss sie, nichts zu sagen und die Musik zu genießen. Sie passte zu diesem Abend, zu dieser Nacht. Sie beruhigte.
Takeda lenkte den Wagen in Schrittgeschwindigkeit vom Hof, passierte dabei Claudias Peugeot. Sie hatte beschlossen, ihren Wagen stehen zu lassen und später oder auch morgen abzuholen.
Direkt außerhalb der Einfahrt stand eine Meute Pressevertreter, die wütend eingelassen werden wollten. Die uniformierten Kollegen hatten alle Hände voll damit zu tun, sie zurückzudrängen und davon abzuhalten, auf dem Gelände wichtige Spuren zu zerstören. In kleinen Gruppen wurden sie nach und nach auf den Hof gelassen, um aus genügend Abstand Fotos zu machen. Um es auf die Titelseiten am nächsten Morgen zu schaffen, war es vermutlich schon zu spät, dachte Claudia. Aber wen interessierte das heutzutage überhaupt noch? Zeitungen las doch sowieso niemand mehr. Das Internet hingegen wurde bestimmt jetzt schon mit den ersten Meldungen überflutet.
Für die Menschen war die neue Informationsfreiheit sicherlich ein Fortschritt. Nachrichten, allzeit und überall verfügbar. Für die Polizei hieß es aber eben auch, dass ruhige Ermittlungen jenseits der Öffentlichkeit nicht mehr möglich waren. Schon gar nicht, wenn das Opfer prominent war. Schlimmer als die Nachrichtenportale waren die sozialen Netzwerke. Die Leute schrieben sich dort nach jedem spektakulären Verbrechen die Finger wund. Erst kam die Lawine der Trauerbekundungen, dann die des Hasses und schließlich die der Kritik an den Ermittlungsbehörden. Es war jedes Mal dasselbe. Wenn eine Tat nicht binnen Stunden aufgeklärt war, gab es immer die Idioten, die der Polizei Unfähigkeit vorwarfen. Meistens waren es dieselben, die dann en passant das Todesurteil für den Täter oder die Täterin forderten. Natürlich bevor überhaupt klar war, was genau eigentlich passiert war und wer möglicherweise die Schuld daran trug … bis zur Lynchjustiz war es von da nur noch ein kleiner Schritt.
Claudia schüttelte ihre Gedanken ab und blickte aus dem Fenster. Sie bewegten sich in westlicher Richtung nach Halstenbek, einer kleinen Gemeinde außerhalb Hamburgs, in der viele Japaner wohnten. Dort gab es sogar eine japanische Schule, wie Takeda ihr einmal erzählt hatte. Auch Ryūtarō Matsumoto hatte dort eine Wohnung gemietet, wie sie dem Ausweis des Fußballers hatten entnehmen können. Den hatten sie – zusammen mit weiteren persönlichen Gegenständen – in der Innentasche seiner Jacke gefunden, die ein paar Meter vom Fundort der Leiche entfernt gelegen hatte, und zwar genauso feinsäuberlich zusammengefaltet, wie es Takeda normalerweise auch immer mit seiner Kleidung tat.
Sie mussten ein kurzes Stück auf die Autobahn. Claudia beugte sich nach vorne und stellte die Musik leiser, sagte zu Takeda: »Erzähl mir, was du über Matsumoto weißt, Ken. Du hast, glaube ich, einen ziemlichen Wissensvorsprung. Ich schätze mal, so gut wie jeder hat einen Wissensvorsprung im Vergleich zu mir.«
Takeda warf ihr einen fragenden Seitenblick zu. »Jeder?«
»Jeder, der sich für Fußball interessiert. Trifft für mich leider nicht zu.«
»Aber wir waren zusammen bei St. Pauli im Stadion. Ich dachte, du bist Fan?«
Claudia lachte. »Pauli ist etwas anderes. Da geht’s um die Atmosphäre, und von der bin ich wirklich Fan. Was die Männer auf dem Rasen machen, ist mir ziemlich egal.«
Das war die reine Wahrheit. Die Stimmung im Millerntor-Stadion war einzigartig. Sie erinnerte Claudia an ein Rockkonzert. Es war einfach umwerfend, wenn die Spieler zu Hells Bells von AC/DC ins Stadion einliefen. Gänsehaut garantiert, unabhängig davon, dass es dabei eigentlich um Fußball ging. Ihr war es im Übrigen zu verdanken, dass Ken neuerdings an kalten Tagen immer eine St.-Pauli-Pudelmütze trug. Er sah einfach umwerfend damit aus.
»Das heißt, du könntest nicht einmal sagen, wo St. Pauli in der Tabelle steht? Oder der HSV?«, fragte Takeda.
»Tabelle? Habe ich schon mal von gehört, dass es so etwas gibt. Aber wo die stehen? Ich habe nicht die geringste Ahnung.«
»Ich verstehe«, sagte Takeda trocken. »Dann also ein bisschen Nachhilfe in Sachen Fußball oder genauer gesagt in Sachen Ryūtarō Matsumoto. Er stammt, wenn ich mich richtig erinnere, aus Saitama. Das ist gar nicht weit von Tokio entfernt. In Japan nennen ihn seine Fans nur Ryū oder auch Za Duragon!«
»Za was?«
Takeda räusperte sich, versuchte es etwas deutlicher: »The Dragon. Das ist Englisch. Soll es jedenfalls sein. Der Drachen.«
»Ach so, sag das doch gleich.«
»Hab ich versucht. Englisch ist für uns Japaner, nun ja, nicht einfach.«
»Genau wie für uns Deutsche. Aber egal, weiter.«
»Matsumoto hat seinen Spitznamen wegen des ersten Schriftzeichens, mit dem sein Vorname Ryūtarō geschrieben wird. Ryū. Es bedeutet Drachen. Den Spitznamen Matsu hat er nur hier in Deutschland.«
»Cooler Name. Der Drachen.«
»Matsu war schon als junger Spieler sehr talentiert. Seine Karriere begann bei Jef United in Chiba. Dann ist er zu den Urawa Reds in seine Geburtsstadt nach Saitama gewechselt. Dort war er dann zwei oder dreimal hintereinander Torschützenkönig der J-League, also der obersten Liga in Japan. Das ist gar nicht so lange her. In der Zeit ist er zum Superstar geworden, auch außerhalb des Sports. Du kannst in Japan praktisch keine Fernsehsendung sehen, ohne dass in der Werbeunterbrechung ein Spot mit Matsu läuft. Wir Japaner machen sowieso gerne Werbung mit Prominenten, und Matsu ist einer der begehrtesten. Er ist das Werbegesicht für grünen Tee, für Bier, für Instant-Nudelsuppen, Sportkleidung, Anzüge, Fertighäuser, was weiß ich. Dass er letztes Jahr nach Deutschland gewechselt ist, war natürlich eine Sensation.«
»Wobei er bei weitem nicht der Einzige war, oder? Ich meine, in der Bundesliga spielen doch inzwischen ziemlich viele Japaner. Das weiß ja sogar ich, die keine Ahnung von Fußball hat.«
»Ja, das stimmt. Sogar in den unteren Ligen spielen mittlerweile viele meiner Landsleute. Ich habe Matsus Wechsel im letzten Jahr auch deshalb genau verfolgt, weil er ja nur wenige Monate vor mir hier nach Hamburg gekommen ist. Ich erinnere mich, dass er in einem Interview sagte, dass er auch deshalb in die Bundesliga wechsele, weil er Deutschland bewundere. Er hat sich übrigens dann auch sehr darum bemüht, Deutsch zu lernen.«
»Und weißt du etwas über sein Privatleben?«
»Sagen wir es mal so. Er ist … er war einer der begehrtesten Junggesellen Japans. Er ist reich, sieht gut aus und gilt auch noch als Musterbeispiel an Tugendhaftigkeit.«
»Und jetzt ist er tot«, sagte Claudia.
Takeda nickte betroffen. »Du kannst jetzt vielleicht noch ein wenig besser einschätzen, was die Nachricht in Japan auslösen wird.«
»Allerdings. Wie du sagtest, als wenn Müller oder Boateng ermordet worden wären,«, erwiderte Claudia.
Einige Augenblicke der Stille folgten. Beiden war klar, dass die Ermittlungen diesmal noch viel mehr vor den Augen der Öffentlichkeit stattfinden würden als ohnehin schon. Diesmal sah ihnen die ganze Welt, zumindest die ganze Fußballwelt auf die Finger.
»Du meintest ja, dass er reich ist«, nahm Claudia den Faden wieder auf. »Hast du vorhin sein Auto gesehen? Es stand am Rand vom Hof.«
»Ja, natürlich. Ein Golf. Ein deutsches Auto also.«
»Ob nun deutsch oder japanisch oder sonstwas, das meine ich nicht. Aber eben ein Golf …«
»Du findest, das ist kein Wagen für einen erfolgreichen Promi?«
»Natürlich nicht. Die Fußball-Millionäre fahren doch sonst alle mit Porsches oder Hummern herum. Protzkarren. Und unser japanischer Superstar tuckert in einem Golf herum? Das fällt schon auf.«
Takeda lächelte. »Denk daran, dass Matsu als besonders tugendhaft galt. Er war sicherlich zigfacher Millionär, aber er lebte dennoch sehr bescheiden. Das wurde immer wieder in den Medien thematisiert, und dafür liebten ihn seine Fans. Alles, wofür er sich interessierte, war der Sport. Da gab er wirklich alles, bis zum Letzten. Wenn er in einem Spiel mal wieder das entscheidende Siegtor geschossen hatte und dann von den Reportern gefragt wurde, wie es ihm ging, sagte er meistens: Shōrai ni motto gambaritai to omoimasu.«
»Und was heißt das?«
»Dass er sich in der Zukunft noch mehr anstrengen möchte. Das sagen japanische Sportler immer, aber Matsu meinte es ernst. Er wollte sich nie auf seinen Erfolgen ausruhen, sondern sich immer weiter verbessern.«
Claudia pustete die Wangen auf, ließ dann die Luft geräuschvoll entweichen. »Trotzdem hat diesem großen Vorbild jemand ein Loch in den Kopf geschossen. Entweder war der Täter von Matsus Tugendhaftigkeit so genervt, dass er sie nicht ertragen hat. Oder – und das halte ich für wahrscheinlicher – das Bild, das du von ihm entwirfst, ist nicht ganz vollständig.«
Claudia spürte, dass ihre Worte Takeda einen Stich versetzten. Ihr war klar, dass der Inspektor normalerweise die gleichen Schlussfolgerungen gezogen hätte wie sie. Nur im Falle eines Landsmannes schien es ihm schwerzufallen. Klar, das hatte er ihr schon bei anderer Gelegenheit erklärt. Japaner gingen immer erst einmal davon aus, dass sie und ihre Landsleute nichts Unrechtes taten, also weder stahlen noch betrogen noch mordeten … Als Polizeibeamter wusste Takeda natürlich, dass das nicht stimmte, doch Reste dieses unerschütterlichen Glaubens an die eigene Rechtschaffenheit besaß offenbar auch er.
Der Inspektor wollte soeben etwas erwidern, als die Stimme des Navigationsgerätes zu hören war. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
6.
Ryūtarō Matsumotos Wohnung befand sich in einem typisch norddeutschen, rot geklinkerten Mehrfamilienhaus in einer unscheinbaren Seitenstraße. Genau wie sein Golf wollte die Unterkunft so gar nicht zur Vorstellung eines millionenschweren, mit Werbeverträgen überhäuften Spitzensportlers passen.
Für das Innere der Wohnung, zu der Claudia und Takeda sich mit dem Schlüssel, der sich ebenfalls bei Matsumotos Sachen befunden hatte, Zugang verschafften, galt dasselbe. Dort erwartete sie ein heilloses Durcheinander. Angefangen vom Flur über das Wohn- bis hin zum Schlafzimmer derselbe Anblick. Überall lagen Kleider, Schuhe, Unterwäsche herum, dazu unzählige Verpackungen von Instant-Nudelsuppen, Zeitungen, Bücher, Manga-Hefte, Dosen mit Nahrungsergänzungsmitteln, Kisten mit Modellbausätzen von Flugzeugen und Schiffen, Hanteln und andere Sportgeräte.
Das Durcheinander war so gewaltig, dass Claudia im ersten Moment glaubte, sie wären nicht die ersten Besucher in der Wohnung und jemand hätte die Räume auf der Suche nach etwas durchwühlt. Aber dazu passte nicht, dass die Möbel unangetastet waren. Keine Schublade war herausgerissen, keine Schranktür offen oder aus den Angeln gerissen. Nein, hier war einfach nur jemand sehr, sehr unordentlich.
Claudia stand inmitten des Chaos und sagte zu Takeda: »Sieht aus wie bei dir, findest du nicht?«
Takeda errötete. »So schlimm? Ich meine, bei mir?«
»Schon. Kann es sein, dass ihr Japaner nicht so auf Aufräumen steht?«
»Das ist möglich, aber noch wahrscheinlicher ist, dass alleinstehende Männer nicht auf Aufräumen stehen.«
Claudia prustete. »Es gibt ein deutsches Sprichwort. Ist ganz kurz, kann man sich darum gut merken: Männer sind Schweine.«
Takeda grinste. »Bezieht sich das nicht eher auf den Umgang mit Frauen?«
»Vermutlich. Passt aber zu beidem.«
Takeda wurde wieder ernst und sagte: »Dass jemand wie Matsumoto keine Zeit zum Aufräumen hat, finde ich naheliegend. Dass er sich aber keine Putzfrau leistet, ist sonderbar. Am Geld kann’s kaum liegen.«
Claudia zog ein paar Latexhandschuhe über, stakste dann ziellos durch die Unordnung. Hier und da nahm sie etwas in die Hand, legte es dann wieder sorgsam an denselben Platz zurück. Vermutlich war es wirklich so, wie Takeda vermutete. Hier lebte einfach ein junger, alleinstehender Mann, der alles Mögliche im Kopf hatte, aber eben nicht, für Ordnung zu sorgen. Ken war wirklich genauso, davon hatte sie sich bei ihren Besuchen in seiner Wohnung überzeugen können. Allerdings musste man auch dazu sagen, dass Ken selbst, trotz des Chaos in seinen Zimmern, immer peinlich gepflegt und tadellos gekleidet war. Vermutlich war es bei Matsumoto genauso gewesen. Zuhause ein Schwein, aber draußen der schöne Schein.
Kein Wunder, dass diese Marie Kondo in Japan ein Superstar war und mittlerweile ja auch weltweit bekannt geworden war. Sie hatte aus dem Aufräumen eine Wissenschaft gemacht – vermutlich war es die einzige Art, wie man es den Japanern schmackhaft machen konnte.
Claudia war in das Wohnzimmer getreten und blickte sich unschlüssig um, als sie zu ihrer Überraschung auf dem flachen Couchtisch im Wohnzimmer ein Smartphone entdeckte. War das Matsumotos Gerät? Und wenn ja, warum hatte er es nicht mitgenommen, als er das Haus verlassen hatte?
Sie nahm das Gerät in die Hand, stellte fest, dass es per Gesichtserkennung gesperrt war. Sie wollte gerade Takeda rufen, als der ihr zuvorkam und von nebenan nach ihr rief. Er hatte kurz zuvor den dritten und kleinsten Raum der Wohnung betreten, dessen Tür als einzige verschlossen gewesen war. »Claudia? Komm doch mal rüber. Das hier ist interessant.«
Claudia steckte das Smartphone in die Tasche, ging über den Flur in das kleinste Zimmer der Wohnung – und war erstaunt.
Der Raum hatte vielleicht acht Quadratmeter und war anders als die übrigen Zimmer makellos aufgeräumt und blitzsauber. Außerdem war er mehr oder weniger leer. Im schwachen Licht einer kleinen Stehlampe sah Claudia nur ein einziges Sitzkissen, das mitten im Raum auf dem Boden lag, dazu stand an der Wand ein schmales Sideboard. Mehr nicht. In der Luft hing ein entfernter Duft nach Räucherwerk, vermischt mit Noten von Sandelholz, die sie an Takedas Rasierwasser erinnerten.
Claudia trat vor ein Plakat, das als einziger Wandschmuck an der Stirnseite des Zimmers hing, betrachtete es und schreckte regelrecht zurück. »Was für eine Scheiße ist das denn? Von wegen der tugendhafte Musterknabe Matsumoto …«
»Ich verstehe nicht«, sagte Takeda.
»Sieh doch hin.« Claudia deutete auf das Plakat, auf dessen oberer Hälfte ein riesiges Hakenkreuz zu sehen war, etwas kleiner darunter eine Buddhafigur, die vor einer Palme saß und meditierte. »Wir haben es ja wohl mit einem Nazi zu tun, oder? Gibt es das? Japanische Nazis?«
Takeda starrte abwechselnd zu Claudia und auf das Plakat, er brauchte wohl einige Zeit, um ihre Gedanken nachvollziehen zu können. Dann lachte er auf und erklärte kopfschüttelnd: »Natürlich gibt es japanische Nazis, sogar mehr, als man sich wünscht. Aber ich glaube nicht, dass Matsumoto einer war.«
»Und was soll dann das da?«
»Das ist ein Missverständnis. Das Hakenkreuz hat nichts mit Nazis zu tun. Es ist in Japan ein Symbol für den Buddhismus. Und sieh genau hin, die Haken zeigen in die andere Richtung als bei den Nazis, nämlich nach links.«
Claudia beugte sich vor, zuckte dann mit den Schultern. »Stimmt, du hast recht. Es ist andersrum. Wäre mir gar nicht aufgefallen.«
Takeda hob vielsagend die Augenbrauen. »Du bist nicht die Erste, die darauf hereinfällt. In meiner Heimat gibt es sogar Überlegungen, das Symbol eben deswegen nicht mehr zu benutzen. Auf Straßenkarten und Hinweisschildern, die zu Tempeln führen, ist es immer drauf. Aber es führt zu oft zu Missverständnissen, vor allem bei ausländischen Touristen.«
»Okay, verstehe«, sagte Claudia. »Dann war Matsu also kein Nazi, sondern einfach nur Buddhist.«
»So sieht es aus. Offenbar sogar ein aktiv praktizierender. Ich denke, er hat in diesem Raum meditiert.«
Takeda betrachtete nun seinerseits das Plakat eingehender, sog zischend die Luft zwischen den Zähnen ein und stieß dazu nachdenkliche Brummlaute aus. Dann fuhr er mit dem Finger die kalligraphischen Schriftzeichen entlang, die neben Hakenkreuz und Buddha von oben nach unten liefen, murmelte dabei einige Silben vor sich hin.
»Was steht da?«, fragte Claudia.
»Ich bin mir nicht sicher. Es ist eine sehr schöne Kalligraphie, aber sie ist schwer zu lesen. Könnte sein, dass es ein Auszug aus einer buddhistischen Sutra ist. Ich müsste im Internet recherchieren oder jemanden fragen, der sich besser mit so etwas auskennt.«
Claudia merkte, dass Takeda seltsam nachdenklich geworden war. Sie wartete auf eine Erklärung, die jedoch unterblieb.
»Okay, vielleicht schaffst du es ja doch noch, die Zeichen zu entziffern. Ich sehe mich in der Zeit weiter drüben um«, sagte Claudia. Sie warf Takeda noch einen Blick zu, doch der war immer noch völlig in die Betrachtung des Plakats versunken. Schulterzuckend ließ sie ihn allein und kehrte ins Wohnzimmer zurück.
Claudia nahm wieder ein paar Dinge in die Hand, fand aber nichts, das interessant wirkte. Auf dem mit Unterlagen übersäten Schreibtisch stand ein Computer, daneben lagen stapelweise Briefe und Papiere, die meisten davon in Japanisch. Gut, dass sie Takeda an ihrer Seite hatte. Der konnte das ja zum Glück alles lesen und dann entscheiden, ob es wichtig war oder nicht.
Claudia kehrte in den Flur zurück. Sie warf einen Blick auf ihre Uhr, es war inzwischen fast drei Uhr früh. Sie sollten für heute Schluss machen. Morgen mussten sich die Kollegen von der Spurensicherung die Wohnung sowieso noch einmal vornehmen. Vielleicht fanden die ja noch etwas Interessantes. Außerdem sollten sie sämtliche Papiere und Unterlagen in Kisten packen und ins Präsidium bringen, wo Ken sie dann durchsehen könnte.
Claudia rief zu Takeda hinüber, dass sie aufbrechen wollte. Der gab sich einverstanden, ging nun seinerseits noch einmal in das Wohnzimmer, wo er einige Unterlagen, die ihm spontan wichtig erschienen, zusammenklaubte, um sie spätestens morgen früh durchzugehen.
Sie wollten die Wohnung gerade verlassen, als sie vom Klingeln eines Handys aufgehalten wurden.
Takeda sah Claudia fragend an. »Ich glaube, es ist deins.«
»Nein, ist es nicht.«
Takeda deutete auf die Tasche ihres Blazers, aus der das Klingeln kam. Erst jetzt begriff Claudia, dass es das Handy war, das sie auf dem Wohnzimmertisch gefunden hatte. Sie holte das Gerät aus der Tasche. Im Display wurden kein Name und keine Nummer angezeigt, dafür ein paar japanische Schriftzeichen. Sie drehte das Display zu Takeda, der sah kurz darauf und erklärte: »Da steht nur, dass die Nummer des Anrufers nicht übertragen wird. Geh lieber dran.«
Claudia nickte, wischte dann über das grüne Hörersymbol. Zum Glück ließ sich trotz Gesichtserkennung das Gespräch annehmen. Die Verbindung stand, Claudia sagte jedoch nichts. Sie hielt das Handy so weit von ihrem Ohr entfernt, dass auch Takeda die Stimme des Anrufers hören konnte.
»Matsu? Bist du da? Mann, wieso hast du nicht angerufen? Red schon, wie ist es gelaufen?« Es war eine Männerstimme, die am anderen Ende der Leitung sprach, auf Deutsch.
Claudia zuckte mit den Schultern, hielt sich das Gerät jetzt doch ans Ohr und sagte: »Mein Name ist Harms, Kriminalpolizei. Mit wem spreche ich bitte?«
»Was?«
Claudia wiederholte ihre Worte. Am anderen Ende der Leitung sagte die Stimme: »Verdammte Scheiße.« In der nächsten Sekunde beendete der Anrufer die Verbindung.
Für einige Momente standen Claudia und Takeda stumm voreinander. Dann sagte er leise: »Ich befürchte, dass du recht hast. Ein Spitzensportler, der mitten in der Nacht angerufen wird – und ein Anrufer, der auflegt, nachdem ihm klar geworden ist, dass er mit der Polizei spricht … Das Bild vom tugendhaften Ryūtarō Matsumoto scheint nicht vollständig zu sein.«
7.
Obwohl Takeda zutiefst erschöpft war und dringend Schlaf benötigte, machte er zuhause doch kein Auge zu.
Stattdessen saß er in Boxershorts auf seinem Futon, rauchte eine Mild Seven und trank ein Glas Yamazaki-Whiskey. Dazu hörte er Musik von John Coltrane. All das waren Dinge, die ihm normalerweise dabei halfen, zur Ruhe zu kommen.
Heute nicht.
Seine innere Anspannung wollte einfach nicht nachlassen, im Gegenteil. Es wurde schlimmer. Kein Wunder, denn gerade als er in seine Wohnung gekommen war, hatte sein Handy geklingelt. Eine japanische Nummer. Eine weibliche Stimme meldete sich und stellte zum stellvertretenden Innenminister durch, einem Mann namens Nakayama. In Japan war später Vormittag, und die Medien, so erklärte Nakayama gleich zu Beginn ihres Gesprächs, kannten kein anderes Thema als den Tod von Matsumoto. Der Vizeminister brüllte auf Takeda ein und machte ihm klar, dass der Inspektor nun nationale Verantwortung trage. Der Minister, die Polizei, ja ganz Japan erwarte von ihm eine schnelle Lösung des Falles! Ob er das verstanden habe? Gewiss, Herr Vizeminister, gewiss, er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um die Dinge schnellstmöglich aufzuklären, versicherte Takeda und verbeugte sich dabei unentwegt und so tief, dass ihm der Rücken schmerzte.
Mit einer wütenden Bewegung drückte Takeda seine Zigarette im Aschenbecher aus. Dann beugte er sich vor und stellte die kleine, tragbare Soundanlage aus.
Der Jazz versagte in dieser Nacht, half ihm nicht zu entspannen. Dann musste es halt so gehen.
Stille erfüllte den Raum.
Takeda saß reglos da und lauschte ins Nichts.
Dann, ganz leise, nahm er den zarten, eiskalten Märzregen wahr, der von draußen leise ans Fenster klopfte. Die Tropfen waren sehr fein, es war ein saiu, ein leichter Regen, wie man auf Japanisch sagen würde. In Takedas Muttersprache gab es unendlich viele Worte, um den Regen zu beschreiben, viele davon waren lautmalerisch wie zum Beispiel shitoshito für anhaltenden Regen oder zāzā für einen heftigen Schauer. Schön war auch potsupotsu für die ersten Tropfen eines Unwetters, wobei, wenn es schon etwas nasser wurde, hätte man wohl eher von parapara gesprochen …
In dieser Nacht war der Regen also shitoshito. Obwohl, ganz gelegentlich mischten sich ein paar dickere Tropfen in den feinen Schauer, klopften einer Schlagzeug-Improvisation gleich an die Scheibe. Takeda gelang ein Lächeln. Er schloss die Augen, konzentrierte sich ganz aufs Hören. Die noch kahlen Äste der Buche, die vor seinem Fenster wuchs, raschelten im Wind – eine vom Percussion-Besen gerührte Snare-Drum. Als der Wind kurz auffrischte, knarrte der Fensterrahmen – ein mutiges Solo, das etwas von einer gedämpften, stoßartig geblasenen Trompete hatte. Schließlich hörte Takeda das silberzarte Surren der Deckenlampe, eine entfernte Triangel, begleitet vom Plätschern eines der Heizkörper, einer etwas unbeholfenen und doch wunderschönen Gesangs-einlage … Takeda fand die Ruhe, die Erlösung, nach der er sich sehnte. Das Leben war Jazz, die Musik war überall zu hören, in allen Dingen, auch wenn die angeblich stumm und unbelebt waren. Jazz. Wer das Geheimnis dieser Musik erkannt hatte, wusste, dass auch die Stille von Harmonie erfüllt war, dass die seltsamsten, entferntesten, widerstrebendsten Geräusche sich am Ende doch zum großen Orchester des Lebens fügten …
Mit diesen Gedanken legte Takeda sich auf dem Futon zurück, schloss die Augen und fiel in einen kurzen, traumlosen Schlaf.
8.
Als Claudia am Vormittag den voll besetzten Besprechungsraum der Mordkommission betrat, hatte sie das Gefühl, durch ein Wurmloch gefallen zu sein. Sie war gar nicht mehr im Polizeipräsidium, sondern in einer Eckkneipe mit Sky-Fernseher. Und es war auch nicht mehr Montagmorgen, sondern Samstagnachmittag. Der Eindruck wurde verstärkt durch die Rauchschwaden, die ihr Kollege Horst Kröger verbreitete, denn der hatte sich trotz Rauchverbot mal wieder eine Kippe angesteckt. Er erklärte gerade mit seiner tiefen, kratzigen Stimme: »Jetzt, wo Matsu weg ist, ist die Saison für den HSV gelaufen. Die Delle wird zu tief sein, um sie auszubügeln. Er war der beste Mann auf dem Rasen.«
»Blödsinn, jedenfalls wenn du die letzten Wochen meinst«, konterte Karsten Surbach, ein junger sportbegeisterter Kriminalhauptkommissar. »Matsu war im Formtief, der hat ja teilweise auf der Bank gesessen. Die Mannschaft wird’s also verschmerzen.«
Klaus Dieter Haferkamp, der kurz vor der Pensionierung stand, lachte scheppernd und meinte: »Warum verpflichtet der Verein nicht wieder Kevin Keagan? Als Ersatz für Matsu, meine ich. Keagan ist zwar fast siebzig, aber da hättet ihr sofort wieder einen besten Mann auf dem Feld.«
Allgemeines Gegröle setzte ein, wurde abgelöst durch allerlei typisch hamburgische Kommentare zu Keagan, Kaltz und Uwe Seeler, den ewigen Helden des HSV.
Claudia stellte ihren Kaffeebecher ab und setzte sich an einen der Tische. Ungläubig schüttelte sie den Kopf. Offenbar führte das Thema Fußball nicht nur beim Durchschnittsdeutschen dazu, dass weite Areale des Großhirns abgeschaltet wurden, sondern auch bei hochspezialisierten Kripobeamten. Denn mal ehrlich, es gab genug ernsthafte Punkte am Fall Matsumoto, die sich besprechen ließen – die Auswirkungen auf den Tabellenplatz des HSV war nun wirklich nicht der wichtigste.