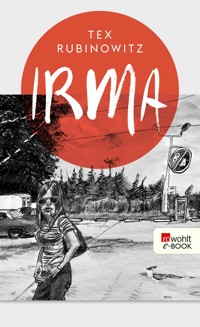
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Freundschaftsanfrage per Facebook. Sie kommt von Irma. Die hat der Erzähler zuletzt vor 30 Jahren gesehen, als er mit ihr in Wien Wohnung und Bett teilte. Und alles begann und endete mit einem Zettel auf dem Küchentisch. Derart angestoßen, beginnt er sich zu erinnern: an die reichlich dysfunktionale Beziehung zweier junger Menschen, die nicht wissen, ob sie in Gefühlsdingen besonders aufrichtig oder einfach nur bindungsunfähig sind. An frühere Stationen seines Lebens, erotische Suchbewegungen, Niederlagen anderer Art, Missbrauchserfahrungen, Reisen in die Welt hinaus bis nach China. Der Autor hat zu seinem Text Bilder gesammelt, alte Plattencover, Fotos, Werbepostkarten. Das kennt man seit W. G. Sebald von vielen «recherchierend» vorgehenden literarischen Werken. Rubinowitz stellt aber diese Form der Beglaubigung gleich wieder in Frage, indem er die Bilder von dem befreundeten Künstler Max Müller nachzeichnen lässt. Dies ist ein ganz und gar eigensinniger, sprunghafter, komischer, sehr unterhaltsamer und zugleich verstörender Versuch über Vergänglichkeit und Erinnerung, über das, was zurückschaut, wenn man autobiographisch hinter sich blickt, und über das, was dabei herauskommt, wenn man sich anschickt, aus der eigenen Biographie Literatur zu machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Tex Rubinowitz
Irma
Über dieses Buch
Eine Freundschaftsanfrage per Facebook. Sie kommt von Irma. Die hat der Erzähler zuletzt vor 30 Jahren gesehen, als er mit ihr in Wien Wohnung und Bett teilte. Und alles begann und endete mit einem Zettel auf dem Küchentisch. Derart angestoßen, beginnt er sich zu erinnern: an die reichlich dysfunktionale Beziehung zweier junger Menschen, die nicht wissen, ob sie in Gefühlsdingen besonders aufrichtig oder einfach nur bindungsunfähig sind. An frühere Stationen seines Lebens, erotische Suchbewegungen, Niederlagen anderer Art, Missbrauchserfahrungen, Reisen in die Welt hinaus bis nach China.
Der Autor hat zu seinem Text Bilder gesammelt, alte Plattencover, Fotos, Werbepostkarten. Das kennt man seit W. G. Sebald von vielen «recherchierend» vorgehenden literarischen Werken. Rubinowitz stellt aber diese Form der Beglaubigung gleich wieder in Frage, indem er die Bilder von dem befreundeten Künstler Max Müller nachzeichnen lässt.
Dies ist ein ganz und gar eigensinniger, sprunghafter, komischer, sehr unterhaltsamer und zugleich verstörender Versuch über Vergänglichkeit und Erinnerung, über das, was zurückschaut, wenn man autobiographisch hinter sich blickt, und über das, was dabei herauskommt, wenn man sich anschickt, aus der eigenen Biographie Literatur zu machen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Anzinger | Wünschner | Rasp, München, unter Verwendung einer Zeichnung von Max Müller
ISBN Taschenbuchausgabe 978-3-499-27069-0 (1. Auflage 2016)
ISBN 978-3-644-04831-7
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1.
Neulich erreichte mich eine Freundschaftsanfrage über Facebook. Ich bekomme oft solche Anfragen und weiß immer nicht, ob ich sie beantworten soll, was mir das bringen könnte, mal ganz davon abgesehen, dass Facebook ein Wartesaal für Idioten ist und ich mich seit Jahren frage, was mache ich hier eigentlich. Aber dann kam eben diese Anfrage, und die war interessant, und vielleicht läuft es ja darauf hinaus, dass wir alle auf so was warten. Die Anfrage kam von einer Irma, und ich wusste augenblicklich, wer das ist. Es waren ja nur ein paar Monate, und jetzt sind 30 Jahre vergangen. Und alles begann und endete mit einem Zettel auf dem Küchentisch.
2.
Ich bin weggegangen. Wenn ich in 50 Minuten nicht zurück bin, komme ich gar nicht mehr. Brauchst nicht zu warten.
50 Minuten? Wieso 50 Minuten? Ich habe mal ein Foto gesehen, von einem Mann, der sich selbst angezündet hat, 95 Prozent seiner Haut waren verbrannt, er hatte noch endlose 50 Minuten zu leben, ein langsamer Tod. Er saß auf einem weißen Plastikstuhl, einem sogenannten Monobloc, die gibt’s heute gar nicht mehr. Sie hatten ihn da raufgesetzt, keine Ahnung, warum, dass er es 50 Minuten irgendwie bequem hat, oder sie wollten ihn demütigen oder etwas dazwischen.
Du bist erst mal 50 Minuten frei – und danach vielleicht noch freier. Ich war niemals hier. Freu dich.
Ich fand den Zettel auf dem Küchentisch. Sie hatte ihn geschrieben, wir schrieben uns oft solche kleinen Botschaften, banale («Keine Butter») oder mysteriöse («Die Zeit der Unschuld ist vorbei, wenn das Klopapier durch Hasendraht ersetzt wird»). Sie saß im Wohnzimmer (das auch unser Schlafzimmer ist) und sah fern, eine Dokumentation über Eulen, sie rauchte. Was sah ich zuerst, sie oder den Rauch?
«Alles klar?»
Sie sagt nichts.
«Du rauchst?»
«Nein, ich schaue einen Eulenfilm.»
«Aber du rauchst dabei.»
«Scheint so.»
Ich mag es nicht, wenn sie im Wohn-/Schlafzimmer raucht, wir rauchen eigentlich nur in der Küche, also ich selten, eher nie, sie andauernd. Einmal meinte sie zu mir: «Du rauchst, wie ein Nichtraucher denkt, dass ein Raucher raucht.» Ich weiß auch nicht, warum wir in der Küche rauchen, vielleicht weil in der Küche weniger Stoff ist, in dem der Rauch hängenbleiben kann. Komisch, dass Rauch nicht in Essen hängenbleibt, gar nicht so komisch eigentlich, Essen wird ja immer gleich aufgegessen, Teppiche werden es eben nicht, und nicht ohne Grund hängen vor Küchenfenstern eher selten Gardinen. Ein Zimmer, in dem nicht geraucht wird, ist wie ein Zimmer ohne Vorhänge – ihre Worte.
Sie hat, als ich sie wieder mal dafür kritisierte, dass sie im Wohnzimmer raucht, sinngemäß gesagt, Raucher seien freigeistige und genussfreudige Menschen, denen ihr freier Genuss vermiest werden und als «Sucht» stigmatisiert werden solle. Bezeichnenderweise seien ja auch Hitler und Stalin Nichtraucher gewesen. Wenn mehr Menschen rauchen würden, gäbe es wohl nicht einmal mehr Kriege, denn die Raucher seien so entspannt, dass sie genussvoll leben und leben lassen könnten.
Auf meinen Einwand, dass Stalin doch Kettenraucher gewesen sei, seufzte sie Edie-Sedgwick-haft: «Aber er hat sich verhalten wie ein Nichtraucher.»
Ich wollte diese Diskussion nicht. Mich störte der Rauch auch weniger als ihre Unberechenbarkeit.
«Ich hab den Zettel in der Küche gelesen.»
«Nicht jetzt.»
«Wenn du den Film zu Ende gesehen hast, gehst du?»
«Ja.»
«Und kommst wieder?»
«Nicht jetzt»
«50 Minuten?»
Keine Antwort. Ich habe nichts gegen Pragmatismus, Eulen, Rauchen an den richtigen Orten, einfach mal so eben Verschwinden, aber manchmal würde ich mir bei ihr vielleicht etwas mehr Leidenschaft wünschen, Pathos. Einen durch und durch pragmatischen Menschen kann man nicht anfassen, man kann ihn ja eigentlich auch nicht umbringen, du kriegst ihn nicht.
«Geht’s dir nicht gut? Ist was?»
Sie zündete sich eine neue Zigarette an und bedachte mich mit einem Blick wie ein verhungerter Blitz: «Pass mal auf, lass mich bitte diesen Film zu Ende ansehen, dann kümmern wir uns um dich. O.k.?»
Wieso um mich kümmern? Ich kann mich um mich selbst kümmern, zumindest für die Länge eines Eulenfilms. Ich ging in die Küche, nicht um zu rauchen, ich hätte ja für sie dort rauchen können, ich machte mir ein Bier auf, das ist meins, sie trank kein Bier. Sie meinte, die Bitterkeit des Bieres sei ihr zu arrogant.
Irma trank auch keinen Wein oder sonst was, sie leckte an Batterien. Immer hatte sie eine Batterie bei sich, an der sie lutschte. Abwechselnd rauchen und an der Batterie lecken, Zigaretten und Batterien, das hielt offenbar ihre Maschine am Laufen. Immerhin weniger irritierend, als an Steckdosen zu lecken und Pfeife zu rauchen.
Ich habe Irma in Wien kennengelernt, im U4, damals eine angesagte Disco, als Discos noch nicht Clubs hießen, und zum U4 sagte man noch nicht einmal Disco, sondern nur U4. Hier soll auch immer Falco rumgehangen haben, wir waren später noch öfter dort, Falco habe ich allerdings nie gesehen. Ich kann mich nur an ein Lied erinnern, Madam Butterfly, von Malcolm McLaren, das war damals ein kleiner Hit. Das Lied ging endlos, es schien mir zumindest endlos (in Wirklichkeit dauert es sieben Minuten, aber in den uns eingebrannten Songparametern sind sieben Minuten eben lang), wir standen an der Bar, sie trank nichts, ich irgendein charakter- und kohlensäurearmes Bier. Sie schüttete mir Zucker in die Jackentasche, das fand sie wohl lustig, aber es war der vielleicht intimste Akt zwischen uns, vielleicht eine Ouvertüre, auf dieser Frequenz würde sie also senden. «Back in Nagasaki I got married to Cho Cho San. That was her name. Back in those days. And I was her man.» Das Stück basiert ja auf einer Oper Puccinis, und Opern waren und sind mir eigentlich immer noch relativ egal, aber solche Koinzidenzen, Oper in der Disco, Zucker in der Tasche, adeln bekanntlich jeden Unsinn, vielleicht gilt das sogar für Opern in der Oper.
Irma kam mit dem Zug. Sie war mit einem Interrailpass unterwegs, das war im September 1984, und ist gewissermaßen in Wien steckengeblieben. Sie wollte nach Ungarn, bekam aber kein Visum, oder das Visum war ihr zu teuer, irgendwas mit dem Visum war es. Wir blieben bis zur Sperrstunde, als man die ganzen Gestalten ungeschützt in einen hämischen Morgen kehrte, die ganzen Übrigbleiber und Nachzehrer. Es will ja niemand der Letzte in einer Disco sein, wenn das Licht angeht, der Erste auch nicht, wenn das Licht noch an ist. Aber uns war das egal, wir hatten das billige Lied im Ohr, das jetzt unser Lied war, es ließ sich schlecht tothören, es summte in uns nach, in einem besseren Kontext, wie wir fanden, wir hatten es da rausgeholt.
Was jetzt? Ratlos gingen wir durch Nagasaki, ich kannte die Stadt auch noch nicht, war erst seit einem Monat hier, wir küssten uns unter einer eisernen Otto-Wagner-Brücke die Lippen wund, und ich habe das so interpretiert, dass wir jetzt zusammen wären, dass dieser Kuss das jetzt sozusagen besiegeln würde. Am Abend fuhr sie mit dem Zug nach Belgien, aber drei Wochen später kam sie nach Wien zurück, unangekündigt, und zog wie selbstverständlich bei mir ein, und wie selbstverständlich ließ ich sie einziehen, ich wollte mir nicht die Blöße der Überrumpelung und Überforderung geben. Da stand sie vor der Tür, mit einem kleinen Wanderrucksack: ein bisschen Kleidung, unter anderem ein schwarzes Hemd, auf dessen Knopfleiste sie mit weißer Wäschefarbe Ameisen, und eine grüne Seifendose, auf die sie einen Hecht gemalt hatte, der von einer Axt in zwei Teile gespalten war. Mich rührte das, nicht die Tiere, sondern, dass sie Seife mitgebracht hatte, ein kleines runzliges Stückchen, dessen Aroma schon längst ausgehaucht war.
Wir imitierten Leben, in meiner 26-Quadratmeter-Wohnung in Ottakring, Schellhammergasse 16, Garçonnière nannte man das schönfärberisch. Klo am Gang, als einzigen Luxus: ein Fernseher und ein Videorecorder, den hatte mir mein Vorgänger überlassen, nein, eingetauscht gegen einen dunkelblauen Marinemantel mit silbernen Knöpfen und einen hellblauen Sony-Walkman.
Irma war irgendwie Litauerin, sie kam aus Litauen, finsterste Sowjetunion damals. Ich fragte sie, wie denn das gegangen sei, dass sie so einfach ausreisen konnte, sie sprach ein leicht patiniertes Deutsch, mit nasalen Vokalen und wunderlichen Vokabeln (verbumfeit, baglamisiert, klabastrig), sie meinte, sie und ihre Eltern würden schon länger («ewig und drei Tage») in Hannover leben, als Kontingentflüchtlinge, eigentlich Baltendeutsche, auch wenn dieses Deutsche an ihnen inzwischen einem Kompromiss gewichen sei. Sie schwärmte für die Stadt, weil sie so uncharismatisch sei. Charismaradiergummi nannte sie mich mal in einem anderen Zusammenhang, ich weiß nicht, ob das als Spott oder Kompliment gedacht war, sie wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal, dass ich selbst aus Hannover komme. Als ich ihr das erzählte, nannte sie mich nie wieder so, leider.
Ich war ihr erster Freund, und sie war meine erste (echte) Freundin, nach kleinen blinden Gehversuchen ohne Bedeutung, na gut, sie hat mal etwas von einem Franzosen erzählt.
Unsere Freundschaft, oder besser: unser Zusammensein, war genauso pragmatisch, also unangreifbar, wie alles an und mit ihr. Wenn wir uns küssten, ließ sie die Augen offen. Ich assoziierte automatisch immer die Righteous Brothers: «You never close your eyes anymore when I kiss your lips», das heißt den falschen Brüdern zufolge ja, wenn man die Augen auflässt, ist es vorbei («You’ve lost that lovin’ feeling»). Aber was hat man denn vorher gesehen, wenn man die Augen geschlossen hat? Den Vorgänger vielleicht? Einen Idealpartner? Einen Franzosen? Ist das nicht Betrug? Sie verschließen die Augen vor der Wirklichkeit wie kleine Kinder, wenn die die Augen zumachen, existiert die Welt auch nicht mehr oder nur eine, in der eine Katze mit einer Krone auf dem Kopf Präsident werden kann.
Man klappt Leichen die Lider runter, damit die Lebenden nicht von den vorwurfsvollen Blicken der Toten belästigt werden, sie ertragen es nicht, so einfach ist das. Natürlich weiß ich, dass man beim Küssen die Augen schließen soll, um unabgelenkt den Moment zu genießen, aber das kann niemand beweisen. Ich vermute, dass die Mehrheit der Küssenden, die ihre Augen schließen, sich einen Ausweg zusammenknutschen, Motto: Bloß weg hier.
Nur einmal, ganz kurz, ich gebe es zu, hab ich mir selbst vorgegaukelt, sie lässt die Augen vielleicht auf, weil sie Angst hat, ich könnte abhauen – währenddessen.
Aber wir küssten uns schon lange nicht mehr, Sex gab es natürlich auch keinen, ich kann dieses Wort nicht einmal aussprechen, Sex, ein Wort wie eine Prothese. Von ihr kamen immer kryptische Meldungen wie «Mach dich doch nicht lächerlich» und Abwehrreaktionen. Es tue ihr weh, das gehe nicht, wir müssten es verschieben. Ja, mein Gott, verschieben wir «es», ich zehrte ja immer noch vom Zucker in meiner Tasche. Beim Sex, machen wir uns doch nichts vor, ist man sich sowieso fremder als bei jedem anderen Kontakt zwischen zwei Zellhaufen, man beginnt vielleicht gemeinsam etwas (sechzig Sekunden Aufeinandergeklatsche), entfernt sich dabei aber mehr und mehr, konzentriert sich doch nur auf sich, um am Ende in einer ratlosen Lähmung zu erstarren, wie zwei sterbende Karpfen. Was war das eben, wer oder was ist das da neben mir?
Paul McCartney hat mal gefragt: «Why Don’t We Do It in the Road?»
Die Antwort ist doch ganz einfach: Weil wir es noch nicht mal im Bett machen.
Obwohl, es gab so was wie Sex, pragmatischen Sex, klar. Immer wenn sie nämlich ihre Menstruation bekam, hatte sie derartige Krämpfe und Schmerzen, dass sie meinte, nur ein Orgasmus könne sie davon erlösen und sie entspannen. Dazu musste ich mich auf den Bauch legen, und sie ritt dann quasi auf meinem Po «nach O-Town», wie sie das nannte. Einmal rief währenddessen ihre Mutter an, Irma war ganz aus der Puste, die Mutter fragte, was denn sei, und Irma meinte, sie hätte gerade eine Wand aufgestemmt. Das war also unser Sex.
Ich studierte zu der Zeit Kunst, aber auch nur eine Woche, ich war zwar inskribiert, aber es war ja niemand da, der etwas hätte unterrichten können, mein Professor fand es wohl gut, uns «machen» zu lassen. Zwei kleine Tiroler namens Andi und Chappi bauten sich aus Pappkartons eine kleine Anti-Uni im Lehrsaal, da krochen sie jeden Morgen rein und hörten Radio, kein Mensch wusste, was sie dadrin wirklich trieben. Angesichts dieser trüben Aussichten, dachte ich, kann ich es auch gleich bleibenlassen, und hing stattdessen im Café Alt Wien herum, trank Bier, aß nichts und trank stattdessen noch mehr Bier.
Meinen nun ungültig gestempelten Studentenausweis wollte ich nicht einfach wegschmeißen, sondern irgendwo deponieren, muss sich doch gelohnt haben, dass man überhaupt aufgenommen wurde, als einer unter 5 von 150 Bewerbern, und mit ihm in einem pathetischen Akt irgendwo und irgendwie eine biographische Marke zu setzen, ein kleines unsichtbares Happening zu veranstalten. Ich entschied mich für das Schloss Schönbrunn, genauer gesagt dessen Park. Dort gibt es zwei sogenannte Najadenbrunnen, Najaden sind in der griechischen Mythologie Nymphen, die über Seen, Bäche und Tümpel wachen. Trocknete das Gewässer einer Najade aus, blendete Zeus sie zur Strafe. Sie waren darüber hinaus bekannt für ihre extreme Eifersucht.
In dem einen Bassin reckt sich eine Najade aus dem Wasser, schaut schräg nach oben und hält, wohl zum Schutz vor allzu viel grellem Licht, die Hand wie einen die Augen beschattenden Schirm an ihre Stirn.
Und in diesen Brunnen sprang ich eines frühen Morgens, es war vielleicht fünf Uhr, der Schlosspark war noch versperrt, ich kletterte über die Mauer, zog mich aus und schwamm in der trüben Brühe, den Studentenausweis zwischen den Zähnen, zur Nymphe. Ich wollte ihn ihr in die Hand drücken, als Sonnenschirm sozusagen, denn nicht nur Kunst zu studieren kann Blindheit zeitigen, sondern auch Eifersucht und zu viel in die Sonne zu schauen. Ich bestieg die Nymphe regelrecht, mir fiel auf, wie groß sie eigentlich ist, ich würde sie, wenn sie aufrecht stünde, auf 2 Meter 50 schätzen, ich bestieg sie wie einen Berg und kam mir dabei vor wie der schnakenartige Robert Crumb, wenn er in seinen Zeichnungen wonnevoll die feste Wade einer seiner Amazonen reitet. Um nicht abzurutschen, hielt ich mich an dem fest, was so da war, an Hüfte, Brüsten und leider auch an ihrem abgespreizten Daumen, und in diesem Moment brach der Daumen ab. Die Brunnen samt Figuren stammen aus der Zeit um 1700, der Zement ist wohl inzwischen etwas mürbe geworden, nun war aber paradoxerweise mit einem Mal der Nymphendaumen plötzlich sichtbar, obwohl er ja gar nicht mehr da war, so wie die Mona Lisa mehr Besucher anzog, als man sie gestohlen hatte, die Leute wollten die durch das Verbrechen entstandene Lücke sehen. Ich flog samt Ausweis und Daumen rückwärts zurück in den Brunnen, und während des Fallens dachte ich an Irma. Ich brachte ihr den Daumen nach Hause, sozusagen als Trophäe, und vielleicht irre ich mich, aber ich glaube sie ein Lächeln unterdrückt gesehen zu haben.
Irma machte gar nichts, wollte nie mit ins Alt Wien, sie war immer zu Hause und brütete vor sich hin. Als ich sie einmal fragte, was sie denn so vorhabe, zuckte sie nur mit den Schultern, wie eine Schlange, die kurz davorsteht, sich zu häuten, auch wenn Schlangen nicht direkt Schultern haben. Ich traute mich nicht, weiter zu fragen, aber am nächsten Tag hatte sie ein paar Lehrbücher gekauft (sagte sie, ich weiß aber, dass sie sie geklaut haben musste, sie hatte ja kaum Geld). Koreanisch für Anfänger. Sie lernte tatsächlich Koreanisch und begrüßte mich von da an mit Anjong und meinte, dass heiße zwar «Guten Tag», aber es sei ihre Art, «Ich liebe dich» zu sagen, so solle ich das immer interpretieren, wenn sie mich so begrüßen würde. Hab ich verstanden, man braucht eben Codes, wenn man keine gemeinsame Sprache findet.
Das war auch die Zeit, als sie Batterien lutschte. Warum machst du das? Ich fragte sie, und sie meinte, das hätten sie als Kinder in Litauen immer gemacht, es schmecke sauer, das sei so was wie saure Drops, die habe es ja nicht gegeben, in Litauen sei immer alles nur süß gewesen, selbst das Brot. Weshalb sie auch gerne Autos Zucker in den Tank geschüttet hätten.
Was habe ich denn als Kind gemacht? Genau, ich hab rohe Leber gekaut, mein Vater brachte immer, wenn er irgendwann nach Hause kam, spät in der Nacht, wir schliefen schon alle, rohe Leber mit, er arbeitete an einer Freibank und schnitt sich und mir immer wieder kleine Stücke davon ab, die wir gemeinsam kauten. Später (als er dann gar nicht mehr kam) kaute ich UHU, den Klebstoff, zu Kügelchen gerollt, aber das war nur so eine Phase, schmeckte erregend scharf, da kamen mir ihre Batterien gar nicht mal so abwegig vor. Sie hatte immer Batterien bei sich und Zigaretten, sie meinte, das gehöre zusammen, das Rauchen entspanne, die Säure aus den Batterien mache munter. Sie aß ja auch kaum etwas. Essen sei langweilig, behauptete sie, reine Zeitverschwendung, ihr schmecke nichts, sie bekomme nichts runter, sie verstehe es auch nicht, allein vom Gedanken an Essen bekomme sie Sodbrennen, und sie fürchte, dass es, wenn sie etwas esse, noch schlimmer würde. Und sie brauchte immer ewig auf dem Klo, echt stundenlang. Ich fragte sie mal durch die Tür, ob alles in Ordnung sei, was sie denn dadrin mache. Seufzend antwortete sie, sie verwöhne sich im Spiegel mit einem Lächeln, wenn ich reinkäme, habe sie sich totgelächelt und ich sei schuld daran. Sie solle keine Witze machen, sagte ich, aber sie erklärte, der eigentliche Witz sei, dass sie nicht scheißen könne, es komme nichts (kein Wunder), sie presse und presse und darüber schlafe sie mitunter ein. Sie schlief auf dem Klo ein, weil sie offenbar vergessen hatte, warum sie auf dem Klo saß.
Sie lernte also Koreanisch, und wie es mir schien, mit einem gewissen Eifer, aus dem nicht wirklich hervorging, was sie damit vorhatte oder was es in ihr auffüllen sollte. Einmal hielt sie mir einen Vortrag über Hangul; die Koreaner hätten ja im Gegensatz zu den rückständigen Japanern und Chinesen ihr Hangul, also Buchstaben wie wir, siebzehn, weswegen sie auch so oft von ihren zwei Nachbarn erobert, vergewaltigt und versklavt worden seien. Ich verkniff mir den Einwand, dass wohl der geringste Grund, eine Nation zu versklaven, der ist, dass sie siebzehn Buchstaben hat.
Zu der Zeit begann ich mich selbst zu tätowieren, ganz roh, mit zwei zusammengebundenen Nadeln und Tusche, Punkt für Punkt, das war zu einer Zeit, als noch nicht jeder Idiot tätowiert war und eine Tätowierung ein echtes Stigma und man dadurch wirklich noch der Außenseiter sein konnte, als der ich mich immer fühlte, weil ich es ja auch war. Leide nicht darunter, sondern versteh es als dein Kapital – die Lebenslüge der Clowns.
Ich tätowierte mir zwei koreanische Buchstaben, auf jeden Unterarm einen, ein A für Anjong und ein I für Irma, ich wusste, dass sie das lächerlich finden würde, ich legte es sogar darauf an. Sie erklärte, zusammengesetzt ergäben die Buchstaben AI und das sei auf der ganzen Welt, von Litauen bis Korea, der gebräuchliche Schmerzensschrei im Affekt, nur im Deutschen nicht, da seien die Buchstaben in umgekehrter Reihenfolge die Laute, die ein (malt Gänsefüßchen in die Luft) «Grautier mit vier Buchstaben» von sich gebe, aber, und das sollte mich wohl beruhigen, nur im Deutschen.
Einmal musste ich ihr ein Huhn klauen, im Prater. Wir waren den ganzen Tag an der sich mühsam dahinschiebenden, öligen Donau, nicht weit vom Friedhof der Namenlosen, schwammen auch, was nicht ganz ungefährlich ist, sie kollidierte beinahe mit einem roststarrenden rumänischen Frachtschiff namens Ioana Radu. Danach waren wir ziellos im Prater herumgeirrt, stundenlang; völlig erschöpft und ausgehungert kamen wir abends am Praterstern, an und da gab es noch so einen Hühnergrill, ein Brathuhnkarussell auf der Straße. Los, klau mir eins, meinte sie plötzlich. Sie ging schon etwas vor und überwachte die Aktion, wie ein Detektiv. Ich drückte mich an dem Stand herum, überwand mich dann und riss das Huhn, das glühend heiß war, vom Spieß und rannte, lief zu ihr. Wir schlangen das Tier irgendwo auf der Bank einer Bushaltestelle hinunter, wie Delinquenten, so fühlten wir uns wohl auch, Hühnchen zum Schafott. Kein Dank, keine Anerkennung von ihr, nichts, meine Hände waren verbrüht, fettig sowieso, trotzdem ein ähnlich intimes Souvenir wie damals der Zucker in der Tasche. Ich glaube, es ging ihr gar nicht so sehr um das Essen; das war vielmehr eine Art der Initiation, mich zum Trottel zu machen, vielleicht hielt sie mich für unterfordert. Sie kann mir keine richtige Liebe geben, keinen Sex, also gibt sie mir Aufgaben, die ich dann interpretieren kann, wie es mir gefällt. Ein Brathuhn ist wohl auch nicht immer das, was es scheint. Ein Brathuhn sagt: Anjong.
Ich habe mal versucht, den Aufnahmeknopf eines Kassettenrecorders so schnell zu drücken, dass er das Geräusch des Drückens mit aufnimmt. Und so kam mir das, was wir hatten, immer vor: wie ein noch nicht angekommenes Geräusch.
Gleich nachdem sie zu mir gezogen war, sagte sie: «Meine Geheimnisse sind bei dir nicht sicher.» Ich fragte, was sie damit meinte, was das für Geheimnisse seien, aber sie sagte nichts, zog nur die Batterie aus der Tasche und lutschte daran, grinsend, nickend, denk mal drüber nach. Vielleicht waren ihre Geheimnisse so geheim, dass noch nicht einmal sie sie kannte. Vielleicht soll ich mir auch Geheimnisse ausdenken und sie ihr anbieten, und sie wählt aus, was für sie brauchbar ist, woraus sie sich zusammenstecken kann, das ganze Geheimnis war letztlich, ganz nahe an etwas zu sein, ohne zu wissen, woran eigentlich, und ich würde es nie erfahren.
«Na, fühlst du dich jetzt besser, geht’s dir besser?»
Ihr Film ist offenbar zu Ende, jetzt beginnt meiner, na, Irma, was kommt jetzt?
«Was meinst du?»
«Trinkst wieder Bier?»
«Ja, wie du siehst.»
«Den Zettel gelesen?»
«Ja, hab ich gelesen. Gehst du, willst du weg?»
«Ja, natürlich, jeder will doch weg. In jeder Anwesenheit ist doch die Abwesenheit gleich mit eingebaut, so oder so.»
«Ich bleib hier.»
«Sicher nicht. Du wirst auch gehen, irgendwann.»
«Aber wenn du gehen willst, warum das überhaupt ankündigen? Tu’s doch einfach.»
«Weil das nicht funktioniert. Man wird doch dauernd zu etwas gezwungen.»
«Niemand zwingt dich, Koreanisch zu lernen.»
Das war allerdings unterste Schublade.
Wortlos zog sie sich Mantel und Schuhe an und verließ die Wohnung. Es war Winter, wo wollte sie hin?
Als man den hochbetagten Charlie Chaplin fragte, was er denn jetzt noch vorhabe, ob er noch Träume oder Wünsche habe, meinte er nach einer langen, kontemplativen Pause, er wolle noch einen Film über Spatzen drehen. Sie sollten die Hauptdarsteller sein, die Menschen nur Nebenfiguren, die Spatzen sollten die Menschen spielen, die Menschen Spatzen, die sich um die Krümel rangeln. Daraus wurde nichts, leider, er starb 1977, wurde beerdigt, zwei Monate später klauten ein Pole und ein Bulgare seine Leiche, reisten damit durch die halbe Schweiz, vergruben sie woanders, um die Familie zu erpressen, sie wollten 600000 Franken. «Charlie hätte das lächerlich gefunden», meinte seine Witwe Oona und verhandelte gar nicht erst.
Spatzen sind in Europa sogenannte Standvögel, nur die wenigsten sind Kurzstreckenzieher, lediglich nicht dauernd von Menschen bewohnte Siedlungen im Alpenraum werden im Spätherbst oder Winter vom Haussperling geräumt. In Pakistan und Indien gibt’s ein paar Zugspatzen und Teilzieher, sie können schon ein paar Kilometer fortziehen, aber Exoten werden sie nirgends. Und Charlie war demnach noch als Leiche ein Kurzstreckenzieher.
3.
Wie Irma, nach zwei Stunden war sie wieder zurück, 70 Minuten zu spät oder für meine Freiheit zu früh. Sie habe meinen Text gelesen, meinte sie, er gefalle ihr gut, selbst das Ende sei gut, aber ein bisschen rustikal. Das würde sie rausnehmen, das mit Chaplin und den Spatzen, solche Schlüsse seien immer wie Kuckuckseier, man könne sich damit die ganze Geschichte ruinieren.
«Ich hab’s ja für dich geschrieben.»
«Für mich? Wieso, versteh ich jetzt nicht. Bin ich ein Spatz?»
«Jetzt redest du wie die Irma im Text.»
«Schau mal, vielleicht bin ich das sogar oder eine Projektion, ist mir im Grunde auch egal. Ich brauche dich nicht, damit du mich brauchst, ich brauche dich, damit du mich NICHT brauchst.» (Der Satz kam viel zu schnell, um ihn zu kapieren; er klang auch ein bisschen einstudiert, so als hätte sie den richtigen Anlass abgewartet, um ihn abzuwerfen.) «Wenn das mit unserem Sex nicht so klappt, wie du dir das vorstellst, wenn du unzufrieden bist, ich spür das ja, dann hol ihn dir eben woanders. Nimm ihn dir, ich bin die Letzte, die eifersüchtig wäre, ich hab kein Problem mit meiner Sexualität, so bin ich nun mal, das müssen wir so hinnehmen. Ich hab keine Lust, das zu analysieren, und ich ahne, wo das herkommt, aber ich lebe nicht in irgendeiner Vergangenheit, sie gehört mir nicht mehr und ist auch nicht mehr das, was sie früher einmal war. Von der Zukunft bleibt mir oder uns auch nur noch ein unberechenbarer Rest, nicht viel, und was die Gegenwart von mir will, ist mir, ehrlich gesagt, schnuppe.»
Mir fiel nichts ein, außer, dass ich jetzt plötzlich eifersüchtig wurde auf jemanden, der nicht eifersüchtig ist. Und auf jemanden, der das Wort schnuppe in diesem Kontext brachte, sowieso.
Sie ging wieder ins Wohnzimmer, schaltete den Fernseher an, aber diesmal, um sich einen Spielfilm anzusehen, sie war wohl bei einer Videothek gewesen. Natürlich ein koreanischer Film, oh, den, der jetzt lief, kannte ich, den hatte wir schon mal gemeinsam gesehen. Sie saß vollkommen autistisch vor dem Apparat, rauchend und mit einem Notizblock auf ihren Knien, wohl um Vokabeln mitzuschreiben. Na ja, war ich wieder mal alleine, die Eulen aus meinem Text waren jetzt ein rachsüchtiger Koreaner, der einen lebendigen Oktopus verschlingt, während sie an ihrer Batterie nuckelt.
Natürlich wollte ich ihr mit meinem Schreiben etwas mitteilen, nämlich all das, was ich nicht artikulieren konnte, aber entstanden ist ein larmoyantes Grundbrummen, und eigentlich habe ja auch nicht ich ihn geschrieben, sondern jemand, der Irma gefallen sollte.
Statt diese Scharade zu beenden, tätowierte ich mich, machte mich zum Esel. Statt zu sagen, lass es uns lassen, was hält uns denn noch zusammen, nicht viel mehr als die Spucke unserer seltenen Küsse, klaute ich ihr ein Brathuhn. Genauso gut hätte ich mich vor die Tür setzen können, vor meine eigene, mich aus ihrem Leben entlassen, aber ich konnte es nicht, aus falschem Verantwortungsgefühl, wo soll sie denn hin? Vielleicht wollte ich sie beschützen, vor sich selbst oder vor Idioten wie mir.
Einmal habe ich sie geschlagen. In Berlin war das, in einem dieser novembergrauen November, dem elenden Monat, den niemand mag außer uns, wir hatten so was wie Mitleid mit ihm, aber kann auch sein, dass ich ihr das einfach nachgeplappert habe. Wir stocherten da in Berlin eine Woche orientierungslos herum, dann am Ende, auf dem Bahnhof, nachts, da habe ich ihr eine runtergehauen, weil sie mir Geld gegeben hat. Ich hatte sie nach diesem Geld gefragt, ich musste die Nacht irgendwie rumbringen, Bier kaufen und so, ihr Zug nach Hannover, sie wollte zu ihren Eltern, fuhr gleich, in zwei Minuten, ich hatte noch zu warten, bis zum Morgen, bis mein Zug nach Wien ging. Sie gab mir also dieses Geld, das wenige, das sie noch hatte, und ich schlug ihr ins Gesicht. Ein grausamer Reflex, ich habe jahrelang verdrängt, darüber nachzudenken, warum ich das tat. Vielleicht weil sie nachgab, darum, ich wollte, dass sie hart bleibt, mir nichts gibt. Und mich wollte ich nicht in dieser Rolle des Bittstellers, ich hasste mich in dieser Rolle, diese stinkende Unterwerfung, und ich wollte sie nicht so schwach haben, schwächer als mich, zum ersten und einzigen Mal war sie schwächer. Ich schlug sie und meinte mich und wollte sie dafür bestrafen, dass sie nicht mehr sie selbst war. Durch das Fenster ihres abfahrenden Zuges sah ich sie, ich habe niemals jemanden so entsetzt blicken sehen, wie ein Reh aus einem brennenden Wald, nicht sie weinte, ich weinte für sie.
Jetzt sitze ich wieder in der Küche und trinke ein Bier, und eine Fremde sitzt kilometerweit weg und macht ihre Irmasachen. Wir könnten ja immer so weitermachen, ich könnte ihr wieder einen Text schreiben, Zeit habe ich ja, für die Dauer eines Films, ich könnte sie mir neu erfinden, könnte sie mir so zurechtschreiben, wie sie mir gefällt, in der Hoffnung, dass die beiden Bilder, das von meiner Irma und das von der echten Irma, irgendwann deckungsgleich werden, bevor sie wirklich und endgültig verschwindet.
Aber sie konnte wohl noch nicht gehen, weil etwas für sie noch nicht stimmte, etwas noch nicht fertig war. Wie soll man auch etwas beenden, das nicht einmal angefangen hat? Dabei hätte sie leicht gehen können, mit ihrem Ameisenhemd, der grünen Seifendose und den Koreanischlehrbüchern, sie hat ja hier sonst nichts, kennt niemanden, und niemand hat sie gesehen. Sie lebt sozusagen ganz flach hier, als lauere sie auf irgendwas: dass es irgendwann mal losgeht oder die Koreaner kommen.
Aber ich war leer (wie eine leere Batterie), ich wusste nicht, was ich ihr schreiben sollte. Nach dem zweiten Bier bin ich dann gegangen, ich rief ihr ein schwaches «Viso gero» ins Wohnzimmer, litauischer Abschiedsgruß, aus ihrer Welt kam nur ein markerschütternder koreanischer Schrei, in ihrem Film murkste wohl gerade einer einen ab. Ich zog Mantel und Schuhe an und ging auf die matschige Straße, ging zum schaffnerlosen J-Wagen, der nach modrigem Holz und Bohnerwachs roch, fuhr in den ersten Bezirk, setzte mich ins Alt Wien, wie üblich, irgendwer fand sich immer, Sauerstoffdiebe, die sich mit ihren Zigaretten betranken, ihre einzige kreative Leistung, immer noch ergiebiger als eine autistische Batteriesäurelitauerin mit Faible für eine





























