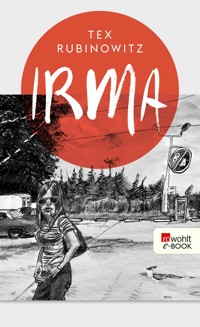9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paralleltourismus Tex Rubinowitz' Reiseberichte sind phantastisch, komisch und ganz ohne Vorbild. Und die Reisen gehen, konsequent an allen «Sehenswürdigkeiten» vorbei, an Orte, die mal wirklich interessant sind. In Bhutan besucht er eine königliche Hochzeit, mit einer Verkehrsampel im Gepäck, denn die gibt es in dem Land auf dem Dach der Welt bisher noch nicht. In Porto geht er auf eine Ingo-Schulze-Lesung, die in der Erkenntnis gipfelt, dass Porto nicht gerade der günstigste Ort für eine Ingo-Schulze-Lesung ist. Ob in Baku, Budapest, Beppu oder Berlin, auf dem Schlager-Grand-Prix, dem Bachmann-Wettbewerb oder dem nördlichsten Filmfestival der Welt in Sodankylä: Überall kommt Rubinowitz mit den Leuten ins Gespräch; immer führen die Gespräche in Sphären, die selten ein Mensch betrat. «Ich rede gerne mit Menschen, ja, das muss man so sagen, statt sie anzustarren, zu ignorieren, mit ihnen zu schlafen oder sie zu hassen, das kann man alles danach immer noch, aber zunächst einmal reden. Meine Mutter hat mir erzählt, ich hätte als Kind sogar mit Holz geredet und mit Hunden, aber mit dem falschen Ende, der wedelnde Schwanz war mir wohl kommunikativer. Bereits damals ließ ich mich offenbar von Paul Watzlawicks Axiom, dass man nicht nicht kommunizieren könne, durchs Leben lenken. Reden ist für mich wie Atmen, die beiden Tätigkeiten sind sich ja im Grunde nicht unähnlich und wichtiger als Essen, Essen ist verzichtbar, Reden nicht. Ohne Kommunikation wären wir ausgestorben, ohne Essen nicht, wir hätten gelernt, uns osmotisch zu ernähren, das ist wohl auch der Grund, warum ich nach wie vor mit Bäumen rede, vielleicht, um ihnen die Technik der Photosynthese zu entlocken. Ich habe einmal in Japan einen ganzen Nachmittag mit einem trisomischen Kind geredet, es ging, wir erfanden eine neue Sprache.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Tex Rubinowitz
Rumgurken
Reisen ohne Plan, aber mit Ziel
Über dieses Buch
Paralleltourismus
Tex Rubinowitz' Reiseberichte sind phantastisch, komisch und ganz ohne Vorbild. Und die Reisen gehen, konsequent an allen «Sehenswürdigkeiten» vorbei, an Orte, die mal wirklich interessant sind. In Bhutan besucht er eine königliche Hochzeit, mit einer Verkehrsampel im Gepäck, denn die gibt es in dem Land auf dem Dach der Welt bisher noch nicht. In Porto geht er auf eine Ingo-Schulze-Lesung, die in der Erkenntnis gipfelt, dass Porto nicht gerade der günstigste Ort für eine Ingo-Schulze-Lesung ist. Ob in Baku, Budapest, Beppu oder Berlin, auf dem Schlager-Grand-Prix, dem Bachmann-Wettbewerb oder dem nördlichsten Filmfestival der Welt in Sodankylä: Überall kommt Rubinowitz mit den Leuten ins Gespräch; immer führen die Gespräche in Sphären, die selten ein Mensch betrat.
«Ich rede gerne mit Menschen, ja, das muss man so sagen, statt sie anzustarren, zu ignorieren, mit ihnen zu schlafen oder sie zu hassen, das kann man alles danach immer noch, aber zunächst einmal reden. Meine Mutter hat mir erzählt, ich hätte als Kind sogar mit Holz geredet und mit Hunden, aber mit dem falschen Ende, der wedelnde Schwanz war mir wohl kommunikativer. Bereits damals ließ ich mich offenbar von Paul Watzlawicks Axiom, dass man nicht nicht kommunizieren könne, durchs Leben lenken. Reden ist für mich wie Atmen, die beiden Tätigkeiten sind sich ja im Grunde nicht unähnlich und wichtiger als Essen, Essen ist verzichtbar, Reden nicht. Ohne Kommunikation wären wir ausgestorben, ohne Essen nicht, wir hätten gelernt, uns osmotisch zu ernähren, das ist wohl auch der Grund, warum ich nach wie vor mit Bäumen rede, vielleicht, um ihnen die Technik der Photosynthese zu entlocken. Ich habe einmal in Japan einen ganzen Nachmittag mit einem trisomischen Kind geredet, es ging, wir erfanden eine neue Sprache.»
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Walter Hellmann
(Fotos: Hertha Hurnaus; eSeL.at)
ISBN Buchausgabe 978-3-499-25775-9 (1. Auflage 2012)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-46601-2
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Paralleltourismus
Die Entenmuschelkur
Tod in Budapest
Fußbier
Der erste Platz ist gar nicht schlecht
Die Tage der reitenden Leichenwäscher
Ausgedzongt in Shangri-La
Hast noch Käse im Haar
Das Jahr, als Frau Strigl zurückkam
Zwei Türen
Unterm Tisch des Seepferdchens
Was gibt’s denn da zu grinsen, Rumäne?
Das Dorf
Gloria
Häuser ohne Augen
Paralleltourismus
Die Zeit hat mir die Brille in den Koffer gelegt.
Holger Hiller
Weil ich noch nie richtig gearbeitet habe, bis auf nicht erwähnenswerte fünfzehn Bundeswehrmonate und ein Jahr Zeitvernichtung bei einer wohltuend uninnovativen Werbeagentur (Ogilvy & Mather), hatte ich auch noch nie in meinem Leben Urlaub, also Urlaub im Sinne von bezahltem Wegfahren zu Regenerationszwecken. In den Schulferien arbeitete ich bei der Stachelbeerernte, um Geld zu haben, und davor, als ich noch zu dumm zum Arbeiten war, schleppten mich meine Eltern, die an und für sich ausgewiesene Kommunistenhasser waren, regelmäßig in die DDR, weil da alle Angehörigen lebten, die zu lahm oder zu doof gewesen waren, vor dem August 1961 das System zu wechseln. Prerow, heiße Kiefernwälder, weißer Strand, grünes Wasser, einmal musste mir ein Backenzahn gezogen werden, das ist alles, was an Erinnerung geblieben ist. Leider, denn ich würde gerne den Backenzahn gegen das Bild eines dauerhaft schlechtgelaunten und fluchenden Vaters tauschen.
Der Familienspuk endete, als ich sechzehn Jahre alt wurde. Ich flog von der Schule, zog aus, in eine ranzige Wohngemeinschaft in einen alten Wasserturm in Lüneburg, und jobbte da und dort (Lünebest Spezialjoghurt), naturgemäß ohne Festanstellung, weswegen es auch keinen Urlaub gab. Wenn ich wegfuhr, nannte ich das Wegfahren oder vom Acker machen, in den neunzehnhundertsiebziger Jahren war ja alles Mobile landwirtschaftlich konnotiert – pflanz dich, verdufte, mach dich vom Acker, schwing die Hufe, lass rüberwachsen, ruf in einen Kartoffelsack und warte auf das Echo (bedeute: mit deiner Meinung stehst du hier alleine) –, vielleicht ein später Nachhall des ein paar Jahre vorher für das in Trümmern liegende Deutschland angedachten Morgenthau-Plans, dem man so knapp entronnen war.
Wenn ich also wegfuhr, dann sicher nicht, um an irgendeinem Ziel zu entspannen oder etwas zu lernen, das Wegfahren war vielmehr zur Arbeit geworden; schon allein das zähe, tagelange, bange und demütigende Autostoppen. Angekommen bin ich auch nie, musste immer weiter, durch ganz Europa, und über die Grenzen hinaus, bis nach Alma-Ata, und dann gleich wieder zurück, einen Kanister mit 15 Litern Kumys im Gepäck, also vergorener Stutenmilch, damit wollte ich in meiner unendlichen Naivität einen schwunghaften Handel aufziehen. Das musste natürlich allein schon daran scheitern, dass ich mich auf dem langen Rückweg an der nahrhaften Milch labte bei gleichzeitiger Gewichtsminimierung.
So wie der Stubenkamerad während der Bundeswehrzeit in Westerland auf Sylt, ein Zuhälter aus Hannover («Ich hab nur ein Pferdchen laufen»), der immer vom Lindener Bier schwärmte, das das beste sei, was man trinken könne, und versprach, das nächste Mal eine Flasche mitzubringen, damit ich mal koste, was mir, der ich nie übers Wochenende heimfuhr, entgehe, und jeden Sonntag kam er mit leeren Händen zurück, er hatte die Flasche auf der beschwerlichen Zugfahrt ausgetrunken. (Als ich dann viel später einmal in Hannover war, bekam ich schon beim Anflug einen enormen Lindenerdurst, aber, welche Enttäuschung, die Brauerei existiert seit 1997 nicht mehr. Mit Hannover assoziiere ich seither nur noch eine pauschale Komplettdrainage.)
Nach der Stutenmilchaktion kam ich auf die Idee, von nun an immer etwas zu machen, Reisen mit Auftrag, damit das mühselige Unterwegssein wenigstens mit etwas Sinn befüllt wird und ich den Ländern, Gegenden und Völkern irgendetwas zurückgeben kann, Geld bekommen ja immer nur die Falschen und hatte ich sowieso nicht. Und wenn mir schon nicht unbedingt die große Vision des Entrepreneurs zur Verfügung stand, so konnte man aus den Vorhaben immer noch eine Kunstaktion generieren, Kunst geht immer, wie Martin Kippenberger sagte, der ein globales U-BahnNetz baute, bestehend nur aus Attrappen von Eingängen und Lüftungsschächten, bei denen regelmäßig abgespielte Fahrgeräusche und durch Ventilatoren erzeugte Luftströme die Fiktion verstärkten (Stationen etwa auf der Kykladeninsel Syros, in Dawson City in Kanadas Yukon-Territorium und in Münster, Westfalen). Aber es gibt ja auch weniger aufwendige Fluxusaktionen, kleine Eingriffe oder Hinterlassenschaften, die man irgendwo deponiert, wie James Lee Byars, der mit Gehrock, goldenem Zylinder und Gamaschen das Matterhorn erklomm, um dort nichts anderes zu hinterlassen als einen Tropfen Parfüm – an Pathos zwar schwer topbar, aber als Ansporn durchaus attraktiv fürs geistige Reisegepäck. Man kann sich natürlich auch, wie es die Situationisten empfohlen haben, in irgendeiner, für einen selbst fremden Stadt einen Hund ausleihen und sich von ihm gleichsam durch die Stadt ziehen lassen, nachvollziehen, wie er sich durch seine Stadt schnüffelt, das überschreitet dann die Grenzen der Kunst und betritt die olfaktorische Welt der Psychogeographie.
Ich bin einmal durch halb Europa getrampt, mit einem Unguis incarnatus, vulgo eingewachsener Fußnagel, eine stark pochende Entzündung, es bildet sich Granulationsgewebe, sogenanntes «wildes Fleisch», ein Reisegefährte, der unbedingte Aufmerksamkeit fordert, und das war in dem Moment vielleicht nicht wirklich lustig, aber rückblickend betrachtet natürlich ein exquisites Beispiel für das etwas andere Reisen. Urlaub mit Schmerzen, man nimmt alles um sich herum ganz anders wahr, einem selbstverständlichen Umstand wie der Straße wird endlich einmal die Aufmerksamkeit geschenkt, die er verdient, jeder Schritt ein stechender Schmerz, kanalisiert noch durch meine engen, klobigen, nach vorne spitz zulaufenden Rockabilly-Schuhe, die ich zu jener Zeit trug. Ich kaufte mir dann in Belgien erbsgrüne Flip-Flops, wie furchtbar stillos, aber meine Zehen verlangten nach Luft. Die Rockabilly-Creepers schmiss ich in einem pathetischen Akt in den Ärmelkanal, von dem einen Pier in Blankenberge, natürlich nicht dem aus Beton, sondern dem aus Holz, zu dem ich immer wieder gerne zurückkehre, um mich dort mit Duvel volllaufen zu lassen, kleine viskose Passagen ins Paradies. Trotz der neuen Fußfreiheit quoll mein rechter Zeh, der befallene, auf wie ein Ballon, heiß und prall mit gelbem Eiter. Ab und zu stach ich den Ballon mit einem Kugelschreiber an und ließ Eiter ab, aber es änderte natürlich nichts, die bösen Keime reisten mit mir im Zeh bis Portugal, eine Spur des Eiters, der Auftrag war also, dem Schmerz Europa zu zeigen, oder andersherum. Wie Joseph Beuys einst dem toten Hasen die Kunst erklärt hat, während draußen vor der verschlossenen Tür die murrenden Museumsbesucher warten mussten.
In Porto lernte ich einen Zahnarzt kennen, einen etwa zwei Meter großen, schwulen Afrobrasilianer namens Marco, der als Barmann arbeiten musste, weil es viel zu viele brasilianische Zahnärzte in Portugal gibt. Ihm klagte ich mein Leid. Er sah sich meinen Zeh an und meinte, das könne man behelfsmäßig reparieren. Zunächst gab er mir einen Wodka, den sollte ich mir über den Zeh kippen, zwecks Sterilisation, der gehe «aufs Haus», daheim habe er ein kleines Instrumentarium, keimfreies Operationsbesteck, Skalpell, Nadeln und Faden. Auf meinen Einwand hin, dass das, was mich plage, antipodisch am gegenüberliegenden Punkt dessen liege, was eigentlich sein Aufgabenbereich sei, meinte er, völlig richtig, aber er sehe hier etwas, was auch ein Laie rasch beheben könne, das sei ganz einfach. Er zeichnete mir auf eine Serviette, was er vorhatte, es sah seriös aus, ich solle nur seine Schicht abwarten, dann könnten wir das bei ihm zumindest versuchen. Ich wartete also in seiner Bar und trank mir die Skepsis weg. Um vier Uhr morgens gingen wir in seine Wohnung. Ich bin bei solchen Sachen immer sehr arglos und denke, mit Arglosigkeit macht man sich immun, Angst macht empfindlich, schreckhaft und verwundbar, und mein pochender Zeh sagte, geh mit. Ich hatte Marco zwar vorsorglich angedeutet, ich sei nicht schwul, wenn er es darauf anlegen würde, könne er sich den Vorwand, den Umweg über die Operation sparen, aber er meinte nur, er wisse das natürlich, und auch wenn ich «zip zip» (bisexuell wahrscheinlich) sei, möchte er mir nur helfen, er habe das auch mal gehabt, das mit dem Zeh. Ich war so betrunken, dass das als Anästhetikum ausgereicht hätte, aber als er in einer nierenförmigen Schale sein Besteck zurechtlegte, beschlichen mich allerdunkelste Jeffrey-Dahmer-Szenarios: Was mache ich eigentlich hier, ein riesiger, schwarzer Voodoo-Zahnarzt amputiert mir nicht den Zeh, sondern betäubt mich, bohrt mir ein Loch in den Kopf und träufelt Säure hinein, um mich zum willenlosen Sexzombie zu machen usw. Ich sagte, ich müsse noch mal schnell aufs Klo, der viele Gin vorhin in der Bar, die Oliven, die Bolinhos de Bacalhau (Kugeln aus Stockfischabfällen), die Zigaretten, ich deutete auf meinen Magen, und das war nicht einmal gelogen, in mir rumorte eine Rastlosigkeit wie die eines läufigen Riesenschnauzers, ich fürchtete bei jedem Flatus, dass Land mitgeht. Marco nickte, und während er sich Gummihandschuhe anzog, suchte ich das Klo, schloss die Tür ab und inspizierte natürlich sofort das Fenster: Es war sehr klein und ließ sich nicht öffnen, sondern bestand aus sieben Glaslamellen zum Kippen, die in Bleischienen steckten. Ich zog alle einzeln heraus und stellte sie behutsam auf den Fußboden, dann zwängte ich mich kopfüber durch das Fensterloch, weil ich mit den Füßen voran nicht hochkam; ich plante, um nicht auf den Kopf zu fallen, so eine Art Purzelbaum auf der anderen Seite. Mit einiger Mühe konnte ich mich an einem Sims festkrallen und den Rest des Körpers aus Marcos Wohnung, die praktischerweise im ersten Stock lag, ziehen wie eine Motte aus ihrem Kokon. Ich plumpste in einem Innenhof auf eine Wäschespinne, was in zweierlei Hinsicht ideal war. Einmal federten die Spinnenspeichen den Fall, und außerdem konnte ich mir ein paar Kleidungsstücke, drei weiße T-Shirts und ein paar Unterhosen, mitnehmen, Letztere waren sogar dringend nötig, denn während des Fallens war das eingetreten, was sich im gärenden Unterbauch bereits drohend angekündigt hatte, und meine Plastiktüte mit dem Gepäck war noch in Marcos Wohnung, auch meine Flip-Flops, aber die konnte man ja nachkaufen. Ich war plötzlich vollkommen ausgenüchtert, gleichzeitig hundemüde, latschte barfuß zum Douro, dem öligen Fluss Portos, der Fuß tat auch gar nicht mehr weh, die Sonne ging auf, ich legte mich auf eine Bank, um dort irgendwie noch ein bisschen Schlaf zu ergattern, nahm mir aber vor, Marco in der nächsten Nacht in seiner Bar wieder zu besuchen und zur Rede zu stellen, obwohl er ja gar nichts gemacht hatte. Als ich ein paar Stunden später mit mörderischen Kopfschmerzen aufwachte, hatte ich selbst dazu keine Lust mehr und verließ die Stadt. So bleibt es ein Geheimnis, was Marco in jener Nacht wirklich im Sinn stand.
Die meisten meiner Reisen mit Auftrag waren indessen konkreterer Natur und sind es nach wie vor. Man kann sich in Indien einen Anzug schneidern lassen, die Jacke mit drei Ärmeln, und die Hose mit drei Beinen, und die Aufgabe besteht eben dann darin, den Schneider ernsthaft davon zu überzeugen, dass das zwar nicht für einen selbst, aber für einen «Freund» sei, der bis auf die zwei überzähligen Gliedmaßen die gleichen Maße hat wie man selbst, soll vorkommen, die Launen der Herrn sind unergründlich, und der Schneider solle sich doch mal seine eigenen Gottheiten anschauen, Vishnu, der Alldurchdringende, hat vier Arme, und Kali sogar zehn, und zusätzlich ein drittes Auge, er solle sich mal vorstellen, sagte ich dem Schneider, er sei Optiker und ich bestelle eine Brille mit drei Gläsern, aber er wollte mir nicht folgen.
Ich war einmal mit Martin Sonneborn in Usbekistan unterwegs, und er wollte unbedingt einen Elefanten kaufen. Nun ist ja Usbekistan für so manches bekannt (wofür eigentlich?), aber nicht direkt dafür, eine elefantenproduzierende Nation zu sein, was Sonneborn nicht daran hinderte zu insistieren, ja, auch laut zu werden, wo er denn jetzt bitte, verdammt noch mal, den Elefanten herbekomme. Geschäftstüchtige Usbeken machten sich tatsächlich mit uns Gedanken, warfen theatralisch ihre Stirnen in Wellen, recherchierten, vermutlich schon den Anteil ausrechnend, den sie bei so einem großen Ding mitschneiden könnten, einer bot uns auf Sonneborns gebelltes «Elefant, Elefant» ein Telefon zum Kauf an, womit ich mich an Sonneborns Stelle schon zufriedengegeben hätte, denn es war ein ganz großes klobiges Mobiltelefon, beige wie die Zähne des Anbieters, der vielleicht Linguist war und sich gesagt haben mochte, das eine ist des anderen Anagram, ungefähr zumindest, vielleicht ist dieser Wunsch in Wahrheit eine linguistische Rätselfrage. Aber Sonneborn lehnte hier wie auch bei anderen Angeboten (Plüschelefant) ab. Für ihn war eben die unlösbare Aufgabe mit impliziertem Scheitern zur pataphysischen Versuchsanordnung geworden, Riesenaufwand mit vergleichsweise mickrigem Resultat.
Mein Vater war ein echter Kotzbrocken. Nicht nur, dass er mich regelmäßig verdrosch, sondern er log auch und klaute gerne, nahm immer und überall etwas mit, für ihn war das so eine Art Sport. Er wechselte oft die Anstellung, arbeitete eine Zeitlang in einer Freibank, wo minderwertiges Fleisch verkauft wurde, Tiere, die durch Unfälle zu Tode kamen, das Fleisch durchaus noch genießbar, und er brachte immer große Blöcke Flomen (Bauchwandspeck von Schweinen) mit, aus denen meine Mutter Schmalz sieden musste, aber auch riesige Rinderlebern, ob gestohlen oder Teil seines Lohns, weiß ich nicht. Von der Leber aßen wir tagelang. Meine Mutter briet sie steinhart, dazu gab es Kartoffelbrei, Zwiebeln und gebratene Äpfel. Manchmal schnitt mein Vater sich und mir vorher kleine Stückchen von der rohen Leber ab und meinte, ich solle es ihm gleichtun und das Stück kauen, Eskimos machten das auch, sei gesund. Ich hatte weder Bedenken noch Ekel, schmeckte interessant und erinnerte in seiner Beschaffenheit an Kaugummi. Am Ende hatte man das Blut aus dem Brocken gekaut, übrig blieb ein weißes fasriges Stück Fleisch, das man ausspucken durfte, macht man ja mit Kaugummis auch.
Einmal unternahmen wir mit unserem kleinen weißen Lada 1200 einen Familienausflug zum Steinhuder Meer, im Winter, wir gingen übers Eis zum Schloss Wilhelmstein, dort war dann gar nichts. Mein Vater schimpfte wie üblich, und wir mussten wieder zurück, aber später auf dem Eis sah ich, dass er gar nicht mehr so unfroh aussah und etwas bei sich trug, eingewickelt in seinem Taschentuch. Ich fragte, was das sei, und er meinte nur: nichts. Schwieg und schleppte das Ding, weit vor uns fünf Kindern und der Frau, die die Leber zu hart briet, marschierend, ans Ufer, zum Lada. Als wir ankamen, saß er vergnügt im Wagen und rauchte, dann zeigte er uns seine Beute: Eine bestimmt 10 Kilo schwere Kanonenkugel, ich konnte sie nicht heben, zu schwach, er lachte mich aus. Die Kugel folgte uns mit jedem Umzug: Als ich dann aber von zu Hause auszog, stahl ich sie ihm, ohne genau zu wissen, was ich mit ihr sollte, sie war ja nicht mal schön oder beredt, halt ein großer schwerer Klumpen verrosteten Eisens. Wie alt war sie? Wurde sie je abgeschossen? Welches Erz wurde für sie wo ausgewrungen? Ich glaube, ich war nur fasziniert von dem schieren Gewicht der zur Wirkungslosigkeit verdammten Geschichte.
Ich wohnte in diesem alten Wasserturm in Lüneburg mit einem Leichtfuß namens Jens. Wir klauten wie die Raben, meistens Alkohol aus Gaststättenlagern, tranken diesen an langen Abenden, während wir uns gegenseitig tätowierten, ABBA hörten und Siebzehnundvier um Geld spielten. Man kann, wenn man geschickt ist und der Gegner unerfahren, bei dem Spiel leicht gewinnen. Ich erinnere mich an einen Typen, der bei uns häufiger Gast war, Ralf, genannt Ralle, den nahmen wir regelmäßig aus. Er war ein bisschen langsam in allem, und in seiner Not ließ er, wenn er sich übernommen hatte, Karten verschwinden. Einmal sah ich ihn eine Karte unter seinen Oberschenkel schieben; auf die Frage, was das werden solle, antwortete er hilflos: «Wenn da eine Karte unter meinem Bein liegt, ist das nicht meine.» Das brach uns das Herz, und wir beendeten das Spiel aus Mitleid, aber nur für diesen Abend, denn wir mussten ja qua Ralle unser Einkommen sichern. Weil ich ja nirgends angestellt war, konnte ich jederzeit wegfahren, was ich auch tat, auch mal mit dem Fahrrad, natürlich auch gestohlen, das ich am Zielort üblicherweise verkaufte, den mühsamen Rückweg wollte ich mir nicht auch noch antun, zurück fuhr ich Zug. Eines Abends spielten wir wieder fröhlich, ich versuchte meine Reisekasse noch aufzufüllen, Sachen waren bereits gepackt, Satteltaschen befüllt, Rad stand unten im Hof, weiß nicht mehr, ob ich noch was verdiente an dem Abend. Ich stand sehr früh auf, um sechs oder so, denn ich wollte an dem Tag viel schaffen, ich wollte nach Bamberg, ohne Grund, mir gefiel einfach der Name, natürlich hysterisch auf der ersten Silbe kreischend ausgesprochen, und mit gedehntem M, wie Dieter Hallervorden in dem Sketch «Mich schickt der Herr Bamberger», ein Kammerspiel, über dem ich in meiner Jugend regelmäßig barst vor Lachen. Morgens schob ich das Rad vom Hof und fuhr los. Ich trat wie eine Maschine in die Pedalen. Irgendwann zu Mittag machte ich Pause, lehnte das Rad an einen Baum und wunderte mich, warum das Hinterrad so schwer war und zudem einen Linksdrall hatte, ich nahm doch kaum Gepäck mit. Ich schaute in die Satteltasche, da lag die Kanonenkugel, die hatte mir der niederträchtige Mitbewohner eingepackt. Er fand das wohl «witzig»: Ich überlegte. Die konnte ich doch nicht einfach wegschmeißen, zurück wollte ich auch nicht, ich war etwa bei Soltau, schaute auf meine Karte, und da sah ich das am Rande der Heide schimmernde blaue Auge des Steinhuder Meeres. Nun war klar, was ich zu tun hatte. Ich sparte mir Bamberg für später auf, die Stadt läuft ja nicht weg und Bombardements waren aus der Mode gekommen, fuhr stattdessen Richtung Neustadt am Rübenberge, was ziemlich nah am «Meer» liegt und ebenfalls einen schwungvollen Namen hat, wickelte die Kugel dort in ein T-Shirt ein, ein Taschentuch, um den Akt noch authentischer zu machen, hatte ich natürlich nicht. Dann fuhr ich mit der Fähre hinüber zum Schloss Wilhelmsburg, fand den Kanonenkugelhaufen, packte meine aus und legte sie zurück. Ich bildete mir ein, dass sie ein seufzendes Geräusch machte, wie ein Tier, das nach ein paar Minuten der Schur oder ein paar Tagen Quarantäne wieder zurück zur Herde entlassen wird.
Die Entenmuschelkur
We went up that mountain to see Jesus Christ, which turns out to be quite smaller than either the statue of liberty or the Eiffel tower. Guillermo got an awful toothache, and drank two enormous glasses full of whiskey in the restaurant, as a sort of anaesthetic. He said it didn’t do anything for the pain, just turned him into a drunk with a toothache.
Donald Baechler
Es ist Februar, ich bin krank. Eine schwere Lungenentzündung hat mich in ihrem gichtigen Würgegriff, ich huste mich um den Verstand. Meine an und für sich granitene Kehle ist so wund, dass das, was sie da so regelmäßig produziert und auswirft, ein kompaktes Quantum bronchialen Eiters darstellt, würfelförmig fast, ich warte auf Blut, hätte dann eigentlich jetzt mal langsam kommen können, dass das auch erledigt wäre. Die verquollene, eiskalte Denkniere ist dicht, komplett zu, ich höre dumpf, das Auge, über das sich zum Schutz die Nickhaut geschoben hat, gebrochen, Schwitzen und Frösteln lösen sich in Wellen ab, Glieder geschwollen, Gelenke versulzt, kochend heiße Füße, triefäugig, kurzatmig, rasselnd, hängetittrig, truthahnhalsig, schludrig, trostverlassen, alles kommt zusammen. Ich bin der Schatten eines Wracks im Zwielicht meines eigenen Mitleids, oder so ähnlich, niemand hilft mir, nichts geht mehr, ich bin alleine, fünfzig Jahre, nichts geleistet, hier kommt deine Strafe, Kafka kam nur bis Kierling, ich buche einen Flug nach Porto.
Ich besinne mich für meine letzte Stunde auf diese Stadt, weil ich hier zum ersten Mal ankam. Der Ring schließt sich («Ringen sluttet», Knut Hamsun), hier am Rande Europas fühlte ich mich zum ersten Mal wohl. Wie sang einst der große Genesis P. Orridge: «When all the numbers swim together and all the shadows settle», und jetzt sollte der gehetzte Schatten einer niedrigen Nummer hier endlich Ruhe finden. Porto befriedigte offenbar bestimmte Bedürfnisse, aber wodurch, wusste ich damals nicht, und ich weiß es bis heute nicht genau, irgendein okkultes Zusammenspiel von rätselhaften Sinneseindrücken und einer improvisierten Ordnung in aller Kaputtheit (die DDR löste das bei mir übrigens auch immer aus). Das gekachelte Land, immer wieder schmiege ich mich an die kühlende, trostspendende Fliese.
Dabei kenne ich Portugal, das restliche Land, überhaupt nicht, ich weiß nicht einmal, ob Lissabon überhaupt existiert. O.k., die Azoren kenne ich, sogar gut, na ja, zumindest vier von neun Inseln. Auf den Azoren habe ich sogar ein Konto eröffnet, Banco Comercial dos Açores, auf das ich immer wieder Geld transferiere, vom meinem anderen Konto, jenem auf den Åland-Inseln, Ålandsbanken, oder von diesem auf die Azoren, wo ich halt gerade bin, kleine Summen natürlich, und das auch nur, weil ich mir während des Überweisungsvorgangs eine selten benutzte Pipeline vorstelle, durch die das Sümmchen tröpfelt, dieser kaum beachtete Transfermuskel, einer muss ihn doch in Bewegung halten, dass ich also einer der wenigen bin, wenn nicht gar der Einzige, der dieses Nebengeleis überhaupt noch befährt (Mitleid mit Dingen).
Mit sechzehn war ich zum ersten Mal in Porto. Ich kaufte mir natürlich gleich eine Flasche Portwein meines Jahrgangs, diese schönen schwarzen Flaschen mit den groben, mit Schablonen aufgemalten Basisinformationen, PORTO 1961, macht das nicht jeder? Bei mir kam noch dazu, dass ich sechzehn Jahre nach Kriegsende geboren wurde, und 16 von hinten ist 61, das musste gefeiert werden. Ich leerte die schöne Flasche auf einen Sitz, dieser warme, süße Wein, spürte dann eigentlich gar nichts, bekam lediglich Sodbrennen und belegte Ohren. Vielleicht war’s ja alkoholfreier Wein, das glaube ich aber nicht, all die alkoholfreien Irrtümer wurden erst Jahre später gemacht.
Porto, eine verrottete, kariöse Stadt, in der die Möwen das urbane Gefüge prägen, und die Tauben den weit entfernten Strand. Die Möwen haben sie verdrängt, rausgeschmissen, eine Stadt, die offenbar nur noch von Katzenpisse zusammengehalten wird, jedes zweite Haus eine Ruine, in denen kranke Katzen nisten und nasses Brot fressen, sie haben nichts zu tun, außer zu resignieren. Wenn also nicht Schimmel und Katzen wären, würde das hier bald alles zusammenbrechen wie ein Kartenhaus, diese Stadt korrodiert, genau wie ich, passt ja. Es ist auch immer besser, in der Fremde krank zu sein, ein Unsichtbarer, in vertrauter Umgebung muss man sich dauernd rechtfertigen und falsches Mitgefühl erdulden, «Was, schon wieder krank?», «Ich dachte, du wirst nie krank?». Krankheit ist peinlich, so ist das nun mal, jeder siecht für sich allein.
Einmal am Morgen macht mich meine Qual in meinem schweißnassen Faulbett dann doch lachen, so schlimm kann es wohl dann doch nicht sein: Ich wache auf, ich muss niesen und gleichzeitig husten, und als ich den Mund aufmache, will sich auch noch ein Gähnen dazwischendrängen, sei es aus parasitären Gründen oder solchen der Effizienz.
Immer rufen mich meine portugiesischen Freunde an oder schicken Durchhalteparolen auf mein kleines Nokiatelefon. Paulo, ein Maracujabauer und ehemaliger Mosambiksöldner, fragt, ob’s mir gutginge, ob ich nicht mal vorbeikommen möge, ob ich etwas brauche, aber ich krächze kaum glaubhaft, ich sei auf dem Weg der Besserung. In Wirklichkeit verschlimmert sich mein Zustand, die Nässe kriecht mir in die Knochen, ins Gebälk, draußen regnet es sauer seit Tagen, ich fühle mich wie ein von seinem Schutzbefohlenen verlassenes Kind. Die verfluchte Kälte versucht zum Reaktorkern vorzudringen, ich liege da wie eine Sporttasche voller nasser Handtücher in einem Tunnel, dessen Ausgang zugemauert ist, ich bin so schwach, dass mir nur noch verblödete Metaphern einfallen.
Meine Hauptsorge gilt den Knien, die Knie sind immer so kalt, man muss die Knie wärmen, bei mir geht sehr viel über diese Organe, sie sind empfindlich wie Fühler. Als Walter Kempowski in seiner achtjährigen Zuchthauszeit einmal bestraft wurde, indem man ihn nackt in eine kahle Betonzelle setzte und mit kaltem Wasser übergoss, gab ein mitfühlender Aufseher (Russe) dem Schlotternden den Rat, seine Knie anzuhauchen, weil er wohl auch von der Leichtleitfähigkeit dieser Knorpelsensoren wusste. Deshalb bestelle ich mir hier, in der klammen Stadt, immer zwei Kaffees gleichzeitig und stelle sie mir auf die Knie. Manchmal schleppe ich mich auch fiebrig aus der muffigen Stube runter ins Restaurant Portista Marisqueira, gegenüber der phantastischen Parkhaustorte im brutalistischen Stil (dem Silo Auto), die aussieht wie das Guggenheimmuseum in New York. Das Wirtshaus ist so schön, dass man das Innere streicheln möchte, draußen leuchtet die Galp-Tankstelle orange, überhaupt geht nachts ein orangenes Glosen von dieser Stadt aus, man sieht es gut, wenn man sie von oben betrachtet, beispielsweise aus der umwerfenden Bar im siebzehnten Stock des Hotels Dom Henrique, direkt neben dem Autosilo. Da sieht man dann und wann geordnet ungeordnet Wolken orangener Pünktchen aufstieben, als seien es Funken, es sind aber nur von unten orange angestrahlte Taubenschwärme bei ihrer letzten Vergnügungstour des Abends, denn nachts tauschen sie ihr Revier wieder mit den Möwen, die sich zur Bettruhe an den Strand verziehen.
Das Glosen kommt natürlich vom fauligen Atem der Häuser, nachts, so kennt man’s, wenn man’s kennt, aus dem Hochmoor bei Worpswede, grün glimmende Irrwische, Faulgase sind das, hier ist das, was die Stadt aushaucht, eben orange.
Ich würge in der Portista Marisqueria ein frugales Mahl herunter, zwei Bolos de Bacalhau, frittierte Kugeln aus Stockfischabfällen und Kartoffelbrei, spüle mit Portwein nach, mir schmeckt das. Dabei beobachte ich Berto, den geistig behinderten Parkplatzeinweiser vorm großen Fenster, eine echte Hilfe ist er nicht, die Leute geben ihm Geld, damit er nichts tut, ab und zu kommt er rein und trinkt ein großes Glas warme Milch. Die Gegend hier ist absolut phantastisch, der schönste Teil Portos, fraglos, nebenan die Confeitaria Cunha, die so aussieht und in der man sich so behaglich fühlt wie in einer Bar im Weltraum. Ich würde diese Gegend ein retrofuturistisches Kleintokio nennen. Es gibt diese rätselhafte Autobahnspange (hinter der Metrostation Trindade, einem Meisterwerk von Souto de Moura), sie soll eine Kreuzung entlasten. Staus an der Kreuzung gibt es aber nach wie vor, man kann also beides benutzen, entlastet wird gar nichts. Die Spange steht auf Stelzen, so wie die vielen herrlichen, übereinandergeschichteten Kettenglieder Tokios, Autobahnen und Kanäle, überhaupt das Japanische an Portugal, oder umgekehrt, es ist ja nicht nur das Danke, das die Portugiesen den Japanern überlassen haben (Obrigado/Arigato), und dass sie ihnen beigebracht haben, wie man Tempura macht, kannten sie ja alles nicht. Knöpfe auch nicht, die kamen auch von den Portugiesen, und außerdem verbindet beide Nationen das ständige Lachen, Keckern eher, selbst bei Tragödien, wie den aktuellen in beiden Ländern, Finanzkollaps, Nuklearkatastrophe, aber es ist kein Lachen, wie wir es verstehen, wenn man uns kitzelt oder wenn wir einen Hund mit drei Beinen sehen, sondern eine soziale Technik, um mit ausweglosen Situationen fertigzuwerden. Und wenn das Portugiesische gesprochen klingt, als würde ein halskranker Holländer versuchen, Russisch zu gurgeln, all diese Nasallaute, so klingt es gesungen wie Japanisch. Man höre sich nur mal die Schnulzen von Amália Rodrigues an, während die sie begleitende Gitarre überraschenderweise wie eine Anton-Karas-Zither scheppert, genau die Musik dudelt übrigens gerade in der Portista Marisqueria, während ich schwach am Tresen hänge, aber vielleicht ist hier auch nur der Wunsch Vater des Gedankens. Es ist einfach zu viel Japan hier in dieser Ecke, beziehungsweise Nagasaki, die europäischste Stadt Japans, auch da stinkt es nach Katzenpisse, die Katzen dort haben allerdings alle eigenartigerweise keine Schwänze, irgendjemand muss sie ihnen abgeschnitten haben, spät in der Nacht, ohne Zeugen. Und was soll ich sagen? Beim anschließenden Googeln, mit wem denn Porto so städteverpartnert ist, kommt doch tatsächlich Nagasaki raus. Jena ist übrigens auch mit Porto auf diese Art verbunden, die Stadt, in der ich kurz vor dem ersten Portotrip meine Unschuld ließ, na bitte, sie hieß Ute, hallo Ute, wie geht’s dir?
Wieder im Hotelzimmer (Albergaria Miradouro, dieser mächtige Aztekentempel), erfahre ich aus dem Fernsehen, dass Prinz Charles gerade ebenfalls im Lande weilt. Man sieht ihn beim Besuch einer Landwirtschaftsmesse eine mittelgroße Tomate verschlingen. Er nimmt sie ganz in den Mund, nun stellt man sich vor, wie es ausgesehen hätte, wenn sie im Rachenraum ungünstig geplatzt und dem Prinzen der Schleim des Paradeisers aus der Nase geschossen wäre, ich hätte das als Zeichen der Solidarität mit meiner eigenen Limnizität wertgeschätzt.
Nicht wirklich überrascht war ich, als, während ich einen Tag darauf in einem schmierigen Laden, einer beliebten Traditionsfressanstalt namens Conga-Casa das Bifanas kauere, da gibt’s Codorniz, in widerlicher Schweinefleischsuppe gegarte Wachteln, draußen plötzlich Blaulicht zuckt. Ein Konvoi, ich hab ihn am Zinken erkannt, oder waren es die Ohren, durch die sich das Zwielicht streute? Charles, Chucky, die Sohnespuppe, fuhr vorbei, ohne auch nur zu ahnen, was sich hier drinnen für Dramen abspielen. Im Conga stinkt es erbärmlich, nach dieser mit Bier, Portwein und Pfeffer gewürzten Schweinebrühe, die Tag und Nacht brodelt, deren Kessel laut Informationen meiner Gewährsleute niemals gereinigt wird, worauf der Besitzer ganz besonders stolz zu sein scheint, Gesetzesbrüche feiern hier fröhliche Urständ. Immer wieder stolziert er durch seinen Laden und verteilt klebrige Karamellbonbons an die Gäste, generös wie ein Fürst an sein Volk, denn er hat zu allem Überfluss zu seiner brummenden Bude auch noch zweimal hintereinander im Lotto gewonnen. Die Bonbons sollen wohl im Nasenrachenraum diesen pestilenzialischen Brodem überlagern. Interessanterweise ging es mir nach dem Besuch der Kaschemme erheblich besser, als habe das Miasma die bösen Kräfte aus meiner siechen Hülle verblasen, Elend mit Elend beikommen, Methode Gegenschmerz. Vielleicht war mein Körper einfach nur erleichtert, dass er aus dieser Stinkestube herauskam, und zeigte sich auf diese Art erkenntlich.
An einem Abend gehe ich zu einer Lesung von Ingo Schulze, dem Ostdeutschen mit den Ringelhaaren wie Oberst Gaddafi, er liest in einer Buchhandlung namens Gato Vadio, passt ja, Räudige Katze. Eingeführt wird Schulze vom verehrungswürdigen Hubert Winkels, Literaturgroßwesir der Altpapierattacke DIEZEIT, ein Mann, der sein Handwerk versteht wie kein Zweiter und keine Gefangenen macht. Man muss ihn nicht kennen, um seinem Urteil zu vertrauen, zwei Meter groß, oben diese weiße Haarsäule, sie verleiht ihm etwas von einem Papst, aber nicht einem dieser weinerlichen aktuellen, sondern einem jener Monster, die Francis Bacon so gerne gemalt hat. Auch umweht ihn die Aura eines Grafen aus dem Zwischenreich, der schon 450 Jahre auf diesem Erdenrund wandelt und nicht zur Ruhe kommen kann. Bevor Schulze zu lesen anfängt, grauenvoll leiernd, wie erwartet (warum können Schriftsteller eigentlich nicht vortragen? Warum versuchen sie immer in alles diese verdammte Bedeutung zu buttern, was soll dieser hilflose Versuch, Schauspieler zu imitieren, diese theatralische Leidensstimme, wie das Klagemantra einer alten Muhme), interviewt ihn Winkels noch eine gute zähe Stunde. Es ist, als versuche er ihn vom Lesen abzuhalten. Die Nässe kriecht derweil sichtbar in die Buchhandlung, wie in dem Film «The Fog, Nebel des Grauens». Feuchtigkeit ist ja nicht gerade der Aggregatzustand, den Bücher am liebsten haben, und zu allem Überfluss wird im Laden auch noch geraucht (in Portugal ist das Trotzrauchen noch weit verbreitet; dafür darf man in den eigenen vier Wänden nicht rauchen, wenn die Putzfrau gerade da und Nichtraucherin ist, es gibt einen eigenen Schutzparagraphen dafür, eine Alibifarce, von denen das Rechtssystem hier strotzt). Ich vermute, hier wird geraucht als Maßnahme, um den Raum trockenzulegen, mich wundert gar nichts mehr. Gebrannt hätte hier sowieso nichts, geschwelt allenfalls, Kafka hätte mit Sicherheit gelacht, wenn er versehentlich nicht gestorben wäre und Brod ihm hätte gestehen müssen: «Sie brannten nicht, sie glommen nur.» Anwesend waren mit mir zehn Zuhörer, acht davon Angestellte des hiesigen Goethe-Instituts und ein alter Portugiese, der aber schlief. Zählt ein schlafender Gast noch als Gast? Das Institut hat gerade großzügig eine Schulze-Übersetzung finanziert, und jetzt diese kleine Tour durch Portugal, ich frage mich, wer das hier lesen soll, im Buch geht’s um Mausefallen in der DDR