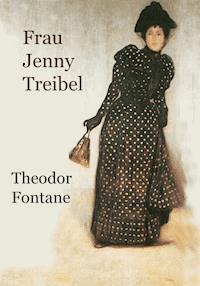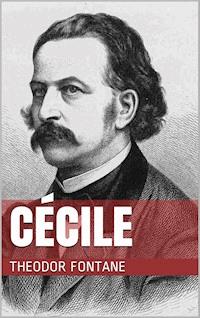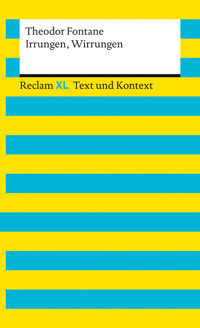
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Der adlige Botho und die bürgerliche Lene gehen eine Beziehung ein, die Standesgrenzen überschreitet. Wie lange können sie dem Druck der Gesellschaft widerstehen? Ein Roman über Liebe und das Bedauern, sie zu verlieren. Klassenlektüre und Textarbeit einfach gemacht: Die Reihe »Reclam XL – Text und Kontext« erfüllt alle Anforderungen an Schullektüre und Bedürfnisse des Deutschunterrichts: * Reclam XL bietet den sorgfältig edierten Werktext – seiten- und zeilengleich mit der entsprechenden Ausgabe aus Reclams Universal-Bibliothek. * Das Format ist größer (12,2 x 20 cm) als die gelben Klassiker der Universal-Bibliothek, mit ausreichend Platz für Notizen am Seitenrand. * Schwierige Wörter werden am Fuß jeder Seite erklärt, ausführlichere Wort- und Sacherläuterungen stehen im Anhang. * Ein Materialienteil mit Text- und Bilddokumenten erleichtert die Einordnung und Deutung des Werkes im Unterricht. * Natürlich passen auch weiterhin alle Lektüreschlüssel, Erläuterungsbände und Interpretationen dazu! E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Theodor Fontane
Irrungen, Wirrungen
RomanReclam XL | Text und Kontext
Herausgegeben von Wolf Dieter Hellberg
Reclam
2013, 2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2021
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-960175-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-016121-0
www.reclam.de
Inhalt
Irrungen, Wirrungen
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Anhang
1. Zur Textgestalt
2. Anmerkungen
3. Leben und Zeit
4. Fontanes Zeitromane und seine Romantheorie
5. Entstehung des Romans
6. Darstellung der Wirklichkeit
7. Rezeption des Romans
8. Interpretationen
9. Literaturhinweise
Fußnoten
Irrungen, Wirrungen
[5]Erstes Kapitel
An dem Schnittpunkte von Kurfürstendamm und Kurfürstenstraße, schräg gegenüber dem »Zoologischen«, befand sich in der Mitte der 70er Jahre noch eine große, feldeinwärts sich erstreckende Gärtnerei, deren kleines, dreifenstriges, in einem Vorgärtchen um etwa hundert Schritte zurückgelegenes Wohnhaus, trotz aller Kleinheit und Zurückgezogenheit, von der vorübergehenden Straße her sehr wohl erkannt werden konnte. Was aber sonst noch zu dem Gesamtgewese der Gärtnerei gehörte, ja die recht eigentliche Hauptsache derselben ausmachte, war durch eben dies kleine Wohnhaus wie durch eine Kulisse versteckt und nur ein rot und grün gestrichenes Holztürmchen mit einem halb weggebrochenen Zifferblatt unter der Turmspitze (von Uhr selbst keine Rede) ließ vermuten, dass hinter dieser Kulisse noch etwas anderes verborgen sein müsse, welche Vermutung denn auch in einer von Zeit zu Zeit aufsteigenden, das Türmchen umschwärmenden Taubenschar und mehr noch in einem gelegentlichen Hundegeblaff ihre Bestätigung fand. Wo dieser Hund eigentlich steckte, das entzog sich freilich der Wahrnehmung, trotzdem die hart an der linken Ecke gelegene, von früh bis spät aufstehende Haustür einen Blick auf ein Stückchen Hofraum gestattete. Überhaupt schien sich nichts mit Absicht verbergen zu wollen, und doch musste jeder, der zu Beginn unserer Erzählung des Weges kam, sich an dem Anblick des dreifenstrigen Häuschens und einiger im Vorgarten stehenden Obstbäume genügen lassen.
Es war die Woche nach Pfingsten, die Zeit der langen Tage, deren blendendes Licht mitunter kein Ende nehmen wollte. Heut aber stand die Sonne schon hinter dem Wilmersdorfer Kirchturm, und statt der Strahlen, die sie den ganzen Tag über herabgeschickt hatte, lagen bereits abendliche Schatten in dem Vorgarten, dessen halbmärchenhafte [6]Stille nur noch von der Stille des von der alten Frau Nimptsch und ihrer Pflegetochter Lene mietweise bewohnten Häuschens übertroffen wurde. Frau Nimptsch selbst aber saß wie gewöhnlich an dem großen, kaum fußhohen Herd ihres die ganze Hausfront einnehmenden Vorderzimmers und sah, hockend und vorgebeugt, auf einen rußigen alten Teekessel, dessen Deckel, trotzdem der Wrasen auch vorn aus der Tülle quoll, beständig hin und her klapperte. Dabei hielt die Alte beide Hände gegen die Glut und war so versunken in ihre Betrachtungen und Träumereien, dass sie nicht hörte, wie die nach dem Flur hinausführende Tür aufging und eine robuste Frauensperson ziemlich geräuschvoll eintrat. Erst als diese Letztre sich geräuspert und ihre Freundin und Nachbarin, eben unsre Frau Nimptsch, mit einer gewissen Herzlichkeit bei Namen genannt hatte, wandte sich diese nach rückwärts und sagte nun auch ihrerseits freundlich und mit einem Anfluge von Schelmerei: »Na, das is recht, liebe Frau Dörr, dass Sie mal wieder rüberkommen. Und noch dazu von’s ›Schloss‹. Denn ein Schloss is es und bleibt es. Hat ja ’nen Turm. Un nu setzen Sie sich … Ihren lieben Mann hab ich eben weggehen sehen. Und muss auch. Is ja heute sein Kegelabend.«
Die so freundlich als Frau Dörr Begrüßte war nicht bloß eine robuste, sondern vor allem auch eine sehr stattlich aussehende Frau, die, neben dem Eindruck des Gütigen und Zuverlässigen, zugleich den einer besonderen Beschränktheit machte. Die Nimptsch indessen nahm sichtlich keinen Anstoß daran und wiederholte nur: »Ja, sein Kegelabend. Aber, was ich sagen wollte, liebe Frau Dörr, mit Dörren seinen Hut, das geht nicht mehr. Der is ja schon fuchsblank und eigentlich schimpfierlich. Sie müssen ihn ihm wegnehmen und einen andern hinstellen. Vielleicht merkt er es nich … Und nu rücken Sie ran hier, liebe Frau Dörr, oder lieber da drüben auf die Hutsche … Lene, na Sie wissen ja, is ausgeflogen un hat mich mal wieder in Stich gelassen.«
[7]»Er war woll hier?«
»Freilich war er. Und beide sind nu ein bisschen auf Wilmersdorf zu; den Fußweg lang, da kommt keiner. Aber jeden Augenblick können sie wieder hier sein.«
»Na, da will ich doch lieber gehn.«
»O nich doch, liebe Frau Dörr. Er bleibt ja nich. Und wenn er auch bliebe, Sie wissen ja, der is nicht so.«
»Weiß, weiß. Und wie steht es denn?«
»Ja, wie soll es stehn? Ich glaube, sie denkt so was, wenn sie’s auch nich wahr haben will, und bildet sich was ein.«
»O du meine Güte«, sagte Frau Dörr, während sie, statt der ihr angebotenen Fußbank, einen etwas höheren Schemel heranschob: »O du meine Güte, denn is es schlimm. Immer wenn das Einbilden anfängt, fängt auch das Schlimme an. Das is wie Amen in der Kirche. Sehen Sie, liebe Frau Nimptsch, mit mir war es ja eigentlich ebenso, man bloß nichts von Einbildung. Und bloß darum war es auch wieder ganz anders.«
Frau Nimptsch verstand augenscheinlich nicht recht, was die Dörr meinte, weshalb diese fortfuhr: »Und weil ich mir nie was in’n Kopp setzte, darum ging es immer ganz glatt und gut und ich habe nu Dörren. Na, viel is es nich, aber es is doch was Anständiges und man kann sich überall sehen lassen. Und drum bin ich auch in die Kirche mit ihm gefahren und nich bloß Standesamt. Bei Standesamt reden sie immer noch.« Die Nimptsch nickte.
Frau Dörr aber wiederholte: »Ja, in die Kirche, in die Matthäikirche un bei Büchseln. Aber was ich eigentlich sagen wollte, sehen Sie, liebe Frau Nimptsch, ich war ja woll eigentlich größer und anziehlicher als die Lene, un wenn ich auch nicht hübscher war (denn so was kann man nie recht wissen un die Geschmäcker sind so verschieden), so war ich doch so mehr im Vollen un das mögen manche. Ja, so viel is richtig. Aber wenn ich auch sozusagen fester war un mehr im Gewicht fiel un so was hatte, nu ja, ich [8]hatte so was, so war ich doch immer man ganz einfach un beinah simpel un was nu er war, mein Graf mit seine fuffzig auf’m Puckel, na, der war auch man ganz simpel und bloß immer kreuzfidel un unanständig. Und da reichen ja keine hundert Mal, dass ich ihm gesagt habe: ›Ne ne, Graf, das geht nicht, so was verbitt ich mir …‹ Und immer die Alten sind so. Und ich sage bloß, liebe Frau Nimptsch, Sie können sich so was gar nich denken. Grässlich war es. Und wenn ich mir nu der Lene ihren Baron ansehe, denn schämt es mir immer noch, wenn ich denke wie meiner war. Und nu gar erst die Lene selber. Jott, ein Engel is sie woll grade auch nich, aber propper und fleißig un kann alles und is für Ordnung un fürs Reelle. Und sehen Sie, liebe Frau Nimptsch, das is grade das Traurige. Was da so rumfliegt, heute hier un morgen da, na, das kommt nicht um, das fällt wie die Katz immer wieder auf die vier Beine, aber so’n gutes Kind, das alles ernsthaft nimmt und alles aus Liebe tut, ja, das ist schlimm … Oder vielleicht is es auch nich so schlimm; Sie haben sie ja bloß angenommen un is nich Ihr eigen Fleisch und Blut un vielleicht is es eine Prinzessin oder so was.«
Frau Nimptsch schüttelte bei dieser Vermutung den Kopf und schien antworten zu wollen. Aber die Dörr war schon aufgestanden und sagte, während sie den Gartensteig hinuntersah: »Gott, da kommen sie. Und bloß in Zivil, un Rock un Hose ganz egal. Aber man sieht es doch! Und nu sagt er ihr was ins Ohr und sie lacht so vor sich hin. Aber ganz rot is sie geworden … Und nu geht er. Und nu … wahrhaftig, ich glaube, er dreht noch mal um. Nei, nei, er grüßt bloß noch mal und sie wirft ihm Kussfinger zu … Ja, das glaub ich; so was lass ich mir gefallen … Nei, so war meiner nich.«
Frau Dörr sprach noch weiter, bis Lene kam und die beiden Frauen begrüßte.
[9]Zweites Kapitel
Andern Vormittags schien die schon ziemlich hochstehende Sonne auf den Hof der Dörr’schen Gärtnerei und beleuchtete hier eine Welt von Baulichkeiten, unter denen auch das »Schloss« war, von dem Frau Nimptsch am Abend vorher mit einem Anfluge von Spott und Schelmerei gesprochen hatte. Ja, dies »Schloss«! In der Dämmerung hätt es bei seinen großen Umrissen wirklich für etwas Derartiges gelten können, heut aber, in unerbittlich heller Beleuchtung daliegend, sah man nur zu deutlich, dass der ganze bis hoch hinauf mit gotischen Fenstern bemalte Bau nichts als ein jämmerlicher Holzkasten war, in dessen beide Giebelwände man ein Stück Fachwerk mit Stroh- und Lehmfüllung eingesetzt hatte, welchem vergleichsweise soliden Einsatze zwei Giebelstuben entsprachen. Alles andere war bloße Steindiele, von der aus ein Gewirr von Leitern zunächst auf einen Boden und von diesem höher hinauf in das als Taubenhaus dienende Türmchen führte. Früher, in Vor-Dörr’scher-Zeit, hatte der ganze riesige Holzkasten als bloße Remise zur Aufbewahrung von Bohnenstangen und Gießkannen, vielleicht auch als Kartoffelkeller gedient, seit aber, vor so und so viel Jahren, die Gärtnerei von ihrem gegenwärtigen Besitzer gekauft worden war, war das eigentliche Wohnhaus an Frau Nimptsch vermietet und der gotisch bemalte Kasten, unter Einfügung der schon erwähnten zwei Giebelstuben, zum Aufenthalt für den damals verwitweten Dörr hergerichtet worden, eine höchst primitive Herrichtung, an der seine bald danach erfolgende Wiederverheiratung nichts geändert hatte. Sommers war diese beinah fensterlose Remise mit ihren Steinfliesen und ihrer Kühle kein übler Aufenthalt, um die Winterszeit aber hätte Dörr und Frau, samt einem aus erster Ehe stammenden zwanzigjährigen, etwas geistesschwachen Sohn, einfach erfrieren müssen, wenn nicht die beiden großen, an der andern Seite des [10]Hofes gelegenen Treibhäuser gewesen wären. In diesen verbrachten alle drei Dörrs die Zeit von November bis März ausschließlich, aber auch in der besseren und sogar in der heißen Jahreszeit spielte sich das Leben der Familie, wenn man nicht gerade vor der Sonne Zuflucht suchte, zu großem Teile vor und in diesen Treibhäusern ab, weil hier alles am bequemsten lag: hier standen die Treppchen und Estraden, auf denen die jeden Morgen aus den Treibhäusern hervorgeholten Blumen ihre frische Luft schöpfen durften, hier war der Stall mit Kuh und Ziege, hier die Hütte mit dem Ziehhund und von hier aus erstreckte sich auch das wohl fünfzig Schritte lange Doppel-Mistbeet, mit einem schmalen Gange dazwischen, bis an den großen, weiter zurückgelegenen Gemüsegarten. In diesem sah es nicht sonderlich ordentlich aus, einmal weil Dörr keinen Sinn für Ordnung, außerdem aber eine so große Hühnerpassion hatte, dass er diesen seinen Lieblingen, ohne Rücksicht auf den Schaden, den sie stifteten, überall umherzupicken gestattete. Groß freilich war dieser Schaden nie, da seiner Gärtnerei, die Spargelanlagen abgerechnet, alles Feinere fehlte. Dörr hielt das Gewöhnlichste zugleich für das Vorteilhafteste, zog deshalb Majoran und andere Wurstkräuter, besonders aber Borré, hinsichtlich dessen er der Ansicht lebte, dass der richtige Berliner überhaupt nur drei Dinge brauche: eine Weiße, einen Gilka und Borré. »Bei Borré«, schloss er dann regelmäßig, »ist noch keiner zu kurz gekommen.« Er war überhaupt ein Original, von ganz selbstständigen Anschauungen und einer entschiedenen Gleichgiltigkeit gegen das, was über ihn gesagt wurde. Dem entsprach denn auch seine zweite Heirat, eine Neigungsheirat, bei der die Vorstellung von einer besondren Schönheit seiner Frau mitgewirkt und ihr früheres Verhältnis zu dem Grafen, statt ihr schädlich zu sein, gerad umgekehrt den Ausschlag zum Guten hin gegeben und einfach den Vollbeweis ihrer Unwiderstehlichkeit erbracht hatte. Wenn sich dabei mit gutem Grunde von Überschät[11]zung sprechen ließ, so doch freilich nicht von Seiten Dörrs in Person, für den die Natur, so weit Äußerlichkeiten in Betracht kamen, ganz ungewöhnlich wenig getan hatte. Mager, mittelgroß und mit fünf grauen Haarsträhnen über Kopf und Stirn, wär er eine vollkommene Trivialerscheinung gewesen, wenn ihm nicht eine zwischen Augenwinkel und linker Schläfe sitzende braune Pocke was Apartes gegeben hätte. Weshalb denn auch seine Frau nicht mit Unrecht und in der ihr eigenen ungenierten Weise zu sagen pflegte: »Schrumplich is er man, aber von links her hat er so was Borsdorfriges.«
Damit war er gut getroffen und hätte nach diesem Signalement überall erkannt werden müssen, wenn er nicht tagaus tagein eine mit einem großen Schirm ausgestattete Leinwandmütze getragen hätte, die, tief ins Gesicht gezogen, sowohl das Alltägliche, wie das Besondere seiner Physiognomie verbarg.
Und so, die Mütze samt Schirm ins Gesicht gezogen, stand er auch heute wieder, am Tage nach dem zwischen Frau Dörr und Frau Nimptsch geführten Zwiegespräche, vor einer an das vordere Treibhaus sich anlehnenden Blumen-Estrade, verschiedene Goldlack- und Geranium-Töpfe beiseiteschiebend, die morgen mit auf den Wochenmarkt sollten. Es waren sämtlich solche, die nicht im Topf gezogen, sondern nur eingesetzt waren, und mit einer besonderen Genugtuung und Freude ließ er sie vor sich aufmarschieren, schon im Voraus über die »Madams« lachend, die morgen kommen, ihre herkömmlichen fünf Pfennig abhandeln und schließlich doch die Betrogenen sein würden. Es zählte das zu seinen größten Vergnügungen und war eigentlich das Hauptgeistesleben, das er führte. »Das bisschen Geschimpfe … Wenn ich’s nur mal mit anhören könnte.«
So sprach er noch vor sich hin, als er, vom Garten her, das Gebell eines kleinen Köters und dazwischen das verzweifelte Krähen eines Hahns hörte, ja, wenn nicht alles [12]täuschte, seines Hahns, seines Lieblings mit dem Silbergefieder. Und sein Auge nach dem Garten hin richtend, sah er in der Tat, dass ein Haufen Hühner auseinandergestoben, der Hahn aber auf einen Birnbaum geflogen war, von dem aus er gegen den unten kläffenden Hund unausgesetzt um Hilfe rief.
»Himmeldonnerwetter«, schrie Dörr in Wut, »das is wieder Bollmann seiner … Wieder durch den Zaun … I, da soll doch …« Und den Geraniumtopf, den er eben musterte, rasch aus der Hand setzend, lief er auf die Hundehütte zu, griff nach dem Kettenzwickel und machte den großen Ziehhund los, der nun sofort auch wie ein Rasender auf den Garten zuschoss. Eh dieser jedoch den Birnbaum erreichen konnte, gab »Bollmann seiner« bereits Fersengeld und verschwand unter dem Zaun weg ins Freie, – der fuchsgelbe Ziehhund zunächst noch in großen Sätzen nach. Aber das Zaunloch, das für den Affenpinscher grad ausgereicht hatte, verweigerte ihm den Durchgang und zwang ihn, von seiner Verfolgung Abstand zu nehmen.
Nicht besser erging es Dörr selber, der inzwischen mit einer Harke herangekommen war und mit seinem Hunde Blicke wechselte. »Ja, Sultan, diesmal war es nichts.« Und dabei trottete Sultan wieder auf seine Hütte zu, langsam und verlegen, wie wenn er einen kleinen Vorwurf herausgehört hätte. Dörr selbst aber sah dem draußen in einer Ackerfurche hinjagenden Affenpinscher nach und sagte nach einer Weile: »Hol mich der Deubel, wenn ich mir nich ’ne Windbüchse anschaffe, bei Mehles oder sonst wo. Un denn pust ich das Biest so stille weg, und kräht nich Huhn nich Hahn danach. Nich mal meiner.«
Von dieser ihm von Seiten Dörrs zugemuteten Ruhe schien der Letztere jedoch vorläufig nichts wissen zu wollen, machte vielmehr von seiner Stimme nach wie vor den ausgiebigsten Gebrauch. Und dabei warf er den Silberhals so stolz, als ob er den Hühnern zeigen wolle, dass seine [13]Flucht in den Birnbaum hinein ein wohlüberlegter Coup oder eine bloße Laune gewesen sei.
Dörr aber sagte: »Jott, so’n Hahn. Denkt nu auch Wunder was er is. Un seine Courage is doch auch man so so.«
Und damit ging er wieder auf seine Blumen-Estrade zu.
Drittes Kapitel
Der ganze Hergang war auch von Frau Dörr, die gerade beim Spargelstechen war, beobachtet, aber nur wenig beachtet worden, weil sich Ähnliches jeden dritten Tag wiederholte. Sie fuhr denn auch in ihrer Arbeit fort und gab das Suchen erst auf, als auch die schärfste Musterung der Beete keine »weißen Köppe« mehr ergeben wollte. Nun erst hing sie den Korb an ihren Arm, legte das Stechmesser hinein und ging langsam und ein paar verirrte Küken vor sich her treibend, erst auf den Mittelweg des Gartens und dann auf den Hof und die BlumenEstrade zu, wo Dörr seine Markt-Arbeit wieder aufgenommen hatte.
»Na, Suselchen«, empfing er seine bessre Hälfte, »da bist du ja. Hast du woll gesehn? Bollmann seiner war wieder da. Höre, der muss dran glauben und denn brat ich ihn aus; ein bisschen Fett wird er woll haben un Sultan kann denn die Grieben kriegen … Und Hundefett, höre Susel …« und er wollte sich augenscheinlich in eine seit einiger Zeit von ihm bevorzugte Gichtbehandlungsmethode vertiefen. In diesem Augenblick aber des Spargelkorbes am Arme seiner Frau gewahr werdend, unterbrach er sich und sagte: »Na, nu zeige mal her. Hat’s denn gefleckt?«
»I nu«, sagte Frau Dörr und hielt ihm den kaum halbgefüllten Korb hin, dessen Inhalt er kopfschüttelnd durch die Finger gleiten ließ. Denn es waren meist dünne Stangen und viel Bruch dazwischen.
[14]»Höre, Susel, es bleibt dabei, du hast keine Spargel-Augen.«
»O, ich habe schon. Man bloß hexen kann ich nich.«
»Na, wir wollen nich streiten, Susel; mehr wird es doch nich. Aber zum Verhungern is es.«
»I, es denkt nich dran. Lass doch das ewige Gerede, Dörr; sie stecken ja drin un ob sie nu heute rauskommen oder morgen, is ja ganz egal. Eine düchtigeHusche, so wie die vor Pfingsten, und du sollst mal sehn. Und Regen gibt es. Die Wassertonne riecht schon wieder un die große Kreuzspinn is in die Ecke gekrochen. Aber du willst jeden Dag alles haben; das kannst du nich verlangen.«
Dörr lachte. »Na, binde man alles gut zusammen. Und den kleinen Murks auch. Und du kannst ja denn auch was ablassen.«
»Ach, rede doch nicht so«, unterbrach ihn die sich über seinen Geiz beständig ärgernde Frau, zog ihn aber, was er immer als Zärtlichkeit nahm, auch heute wieder am Ohrzipfel und ging auf das »Schloss« zu, wo sie sich’s auf dem Steinfliesen-Flur bequem machen und die Spargelbündel binden wollte. Kaum aber, dass sie den hier immer bereitstehenden Schemel bis an die Schwelle vorgerückt hatte, so hörte sie, wie schräg gegenüber in dem von der Frau Nimptsch bewohnten dreifenstrigen Häuschen ein Hinterfenster mit einem kräftigen Ruck aufgestoßen und gleich darauf eingehakt wurde. Zugleich sah sie Lene, die mit einer weiten, lilagemusterten Jacke über den Friesrock und einem Häubchen auf dem aschblonden Haar, freundlich zu ihr hinüber grüßte.
Frau Dörr erwiderte den Gruß mit gleicher Freundlichkeit und sagte dann: »Immer Fenster auf; das ist recht, Lenchen. Und fängt auch schon an heiß zu werden. Es gibt heute noch was.«
»Ja. Und Mutter hat von der Hitze schon ihr Kopfweh und da will ich doch lieber in der Hinterstube plätten. Is auch hübscher hier; vorne sieht man ja keinen Menschen.«
[15]»Hast Recht«, antwortete die Dörr. »Na, da werd ich man ein bisschen ans Fenster rücken. Wenn man so spricht, geht einen alles besser von der Hand.«
»Ach, das is lieb und gut von Ihnen, Frau Dörr. Aber hier am Fenster is ja grade die pralle Sonne.«
»Schad’t nichts, Lene. Da bring ich meinen Marchtschirm mit, altes Ding und lauter Flicken. Aber tut immer noch seine Schuldigkeit.«
Und ehe fünf Minuten um waren, hatte die gute Frau Dörr ihren Schemel bis an das Fenster geschleppt und saß nun unter ihrer Schirm-Stellage so behaglich und selbstbewusst, als ob es auf dem Gensdarmen-Markt gewesen wäre. Drinnen aber hatte Lene das Plättbrett auf zwei dicht ans Fenster gerückte Stühle gelegt und stand nun so nah, dass man sich mit Leichtigkeit die Hand reichen konnte. Dabei ging das Plätteisen emsig hin und her. Und auch Frau Dörr war fleißig beim Aussuchen und Zusammenbinden und wenn sie dann und wann von ihrer Arbeit aus ins Fenster hineinsah, sah sie, wie nach hinten zu der kleine Plättofen glühte, der für neue heiße Bolzen zu sorgen hatte.
»Du könntest mir mal ’nen Teller geben, Lene, Teller oder Schüssel.« Und als Lene gleich danach brachte, was Frau Dörr gewünscht hatte, tat diese den Bruchspargel hinein, den sie während des Sortierens in ihrer Schürze behalten hatte. »Da, Lene, das gibt ’ne Spargelsuppe. Un is so gut wie das andre. Denn dass es immer die Köppe sein müssen, is ja dummes Zeug. Ebenso wie mit’n Blumenkohl; immer Blume, Blume, die reine Einbildung. Der Strunk is eigentlich das Beste, da sitzt die Kraft drin. Und die Kraft is immer die Hauptsache.«
»Gott, Sie sind immer so gut, Frau Dörr. Aber was wird nur Ihr Alter sagen?«
»Der? Ach, Leneken, was der sagt, is ganz egal. Der red’t doch. Er will immer, dass ich den Murks mit einbinde, wie wenn’s richtige Stangen wären; aber solche Bedrü[16]gerei mag ich nich, auch wenn Bruch- und Stückenzeug gradeso gut schmeckt wie’s Ganze. Was einer bezahlt, das muss er haben, un ich ärgre mir bloß, dass so’n Mensch, dem es so zuwächst, so’n alter Geizkragen is. Aber so sind die Gärtners alle, rapschen und rapschen un können nie genug kriegen.«
»Ja«, lachte Lene, »geizig is er und ein bisschen wunderlich. – Aber eigentlich doch ein guter Mann.«
»Ja, Leneken, er wäre so weit ganz gut un auch die Geizerei wäre nich so schlimm un is immer noch besser als die Verbringerei, wenn er man nich so zärtlich wäre. Du glaubst es nich, immer is er da. Un nu sieh ihn dir an. Es is doch eigentlich man ein Jammer mit ihm un dabei richtige Sechsundfünfzig un vielleicht is es noch ein Jahr mehr. Denn lügen tut er auch, wenn’s ihm gerade passt. Un da hilft auch nichts, gar nichts. Ich erzähl ihm immer von Schlag und Schlag und zeig ihm welche, die so humpeln und einen schiefen Mund haben, aber er lacht bloß immer und glaubt es nich. Es kommt aber doch so. Ja, Leneken, ich glaub es ganz gewiss, dass es so kommt. Und vielleicht balde. Na, verschrieben hat er mir alles un so sag ich weiter nichts. Wie einer sich legt, so liegt er. Aber was reden wir von Schlag und Dörr un dass er bloß O-Beine hat. Jott, mein Lenechen, da gibt es ganz andere Leute, die sind so grade gewachsen wie ’ne Tanne. Nich wahr, Lene?«
Lene wurde hierbei noch röter, als sie schon war, und sagte: »Der Bolzen ist kalt geworden.« Und vom Plättbrett zurücktretend, ging sie bis an den eisernen Ofen und schüttete den Bolzen in die Kohlen zurück, um einen neuen herauszunehmen. Alles war das Werk eines Augenblicks. Und nun ließ sie mit einem geschickten Ruck den neuen glühenden Bolzen vom Feuerhaken in das Plätteisen niedergleiten, klappte das Türchen wieder ein und sah nun erst, dass Frau Dörr noch immer auf Antwort wartete. Sicherheitshalber aber stellte die gute Frau [17]die Frage noch mal und setzte gleich hinzu: »Kommt er denn heute?«
»Ja. Wenigstens hat er es versprochen.«
»Nu sage mal, Lene«, fuhr Frau Dörr fort, »wie kam es denn eigentlich? Mutter Nimptsch sagt nie was, un wenn sie was sagt, denn is es auch man immer so so, nich hüh un nich hott. Und immer bloß halb un so konfuse. Nu, sage du mal. Is es denn wahr, dass es in Stralau war?«
»Ja, Frau Dörr, in Stralau war es, den zweiten Ostertag, aber schon so warm, als ob Pfingsten wär, und weil Lina Gansauge gern Kahn fahren wollte, nahmen wir einen Kahn und Rudolf, den Sie ja wohl auch kennen, und der ein Bruder von Lina ist, setzte sich ans Steuer.«
»Jott, Rudolf. Rudolf is ja noch ein Junge.«
»Freilich. Aber er meinte, dass er’s verstünde, und sagte bloß immer: ›Mächens, ihr müsst still sitzen; ihr schunkelt so‹, denn er spricht so furchtbar berlinsch. Aber wir dachten gar nicht dran, weil wir gleich sahen, dass es mit seiner ganzen Steuerei nicht weit her sei. Zuletzt aber vergaßen wir’s wieder und ließen uns treiben und neckten uns mit denen, die vorbeikamen und uns mit Wasser bespritzten. Und in dem einen Boote, das mit unsrem dieselbe Richtung hatte, saßen ein paar sehr feine Herren, die beständig grüßten, und in unsrem Übermut grüßten wir wieder und Lina wehte sogar mit dem Taschentuch und tat, als ob sie die Herren kenne, was aber gar nicht der Fall war, und wollte sich bloß zeigen, weil sie noch so sehr jung ist. Und während wir noch so lachten und scherzten und mit dem Ruder bloß so spielten, sahen wir mit einem Male, dass von Treptow her das Dampfschiff auf uns zukam, und wie Sie sich denken können, liebe Frau Dörr, waren wir auf den Tod erschrocken und riefen in unserer Angst Rudolfen zu, dass er uns heraussteuern solle. Der Junge war aber aus Rand und Band und steuerte bloß so, dass wir uns beständig im Kreise drehten. Und nun schrien wir und wären sicherlich überfahren worden, wenn nicht in [18]eben diesem Augenblicke das andre Boot mit den zwei Herren sich unsrer Not erbarmt hätte. Mit ein paar Schlägen war es neben uns und während der eine mit einem Bootshaken uns fest und scharf heranzog und an das eigne Boot ankoppelte, ruderte der andere sich und uns aus dem Strudel heraus und nur einmal war es noch, als ob die große, vom Dampfschiff her auf uns zukommende Welle uns umwerfen wolle. Der Capitain drohte denn auch wirklich mit dem Finger (ich sah es inmitten all meiner Angst), aber auch das ging vorüber und eine Minute später waren wir bis an Stralau heran und die beiden Herren, denen wir unsre Rettung verdankten, sprangen ans Ufer und reichten uns die Hand und waren uns als richtige Kavaliere beim Aussteigen behülflich. Und da standen wir denn nun auf der Landungsbrücke bei Tübbeckes und waren sehr verlegen und Lina weinte jämmerlich vor sich hin und bloß Rudolf, der überhaupt ein störrischer und großmäuliger Bengel is und immer gegen’s Militär, bloß Rudolf sah ganz bockig vor sich hin, als ob er sagen wollte: ›Dummes Zeug, ich hätt euch auch rausgesteuert.‹«
»Ja, so is er, ein großmäuliger Bengel; ich kenn ihn. Aber nu die beiden Herren. Das ist doch die Hauptsache …«
»Nun die bemühten sich erst noch um uns und blieben dann an dem andren Tisch und sahen immer zu uns rüber. Und als wir so gegen sieben, und es schummerte schon, nach Hause wollten, kam der eine und fragte, ›ob er und sein Kamerad uns ihre Begleitung anbieten dürften?‹ Und da lacht’ ich übermütig und sagte, ›sie hätten uns ja gerettet und einem Retter dürfe man nichts abschlagen. Übrigens sollten sie sich’s noch mal überlegen, denn wir wohnten so gut wie am andern Ende der Welt. Und sei eigentlich eine Reise.‹ Worauf er verbindlich antwortete: ›desto besser.‹ Und mittlerweile war auch der andre herangekommen … Ach, liebe Frau Dörr, es mag wohl nicht recht gewesen sein, gleich so freiweg zu sprechen, aber der eine gefiel [19]mir und sich zieren und zimperlich tun, das hab ich nie gekonnt. Und so gingen wir denn den weiten Weg, erst an der Spree und dann an dem Kanal hin.«
»Und Rudolf!«
»Der ging hinterher, als ob er gar nicht zugehöre, sah aber alles und passte gut auf. Was auch recht war; denn die Lina is ja erst achtzehn und noch ein gutes, unschuldiges Kind!«
»Meinst du?«
»Gewiss, Frau Dörr. Sie brauchen sie ja bloß anzusehn. So was sieht man gleich.«
»Ja, mehrstens. Aber mitunter auch nich. Und da haben sie euch denn nach Hause gebracht?«
»Ja, Frau Dörr.«
»Und nachher?«
»Ja, nachher. Nun Sie wissen ja, wie’s nachher kam. Er kam dann den andern Tag und fragte nach. Und seitdem ist er oft gekommen und ich freue mich immer, wenn er kommt. Gott, man freut sich doch, wenn man mal was erlebt. Es ist oft so einsam hier draußen. Und Sie wissen ja, Frau Dörr, Mutter hat nichts dagegen und sagt immer: Kind, es schad’t nichts. Eh man sich’s versieht, is man alt.«
»Ja, ja«, sagte die Dörr, »so was hab ich die Nimptschen auch schon sagen hören. Und hat auch ganz recht. Das heißt, wie man’s nehmen will und nach’m Katechismus is doch eigentlich immer noch besser und sozusagen überhaupt das Beste. Das kannst du mir schon glauben. Aber ich weiß woll, es geht nich immer und mancher will auch nich. Und wenn einer nich will, na, denn will er nich un denn muss es auch so gehn und geht auch mehrstens, man bloß, dass man ehrlich is un anständig und Wort hält. Un natürlich, was denn kommt, das muss man aushalten un darf sich nicht wundern. Un wenn man all so was weiß und sich immer wieder zu Gemüte führt, na, denn is es nich so schlimm. Un schlimm is eigentlich man bloß das Einbilden.«
[20]»Ach, liebe Frau Dörr«, lachte Lene, »was Sie nur denken. Einbilden! Ich bilde mir gar nichts ein. Wenn ich einen liebe, dann lieb ich ihn. Und das ist mir genug. Und will weiter gar nichts von ihm, nichts, gar nichts, und dass mir mein Herze so schlägt und ich die Stunden zähle bis er kommt, und nicht abwarten kann, bis er wieder da ist, das macht mich glücklich, das ist mir genug.«
»Ja«, schmunzelte die Dörr vor sich hin, »das is das Richtige, so muss es sein. Aber is es denn wahr, Lene, dass er Botho heißt? So kann doch einer eigentlich nich heißen; das is ja gar kein christlicher Name.«
»Doch, Frau Dörr.« Und Lene machte Miene, die Tatsache, dass es solchen Namen gäbe, des Weiteren zu bestätigen. Aber ehe sie dazu kommen konnte, schlug Sultan an und im selben Augenblicke hörte man deutlich vom Hausflur her, dass wer eingetreten sei. Wirklich erschien auch der Briefträger und brachte zwei Bestellkarten für Dörr und einen Brief für Lene.
»Gott, Hahnke«, rief die Dörr dem in großen Schweißperlen vor ihr Stehenden zu, »Sie drippen ja man so. Is es denn so ’ne schwebende Hitze? Un erst halb zehn. Na so viel seh ich woll, Briefträger is auch kein Vergnügen.«
Und die gute Frau wollte gehn, um ein Glas frische Milch zu holen. Aber Hahnke dankte. »Habe keine Zeit, Frau Dörr. Ein ander Mal.« Und damit ging er.
Lene hatte mittlerweile den Brief erbrochen.
»Na, was schreibt er?«
»Er kommt heute nicht, aber morgen. Ach, es ist so lange bis morgen. Ein Glück, dass ich Arbeit habe; je mehr Arbeit, desto besser. Und ich werde heut Nachmittag in Ihren Garten kommen und graben helfen. – Aber Dörr darf nicht dabei sein.« –
»I Gott bewahre.«
Und danach trennte man sich und Lene ging in das Vorderzimmer, um der Alten das von der Frau Dörr erhaltene Spargelgericht zu bringen.
[21]Viertes Kapitel
Und nun war der andre Abend da, zu dem Baron Botho sich angemeldet hatte. Lene ging im Vorgarten auf und ab, drinnen aber, in der großen Vorderstube, saß wie gewöhnlich Frau Nimptsch am Herd, um den herum sich auch heute wieder die vollzählig erschienene Familie Dörr gruppiert hatte. Frau Dörr strickte mit großen Holznadeln an einer blauen, für ihren Mann bestimmten Wolljacke, die, vorläufig noch ohne rechte Form, nach Art eines großen Vlieses auf ihrem Schoße lag. Neben ihr, die Beine bequem übereinandergeschlagen, rauchte Dörr aus einer Tonpfeife, während der Sohn in einem dicht am Fenster stehenden Großvaterstuhle saß und seinen Rotkopf an die Stuhlwange lehnte. Jeden Morgen bei Hahnenschrei aus dem Bett, war er auch heute wieder vor Müdigkeit eingeschlafen. Gesprochen wurde wenig, und so hörte man denn nichts, als das Klappern der Holznadeln und das Knabbern des Eichhörnchens, das mitunter aus seinem Schilderhäuschen herauskam und sich neugierig umsah. Nur das Herdfeuer und der Wiederschein des Abendrots gaben etwas Licht.
Frau Dörr saß so, dass sie den Gartensteg hinaufsehen und trotz der Dämmerung erkennen konnte, wer draußen, am Heckenzaun entlang, des Weges kam.
»Ah, da kommt er«, sagte sie. »Nu, Dörr, lass mal deine Pfeife ausgehen. Du bist heute wieder wie’n Schornstein un rauchst und schmookst den ganzen Tag. Un son’n Knallerballer wie deiner, der is nich für jeden.«
Dörr ließ sich solche Rede wenig anfechten, und ehe seine Frau mehr sagen oder ihre Wahrsprüche wiederholen konnte, trat der Baron ein. Er war sichtlich angeheitert, kam er doch von einer Maibowle, die Gegenstand einer Klubwette gewesen war, und sagte, während er Frau Nimptsch die Hand reichte: »Guten Tag, Mutterchen. Hoffentlich gut bei Weg’. Ah, und Frau Dörr; und Herr [22]Dörr, mein alter Freund und Gönner. Hören Sie, Dörr, was sagen Sie zu dem Wetter? Eigens für Sie bestellt und für mich mit. Meine Wiesen zu Hause, die vier Jahre von fünf immer unter Wasser stehen und nichts bringen als Ranunkeln, die können solch Wetter brauchen. Und Lene kann’s auch brauchen, dass sie mehr draußen ist; sie wird mir sonst zu blass.«
Lene hatte derweilen einen Holzstuhl neben die Alte gerückt, weil sie wusste, dass Baron Botho hier am liebsten saß; Frau Dörr aber, in der eine starke Vorstellung davon lebte, dass ein Baron auf einem Ehrenplatz sitzen müsse, war inzwischen aufgestanden und rief, immer das blaue Vlies nachschleppend, ihrem Pflegesohn zu: »Will er woll auf! Ne, ich sage. Wo’s nich drin steckt, da kommt es auch nich.« Der arme Junge fuhr blöd und verschlafen in die Höh und wollte den Platz räumen, der Baron litt es aber nicht. »Ums Himmels willen, liebe Frau Dörr, lassen Sie doch den Jungen. Ich sitz am liebsten auf einem Schemel, wie mein Freund Dörr hier.«
Und damit schob er den Holzstuhl, den Lene noch immer in Bereitschaft hatte, neben die Alte und sagte, während er sich setzte: »Hier neben Frau Nimptsch; das ist der beste Platz. Ich kenne keinen Herd, auf den ich so gern sähe; immer Feuer, immer Wärme. Ja, Mutterchen, es ist so; hier ist es am besten.«
»Ach, du mein Gott«, sagte die Alte. »Hier am besten! Hier bei ’ner alten Wasch- und Plättefrau.«
»Freilich. Und warum nicht? Jeder Stand hat seine Ehre. Waschfrau auch. Wissen Sie denn, Mutterchen, dass es hier in Berlin einen berühmten Dichter gegeben hat, der ein Gedicht auf seine alte Waschfrau gemacht hat?«
»Is es möglich?«
»Freilich ist es möglich. Es ist sogar gewiss. Und wissen Sie, was er zum Schluss gesagt hat? Da hat er gesagt, er möchte so leben und sterben wie die alte Waschfrau. Ja, das hat er gesagt.«
[23]»Is es möglich?« simperte die Alte noch einmal vor sich hin.
»Und wissen Sie, Mutterchen, um auch das nicht zu vergessen, dass er ganz Recht gehabt hat und dass ich ganz dasselbe sage? Ja, Sie lachen so vor sich hin. Aber sehen Sie sich mal um hier, wie leben Sie? Wie Gott in Frankreich. Erst haben Sie das Haus und diesen Herd und dann den Garten und dann Frau Dörr. Und dann haben Sie die Lene. Nicht wahr? Aber wo steckt sie nur?«
Er wollte noch weiter sprechen, aber im selben Augenblicke kam Lene mit einem Kaffeebrett zurück, auf dem eine Karaffe mit Wasser samt Apfelwein stand, Apfelwein, für den der Baron, weil er ihm wunderbare Heilkraft zuschrieb, eine sonst schwer begreifliche Vorliebe hatte.
»Ach Lene, wie du mich verwöhnst. Aber du darfst es mir nicht so feierlich präsentieren, das ist ja wie wenn ich im Klub wäre. Du musst es mir aus der Hand bringen, da schmeckt es am besten. Und nun gib mir deine Patsche, dass ich sie streicheln kann. Nein, nein, die Linke, die kommt von Herzen. Und nun setze dich da hin, zwischen Herr und Frau Dörr, dann hab ich dich gegenüber und kann dich immer ansehn. Ich habe mich den ganzen Tag auf diese Stunde gefreut.«
Lene lachte.
»Du glaubst es wohl nicht? Ich kann es dir aber beweisen, Lene, denn ich habe dir von der großen Herren- und Damen-Fête, die wir gestern hatten, was mitgebracht. Und wenn man was zum Mitbringen hat, dann freut man sich auch auf die, die’s kriegen sollen. Nicht wahr, lieber Dörr?«
Dörr schmunzelte, Frau Dörr aber sagte: »Jott, der. Der un mitbringen. Dörr is bloß für rapschen und sparen. So sind die Gärtners. Aber neugierig bin ich doch, was der Herr Baron mitgebracht haben.«
»Nun, da will ich nicht lange warten lassen, sonst denkt meine liebe Frau Dörr am Ende, dass es ein goldener Pan[24]toffel ist oder sonst was aus dem Märchen. Es ist aber bloß das.«
Und dabei gab er Lenen eine Tüte, daraus, wenn nicht alles täuschte, das gefranzte Papier einiger Knallbonbons hervorguckte.
Wirklich, es waren Knallbonbons und die Tüte ging reihum.
»Aber nun müssen wir auch ziehen, Lene; halt fest und Augen zu.«
Frau Dörr war entzückt, als es einen Knall gab, und noch mehr, als Lenes Zeigefinger blutete. »Das tut nich weh, Lene, das kenn ich; das is, wie wenn sich ’ne Braut in’n Finger sticht. Ich kannte mal eine, die war so versessen drauf, die stach sich immerzu un lutschte und lutschte, wie wenn es Wunder was wäre.«
Lene wurde rot. Aber Frau Dörr sah es nicht und fuhr fort: »Und nu den Vers lesen, Herr Baron.«
Und dieser las denn auch:
»In Liebe selbstvergessen sein,
Freut Gott und die lieben Engelein.«
»Jott«, sagte Frau Dörr und faltete die Hände. »Das is ja wie aus’n Gesangbuch. Is es denn immer so fromm?«
»I bewahre«, sagte Botho. »Nicht immer. Kommen Sie, liebe Frau Dörr, wir wollen auch mal ziehen und sehn, was dabei herauskommt.«
Und nun zog er wieder und las:
»Wo Amors Pfeil recht tief getroffen,
Da stehen Himmel und Hölle offen.«
»Nun, Frau Dörr, was sagen Sie dazu? das klingt schon anders; nicht wahr?«
»Ja«, sagte Frau Dörr, »anders klingt es. Aber es gefällt mir nicht recht … Wenn ich einen Knallbonbon ziehe …«
»Nun?«
»Da darf nichts von Hölle vorkommen, da will ich nich hören, dass es so was gibt.«
»Ich auch nicht«, lachte Lene. »Frau Dörr hat ganz [25]Recht; sie hat überhaupt immer Recht. Aber das ist wahr, wenn man solchen Vers liest, da hat man immer gleich was zum Anfangen, ich meine zum Anfangen mit der Unterhaltung, denn anfangen is immer das Schwerste, gerade wie beim Briefschreiben; und ich kann mir eigentlich keine Vorstellung machen, wie man mit so viel fremden Damen (und ihr kennt euch doch nicht alle) so gleich mir nichts dir nichts ein Gespräch anfangen kann.«