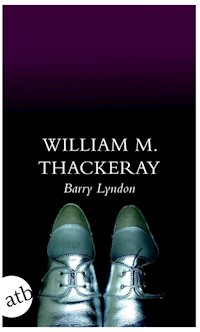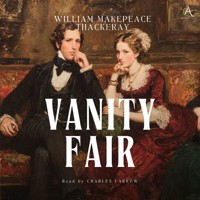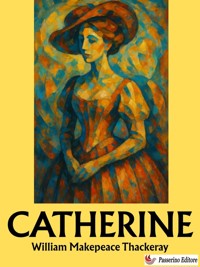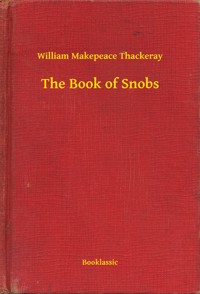Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SK Digital Classics
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
London, 1814: In der glanzvollen Welt der britischen Oberschicht bestimmt nicht Moral, sondern Eitelkeit den Wert eines Menschen - gemessen an Titeln, Beziehungen und der Kunst des schönen Scheins. Inmitten dieser Gesellschaft treffen zwei junge Frauen aufeinander, deren Schicksale sich verflechten werden. Die mittellose, aber scharfsinnige Becky Sharp und ihre gutmütige Freundin Amelia Sedley könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Amelia auf die wahre Liebe hofft, steigt die verführerische Becky mit List in der Gesellschaft auf. In William Makepeace Thackerays Meisterwerk "Vanity Fair" – zu Deutsch "Jahrmarkt der Eitelkeiten" – entfaltet sich ein meisterhaftes Panorama menschlicher Schwächen. Die beiden Freundinnen werden in ein Spiel aus Intrigen verstrickt, in dem ihre Werte und Loyalitäten auf eine harte Probe gestellt werden. Mit beißendem Witz und psychologischer Präzision enthüllt dieser packende Gesellschaftsroman die Mechanismen sozialer Macht und lässt die Masken der "feinen Gesellschaft" fallen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1468
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Makepeace Thackeray
Jahrmarkt der Eitelkeiten
Vollständige deutsche Ausgabe von „Vanity Fair“
Novelaris Verlag 2024
ISBN: 978-3-68931-076-9
Inhaltsverzeichnis
Vor dem Vorhang
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
1O. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
Cover
Table of Contents
Text
Vor dem Vorhang
Während der Direktor des Puppentheaters vor dem Vorhang auf den Brettern sitzt und über den Jahrmarkt schaut, befällt ihn beim Anblick des bunten Treibens eine tiefe Melancholie. Da wird gegessen und getrunken, geliebt und kokettiert, gelacht und geweint, geraucht, betrogen, gestritten, getanzt und gegeigt, da drängen sich Großmäuler im Getümmel, Stutzer machen Frauen schöne Augen, Spitzbuben leeren Taschen, und Polizisten sind auf der Wacht; da schreien Quacksalber (andere Quacksalber, die Pest soll sie holen!) vor ihren Buden, und Bauerntölpel starren zu den flitterglänzenden Tänzerinnen und den armen, alten, geschminkten Clowns hinauf, während die Langfinger sich hinten an ihren Taschen zu schaffen machen. Ja, das ist der Jahrmarkt der Eitelkeit; gewiss kein moralischer Ort und auch kein lustiger, wenn es auch lärmend genug zugeht. Seht euch die Gesichter der Schauspieler und Possenreißer an, wenn sie von der Arbeit zurückkommen, wie der Hanswurst sich die Schminke aus dem Gesicht wäscht, ehe er sich mit seiner Frau und seinen kleinen Hanswürstchen hinter der Jahrmarktsbude zum Essen setzt. Bald geht der Vorhang auf, und er wird Purzelbäume schlagen und schreien: „Seid ihr alle da?“
Wenn ein nachdenklicher Mensch über solch einen Vergnügungsort wandelt, wird er vermutlich weder von seiner noch anderer Leute Fröhlichkeit überwältigt werden. Hier und da rührt und belustigt ihn wohl eine humorvolle oder ergreifende Episode – ein niedliches Kind, das eine Pfefferkuchenbude betrachtet; ein hübsches Mädchen, das errötend den Worten ihres Liebhabers lauscht, während er ihr ein Geschenk aussucht; der arme Hanswurst dort hinter dem Wagen, der inmitten seiner braven Familie, die von seinen Kunststücken lebt, an seinem Knochen nagt. Der allgemeine Eindruck aber ist eher melancholisch als heiter. Wenn du nach Hause kommst, so setzt du dich in ernster, nachdenklicher, milder Stimmung hin und wendest dich deinen Büchern oder deinen Geschäften zu.
Eine andere Moral als die habe ich unserer Geschichte vom „Jahrmarkt der Eitelkeit“ nicht unterzulegen. Manche betrachten Jahrmärkte überhaupt als etwas Unmoralisches und meiden sie mit ihrer Familie und den Dienstboten: vielleicht haben sie recht. Aber die, die anders denken, träge sind oder wohlwollend oder sarkastisch, treten vielleicht auf eine halbe Stunde näher, um sich die Vorstellungen anzusehen. Es gibt da alle möglichen Bilder: fürchterliche Kämpfe, großartiges Kunstreiten; Szenen aus dem Leben der vornehmen Welt und solche aus dem Mittelstand; ein bisschen Liebe für die Sentimentalen und ein paar komische leichte Szenen. Das Ganze ist umrahmt von entsprechenden Kulissen und von den Kerzen des Verfassers brillant beleuchtet.
Was soll der Direktor des Puppentheaters noch sagen? – Er muss für die freundliche Aufnahme danken, die das Stück bei den achtbaren Leitern der öffentlichen Presse, beim hohen und niederen Adel und bei dem verehrungswürdigen Publikum überhaupt gefunden hat, als er mit seinem Theater in allen bedeutenden Städten Englands herumkam. Der Gedanke, dass seine Puppen den Beifall der besten Gesellschaft des Königreiches gefunden haben, macht ihn stolz. Von der berühmten kleinen Marionette Becky wurde gesagt, sie sei ungemein gelenkig und bewege sich sehr lebhaft am Draht. Die Puppe Amelia hat der Künstler ebenfalls mit größter Sorgfalt geschnitzt und angezogen, dennoch hat sie nur einen kleineren Kreis von Bewunderern gehabt. Die Figur Dobbin tanzt sehr drollig und natürlich, wenn es auch etwas unbeholfen wirkt. Dem Tanz der kleinen Jungen haben einige gern zugesehen; und man achte bitte auf die reich gekleidete Figur des schurkischen Adligen, bei dem keine Kosten gescheut wurden und den der Teufel am Ende dieser Sondervorstellung holen wird. Hiermit, und mit einer tiefen Verbeugung vor seinen Gönnern, zieht sich der Theaterdirektor zurück, und der Vorhang geht auf.
London, 28. Juni 1848
1. Kapitel
Chiswick Mall
Im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts fuhr an einem sonnigen Junimorgen vor dem mächtigen eisernen Tor von Miss Pinkertons Mädchenpensionat in der Chiswick Mall eine große Familienkutsche vor, gezogen von zwei wohlgenährten Pferden mit glänzendem Geschirr. Sie wurden von einem beleibten Kutscher mit Dreispitz und Perücke in einem Tempo von vier Meilen pro Stunde gelenkt. Ein schwarzer Diener, der neben dem beleibten Kutscher auf dem Bock döste, streckte seine krummen Beine, sobald der Wagen an Miss Pinkertons glänzendem Messingschild hielt, und als er die Klingel zog, sah man wenigstens zwanzig junge Köpfe aus den schmalen Fenstern des stattlichen alten Backsteingebäudes lugen. Ja, ein genauer Beobachter hätte sogar das rote Näschen der gutmütigen Miss Jemima Pinkerton über einigen Geranientöpfen am Fenster des Empfangsraumes der Dame selbst erblicken können.
„Es ist die Kutsche von Mrs. Sedley, Schwester“, sagte Miss Jemima. „Sambo, der schwarze Diener, hat gerade geläutet; und der Kutscher hat eine neue rote Weste an.“
„Hast du alle für das Ausscheiden von Miss Sedley nötigen Vorbereitungen getroffen, Miss Jemima?“ fragte Miss Pinkerton, jene majestätische Dame, die Semiramis von Hammersmith, die Freundin von Doktor Johnson, die Korrespondentin von Mrs. Chapone.
„Die Mädchen sind heute Morgen um vier Uhr aufgestanden, um ihr die Koffer zu packen, Schwester“, erwiderte Miss Jemima; „wir haben ihr einen Blumenstrauß gebunden.“
„Sage lieber Bukett, Schwester Jemima, es klingt feiner.“
„Nun ja, ein Bukett, fast so groß wie ein Heuschober; ich habe zwei Flaschen Levkojenwasser für Mrs. Sedley und auch das Rezept dafür in Amelias Koffer gepackt.“
„Und ich hoffe, Miss Jemima, du hast eine Abschrift von Miss Sedleys Rechnung angefertigt; das ist sie, nicht wahr? Sehr gut – dreiundneunzig Pfund und vier Shilling. Adressiere sie bitte an John Sedley, Esquire, und siegle dieses Billett, das ich an seine Gemahlin geschrieben habe.“
Miss Jemima brachte einem eigenhändig geschriebenen Brief ihrer Schwester, Miss Pinkerton, ebenso tiefe Ehrfurcht entgegen, wie sie dem Brief eines Staatsoberhauptes entgegengebracht hätte. Nur wenn die Schülerinnen die Anstalt verließen oder wenn sie heiraten wollten, und einmal, als die arme Miss Birch an Scharlach gestorben war, schrieb Miss Pinkerton persönlich an die Eltern ihrer Schülerinnen, und Jemima war überzeugt, wenn etwas imstande sei, Mrs. Birch über den Verlust ihrer Tochter zu trösten, dann war es das fromme und beredte Schreiben, worin Miss Pinkerton ihr das Ereignis mitteilte.
Im vorliegenden Fall lautete Miss Pinkertons Billett folgendermaßen:
Chiswick, The Mall, 15. Juni 18 ..
Madame – nach ihrem sechsjährigen Aufenthalt in der Mall habe ich die Ehre und das Vergnügen, Miss Amelia Sedley ihren Eltern als junge Dame vorzustellen, die nicht unwürdig ist, in deren glänzendem, gebildetem Kreise die ihr zukommende Stellung einzunehmen. Es mangelt der liebenswürdigen Miss Sedley nicht an jenen Tugenden, welche eine junge englische Dame von vornehmer Abkunft charakterisieren, jenen Kenntnissen, die ihrer Geburt und ihrem Stand entsprechen. Ihr Fleiß und Gehorsam haben sie ihren Lehrern lieb und wert gemacht, und ihr reizendes, sanftes Wesen hat ihre älteren und ihre jüngeren Gefährtinnen bezaubert.
In der Musik, im Tanzen, in der Orthographie, in allen Arten von Handarbeiten erfüllt sie wohl die sehnlichsten Wünsche ihrer Verwandten. In der Geographie bleibt noch manches zu wünschen übrig, und eine sorgfältige und unablässige Anwendung des Rückenbrettes, täglich vier Stunden in den nächsten drei Jahren, wird zur Erlangung jener würdevollen Haltung empfohlen, die für eine junge Dame von Welt erforderlich ist.
In den Grundsätzen der Religion und Moral wird sich Miss Sedley einer Anstalt würdig erweisen, die durch die Gegenwart des großen Lexikographen und die Gönnerschaft der bewunderungswürdigen Mrs. Chapone geehrt worden ist. Bei ihrem Scheiden von der Mall nimmt Miss Amelia die Herzen ihrer Gefährtinnen und die liebevolle Hochachtung ihrer Lehrerin mit sich, welche die Ehre hat zu zeichnen als
Ihre gehorsamst ergebene Dienerin Barbara Pinkerton.
PS: Miss Sharp begleitet Miss Sedley. Es wird ausdrücklich gebeten, dass Miss Sharp ihren Aufenthalt am Russell Square nicht länger als zehn Tage ausdehnt. Die vornehme Familie, die sie eingestellt hat, wünscht ihre Dienste baldmöglichst in Anspruch zu nehmen.
Als Miss Pinkerton diesen Brief beendet hatte, schrieb sie ihren und Miss Sedleys Namen auf das Vorsatzblatt eines Exemplars von Johnsons Wörterbuch, jenem interessanten Werk, welches sie jeder Schülerin beim Ausscheiden zu überreichen pflegte. Auf dem Deckel des Buches konnte man die „Zeilen an eine junge Dame bei ihrem Abgang von Miss Pinkertons Schule in der Mall, von dem seligen, hochverehrten Doktor Samuel Johnson“ lesen. In der Tat führte diese majestätische Dame den Namen des Lexikographen ständig auf den Lippen, und ein Besuch, den er ihr abgestattet hatte, war die Ursache ihres Rufes und ihres Vermögens geworden.
Nachdem Miss Jemima von ihrer älteren Schwester aufgefordert worden war, „das Wörterbuch“ aus dem Schrank zu holen, hatte sie dem erwähnten Behältnis zwei Exemplare entnommen. Als Miss Pinkerton die Widmung in das erste geschrieben hatte, reichte ihr Jemima mit zweifelnder und schüchterner Miene das andere.
„Für wen soll das sein, Miss Jemima?“ fragte Miss Pinkerton äußerst kühl.
„Für Becky Sharp“, erwiderte Jemima, heftig zitternd, und ihr welkes Gesicht wurde rot bis zum Halse, als sie ihrer Schwester den Rücken wandte. „Für Becky Sharp, sie geht ja auch.“
„MISS JEMIMA!“ rief Miss Pinkerton in den größten Großbuchstaben. „Bist du bei Sinnen? Stell das Wörterbuch in den Schrank zurück und wage in Zukunft nicht mehr, dir eine solche Freiheit herauszunehmen!“
„Ach, Schwester, es kostet doch nur zwei Shilling und neun Pence, und die arme Becky wird sich grämen, wenn sie keins bekommt.“
„Schick Miss Sedley sofort zu mir“, sagte Miss Pinkerton. Und so eilte die arme Jemima, verwirrt und ängstlich, ohne noch ein Wort zu wagen, davon.
Miss Sedleys Vater war ein ziemlich vermögender Kaufmann in London, während Miss Sharp Lehrschülerin war, für die Miss Pinkerton genug getan zu haben glaubte, auch ohne ihr beim Scheiden die hohe Ehre des Wörterbuches zuteilwerden zu lassen.
Briefe von Schulvorsteherinnen sind kaum vertrauenswürdiger als Grabinschriften; wie es aber doch bisweilen vorkommt, dass ein Mensch das Zeitliche segnet und die Lobpreisungen des Steinmetzen über seinen Gebeinen verdient, also wirklich ein guter Christ, ein guter Vater, ein gutes Kind, eine gute Ehefrau oder ein guter Ehemann gewesen ist, also wirklich eine seinen Tod betrauernde, verzweifelte Familie hinterlässt, so kommt es auch hin und wieder in Mädchen- oder Knabenschulen vor, dass der Schüler die Lobpreisungen des selbstlosen Lehrers verdient. Miss Amelia Sedley nun war eine junge Dame dieser besonderen Art und verdiente nicht nur alles, was Miss Pinkerton zu ihrem Lobe sagte, sondern besaß noch viele andere liebenswerte Eigenschaften, die die wichtigtuerische alte Minerva von einem Weibe infolge des Rang- und Altersunterschiedes zwischen ihr und ihrer Schülerin nicht zu sehen vermochte. Denn Amelia konnte nicht nur singen wie eine Lerche oder eine Billington, tanzen wie Hillisberg oder Parisot, prächtig sticken und war fehlerfrei in der Rechtschreibung wie das Wörterbuch selbst, sondern sie besaß auch ein so gutes, freundliches, weiches, sanftes, großmütiges Herz, dass sie die Liebe von jedermann in ihrer Umgebung gewann, von der Minerva bis herab zu der armen Scheuermagd und der Tochter der einäugigen Kuchenfrau, die den jungen Damen in der Mall ihre Ware einmal in der Woche verkaufen durfte. Von den vierundzwanzig jungen Damen waren zwölf ihre Busenfreundinnen. Sogar die neidische Miss Briggs sprach nie schlecht von ihr; die hoch-wohlgeborene Miss Saltire (Lord Dexters Enkelin) gab zu, dass sie eine elegante Erscheinung sei, und bei Miss Swartz gar, der reichen wollhaarigen Mulattin von Saint Kitts, erlebte man an dem Tage, als Amelia die Schule verließ, einen solchen Tränenausbruch, dass man nach Doktor Floss schicken und sie mit Riechsalz halb betäuben musste. Miss Pinkertons Zuneigung war ruhig und würdevoll, wie die hohe Stellung und die hervorragenden Tugenden dieser Dame nicht anders erwarten ließen; aber Miss Jemima hatte bei dem bloßen Gedanken an Amelias Abreise schon mehrmals geschluckt, und wäre nicht die Furcht vor ihrer Schwester gewesen, so hätte sie hysterische Anfälle bekommen wie die (doppelt zahlende) Erbin von Saint Kitts. Einen solchen Luxus mit seinem Schmerz zu treiben ist indessen nur besonders bevorzugten Schülerinnen gestattet. Die ehrliche Jemima dagegen hatte die Oberaufsicht über die Rechnungen, das Waschen und Ausbessern, die Puddings, das silberne und das einfache Geschirr sowie über die Dienerschaft. Aber warum sprechen wir von ihr: wahrscheinlich werden wir bis in alle Ewigkeit nichts mehr von ihr hören, und weder sie noch ihre ehrfurchtgebietende Schwester wird jemals wieder in der kleinen Welt unserer Geschichte auftauchen, wenn sich erst einmal das große, verschnörkelte, eiserne Tor geschlossen hat.
Da wir indessen viel über Amelia erfahren werden, kann es nichts schaden, wenn wir gleich zu Anfang unserer Bekanntschaft sagen, dass sie eines der besten und liebenswürdigsten Geschöpfe war, die je lebten, und es ist ein Segen, dass wir, da es sowohl im Leben als auch in Romanen (und in diesen besonders) von Bösewichten der schlimmsten Sorte nur so wimmelt, solch einen ehrlichen und gutherzigen Menschen zur Seite haben. Da sie keine Heldin ist, brauchen wir ihre Person nicht zu beschreiben; ich befürchte sogar, dass ihre Nase etwas zu klein und ihre Wangen viel zu rund und rot für eine Heldin waren; aber ihr Gesicht strahlte von blühender Gesundheit, und auf ihren Lippen lag das munterste Lächeln; sie hatte ein Paar Augen, die von lebhafter und ehrlicher guter Laune blitzten, wenn sie sich nicht gerade mit Tränen füllten, und das geschah in der Tat viel zu oft, denn das einfältige Ding konnte über einen toten Kanarienvogel oder über eine Maus, die die Katze gefangen hatte, oder über den Schluss eines Romans, war er auch noch so albern, weinen; und sagte man ihr ein unfreundliches Wort – vorausgesetzt, es fand sich jemand, der so hartherzig war –, umso schlimmer war es dann für diesen. Sogar Miss Pinkerton, diese strenge und göttergleiche Dame, schalt sie nur einmal, und obgleich sie von Gefühlen ebenso wenig verstand wie von Algebra, gab sie allen Lehrern den ausdrücklichen Befehl, mit Miss Sedley so sanft wie möglich umzugehen, da diese eine raue Behandlung nicht vertrage.
Als der Tag der Abreise kam, wusste Miss Sedley daher nicht, für welche ihrer beiden Gewohnheiten – lachen oder weinen – sie sich entscheiden sollte. Sie war froh, nach Hause zu kommen, und dabei doch wieder so unendlich traurig, die Schule verlassen zu müssen. Die letzten drei Tage folgte ihr die kleine verwaiste Laura Martin überallhin, wie ein kleines Hündchen. Sie musste mindestens vierzehn Geschenke machen und entgegennehmen und vierzehnmal das feierliche Versprechen geben, jede Woche zu schreiben. „Schicke deine Briefe an mich bitte an die Adresse meines Großvaters, des Grafen von Dexter“, sagte Miss Saltire (die, nebenbei erwähnt, etwas knauserig war). „Du brauchst dich nicht um das Porto zu kümmern, schreibe mir nur jeden Tag, mein Herzblatt“, bat die ungestüme, wollhaarige, aber großherzige und liebevolle Miss Swartz, und die kleine Laura Martin – die eben schreiben gelernt hatte – ergriff die Hand ihrer Freundin und sagte, ihr ernst ins Gesicht schauend: „Amelia, wenn ich dir schreibe, werde ich dich Mama nennen.“ Zweifellos wird Jones, der dieses Buch in seinem Klub liest, alle diese Einzelheiten äußerst töricht, unbedeutend, geschwätzig und übersentimental finden. Ja ich sehe direkt, wie Jones in diesem Augenblick –gerötet nach dem Genuss seiner Hammelkeule und einem Glas Wein – seinen Bleistift zückt, die Worte „töricht, geschwätzig“ und so weiter unterstreicht und „sehr richtig“ an den Rand schreibt. Ja, er ist ein Mann von großem Geist und bewundert das Erhabene und Heroische im Leben und im Roman; und deshalb sollte er sich lieber warnen lassen und sich anderem zuwenden.
Nun gut. Nachdem Mr. Sambo Miss Sedleys Blumen, Geschenke, Koffer und Hutschachteln in der Kutsche verstaut und dem Kutscher grinsend einen winzigen, schäbigen alten Rindslederkoffer, säuberlich mit Miss Sharps Namensschild versehen, gereicht hatte, den dieser hohnlächelnd wegpackte, schlug die Abschiedsstunde. Der Schmerz dieses Augenblicks wurde durch die vortreffliche Ansprache, die Miss Pinkerton an ihre Schülerin richtete, beträchtlich gelindert. Nicht dass die Abschiedsrede Amelia etwa zum Philosophieren verleitet hätte oder sie irgendwie mit einer Ruhe, die der Vernunft entspringt, gewappnet hätte – nein, die Rede war unerträglich langweilig, hochtrabend und ermüdend; und da Miss Sedley ihre Schulvorsteherin nicht wenig fürchtete, so wagte sie nicht, in deren Gegenwart ihrem privaten Schmerz freien Lauf zu lassen. Ein Kümmelkuchen nebst einer Flasche Wein wurden in den Empfangsraum gebracht, was sonst nur bei dem feierlichen Anlass von Elternbesuchen geschah, und nachdem man diesen Erfrischungen gehörig zugesprochen hatte, stand es Miss Sedley frei, zu gehen.
„Sie gehen doch wohl hinein und verabschieden sich von Miss Pinkerton, Becky?“ sagte Miss Jemima zu einer jungen Dame, die, von niemandem beachtet, eben mit ihrer Hutschachtel die Treppe herabkam.
„Ich kann wohl nicht umhin“, sagte Miss Sharp gelassen zu Miss Jemimas Verwunderung; und nachdem Jemima an die Tür geklopft hatte und zum Hereinkommen aufgefordert worden war, trat Miss Sharp unbekümmert vor und sagte in vollendetem Französisch: „Mademoiselle, je viens vous faire mes adieux.“
Miss Pinkerton konnte nicht Französisch; sie stand nur denen vor, die es konnten; aber sie biss sich auf die Lippen, warf den ehrwürdigen Kopf mit der römischen Nase unter dem großen feierlichen Turban in den Nacken und sagte: „Miss Sharp, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen!“ Während die Semiramis von Hammersmith sprach, machte sie eine Handbewegung, teils zum Zeichen des Abschiedes, teils um Miss Sharp Gelegenheit zu bieten, einen zu diesem Zwecke ausgestreckten Finger zu schütteln.
Miss Sharp aber faltete nur sehr kühl lächelnd die Hände, verbeugte sich und verschmähte die ihr zugedachte Ehre völlig, worauf Semiramis ihren Turban unwilliger denn je zurückwarf. Es war wirklich ein kleiner Kampf zwischen der jungen Dame und der alten Dame, und die alte zog den Kürzeren. „Der Himmel beschütze dich, mein Kind“, sagte sie und umarmte Amelia, wobei sie über des Mädchens Schulter hinweg Miss Sharp grimmig anblickte.
„Kommen Sie, Becky“, sagte Miss Jemima und zog das junge Mädchen in höchster Angst hinaus. Die Tür des Empfangsraumes schloss sich für immer hinter ihnen.
Dann folgten die Aufregung und das Abschiednehmen unten. Worte vermögen es nicht zu schildern. In der Vorhalle hatten sich alle Dienstboten versammelt, die teuren Freundinnen, überhaupt sämtliche jungen Damen und der eben angekommene Tanzlehrer; da gab es ein solches Drängen und Umarmen, Küssen und Weinen, begleitet von den aus dem Zimmer der reichen Miss Swartz dringenden hysterischen Schreien, dass keine Feder es zu beschreiben vermag und ein gefühlvolles Herz es gern übergeht.
Endlich waren die Umarmungen vorüber; sie trennten sich – das heißt, Miss Sedley trennte sich von ihren Freundinnen. Miss Sharp war einige Minuten zuvor ruhig in die Kutsche gestiegen. Niemand weinte bei ihrem Scheiden.
Der krummbeinige Samba schlug die Wagentür hinter seiner weinenden jungen Herrin zu und sprang hinten auf. „Halt!“ rief Miss Jemima, die mit einem Päckchen zum Tor stürzte. „Es sind nur ein paar belegte Brote, meine Liebe“, sagte sie zu Amelia. „Falls Sie Hunger bekommen – und Becky, Becky Sharp, hier ist ein Buch für Sie, das meine Schwester – das heißt ich – Johnsons Wörterbuch, wissen Sie? Sie dürfen uns nicht ohne das Buch verlassen. Adieu! – Fahr zu, Kutscher! Gott segne euch!“ Und das gutmütige Geschöpf eilte, ganz überwältigt von ihren Gefühlen, in den Garten zurück.
Aber siehe da! Gerade als der Wagen anfuhr, steckte Miss Sharp ihr blasses Gesicht aus dem Fenster und schleuderte tatsächlich das Buch in den Garten zurück.
Die arme Jemima fiel vor Entsetzen fast in Ohnmacht. „Nein, ich habe noch nie…“, sagte sie, „so ein unverschämtes …“ Die heftige Erregung erlaubte ihr nicht, die angefangenen Sätze zu vollenden. Die Kutsche rollte fort; das große Tor wurde geschlossen; die Glocke gab das Zeichen zur Tanzstunde. Vor den beiden jungen Damen liegt nun die Welt; deshalb: ade, Chiswick Mall!
2. Kapitel
In dem sich Miss Sharp und Miss Sedley rüsten, den Feldzug zu eröffnen
Nachdem Miss Sharp die im vorigen Kapitel erwähnte Heldentat vollbracht und gesehen hatte, wie das Wörterbuch über das Pflaster des Gärtchens geflogen und vor den Füßen der erstaunten Miss Jemima gelandet war, erschien auf dem Gesicht der jungen Dame, das bis dahin einen bleichen Hass gezeigt hatte, ein kaum liebenswürdigeres Lächeln, und sie sank in die Kutsche zurück und sagte erleichtert: „So, das war das Wörterbuch; und nun ist Chiswick Gott sei Dank überstanden.“
Miss Sedley war über Beckys trotzige Handlung fast ebenso bestürzt wie Miss Jemima, denn man möge bedenken, dass sie erst vor einer Minute die Schule verlassen hatte und dass die Eindrücke von sechs Jahren in einem so kurzen Zeitraum nicht ausgelöscht werden können. Ja, bei einigen Menschen wirken die Schrecken und die Ehrfurcht der Jugendzeit ständig fort. Ich kenne einen alten Herrn von achtundsechzig Jahren, der mir eines Morgens beim Frühstück aufgeregt berichtete: „Ich habe heute Nacht geträumt, Doktor Raine hätte mich geprügelt.“ Die Phantasie hatte ihn im Laufe jenes Abends um fünfundfünfzig Jahre zurückgeführt. Im Innersten flößten ihm Doktor Raine und sein Stock jetzt mit achtundsechzig Jahren ebenso viel Furcht ein wie mit dreizehn. Wäre nun der Doktor mit einer großen Rute jetzt, in seinen alten Tagen, vor ihm erschienen und hätte ihm mit schrecklicher Stimme zugerufen: Junge, die Hosen herunter! … Nun ja, Miss Sedley war wegen dieser Unbotmäßigkeit höchst bestürzt.
„Wie konntest du das nur tun, Rebekka!“ sagte sie endlich nach einer Pause.
„Ach, glaubst du denn, Miss Pinkerton wird herauskommen und mich in das schwarze Loch zurückholen?“ fragte Rebekka lachend.
„Nein, aber …“
„Das ganze Haus ist mir verhasst“, fuhr Miss Sharp wütend fort. „Hoffentlich bekomme ich es nie wieder zu Gesicht. Ich wollte wahrhaftig, es läge auf dem Grunde der Themse, und wenn Miss Pinkerton dort wäre – ich würde sie bestimmt nicht herausziehen. Oh, wie gern würde ich sie in dem Wasser da treiben sehen, samt ihrem Turban und allem anderen, die Schleppe hinter ihr her, und als Schiffsschnabel ihre Nase!“
„Pst!“ rief Miss Sedly.
„Warum? Wird der schwarze Diener schwatzen?“ rief Miss Rebekka lachend. „Er soll ruhig zurückgehen und Miss Pinkerton sagen, dass ich sie aus tiefster Seele hasse; ich wollte, er täte es, und ich wollte, ich hätte auch eine Möglichkeit, es ihr zu beweisen. Zwei Jahre lang hat sie mich bloß beleidigt und beschimpft. Ich bin schlechter behandelt worden als eine Küchenmagd. Nie hatte ich eine Freundin, und außer dir gab mir niemand ein freundliches Wort. Ich musste die kleinen Mädchen in den unteren Klassen beaufsichtigen und mit den größeren französisch sprechen, bis meine Muttersprache mir zum Halse heraushing. War es nicht ein köstlicher Spaß, dass ich mit Miss Pinkerton Französisch sprach? Sie kann kein Wort Französisch, aber sie ist viel zu stolz, es einzugestehen. Ich glaube, das war der Grund, weshalb sie mich laufenließ, und deshalb sei dem Himmel Dank für das Französische! Vive la France! Vive l’Empereur! Vive Bonaparte!“
„Rebekka! Rebekka, schäm dich!“ rief Miss Sedley; das war die größte Lästerung, die Rebekka je ausgestoßen hatte, denn wenn man in jenen Tagen in England sagte: „Es lebe Bonaparte!“, so war dies gleichbedeutend mit: „Es lebe Luzifer!“ – „Wie kannst du nur! Wie wagst du, so schlecht und rachsüchtig zu denken?“
„Rache mag schlecht sein, aber sie ist natürlich“, erwiderte Miss Rebekka. „Ich bin kein Engel.“ Und um die Wahrheit zu sagen, das war sie wirklich nicht.
Denn man wird im Laufe dieser kleinen Unterhaltung, während deren die Kutsche am Ufer des Flusses träge dahinrollte, bemerkt haben, dass Miss Rebekka Sharp zweimal das Bedürfnis verspürt hatte, dem Himmel zu danken; das erste Mal jedoch geschah es nur deshalb, weil er sie von einer Person befreit hatte, die sie hasste, und das zweite Mal, weil er ihr die Gelegenheit gab, ihre Feinde in Verlegenheit oder Verwirrung zu bringen. Beides waren nicht gerade liebenswürdige Beweggründe zu frommer Dankbarkeit, und freundliche und versöhnliche Gemüter würden sie auch nicht dafür gebrauchen. Miss Rebekka nun war nicht im mindesten freundlich oder versöhnlich. Dieser kleine Misanthrop (oder, besser gesagt, Misogyn, denn mit der Männerwelt hatte sie bisher wohl wenig Erfahrungen gemacht) war der Meinung, alle Welt behandele sie schlecht, wobei ziemlich sicher ist, dass alle Menschen beiderlei Geschlechts, die alle Welt schlecht behandelt, diese Behandlung auch verdienen. Die Welt ist ein Spiegel, aus dem jedem sein eigenes Bild entgegenblickt. Wirf einen mürrischen Blick hinein, und sie wird dir ein saures Gesicht zeigen, lach sie an und lach mit ihr, und sie ist dir ein lustiger, freundlicher Gefährte. Alle jungen Leute mögen nun ihre Wahl treffen. Eines ist jedoch sicher: Wenn die Welt Miss Sharp vernachlässigte, so war jedenfalls nicht bekannt, dass sie selbst jemals einem Menschen eine Freundlichkeit erwiesen hatte; man konnte auch nicht erwarten, dass vierundzwanzig junge Damen so liebenswürdig sein würden wie die Heldin dieses Buches, Miss Sedley (wir wählten sie dazu, weil sie die gutmütigste von allen war; denn was hätte uns sonst daran hindern können, Miss Swartz oder Miss Crump oder Miss Hopkins zur Heldin zu machen?). Man kann nicht erwarten, dass alle so bescheiden und sanft sind wie Miss Amelia Sedley, dass sie jede Gelegenheit ergreifen, Rebekkas Hartherzigkeit und unfreundliches Wesen zu bekämpfen und durch tausend gute Worte und Dienste Rebekka wenigstens einmal dazu bringen, ihre Feindseligkeit gegenüber dem eigenen Geschlecht zu überwinden.
Miss Sharps Vater war Künstler und hatte in Miss Pinkertons Schule Zeichenunterricht erteilt. Er war ein gewandter Mann, ein angenehmer Gesellschafter, in seiner Kunst sorglos und hatte eine starke Neigung zum Schuldenmachen und eine Vorliebe fürs Wirtshaus. War er betrunken, so pflegte er Frau und Tochter zu schlagen, und im Katzenjammer des nächsten Morgens schimpfte er auf die Welt, die sein Genie verkannte, und schmähte mit viel Witz und oftmals nicht unberechtigt seine Malerkollegen, diese Dummköpfe und Narren. Da er sich nur mühsam über Wasser hatte halten können und in Soho, wo er lebte, im Umkreis von einer Meile Schulden hatte, glaubte er seine Lage durch die Heirat mit einer jungen Französin, einer Balletttänzerin, zu verbessern. Miss Sharp erwähnte den einfachen Stand ihrer Mutter nie, sondern pflegte in späteren Jahren zu sagen, die Entrechats seien eine Adelsfamilie aus der Gascogne, und sie tat sich auf ihre Abkunft einiges zugute. Und seltsam genug: Je mehr sie im Leben vorwärtskam, desto höher stiegen auch die Vorfahren der jungen Dame in Rang und Glanz.
Rebekkas Mutter hatte irgendwo eine gewisse Erziehung genossen, und ihre Tochter sprach ein tadelloses Französisch. Dies war in jenen Tagen eine seltene Fertigkeit und verhalf ihr zu einer Anstellung bei der orthodoxen Miss Pinkerton. Denn als ihr Vater nach dem Tode der Mutter erkannt hatte, dass er sich nach seinem dritten Anfall von Delirium tremens wahrscheinlich nicht mehr erholen würde, schrieb er einen mannhaften und zugleich rührenden Brief an Miss Pinkerton, in dem er das verwaiste Kind ihrem Schutz empfahl. Dann sank er ins Grab, nachdem sich zwei Gerichtsvollzieher über seinem Leichnam gestritten hatten.
Rebekka war siebzehn Jahre alt, als sie nach Chiswick kam und als Lehrschülerin verpflichtet wurde. Wie wir gesehen haben, bestanden ihre Pflichten darin, mit den Schülerinnen französisch zu sprechen; dafür hatte sie Kost und Logis frei, bekam jährlich ein paar Guineen und durfte bei den unterrichtenden Lehrern einige Weisheitsbrocken aufschnappen.
Sie war klein und schmächtig, hatte ein blasses Gesicht, rotblondes Haar und hielt die Lider gewöhnlich gesenkt. Wenn sie aufsah, erblickte man sehr große, eigentümliche, anziehende Augen, so anziehend, dass sich Ehrwürden Mr. Crisp, der soeben von Oxford gekommene Hilfsgeistliche des Pfarrers von Chiswick, Ehrwürden Mr. Flowerdew, in Miss Sharp verliebte, als er von einem tödlichen Blick getroffen wurde, den sie von den Pensionatsbänken quer durch die Chiswicker Kirche zum Chorpult hin abschoss. Dieser betörte junge Mann trank bisweilen Tee bei Miss Pinkerton, der er durch seine Mutter vorgestellt worden war, und in einem abgefangenen Briefchen, das die einäugige Kuchenfrau hatte überbringen sollen, machte er tatsächlich eine Art Heiratsantrag. Mrs. Crisp wurde aus Buxton herbeigeholt und entfernte ihren geliebten Sohn schleunigst; schon der bloße Gedanke an einen solchen Adler im Chiswicker Taubenschlag verursachte im Busen von Miss Pinkerton einen gewaltigen Aufruhr, und sie hätte Miss Sharp weggeschickt, wenn sie nicht gezwungen gewesen wäre, dann eine Kontraktstrafe zu zahlen. Nie glaubte sie den Beteuerungen der jungen Dame, die versicherte, mit Mr. Crisp nur im Beisein der Vorsteherin beim Tee gesprochen zu haben.
Neben den vielen hochgewachsenen und kräftigen jungen Damen in der Schule wirkte Rebekka Sharp wie ein Kind. Aber sie hatte die traurige Frühreife der Armut. Manchen ungeduldigen Gläubiger hatte sie von der Tür ihres Vaters weggeplaudert; manchen Kaufmann hatte sie in gute Stimmung geschwatzt und ihm ein weiteres Mal das tägliche Brot abgeschmeichelt. Gewöhnlich saß sie bei ihrem Vater, der auf ihren Mutterwitz sehr stolz war, und hörte die Reden seiner zügellosen Kumpane mit an, die oft für Mädchenohren wenig geeignet waren. Wie sie selbst sagte, war sie jedoch nie ein Kind gewesen; schon mit acht Jahren war sie ein Weib. Warum nur ließ Miss Pinkerton einen so gefährlichen Vogel in ihren Käfig hinein!
Tatsächlich hielt die alte Dame Rebekka für das sanftmütigste Geschöpf der Welt, denn wenn ihr Vater sie mit nach Chiswick nahm, pflegte sie die Rolle der ingénue so vollendet zu spielen, dass Miss Pinkerton meinte, sie sei ein bescheidenes und unschuldiges Kind, und ein Jahr noch vor dem Abkommen über Rebekkas Aufnahme im Hause – das Mädchen war damals sechzehn Jahre alt – überreichte ihr Miss Pinkerton majestätisch mit einer kleinen Ansprache eine Puppe als Geschenk, eine Puppe, die, nebenbei erwähnt, Miss Swindle gehört hatte und ihr weggenommen worden war, als man sie ertappte, wie sie heimlich während des Unterrichts damit spielte.
Wie lachten Vater und Tochter, als sie nach der Abendgesellschaft zusammen nach Hause wanderten (es war bei Gelegenheit der Jahresschlussfeier, zu der alle Lehrer eingeladen wurden), und wie wütend wäre Miss Pinkerton geworden, hätte sie die Karikatur gesehen, die Rebekka, die kleine Schauspielerin, von ihr aus der Puppe machte! Sie pflegte mit der Puppe Gespräche zu führen, die die Newman Street, die Gerrard Street und das ganze Künstlerviertel begeisterten. Wenn die jungen Maler kamen, um mit ihrem faulen, liederlichen, gewandten, lustigen älteren Kollegen Grog zu trinken, so fragten sie Rebekka regelmäßig, ob Miss Pinkerton zu Hause sei; sie kannten die arme Seele so gut wie Mr. Lawrence oder Präsident West. Einst hatte sie die Ehre, einige Tage in Chiswick zu verbringen; sie kam mit der Idee zurück, eine andere Puppe zur Miss Jemmy zu ernennen; denn obgleich das ehrliche Geschöpf Jemima sie mit Gelee und Kuchen für drei Kinder vollgestopft und ihr beim Abschied sogar noch ein Siebenshillingstück geschenkt hatte, so war doch der Sinn fürs Lächerliche bei dem Mädchen weitaus stärker als die Dankbarkeit, und Miss Jemmy wurde ebenso unbarmherzig geopfert wie ihre Schwester.
Die Katastrophe kam, als Rebekka in ihre neue Heimat, die Mall, gebracht wurde. Die strenge Förmlichkeit des Hauses erstickte sie: die Gebete und die Mahlzeiten, die Unterrichtsstunden und die Spaziergänge, alles in klösterlicher Regelmäßigkeit, lasteten beinahe unerträglich auf ihr, und sie vermisste die freie Bettelarmut des alten Ateliers in Soho so sehr, dass jeder, auch sie selbst, glaubte, der Kummer um den Vater verzehre sie. Sie hatte ein kleines Zimmerchen unter dem Dach, wo die Dienstmädchen sie nachts schluchzend auf und ab gehen hörten; allein das geschah vor Wut und nicht vor Kummer. Bisher hatte Heuchelei ihr ferngelegen; nun, in ihrer Einsamkeit, lernte sie, sich zu verstellen. Nie war sie in weiblicher Gesellschaft gewesen; ihr Vater war trotz aller seiner Laster ein begabter Mann; sie zog seine Unterhaltung tausendmal dem Geschwätz ihrer Geschlechtsgenossinnen vor, mit denen sie jetzt zusammenkam. Die eitle Wichtigtuerei der alten Schulvorsteherin, die törichte Gutmütigkeit ihrer Schwester, das dumme Geschwätz und die Klatschsucht der größeren Schülerinnen und die kalte Korrektheit der Erzieherinnen ermüdeten sie; und das unglückselige Geschöpf besaß kein sanftes, mütterliches Herz, um sich von dem Geplappere und Geplaudere der kleineren Mädchen, die sie hauptsächlich zu betreuen hatte, besänftigen und einnehmen zu lassen. Zwei Jahre lebte sie unter ihnen, und keine trauerte ihr nach, als sie ging. Die sanfte, gütige Amelia Sedley war die einzige, der sie sich einigermaßen angeschlossen hätte; und wer fühlte sich nicht zu Amelia hingezogen?
Das Glück – die überlegene Stellung der jungen Damen um sie her erfüllten Rebekka mit unaussprechlichem Neid. „Wie vornehm sich doch dieses Mädchen aufspielt, bloß weil sie die Enkelin eines Grafen ist“, sagte sie von der einen. „Wie sie doch vor der Kreolin und ihren hunderttausend Pfund kriechen! Ich bin tausendmal gescheiter und hübscher als dieses Geschöpf mit all seinem Reichtum. Ich bin ebenso gut erzogen wie die Grafenenkelin, trotz ihres vornehmen Stammbaumes; und doch beachtet mich hier niemand. Aber gaben nicht, als ich noch bei meinem Vater lebte, die Männer ihre lustigsten Bälle und Gesellschaften auf, um den Abend mit mir zu verbringen?“ Sie beschloss, sich auf jeden Fall aus dem Gefängnis zu befreien, in dem sie sich befand, und begann nun, selbständig zu handeln und zum ersten Mal in ihrem Leben zusammenhängende Zukunftspläne zu schmieden.
Sie nutzte daher die Bildungsmöglichkeiten, welche das Haus ihr bot; und da sie gute Begabung für Musik und Sprachen zeigte, so hatte sie in kurzer Zeit das kleine Wissensgebiet durchstreift, dessen Kenntnis man bei einer Dame jener Tage für nötig hielt. Sie übte sich sehr fleißig in der Musik, und eines Tages, als die Mädchen ausgegangen waren und sie zu Hause geblieben war, hörte die Minerva sie ein Stück so gut spielen, dass sie weise überlegte, sie könne sich die Kosten eines Musiklehrers für die kleineren Mädchen sparen, und sie gab Miss Sharp zu verstehen, dass sie künftig Musikunterricht zu erteilen habe.
Zum ersten Mal und zum größten Erstaunen der majestätischen Vorsteherin weigerte sich das Mädchen. „Ich bin hier, um mit den Kindern französisch zu sprechen“, sagte Rebekka kurz, „und nicht um Musikunterricht zu geben, damit Sie Geld sparen. Bezahlen Sie es mir, dann werde ich sie unterrichten.“
Die Minerva musste klein beigeben und fand sie natürlich von dem Tage an unausstehlich. „Fünfunddreißig Jahre lang“, sagte sie mit einiger Berechtigung, „habe ich keinen Menschen erlebt, der gewagt hätte, in meinem Hause meine Autorität in Frage zu stellen. Ich habe eine Schlange an meinem Busen genährt.“
„Eine Schlange – Quatsch“, antwortete Miss Sharp der alten Dame, die vor Erstaunen fast in Ohnmacht fiel. „Sie haben mich aufgenommen, weil ich Ihnen nützlich war. Zwischen uns kann von Dankbarkeit keine Rede sein. Ich hasse diesen Ort und möchte gern weg von hier. Ich tue nur das, wozu ich verpflichtet bin, nicht mehr.“
Vergebens fragte die alte Dame, ob sie denn auch wisse, dass sie mit Miss Pinkerton spreche. Rebekka lachte ihr nur ins Gesicht, ein so schreckliches, sarkastisches, teuflisches Lachen, dass die Schulvorsteherin beinahe in Krämpfe fiel. „Geben Sie mir Geld“, sagte das Mädchen, „und Sie werden mich los – oder besorgen Sie mir, wenn Ihnen das lieber ist, eine Stelle als Erzieherin in einer adligen Familie -Sie können es, wenn Sie wollen.“ Und in ihren späteren Auseinandersetzungen kam sie immer wieder auf diesen Punkt zurück. „Verschaffen Sie mir eine Stelle – wir können einander nicht ausstehen, und ich bin bereit zu gehen.“
Die würdige Miss Pinkerton besaß zwar eine römische Nase und einen Turban und war, von Gestalt ein Grenadier, bis zu diesem Tage eine alles bezwingende Fürstin gewesen, mit dem Willen und der Stärke ihres kleinen Lehrlings konnte sie es jedoch nicht aufnehmen. Sie kämpfte und bemühte sich vergeblich, das Mädchen einzuschüchtern. Bei dem Versuch, sie einmal öffentlich zu schelten, kam Rebekka auf die bereits erwähnte Idee, ihr auf Französisch zu antworten, was die alte Frau ganz und gar aus der Fassung brachte. Um ihre Autorität in der Schule zu wahren, erwies es sich als notwendig, diese Rebellin, dieses Ungeheuer, diese Schlange, diesen Feuerbrand zu entfernen; und da sie gerade hörte, dass Sir Pitt Crawleys Familie eine Gouvernante brauchte, empfahl sie – trotz Feuerbrand und Schlange – Miss Sharp für die Stelle.
„Ich kann“, sagte sie, „Miss Sharps Betragen bestimmt nicht tadeln, wenn ich ihr Benehmen gegen mich selbst ausnehme; und ich muss zugeben, dass ihre Talente und Kenntnisse hervorragend sind. Zumindest was den Kopf betrifft, macht sie dem Erziehungssystem in meiner Schule alle Ehre.“
Auf diese Weise brachte die Vorsteherin die Empfehlung mit ihrem Gewissen in Einklang; der Kontrakt wurde gelöst, und der Lehrling war frei. Der Kampf, hier in wenigen Zeilen beschrieben, dauerte natürlich einige Monate. Und da Miss Sedley, die nun siebzehn Jahre alt war und die Schule verlassen sollte, mit Miss Sharp befreundet war („Dies ist der einzige Punkt in Amelias Betragen“, meinte Minerva, „der ihrer Lehrerin missfallen hat“), so wurde Miss Sharp von ihrer Freundin eingeladen, eine Woche bei ihr zu Hause zu verbringen, ehe sie ihre Stelle als Erzieherin in einem Privathaushalt antrat.
So begann das Leben für die beiden jungen Damen. Für Amelia war es ganz neu, frisch und glänzend, in all seiner Schönheit. Nicht ganz so neu war es für Rebekka – denn in der Tat, um die Wahrheit über die Crisp-Affäre zu sagen, hatte die Kuchenfrau jemandem, der es wieder unter Eid weitererzählte, angedeutet, dass zwischen Mr. Crisp und Miss Sharp eine ganze Menge mehr vorgekommen sei, als an die Öffentlichkeit gedrungen war, und dass sein Brief nur eine Antwort auf einen andern gewesen sei. Wer vermag aber zu sagen, wie die Sache sich wirklich verhielt? Wenn das Leben für Rebekka nun auch nicht direkt begann, so begann sie es doch wieder einmal von vorn.
Als die jungen Damen den Schlagbaum auf der Kensingtoner Chaussee erreichten, hatte Amelia ihre Gefährtinnen zwar nicht vergessen, aber doch ihre Tränen getrocknet, und sie errötete heftig und war entzückt, als ein junger Offizier der Leibgarde sie im Vorbeireiten erspähte und sagte: „Bei Gott, ein verdammt schönes Mädchen!“ Und ehe noch der Wagen am Russell Square anlangte, hatten sie viel über die Vorstellung bei Hofe geplaudert, und ob junge Damen sich bei solchem Anlass wohl puderten und Reifröcke trügen, und ob Amelia dieser Ehre wohl teilhaftig werden würde; dass sie auf jeden Fall den Ball beim Lord Mayor erleben sollte, wusste sie. Als man nun endlich zu Hause angekommen war, hüpfte Miss Amelia Sedley an Sambos Arm heraus, ein so glückliches und hübsches Mädchen wie kaum ein anderes in dem ganzen großen London. In diesem Punkte war Sambo ganz der Ansicht des Kutschers, ihr Vater war darüber einig mit der Mutter, und so dachten alle Dienstboten des Hauses, die lächelnd in der Vorhalle standen und ihre junge Herrin mit Verbeugungen und Knicksen begrüßten.
Man kann versichert sein, dass Amelia Rebekka jedes Zimmer im Hause zeigte und alle ihre Schubfächer, Bücher, das Klavier, ihre Kleider, Halsketten, Broschen, Spitzen und allerlei andere Kleinigkeiten. Rebekka musste unbedingt den weißen Karneolschmuck und die Türkisohrringe sowie ein wunderhübsches geblümtes Musselinkleid annehmen, das sie ausgewachsen hatte, das ihrer Freundin aber wie angegossen passen musste; und sie beschloss im Innern, die Mutter um Erlaubnis zu bitten, der Freundin ihren weißen Kaschmirschal schenken zu dürfen. Konnte sie ihn denn nicht entbehren, zumal ihr Bruder Joseph ihr soeben zwei aus Indien mitgebracht hatte?
Als Rebekka die zwei prächtigen Kaschmirschals sah, die Joseph Sedley seiner Schwester mitgebracht hatte, sagte sie ganz aufrichtig, „dass es herrlich sein müsse, einen Bruder zu haben“, und weckte damit sehr leicht das Mitleid der gütigen Amelia für die arme Waise, die ohne Angehörige, freundlos und allein in der Welt stand.
„Du bist nicht allein“, sagte Amelia, „du weißt, Rebekka, ich werde stets deine Freundin sein und dich wie eine Schwester lieben – ganz bestimmt.“
„Ach, hätte ich doch Eltern, wie du – gute, reiche, liebevolle Eltern, die einem jeden Wunsch erfüllen und einen mit ihrer Liebe umgeben, dem Kostbarsten, was es gibt. Mein armer Papa konnte mir nichts schenken, und ich besaß auf der ganzen Welt nur zwei Kittel! Und dann noch einen Bruder zu haben, einen lieben Bruder! Oh, wie musst du ihn liebhaben!“
Amelia lachte.
„Wie? Hast du ihn etwa nicht lieb? Wo du doch immer sagst, du liebst alle Menschen?“
„Ja, natürlich, ich habe ihn lieb, nur…“
„Nur was?“
„Nur scheint Joseph sich nicht viel darum zu kümmern, ob ich ihn liebhabe oder nicht. Als er nach zehnjähriger Abwesenheit kam, reichte er mir zwei Finger! Er ist freundlich und gut, aber er spricht selten mit mir; ich glaube, er liebt seine Pfeife viel mehr als seine…“ Aber hier stockte Amelia, denn warum sollte sie schlecht von ihrem Bruder sprechen? „Er war sehr freundlich zu mir, als ich klein war“, setzte sie hinzu; „ich war erst fünf Jahre alt, als er wegging.“
„Ist er nicht sehr reich?“ fragte Rebekka. „Alle indischen Nabobs sollen doch ungeheuer reich sein.“
„Ich glaube, er hat ein sehr großes Einkommen.“
„Und ist deine Schwägerin eine nette, hübsche Frau?“
„Hach, Joseph ist doch gar nicht verheiratet“, rief Amelia und lachte abermals.
Möglicherweise hatte sie es Rebekka schon einmal erzählt, aber die junge Dame schien es wieder vergessen zu haben; sie beteuerte eifrig, sie habe erwartet, eine Anzahl Neffen und Nichten von Amelia zu sehen. Sie sei ganz enttäuscht, Mr. Sedley unverheiratet zu finden; sie sei überzeugt, Amelia habe ihr erzählt, er sei verheiratet, und sie sei so vernarrt in kleine Kinder.
„Ich dachte, du hättest in Chiswick genug davon gehabt“, sagte Amelia, etwas verwundert über das plötzliche Interesse ihrer Freundin. In späteren Tagen hätte Miss Sharp sich niemals darauf eingelassen, Meinungen zu äußern, deren Unwahrheit so leicht aufzudecken war, allein wir dürfen nicht vergessen, dass das arme unschuldige Geschöpf erst neunzehn Jahre alt, dass sie in der Kunst, sich zu verstellen, noch wenig bewandert war, erst Erfahrungen sammeln musste. Die obigen Fragen in der Sprache des Innern dieses scharfsinnigen jungen Mädchens übersetzt, bedeuteten einfach folgendes: Wenn Mr. Joseph Sedley reich und unverheiratet ist, warum sollte ich ihn dann nicht heiraten? Ich habe zwar nur vierzehn Tage vor mir, aber es kann ja nichts schaden, wenn ich es versuche.
Sie beschloss im Innern, diesen lobenswerten Versuch zu unternehmen. Sie verdoppelte ihre Zärtlichkeit gegenüber Amelia; sie küsste das Halsband mit dem weißen Karneol, als sie es anlegte, und beteuerte, sie werde sich nie, nie davon trennen. Als die Tischglocke erklang, ging sie, wie junge Mädchen zu gehen pflegen, den Arm um die Taille ihrer Freundin geschlungen, die Treppe hinab. Als sie an der Tür des Gesellschaftszimmers anlangten, war sie so aufgeregt, dass sie kaum Mut fassen konnte einzutreten. „Fühl mal, wie mein Herz klopft, meine Liebe“, sagte sie zu ihrer Freundin.
„Ach wo“, meinte Amelia, „komm mit herein und fürchte dich nicht. Papa wird dir nichts tun.“
3. Kapitel
Rebekka vor dem Feind
Ein sehr gedrungener, kurzatmiger Mann in wildledernen Hosen und Reitstiefeln, mit mehreren, ungeheuren Halstüchern, die ihm beinahe bis an die Nase reichten, in einer rotgestreiften Weste und einem apfelgrünen Rock mit fast talergroßen Stahlknöpfen (das war das Morgenkostüm eines Stutzers jener Tage) las am Kaminfeuer Zeitung, als die beiden Mädchen hereintraten; er sprang von seinem Lehnsessel auf, errötete heftig und verbarg bei ihrem Erscheinen das Gesicht fast völlig in seinen Halstüchern.
„Es ist nur deine Schwester, Joseph“, sagte Amelia lachend und schüttelte die ihr entgegengestreckten beiden Finger. „Du weißt, ich bin jetzt für immer nach Hause gekommen; und dies ist meine Freundin, Miss Sharp, von der ich dir bereits erzählt habe.“
„Nein, niemals, auf mein Wort“, sagte der Kopf hinter dem Halstuch unter heftigem Schütteln, das heißt, ja; welch abscheulich kaltes Wetter, Miss“; und damit fing er an, aus Leibeskräften das Feuer zu schüren, obwohl es Mitte Juni war.
„Er sieht sehr gut aus“, flüsterte Rebekka Amelia vernehmlich zu.
„Meinst du?“ sagte die letztere, „ich werde es ihm sagen.“
„Nicht um alles in der Welt, Teuerste“, sagte Miss Sharp und wich so schüchtern wie ein Reh zurück. Sie hatte vorher vor dem Herrn einen ehrerbietigen, jungfräulichen Knicks gemacht, und ihre sittsamen Augen schauten so beharrlich auf den Teppich, dass es ein Wunder war, wie sie Gelegenheit gefunden hatte, ihn zu sehen.
„Ich danke dir für die schönen Schals, Bruder“, sagte Amelia zu dem Feuerschürer. „Sind sie nicht schön, Rebekka?“
„Oh, himmlisch!“ bestätigte Miss Sharp, und ihre Augen wanderten vom Teppich geradewegs zum Kronleuchter.
Joseph machte immer noch mit dem Schüreisen und der Feuerzange ein ungeheures Getöse; dabei keuchte und schnaufte er und lief so rot an, wie sein gelbes Gesicht nur erlaubte.
„Ich kann dir keine so schönen Geschenke machen, Joseph“, fuhr seine Schwester fort, „aber ich habe dir in der Schule ein Paar sehr schöne Hosenträger gestickt.“
„Guter Gott! Amelia“, rief der Bruder, ernstlich beunruhigt, „was meinst du nur?“ Und er riss mit aller Macht an der Klingelschnur, bis er sie in der Hand hielt, was den braven Burschen noch mehr verwirrte. „Um Himmels willen, sieh nach, ob mein Buggy vor der Tür steht. Ich kann nicht warten, ich muss fort. Dieser verd… Stallknecht! Ich muss fort.“
In diesem Augenblick trat der Vater der Familie herein, wie ein echter britischer Kaufmann mit den Petschaften klimpernd. „Was gibt es, Emmy?“ fragte er.
„Joseph sagt, ich soll nachsehen, ob sein – sein Buggy vor der Tür steht. Was ist ein Buggy, Papa?“
„Das ist eine einspännige Sänfte“, sagte der alte Herr, der in seiner Art ein Schalk war.
Bei diesen Worten brach Joseph in ein wildes Gelächter aus, von dem er jedoch, wie von einem Schuss getroffen, jäh abließ, als er dem Blick von Miss Sharp begegnete.
„Diese junge Dame ist deine Freundin? Miss Sharp, es freut mich, Sie zu sehen. Haben Sie und Emmy mit Joseph bereits Streit gehabt, dass er durchaus fortwill?“
„Ich versprach meinem Kameraden Bonamy, mit ihm zu speisen“, erklärte Joseph.
„Ei, ei! Sagtest du nicht deiner Mutter, du wolltest zu Hause speisen?“
„Aber so wie ich angezogen bin, ist es unmöglich.“
„Sehen Sie ihn doch an, Miss Sharp; ist er nicht schön genug, um überall zu speisen?“
Hierauf blickte Miss Sharp natürlich ihre Freundin an, und beide brachen in ein Gelächter aus, das dem alten Herrn sehr angenehm war.
„Haben Sie je bei Miss Pinkerton solch ein Paar wildlederne Hosen gesehen?“ fuhr er fort, seinen Vorteil ausnutzend.
„Um Himmels willen! Vater!“ rief Joseph.
„Da haben wir’s! Nun habe ich seine Gefühle verletzt. Mrs. Sedley, meine Liebe, ich habe die Gefühle deines Sohnes verletzt. Ich habe auf seine ledernen Hosen angespielt. Frag doch Miss Sharp, ob es stimmt! Komm, Joseph, versöhn dich mit Miss Sharp, und lasst uns essen gehen.“
„Es gibt einen Pilaw, Joseph, ganz so, wie du ihn liebst, und Papa hat den besten Steinbutt von Billingsgate mitgebracht.“
„Komm, komm, mein Junge, geh mit Miss Sharp hinunter, und ich werde mit diesen zwei jungen Damen folgen“, sagte der Vater, reichte Frau und Tochter den Arm und ging munter davon.
Wenn Miss Rebekka Sharp im Innern beschlossen hatte, diesen dicken Beau zu erobern, so glaube ich nicht, meine Damen, dass wir ein Recht haben, sie zu tadeln; denn obgleich die jungen Mädchen das Geschäft der Jagd nach dem Ehemann im allgemeinen mit geziemender Sittsamkeit ihren Mamas überlassen, so müssen wir uns doch erinnern, dass Miss Sharp keine liebevolle Mutter besaß, die diese heikle Angelegenheit für sie in Ordnung bringen könnte, und dass, wenn sie sich nicht selbst einen Mann verschaffte, niemand in der weiten Welt ihr diese Mühe abnehmen würde. Weshalb lassen sich junge Mädchen sonst in der Gesellschaft einführen, wenn nicht aus dem edlen Streben, einen Mann zu finden? Was führt sie zu Hunderten in die Bäder? Was bewegt sie, eine entsetzlich lange Saison hindurch bis fünf Uhr morgens zu tanzen? Was treibt sie, sich mit Klaviersonaten abzumühen, bei dem gerade modernen Gesangmeister für eine Guinee pro Stunde vier Lieder zu lernen, Harfe zu spielen, falls sie wohlgeformte Arme und hübsche Ellbogen haben, grüne Jägerhütchen mit Federn zu tragen, wenn nicht der Wunsch, mit diesen tödlichen Waffen einen „begehrenswerten“ jungen Mann zur Strecke zu bringen? Was veranlasst respektable Eltern, ihre Teppiche zusammenzurollen, im Hause das Unterste zuoberst zu kehren und ein Fünftel ihres Jahreseinkommens für Bälle und eisgekühlten Champagner auszugeben? Ist es bloß die Liebe zu ihresgleichen oder der echte Wunsch, junge Leute beim Tanzen glücklich zu sehen? Pah! Sie wollen ihre Töchter verheiraten; und wie die ehrliche Mrs. Sedley in der Tiefe ihres wohlwollenden Herzens bereits ein Dutzend kleiner Pläne zur Verheiratung ihrer Amelia ausgedacht hatte, so hatte auch unsere geliebte, aber schutzlose Rebekka beschlossen, ihr Möglichstes zu tun, sich einen Mann zu sichern, den sie sogar noch notwendiger brauchte als ihre Freundin. Sie besaß eine lebhafte Phantasie; außerdem hatte sie „Tausendundeine Nacht“ sowie „Guthries Geographie“ gelesen, und tatsächlich hatte sie sich beim Ankleiden zum Essen, nachdem sie Amelia gefragt hatte, ob ihr Bruder sehr reich sei, ein prachtvolles Luftschloss gebaut, dessen Herrin sie war, mit einem Ehemann irgendwo im Hintergrund (sie hatte ihn noch nicht gesehen, und seine Gestalt war daher noch etwas verschwommen); sie war geputzt mit einer unendlichen Menge von Schals, Turbanen und Diamanthalsbändern, unter den Klängen des Marsches aus „Blaubart“ auf einen Elefanten gestiegen, um dem Großmogul einen Höflichkeitsbesuch abzustatten. Bezaubernde Märchenträume! Es ist das glückliche Vorrecht der Jugend, euch zu ersinnen, und manches phantasiereiche junge Geschöpf hat schon wie Rebekka Sharp solchen Tagträumen nachgehangen.
Joseph Sedley war zwölf Jahre älter als seine Schwester Amelia. Er stand im Zivildienst der Ostindischen Kompanie, und sein Name war zu der Zeit, von der wir schreiben, in der bengalischen Abteilung des „Ostindischen Registers“ als Steuereinnehmer von Boggley Wollah aufgeführt – ein ehrenvoller und einträglicher Posten, wie man allgemein weiß. Will der Leser erfahren, zu welchen höheren Stellungen Joseph im Dienste aufstieg, so verweisen wir ihn auf die bereits erwähnte Zeitschrift.
Boggley Wollah liegt in einem schönen, einsamen, sumpfigen Dschungelgebiet, berühmt wegen seiner Schnepfenjagden, wo man nicht selten auch einen Tiger antreffen kann. Ramgunge, wo sich eine Behörde befindet, ist nur vierzig Meilen entfernt, und etwa dreißig Meilen weiter liegt ein Kavallerieposten; das alles berichtete Joseph seinen Eltern nach Hause, als er seine Steuereinnehmerstelle antrat. Er hatte ungefähr acht Jahre seines Lebens ganz allein an diesem bezaubernden Ort zugebracht, wobei er kaum häufiger als zweimal jährlich, wenn nämlich ein Truppenkommando eintraf, um die von ihm erhobenen Steuern nach Kalkutta zu bringen, je einen Christenmenschen zu Gesicht bekam.
Glücklicherweise zog er sich um diese Zeit ein Leberleiden zu, und um das zu heilen, kehrte er nach Europa zurück. Diese Krankheit wurde ihm zu einer Quelle von Freude und Unterhaltung in der Heimat. Er lebte in London nicht bei seiner Familie, sondern hatte als lebenslustiger Junggeselle eine eigene Wohnung. Ehe er nach Indien ging, war er zu jung gewesen, um an den herrlichen Vergnügungen der Lebemänner teilzuhaben; nun, bei seiner Rückkehr, stürzte er sich umso eifriger hinein. Er lenkte seine Pferde durch den Park, speiste in vornehmen Restaurants (der Orientklub bestand noch nicht), besuchte häufig die Theater, wie es in jenen Tagen Mode war, oder zeigte sich in der Oper, mühsam in enge Beinkleider gezwängt und mit Dreispitz.
Bei seiner Rückkehr nach Indien, wie auch später, pflegte er stets mit großer Begeisterung von den Freuden dieses Lebensabschnittes zu sprechen und gab zu verstehen, dass er und Brummel die tonangebenden Salonlöwen jener Zeit gewesen seien. Aber er war hier ebenso einsam wie in seinem Dschungel in Boggley Wollah. Er kannte kaum eine Seele in der Hauptstadt; und hätte er nicht seinen Doktor gehabt und seine Quecksilberpillen und das Leberleiden, so wäre er vor Langweile gestorben. Er war ein träger, mürrischer Bonvivant; der Anblick einer Dame erschreckte ihn außerordentlich, und so geschah es, dass er sich nur selten im väterlichen Kreise am Russell Square blicken ließ, wo es überaus lustig zuging und wo die Späße seines gutmütigen alten Vaters seine Eigenliebe verletzten.
Sein Leibesumfang verursachte Joseph viele besorgte Gedanken und Unruhe. Dann und wann machte er auch einen verzweifelten Versuch, sich seines überflüssigen Fettes zu entledigen; aber seine Trägheit sowie seine Vorliebe fürs Wohlleben wurden dieser Reformbestrebungen bald wieder Herr, und er kehrte wieder zu seinen drei Mahlzeiten täglich zurück.
Er war niemals gut gekleidet, obwohl er sich ungeheure Mühe gab, seine dicke Person zu putzen, und Stunden mit dieser Beschäftigung verbrachte. Sein Diener verschaffte sich ein Vermögen mit seiner alten Garderobe; auf seinem Toilettentisch standen ebenso viele Pomaden und Essenzen wie bei einer welkenden Schönheit; um eine Taille zu bekommen, hatte er alle damals erfundenen Leibgurte, alle Korsette und Leibbinden ausprobiert. Wie die meisten dicken Menschen ließ er sich die Kleider sehr eng machen und wählte stets die glänzendsten Farben und den jugendlichsten Schnitt. Hatte er nachmittags endlich seine Toilette beendet, so fuhr er mit niemand in den Park und kam dann zurück, um sich abermals anzukleiden und mit niemand im Piazza-Kaffeehaus zu speisen. Er war eitel wie ein Mädchen, und vielleicht war seine außerordentliche Schüchternheit eine Folge seiner außerordentlichen Eitelkeit. Gelingt es Miss Rebekka bei ihrem Eintritt ins Leben, ihn zu besiegen, so ist sie ein Mädchen von ungewöhnlicher Gewitztheit.
Ihr erster Schachzug bewies beträchtliche Gewandtheit. Als sie Sedley einen gutaussehenden Mann nannte, wusste sie, dass Amelia es ihrer Mutter erzählen würde, die es wahrscheinlich Joseph wiedersagen oder sich doch jedenfalls über das Kompliment für ihren Sohn freuen würde. Allen Müttern tut das wohl. Hätte man der Sycorax gesagt, ihr Sohn Caliban sei schön wie Apollo, so hätte es die Hexe gefreut. Vielleicht hörte Joseph Sedley das Kompliment auch selbst – Rebekka sprach ja laut genug –, und tatsächlich hatte er es auch gehört. Da er sich insgeheim für einen schönen Mann hielt, durchzuckte das Lob jede Fiber seines dicken Körpers und ließ ihn vor Wonne erbeben. Dann kam aber ein Rückschlag. Macht das Mädchen sich über mich lustig? dachte er, und darauf stürzte er, wie wir gesehen haben, geradewegs zur Klingel und wollte fort, bis die Scherze seines Vaters und die Bitten seiner Mutter ihn einhalten ließen und zum Bleiben bewogen.
Zweifelnd und erregt führte er die junge Dame zum Essen. Hält sie mich wirklich für schön, dachte er, oder nimmt sie mich nur auf den Arm? Wir haben davon gesprochen, Joseph Sedley sei eitel wie ein Mädchen. Der Himmel beschütze uns! Die Mädchen brauchen nur den Spieß umzudrehen und von ihresgleichen zu behaupten: „Sie ist so eitel wie ein Mann“, und sie haben vollkommen recht. Das bärtige Geschlecht ist ebenso erpicht auf Lob, ebenso wählerisch in Bezug auf die Kleidung, ebenso stolz auf persönliche Vorzüge, sich ebenso seiner Unwiderstehlichkeit bewusst wie je eine Kokette auf der Welt.
So gingen sie also die Treppe hinab, Joseph über und über rot, Rebekka sehr sittsam, die grünen Augen zu Boden geschlagen. Sie war weiß gekleidet, die bloßen Schultern weiß wie Schnee – ein Bild von Jugend, schutzloser Unschuld und bescheidener, jungfräulicher Naivität.
Ich muss sehr sanft sein, dachte Rebekka, und recht viel Interesse für Indien an den Tag legen.
Nun haben wir gehört, dass Mrs. Sedley einen schönen Curry zubereitet hatte, gerade wie ihr Sohn ihn mochte, und im Laufe des Essens wurde Rebekka eine Portion davon angeboten. „Was ist das?“ wollte sie wissen und richtete einen fragenden Blick auf Mr. Joseph.
„Köstlich“, erwiderte er, mit vollem Munde kauend. Sein Gesicht war rot von der heiligen Handlung des Hinunterschlingens. „Mutter, er ist so gut wie meine eigenen Currys in Indien.“
„Ach, wenn es ein indisches Gericht ist“, sagte Miss Rebekka, „muss ich es versuchen. Ich bin sicher, alles, was von dort kommt, muss gut sein.“
„Gib doch Miss Sharp etwas Curry, meine Liebe“, sagte Mr. Sedley lachend.
Rebekka hatte das Gericht noch nie zuvor gekostet.
„Finden Sie ihn auch so gut wie alles andere, was aus Indien kommt?“ fragte Mr. Sedley.
„Oh, vortrefflich!“ antwortete Rebekka, der der Cayennepfeffer Höllenqualen bereitete.
„Essen Sie ein Chili dazu, Miss Sharp“, sagte Joseph, voll ehrlicher Anteilnahme.
„Ein Chili“, keuchte Rebekka, nach Luft schnappend. „Ja, ja!“ Sie glaubte, ein Chili sei, dem Namen nach zu urteilen, etwas Kühlendes, und ließ sich daher eins geben.
„Wie frisch und grün sie aussehen“, meinte sie und steckte eins in den Mund. Es brannte aber noch mehr als der Curry; Fleisch und Blut konnten es nicht länger ertragen. Sie legte die Gabel weg. „Wasser, um Himmels willen, Wasser!“ rief sie. Mr. Sedley brach in ein lautes Gelächter aus (er war ein ungehobelter Mann und an der Börse tätig, wo man handgreifliche Scherze liebte). „Sie sind echt indisch, das kann ich Ihnen versichern“, sagte er. „Sambo, gib Miss Sharp Wasser.“
Das väterliche Lachen rief bei Joseph ein Echo hervor, der den Spaß äußerst gelungen fand. Die Damen lächelten nur wenig. Sie dachten, die arme Rebekka habe zu viel auszustehen. Diese hätte zwar den alten Sedley gern erwürgt, aber sie schluckte ihren Ärger hinunter, wie vorher den abscheulichen Curry, und sagte, sobald sie sprechen konnte, aufgeräumt, mit drolliger Miene: „Ich hätte an den Pfeffer denken sollen, den die persische Prinzessin aus ›Tausendundeiner Nacht‹ in die Sahnetörtchen streut. Streut man in Indien Cayennepfeffer in die Sahnetörtchen, mein Herr?“
Der alte Sedley begann zu lachen und dachte, Rebekka sei doch ein munteres Ding. Joseph aber sagte bloß: „Sahnetörtchen, Miss? Unsere Sahne in Bengalen ist herzlich schlecht. Gewöhnlich brauchen wir Ziegenmilch; und, weiß Gott, der gebe ich jetzt den Vorzug.“
„Nun werden Sie wohl nicht mehr alles, was aus Indien kommt, lieben, Miss Sharp?“ fragte der alte Herr; als sich aber die Damen nach dem Essen zurückgezogen hatten, bemerkte der schlaue alte Bursche zu seinem Sohn: „Nimm dich in Acht, Joe; das Mädchen hat es auf dich abgesehen.“
„Pah, Unsinn!“ sagte Joe, höchlich geschmeichelt. „Ich erinnere mich, da wir ein Mädchen in Dumdum, eine Tochter Cutlers von der Artillerie, die später Lance, den Stabsarzt, heiratete. Sie hat mir im Jahre 1804 nachgestellt, mir und Mulligatawney, von dem ich vor dem Essen erzählt habe, ein verteufelt tüchtiger Kerl, dieser Mulligatawney, er ist jetzt Beamter in Budgebudge und wird in fünf Jahren sicherlich im Gouvernementsrat sein. Kurz und gut, die Artillerie gab einen Ball, und Quintin vom Königlichen Vierzehnten Regiment sagte zu mir: ›Sedley‹, sagte er, ›ich wette dreizehn gegen zehn, dass Sophie Cutler entweder Sie oder Mulligatawney noch vor der Regenzeit geangelt hat.‹ – ›Es gilt‹, sage ich; und meiner Treu – dieser Rotwein ist sehr gut. Von Adamson oder Carbonell?“
Ein leises Schnarchen war die einzige Antwort: der ehrliche Börsenmakler war eingeschlafen, und so konnte Joseph den Rest seiner Geschichte für heute nicht mehr an den Mann bringen. Aber er ist in der Gesellschaft von Männern stets sehr mitteilsam und hat diese köstliche Geschichte viele Dutzend Male seinem Arzt, Doktor Gollop, erzählt, wenn dieser kam, um sich nach der Leber und den Quecksilberpillen zu erkundigen.
Da Joseph Sedley sehr krank war, begnügte er sich mit einer Flasche Rotwein, abgesehen von seinem Madeira beim Mittagessen. Außerdem führte er sich einige Teller voll Erdbeeren mit Sahne sowie vierundzwanzig Biskuitküchlein, die unbeachtet neben ihm auf einem Teller lagen, zu Gemüte, und in Gedanken (Romanschreiber haben das Vorrecht, alles zu wissen) beschäftigte er sich viel mit dem Mädchen droben. Ein nettes, lustiges, heiteres, junges Geschöpf, dachte er bei sich. Wie sie mich anblickte, als ich bei Tisch ihr Taschentuch aufhob! Sie ließ es zweimal fallen. Wer singt wohl im Salon? Soll ich hinaufgehen und nachsehen?
Aber seine Schüchternheit überfiel ihn mit unbezwingbarer Gewalt. Sein Vater schlief, sein Hut lag in der Vorhalle, und ganz in der Nähe, auf der Southampton Row, war ein Droschkenstand. „Ich werde in die ›Vierzig Räuber‹ gehen“, sagte er, „Miss Decamp tanzt“; und mit diesen Worten schlich er sich auf Zehenspitzen davon und verschwand, ohne seinen würdigen Vater zu wecken.
„Da geht Joseph“, sagte Amelia, die aus dem offenen Salonfenster sah, während Rebekka Klavier spielte und sang.
„Miss Sharp hat ihn verscheucht“, bemerkte Mrs. Sedley. „Armer Joe, warum ist er aber auch so schüchtern?“
4. Kapitel
Die grünseidene Börse