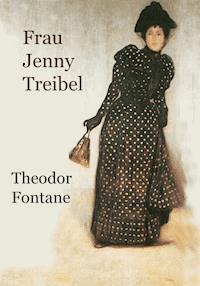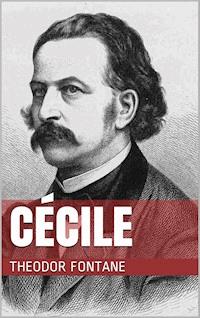Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Basierend auf einer Sommerreise mit einem Freund durch Schottland ist "Jenseits des Tweed" ein früher Klassiker der Reiseliteratur. Mit einem Augenmerk auf historische Ereignisse und Schauplätze berichtet Fontane anschaulich und lebhaft von den Stationen seiner Schottlandreise. Inspiriert von literatischen Meistern wie Sir Walter Scott und Shakespeare gelingt es Fontane den rauen Charme der schottischen Landschaften einzufangen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theodor Fontane
Jenseits des Tweed
Saga
Jenseits des Tweed
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1860, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726997422
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Vorbemerkung
Eine Reise an der Seite eines Freundes ist eine Freundschaftsprobe, wie die Ehe eine Liebesprobe ist. Wir haben sie bestanden. Wem anders könnt' ich dieses Buch zueignen, als Dir, dem besten, dem nachsichtigsten aller Reisegefährten. Freilich, je mehr ich empfunden habe, wie gut sich's mit Dir wandert, desto lebhafter ist auch die Rückerinnerung an einen alten Pakt in mir geworden, an ein gegenseitiges, halb verjährtes Versprechen, an das diese Zeilen Dich leise mahnen mögen.
Entsinnst Du Dich des Silvestertages 1846? Wie gestern stehen die Stunden vor meiner Seele, wo wir durch die winterstille, märkische Heide fuhren und endlich vor dem Gutshaus Deines Vaters hielten. Den alten Herrn fesselte damals schwere Krankheit auf dem fernen Rügen, Todesahnung hatte sein Herz beschlichen, und die Weisung war an Dich gekommen, in alten Schränken nach alten Familienpapieren zu suchen. Es galt ein Testament, die Bestellung seines Hauses; das führte uns hinaus. Wie ein verzaubertes Schloß im Märchen lag das alte, graue Steinhaus da, eine hohe Schneemauer um sich her und überragt von den halb dunklen, halb glitzernden Edeltannen des Gartens. Stille draußen und drinnen. Auf unser wiederholtes Klopfen und Klingeln erschien ein alter Diener, verwöhnt und mürrisch, wie alle alten Diener sind. Zögernd, mit sauersüßem Gesicht, fand er sich endlich in Deine Autorität. Wir öffneten die Fensterläden, schafften Luft und Licht in den halb spukhaft gewordenen Räumen und fanden endlich, was wir suchten – die Papiere. Inzwischen war es wohnlicher geworden in dem großen Gartensaal, ein Feuer prasselte im Kamin, statt des Staubes breitete sich ein Tischtuch über die Tafel, und das frugale Mahl, das angerichtet war, adelte sich selbst durch die Flasche alten Rheinweins, die auf dem Tische stand. Wir setzten uns, und plaudernd von diesem und jenem, lief mein Auge an den roten Samttapeten hin und musterte die Bilderschätze, die in langer Reihe daran hingen. Ich sah zum ersten Male den schönen Kopf von Beatrice Cenci und vor allem den Stolz Eures Hauses, das Wert- und Prachtstück der Sammlung – das Modell des Moses von Buonarottis eigener Hand. Meine Fragen drängten sich, und Deine Lippen – nicht Freunde sonst von vielem Reden – flossen über bei der Erinnerung an schöne, italienische Tage. Wir füllten die Gläser bis zum Rand und stießen an auf ein Reisebündnis und ein gemeinschaftliches »jenseits der Alpen«.
Der Wunsch jener Stunde ist uns bis heute versagt geblieben. Nicht Deine Hand hat mich den kapitolinischen Hügel hinauf- oder in die Campagna hinausgeführt, sondern umgekehrt, die meinige übernahm Führerdienste, wenn wir in alten Douglas-Schlössern umherforschten oder die Stelle suchten, wo Fitzjames und Roderick Dhu miteinander gekämpft. Aber die alten Zusagen bleiben in Kraft, und während ich Dir dies Buch überreiche, das die Bilder zwischen dem Tweed und dem Moray-Busen noch einmal vor Dir entrollen soll, sprech' ich zugleich die Hoffnung aus, daß auch der Tag kommen möge, wo wir, wie auf Edinburg-Castle, so auf Castell St. Elmo gemeinschaftlich stehen. Welche Wege aber auch die heiteren Reisegötter in Zukunft uns führen mögen, vor allem mög' uns gute Kameradschaft auf dem Lebenswege beschieden sein, den wir, seit zwanzig Jahren nun, in Leid und Freude zusammengehn.
Th. F.
Von London bis Edinburg
Geschlagen, gestoßen, gepreßt, gepufft,
Zehn Meilen die Stunde ging's durch die Luft.
Altes Lied (Die Hexen von Inverneß).
»Nach Schottland also!« Die Koffer waren gepackt, die Billetts gelöst, und als der Spätzug sich endlich in Bewegung setzte und majestätisch aus der Halle des Kings-Cross-Bahnhofs hinausglitt, überlief es mich ähnlich wie vierzehn Jahre früher, wo es zum ersten Male für mich hieß: »Nach England!«
Ähnlich sag' ich, denn vierzehn Jahre sind eine lange Zeit und nehmen uns viel von Begeisterung und Fähigkeit zur Freude. Wie steht jener Tag noch klar vor meiner Seele, der damals über meine Reise entschied. Ich war Soldat und auf Königswache. Der Offizier hatte seine liebe Not mit uns, denn wir waren zwanzig Freiwillige oder mehr, und jeder, der Soldat gewesen ist, weiß, was es mit solchen Volontärwachen auf sich hat. An Disziplin war Mangel, aber Überfluß an guter Laune, und während die einen über Tisch und Bänke sprangen, spielten die anderen Dreikart oder gaben sich durch Vortrag von Hauptmanns- und Kompagnieanekdoten ein möglichst martialisches Ansehen. Es war ein kostbarer Maitag; begierig nach frischer Luft, hatte ich eben draußen in der Säulenhalle Platz genommen und blickte, den ungewohnten Helm hin und her schiebend, auf den schönen, breiten Opernplatz, der sonnenbeschienen vor mir lag. Da weckte mich ein leiser Schlag auf die Schulter. Als ich aufblickte, stand ein Freund vor mir, sonnenverbrannt, in Reisekleidern, jener Glücklichen einer, an die sich das beatus ille des Dichters richtet. Er lachte über den »Grenadier«, der ihm noch neu an mir war, und fragte dann kurz: »Willst du mit nach England? Ich reise morgen abend.« »Aber Urlaub!« – »Das ist deine Sache.« Das Gespräch gedieh nicht weiter; der Posten draußen rief uns mit lauter Stimme an die Gewehre. Wir traten an. Ablösung vor. Fünf Minuten später schilderte ich schon vor dem Gouvernementsgebäude in der Wallstraße. Niemals wohl hat der alte Müffling eine Schildwacht vor seiner Tür gehabt, der das Herz so hoch geschlagen hätte wie mir an jenem Nachmittage.
Voll so hoch schlug mir das Herz jetzt nicht, aber es schlug doch freudig und dankbar zugleich, als mein diesmaliger Reisegefährte dem hinter uns verschwindenden London ein Lebewohl zuwinkte und mit Genugtuung die Worte wiederholte: »Nach Schottland also!«
Wir fuhren dritter Klasse, halb ersparungs-, halb beobachtungshalber, und hatten trotz einiger Unbequemlichkeiten nicht Ursach, unsere Wahl zu bereuen. Der bis auf den letzten Platz besetzte, durch keine Zwischenwände geschiedene Wagen glich einem Auswandrerschiff. Die Mittelbank, auf der wir saßen, zog genau die Grenzlinie zwischen zwei verschiedenen Elementen, aus denen unsere Reisegesellschaft bestand, zwischen armen Engländern und sparsamen Schotten. Denn der Engländer fährt nur dritter Klasse, wenn er muß, der Schotte, wenn er kann. Nachdem die ersten Tunnel und Überbrückungen passiert waren, schwand die gegenseitige Zurückhaltung rasch, und der Austausch jener kleinen Dienste und Bequemlichkeiten begann, wie er nicht auszubleiben pflegt, wo sich 40 oder 50 Menschen, wenn nicht zu gemeinsamer Gefahr, so doch zu gemeinsamer Strapaze zusammengepfercht finden. Dick zusammengefaltete Tücher wurden den Damen angeboten, um die Ecken und Kanten minder scharf, das Holz der Bänke minder hart zu machen, und über das Öffnen und Schließen der Fenster kamen die Erkältungsgeneigten mit den Ventilationsbedürftigen zu einem gefälligen Kompromiß. Vor uns saßen die Engländer. Da waren zunächst zwei arme Frauen mit ihren Kindern, vier oder fünf an der Zahl. Sie hatten die Doppelbank am äußersten Rande des Wagens inne und hausten darin wie in einer Privatkajüte. Milch wurde gewärmt, die Brust gegeben (mit jener Unbefangenheit, die den englischen Frauen der unteren Stände eigentümlich ist), und die Flaggen, die dann und wann zum Fenster hinauswehten, waren im Einklang mit all dem übrigen. Vor ihnen saßen zwei junge Leute, augenscheinlich aus guter Familie, Schüler, die eine Ferienreise nach Schottland machten und unter Lachen behilflich waren, wenn die Kinderstube in ihrem Rücken diese oder jene Dienstleistung wünschenswert machte. Neben ihnen eine alte Lady in Trauer. Freundlich, aber abgehärmt, schmucklos, aber sauber und in wahrem Rigorismus selbst die hölzerne Rückenlehne ihres Sitzes verschmähend, so saß sie da, ersichtlich die Frau eines Offiziers, der, an der Dschamna vielleicht oder im Pandschab gefallen, ihr einen geachteten Namen und nichts weiter hinterlassen hatte.
Heitrer, farbenreicher sah es in der zweiten Wagenhälfte aus, der wir den Rücken zukehrten. Das schottische Element bewährte sich in seinem pittoresken Reiz. Keine nacktbeinigen Kiltträger waren zugegen, aber die blauwollene schottische Mütze mit ihren lang herabhängenden Seidenbändern (eine Tracht, deren Karikatur wir nur in unseren deutschen Städten kennen) saß malerisch auf den Köpfen der jungen Männer; Plaids in allen Mustern und Farben dienten diesem als Mantel und jenem als Kissen, während grau- und weißkarierte Tücher sich überall hin ausspannten und dem Ganzen den Charakter eines romantischen Feldlagers gaben.
So ging es dahin. Die bekannten Bilder englischer Landschaft zogen an uns vorüber. Die Sonne war längst unter, auch das Abendrot schwand jetzt, und nur jenes zauberhafte, dunkle Blau lag noch in breiten Streifen am Himmel, das in diesem Lande so gern und so schön einen klaren Tag beschließt. Ohne Aufenthalt brausten wir durch ein halbes Dutzend Stationsplätze hindurch; erst in Peterborough (einer Kathedralenstadt, 15 deutsche Meilen von London) machten wir halt, um einen anderen Zug abzuwarten. Inzwischen war es Nacht geworden, und jeder schickte sich an, der Ruhe zu pflegen, so gut es die Wände und Bänke irgend erlaubten. Die Schüler lagen schnarchend auf harter Diele, die Kinder schliefen, die Flaggen waren eingezogen; nur die alte Lady saß noch immer aufrecht, fest entschlossen, stärker zu sein als Schlaf und Ermattung.
Die Geschwindigkeit, mit der wir fuhren, wuchs jetzt: 40 englische Meilen die Stunde. Man überantwortete sich seinem Gott und schlief ein. Dann und wann hielt der Zug, und unbekannte, wenigstens unverstandene Worte trafen das Ohr, endlich aber schüttelte das in Traum und Halbschlaf lang herbeigesehnte: »York, York, fifteen minutes« den Schlaf von aller Augen, und halb schiebend, halb geschoben, fanden wir uns endlich an einer langen Tafel wieder, auf der die Zugehörigkeiten eines englischen Frühstücks serviert waren. »Tea«, »Coffee«, »Soda-Water«, klang es hier fordernd durcheinander. 15 Minuten sind wenig Zeit für hundert Gäste und drei verschlafene Kellner. Meine Tasse Tee war erst halb geleert, als die Glocke draußen schon wieder lärmte. »Das war also York!« rief ich dem Freunde zu, mich neben ihm in die Ecke drückend. »So gehen uns die Wünsche unsrer Jugend in Erfüllung. Statt des Doms ein Bahnhof und statt des Platzes, drauf Percy starb, eine Restauration mit doppelten Preisen.«
Als wir Newcastle erreichten, dämmerte bereits der Morgen; zu unserer Linken lag die Stadt, schwarz und finster, wie aufgebaut aus Kohlenblöcken. Eine Stunde später waren wir an der schottischen Grenze. »Berwick, Berwick!« riefen die Schaffner und gönnten uns Zeit, einen Umblick zu halten. Der ganze Platz macht immer noch den Eindruck einer Grenzlokalität, auch jetzt noch, wo der alte, halb zerfallene Wartturm nichts mehr bedeutet als eine Mahnung an Zeiten, die nicht mehr sind. Der Tweed geht hier ins Meer, und sein Bett, das mehr einer weiten Felskluft als einer Flachlandrinne gleicht, unterstützt die Vorstellung, daß wir hier an einem Grenzfluß stehen.
Die Morgensonne lacht freundlich, während wir die schottische Landschaft durchfliegen. Die Felder, die Art der Bestellung, das Seltenerwerden der Hecken, alles weicht ab von dem in England Üblichen und ruft uns (wie vieles andere noch, auf das wir stoßen werden) die Bilder deutscher Heimat mehr und mehr ins Gedächtnis zurück. Bei Dunbar gesellt sich noch ein anderer Gruß aus der Heimat hinzu, wir haben uns der Küste bis auf wenige tausend Schritt genähert, und das deutsche Meer liegt leise schäumend zu unserer Rechten. Hier wendet sich die Bahn, die bis dahin ununterbrochen nordwärts lief, plötzlich nach Westen und ungefähr die Linie innehaltend, die ihr der schöne Meerbusen des Forth vorschreibt, führt sie uns nach einer kurzen halben Stunde durch eine bald im Morgennebel, bald im Sonnenglanze daliegende Landschaft dem ersten Ziel unserer Reise entgegen. Villen und Parks, chaussierte Wege und Brücken, Häuser, Menschen und immer wachsender Verkehr verkünden uns, daß wir einer großen Stadt, einem Mittelpunkt weiter Bezirke uns nähern, und ehe wir noch Zeit gefunden haben, uns in dem immer bunter werdenden Bilde zurechtzufinden, läßt der Zug in seinem Fluge nach, und die 10 Stock hohen Steinhäuser Edinburgs tauchen grau und majestätisch vor uns auf.
Johnstons Hotel. Erster Gang in die Stadt
»Waterloo Place, any hotel you like«, Waterloo-Platz, ins erste beste Hotel! Mit diesem Zuruf vertrauten wir uns der Führung unsres Cabkutschers an und harrten der Dinge, die da kommen würden. Ich lieb' es bei solchen und ähnlichen Gelegenheiten, mich dem blinden Zufall zu überlassen, und habe die Erfahrung für mich, daß man mindestens nicht schlechter dabei fährt, als wenn man unschlüssig hin und her schwankt und hinterher den Ärger hat, doch nicht das Rechte getroffen zu haben. Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Unser Cab hielt nach fünf Minuten schon vor Johnstons Hotel, Waterloo-Place, und es wäre unbillig, dem Kutscher nachzureden, daß er seine diskretionäre Gewalt absonderlich mißbraucht hätte. Johnstons Hotel gehört zu jener Klasse von Gasthäusern, die unter dem Namen der »Commercial and Temperance Hotels« in allen Ländern, wo das angelsächsische Element herrscht, eine Art von Notorität erlangt haben. Der Temperanzseite dieser Etablissements leg' ich herzlich wenig Gewicht bei; es ist diese zur Schau gestellte Mäßigkeit derselben halb Lüge, halb Karikatur, und in bestem Falle Lockung und Aushängeschild; was aber diesen Gasthäusern in dem kostspieligen, aufgesteiften, selbstquälerischen England eine Bedeutung gibt, das ist der Umstand, daß sie in ihrer ausgesprochenen Einfachheit die Kehrseite jenes modernen Prachtbaus sein wollen, der unter dem Namen »Hotel« so viele erträumte Reize und so viele prosaische Wirklichkeiten umschließt. Es ist Affektation oder Selbsttäuschung, wenn wir auf Reisen plötzlich glauben, ohne Eleganz, ohne zehn Gänge und ohne gräfliche Nachbarschaft nicht leben zu können; was uns aber wirklich not tut, das ist ein unprätentiöses, freundliches Entgegenkommen und eine angemessene Bewirtung um unseres Geldes, nicht aber bloß - um Gottes willen. Der alte Satz mag fortbestehen, daß die großen Hotels die besten sind. Aber ein anderer Satz stellt sich ihm gleichberechtigt an die Seite, und zwar der, daß die vornehmen Gasthäuser nicht die angenehmsten sind.
In Johnstons Hotel hatten wir vollkommen das süße Gefühl der Hingehörigkeit statt des bloßen Geduldetseins; sonst fehlte freilich manches. – Die beblümten Teppiche auf Flur und Treppen hatten längst ihren Blumenfrühling hinter sich, und die altmodischen Bettstätten mit ihren verschossenen Quasten und Damastgardinen standen unheimlich da wie in alten Schlössern aufgekaufte Paradebetten, in denen Lords und Häuptlinge von Geschlecht zu Geschlecht das Zeitliche gesegnet hatten. Das sind nicht Bilder, die den Schlaf leicht und die Träume heiter machen, wenn wir sie auch im Einklang finden mit all den Lieblingsvorstellungen, die wir von Jugend auf an den Namen Schottland geknüpft haben. Aber jedenfalls rechten wir nicht darüber und erinnern uns gern der Wahrheit, daß man überall schläft, wenn man nur müde ist. Weniger freilich als der leise Schauer, der uns angesichts dieser blutroten Bettvorhänge überläuft, will uns der Fettbrodem gefallen, der, aus der Küche aufsteigend, alle Etagen des Hauses durchdringt, und nur widerwillig erinnern wir uns des korrespondierenden Satzes: man ißt überall, wenn man nur hungrig ist.
Aber wir sind wirklich hungrig, und nachdem wir die Übernächtigkeit aus den Augen gewaschen und in Eil' unsre Toilette gemacht haben, suchen wir das Frühstückszimmer auf, das sich hoch und breit und behaglich durch die halbe erste Etage zieht. Hier weht ein andrer Geist, die Ventilation ist trefflich, und kein gelegentlicher Zugwind plaudert vorschnell die Geheimnisse der Küche aus. Das schöne schottische Weizenbrot lacht uns an, und bald sitzen wir vor einer wohlbesetzten Tafel, auf der uns, neben den üblichen Erfordernissen eines englischen Frühstücks, Haferbrötchen und Dundee-Marmelade daran mahnen, daß wir auf schottischem Grund und Boden sind. Ein alter Kellner von viel über sechzig trippelt freundlich und geschäftig um uns herum, befriedigt seine Neugier durch Vorlegung eines Fremdenbuchs und erzählt uns plauderhaft von den Geschicken seines Lebens. Französische Säbel, unter die sein Hinterkopf während des spanischen Krieges geriet, haben seiner Laufbahn und seinem Verstand ein rasches und bescheidenes Ende gesetzt, aber was er bei Astorga an Hirn verloren hat, ist seinem Herzen zugute gekommen, und er spricht mit Vorliebe von den »Frenchmen«, unbekümmert darum, ob sie vor 40 Jahren ihm die Beförderungsleiter abgebrochen haben oder nicht. Nun aber treibt er uns zur Eil' und mahnt uns aufzubrechen, um die Stadt, auf die er stolz ist, in ihrer besten Beleuchtung, d. h. unter leis bewölktem Himmel zu sehn. Wir folgen seinem Rat und biegen nach rechts hin in die Neustadt ein.
Waterloo-Place und Princes-Street bilden eine einzige grade Linie, von der Edinburg in ähnlicher Weise durchschnitten wird wie etwa Paris von der Rue Rivoli. Die große Mittelader der schottischen Hauptstadt sondert sich gleich auf den ersten Blick in drei Teile von ziemlich gleicher Größe, in zwei Flügel und ein Zentrum. Der eine Flügel heißt Waterloo-Place, der andere West-Princes-Street; die halb boulevard-, halb platzartige Erweiterung aber, die zwischen beiden liegt, führt den Namen der eigentlichen Princes-Street. Dieser platzartigen Erweiterung gehen wir jetzt entgegen und nehmen in der Mitte derselben unseren Stand, genau da, wo sich das im gotischen Stil ausgeführte, turmartige Monument Walter Scotts bis zu einer Höhe von 200 Fuß erhebt. Hier halten wir Umschau. Hinter uns die Neustadt mit ihrer Fülle nobler und moderner Bauten, links die pittoresken Felspartien der Salisbury-Crags, rechts die langen Straßen der Stadt mit ihren Kirchen und Palästen. So nach allen Seiten hin in Anspruch genommen – wird unser Auge doch immer wieder nach vornhin gerichtet, wo sich, nur durch eine flußbettartige Vertiefung von uns getrennt, die berühmte High-Street der Altstadt Edinburg samt ihren Ausläufern und Seitenstraßen erhebt. Parallellaufend mit Princes-Street, zeigt die gegenüberliegende Altstadtstraße doch dadurch einen völlig verschiedenen Charakter von jener, daß sie nicht flach und gradlinig sich hin erstreckt, sondern dem natürlichen Zuge und selbst den Kapricen des Hügels folgend, auf dem sie steht, einen malerischen und abwechslungsreichen Anblick gewährt. Der Hügel steigt langsam an, läuft dann, wie seine Kräfte sparend, in horizontaler Linie weiter, bis er plötzlich, zu einem letzten Sprunge sich zusammenraffend, kegelartig in die Höhe schießt und nun den Weg überschaut, den er eben zurückgelegt. Auf dem langsam ansteigenden Teile der Berglinie erhebt sich Canongate; unmittelbar vor uns von dem gradlinigen First des Hügels grüßt High-Street selbst zu uns herüber; zur Rechten aber, die Situation vom Felsen aus beherrschend, ragt Edinburg-Castle mit seinen Wällen und Kanonen in die Luft.
Jeder ehrliche Schotte hält diesen Punkt für den schönsten in der Welt, eine Ansicht, worüber er sich mit den Bewohnern von Neapel und Palermo und noch mehr mit jenen auseinandersetzen mag, die, aus tristeren Gegenden nach dem Süden pilgernd, jene schönen Punkte unter dem Vorteil des Kontrastes und mit verklärendem, feiertäglichem Auge sehn. Der Freund an meiner Seite war jener Glücklichen einer; er enthielt sich aber weislich des Vergleichs und entwand sich dem Pressenden meiner Frage durch das bekannte: jedes in seiner Art.
Lassen wir also das Paralleleziehen und das ängstliche Forschen nach einem Mehr oder Weniger; freuen wir uns der Schönheit, die unbestritten vor uns liegt. Diese Schönheit beschreiben zu wollen, wäre eitles Unterfangen, aber die Frage läßt sich wenigstens beantworten, aus welchen Elementen sich diese Schönheit auferbaut. Es ist nicht die Lage allein, die diese Eindrücke schafft, es sind ebensosehr die Dinge, die sich diese Lage zunutze gemacht und sich, derselben entsprechend, auf ihr errichtet haben. Die Solidität des Materials wie des Baustils steht ebenso untereinander wie mit der ganzen Örtlichkeit im Einklang und gibt dem Ganzen jenen großstädtischen Charakter, den ich, mehr noch wie ihre Schönheit, als den eigentlichen und frappantesten Zug dieser Stadt hervorheben möchte. Auf grauen Felsen steigen graue, acht Stock hohe Felsenhäuser in die Luft, phantastisch schnörkelt sich, einer silbergrauen Brautkrone nicht unähnlich, der Turm von St. Giles über die Häuser empor, und gemeinschaftlich über dem Ganzen liegt jener graue Nebelschleier, der den Zauber dieser nordischen Schönheitsstadt vollendet. Der Reiz der Farbe fehlt, aber man vermißt ihn nicht, ja erschrecken würd' es uns, den vollendeten Karton, der vor uns liegt, in einen Buntfarbendruck verwandelt zu sehen. Das Grau dieser Häuser entspricht jenem unbestimmten Farbenton, der uns inmitten alter Dome so oft entzückt und zur Andacht gestimmt hat.
Nicht die Farbe würde die Wirkung der vor uns liegenden Altstadt von Edinburg erhöhn, aber was die Farbe nicht vermöchte, das vermag das Zauberspiel von Schatten und Licht. Allabendlich, wenn die Nebel sich dunkler zu färben beginnen und die grauschwarze Steinwand der Häuser mit den grauschwarzen Nebeln allmählich in eins zusammenfließt, blitzen plötzlich Lichter aus diesem Chaos heraus, und immer heller, zahlreicher werdend, durchleuchten sie endlich die aus Nacht und Nebel gewobene Hülle, die nun wieder von ihrem dunklen Hintergrunde sich loslösend, wie ein durchsichtiger Schleier um die immer schwärzer werdenden Häuser schwebt. Wenn dann vom Schloß herab durch die stillgewordene Nacht die Hornsignale in langen Tönen ziehn, beschleicht es uns, als ob das Ganze eine Zauberschöpfung sei, die ein Klang ins Dasein rief und die verschwinden muß, sobald der letzte Ton erstirbt.
Holyrood-Palace
Dieser so berühmt gewordene Palast liegt unmittelbar vor der Stadt in einem weiten, mehrfach geöffneten Talkessel, der von verschiedenen Hügeln, vom Calton-Hill im Norden, von den Salisbury-Crags im Osten und Süden und von dem hochgelegenen Alt-Edinburg im Westen, begrenzt und gebildet wird. Da, wo die letzten Häuser von Canongate (siehe das vorige Kapitel) ins Tal hinuntersteigen, erhebt sich, kaum durch die Breite eines Marktplatzes von ihnen getrennt und die vor ihm liegende Hügelstraße hinauf blickend, der Palast von Holyrood. Vom Mittelpunkt der Stadt aus ihn zu erreichen, lassen sich zwei Wege einschlagen, der eine durch die Altstadt (High-Street und Canongate), der andere parallel damit durch Princes-Street und Waterloo-Place an einer Reihe hübscher Gartenanlagen hin, die sich, bereits außerhalb der Stadt, am Fuße des Calton-Hill entlang ziehen. Da ich noch oft Gelegenheit haben werde, den Leser auf dem erstgenannten Wege durch High-Street und Canongate zu geleiten, so wählen wir heut den Weg am Fuß des Calton-Hill entlang, der uns, auf einem kleinen Umwege durch die Regent-Road, nach dem Palaste führt. Hübsche Landschaftsbilder breiten sich vor uns aus, sobald wir Waterloo-Place im Rücken haben; nichts Besonderes aber fesselt unsren Blick, mit Ausnahme eines seltsamen Steinackers unmittelbar zu unsrer Rechten, von dem wir nicht wissen, ob er mehr einen Friedhof oder einem Schutthaufen gleicht. Auf unsre Frage erhalten wir folgende Antwort. Als Terrain geschafft werden mußte für das schottische Eisenbahnnetz, das in Edinburg seinen Zentralpunkt hat, entschied man sich begreiflicherweise für Ankauf jener flußbettartigen, die Altstadt von der Neustadt trennenden Vertiefung, die ich im vorigen Kapitel beschrieben habe. In dieser Vertiefung, feucht und ungesund wie sie war, stand eine alte Kirche mit ihrem Gottesacker drum herum. Die Schiene brauchte Platz, der schottische Unternehmungsgeist war stärker als die schottische Kirchlichkeit, und binnen kurzem war der alte Bau ein Trümmerhaufen. Man wußte nicht, was damit zu machen, oder konnte sich nicht einigen über den Verkauf, kurzum, die ehemalige Kirche samt ihren tausend Grabsteinen wurde wie Schutt vor die Stadt gefahren und dort auf einem nunmehr umzäunten Felde abgeladen. Da liegen nun hoch aufgeschichtet die Trümmer von Sockel und Kapitäl, von Kreuz und Leichenstein, das Ganze eine seltsame Ruhestatt, darauf man einen alt gewordenen Kirchhof begraben hat.
Unmittelbar hinter diesem Acker halten wir uns rechts und biegen in eine aus ärmlichen und zerstreuten Häusern bestehende Straße ein, die uns innerhalb weniger Minuten vor das Portal des Palastes führt. Ehe wir dasselbe erreichen, werden wir durch einen jungen Schotten, der uns begleitet, auf das Badehaus der Maria Stuart aufmerksam gemacht. Wiewohl sein Finger eine ganz bestimmte Richtung angibt, so fragen wir doch »wo?« Aber die halb erschrockene Frage ändert nichts, und die Fingerspitze deutet unverrückt auf ein kleines, halb backofenartiges Eckhaus, das wir eher für das Waschhaus einer armen Frau als für das Badehaus einer Königin halten würden. Es ist so niedrig, daß man die Hand auf die untersten Dachziegel legen kann, und ein etwas vorspringender klumphafter Giebel, der dem Ganzen das Ansehen gibt, als ob ein dicker Mann auf den Schultern eines dünnen säße, ist nicht angetan, der Erscheinung einen gesteigerten Reiz zu leihen. Kopfschüttelnd darüber, daß so viel Schönheit hinter solchen Mauern heimisch gewesen sein soll, schreiten wir weiter, erreichen nach kaum hundert Schritten eine platzartige Auffahrt, machen linksum und stehen in Front des Palastes.
Der Palast ist ein Viereck von mäßigen Proportionen, ziemlich niedrig, an den beiden hausartig vorspringenden Frontecken von je vier Spitztürmen flankiert; das Ganze ohne Stil, ohne Schönheit, ohne Stattlichkeit, aber doch nicht geradezu häßlich und unverkennbar mit jenen Zügen ausgestattet, die eine Physiognomie interessant machen. Dies ist Holyrood-Palace. Neben demselben, aber etwas zurückgelegen, so daß beide Baulichkeiten nur an einer einzigen Ecke statt mit ihren vollen Seiten zusammentreffen, erhebt sich eine Ruine: die Royal Chapel von Holyrood, das einzige Überbleibsel jener reichen und stolzen Abtei, die hier mit ihren Klosterhöfen, ihrer Kapelle und ihren Gärten weite Morgen Landes bedeckte. Lange bevor es einen Holyrood-Palace gab, gab es eine Holyrood-Abtei. David I. von Schottland, der fromme Gründer der Abteien von Melrose und Kelso, gründete auch diese Abtei von Holyrood (um 1150), und erst 350 Jahre später begannen neben derselben sich jene schlichten Mauern und Türmchen zu erheben, die in ihrer damaligen äußerst begrenzten Ausdehnung kaum den Namen eines Palastes beanspruchen konnten. Es war ein Schwalbennest, das sich, wie Schutz suchend, an die stattliche alte Abtei anklebte. Seitdem ist diese zu einer Ruine geworden, während der Palast ihr mit der Hälfte ihres Raumes zugleich das Ganze ihres Ruhmes genommen hat. Die Abtei hat längst aufgehört, eine Pilgerstätte zu sein, der Palast ist es geworden, und die wenigsten unter den Tausenden, die dieser Stätte zuströmen, haben eine Ahnung davon, daß Wand an Wand mit dem Palaste von Holyrood noch eine gleichnamige Abtei ihrer harrt.
Wir besuchen diese zunächst. Die uns zugekehrte Front, ein Turm und ein Portal, sind verhältnismäßig gut erhalten und geben am deutlichsten Zeugnis für die nicht gewöhnliche Schönheit des Kapellenbaues, der sich einstens hier erhob. Eintretend haben wir einen nach allen vier Seiten hin geschlossenen Raum vor uns, das Dach ist eingestürzt, und der Fußboden gleicht einem Kirchhof: ein Rasenstück, aus dem sich zahlreiche Grabsteine erheben. Umschau haltend, wächst das Interesse, solange wir unsere Aufmerksamkeit auf die Fülle des Details richten, das entweder durch Alter und Eigentümlichkeit oder, bei Schöpfungen einer späteren Epoche, durch Schönheit imponiert. Von dem Augenblick an aber, wo wir Miene machen, uns in dem Ganzen zu orientieren, sind wir verloren und bezahlen unsere Wißbegier mit immer wachsender Unruhe. Wir fordern etwas, was uns die Dinge nicht mehr gewähren können. Vielfach zerstört und geschädigt, teilweise niedergerissen, um den Neubauten des Palastes Platz zu machen, schließlich (vor etwa 100 Jahren) unter die Hände eines pietät- und kenntnislosen Architekten geraten, gleicht das Ganze nur noch einem willkürlich zusammengesetzten Scherbenmosaik. Der Kitt hat alles tun müssen. Nicht die Frage »paßt es« hat den Architekten beschäftigt, sondern immer nur die Frage »klebt es«. Die Grabsteine ringsumher tragen manchen berühmten Namen, aber doch nicht berühmt genug, um einer besonderen Erwähnung wert zu sein. Nur einen Stein, am äußersten Ende der Kapelle, kündigt unser Führer mit gehobener Stimme an, den Stein, auf dem Maria Stuart und Darnley knieten, als der Bischof von Brechin ihre segenslose Ehe segnete. Man sagt, daß die Königin bei dieser Gelegenheit ein schwarzes Kleid trug, dasselbe, das sie am Begräbnistage ihres ersten Gemahls getragen hatte.
Die beiden Namen aber, die wir eben vernommen, mahnen uns daran, daß auch wir nicht nach der Kapelle von Holyrood, sondern nach dem Palaste gleichen Namens unsere Wallfahrt angetreten haben, und an der Flanke desselben hin denselben Weg zurücknehmend, auf dem wir in die Kapelle eintraten, werfen wir jetzt von der platzartigen Auffahrt her nochmals einen Blick auf den Palast, zumal auf die berühmt gewordenen Stockwerke und Türmchen an der Nordwestecke, und treten dann ein.
Das Portal, unter dem wir uns zunächst befinden, zeigt durchaus nichts Stattliches oder Schloßartiges, es ist ein gepflasterter Torweg, dessen Überbau von rohen Säulen getragen wird. Zur Linken befindet sich eine Pförtner-, zur Rechten eine Wachstube; Gewehre der Mannschaften hängen an den Wänden, und die Schmucklosigkeit des Ganzen erinnert an einen Kaserneneingang, der vierzehn Tage vorher auf Regimentsbefehl geweißt worden ist. Wir passieren diesen Torweg und haben jetzt den geräumigen, nach allen Seiten hin geschlossenen Hof des Palastes vor uns. Die Zimmer im rechten Flügel heißen die »Queen's Apartments«. Die Königin, um die es sich dabei handelt, ist nicht Queen Mary, sondern Queen Victoria. Alljährlich, wenn die Königin nach Balmoral geht, um die Sommermonate auf dieser reizenden Besitzung (zwischen Inverneß und Aberdeen) zu verbringen, pflegt sie auf der Durchreise eine Nacht in Holyrood-Palace zu verbringen. Ich habe diese Queen's Apartments gewissenhaft in Augenschein genommen, führe aber meine Leser absichtlich nicht treppauf in den Flügeln des Gebäudes umher, sondern halte sie, um ihnen das Bild des Ganzen so wenig wie möglich zu verwirren, unter dem frischgeweißten Torweg fest und erzähl' ihnen lieber, was von jenen Apartments mit hohen Fenstern und herabgelassenen Rouleaux zu wissen not tut. Alle dahin gehörigen Zimmer sind modern, moderne Bilder, zum Teil kein Dutzend Jahre alt, hängen an den Wänden, geblümter Chintz zieht sich sorglich über Stühle und Ottomanen, und die nicht sonderlich interessante Inspektion schließt man mit der beruhigenden Gewißheit, daß kein Rizzio in diesen Räumen ermordet worden sei.
Um diesen ermordeten Rizzio handelt es sich nun aber mal; die ganze Berühmtheit dieses Ortes knüpft sich an jenen baufälligen alten Nordwestturm, der der Zeuge jener Ermordung war. Diesem Nordwestturm gilt jetzt unser Besuch; aus dem Torweg tretend, biegen wir links kurz um, schreiten an der Rückseite des Frontflügels entlang und treten da, wo der linke Flügel auf den Frontflügel stößt, durch eine Ecktür ein. Die Räumlichkeiten dieses Turmes liegen in drei Etagen: Hochparterre die Zimmer Darnleys und eine Gemäldegalerie; eine Treppe hoch die Zimmer Maria Stuarts; zwei Treppen hoch niedrige Zimmerchen, in denen einige Damen vom Haushalt der Königin (vielleicht die sogenannten »vier Marien«) gewohnt haben mögen.
Über diese vier Marien möchte ich hier ein paar Worte einschalten. Sie waren die Töchter aus vornehmen schottischen Familien, standen im selben Alter wie die Königin, hatten schon in Frankreich die nächste Umgebung derselben ausgemacht und waren mit ihr nach Schottland zurückgekehrt. Ihre Namen waren Mary Fleming, Mary Beaton, Mary Livingstone und Mary Seaton. Die Letztere stand ihr besonders nah und war ihre einzige Gesellschafterin während ihrer Gefangenschaft in Schloß Lochleven. Die Idee, eine Königin Maria mit vier Marien zu umgeben, wie man einen Edelstein mit vier ihm verwandten Steinen umgibt, scheint schon zu Lebzeiten Marias die Poeten des Landes vielfach angeregt zu haben, und so existieren mehrere alte Balladen, in denen diese vier Marien eine Rolle spielen. Die vier oben angeführten Familiennamen werden dabei nicht immer festgehalten, und so führt z. B. die schönste und ergreifendste der Marien-Balladen die Überschrift: »Maria Hamilton«.
Wir kehren nach dieser Abschweifung zu unserm Nordwestturme zurück. Das erste, was wir in Augenschein nehmen, ist die Gemäldegalerie. Diese ist ein Unikum, und insofern ganz an ihrem Platze hier, als sie ein heiteres Gegengewicht gegen die Schrecknisse dieses Ortes bildet. Sie enthält hundertundzehn Porträts der schottischen Könige von Fergus I. (330 vor Christo) bis auf Karl Stuart. Der Künstler, der sie schuf, hieß Jakob de Witt, ein Vlamänder. Der Kontrakt, durch den er sich zur Herstellung dieser Porträts verpflichtete, existiert noch; er ist aus dem Jahre 1684 und lautet dahin: »Jakob de Witt verpflichtet sich zur Lieferung von 110 Porträts in zwei Jahren, sowie auch zur Beschaffung der dazu nötigen Farben und Leinwand; das Gouvernement andererseits zahlt besagtem de Witt jährlich 120 Lstr. und macht sich verbindlich, ihm die nötigen Originale zu liefern.« Sehr komisch ist die Kostüm- und Familienähnlichkeit aller, so daß es niemandem auffallen würde, wenn man die Nummern durcheinander werfen und die Namen hinterher durch Los bestimmen wollte! Englische Dragoner zerhieben während des Stuart-Aufstandes (1745) ein Dutzend dieser Porträts, wogegen nicht viel zu sagen ist; das aber muß überraschen, daß man sich hinterher die Mühe gegeben hat, diese zersäbelten Kunstschätze wieder zu restaurieren. Der Saal, in dem sich diese Porträtgalerie befindet, ist dadurch interessant, daß der Prätendent oder »Prinz Charlie«, wie ihn die Schotten zu nennen pflegen, während seiner kurzen Residenz in Holyrood einen prächtigen Ball in demselben gab. Hier tanzten jene Gestalten, die W. Scott in seinem »Waverley« auf viele Jahrhunderte hin der Vergessenheit entrissen hat: Fergus und Flora Mac-Ivor, der alte Bradwardine und seine reizende Tochter.
In gleicher Höhe mit der Gemäldegalerie befinden sich die Zimmer Lord Darnleys. Alte Bilder und Tapeten hängen an den Wänden, aber nichts, was unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen könnte; nur das Schlafzimmer wird dadurch interessant, daß es an einen halbversteckten Treppenturm grenzt, dessen spiralförmige Steintreppe damals eine geheime Verbindung nach unten und nach oben unterhielt. Nach oben führte diese Vertraulichkeitstreppe in die Gemächer der Königin, nach unten auf die Straße. Personen, die im Palast nicht gesehen werden sollten, machten mit Hilfe dieser Treppe ihren Besuch bei Lord Darnley; auch die Verschwörer gegen Rizzio stiegen am Abend des 9. März hier hinauf. Nachdem sie einig geworden, sammelten sie sich draußen auf den obersten Stufen der einen und den untersten Stufen der andern Treppe (der Raum ist so eng, daß an Flur und Treppenabsatz gar nicht zu denken ist), um nun Mann hinter Mann, nicht unähnlich wie man eine Sturmleiter erklimmt, in die Zimmer der Königin vorzudringen. Wir hatten vor, denselben Weg zu machen und wanden uns die Spirale hinauf, auf der an jenem Märzabend Darnley und seine Freunde hinangestiegen waren. Es ward uns ein wenig unheimlich dabei, und dies Gefühl wuchs noch, als wir plötzlich vor einer kleinen, kaum mannsbreiten Tür standen und vergeblich auf die rostige Klinke drücken, um zu öffnen. Lord Ruthven und seine Leute würden durch einen kräftigen Fußtritt das unerwartete Hindernis rasch aus dem Wege geräumt haben, wir aber fanden uns veranlaßt, kehrtzumachen und auf dem eigentlichen Treppenaufgang nunmehr unser Glück zu versuchen.
Die sogenannten »Queen Mary's Apartments«, also die Zimmer der Königin Maria, befinden sich unmittelbar über den Zimmern Lord Darnleys und umfassen vier Räume von verschiedener Größe. Wir treten zuerst in das Audienzzimmer, dem es seinerzeit an Eleganz und Farbenfrische nicht gefehlt haben mag; Gobelintapeten, Holzgetäfel an Wand und Decke und in der Mitte des Zimmers eine Art Staatsbett, in dem Karl I. bei seinem letzten Besuche in Schottland geschlafen haben soll. Hundert Jahre später ruhte Prinz Charlie (nach dem Siege von Prestonpans) auf diesen Kissen aus, schwerlich träumend, daß er sieben Monate später schon ein gehetzter Flüchtling sein und sein Besieger (der Herzog von Cumberland) auf ebenjenen Kissen schlafen werde. Vielleicht, daß das Bett vor hundert Jahren einladender war als jetzt; wie es da vor mir stand, weckte es nur die Empfindung, daß ich mir ein angenehmeres Lager gesucht und selbst ein Biwak auf schottischer Heide vorgezogen haben würde. Was diesem Audienzzimmer eine größere Bedeutung leiht als die Gardinen und die historischen Erinnerungen dieses Betts, ist der Umstand, daß die vielfachen Begegnungen zwischen John Knox und der Königin an dieser Stelle stattfanden. Hier war es, wo sie unter Zorn und Tränen ausrief: »Was kümmert Euch meine Heirat? Wer gibt Euch das Recht zu dieser Sprache? Wer und was seid Ihr in diesem Lande?« Und wo der Mann im Genfer Käppchen, ungeblendet durch Schönheit und unerschüttert durch Macht, standhaft erwiderte: »Ich bin ein Untertan dieses Landes, geboren darin; und ob ich auch kein Graf oder Herr bin, doch bin ich ein nützliches Glied dieser Gemeinschaft.«
Aus dem Audienzzimmer treten wir in das Schlafzimmer, dasselbe, an dessen wurmstichiger Tür wir von außen gepocht hatten. Das Zimmer ist ein Quadrat, aber durch Fenster, Türen, Kamin und Nischen so vielfach unterbrochen, daß es mehr den Eindruck eines Vielecks als eines Vierecks macht. Die Einrichtung ist so ziemlich dieselbe wie die des Audienzzimmers, aber hundert Kleinigkeiten, die durch die Hand der schönen Frau gingen, ihr dienten oder sie erfreuten, finden sich hier zusammen und machen dies Zimmer zu dem interessantesten, das man vielleicht irgendwo betreten kann. Das Bett mit seinen Scharlachbehängen, seinen Schnüren und Quasten ist wohlerhalten, und auf den Polstern und Decken liegt der zwei Hand breite Rest von einer jener wollnen Decken, die nach englisch-französischer Sitte schon damals statt des Federbetts dienten. Es ist bekannt, wie leicht solche Dinge ins Lächerliche umschlagen, aber die ganze Umgebung ist der Art, daß Frivolität nicht aufkommen kann und sich bescheidet, anderen Gedanken das Feld zu räumen. Die Gobelins, die an den Wänden hängen, stellen den Fall des Phaeton dar; man kann darin nicht gut, wie einige gewollt haben, ein sinniges Spiel des Zufalls erkennen, da der Fall der schönen Königin sicherlich keine Vergleichungspunkte mit dem des Phaeton bietet. Sie strebte nie zu hoch, im allgemeinen nicht hoch genug; als sie dem Bothwell die Hand reichte, entschlug sie sich ihrer Würde als Königin und als Frau, das stürzte sie. - Unter den Kleinigkeiten, deren das Zimmer so viele besitzt, sind Stickereien von der Hand der Königin Elisabeth, die diese der Maria Stuart für deren eben geborenen Sohn, den späteren Jakob VI., zum Geschenk machte; daneben Handarbeiten Maria Stuarts selbst, Körbchen, Kästchen, Necessaires usw.
Von diesem Schlafzimmer aus führen zwei Türen nach rechts und links hin in zwei angrenzende kleine Räume, von denen der eine den Namen eines Ankleidezimmers (dressing-room), der andere den eines Eßzimmers (supping-room) führt. Der dressing-room hat kein Blatt in der Geschichte; desto mehr Blätter gehören dem supping-room. Wir werfen noch einen Blick auf die mehrerwähnte wurmstichige kleine Tür, die wir jetzt kaum fußbreit zur Rechten haben, und treten nunmehr in den unmittelbar daneben gelegenen supping-room ein. Wir sehen darin allerhand Rüstungsstücke (Brustharnisch, Schwert, Sporen), die dem Lord Darnley gehört haben sollen; an anderer Stelle befindet sich ein Marmorblock und ein auf Stein gemaltes kleines Altarbild. Dinge, die einstens der Hauskapelle der Königin zugehörten und nun wie in einem Kuriositätenladen, in diesem »supping-room« eine Stelle gefunden haben. So unpassend wie möglich. Dies Zimmer müßte kahl und leer sein, nackte, graue Wände, nichts weiter. Hier empfing Rizzio die ersten Dolchstiche. Was den Eintretenden mit ganz besonderem Schauder erfaßt, das ist die überraschende Kleinheit und Enge dieses Gemachs. Es ist nur 10 Fuß lang und 9 Fuß breit. Man war hier auf Dolche angewiesen. In diesem Zimmer befanden sich am Abend des 9. März 1565 sieben Personen: Maria Stuart; ihr Halbbruder Lord Robert Stuart; Arthur Erskine, Hauptmann von der Garde; ein Kammerherr; eine Hofdame; die Gräfin von Argyle und Rizzio. Rechnet man den Tisch hinzu, an dem sie saßen, so muß das Zimmer gefüllt gewesen sein. Aber die draußen Stehenden waren entschlossen, Platz zu schaffen. Zuerst erschien Darnley, setzte sich neben die Königin und schlang seinen Arm um ihren Leib, um sie nach Möglichkeit auf ihrem Sitze festzuhalten. Dann trat Lord Ruthven ein, hager, blaß, todkrank, das Haupt unbedeckt, aber sein Leib in Eisen gekleidet; mit ihm kamen Kerr von Falkonside und George Douglas; Bewaffnete und Fackelträger schlossen den Ausgang. »Es gilt nicht Euch, hohe Frau«, rief Ruthven, »nur jenem Schuft da.« Rizzio sprang auf und barg sich hinter der Königin. Es war jetzt unmöglich, ihn zu treffen; der enge Raum des Zimmers war abgesperrt, eine lebendige Hecke, dahinter der Sänger. »Gebt ihn heraus!« schrie Kerr von Falkonside und legte sein Pistol auf die Königin an. Die geängstigte, aber entschlossene Frau folgte ihm mit den Augen. Diesen Moment benutzte Douglas; über die Schulter der Königin hinweg traf er jetzt den dahinter geborgenen Sänger. Rizzio sank zusammen; man zog ihn hervor, zerrte ihn durch das Schlaf- und Audienzzimmer; draußen an der Treppenstufe ließ man ihn liegen. Sechsundfünfzig Dolchstiche hatten ihr Werk getan. Lord Ruthven schritt in das Zimmer der Königin zurück und forderte einen Becher Wein. Er war so matt, daß er sich mühsam aufrecht hielt; eine Woche später war er nicht mehr. Der Tod schien nur gewartet zu haben, um nicht zwischen ihn und diesen Mord zu treten.
All das stand vor unsrer Seele, als wir uns in dem elenden Zimmerchen umsahen. Wir verließen es wieder, ohne ein Wort zu sprechen. Als wir bis an die Treppe gekommen waren, rief uns einer der Aufseher nach: »Wait a moment, Gentlemen, you didn't see the blood yet.« (Warten Sie einen Augenblick, meine Herren, Sie haben das Blut noch nicht gesehen.) In der Tat standen wir auf dem Punkt, an dem Blute Rizzios ohne weitere Teilnahme vorbeizugehen. Wir hielten an und sahen nun den großen braungrauen Fleck, das sichtbare Zeichen der Schrecknisse jenes Abends. Zu sagen, daß wir viel dabei empfunden hätten, wäre Lüge. Diese Dinge dürfen einem nicht in Substanz auf den Leib rücken. Die roten Flecke, die das Gewissen der Lady Macbeth sieht, wo sie nicht sind, werden ewig ihr Grauen für uns behalten; aber es ist vorbei damit, wenn man uns das Blut tischbreit auf die Diele malt. Auch die Vorstellung kann nicht retten, daß es vielleicht das echte sei.
Von Holyrood bis Edinburg-Castle
Aus Holyrood-Palace heraustretend und den mehrerwähnten Platz passierend, der unmittelbar vor dem Palaste liegt, treten wir jetzt in den untern Teil jener hügelansteigenden, malerisch gelegenen Straße ein, deren Profillinien ich im zweiten Kapitel bereits beschrieben habe. Der untere Teil der Straße, am Hügelabhang gelegen, heißt Canongate; der obere Teil, den Rücken des Hügels einnehmend, ist High-Street.
Canongate, so geheißen, weil die Chorherren (Canons) von Holyrood die ersten Häuser hier aufführten, war vor drei Jahrhunderten der Lieblingssitz der Reichen und Vornehmen des Landes. Die unmittelbare Nähe des Palastes machte es, daß man diesem Faubourg (denn das war Canongate damals) selbst den Vorzug vor der stattlicheren High-Street gab. Lange Zeit hindurch blieben diese Dinge unverändert, und noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts hatten Herzöge, Grafen und Lords ihre Paläste hier. Wenn man sich jetzt in dieser Straße umsieht, so kann man freilich ein gewisses Staunen nicht unterdrücken, daß z. B. noch um 1750 herum fünfundzwanzig Grafen (der Lords und Barone zu geschweigen) ihre Paläste hier gehabt haben sollen. Unscheinbare Häuser zu beiden Seiten der Straße führen noch jetzt den Namen alter und berühmter Geschlechter und beweisen im innigsten Zusammenhange mit den Taten, die hier geschahen, welch Zustand verhältnismäßiger Roheit und Unkultur hier noch herrschte, als das übrige Westeuropa bereits unter dem Einfluß der wiedererwachten Künste war. Geschmack und Komfort fanden hier sehr spät eine Stätte. Als Schottland während des 16. Jahrhunderts in die nächste politische Beziehung zu Frankreich trat, waren die Zustände des Landes noch so arm und hoffnungslos, um in der Bevölkerung desselben nicht einmal den Gedanken an Mitbewerbung oder Nacheiferung aufkommen zu lassen. Den Rest tat der Puritanismus; was noch von Schätzen und Vorbildern guten Geschmacks übrig war, das brannte er nieder oder entkleidete es seiner Schönheit. Abgeschiedenheit, Armut und das ausschließlich aufs Innerliche gerichtete religiöse Leben des schottischen Volks vereinigten sich dahin, der Kunst und ihrem nie fehlenden Gefolge, dem Komfort und dem Luxus, die Niederlassung, das Bürgerrecht in diesem Lande zu erschweren. Das Haus blieb hier ein bloßer Steinbau mit kleinen Türen und dürftigen Fenstern, eine Schutzwehr gegen Wind und Wetter, ein Kastell, fest, eng, warm, aber- schmucklos.
Wer geneigt sein könnte, einen Zweifel hiergegen zu erheben, der sehe sich um in Canongate. Kein englischer Fisch- und Gemüsehändler würde jetzt Raum, geschweige Komfort genug in einem jener grauen Steinhäuser finden, drin noch vor 100 Jahren die Träger berühmter Namen sich's wohl sein ließen.
Nur einige Häuser zeichnen sich auch jetzt noch durch ihre Geräumigkeit oder durch jene Apartheiten in der Bauart aus, die uns sofort mutmaßen lassen, daß es nicht alltägliche Dinge gewesen sein können, die sich darin zugetragen haben. Da haben wir zunächst zur Linken »Queensberry-House«. Die ehemalige Wohnung der Herzöge gleichen Namens ist seit 50 Jahren und mehr zu einem Hospital und Armenhaus geworden, eine Umwandlung, der man es lassen muß, daß sie im Einklang steht mit dem spukhaften Mauerwerk und der finstren Geschichte, die sich daran knüpft. Diese Geschichte ist folgende. Es war am 1. Mai 1707, an demselben Tage, an dem die Union zwischen England und Schottland, die bis dahin nur als Personalunion bestanden hatte, durch Abgeordnete beider Länder zum Abschluß gebracht wurde. Die glückliche Beendigung der dahin abzielenden Schritte war das Werk und Verdienst des schottischen Herzogs von Queensberry. Der Herzog verließ früh das Haus, um beim Abschluß der Verhandlungen zu präsidieren. Ganz Edinburg war auf den Straßen. Auch die Dienerschaft von Queensberry-House hatte das herzogliche Palais verlassen; niemand war im Hause zurückgeblieben als des Herzogs ältester Sohn, wahnsinnig in seiner Zelle, und ein Küchenjunge hinterm Herd. Gegen Mittag waren die Verhandlungen geschlossen, Kanonenschüsse vom alten Schloß her rollten über die Stadt hin. Alles strömte heim, auch die Dienerschaft von Queensberry-House. Was fanden sie vor? Die Eisenstäbe der Zelle waren zerbrochen; in der Küche stand der Wahnsinnige und drehte den Spieß; an dem Spieß steckte der Küchenjunge. Das Grausige dieser Geschichte wächst noch durch den leisen Beisatz von Komischem, der unser Gefühl in einen gewissen Zwiespalt und uns vor uns selber fast unter die Anklage der Frivolität bringt.
Hundert Schritte aufwärts von Queensberry-House haben wir Moray-House an derselben Seite der Straße. Die blanken Fenster und die geputzten Messinggriffe sagen uns hier, daß noch Bewohner hinter diesen sauber gehaltenen Wänden leben, die, wenn nicht an Rang und Reichtum, so doch an Sitte und vornehmer Gewöhnung jenen königlichen Morays verwandt sein müssen, die vor zwei Jahrhunderten hier heimisch waren und dem Hause seinen Namen gaben. Im Vorübergehen gewahren wir an den Fenstern des ersten Stocks einen schmucklosen eisernen Balkon. Die Geschichte, die sich daran knüpft, erzähl' ich in einem späteren Kapitel.