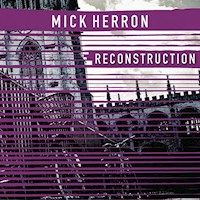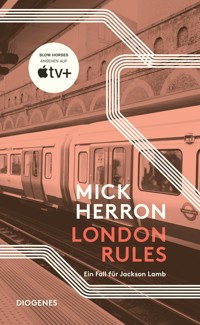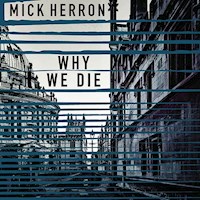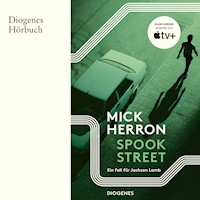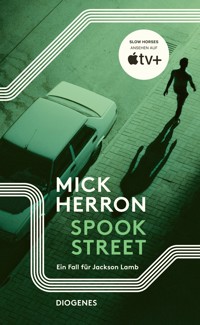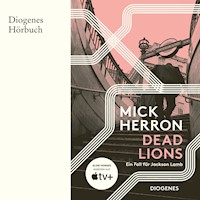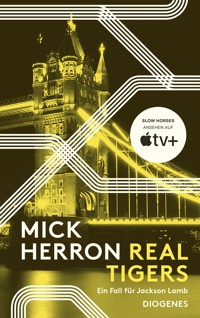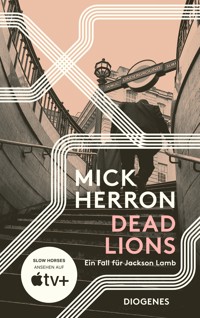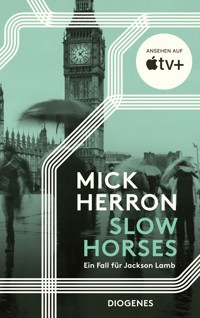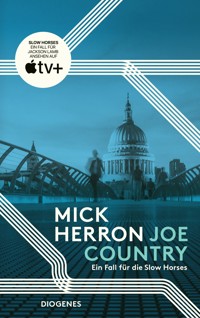
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Slow Horses
- Sprache: Deutsch
In Slough House, dem Abstellgleis des MI5, werden Erinnerungen wach – nur leider keine guten. Catherine Standish kauft wieder Alkohol, und Louisa Guy wühlt in den Trümmern einer alten Liebe. Jackson Lamb quittiert das höchstens mit Flatulenz und einem Schluck Whiskey, doch selbst ihn holen die dunklen Schatten seiner Vergangenheit ein. Auf der Suche nach einem altbekannten Verräter schickt er seine Truppe ins Feld – aber nicht alle kehren zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mick Herron
Joe Country
Ein Fall für Jackson Lamb
Roman
Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer
Diogenes
Für Annabelle
1
Die Eule flatterte kreischend aus der Scheune; ihre Flügelspitzen brannten lichterloh. Einen Moment lang hob sie sich vor dem fahlen Himmel ab wie ein sterbender Engel, versengt von seiner eigenen Göttlichkeit; dann war sie nur noch eine rußige Hülle, die wie ein Amboss in die nahen Bäume fiel. Er fragte sich, ob sie die Äste in Brand setzen würde. Aber die Bäume waren dick mit Schnee bedeckt, und jeder Funke, der den Sturz überstanden hätte, wäre sofort gelöscht worden. Er drehte sich noch einmal zur Scheune um, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das Dach einstürzte und eine Wolke aus Funken und Staub aufwirbelte. Irgendwie faszinierend, wenn man auf so etwas stand. Das war es wohl, was Brandstifter heißmachte.
Aber er war kein Brandstifter, er befolgte nur Anweisungen. Sie hatten die Scheune angezündet, um ihre Spuren zu verwischen, und es war keinem von ihnen in den Sinn gekommen, dass sie dabei ein Massensterben anrichten würden, dass sich im Inneren eine Eule und jede Menge Mäuse, Ratten, Spinnen und so weiter befanden. Nicht, dass das von Bedeutung gewesen wäre. Aber er hätte sich dieser Möglichkeit bewusst sein müssen. Dann wäre ihm nicht das Herz in die Hose gerutscht, als der brennende Vogel auftauchte und verzweifelt den letzten Sekunden seines Lebens nachjagte.
Jetzt waren sie vorüber. Dort oben im großen grauen Jenseits, während sein einstiges Zuhause durch das Wunder der Flammen in eine rauchige Ruine verwandelt wurde.
Irgendetwas gab nach, es krachte und Funken stoben – ein ebenso gutes Signal wie jedes andere: Zeit zu gehen.
»Sind wir fertig?«, fragte er.
»Nicht so fertig wie dieser Vogel. Was war das, ein Huhn oder was?«
»… Ja, klar. Ein Huhn.«
Mein Gott!
Er überprüfte die Riemen seines Rucksacks, zurrte die Manschetten seiner Steppjacke fest, schlug die Kapuze hoch und ging voraus in Richtung Fußweg. Hinter ihnen stiegen Rauschschwaden auf, während der Schnee immer dichter fiel und alle Konturen verschluckte. Die Scheune war unbenutzt gewesen und stand weit abgelegen. Die Rauchsäule würde Aufmerksamkeit erregen, aber sie wären längst weg und ihre Spuren verwischt, bevor die ersten Einsatzkräfte einträfen, und hier draußen hatte man praktischerweise immer Sündenböcke parat: Jugendliche. Das Landleben bestand nicht nur aus Traktorfahren und lustigem Mistschippen. Die Teenies hier dröhnten sich garantiert mit Crystal Meth und Cider zu und steckten Scheunen in Brand. Das hätte er jedenfalls getan, wenn er hier hätte aufwachsen müssen.
Wenn man die Leichen fand, würde es natürlich Aufruhr geben, aber das würde erst passieren, wenn die Flammen erloschen waren. Und bis dahin hätten die Feuerwehrleute das Blut im Schnee längst zu ekliger Matsche zertrampelt.
Seine rechte Manschette war zu eng, und er lockerte den Klettverschluss. Schon besser. Eine gute Jacke: schützte vor der Witterung. Die Frau hatte eine ähnliche Jacke getragen. Sie sah neu aus, hatte aber einen Dreiecksriss über der rechten Brust, wahrscheinlich vom Klettern über einen Zaun. Der Mann dagegen war nicht für die Kälte gekleidet gewesen und hätte sich auch ohne sein Zutun den Tod geholt.
Der Fußweg führte aus dem schützenden Wald heraus, und sie befanden sich wieder im Freien. Das Wetter kam von der Küste, und sie liefen darauf zu: Unterwegs würde er den Chef anrufen und einen Treffpunkt vereinbaren. Mit etwas Glück hatte der Boss den Jungen heute Morgen gefunden und umgebracht, aber sie waren jetzt sowieso auf dem Sprung. Manchmal gingen Jobs schief; manchmal blieben Kollegen auf der Strecke. Man verbuchte es als Lektion fürs Leben, ging nach Hause und leckte seine Wunden bis zum nächsten Mal.
Sein Begleiter sagte: »Ich könnte einen Drink vertragen.«
»Erst, wenn’s wieder Straßenbeleuchtung gibt.«
Damit meinte er: wenn sie wieder in England waren. In Wales mochte es Straßenbeleuchtung geben, aber die wurde wahrscheinlich von Hamstern in Rädern angetrieben.
Ein schwarzer Schatten flog über ihn hinweg, ein Vogel auf dem Weg nach Hause, und er dachte wieder an die Eule; wie die Flammen sie bereits verzehrten, während sie aus der Scheune floh. Irgendetwas hatten Eulen doch zu bedeuten, oder? Sie waren Omen, wahrscheinlich für den Tod. Die meisten Omen hatten mit dem Tod zu tun. Das kannte man aus Horrorfilmen.
Er erreichte einen Zauntritt und kletterte hinüber. Hinter ihnen lagen ein paar komplizierte Tage und eine schwarze Rauchfahne, die ein Zeichen in den Himmel schickte; vor ihm lagen eine zunehmend weiße Landschaft und jenseits davon das Meer. Während er darauf zuging, dachte er: Die Eule hatte das Richtige prophezeit, wenn auch etwas zu spät. Der Tod war in die Gegend gekommen und hatte reiche Ernte gehalten. Die Aufgabe war schwieriger gewesen als erwartet, denn der Widerstand kam aus der Abteilung für Ausschussware: Slade House? Nein, Slough House … Slough House, und der Chef hatte sie »Slow Horses« genannt. Ja, die Arbeit war schwieriger gewesen als erwartet, aber letztendlich war das egal.
Der Mann war tot. Die Frau war tot.
Slough House würde ein paar neue lahme Gäule brauchen.
ERSTER TEILLahme Enten
2
Städte schlafen bei Licht, als hätten sie Angst vor der Dunkelheit. Entlang der Straßen und rings um die Kreuzungen bilden die Straßenlaternen Blütenketten durch die Nacht, die die Bürgersteige erleuchten und die Sterne ausblenden. Und wenn diese Ketten von oben betrachtet – etwa aus der Perspektive von Astronauten oder in der Fantasie von Lesenden – Nervenbahnen gleichen, die die Hemisphären einer Stadt miteinander verbinden, ist das ein durchaus zutreffender Vergleich. Denn eine Stadt besteht aus Erinnerungen, in Behältern aus Stein und Metall, Ziegeln und Glas gespeicherten Erinnerungen, und je heller das Licht in den Bahnen pulsiert, desto deutlicher treten diese Erinnerungen hervor. Auf den breiten Prachtboulevards haben bedeutende Ereignisse ihre Spuren hinterlassen – Paraden des Königshauses, Kriegskundgebungen, Siegesfeiern –, während auf den Verkehrsknotenpunkten die Schatten unansehnlicherer Vorkommnisse liegen: Aufstände, Lynchmorde und öffentliche Hinrichtungen. An den Ufern der Flüsse rauscht das Murmeln banaler Momente – Hunderttausender Verlobungen und Ehebrüche –, und im explosiven Schein der Transportterminals flackern eine Milliarde Ankünfte und eine Milliarde Abflüge. Einige haben Narben im Gedächtnis der Stadt hinterlassen, andere nur einen leichten Kratzer, aber alle tragen zum Ganzen bei, denn das ist es, was eine Stadt ausmacht: die allmähliche Anhäufung von Geschichte; einer schier unendlichen Anzahl an Ereignissen in einem Netzwerk von Straßen, die nachts aufleuchten.
Doch während sich die glänzendsten dieser Erinnerungen in Gedenktafeln und Statuen manifestieren, werden die privateren verborgen oder zumindest so unübersehbar ausgestellt, dass sie keinem auffallen.
Zum Beispiel im Londoner Stadtteil Finsbury, wo an der Aldersgate Street das Barbican Centre hockt wie eine Kröte. Trotz dieses Anziehungspunkts lastet auch auf dieser Verkehrsader das dumpfe Gewicht der Mittelmäßigkeit: Von allen Londoner Erinnerungen sagt diese unscheinbare Ansammlung von Geschäften und Büros nur den wenigsten etwas, und die grellen nächtlichen Nervenbahnen leuchten hier am schwächsten. Doch unweit des U-Bahn-Eingangs erhebt sich ein vierstöckiges Gebäude, das allerdings niedriger wirkt. Die ebenerdige, schwarze Eingangstür, eingezwängt zwischen einem Zeitungskiosk und einem chinesischen Restaurant, wurde schon lange nicht mehr gereinigt, die Fassade ist heruntergekommen, die Regenrinnen sind verdreckt und die Tauben zeigen dem Gebäude ihre Verachtung auf die traditionelle Art und Weise. Der einzige Anflug von Seriosität – der in Gold tätowierte Schriftzug W.W. Henderson, Rechtsanwalt und Notar auf einem Fenster im zweiten Stock – ist schon lange abgeblättert, und die unbeschrifteten Fenster darüber und darunter sind schmierig und grau. Das Gebäude gleicht einem faulen Zahn in einem schlechten Gebiss. Hier passiert nichts: Hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter.
So soll es auch sein, denn das ist Slough House, und Slough House verdient keine Aufmerksamkeit. Sollte eine Historikerin versuchen, in seine Geheimnisse einzudringen, müsste sie zuerst eine Hintertür überwinden, die bei jedem Wetter klemmt, und dann eine Treppe, deren Knarren auf einen baldigen Einsturz hindeutet, aber danach fände sie wenig, was sie in ihr Notizbuch schreiben könnte: nichts als ein paar Büros, ausgestattet für die 1990-er Jahre, bröckelnder Putz und verrottende Splitter in den Fensterrahmen. Der metallische Geruch eines überstrapazierten Wasserkochers verpestet die Luft, und in den Ecken der abblätternden Decken sammeln sich Schimmelsporen. Sie schleicht von Zimmer zu Zimmer, auf Teppichen, so dünn wie Motel-Bettlaken, legt ihre Hand hoffnungsvoll auf altersschwache, starre Gusseisenheizkörper und findet keine Geschichte mehr außer einem schwachen Abklatsch, jenen Abläufen, die sich gewohnheitsmäßig wiederholen. Also packt sie ihren Stift wieder ein und geht die schäbige Treppe hinunter, durch den muffigen Hof, in dem die Mülltonnen stehen, und hinaus in die Gasse, dann auf die Straße, dann weiter in die Innenstadt. Geschichte findet man überall. Auf der ganzen Welt werden jede Minute neue Erinnerungen geprägt. Es gibt keinen Grund, die Zeit mit dieser Bruchbude zu verschwenden.
Wenn sie weg ist, wird ein Seufzen durch das Gebäude gehen, ein kaum merkliches Ausatmen, das mit Papieren raschelt und an Türen wackelt, und Slough House wird die Gewissheit haben, dass seine Geheimnisse unangetastet bleiben. Denn es birgt durchaus welche: Wie jedes Gebäude in jeder Stadt ist Slough House ein Neuron im städtischen Hippocampus und bewahrt das Echo von allem, was es gesehen und gehört hat. Die Erinnerungen haben die Wände befleckt und sind in das Treppenhaus gesickert; sie stinken nach Versagen und wurden aus den Archiven gelöscht, aber sie existieren weiter und sind nicht für die Augen von Eindringlingen bestimmt. Tief in den Gebeinen des Gebäudes steckt das Wissen, dass einige Räume, die jetzt nur noch eine Person beherbergen, früher Platz für zwei boten; dass einst vertraute Eindrücke – das Gewicht eines Schattens an einer Wand, der Druck eines Fußes auf einer Treppe – der Vergangenheit angehören. Das ist es, was die Erinnerung ausmacht: das ständige Bewusstsein, dass manches verschwunden ist. Und das ist es, was Bewusstsein ausmacht: das Wissen, dass noch mehr verschwinden wird.
Die Zeit vergeht, und die Lichter der Stadt erlöschen, während sie allmählich erwacht. Die Erinnerungen, die der Schlaf aufgewühlt hat, verblassen mit der Morgendämmerung. Der Schnee wird noch vor Ende der Woche kommen, aber heute herrscht nur kalte, graue Normalität. Schon bald werden die Slow Horses antraben und sich ihrer geisttötenden Routine unterwerfen; gedankliche Gewaltmärsche durch eine Landschaft, die sich nicht durch Sehenswürdigkeiten auszeichnet. Bei solchen Aufgaben liegt die Herausforderung darin, sich daran zu erinnern, warum sie überhaupt noch hier aufkreuzen.
Und während sie das tun, widmet sich Slough House seiner alltäglichen lästigen Pflicht des Vergessens.
Woran man sich bei Roddy Ho erinnern musste – wie sich Roddy Ho erinnerte –, war, dass Roddy ein Spion war, ein Schnüffler, ein Agent. Roddy war ein Player.
Deshalb wühlte er im Papierkorb eines anderen.
Ja, er hatte ein schlechtes Jahr hinter sich. Kim, seine Freundin, war gar nicht seine richtige Freundin gewesen, wie sich herausgestellt hatte, und auch wenn der Groschen lange nicht gefallen war: Den Schmerz, den er bei seinem Aufprall verursacht hatte, würde er nicht so schnell vergessen. Er hatte sich verraten gefühlt. Verletzt. Und nicht zuletzt hatte es ihn gestresst, als man ihm klargemacht hatte, dass er selbst um ein Haar zum Verräter geworden war – gut, dass Lamb seinen treuen Adjutanten nicht kampflos hatte abschieben lassen. Aber jetzt, wo sich die Wogen geglättet hatten, waren zwei Dinge sicher: Kim – seine Freundin – war Geschichte, und er, der Rodster, war immer noch das Gehirn, das Slough House am Laufen hielt.
… bis die Vorwürfe in Bezug auf Ihr Verhalten vollständig untersucht wurden, bleiben Sie vorerst in …
Eine Zeit lang war er am Boden zerstört gewesen. Er hatte seinen Bart vom schicken Accessoire zum Hipster-Gestrüpp verwahrlosen lassen. Er war in TerraWar VII im zweiten Level rausgeflogen und konnte nachvollziehen, wie sich Andy Murray gefühlt hatte, als er den Bus von Wimbledon nach Hause nahm. Und er hatte sich kaum dazu aufraffen können, sich gebührend darüber aufzuregen, dass der neue Doctor im Game eine Frau sein würde: Sollten doch andere für das Gute kämpfen. Der RodMan hatte seinen Umhang an den Nagel gehängt.
… darf keinen Kontakt zu Mitarbeitenden aufnehmen, bis die Ermittlungen zur Zufriedenheit dieser Abteilung abgeschlossen sind …
Und wenn er darauf gewartet hätte, dass ihn jemand – am liebsten Louisa, aber notfalls auch Catherine – beiseitenehmen und trösten würde, wäre er auch enttäuscht worden. Andererseits konnte er es ja verstehen. Wenn man einen verwundeten Löwen in seinem Rudel hat – den König des Rudels, das Alphatier –, machte man kein Aufhebens darum, während er gesundete. Man wartete, bis er wieder stark war, und dann seufzte man erleichtert auf, weil die Ordnung wiederhergestellt war. So war es in letzter Zeit gewesen: Er hatte eine ruhige Phase der Genesung durchgemacht, die alle in seiner Umgebung respektierten.
… Ihr Gehalt und Ihre Sozialleistungen werden auf dem aktuellen Stand eingefroren …
Und die jetzt vorbei war: Er war wieder im Spiel. Frauen konnten einem wehtun, aber sie konnten einen nicht brechen. Bestes Beispiel: Batman. Ein Krieger ging allein durchs Leben. Außerdem konnte im Internet-Zeitalter jeder Sex haben – oder zumindest hatte jeder Zugang zu vielen anschaulichen Bildern, wie Sex aussehen konnte. Es hätte also schlimmer sein können.
Was er jetzt gerade tat, quasi als Beitrag zu seiner Rekonvaleszenz, war eine Maßnahme, um die Kontrolle über seine Umgebung wiederzuerlangen. Denn obwohl ein Krieger allein durchs Leben schritt, hatte Ho einen Stallgefährten zugewiesen bekommen. Alec Wicinski, so hieß der Neue, oder Lech – Lek? – was wie ein Name aus Star Wars klang. Er war erst seit zwei Tagen hier, und schon bestand er darauf, dass Roddy seine Sachen auf »seine Seite des Büros« räumte, und grummelte, das sei schließlich sein Schreibtisch, »vorläufig jedenfalls«. Ha, ha. Offensichtlich musste er lernen, denjenigen, die ihm überlegen waren, Respekt zu zollen, was bedeutete, dass Roddy das tun musste, was Roddy am besten konnte: Aufsatteln, durch das World Wild Web reiten und herausfinden, wer dieser Wicinski war und was er getan hatte, um hierher versetzt zu werden und Roddys Privatsphäre zu verletzen.
Also hatte er die logischen Schritte unternommen und sich in die Akten des MI5 vertieft, um die Hintergrundgeschichte dieses neuen Clowns zu recherchieren; Informationen, die für Durchschnitts-Bürohengste nicht zugänglich waren, aber der RodMan ließ sich von keiner Firewall aufhalten. Nur, dass es diese Informationen nicht gab. Er fand nicht nur keine zensierten Passagen über die spezifische Sauerei, die der Neue auf dem Teppich im Regent’s Park hinterlassen hatte, sondern überhaupt nichts – kein Einstellungsdatum, keine Jobbeschreibung, kein Foto; nichts. Es war, als ob Alec (Lech?) Wicinski nicht existierte oder zumindest nicht existiert hätte, bevor er einen Fuß ins Slough House setzte.
Das war interessant. Was Roderick Ho ganz allgemein missfiel.
Roderick Ho mochte es, wenn alles seine Ordnung hatte.
Aber Wicinski hatte Post erhalten, also musste zumindest irgendjemand davon ausgehen, dass er existierte. Er saß am anderen Schreibtisch in Roddys Büro und las das Schreiben mit gerunzelter Stirn, als enthielte es nicht nur schlechte Nachrichten, sondern die Bestätigung für Schlimmeres. Dann zerriss er es und warf die Fetzen in seinen Papierkorb.
Da muss man nicht Sherlock Holmes sein, dachte Roderick Ho spöttisch.
Also wartete er, bis Wicinski Feierabend gemacht hatte, sammelte die Schnipsel ein und setzte sie zusammen. Er brauchte nur vierzig Minuten. Und was er gefunden hatte, war zweifelsohne ein Beweis: ein Brief der Personalabteilung. Darin stand, dass Wicinski keinen Fuß in den Regent’s Park setzen und keinen Kontakt zu seinen Kollegen aufnehmen dürfe; von »laufenden Ermittlungen« war die Rede. »Vorwürfen«. Der Scheiß klang ernst. Aber es gab keine Hinweise auf die Art seiner Sünden.
Also immer noch interessant. Immer noch ungeklärt.
Roddy hatte die Schnipsel wieder in den Papierkorb geworfen, jedenfalls die meisten. Er war jetzt an dem Fall dran. Und jetzt, wo Roddy wieder im Spiel war, war er nicht mehr aufzuhalten.
Das war gestern gewesen. Heute Morgen hatte Wicinski dagesessen, schwarzen Tee getrunken, mit finsterer Miene ein weiteres seitenlanges Schreiben gelesen, und er hätte einem fast schon leidtun können – jedenfalls bis zu dem Moment, als er die Seiten zerknüllte, sie in den Papierkorb warf und wie ein wütender Gorilla aus dem Zimmer stürmte.
Ho hatte gewartet, aber Wicinski war nicht zurückgestürmt.
Die Papierbälle waren alle elegant im Mülleimer gelandet, aber dafür war die Art, wie der Typ aus dem Büro gestampft war, höchst unelegant gewesen, fand Roddy. Etwas mehr Selbstachtung bitte, dachte er und kniete sich neben den Mülleimer. Man muss hohe Ansprüche an sich stellen, dachte er, als er anfing, darin herumzukramen.
Er zog das erste Blatt Papier heraus und strich es glatt.
Leer.
Seltsam.
Er zog ein weiteres Blatt heraus und tat das Gleiche.
Leer.
War dieser Wicinski eine Art abgefuckter Origami-Künstler? Hatte man ihn nach Slough House geschickt, weil er Papier verschwendet hatte? Man musste schon etwas Schräges angestellt haben, um das zu verdienen, aber die Sache war echt abgefahren und gefiel ihm ganz und gar nicht.
Noch eine Seite.
Leer.
Und dann noch eine. Erst auf dem siebten Blatt stand tatsächlich etwas geschrieben, und Roddy setzte sich vor Schreck auf, während er es las.
Fick dich, du kleiner Schnüffler.
Was sollte das denn heißen?
Aber noch bevor Roddy sich einen Reim darauf gemacht hatte, suchte er weiter, denn da waren ja noch mehr Papiere. Er fuhr mit der Hand wieder in den Mülleimer, berührte etwas Festes, und schnapp – Roderick Ho schrie auf, als der Schmerz ihn von den Fingern aufwärts durchzuckte, oh mein Gott, was war denn jetzt passiert? Er zog seine Hand heraus, die vor Schmerzen pochte, und als er durch einen Vorhang aus Tränen sah, was an ihr baumelte, gesellte sich ein weiteres Rätsel zu der kryptischen Nachricht, die er gerade entdeckt hatte.
Warum in aller Welt hatte dieser verdammte Idiot eine nagelneue Mausefalle weggeworfen?
Schon merkwürdig, dachte Louisa Guy im Nachhinein, wie ungewohnt das Klingeln eines Telefons für sie geworden war. Natürlich nicht das eines Handys, sondern das Geräusch eines läutenden Festnetztelefons, das mit seinem begrenzten Repertoire wie aus einem Schwarz-Weiß-Film wirkte, in dem Telefone robuste Apparate mit Wählscheiben und klobigen schwarzen Hörern waren. Die beiden Telefone in ihrem Büro sahen zwar nicht so aus, sondern waren graue Plastikdinger mit Tasten, aber trotzdem: Es war Monate her, dass ihr eigenes Telefon einen Ton von sich gegeben hatte, ganz zu schweigen von dem auf dem unbenutzten Nebentisch. Dass dieses klingelte, kam vollkommen unerwartet, denn abgesehen von allem anderen gehörte dieser Schreibtisch einem toten Mann.
Der tote Mann war Min Harper.
Der Tag war noch nicht einmal zur Hälfte vorbei, hatte aber schon einige Überraschungen bereitgehalten, doch selbst wenn in Slough House etwas Neues passierte, fühlte es sich wie etwas Altes an. River hatte eine SMS geschickt, eine schlechte Nachricht, aber eine, die sich schon seit einer Weile angekündigt hatte und die sie mit keiner Antwort zum Besseren wenden konnte. Und dann war der neue Typ, Lech – Alec? – vorhin in der Küche gewesen. Er hatte ausgesehen wie jedes Slow Horse an den ersten Tagen: wie vor den Kopf geschlagen. Noch letzte Woche hatte er im Regent’s Park gearbeitet, und jetzt war er in Slough House, und während es von dort nach hier nur ein Katzensprung war, war die Distanz von hier nach dort unüberbrückbar. Daran konnte Louisa nichts ändern, selbst wenn sie es gewollt hätte – und es gab gute Gründe, Neuankömmlingen gegenüber vorsichtig zu sein –, aber ihre Unfähigkeit, etwas für River Cartwright zu tun, erweichte sie vielleicht ein wenig, sodass sie Lech zumindest einen Rat geben konnte. Nicht, weil er gerade dabei war, in tiefe Scheiße zu geraten, sondern weil sich auch seichte Scheiße überall verteilte, wenn man nicht aufpasste, wo man hintrat.
Also sagte sie: »Nicht die da.«
»Hm?«
»Nicht diese Tasse.«
Der Neue hatte nach der Clint-Eastwood-Tasse gegriffen, und keiner hatte Lust auf Roderick Hos Reaktion, falls er es merkte.
»Dein Bürokollege kann es nicht leiden, wenn andere seine Sachen benutzen.«
»Ernsthaft?«
»Er ist dafür berüchtigt.«
»Analcharakter, was?«
»Schon, aber eins rate ich dir: Sag das nicht in Lambs Hörweite. Es wäre eine Steilvorlage für ihn.«
Daran hätte man gut anknüpfen könne, aber sie wollte noch nicht zu viel verraten. Also fügte sie lediglich hinzu: »Viel Glück«, und trug ihren Kaffee in ihr Büro. Auf dem Weg dorthin hörte sie einen Schrei aus Hos Zimmer und fragte sich, was das zu bedeuten hatte, war aber nicht neugierig genug, um nachzuschauen.
Und zwanzig Minuten später klingelte das Telefon.
Eine Weile – fünf Klingeltöne lang – starrte sie auf den Apparat, dessen Drrring-Drrring die Büroluft durchwirbelte. Verwählt? Hoffentlich. Instinktiv ahnte sie, dass es nichts Gutes bringen würde, wenn sie den Hörer abnahm. Bis irgendwo von oben ein vertrautes, wütendes Gebrüll ertönte: »Geht jetzt endlich mal jemand an das Scheißtelefon?«, also stand sie schließlich auf, ging zum anderen Schreibtisch und hob den Hörer ab.
»Kanzlei Henderson.«
»Bin ich da …? Ist das das Büro von Min Harper?«
Louisa erschauerte bis ins Mark.
»Hallo?«
»Mr Harper arbeitet hier nicht mehr«, sagte sie. Die Worte, ihr Tonfall, waren mit schwarzem Trauerflor umhüllt.
»Ich weiß, ich weiß … Ich wollte nur …«
Louisa wartete. Es war die Stimme einer Frau, ungefähr in ihrem Alter, etwas unsicher, soweit sie das beurteilen konnte. Min war schon eine Weile tot. Louisa war darüber hinweg, so wie man über eine Erkrankung in der Kindheit hinwegkommt: Ein Teil von einem würde immer schwächer sein, aber man würde nie wieder auf dieselbe Weise erkranken, so die Theorie. Und ob sie nun stimmte oder nicht, Min würde nicht zurückkehren.
»Was ist denn der Grund Ihres Anrufs?« Louisa ertappte sich dabei, dass sie nach einem Stift griff, wie man das im Büro eben tat. Ein Stift, ein Block, die üblichen Utensilien. »Und wer ist am Apparat?«
»Mein Name ist Clare Addison. Also, so heiße ich jetzt, meine ich. Früher hieß ich Clare Harper.«
Louisas Stift hinterließ keine Spuren auf dem Papier.
»Min war mein Mann«, sagte die Frau.
Mit der Macht geht Verantwortung einher, ebenso wie die Möglichkeit, es denjenigen heimzuzahlen, die einen auf seinem Weg nach oben geärgert haben. Diana Taverner war nicht töricht genug, eine richtige Liste erstellt zu haben, aber wie jede kompetente Chefin hatte sie im Geist diverse Namen auf die Rückseite eines Umschlags gekritzelt.
Generaldirektorin des MI5 … Allein der Gedanke daran brachte sie zum Lächeln.
Als sich Claude Whelan für den Ruhestand statt für eine der vorhandenen Alternativen entschieden hatte – darunter diejenige, sich nach draußen führen und erschießen zu lassen –, bot sich niemand automatisch für die Nachfolge an, jedenfalls keine Person, die Diana Taverners Überprüfung auf Herz und Nieren überstanden hätte, wobei Letztere in mindestens einem Fall mehr einem chirurgischen Eingriff als der vom Protokoll geforderten Voruntersuchung glich. Eine potenziell heikle Angelegenheit, aber da die betreffende Person dieselbe Schule wie Oliver Nash besucht und Oliver Nashs Kopf zweimal in die Toilette gesteckt und ihn dabei als Schleimer, Schwachkopf und Opfer bezeichnet hatte, und da Oliver Nash inzwischen Vorsitzender des Kontrollausschusses war, welcher dem Premierminister eine Liste der potenziellen Neubesetzungen für die Leitung des Geheimdienstes vorzulegen hatte, hatte ausnahmsweise einmal das tradierte Männernetzwerk dafür gesorgt, dass eine Frau begünstigt wurde. Man hätte es als Fortschritt werten können, wenn es kein Einzelfall gewesen wäre. Letztendlich hatte jedoch alles zur Zufriedenheit der entscheidenden Parteien geklappt, und die bestanden aus Taverner und Oliver Nash. Taverner war unter den gegebenen Umständen als einzige Kandidatin vorgeschlagen worden, und die neu ernannte Premierministerin – selbst eine Notlösung, auch wenn sie die einzige Person im Land zu sein schien, die sich dessen nicht bewusst war – hatte ihren Segen gegeben, und Taverner hatte nun das Amt inne, von dem sie weit weniger Geeignete schon allzu lange ferngehalten hatten. Und ja, natürlich hatte sie im Kopf eine Liste derer, an denen sie sich rächen würde, und auch wenn manche von ihnen derzeit außerhalb ihrer Reichweite waren, würde sich mit der Zeit sicher eine Gelegenheit ergeben. Für den Moment würde sie sich mit denen begnügen, die in Reichweite waren. Und so gönnte sie an diesem Morgen Emma Flyte, der Chefin der »Dogs«, der internen Dienstaufsicht, eine Audienz.
»Sie werden wohl kaum überrascht sein.«
Flyte zuckte nicht einmal mit der Wimper.
Das Ganze fand im Regent’s Park statt, der zwar der Luftlinie nach nicht weit von Slough House weg war, aber nach anderen Maßstäben endlos weit entfernt. Der Park war das Hauptquartier des MI5; hier lernten die jungen Spione ihr Handwerk, und hierher kehrten umherschweifende Spione zurück, wenn sie ihre Missionen beendet hatten. Er war der Ort, von dem man ausgeschlossen war, wenn man nach Slough House verbannt wurde. Wenn das passiert war, hätte es genauso gut das Schlaraffenland sein können, zu dem man sich jedoch nicht hindurchessen konnte.
»Es geht um Ihre letzte Beurteilung.«
»Bei meiner letzten Beurteilung wurde ich mit ›mehr als zufriedenstellend‹ bewertet.«
»Tja, mein Vorgänger war nun mal ein großer Bewunderer von Ihnen.« Lady Di ließ diesen Satz einen Moment lang für sich sprechen. Claude Whelan war ein großer Bewunderer vieler Personen gewesen; in Bewertungen ausgedrückt hätte jedoch nur Emma Flyte eine glatte Zehn erhalten. In der Zentrale arbeitete eine junge Frau, auf die Whelan auch ein Auge geworfen hatte, aber Josie, so hieß sie, bestach hauptsächlich durch ihre Nähe. Und durch ihre Tops. Claude Whelan war ein guter Mann, aber Gott sei Dank hatte auch er seine Schwächen, sonst hätte er noch immer das Ruder in der Hand. »In dem Maße, dass seine Sicht womöglich ein wenig – getrübt war.«
»Und Sie haben vor, das wieder auszugleichen.«
»Fair und transparent«, sagte Taverner, »so sollten unsere Prozesse ablaufen. Außer bei geheimen Dokumenten, natürlich.«
»Man hat mich eingesetzt, weil die Dogs für private Zwecke der Generaldirektorin missbraucht wurden«, erwiderte Flyte. »Unter meiner Führung hatte das ein Ende. Sind Sie sicher, dass es Ihnen um Fairness und Transparenz geht?«
Sie hatte es nicht zugelassen, dass Taverner die Dogs zu ihren privaten Pudeln machte, und darauf beruhte die Feindseligkeit zwischen den beiden Frauen. Darauf und auf der Tatsache, dass Flyte jünger war als Taverner. Die weibliche Solidarität hatte dort ihre Grenzen, wo die Jahre ihre Furchen zogen.
»Wir sollten uns nicht in Details verzetteln«, sagte Taverner. »Jede neue Führungskraft ist ein neuer Besen, das sollte klar sein. Und die Qualitäten, die ich bei der Leitung der Dienstaufsicht für erforderlich halte, müssen nicht unbedingt mit denen übereinstimmen, die den lieben Claude so begeistert haben. Das ist alles.«
»Sie wollen mich also loswerden. Mit welcher Begründung?«
Ihre Schönheit allein sollte genügen, dachte Taverner. Die Tatsache, dass es keine Vorschrift gab, die Flytes Aussehen verbot, bedeutete nicht, dass es keine geben sollte: Im besten Fall war es eine Ablenkung, im schlimmsten Fall führte es zu Duellen und Blutvergießen. Nicht, dass Flyte jemals aus ihrem Aussehen Vorteile gezogen hätte, aber ein Elefant zog ja auch keinen Vorteil aus seiner Größe. Das hieß aber nicht, dass er keine Bäume umstürzen konnte.
»Niemand behauptet, ich wolle Sie loswerden.«
»Aber Sie wollen meine Leistung neu bewerten.«
»Um die jüngsten Entwicklungen zu berücksichtigen.«
»Die da wären?«
Dass ich jetzt die oberste Chefin bin, verdammt noch mal! Wollte Flyte wirklich, dass sie es laut aussprach?
Taverner schaute sich um. Sie war nach ihrer Beförderung nicht in ein anderes Büro umgezogen, sondern in der Zentrale geblieben. Ihre Vorgänger besaßen meist ein Büro im Obergeschoss mit Blick auf den Park: Sonnenlicht, Grün und eine nicht enden wollende Reihe von Au-pairs, die versuchten, die Kinder nicht zu verlieren; hier unten konnte Lady Di durch ihre Glaswand die jungen Leute beobachten, wie sie die Hotspots überwachten und die Welt auf Kurs hielten. Hier wurde die Arbeit erledigt. Und ein Teil der Arbeit bestand jetzt darin, ihre Position zu festigen; nicht, um sich schnöde zu rächen, sondern um sicherzustellen, dass sie, wenn harte Entscheidungen anstanden, diese auch treffen konnte, ohne dass im Hintergrund ein Chor von Unzufriedenen ertönte. Das und schnöde Rache. Denn man konnte nicht leugnen, wie befriedigend das war.
Wie sich herausstellte, musste nichts laut ausgesprochen werden. Taverners Gesichtsausdruck war für Emma Flyte Antwort genug.
»Vielleicht wäre es leichter, wenn ich einfach meinen Spind ausräumen würde.«
»Um Himmels willen, nein«, entgegnete Taverner. »Wer hat denn etwas von Entlassung gesagt? Nein, was mir vorschwebt, ist eine Rolle, die unserer Neubewertung Ihrer Fähigkeiten besser entspricht. Und damit meine ich keine Degradierung, sondern mehr eine … Versetzung.«
Das Aufflackern der Erkenntnis in Flytes Augen war für Taverner mehr wert als ein neues Paar Schuhe.
»Das soll wohl ein Scherz sein.«
»Nein, keineswegs«, erwiderte Taverner. »Nein, ich glaube, in Slough House sind Sie genau an der richtigen Stelle, unter den gegebenen Umständen.«
Selbstzufrieden bildete sie sich ein, dass sich auf ihrem Gesicht keine Spur von Triumph abzeichnete.
Ihr Mantel war mit den Jahren zu einem Staubgrau verblasst, und in ihn eingehüllt hätte sie mit der Treppe von Slough House verschmelzen und vor dem Hintergrund des abgewetzten Teppichbodens und der altersfleckigen Wände unsichtbar werden können. Passierte das jedem? Oder nur Frauen?
rioja cabernet merlot shiraz
Sie trug auch einen Hut. Das taten heutzutage nicht mehr viele. Ihr Hut war mattviolett, ziemlich ausgeblichen mit der Zeit; als sie ihn gekauft hatte, war seine Farbe lebhafter und leuchtender gewesen. Aber vielleicht ließen auch nur ihre Augen nach, und alles, was sie sahen, verschwamm zu blassen Schemen. Also täuschte sie sich womöglich, was ihren Hut und ihren Mantel anging, und war, ohne es zu wissen, eine blendende Erscheinung. Dieser Gedanke brachte sie fast zum Lachen, ein Impuls, der hier auf der Treppe leicht zu unterdrücken war. Diese Wände hatten schon vieles gehört, aber Lachen nur sehr selten.
burgunder barolo beaujolais
(Das waren natürlich eigentlich keine Farben. Aber immerhin Rottöne, die Farbe von Blut.)
Ihre Handschuhe waren natürlich schwarz, ebenso wie ihre Schuhe. Nicht alles verblasste. Aber ihr Haar war einmal blond gewesen, und obwohl es das – Strähne für Strähne – vielleicht noch immer war, erschien es grau, wenn sie in den Spiegel sah. Das schien Beweis genug zu sein. Es war schon lange her, dass ihr jemand nähergekommen war als ihr eigenes Spiegelbild.
All meine Farben, dachte Catherine Standish. All die Primärfarben, in die das Leben einst getaucht war; jetzt fielen nur noch Schuhe und Handschuhe auf. Alles andere lag im Schatten.
Sie erreichte ihr Büro. Es war kalt darin, obwohl das arthritische Keuchen der Rohre bedeutete, dass die Heizung lief. Ihr Heizkörper musste entlüftet, zur Ader gelassen werden – und da war es wieder, das Blut, auch wenn es nur ein wässriger Ersatz war, ein rostiges Rinnsal. Mantel aus, Hut ab, Computer an. Es gab Berichte von Louisa Guy und River Cartwright auszuwerten: Louisas würde zwar lückenhaft sein – sie stellte die Namen derjenigen zusammen, die »verdächtige Texte« aus öffentlichen Bibliotheken ausgeliehen hatten –, aber ansonsten zuverlässig; River hingegen schien sich aufs Fabulieren verlegt zu haben, selbst wenn er nur eine Adressenliste zusammenstellen musste. Seine aktuelle Aufgabe bestand darin, Gebäude zu identifizieren, die feindlichen Elementen potenziell als Safehouses dienen konnten. Das sollte er tun, indem er Steuerbescheide mit Volkszählungsformularen abglich; es wirkte allerdings eher so, als ob River einmal pro Woche einen Haufen zufälliger Adressen herunterlud und sie durchmischte, damit es echt aussah. Früher oder später würde es Lamb auffallen.
Und dann dieser Neue: Lech Wicinski, auch Alec genannt. Was für eine hirnverbrannte Aufgabe sich Lamb wohl für ihn ausdenken würde?
Und warum interessierte sie das überhaupt?
Seit Wochen war sie jeden Abend auf dem Heimweg nach St John’s Wood eine Station früher aus der U-Bahn gestiegen, trotz der Kälte. Es war Schnee vorhergesagt, und die Bürgersteige waren hart wie Stahl. Man spürte es bei jedem Schritt; die bitterkalten Steine hämmerten einem durch alle Knochen. So reagierte London, wenn das Wetter die Stadt daran erinnerte, dass sie vergänglich war: Sie kauerte sich zusammen. Vernünftige Leute hielten sich dann nicht draußen auf, wenn sie nicht mussten. Catherine jedoch trotzte jeden Abend der Kälte und stieg eine Station früher aus, weil sie dadurch an der Wine Citadel vorbeikam und eine Flasche kaufen konnte.
sangiovese pinot noir syrah zinfandel
Genau genommen ging es gar nicht so sehr um die Farbe.
Es war Jahre her, dass sie die Freiheit genossen hatte, die praktisch jeder andere besaß. Die scheinbar beiläufige Art der Transaktion begeisterte sie. Man suchte sich eine Flasche aus und zog seine Karte durch. Leute machten das jeden Tag, viele von ihnen mehr als einmal. Sie selbst hatte es in den guten alten Zeiten unzählige Male getan. Damals, als sie in Regent’s Park gearbeitet hatte, war sie eine funktionierende Alkoholikerin gewesen; danach, für eine etwas kürzere Zeit, eine dysfunktionale Alkoholikerin und dann – nachdem sie dank ihres Chefs Charles Partner in einem Service-Sanatorium trocken gelegt worden war – eine trockene Alkoholikerin. Und dann hatte sich ihr Chef, der Generaldirektor des MI5, in der Badewanne das Hirn weggepustet, so hieß es zumindest damals.
Aber wie ein Weinfleck wollte die Geschichte nicht verschwinden, und jedes Mal, wenn sie daran herumwischte, tauchte er wieder auf, mit einem anderen Muster. Partner war, wie sich herausstellte, ein Verräter gewesen. Er, der Leiter des Inlandsgeheimdienstes, der Mann, der Catherine aus ihrer Abwärtsspirale herausgeholt hatte, hatte ein Jahrzehnt lang Verrat begangen. Im Rückblick war das für sie sowohl ein Schock als auch eine Bestätigung für etwas gewesen, das sie schon immer gewusst hatte: dass sich alle aktiven Agenten, alle »Joes«, am Ende selbst bedienten. Charles war lediglich ein extremer Fall gewesen. Erst sehr viel später kam ans Licht, dass Partner sie nicht wegen ihrer Qualitäten, sondern gerade wegen ihrer Sucht angestellt hatte. Sie selbst dagegen hatte sich als seine engagierte Helferin betrachtet, die stets effiziente Assistentin, deren eigenes Leben zwar chaotisch war, die aber dafür sorgte, dass seines in geordneten Bahnen verlief. Doch es stellte sich heraus, dass ihre Hauptqualifikation in seinen Augen darin bestand, dass sie eine Trinkerin war und man darauf bauen konnte, dass sie nicht sah, was vor ihren Augen geschah. Jedes Geheimnis, das er jemals verkauft hatte, war über ihren Schreibtisch gegangen, all seine Verbrechen trugen ihre Fingerabdrücke. Wäre er vor Gericht gestellt worden, hätte sie neben ihm gestanden, und damit wäre es mit ihrer noch frischen Abstinenz schnell vorbei gewesen.
Aber er hatte sich umgebracht, und sie war hier in Slough House gelandet, und während die anderen Insassen es als Folter betrachteten, verstand Catherine es als Buße. Eine Alkoholikerin zu sein war Teil ihrer Veranlagung, die seit ihrer Jugend in ihr steckte; viel schlimmer war, dass sie sich zur Närrin hatte machen lassen. Selbst sinnlose Plackerei war besser, als dieses Risiko noch einmal einzugehen. Sogar Jackson Lamb war besser – seine endlose Grobheit, seine vulgären Gewohnheiten.
Und dann veränderte der Fleck erneut seine Form.
amarone bardolino montepulciano
Es war Diana Taverner gewesen, die es ihr gesagt hatte: Es gibt etwas, Catherine, das Sie unbedingt wissen sollten. Eines musste man Lady Di lassen: Wenn sie einem mit einer Nachricht in den Rücken fiel, ließ sie das Messer anschließend stecken. Haben Sie wirklich geglaubt, er hätte Selbstmord begangen? Aber inzwischen haben Sie es doch schon längst herausgefunden, oder?
Natürlich hatte sie es gewusst, und zwar schon seit Jahren. Sie hatte es gewusst, aber nicht zugelassen, dass sich dieses Wissen verfestigte und Wurzeln schlug.
Jackson Lamb hatte Charles Partner umgebracht. Damals war er Partners Agent gewesen. Partner war sein Führungsoffizier, sein Mentor gewesen, der Maibaum, um den er getanzt hatte. Aber er hatte ihn umgebracht; er hatte ihn in seiner Badewanne erschossen, wo Catherine ihn gefunden hatte. Doch es hatte weder einen Prozess noch Blätterrauschen in der Boulevardpresse gegeben, denn es war ja nur ein weiterer Selbstmord innerhalb des Geheimdienstes gewesen. Ein paar gemurmelte Worte, ein Gang zum Agentenfriedhof, und das war’s. Als Bezahlung oder Bestrafung – sie wusste nicht, welches – hatte Lamb Slough House erhalten und hockte seitdem hier, als grimmiger Aufseher über die Versager des Service, deren Karriere zwar nicht mit einer Kugel in der Badewanne ihren Höhepunkt erreicht hatte, aber dennoch abrupt beendet war. Und hier war auch sie, jeden Tag; legte Berichte auf Lambs Schreibtisch, kochte ihm Tee und leistete ihm manchmal aus Gründen, die sie nie verstanden hatte, in den dunklen Stunden Gesellschaft. Sie mochte ihn nicht, aber sie war an ihn gebunden: ihr Buhmann und gelegentlicher Retter; und auch, wie sich jetzt herausstellte, der Mörder ihres ehemaligen Chefs. Wie sollte sie sich dabei fühlen?
Es war ihr Job, einfach weiterzumachen. Und zwar einen Tag nach dem anderen.
Catherine begann, die Berichte von River und Louisa durchzugehen. Sie ordnete sie, druckte sie aus, heftete sie sauber ab und steckte sie in eine Mappe. Früher oder später würden sie in Regent’s Park landen, wo sie, wer weiß, womöglich ungelesen geschreddert wurden. Das war nur eines von vielen Dingen, auf die sie keinen Einfluss hatte.
Doch später, auf dem Heimweg, würde sie eine Flasche kaufen.
Wenn du die Schule magst, wirst du die Arbeit lieben, hieß es früher. Und es stimmte, dachte Shirley Dander, dass das eine ein gutes Training für das andere war. Gegen die Wutanfälle, Boshaftigkeiten und Attitüden im Büro war die Schule ein Kinderspiel.
Ein typisches Beispiel war J.K. Coe.
Coe war ein Dreiviertel-Psychopath, wenn man Shirley fragte. Beweise dafür gab es genug: Er hatte mindestens zwei Menschen vorsätzlich getötet, und wer weiß, was er in seiner Freizeit anstellte; einen von ihnen (unbewaffnet, gefesselt) hier im Gebäude, der andere war zugegebenermaßen ein schwierigeres Ziel gewesen: ein übler Typ, der mit einer Automatik rumballerte. Coe war auf ihn zugegangen und hatte ihm aus nächster Nähe eine Kugel in den Kopf gejagt. Schon mit einer Handfeuerwaffe hätte es eine Sauerei gegeben; mit einem Polizeigewehr war es moderne Kunst. Abgesehen davon hatte er Shirley einmal ein Messer an die Kehle gehalten. Keine Ahnung, warum sie ihm nur einen Dreiviertel-Status bescheinigte; vielleicht reine Kollegialität. In den meisten Büros wäre man mit so einer Akte schon zur Mittagszeit mit dem Arsch draußen gelandet. In den meisten Schulen auch, hoffte sie jedenfalls.
Aber das hier war Slough House, wo Jackson Lamb die Regeln machte, und solange man nicht sein Mittagessen versteckte oder seinen Whisky stahl, konnte man mit Mord ungeschoren davonkommen. Shirley wusste von mindestens vier Leichen innerhalb dieser Mauern, und das nur an den Werktagen. Außerdem war das hier lediglich die Abstellkammer des Service, in die man geschickt wurde, wenn sie einen zu Tode langweilen wollten. Weiß Gott, was im Regent’s Park los war.
Jedenfalls hatten J.K. Coe und Shirley eine gemeinsame Vergangenheit, was es eigentlich hätte einfacher machen sollen, sich mit ihm zu unterhalten. Ihn zu finden war kein Problem – er saß in seinem Büro –, aber von da an wurde es mühsam.
»Ziemlich ruhig hier.«
Dass er nicht antwortete, bestätigte sie zumindest.
»Wo ist River?«
Er zuckte mit den Schultern.
In seiner Anfangszeit hier hatte Coe die nervige Angewohnheit gehabt, auf einer unsichtbaren Klaviertastatur zu spielen. Ob auf seinem Schreibtisch oder auf einer anderen ebenen Oberfläche: Er klimperte auf imaginären Tasten die Musik, die ihm durch den Kopf ging und die in der Regel durch seinen iPod dort hineingelangte, aber vermutlich ohnehin darin widerhallte. Inzwischen machte er das nicht mehr so oft. Aber er war immer noch ziemlich hohl; ein Charisma-Vakuum. Was nicht bedeutete, dass er keine Informationen aufschnappte.
»Hast du schon mal mit dem Neuen geredet?«
Coe schüttelte den Kopf.
»Hast du gehört, weshalb er verknackt wurde?«
Sie ließen es immer wie eine Verurteilung klingen, denn das war es auch. Eine Strafe.
Aber Coe schüttelte wieder den Kopf.
Auch Shirley schüttelte ihren: Sie verschwendete ihren Atem. Da war ja ein Schuhlöffel gesprächiger. Sie wollte ja nicht seine beste Freundin sein oder so. Aber immerhin hatten sie gemeinsam Verbrecher zur Strecke gebracht, und das sollte doch zumindest eine kleine Plauderei wert sein.
Ansonsten war die Auswahl an Gesprächspartnern gering. River war nicht da, so viel hatten sie festgestellt; Louisa hatte klargemacht, dass sie nicht reden wollte, Ho war Ho, und Catherine verhielt sich in letzter Zeit merkwürdig und verschlossen. Manchmal hatten neue Leute diesen Effekt: Sie erinnerten einen an eine Zeit, in der man noch Hoffnung hatte. Als man glaubte, man hätte einen Fehler gemacht, den man vielleicht noch korrigieren könnte, und dass man sich mit der Zeit unter allgemeinem Beifall an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen könnte.
Doch nach einer Weile wurde einem klar, dass man nur wieder hineingeworfen werden würde.
Shirley sagte: »Gutes Gespräch. Sollten wir bald wiederholen«, und ließ Coe allein.
Zurück in ihrem eigenen Büro widmete sie sich wieder ihrem derzeitigen Auftrag. Lamb war vor nicht allzu langer Zeit auf die blendende Idee gekommen, dass sich Bombenleger-Blödel (seine Worte) im Allgemeinen nicht an die gesellschaftlichen Gepflogenheiten hielten.
»Vielleicht urteile ich da ein bisschen streng, aber wenn meine Lebensaufgabe darin besteht, meine Nachbarn wahllos zu massakrieren, schere ich mich wahrscheinlich kaum darum, meine Fernsehgebühren zu bezahlen. Stimmt’s?«
Shirley sagte: »Schon, aber lernt man nicht, sich unauffällig zu verhalten? In der Terroristenschule?«
»Oh, gut! Eine Freiwillige!«
»Nein, ich wollte nur …«
»Und hier kommt mein Vorschlag für das, mit dem Sie ab sofort Ihre Arbeitszeit ausfüllen werden, bis ich Stopp sage. Ich nenne es … Operation Gesetzesbrecher!«
Und von da an verbrachte Shirley ihre Tage mit dem Anlegen eines Verzeichnisses von Leuten, die ihre Fernsehgebühren, Parkzettel, Alimente und anderen Kleinkram nicht gezahlt hatten …
(»Wäre es nicht schneller, einfach das Bevölkerungsregister von Liverpool zu nehmen und dort anzufangen?«
»Und da heißt es, ihr würdet bei mir nichts lernen.«)
… und damit, diese Liste anschließend »ethnisch zu profilieren«, wie es halbwegs politisch korrekt ausgedrückt wurde. Im Grunde ein klassischer Lamb: sinnlos, zeitraubend und stinklangweilig mit einer Prise Beleidigung. Wenn es jemand anderen getroffen hätte, hätte Shirley darüber lachen können.
Welche Aufgabe Lamb wohl für den Neuen finden würde?
Und was er wohl angestellt hatte, um in Slough House zu landen?
Und warum war River nicht im Büro, der elende Drückeberger?
Gut, dass wenigstens ein paar Leute hier eine vernünftige Arbeitsmoral haben, dachte sie, vergewisserte sich, dass ihre Bürotür zu war, und schloss die Augen.
Sein Großvater wurde von Tag zu Tag schwächer.
River saß schon seit den frühen Morgenstunden an seinem Bett, nachdem ihn sein Handy aus dem Schlaf gerissen und eine freundliche Stimme ihm nahegelegt hatte, baldmöglichst herzukommen. Anschließend hatte er minutenlang so getan, als wären die Worte nicht ausgesprochen worden, und im Geist die Uhr zurückgedreht. Er war zwölf, half im Garten und beobachtete die Würmer bei ihrer unverständlichen Arbeit. Auf dem Kopf: der Hut des O.B.s. Ich will nicht, dass du dir einen Sonnenstich holst. Deine Großmutter würde mir die Hölle heißmachen. Oder als er doppelt so alt war und im Arbeitszimmer saß, während der Regen an die Fenster peitschte und der O.B. ihm von den dunklen Tagen des Kalten Krieges erzählte. Im Lauf der Jahre hatte sich der Sessel des alten Mannes so geformt, dass er ihn wie eine Hängematte hielt. Rivers Sessel war ein unvollendetes Werk … An ihrem dunkelsten und nicht weniger kalten Tag hatten sie seine Großmutter Rose beerdigt, und es war das erste und einzige Mal, dass er den O.B. weinen sah.
Man baute sein Leben wie eine Mauer, einen Stein auf den anderen, aber früher oder später wurden diese ersten Steine weggenommen.
Er hatte überlegt, seine Mutter anzurufen, aber diese Überlegung hatte nicht länger gedauert als einmal den Kopf zu schütteln. Dann hatte er sich gezwungen aufzustehen und war in die Kleider vom Vortag geschlüpft, um noch vor Sonnenaufgang im Skylarks, dem Pflegeheim, anzukommen. Sein Großvater war in ein Zimmer verlegt worden, das eigens zum Sterben gedacht war, auch wenn das niemand laut ausgesprochen hatte. Das Licht war sanft, und durch das Fenster blickte man auf die winterlichen Hügel, wo die dürren Bäume wie eine Phalanx von Skeletten aufragten. Das Bett, das der O.B. nicht mehr verlassen würde, war ein klinisches, robustes Modell mit Seitengittern rechts und links, die verhindern sollten, dass er rausfiel, und verschiedenen Maschinen, die seine Vitalfunktionen überwachten. Auf einem Bildschirm verlief die unregelmäßige Kurve seines Herzschlags, ein schwaches Signal. Ein letzter Grenzübertritt, dachte River. Sein Großvater ging hinüber ins Joe Country, das Land der Spione.
Zweimal holte River das Handy heraus, um seine Mutter anzurufen. Zweimal überlegte er es sich anders. Aber er schrieb Louisa eine Textnachricht und ließ sie wissen, wo er war. Sie hatte zurückgeschrieben: Es tut mir so leid. Normalerweise hätte er Catherine angerufen, aber Catherine hatte sich in letzter Zeit verändert und war wieder so wie in seinen ersten Tagen in Slough House: ein blasses Gespenst, das durch die Räume geisterte und keine Spuren hinterließ. Als er am Tag zuvor mit ihr allein in der Küche gewesen war und die Milch aus dem Kühlschrank holte, hatte er dicht neben ihr gestanden und tief eingeatmet: War Alkohol zu riechen? Aber er hatte nur die Kräutermischung ihrer Lieblingsseife und den Duft ihres Parfüms wahrgenommen.
Außerdem: Wenn sie rückfällig geworden wäre, wüssten doch alle davon, oder? Bei einer solchen Fallhöhe. Es sei denn, Catherine hatte das getan, was Catherine tun würde, nämlich so langsam und tief zu fallen, dass es niemand bemerken und niemand hören würde.
Aus dem Bett: ruhiges Atmen.
River stand auf und ging im Zimmer auf und ab, um den Blutkreislauf in Bewegung zu halten. So denkt man in einem Krankenhauszimmer. Das sanfte Ausatmen des O.B., sein leises Murmeln stockten nicht und schienen sich nicht von denen eines normalen Schlafenden zu unterscheiden. Doch diejenigen, die mit dem Tod vertraut waren, hatten Zeichen wahrgenommen, die River nicht entziffern konnte. Wenn das Leben auf die Zielgerade einbiegt, gibt es Signale zu entschlüsseln, Codes sind zu knacken. Es war eine Sprache, die er noch nicht kannte. Alle Todesfälle, die er miterlebt hatte, waren plötzlich eingetreten, bei gesunden Menschen.
Alle fünfzehn Minuten kam eine Krankenschwester herein und kontrollierte die Lage. Sie brachte River eine Tasse Tee und ein Sandwich und klopfte ihm auf die Schulter. Sind Sie der einzige Angehörige? – Wie lange haben Sie Zeit? River hatte noch eine Mutter, Isobel Dunstable, geborene Cartwright, die dem Old Bastard seinen Namen gegeben hatte, und zwar nicht zum Scherz; und einen Vater, den abtrünnigen amerikanischen Spion Frank Harkness, der Isobel nicht aus Liebe oder gar zum Vergnügen verführt hatte, sondern um den O.B. seinem Willen zu unterwerfen – vielleicht das einzige Mal in seinem Leben, dass der O.B. überlistet worden war. Und er hatte nie ein Wort darüber verloren. Als River die Wahrheit erfuhr, war der alte Mann bereits in der Dämmerung verschwunden und konnte nicht mehr zwischen Bäumen und Schatten unterscheiden.
In der Zwischenzeit war Frank abgetaucht, und Rivers Mutter hatte seit Jahren nicht mehr mit ihrem Vater gesprochen.
Ich will nur, dass er unglücklich ist, hatte sie River einmal gesagt. Hinter der spröden Beiläufigkeit spürte er eine Wunde, die noch immer pochte.
Er döste, und als es schließlich passierte, geschah es, ohne dass er es merkte. Seine Augen waren geschlossen, und die Bilder, die durch seinen Kopf huschten, waren ein wirres Durcheinander von Verlust und Unglück. Ein Geräusch draußen auf dem Flur holte ihn zurück, ein klappernder Wagen, und er schreckte mit hämmerndem Herzen auf. Es dauerte noch ein oder zwei Augenblicke, bis er merkte, dass die Maschinen ihre Melodie geändert hatten und, anstatt das ständige Weiter zu vermelden, Nachrichten aus dem Jenseits übermittelten. Sein Großvater hatte die Grenze überschritten.
River stand auf und küsste die Stirn des alten Mannes, kurz bevor die Krankenschwester kam.
Emma sagte: »Das ist nicht Ihr Ernst, oder?«
»Sehe ich aus, als würde ich Witze machen?«
»Nichts für ungut, aber das ist schwer zu sagen.«
Das stimmte. Es war nicht etwa so, dass Lady Dis Miene stets vollkommen ausdruckslos war, und falls sie jemals auf die Idee käme, ihre Untergebenen an der Nase herumzuführen, geschähe das unter kontrollierten Umständen und mit dem entsprechenden Equipment, aber während der Zeit, in der Emma Flyte die Dogs geleitet hatte, hatte sie eine Menge Anweisungen gehört, die leicht als Verarschung hätten durchgehen können. Es war nun mal so, dass die Führungsspitze eines Inlandssicherheitsdienstes viele absurde Situationen zu meistern hatte: einen toxischen Clown im Außenministerium, den Staatsbesuch eines narzisstischen Bettnässers, die Neigung der Wählerschaft, gelegentlich von einer Klippe zu springen. Manchmal dachte man bei Befehlen von oben: Na klar, als ob.
Aber nicht dieses Mal.
»Ich dachte, Slough House steht auf Ihrer Abschussliste«, bemerkte Emma Flyte.
»Ach, ich habe also eine Abschussliste?«
»Oh, ich glaube, wir wissen beide, dass Sie eine haben. Und Slough House ist Ihnen schon seit Jahren ein Dorn im Auge, stimmt’s? Jetzt stehen Sie endlich ganz oben auf der Leiter, und ich hätte gedacht, Ihr erster Schritt wäre es, das Haus dem Erdboden gleichzumachen.«
Und diesen dann zu planieren und festzustampfen. Man konnte nicht vorsichtig genug sein, wenn es um Jackson Lamb ging.
»Stattdessen nutzen Sie sein Potenzial – oh nein, das ist nicht wahr, oder? Sie haben einen Deal mit Lamb gemacht.«
»Ich bin Generaldirektorin, Ms Flyte. Ich brauche mit niemandem einen Deal zu machen.«
»Und ich war mal bei den Bullen, Ms Taverner, und ich erkenne Bullshit, wenn ich ihn höre. So sind Sie Whelan losgeworden, richtig? Lamb hat Ihnen geholfen, und im Gegenzug ist Slough House aus dem Schneider.«
Kaum hatte sie es ausgesprochen, wusste sie, dass es der Wahrheit entsprach. »Hinter den Kulissen« war Diana Taverners natürliches Habitat, und was Lamb betraf, so würde er mit dem Teufel verhandeln, wenn die Umstände es erforderten. Ob der Teufel Lamb allerdings die Hand darauf geben würde, war eine andere Frage. Sogar der Satan hat seine Prinzipien.
Lady Di hatte sich zurückgelehnt. Kein gutes Zeichen. Taverner war ein unruhiger Geist. Wenn jemand anderes das Sagen hatte, tigerte sie in der Regel hin und her, anstatt ruhig dazusitzen, wohl mit dem Hintergedanken, dass sie dadurch keine so leichte Zielscheibe bot, vermutete Emma.
Taverner ergriff jetzt das Wort. »Sagen wir mal so«, begann sie, »je höher man aufsteigt, desto mehr verändert man seine Perspektive. Tatsächlich ist Slough House in der Vergangenheit ein Ärgernis gewesen, und vielleicht wird es das auch in Zukunft wieder sein, und dann werde ich nicht zögern, entsprechend zu reagieren. Aber für den Moment – nennen wir es eine Übergangsphase – kann es für bestimmte Zwecke von Nutzen sein. Nicht zuletzt, um das Problem Ihrer beruflichen Laufbahn zu lösen.« Einen Augenblick lang wandte sie den Blick von Emma ab und schaute durch die Glaswand zu den jungen Leuten in der Zentrale. Ein Bereich mit zahlreichen Zielen, schoss es Emma durch den Kopf. Es gab so viele Möglichkeiten, Diana Taverner zu enttäuschen, von denen man manche erst erkannte, wenn der eigene Hals schon auf dem Schafott lag. »Also ja, wie Sie eben schon bemerkt haben, nutze ich sein Potenzial. Das ist die Aufgabe von Führungspersönlichkeiten.«
Emma schüttelte den Kopf.
»Möchten Sie noch etwas hinzufügen?«
»Die Met war schon schlimm genug«, sagte Emma. »Aber das? Mein Gott, Sie würden eine Stadt niederbrennen, um Ihr Gesicht zu wahren.«
»Das käme auf die Stadt an.«
»Ich wünschte, ich könnte das für einen Witz halten.«
»Dieses Meeting scheint sich hauptsächlich um meinen Sinn für Humor zu drehen. Um es kurz zu machen: Wenn ich etwas lustig finde, lache ich. Verstanden?«
»Sie erinnern mich an jemanden von früher, bei der Polizei.«
»Den Kommissar, hoffe ich.«
»Nein, an einen Serientäter. Ich habe ihn bestimmt ein Dutzend Mal verhaftet, meistens weil er irgendwelche Leute verprügelt hatte. Aber er hat nie zugegeben, dass er derjenige war, der ein Problem hatte.«
»Ich werde unsere Plaudereien vermissen«, sagte Diana Taverner. »Aber ich komme nicht oft in diese Ecke von London. Nicht, weil der Weg dorthin zu umständlich wäre, sondern weil es da so beschissen ist. Es sei denn, Sie stehen auf Street Food?«
Emma Flyte lächelte. »Ich habe in meinem Leben genug davon gegessen, um eines zu lernen: dass ich entscheide, wo ich es kaufe.«
»Das klingt, als würden Sie meinen Vorschlag ablehnen. Oder möchten Sie sich vielleicht deutlicher ausdrücken?«
»Gern«, sagte Emma. »Mit dem größten Mangel an Respekt, Ma’am, fuck you. Und scheiß auf Ihren Job.«
Und da es keinen Sinn hatte, das Gespräch noch weiter in die Länge zu ziehen, ging sie.
Und so vergeht der Tag, wie die meisten Tage vergehen, und die Stadt versinkt wieder in der Nacht. Auf der Dachrinne von Slough House, auf den Fensterscheiben, auf dem Rahmen der schwarzen Eingangstür, die sich nie öffnet und nie schließt, bildet sich dünnes Eis, und der einzige Beitrag des Gebäudes zu den Lichtern, die die Stadt bis durch die frühen Morgenstunden führen, besteht in einem in der Mitte geteilten gelben Quadrat im obersten Stockwerk, das zum Himmel geneigt ist. Aber gerade, als es die Aufmerksamkeit auf sich zieht, verdunkelt es sich, und einige Minuten später – so lange, wie ein whiskyschwangerer Abstieg sechs halbe Treppen hinunter dauert, mit einer Pause, um das zu nutzen, was aus einer verzerrten Perspektive wie eine mobile Toilette aussieht – taucht eine Gestalt im dicken Mantel aus der angrenzenden Gasse auf, überquert die Straße und verschwindet im Schatten des Barbican, was nicht die Route ist, die sie in der Nacht zuvor genommen hat, und auch nicht die, die sie am nächsten Abend einschlagen wird.
Und dann verschwindet das Gebäude, als hätte ein vorbeifahrender Bus einen Schatten darauf geworfen. Erinnerungen werden wach, Rückstände langen Grübelns – die Spuren, die einstige Bewohner in den Räumen hinterlassen haben –, aber diese werden am Morgen verschwunden sein, und in die Lücken sickern neue Sorgen und Frustrationen. Bald wird der Winter wieder seinen großen Knüppel schwingen, nicht nur in London, sondern überall, und weite Teile des Landes werden vom Schnee verschluckt werden. Bis er schmilzt, werden in Slough House neue Geister spuken.
Bis dahin wird es sein Bestes tun, diejenigen zu vergessen, die bereits darin hausen.
3
Am Samstagmorgen verließ Lech Wicinski die Souterrain-Wohnung in Crouch End, die er sich mit seiner Verlobten teilte, um eine Tüte Milch zu kaufen. Der Laden an der Ecke war keine zweihundert Meter entfernt, aber aus irgendeinem Grund nahm er im Vorbeigehen seinen Autoschlüssel vom Haken, und zu dem Zeitpunkt, als er eigentlich am Tisch sitzen und Rührei essen wollte, verließ er die Stadt in Richtung Westen. In dieser ersten halben Stunde fuhr er blindlings drauflos und versuchte, die Uhr zurückzudrehen, als ob er in einer noch unbekannten Richtung seinen Fehltritt finden und rückgängig machen könnte, und wenn er nach Hause zurückkäme, würde er alles so vorfinden, wie es sein sollte, seine Karriere auf dem richtigen Weg und eine Tüte frischer Milch im Kühlschrank. Er war viel zu rational veranlagt, um zu glauben, dass so etwas wirklich möglich wäre. Aber er war eben auch ein Mensch, also: mein Gott noch mal!
Der Verkehr kroch dahin: die übliche Stadtflucht am Wochenende. Londons Anziehungskraft wirkte hauptsächlich unter der Woche. Nach einer Stunde löste sich der Stau jedoch auf, und er konnte konstant hundertzwanzig fahren. Es war kalt und trocken, die Böschung der Autobahn und die Felder dahinter waren karg und ungepflegt. Die Kühe auf den Feldern standen reglos herum wie Platzhalter für echtes Vieh.
Am Abend zuvor hatte er Josie, eine aus der Zentrale, angerufen und sie gefragt, ob sie Lust hätte, kurz etwas mit ihm trinken zu gehen. In seiner Stimme lag eine gezwungene Fröhlichkeit, ein Lech Wicinski, den keiner von beiden kannte. Aber das war egal, denn sie hatte nur geantwortet: »Tut mir leid, Lech. Das geht nicht.«
… darf keinen Kontakt zu Mitarbeitenden aufnehmen, bis die Ermittlungen zur Zufriedenheit dieser Abteilung abgeschlossen sind …
Er spürte, wie er mit den Zähnen knirschte. Er zwang sich, damit aufzuhören.
Lech hatte das Schreiben in den Papierkorb geworfen, wo es der Arsch, mit dem er jetzt das Büro teilte, gefunden hatte. Eine schnelle Lektion über das Leben in Slough House. In der garstigen kleinen Einkaufspassage gegenüber gab es einen Eisenwarenladen, der Mausefallen verkaufte. Fick dich, du kleiner Schnüffler. Das sollte die Stimmung auflockern.
Und damit es nicht langweilig wurde, hatte er den Henkel von Hos Clint-Eastwood-Becher abgeschlagen und die Teile auf der Küchenanrichte verstreut.
Nachdem er Oxford umfahren hatte, verließ er die Autobahn. Die Straße war schmal und würde im Sommer von Bäumen überschattet sein, aber zu dieser Zeit glichen die überhängenden Äste kraftlosen Armen. Außerdem war die Fahrbahn mit Schlaglöchern übersät und hatte Bremsschwellen, wo sie sich durch Dörfer schlängelte. Die Häuser hier hatten Aussicht auf das Tal und gepflegte Gärten, als zähmten die Leute, die auf dem Land lebten, gerne alles, was sie zähmen konnten. Andererseits: Wer würde das nicht tun? Sobald die Dinge aus dem Ruder liefen, endete alles im Chaos.
Man hatte Pornos auf seinem Dienst-Laptop gefunden – Kinderpornos.
»Ich war das nicht.«
Richard Pynne, sein Vorgesetzter – Dick the Prick, so sein Spitzname, der natürlich auch zutraf –, hatte skeptisch den Kopf geneigt. »Tja, Alec, aber das Zeug ist da. Jeder kann das sehen.« Das erforderte einen Zusatz: »Oder nicht.«
»Wie hast du überhaupt …?«
»Wir führen Kontrollen durch. Remote Sweeps. Das musst du doch wissen. Ihr werdet regelmäßig informiert.«
Das hieß so viel wie: Ist uns egal, wie du dir einen runterholst, solange du kein Geheimdienst-Equipment dafür benutzt.
Er hatte keine Ahnung davon gehabt, bis die Dogs an seinem Arbeitsplatz auftauchten, vor den Augen der ganzen Zentrale seine Hardware ausstöpselten und seinen Schreibtisch durchsuchten. Sie packten alles in diese Plastikwannen, wie man sie an Flughäfen verwendet. Weshalb verdächtigten sie ihn? Dass er ein Geheimnis ausgeplaudert hatte, ein Whistleblower war? Erst Dick the Prick hatte ihm reinen Wein eingeschenkt, in einem der kleineren, fensterlosen Befragungsräume, in die man nicht zum Kaffeetrinken zitiert wurde.
Pynne war dick und würde noch mehr auseinandergehen, wenn er nicht allmählich etwas dagegen unternahm; er hatte schon lange den Sieg über die männliche Glatze errungen, indem er sich den Kopf rasierte, und trug eine Brille mit dickem Gestell, was das Einzige war, was sie gemeinsam hatten, auch wenn Lech selbst seine nur zum Lesen brauchte. Pynne war ein oder zwei Jahre jünger, zog aber auf der Karriereleiter an Lech vorbei, was an seinem Cambridge-Abschluss liegen mochte, vielleicht aber auch daran, dass er einfach ehrgeiziger war. Lass dich nicht von den Sprachmustern täuschen, rief sich Lech ins Gedächtnis. Das Zögern, die Wiederholungen. Dumm war er nicht, dieses Arschloch von Pynne. Einer der Schützlinge von Di Taverner.
Aber das war alles nur weißes Rauschen. Was zählte, war diese Ungeheuerlichkeit: Kinderpornos auf Lechs Laptop. Den nur er benutzte. Und für den er allein verantwortlich war: Sicherheit, Inhalt, alles.
»Ich muss dich also fragen – und zwar ganz offiziell, das Gespräch wird aufgezeichnet: Hast du das getan, Alec? Hast du das heruntergeladen?«
»Ich – nein! Nein, natürlich nicht, verdammt noch mal!«
»War der Laptop im Lauf der letzten Woche in deinem Besitz?«
»Er ist seit einem Jahr in meinem Besitz. Aber ich habe keine verdammten Kinderpornos heruntergeladen, Herrgott noch mal! Ich bin verlobt und werde bald heiraten, um Himmels willen!«
Es klang wie ein fadenscheiniges Alibi. Männer, die eine Frau, eine Verlobte oder eine Partnerin haben – Männer, die ein Leben haben, tun so etwas nicht. Sie nutzten keine illegale Pornografie. Natürlich gab es viele, die es trotzdem taten, aber Lech gehörte nicht zu ihnen.
Dick sagte: »Wenn es ein Fehler ist, ein Integritätsproblem – ich meine Datenintegrität unseres Systems –, also, wenn das der Fall ist, wird sich ja alles klären. Aber in der Zwischenzeit muss eine Untersuchung durchgeführt werden, und solange die läuft, darfst du dich leider nicht auf dem Gelände aufhalten.«
Er wurde aus dem Gebäude eskortiert, als hätte man ihn beim Büroklammerklauen erwischt.
Am Schild nach Northwick Park bog er von der Straße ab.
Am selben Morgen, wieder in London.
Louisa, die am Stadtrand lebte, fuhr am Wochenende eigentlich nie in die Stadt, außer zu den wenigen Anlässen, die es zwingend erforderten – ein Date, ein Einkaufsbummel, Langeweile; höchstens jeden zweiten Samstag oder dreimal im Monat –, und doch war sie jetzt hier, in Soho, wie eine blöde Touristin; eine von Millionen, selbst bei diesem trüben Wetter. Sie trug ihre neue weiße Daunenjacke, und auch wenn sie darin etwas unförmig aussah, war sie froh darüber, als sie die U-Bahn verließ, denn in London blies ein eisiger Wind. Im Radio war von einer herannahenden sibirischen Kaltfront die Rede gewesen. Hörte sich an wie ein Kriegsmanöver.
Die Fenster des Cafés waren grau beschlagen, und geisterhafte Schemen wanderten in einem ununterbrochenen Strom vorbei. Louisa legte beide Hände um ihren Americano, und die Tür öffnete und schloss sich, öffnete und schloss sich, und ihrer Uhr nach hätte die Frau schon vor zehn Minuten hier sein müssen. Wenn ich meinen Kaffee ausgetrunken habe, dachte sie. Wenn sie bis dahin nicht aufgetaucht ist, war’s das.
Louisa wäre am liebsten gar nicht erst gekommen.
Bin ich da …? Ist das das Büro von Min Harper?
Eine Art Schwindelgefühl hatte sie durchflutet.
Mr Harper arbeitet hier nicht mehr.