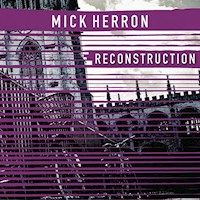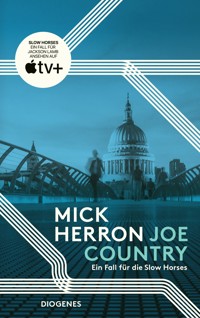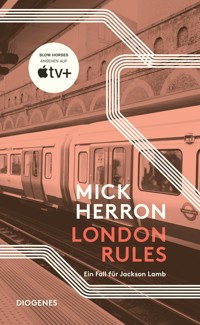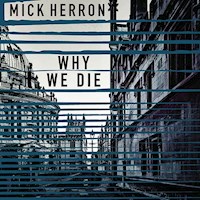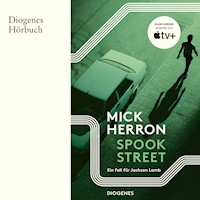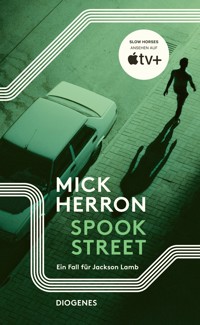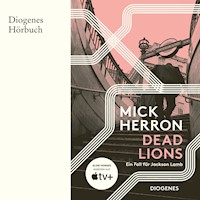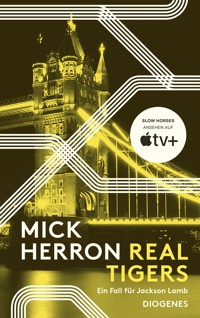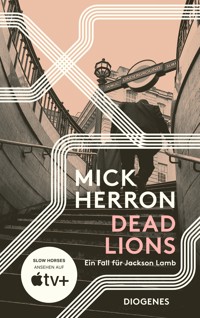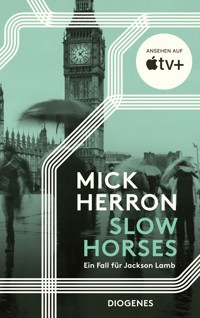15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Slow Horses
- Sprache: Deutsch
Selbst in Slough House, dem belanglosesten Außenposten des mi5, fordert der Brexit seinen Tribut: Das ganze Haus wurde aus den offiziellen Akten gelöscht – mitsamt seinen Insassen. Mehr noch, plötzlich sterben ehemalige Mitglieder wie die Fliegen. Kein Wunder, dass Jackson Lambs Mannschaft etwas paranoid wird. Es wäre klug, sich einen sicheren Ort zu suchen. Aber für kluge Entscheidungen sind die Slow Horses nicht gerade bekannt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mick Herron
Slough House
Ein Fall für die Slow Horses
Roman
Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer
Diogenes
Für Jo
Die einfachste Art, sich das Verhalten jeglicher bürokratischen Organisation zu erklären, ist die Annahme, dass sie von einer Intrige ihrer Feinde kontrolliert wird.
Robert Conquests drittes Gesetz der Politik
1
Ihr Vormittag endete früher als geplant.
Gegen den schneidenden Wind in ihren pelzgefütterten Mantel gehüllt, war sie auf dem Weg zu einer Teambesprechung im neuen Gebäude, einem Granitkomplex am Rande der Stadt. Von außen wirkte es wie der Hauptsitz einer Versicherungsgesellschaft, und so sollte es auch sein. In der Öffentlichkeit versteckt.
Der Himmel war grau, aber nicht finster; die Straßen so innerstädtisch wie gewohnt.
Es war nicht erwünscht, dass sie mit dem Auto zur Arbeit fuhren; dafür stand ihnen ein Shuttle zur Verfügung, das zweimal pro Stunde die zentrumsnahen Viertel abklapperte, und auf dem Weg zu ihrer Haltestelle kam sie an einer Apotheke vorbei. Sie brauchte Badesalz. Dreimal pro Woche war ihr Tag mit Sport ausgefüllt: morgens 15 km laufen, dann Fitnessstudio, dann raus an den Conquest See – zwei Bahnen rudern, zwei Bahnen schwimmen – dann noch einmal 15 km laufen. Danach brauchte man ein langes Bad. Gestern war sie in der Wanne eingeschlafen. Das Plätschern des Badewassers erinnerte sie an das Wasser des Sees, in dem man Gerüchten zufolge einst Blutegel ausgesetzt hatte, um Schwimmende zu Höchstleistungen anzuspornen. Aber bisher war sie noch keinem begegnet. Zum Glück, denn schon bei dem Gedanken an Blutegel bekam sie eine Gänsehaut: so glitschig und wabblig, und dann diese ekelhaften Saugmünder! Wenn man auf einen trat, platzte er wie ein blutgefüllter Ballon.
Ernsthaft, dachte sie: Lieber diese Klette am Hals als so ein widerliches Vieh auf meiner Haut.
Denn inzwischen hatte sie ihn entdeckt. Ein bisschen zu spät, aber höchstens um fünfzehn Sekunden; eine lässliche Sünde, selbst an den Maßstäben ihrer Abteilung gemessen. Schon war sie dabei, ihre Route neu zu planen, und das war der erste Umweg: quer durch die Markthalle, einem riesigen Amphitheater, in dem Hühner an Haken hingen und Gemüsesäcke an den Gängen Spalier standen. Die Wege waren zu schmal, als dass ein Verfolger sich hätte verstecken können, obwohl der sein Bestes tat: Als sie innehielt, um eine Palette Enteneier zu inspizieren, blieb der Gang hinter ihr leer, bis auf eine ältere Frau mit Krücken. Aber er war irgendwo dahinten, ein Typ mit schwarzer Lederjacke; ein bisschen auffällig für einen Zivilfahnder, gar nicht übel für einen Doppelbluff.
Ihre Aufgabe war sonnenklar – es handelte sich um einen weiteren Test. Sie musste ihren Beschatter loswerden, bevor sie die Haltestelle des Shuttlebusses erreichte. Denn man konnte hundert Bahnen im See schwimmen, mehr Kilometer laufen, als es Minuten in der Stunde gab, aber nichts davon zählte, wenn man es nicht schaffte, in der Großstadt einen Verfolger abzuschütteln. Und falls man den Schatten zur Heimatbasis führte, tja … Man munkelte von einer eigenen Abteilung, extra für die Versager: Verlierer, die an einen Schreibtisch auf dem Abstellgleis geschoben wurden, bis in alle Ewigkeit gefangen im Nebel ihrer enttäuschten Ambitionen. Man brauchte es nur einmal zu vermasseln. Das war hart, aber – solange es einem nicht selbst passierte – fair.
Und ihr würde es nicht passieren.
Bei ihrem letzten Einsatz, in einer Stadt im Ausland, war sie die Jägerin gewesen. Die jetzige Situation fühlte sich seltsamerweise ähnlich an. Sie verließ die Markthalle, überquerte die Straße im Kielwasser einer Frau mit grauer Jacke und passendem Rock und folgte ihr in einen Dessousladen auf der gegenüberliegenden Seite: weibliches Territorium. Sie und die Frau waren die einzigen Kundinnen. Der Mann in der Lederjacke lungerte draußen herum und tat so, als würde er auf sein Handy schauen. Sie hatte sich in eine Sackgasse manövriert, aber ihn seinerseits gezwungen, sich zu offenbaren, und sobald er das erkannte, würde er keine andere Wahl haben, als aufzugeben. Im Idealfall so rechtzeitig, dass sie das Shuttle noch erwischte.
Was sollte sie also davon abhalten, einfach an das Fenster zu klopfen und ihm zuzuwinken?
»Entschuldigung?«
Die Frau sprach sie an.
»Verfolgt er Sie etwa? Der da draußen? In der Lederjacke?«
Sie dachte: Okay, mal sehen, wohin das führt. Wer weiß, vielleicht konnte sie etwas für die Zukunft lernen, wenn sie sich dem Zufall überließ.
»Ja.«
Die Augen der Frau huschten zwischen ihr und dem Typen hin und her. »Ein Stalker?«
»Er verfolgt mich schon, seit ich von zu Hause losgegangen bin.«
»Soll ich die Polizei rufen?«
Schon griff die Fremde nach ihrem Handy.
»Nein, ich … Lieber nicht. Er ist ein Ex-Freund. Als ich das letzte Mal die Polizei gerufen habe, kam er später vorbei und hat mich verprügelt.«
Eine wacklige Ausrede, aber sie musste schließlich nicht vor Gericht standhalten.
Die Verkäuferin hinter dem Tresen hatte das Ganze mitverfolgt. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
Die Frau in Grau antwortete: »Da draußen ist ein Mann, der der Dame hier Ärger macht.«
Die Verkäuferin zeigte sich nicht überrascht. Dies war ein Dessousladen.
»Gibt es bei Ihnen vielleicht einen Hinterausgang?«
»Ja, aber der ist eigentlich nicht für Kundinnen.«
»Aber wir sind ja auch keine Kundinnen, oder? Wir werden von einem Mann belästigt, der sich vor Ihrem Geschäft herumtreibt.«
Sie sagte es freundlich, aber mit bedrohlichem Unterton.
»Na ja, dann …«
Die Verkäuferin kapitulierte mit Würde.
»Vielen Dank. Am besten jetzt, wo er uns den Rücken zudreht.«
Denn der Mann in Schwarz hatte sich der Straße zugewandt, den Blick auf den Bildschirm gerichtet.
Sie schaute auf die Uhr. Sie konnte es noch zum Shuttle schaffen. Und das wäre befriedigender, als ihm auf die Schulter zu klopfen und unter die Nase zu reiben, dass er erwischt worden war. Als die Verkäuferin ihnen den Lieferanteneingang zeigte, strahlte die Frau in Grau sie an, als wäre dies ein Abenteuer. Eines, das man bei der Arbeit erzählen konnte: Zivilcourage, hinsehen, nicht wegsehen!
Als sich die Tür hinter ihnen schloss und sie allein in einer mit Mülltonnen vollgestellten Gasse standen, sagte sie: »Danke.«
Die Frau in Grau sagte: »Gern geschehen«, und trat vor, um sie zu umarmen.
Es hätte Einbildung sein können. Aber das hätte bedeutet, dass auch alles andere unwirklich war; nicht nur der plötzliche stilettospitze Schmerz in ihrem Herzen, sondern auch, dass die ganze Welt den Atem anhielt. Die Frau in Grau ließ sie zu Boden sinken und entfernte sich dann geschickt, sodass sie in ihrem letzten Moment begreifen musste, dass dies kein Test war, oder wenn doch, dann einer, bei dem das Scheitern schlimmere Folgen hatte als erwartet. Aber das war nur eine kurz aufflackernde Erkenntnis, längst vorbei, als die Nachricht von ihrem Tod verfasst, verschlüsselt und durch den Äther geschickt wurde, um in einem belebten Raum auf der anderen Hemisphäre zu landen, wo sie von einem ernsten jungen Mann einer älteren Frau überbracht wurde, die ihre Autorität wie einen Hermelinmantel trug: Er hielt sie warm, und die Leute registrierten ihn.
Sie nahm das Tablet, das er ihr hinhielt, las die Nachricht auf dem Bildschirm und lächelte.
»Smiert spionam«, sagte sie.
»… Ma’am?«
»Ian Fleming«, sagte Diana Taverner. »Es bedeutet ›Tod den Spionen‹.« Und dann, als er sie immer noch verständnislos ansah, fügte sie hinzu: »Googeln Sie es.«
TEIL EINSSpurensuche
2
Zugegeben: Auf den ersten Blick ist es nicht die ansehnlichste Immobilie auf dem Markt.
Aber man bedenke das Potenzial!
Das dreistöckige Gebäude, das sich praktischerweise genau zwischen einem chinesischen Restaurant und einem Zeitungskiosk befindet, bietet eine der seltenen Gelegenheiten, in dieser aufstrebenden Gegend Fuß zu fassen. (Eine nette kleine Bemerkung in der Mail vor nicht allzu langer Zeit. Zwar nicht im Immobilienteil, aber immerhin.) Die Fassade ist nach Osten ausgerichtet, wird aber durch den imposanten Blick auf das Barbican Centre vor den blendenden Strahlen der Morgensonne geschützt. Weiteren Schutz für das Gebäude bietet die Aldersgate Street hier im Bezirk Finsbury, der für sein gemäßigtes Klima bekannt ist. Der Verkehr wird durch die nahe gelegenen Ampeln beruhigt, und es besteht eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Sowohl verschiedene Buslinien als auch die U-Bahn mit den beliebten Linien Hammersmith & City, Circle und Metropolitan sind in nur einer Minute fußläufig erreichbar.
Die Vordertür ist nicht in Gebrauch, aber das macht nichts. Wir gehen durch die Hintertür.
Zunächst durchqueren wir den hübschen, pflegeleichten Hof mit reichlich Platz für Mülltonnen und kaputte Möbel. Machen Sie sich nichts aus dem Geruch; zurzeit ist ein Rohr verstopft. Durch diese Hintertür, die heute ein bisschen klemmt – das tut sie normalerweise nicht –, aber ein bisschen Schultereinsatz, und schon sind wir drin. Dann die Treppe hoch, aber Vorsicht, lieber nicht am Geländer festhalten. Es ist mehr zur Zierde da. Ein originelles Detail, nicht wahr?
Und damit gelangen wir in den ersten Stock, wo sich zwei Büros befinden, mit Blick auf das bereits erwähnte städtische Monument gegenüber. Alles unverfälscht und authentisch. Beachten Sie die Einbauten und Armaturen, alles noch original aus den Siebzigerjahren, und die sind doch gerade wieder im Kommen, nicht wahr? Straßenkrawalle, Rezession, Rassismus – haha, kleiner Scherz! Aber mal im Ernst: Mit einem hübschen neuen Anstrich können Sie das alles ganz individuell gestalten, ein wenig Gelb hier, ein wenig Grau da … Es geht doch nichts über einen Hauch von Farbe, um die natürliche Wärme eines Raumes zu betonen.
Aber alles kommt mal in die Jahre, was? Es geht immer nur vorwärts, nie rückwärts.
Und jetzt bitte noch diese Treppe hinauf, etwas Bewegung, das ist gut für Herz und Kreislauf! Nein, das sind keine Feuchtigkeitsflecken im Putz, das ist nur die Patina der Jahrzehnte. Auf dieser Etage befinden sich zwei weitere Büros und eine praktische kleine Küche: Platz für Wasserkocher und Mikrowelle, für Geschirr und was man so braucht. Die Spülmaschine müsste mal überholt werden, aber das ist schnell geschehen. Hier entlang geht’s zur Toilette – oh, der vorherige Nutzer war umweltbewusst. Einfach einmal kurz abziehen.
Und weiter geht’s zu den letzten beiden Büros. Unserer Meinung nach die idealen Schlafzimmer. Die Dachschrägen verleihen den Räumlichkeiten Charakter, bieten aber genügend Platz, um sich ganz nach Belieben zu entfalten, wenn man mal von den Telefonbüchern, den überquellenden Aschenbechern und dem Schmutz auf dem Teppich absieht. Eine kleine Grundreinigung, und schon ist wieder alles tipptopp. Normalerweise wird ein Gebäude bei der Besichtigung besenrein präsentiert, aber der Zugang war ein Problem, wir bitten vielmals um Entschuldigung.
Ah, das Fenster scheint zu klemmen. Da muss man nur mal kurz mit dem Schraubendreher ran, schon funktioniert das wieder.
So, jetzt konnten Sie sich einen Überblick verschaffen. Ein bisschen exzentrisch, kein Haus von der Stange, und es blickt überdies auf eine bewegte Geschichte zurück. Eine Abteilung des Geheimdienstes war hier untergebracht, wenn auch keine besonders aktive. Mehr eine Art Verwaltungstrakt. Die jetzigen Nutzer sind hier schon seit einer gefühlten Ewigkeit untergebracht, obwohl es ihnen wahrscheinlich länger vorkommt. Man sollte meinen, Spione hätten Besseres zu tun, aber vielleicht gehörten sie nie zu den besten. Vielleicht waren sie überhaupt nur deswegen hier.
Aber wir sehen, dass Sie nicht überzeugt sind – es war die Toilette, nicht wahr? –, also sollten wir wohl besser weiter nach Westen ausweichen, wo die traditionelleren Gebäude liegen, drüben im Regent’s Park. Nein, machen Sie sich keine Sorgen wegen der Tür. Sicherheit war hier noch nie ein großes Thema, was schon etwas seltsam ist, wenn man es recht bedenkt.
Nicht, dass uns das etwas anginge – wichtig ist nur, dass dieser Schuppen aus unseren Büchern verschwindet. Aber früher oder später werden wir einen Abnehmer finden. So ist das in unserer Branche, und in Ihrer ist es gewiss nicht anders. So geht es überall auf der Welt. Wenn etwas zum Verkauf steht, wird es früher oder später jemand kaufen.
Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit.
Nur eine Frage der Zeit.
Auf der Suche nach Spendersamen?, lautete die Anzeige über ihrem Kopf.
Definitiv nicht, obwohl man als Frau in der Central Line zur Hauptverkehrszeit durchaus unfreiwillig dafür infrage kam.
Im Augenblick hoffte Louisa Guy jedoch, dass dieser Kelch an ihr vorüberging. Sie war in einer Ecke eingeklemmt, aber sie stand mit dem Rücken zu der drängenden Menge und konzentrierte sich auf die Tür, gegen die sie gedrückt wurde. In der Scheibe erschien alles verschwommen, wie ein 3D-Film ohne Brille, aber sie konnte menschliche Züge ausmachen: verschwommene Münder, die zu Klängen aus iPods die Lippen bewegten, verschlossene Gesichter. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Begegnung in der U-Bahn böse endete, gering war – laut Statistik ein Fall auf eine Million Passagiere –, wollte man nicht die Ausnahme von der Regel sein. Tief durchatmen. Sich nicht das Schlimmste ausmalen. Und dann kam Oxford Circus, wo sich die Menge wie zwitschernde Stare aufteilte und ihr Teil des Schwarms auf den Bahnsteig in Richtung der Ausgänge strömte.
Normalerweise fuhr sie nach der Arbeit nicht mehr in die Stadt. Die Tage, in denen sie in Bars herumgehangen hatte, waren vorbei, und sie bedauerte es nicht. Shoppen war etwas für die Wochenenden, und kulturelle Angebote – Theater, Museen, Konzerte – nahm sie ja doch nie wahr: Sie war eine Londonerin, keine Touristin. Aber sie brauchte neue Laufschuhe, nachdem sie letzte Woche fünfzehn Kilometer durch den Regen gejoggt war; eine blöde Idee, aber sie hatte einen schlechten Tag gehabt, weil die Gedanken an Emma Flyte ihr keine Ruhe ließen. Vor Erinnerungen konnte man zwar nicht davonlaufen, aber man konnte sich so weit auspowern, dass die Details verschwammen. Jedenfalls waren die Laufschuhe entweder geschrumpft oder hatten ihre Form so grundlegend verändert, dass sie an andere Füße gehörten, und jetzt war sie hier, auf dem Weg in die Stadt nach der Arbeit; die Abende waren heller, seitdem die Uhren vorgestellt worden waren, aber die Luft war noch immer winterlich kalt. Auf der Rolltreppe wurde sie durch Videowerbung dazu ermutigt, grundlegende Entscheidungen zu überdenken: Bank wechseln, Telefon wechseln, Job wechseln. In einer perfekten Welt hätte sie alle drei Dinge erledigt, bis sie auf Straßenniveau angekommen wäre.
Dort waren die Bürgersteige feucht vom Regen. Louisa umschiffte Fußgängeransammlungen, überquerte die Regent’s Street im Trab, während die LED-Anzeige 3-2-1 warnte, und schlüpfte in ein Sportgeschäft, dessen Neon-Logo im milchigen Licht nur einen blassen Schein warf und dessen gefliester Boden sich vor Dreck in eine Rutschbahn verwandelt hatte. Ein gelber Poller mahnte sie zur Vorsicht. Wäre sie vorsichtig gewesen, wäre Emma Flyte noch am Leben. Aber es war sinnlos, so zu denken; die Uhren liefen weiter und ließen sich nie besonders weit zurückdrehen. Laufschuhe gab es im Untergeschoss. Sie nahm den nächsten Aufzug; es schien, als würde sie ständig nach oben oder unten fahren. Immer hoch oder runter.
An der hinteren Wand waren Laufschuhe ausgestellt wie eine Reihe von Köpfen in Game of Thrones. Wie immer gab es einen Sale, da der Einzelhandel seit Du-weißt-schon-was am Boden war, aber selbst mit Rabatt waren die Schuhe sündhaft teuer. Die, die gut aussahen, jedenfalls. Und obwohl es bei Laufschuhen darauf ankam, dass sie gut saßen, und nicht, dass sie schick waren, mussten sie trotzdem gut aussehen. Also suchte Louisa sich das Paar aus, das an der Wand am meisten ins Auge fiel, was nichts bedeuten musste, aber ein plausibler Ausgangspunkt war, setzte sich hin und probierte sie an.
Sie fühlten sich ganz gut an. Wenn sie auf und ab ging, drückten sie ein bisschen, mehr als im Sitzen, aber es war schwer zu sagen, ob das nur daran lag, dass sie neu waren, oder ob sie nicht richtig passten. Solche Läden müssten ein Laufband haben. Louisa beugte probeweise ein Bein, um zu sehen, ob das half, und bemerkte, dass ein Mann dies bemerkte – er stand am anderen Ende des Ladens und inspizierte einen Nike –, daher tat sie es noch einmal, und er schaute wieder hin, wenn auch verstohlen. Sie ging in die Hocke und drückte auf die Kappen der Sportschuhe, um ihre Passform zu überprüfen. Er stellte den Nike wieder an die Wand und trat einen Schritt zurück, mit unbewegtem Gesicht. Na klar, dachte Louisa und gab sich in Gedanken einen High Five.
Du hast es immer noch drauf.
Sie setzte sich wieder und zog die Laufschuhe aus. Sie kosteten mehr, als sie ausgeben wollte, und obwohl sie das in der Vergangenheit selten vom Schuhkauf abgehalten hatte, sollte sie doch besser noch andere anprobieren. Wie zur Bestätigung vibrierte das Handy in ihrer Tasche, und genau im selben Moment hörte sie in der Nähe ein Ping – jemand anderes bekam auch gerade eine SMS. Es war der Typ, der sie heimlich beobachtet und versucht hatte, es zu verbergen. Er verschwand hinter einem Regal mit Socken und Armbändern und griff dabei in seine Jacke. Es hätte glatt eine Anmache sein können, dachte sie selbstironisch. Hey, eine gleichzeitige SMS – wie unwahrscheinlich ist das denn? Während sie darüber nachdachte, holte sie ihr Handy heraus und sah nach.
Scheiße!
Louisa sprang auf, ohne Schuhe, und rannte zur gegenüberliegenden Wand, geriet ins Rutschen und hielt sich am Regal fest, aber er war schon weg – war er das auf der Rolltreppe? Er nahm die Treppe je zwei Stufen auf einmal, als würde er auf einen plötzlichen Notruf reagieren – na klar, dachte sie. Wir beide, du und ich. Es hatte keinen Sinn, ihm zu folgen, nicht ohne was an den Füßen. Er war jetzt sowieso außer Sichtweite; garantiert war er schon draußen auf der Straße und verschwand im Gedränge.
Scheißkerl!, dachte sie. Du fieser Scheißkerl! Und dann, während sie über den dreckigen Boden, der ihre Socken durchnässte, zu ihren Schuhen zurücktappte: Was zum Teufel ist hier eigentlich los?
Wenn man die SMS, die fünf Minuten zuvor eingegangen war, nicht mitzählte, war das das erste Lebenszeichen, das River Cartwrights Handy seit Tagen von sich gegeben hatte. Er sollte dringend etwas für sein Sozialleben tun.
»Mr. Cartwright?«
»Ja?«
»Hier ist Jennifer Knox.«
River hatte eine Liste der Frauen im Kopf, mit denen er in den letzten Jahren Kontakt gehabt hatte, und es dauerte nicht lange, sie durchzugehen. Von B bis K war nichts dabei.
»Von nebenan, die Nachbarin deines Großvaters.«
Das erklärte das ältliche Zittern in ihrer Stimme, was ihn einigermaßen erleichterte. So verzweifelt war er nun auch wieder nicht, egal was man über ihn dachte.
»Ach ja, natürlich«, sagte er jetzt. Jennifer Knox. Sie hatte regelmäßig nach seinem Großvater gesehen und ihn mit Eintöpfen und Dorfklatsch versorgt, obwohl die Besuche zuletzt nachgelassen hatten, als der Old Bastard irgendwann weder mit Klatsch noch mit Tatsachen viel anfangen konnte und solche Kleinigkeiten wie die, wer diese Frau war, die seit vielen Jahren neben ihm wohnte, einfach vergessen hatte. Sie hatte Rivers Nummer, weil er die Kontaktperson war, wenn es einen Notfall beim O.B. gab, obwohl der alte Mann mittlerweile über solche Bedürfnisse hinaus war. Das wusste Jennifer Knox sehr genau, denn sie war bei der Beerdigung gewesen.
»Natürlich«, sagte er. »Mrs. Knox. Was kann ich für Sie tun?«
»Es ist jemand im Haus.«
Sie meinte das Haus seines Großvaters, das seit einiger Zeit unbewohnt war. Es gehörte jetzt River, auf dem Papier, wie seine Mutter gerne und häufig hervorhob – »auf dem Papier«, da sie offenbar das Gefühl hatte, die natürliche Ordnung sei durch diese Erbschaft gestört – und es stand, ebenfalls auf dem Papier, zum Verkauf, allerdings zu einem Preis, den der Makler als »viel zu optimistisch« bezeichnet hatte. Zu optimistisch in diesen Post-du-weißt-schon-was-Zeiten. Dass sich niemand ernsthaft dafür interessierte, kam River im Moment sehr gelegen. Er war im Haus seiner Großeltern aufgewachsen, nachdem ihn seine Mutter dort zurückgelassen hatte, ohne an zukünftige Eigentumsrechte zu denken. Er war sieben Jahre alt gewesen. Das war eine Menge Geschichte, die da zum Verkauf stand.
Jennifer Knox redete immer noch. »Ich wollte schon die Polizei rufen, aber dann dachte ich, was ist, wenn es Freunde von dir sind? Oder, du weißt schon, potenzielle Käufer?«
»Danke, Mrs. Knox. Ja, es sind alte Freunde auf der Durchreise, die einen Platz zum Übernachten brauchten. Und ich weiß, dass die Möbel weg sind, aber …«
»Immerhin haben sie ein Dach über dem Kopf, stimmt’s?«
»Genau, und es ist billiger als ein Hotel. Sie sind im Moment auf Reisen und …«
»Wir tun alle, was wir können, nicht wahr? Um das Geld zusammenzuhalten.«
»Morgen früh sind sie wieder weg. Danke, Mrs. Knox. Vielen Dank, dass Sie mir Bescheid gesagt haben.«
River wohnte in einem Ein-Zimmer-Appartement zur Miete, »schön abseits des Touristenrummels«, wie ein selbstgefälliger Trottel es einmal ausgedrückt hatte. Obwohl er einen stattlichen Landsitz geerbt hatte, blieben seine tatsächlichen Lebensbedingungen städtisch-prekär. Die Wohnung war fast das ganze Jahr über kalt und selbst tagsüber dunkel. Im Nachtclub gegenüber spielten zweimal in der Woche Live-Bands, und in der Nähe hatte sich ein Gullydeckel gelockert; jedes Mal, wenn ein Auto darüberfuhr, verkrampfte sich bei dem lauten »ka-chunk ka-chunk« Rivers Kiefer. Während er sein Handy einsteckte, passierte es wieder; es war weniger ein Soundtrack als vielmehr ein hörbarer Zahnschmerz.
River zeigte der Welt im Allgemeinen den Stinkefinger. Dann machte er sich auf den Weg, um nachzusehen, wer in das Haus seines toten Großvaters eingebrochen war.
Währenddessen tat Roddy Ho das, was Roddy Ho am besten konnte.
Was Roddy Ho am besten konnte, war alles.
Das machte solche Momente oft anstrengend, aber hey: Wenn es einfach wäre, Roddy Ho zu sein, könnte es schließlich jeder machen – es gäbe Roddy Hos mit Patschhänden, Roddy Hos mit Halbglatze und sogar Roddy Hos, die Mädels abschreckten. Eine amüsante Vorstellung, aber Roddy Ho hatte keine Zeit, sich damit zu befassen, denn Roddy Ho – der mit den schmalen Händen und dem vollen Haar, der Womanizer – hatte alle Hände voll zu tun.
Und zwar damit, Slough House vor irgendeiner ganz üblen Scheiße zu retten, die im Anflug war.
Wie immer.
Denn selbstverständlich war Scheiße im Anflug: Das hier war schließlich Slough House. Außerdem war es der Rodster höchstpersönlich gewesen, der Jackson Lamb auf den »Wipe«, wie er dazu sagte, aufmerksam gemacht hatte. Dieser Wipe bedeutete, dass Scheiße im Anmarsch war, keine Frage, und dass es sich um üble Scheiße handelte, konnte sich jeder Depp ausrechnen. Das war der Geheimdienst, und wenn in der Spook Street etwas schieflief, dann in der Regel so richtig. Also überprüfte Roddy die Scheiße auf Tiefe und Konsistenz; er versuchte herauszufinden, in welche Richtung sie sich bewegte, und auch wenn er inzwischen über das Stadium hinaus war, in dem sich die ganze Scheiße-Metapher als nützlich erwies, hatte er zumindest seinen Standpunkt klargemacht. Die Scheiße war im Anmarsch, und alle erwarteten von Roddy Ho, dass er die Hotdog-Brötchen dazu lieferte.
Wenn man bei dem Bild blieb, wäre er dann auch fürs Abwischen zuständig.
Kurz abgelenkt, griff er nach einem Stück Pizza. Roddy saß in seinem Büro; es war schon lange nach Sayonara, aber wenn der HotRod auf einer Mission war, schaute er nicht auf die Uhr. Außerdem gab es so manches, was man nicht auf der Dienstfestplatte haben wollte, und dazu gehörte unter anderem das Stöbern in den Behördenakten. Das erste Problem, das er bereits erkannt hatte, nämlich die Fließrichtung der heranströmenden Fäkalien, war ein Kinderspiel gewesen:
Immer wenn Slough House unter den Hammer kam, konnte man darauf wetten, dass Regent’s Park am Amboss stand. Und in diesem Fall war Slough House selbst ausgelöscht worden.
Mit »ausgelöscht« meinte Roddy, dass es aus der Datenbank des Geheimdienstes entfernt worden war. Nicht nur Slough House, sondern auch die Slow Horses waren verschwunden, von dem Neuen, Wicinski, bis hin zu Jackson Lamb; sie alle waren nicht mehr im System gelistet. Zwar fand man sie noch in den ganz tiefen Strukturen, in denen es um Gehälter und Bankkonten ging. Diese waren – nach einem fiesen Hack vor einigen Jahren – nicht mehr mit Namen, sondern mit Mitarbeiternummern versehen, sodass die Slow Horses immer noch bezahlt wurden und immer noch Jobs hatten, aber ihre persönlichen Daten, ihre Personalakten: Sie waren weg, Baby, einfach weg. Wer in der Datenbank des Geheimdienstes nach Roddy Ho suchte, fand null, nada, nitschewo. Als hätte der RodBod aufgehört zu existieren.
Alles hat einmal ein Ende, das wusste er. Zum Beispiel die riesigen Statuen der Jedi-Ritter, die die Taliban zu Staub zerbombt hatten. Aber er hatte geglaubt, dass seine eigene Legende noch eine Weile bestehen würde.
Also hatte er überlegt, sich wieder neu zu installieren – ein Kinderspiel, wenn man das Talent des Rodinators besaß: Er könnte ein Dick Pic als Bildschirmschoner für den MI5 einrichten, wenn er wollte –, aber vielleicht doch besser nicht. Drüben im Park mussten sie wissen, mit wem sie sich anlegten, und garantiert hatten sie zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, falls Roddy-O auf die Idee kam, ihren Mist zu korrigieren. Das bedeutete, dass Ninja-Fähigkeiten gefragt waren, heimlich und raffiniert, und das entsprach im Grunde genau Roddys Profil. Er konnte sich praktisch unsichtbar machen, Tatsache. Die halbe Zeit bemerkten die Leute nicht mal, dass er im Raum war. Und jetzt schlich er wie ein Panther zwischen den Pixeln umher und verschmolz mit der Matrix. Das Sammeln von Informationen war eine Sache, das Sammeln von fehlenden Informationen erforderte eine ganz andere Art von Coolness. Und Roddy Ho war cooler als eine Schüssel Frosties.
Er hielt kurz inne, um Pizzabelag von seiner Tastatur zu wischen, und fasste seine bisherigen Ergebnisse zusammen.
Hauptsächlich hatte er festgestellt, dass derjenige, der sie hatte verschwinden lassen, seine Arbeit beeindruckend gründlich erledigt hatte.
Und zwar in dem Maße, dass die Grünschnäbel im Park, die Nachwuchsspione, die gerade anfingen, nicht mal ahnten, dass Slough House überhaupt existierte.
Ihm kam das Bild eines weißen Flecks in den Sinn, einer Leerstelle auf der Straße, an der die Passanten achtlos vorübergingen, und Roderick Ho fragte sich einen Augenblick lang, ob das überhaupt jemanden kümmerte.
Tanze, als ob niemand zusieht, dachte Shirley Dander.
Welcher Schwachkopf hatte sich das ausgedacht?
Denn der Sinn von Tanzen war doch, dass alle zusahen, zumindest, wenn man es richtig machte. Die Mauerblümchen, die rosa Gin schlürften und wünschten, sie könnten tanzen. Das Wannabe, das auf der Galerie den Typen mit Fliege und Brille knutschte. Das süße Pärchen in der Ecke, das sich gegenseitig abcheckte: Mal im Ernst!, dachte sie. Jetzt kommt schon in die Gänge! Bevor ich eine Münze werfe, wen von euch ich abschleppe.
Könnte passieren, sagte sie sich. Und zwar so leicht, dass sie sich besser ein Warnschild um den Hals gehängt hätte: Wer nicht bei drei auf den Bäumen ist … Damit diese Schnarchsäcke wussten, mit dem sie es zu tun hatten.
Aber bis dahin: Zieht euch diese Moves rein! Kein Rausch war besser als ein natürliches High, und sie war sich ziemlich sicher, dass die Wirkung des Koks inzwischen abgeklungen war. Was durch ihre Adern floss, war pure Shirley-Power.
Am Nachmittag war sie im Slough House gewesen. Eigentlich war sie ja jeden Nachmittag im Slough House, und selbst an den Nachmittagen, an denen sie nicht dort war, hatte sie das Gefühl, dort zu sein. Der Schatten von Slough House begleitete einen, wohin man auch ging: Man könnte bis nach Watford latschen und würde ihn immer noch im Rücken spüren. Denn Slough House saugte dir den Saft aus den Adern – oder versuchte es zumindest. Der Trick bestand darin zu beweisen, dass man mehr Saft in sich hatte, als man ahnte. Wie dem auch sei: blah. An diesem Nachmittag hatte sie im Slough House an einem von Jackson Lambs Lieblingsprojekten gearbeitet: dem Hooligan-Hinterland, wie er es nannte. Er meinte damit, dass man sich keine Selbstmordweste umschnallte und damit durch die Hauptgeschäftsstraße spazierte, ohne dass sich schon vorher irgendwie antisoziale Tendenzen bemerkbar gemacht hatten, etwa in Form von unbezahlten Strafzetteln oder der Benutzung eines Handys im Ruheabteil. Shirley war sich da nicht so sicher, aber das spielte keine Rolle: Im Slough House wurde gemacht, was Jackson Lamb sagte. Die Alternative war zu akzeptieren, dass die eigene Karriere im Geheimdienst vorbei war und es kein Zurück nach Regent’s Park gab, und wie jedes Slow Horse vor ihr und jedes Slow Horse, das noch kommen würde, dachte Shirley Dander, dass sie die Ausnahme von der Regel sein würde. Sie dachte, dass man insgeheim auf sie wartete. Sie dachte, dass das Willkommensspruchband, das man für ihre Heimkehr vorbereitet hatte, bereits irgendwo in einem Büroschrank aufbewahrt wurde.
An diesem Tag würde sie auch tanzen.
Hier und jetzt – wie es immer war und immer sein würde – ertappte sie mehrmals eine Frau dabei, wie sie sie ansah und dann so tat, als wäre es Zufall. Wer weiß, vielleicht würde sie sie flachlegen, aber im Moment konnte sie ihretwegen erstmal einfach nur glotzen wie alle anderen auch, denn das hier war Strictly Come Dander, und jede andere Flachpfeife sollte besser ihren Arsch von der Tanzfläche schaffen. In Ruheposition glich sie möglicherweise, wie ein ehemaliger Kollege es einmal ausgedrückt hatte, einem angriffslustigen Betonpoller, aber das war nur die halbe Wahrheit: Shirley war unterdurchschnittlich groß und zylindrischer gebaut, als es dem gängigen Schönheitsideal entsprach, aber nach den Gesetzen der Physik besaß jeder Körper eine eigene Anziehungskraft, und wenn sie tanzte, stand Shirleys Anziehungskraft der anderer in nichts nach. Hätte man den ehemaligen Kollegen einen Moment später gebeten, seine Beschreibung noch einmal zu wiederholen, hätte er übrigens nur mit einem Röcheln antworten können. Shirley konnte mit Kritik genauso gut umgehen wie jeder andere auch, wenn man mit »jeder andere« einen hypersensiblen Catcher meinte.
Und immer noch beobachtete sie diese Frau und tat so, als täte sie es nicht. Alle Achtung für ihre Hartnäckigkeit, dachte Shirley. Vielleicht sollte sie sich ihrer erbarmen, sie aus der Menge ziehen und beim Tanzen anbaggern, aber das konnte unter Umständen böse Folgen haben, denn die Sache mit Shirleys Partnern – womit sie ihre beruflichen Partner meinte, aber es gab ja auch so etwas wie »schleichende Ausweitung einer Operation« – war die, dass sie dazu neigten zu sterben; ihr Gehirn wurde an einer Bürowand verspritzt oder ihr Bauch an einem verschneiten walisischen Berghang aufgeschlitzt … Shirley hatte sich selbst nie als Unglücksbringer betrachtet, aber das war ja auch egal, oder? Was zählte, war, was die anderen dachten, und mit zwei toten Partnern würde es schwierig werden, den Klatsch und Tratsch aus der Welt zu schaffen. Tu dich mit Shirley zusammen, und deine Tage sind gezählt. Mit so was konnte man keine rumkriegen, die einen von der Seitenlinie aus beobachtete und so tat, als täte sie es nicht.
Das Stroboskop flackerte, die Tanzfläche bebte, und die Bässe wummerten durch ihren Körper. Alle Augen waren auf Shirley Dander gerichtet, und das war ihr nur recht.
Hauptsache, es ging nicht wieder jemand drauf.
Er hatte jetzt ein wenig Geld aus dem Erbe seines Großvaters. Zwar hatte die Pflege am Ersparten des O.B.s gezehrt wie ein gieriger Miethai, aber es war genug übrig geblieben, damit River sich ein Auto kaufen konnte, sein erstes seit Jahren. Vorher hatte er sich eingehend informiert, die Reparaturanfälligkeitsstatistiken für Gebrauchtwagen geprüft, sich Louisas Tipp zu Herzen genommen, dass gelbe Autos in den ersten drei Jahren nur zweiundzwanzig Prozent ihres Wertes verloren und nicht dreißig wie alle anderen Farben, und dann ein Angebot von der Straße gekauft. Ein echtes Schnäppchen. So weit, so gut, dachte er, als das abendliche London in Form von Teppichgroßhändlern und Bettenläden, Garagen und Selfstorage-Lagerhäusern an ihm vorbeizog; er hatte das Fußgängerdasein hinter sich gelassen. Vielleicht war es sogar ein Symbol für einen Neuanfang. Er hatte die Hand am Türgriff, bereit für das, was als Nächstes kam. Aber zunächst musste er sich um das kümmern, was in Kent geschah.
Das Heim seiner Kindheit lag etwas außerhalb von Tonbridge. Jennifer Knox war eine Nachbarin, aber nach ländlichen Maßstäben: In der Innenstadt von London hätten fünfzehn Häuser in die Lücke zwischen seinem Haus und dem von Jennifer Knox gepasst, und die Hälfte der Bewohner hätte man nicht gekannt. Aber draußen vor der Stadt fielen Fremde viel eher auf, ebenso erleuchtete Räume in Häusern, die eigentlich hätten dunkel sein sollen. River hatte also keinen Grund, an der Aussage von Mrs. Knox zu zweifeln: Es war jemand im Haus seines Großvaters – oder war dort gewesen.
Vielleicht war jemand eingebrochen. In der Zeitung war eine Todesanzeige erschienen; sowas machte es Einbrechern leicht, ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Aber es gab noch andere Möglichkeiten. Der O.B. war ein Spion gewesen, eine Legende des Geheimdienstes. Sein Nachruf war diplomatisch formuliert gewesen – seine Tarnung hatte ihn im Verkehrsministerium platziert –, aber er hatte ein Undercover-Leben geführt, und es war nicht auszuschließen, dass einige seiner Geheimnisse weiterlebten. Das Haus war inzwischen größtenteils leer; die meisten Möbel waren abtransportiert worden. Rivers Mutter hatte sich darum gekümmert: Lass mich dir etwas abnehmen. Zuerst hatte er gedacht, dass sie Geld herausschlagen wollte – meine Güte, was sagte das über ihn aus? –, und er hatte ein Machtwort gesprochen, als es um das Arbeitszimmer ging. »Die Bücher«, hatte er gesagt. »Ich behalte die Bücher.«
Seine Mutter nahm wie üblich an, dass er verrückt geworden sei. »Du liest nicht, River.«
»Natürlich lese ich.«
»Aber nicht oft.«
Wer tat das schon? Das Arbeitszimmer des alten Mannes war eine mit Büchern ausgekleidete Höhle, als hätte er sich im Alter zum Hobbit entwickelt. Während des letzten Jahres hatte er jedoch überhaupt nicht mehr gelesen, weil ihm die Worte auf den Seiten entglitten waren. Eine der letzten zusammenhängenden Unterhaltungen, die er mit seinem Enkel geführt hatte: »Ich verliere den Halt.« Der Blick in seinen Augen bodenlos.
Und so blieb das Arbeitszimmer in seinem ursprünglichen Zustand, wie ein Ausstellungsraum in einer leer stehenden Immobilie – Bücher, Stühle, Vorhänge; das Regal mit seiner seltsamen Trophäensammlung: eine Glaskugel, ein Betonbrocken, ein Metallklumpen, der einmal eine Luger gewesen war; der Schreibtisch mit seinem Löschpapier wie ein Requisit aus einem Dickens-Film, und der Brieföffner, der ein echtes Stilett war und einst Beria gehört hatte –, und wenn David Cartwright Geheimnisse hinterlassen hatte, dann befanden sie sich irgendwo in diesem Raum, in diesen Regalen, versteckt zwischen einer Milliarde anderer Wörter. River wusste nicht, ob er das wirklich glauben sollte oder nicht, aber wenn er so dachte, dann taten es vielleicht auch andere und handelten dementsprechend. Die Geheimnisse von Spionen waren für Freunde und Feinde gleichermaßen gefährlich, und der alte Mann hatte sich im Laufe der Jahre in beiden Lagern viele gemacht. River konnte sich gut vorstellen, wie einer von ihnen ein Schloss knackte oder ein Fenster aufhebelte; er konnte sich vorstellen, wie sie im Arbeitszimmer nach Hinweisen suchten. Wenn das der Fall war, musste River es verhindern. Wenn sein toter Großvater eine Spur hinterlassen hatte, würde nur er ihr folgen und niemand sonst.
Der Verkehr lichtete sich, umso dunkler es wurde, und er kam gut voran, parkte in der Nähe des großväterlichen Hauses und ging zu Fuß weiter. Von außen schien das Gebäude verlassen zu sein, es brannte kein Licht. Es bestand immerhin die Möglichkeit, dass die alte Dame sich geirrt hatte. Aber es bestand auch die Möglichkeit, dass sie sich nicht geirrt hatte, und River ging außen herum, nutzte den Schatten der Bäume und schlich sich so leise wie möglich durch die Hintertür hinein.
Lech Wicinski bereitete einen Teig zu; das Rezept hatte er im Kopf.
Zuerst das Mehl abwiegen oder die ungefähre Menge in die Schüssel geben.
Die Hefe und eine Prise Salz hinzufügen. Unterrühren.
Jetzt das warme Wasser und zwei Esslöffel Olivenöl dazugeben.
Und jetzt schlag den Teig so fest, dass ihm Hören und Sehen vergeht.
Er verlor sich dabei für eine Weile in seinen Gedanken.
Es war ein Scheißtag gewesen, also nicht anders als die meisten anderen. Jackson Lamb hatte sich angewöhnt, ihn zu fragen, wann er vorhatte, die Bürofenster zu putzen, als wäre er durch seine Herkunft dazu ausersehen, und obwohl die anderen Slow Horses zwar nicht unbedingt mit ihm warm geworden, aber zumindest etwas aufgetaut waren, herrschte im Slough House beständig eine Atmosphäre wie auf einer Beerdigung für einen ungeliebten Toten. Die Aufgabe, die man ihm übertragen hatte, nachdem er monatelang die Wände angestarrt hatte, war kaum weniger abwechslungsreich als der leere Blick auf die schmutzigen Wände: Lamb hatte etwas über den Rückzug radikalisierter Jugendlicher aus den sozialen Medien im Fernsehen gesehen, in der Zeitung gelesen oder sich selbst ausgedacht und beschlossen, dass Lech dieses Thema sinnvollerweise weiterverfolgen sollte.
»Sie wollen eine Liste von Jugendlichen, die sich aus den sozialen Medien zurückgezogen haben?«
»Von Fratzenbuch, Zwitscher und Co.«
»Haben Sie irgendwelche Ideen, wie ich das anstellen soll?«
Lamb hatte so getan, als würde er nachdenken. »Ich kann das selbst erledigen, falls Sie das damit sagen wollen«, entgegnete er schließlich. »Aber dann wären Sie noch überflüssiger als ohnehin schon.«
Was eine ziemlich typische Interaktion mit Lamb war.
So sahen jedenfalls Lechs Tage aus: Er irrte durch einen Wirrwarr von Hashtags, in einem ähnlich chaotischen Zickzack wie in dem Gesicht, das ihn von jeder spiegelnden Oberfläche aus ansah. Denn auch darauf zeichnete sich ein abschreckendes Zickzackmuster ab. Von ferne hätte man meinen können, er habe mit knapper Not eine Akne-Attacke überlebt; aus der Nähe konnte man die Rasiermesserspuren erkennen, die jene ausradiert hatten, die darunterlagen. Als ob er mit einer Käsereibe über seine Wangen gefahren wäre. Das war schlimm genug, aber es hätte noch schlimmer sein können: Das Wort, das er ausradiert hatte, war PAEDO gewesen, in Lechs Gesicht geritzt von dem Mann, der seinen Laptop mit illegaler Pornografie infiziert hatte.
Bei dem Gedanken daran schlug er noch heftiger auf den Teig ein.
Dieser Mann war inzwischen ausgeschaltet – dank Lamb, wie sich herausstellte –, aber dasselbe galt auch für Lechs Karriere und sein früheres Leben. Regent’s Park würde nie und nimmer zugeben, dass er reingelegt worden war. Seine Freisprechung würde bedeuten, dass ihnen ein Fehler unterlaufen war, und der Park machte keine Fehler. Es gab also keinen Weg zurück ins Helle und keine Zukunftsperspektive, wenn er die Spook Street verließ: Wenn er jetzt ginge, hätte er keine guten Referenzen, und dazu sah er aus wie ein Statist aus einem Horrorfilm. Die Arbeitgeber würden sich nicht überschlagen. Sie dürfen dich zwar nicht diskriminieren, weil du alt, schwul, schwarz, behindert, männlich, weiblich oder dumm bist, aber wenn du aussiehst, als wärst du aus den Trümmern deines eigenen Lebens gekrochen, können sie dir einen mitleidigen Blick zuwerfen: Danke, der Nächste bitte. Slough House würde daher auf absehbare Zeit seine Zukunftsperspektive bleiben.
Kein Wunder, dass er neuerdings unter Paranoia litt. Heute Abend hatte er im Bus auf dem Weg nach Hause das Gefühl gehabt, beobachtet zu werden, und zwar derart intensiv, dass er vorzeitig aus dem Bus stieg, wartete, bis dieser die Straße hinunter verschwunden war, und dann den Rest des Weges zu Fuß zurücklegte. Es war unwahrscheinlich, das wusste er; wenn es einen Vorteil hatte, ein Slow Horse zu sein, dann den, dass sich niemand für einen interessierte. Aber Instinkte konnte man nicht einfach ausschalten.
Er drapierte ein Tuch über die Schüssel. Sobald der Teig aufgegangen war, schlug er erneut auf ihn ein, breitete ihn mit der flachen Hand auf einem Blech aus, gab Olivenöl und eine Paste aus Knoblauch und zerkleinerten Basilikumblättern darüber und ließ ihn eine Stunde ruhen, bevor er ihn in den Ofen schob. Und, Abrakadabra: Focaccia.
Und wie kann ein Leben sinnlos sein, so fragte sich Lech, wenn man noch Focaccia backen kann?
Es kostete ihn all seine Willenskraft, die Schüssel nicht gegen die Wand zu werfen, aber er schaffte es.
Was ist bloß aus mir geworden.
Vor noch nicht allzu langer Zeit hatte Catherine Standish wieder angefangen, Wein zu kaufen; ein bewusstes Heraufbeschwören ihrer Trinkerzeit, mit einem wichtigen Unterschied: Sie trank ihn nicht. Es war ein gewollter Flirt mit der Gefahr, das Ausleben der Alkoholikersehnsucht nach Vergessen, aber am Ende hatte sie getan, was sie tun musste, und alle ihre Flaschen in die Spüle geleert, um die Aladin-Höhle, die sie geschaffen hatte, zu zerstören. Im Nachhinein erinnerte es sie an die Nachweihnachtszeit in ihrer Kindheit, wenn der Schmuck weggepackt wurde und der Alltag wieder einkehrte. Gleichzeitig wusste sie aber auch, dass eine Gefahr gebannt war und ihr Bedauern darüber, dass sie sich ihr nicht gestellt hatte, ihrer Sucht geschuldet war. Die Sucht liebt Herausforderungen, weil sie eine Ausrede zum Scheitern bieten. Doch im Slough House waren die Gelegenheiten zum Scheitern nie spärlich gesät.
Sollte man jemals Gefahr laufen, das zu vergessen, war Jackson Lamb normalerweise zur Stelle, um einen daran zu erinnern.
Aber Lamb hatte das Büro in irgendeiner persönlichen Mission noch vor Catherine verlassen, die heute selbst früher gegangen war. Der Abend war kühl, denn der Beginn der britischen Sommerzeit war von Hagelschauern und grauem Himmel geprägt, und sie trug ihren Wintermantel, während sie an einer Bushaltestelle wartete: nicht ihrer eigenen und auch nicht in der Nähe ihres Heimwegs. Mehrere Busse fuhren vorbei, doch sie nahm keinen, aber als ein Rollstuhl um die nächste Ecke bog und an der Haltestelle vorbeiholperte, folgte sie ihm. Die Rollstuhlfahrerin ließ sich nicht anmerken, ob sie es bemerkt hatte, sondern fuhr bis zur nächsten Kreuzung weiter, wo das elektrische Surren ihres Fahrzeugs am Fußgängerüberweg für einen Moment verstummte. Catherine blieb außerhalb des Blickfelds der Rollstuhlfahrerin, aber die Frau sprach sie trotzdem an.
»Kenne ich Sie?«
»Sagen Sie es mir.«
»Einen Augenblick.«
So lange dauerte es, bis die Ampel umsprang. Der Rollstuhl fuhr wieder an, und als sie die Straße überquerten und der Londoner Verkehr mit ohnmächtiger Wut zusehen musste, sprach die Fahrerin wieder.
»Catherine Standish«, sagte sie. »Catherine Standish, ehemalige persönliche Assistentin von Charles Partner, verstorben und unbeweint. Und jetzt – wie sollen wir es nennen? Bürohilfe? Schlossherrin? Faktotum? – des noch nicht verstorbenen, aber bedauernswerten Jackson Lamb.«
»Ich soll Sie von ihm grüßen.«
»Ach, wirklich?«
»Nein.«
»Hätte ihm auch nicht ähnlich gesehen. Sie wollen also nicht so tun, als wäre das eine zufällige Begegnung?«
»Ich habe schon seit zehn Minuten auf Sie gewartet.«
»Ein Wunder, dass Sie nicht aufgelesen wurden. In dieser Gegend reagiert man äußerst empfindlich auf Herumlungernde.«
»Diese Gegend« hieß: Regent’s Park, das unmittelbare Einzugsgebiet des Geheimdienstes.
»Einer der Vorteile als Frau mittleren Alters«, erwiderte Catherine, »ist der Mantel der Unsichtbarkeit, der damit einhergeht.«
»Wenn Sie sich den Schuh anziehen wollen.«
Eine passende Replik. Molly Doran hatte viele Eigenschaften, aber Unsichtbarkeit gehörte nicht dazu.
»Normalerweise nehme ich ein Taxi«, fuhr sie fort. »Sie haben Glück, dass Sie mich erwischt haben.« Sie blieb abrupt stehen. »Ich habe das mit Ihrem Kollegen gehört. Mein Beileid.«
»Danke.«
»Jackson hasst es, Joes zu verlieren.«
»Die Joes sind wohl auch nicht begeistert.«
»Aha. Sie beißt.« Der Rollstuhl setzte seinen Weg fort. »Der Grund, warum ich nicht in einem Taxi nach Hause fahre, Ms. Standish, ist, dass ich noch etwas in der Stadt zu erledigen habe. Sie haben also zwei Minuten Zeit, um zu erklären, was Sie wollen, und dann können wir beide wieder unserer Wege gehen.«
Catherine sagte: »Wir machen uns Sorgen.«
»Oh, wie überaus tragisch für euch.«
»Und wir dachten, Sie könnten uns vielleicht helfen.«
»Und wie definieren wir ›wir‹ in diesem Zusammenhang?«
»Im Grunde nur ich.«
»Verstehe.« Molly trug Make-up, das jeder Beschreibung spottete; das Gesicht leblos weiß, die Wangen absurd rot. Sie hätte für eine Rolle in einer anderen Art von Zirkus vorsprechen können, als Clownin oder vielleicht als Akrobatin, obwohl sie in letzterem Fall mehr als gefordert gewesen wäre. Ihre Beine endeten zum Beispiel an den Knien.
Sie sagte: »Lamb hat also keine Ahnung, dass Sie sich an mich gewandt haben?«
Catherine war sich bewusst, dass es ein Fehler sein könnte, kategorisch zu behaupten, was Lamb zu einem bestimmten Zeitpunkt wusste und was nicht, nicht mal, wenn er schlief. Aber in dieser Situation war am einfachsten, von Vermutungen auszugehen. »Nein.«
»Das ist aber schade. Wenn Lamb einen Gefallen will, muss er mir jedes Mal etwas dafür geben.«
»Wirklich?«
»Informationen. Kein Geld.« Molly lächelte, aber nicht auf eine sympathische Art. »Die Währung der Spione. Ich horte sie sozusagen.«
»Und genau aus diesem Grund wollte ich Sie sprechen.«
»Das ist der einzige Grund, warum mich jemand sprechen will. Es ist mein Alleinstellungsmerkmal. Meine Daseinsberechtigung.« Molly Doran blieb erneut stehen, und Catherine ahnte, dass sie zu einer Rede ansetzte: »Ich bin Archivarin, Ms. Standish. Ich arbeite in der Welt des Papiers. Mein kleines Reich ist voller Ordner mit den Geheimnissen, die die Leute aufbewahrten, als sie ihre Berichte noch mit der Schreibmaschine verfassten. Vor fünfzehn Jahren hat man mir gesagt, dass die Digitalisierung meiner Art der Zugangskontrolle ein Ende bereiten würde. Das war, bevor man sich voller Schreck bewusst wurde, wie angreifbar die Online-Welt ist.« Sie mimte das Umlegen eines Schalters. »Ein schlaues Kerlchen in Peking, und schon wird alles im Internet für alle sichtbar. Deshalb bin ich immer noch da, aber meine Unterlagen sind in Papierform. Die Zukunft liegt vielleicht nicht in meiner Obhut, aber glauben Sie mir, die Vergangenheit ist mein Reich.« Sie hielt inne. »Dann erzählen Sie mir mal von Ihren Sorgen. Hat jemand an Ihrem Fundament gerüttelt? Ist euch Slough House um die Ohren geflogen?«
Bevor Catherine antworten konnte, ertönte ein lautes Geheul aus der Richtung des Zoos.
»Haben Sie das gehört?«, fragte sie.
»Ah«, sagte Molly. »Der große böse Wolf. Ist er unterwegs, um euer Häuschen wegzupusten?«
»Ich glaube, das hat schon jemand anderes erledigt«, erwiderte Catherine.
Die Hintertür führte in einen Vorraum, in dem Mäntel aufgehängt und Gummistiefel abgestellt wurden, jedenfalls früher.
Jetzt war es bloß noch ein kaltes, leeres Kabuff zwischen der Außenwelt und der Küche. River durchquerte es schweigend. So war es mit vertrauten Häusern: Man kannte ihr Quietschen und die ungeölten Scharniere; man wusste genau, wo man hintreten musste. An einem Türpfosten befand sich ein einzelner Bleistiftstrich, etwa in Höhe von Rivers Hüfte. Er stammte von Rose. Schau mal. So groß bist du jetzt. Und dann hatte David ihm die Regeln des Lebens erklärt: Man lässt Informationen über sich nicht offen herumliegen, sodass jeder sie sehen kann; man markiert seine Größe und sein Alter nicht so, dass die Wiesel sie finden können. Das war Rivers erster Einblick in die geheime Welt seines Großvaters, und er hatte Rose nie wieder gebeten, ihn zu messen.
River hörte keinen Laut. Das Arbeitszimmer befand sich im Erdgeschoss, auf der Rückseite des Hauses: aus der Küche raus und dann nach links. Er hätte es mit geschlossenen Augen gefunden. Die Tür stand einen Spalt offen. Hatte er es so verlassen? Er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, und war sich der Leere um ihn herum deutlich bewusst. Sogar die Standuhr, die schon lange vor seiner Geburt im Flur gestanden hatte, war verschwunden. Ihr fehlendes Ticken war, als würde ihm jemand auf die Schulter klopfen.
Aber im Arbeitszimmer würden die Regale mit Büchern gefüllt sein, die Teppiche an ihrem Platz, der Schreibtisch, die Sessel. Ein Korb mit Holzscheiten würde vor dem Kamin stehen und ein Transistorradio auf dem Couchtisch. Es wäre kaum eine Überraschung, den O.B. dort mit einem Brandyglas in der Hand zu finden. Aber sein Großvater war hinüber nach Joe Country gegangen, und außerdem: In der Luft lag ein Geruch von verkokeltem Staub.
Er legte eine Hand flach gegen die Bürotür und drückte dagegen. Sie schwang auf.
Der sanfte Schein kam von dem alten elektrischen Kamin, der normalerweise hinter dem Sessel des O.B.s verborgen war. In seinem Lichtschein wirkte der Raum wie ein altes holländisches Gemälde: gestochen scharfe Details in der Mitte, die an den Rändern zu Schatten wurden. Und dort, wo er am hellsten leuchtete, stand der Stuhl seines Großvaters, dessen vertraute Schwere in Rivers Leben genauso präsent war wie der Mann, der ihn einst eingenommen hatte. Die Gestalt, die jetzt dort saß, beobachtete River, während er eintrat, aber sie schien sich nicht zu bewegen und nicht zu atmen. Es hätte ein Geist sein können.
»Mein Gott!«, sagte er leise.
Er ging zwei Schritte ins Zimmer hinein.
»Sid?«
»Hallo, River«, sagte sie.
In diesem Moment rast viele Kilometer entfernt ein Krankenwagen um die Kurve der Beech Street und wirft sein Blaulicht zuerst auf die U-Bahn-Station Barbican und dann auf die Gebäude in der nächsten Straße: das chinesische Restaurant, den Zeitungskiosk und die Tür zwischen den beiden, die sich nie öffnet und nie schließt. Für einen Augenblick ist Slough House beleuchtet, und seine Fenster spiegeln das Licht wider, als nähme es voll am Londoner Leben teil; als atmete das Gebäude dieselbe Luft wie alle anderen und hegte dieselben Hoffnungen und Bestrebungen. Doch nur für diesen einen Moment. Gleich darauf donnert der Krankenwagen die Aldersgate Street hinunter, das Jaulen seiner Sirene schallt über die Dächer, und in seinem Kielwasser werden die Fenster von Slough House zu denselben schwarzen Pfützen, die sie vorher gewesen sind, sodass, wenn man hingehen und hineinschauen würde – immer in der Annahme, man könnte so hoch über dem Bürgersteig schweben –, nichts zurückschauen würde. Nicht das alltägliche Nichts der beiläufigen Abwesenheit, sondern das lange Nichts, das folgt, wenn alles vorbei ist.
Aber niemand nähert sich jemals, und niemand schaut hinein. Bei der geringen Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwird, könnte Slough House genauso gut gar nicht existieren. Das ist zwar nicht überraschend, denn die Geheimdienstbranche ist nicht gerade für ihre Blitzlichtgewitter bekannt, aber es vermittelt auch den Eindruck von Überflüssigkeit. Denn in London ist ein Gebäude, an dem man sich am besten vorbeidrückt, ein Gebäude ohne Daseinsberechtigung, und für ein solches Gebäude könnten die Tage gezählt sein; es könnte sein, dass man es nicht als Struktur aus Backsteinen und Mörtel betrachtet, sondern als Chance; als eine Leerstelle, die darauf wartet, dass Stahl und Glas ihr Form verleihen. Die Geschichte hinter seinen Mauern ist keinen Cent wert. Für diejenigen, die kaufen und verkaufen, besitzen und bauen, ist die Vergangenheit nur eine Abkürzung zu dem, was noch vor ihnen liegt, und das, was noch bevorsteht, bietet denjenigen, die bereit sind, sich auf die nötigen Veränderungen einzulassen, märchenhaften Reichtum. So wird es ihnen zumindest versprochen.
Denn eine Stadt ist etwas Unbeständiges, ihre Oberfläche verändert sich unablässig, wie das Meer.
Und wie das Meer hat auch eine Stadt ihre Haie.
3
In der Brewer Street gibt es einen Laden, in dem man russische Zigaretten kaufen kann. Polnischen Kaugummi. Litauischen Schnupftabak …
Auch wenn der Mann, der diese Worte gesprochen hatte, nicht schon lange tot gewesen wäre, hätte er keine Probleme gehabt, den Laden wiederzufinden: Er war nicht umgezogen, nicht renoviert worden, ja im Großen und Ganzen unverändert. Er war immer noch winzig wie eine Besenkammer, und die Kasse auf dem Tresen wurde liebevoll als »elektrisch« bezeichnet; die Regale reichten vom Boden bis an die Decke, und jedes enthielt immer noch die gleiche verwirrende Auswahl an Waren: die gleichen Zigarren mit grünen und gelben Banderolen, die gleichen Schokofrösche in der gleichen Folienverpackung. Über der Tür zum Treppenhaus hing immer noch derselbe Kalender von 1993, und derselbe glänzende Blechkeksdosen-Deckel mit dem Motiv eines verschmitzt grinsenden Stalin stand immer noch auf Kopfhöhe in einem Regal und diente immer noch als Gong, wenn eine Konferenz im Gange war. Als »Konferenz« bezeichnete Old Miles jede Versammlung im Obergeschoss, die mehr als drei Personen umfasste – bei weniger als drei, so pflegte er zu grummeln, war es nicht nötig, die Anwesenden zu zählen, indem er Joe Stalin rhythmisch mit einem kleinen Hammer ins Gesicht schlug.
Old Miles war zwar nicht sein richtiger Name, aber es wurde generell angenommen, dass er eine Menge Meilen auf dem Tacho hatte, und nichts an der Art, wie er sich an eingefahrene Gewohnheiten klammerte, ließ daran zweifeln.
Ein Grund für das Festhalten an Traditionen ist jedoch das Bewusstsein für bevorstehende Veränderungen, und hinter der scheinbar halsstarrigen Unwandelbarkeit des kleinen Ladens verbarg sich eine kleine Verschiebung, die jedoch eine erhebliche Umstrukturierung erforderte. Die wachsende Besorgnis der letzten Jahre hatte sich zu einer drückenden Sorge verdichtet. Die Geschäftskosten stiegen immer weiter, während die Kundschaft aufgrund von Sterblichkeit, Alter und nachlassender Mobilität zunehmend schrumpfte. Früher hatte es hier eine Menge kleiner Läden gegeben, in denen man alles für den täglichen Bedarf einkaufen konnte, notfalls für eine ganze Großfamilie. Aber diese Zeiten waren vorbei, und Old Miles’ Tabak-Schmuggelwaren-Laden bildete inzwischen eine Insel auf einem Hipster-Spielplatz – und das war noch das geringste Problem. London veränderte sich von Tag zu Tag, und auch wenn die Stadt Fremden gegenüber nie so freundlich und einladend gewesen war, wie sie gerne vorgab, so hatte sie doch von der Vielfalt profitiert. Der politische Zeitgeist hatte das geändert, und wie die Geschichte bewies, ließen sich politische Geister am besten durch das Schwenken von Fahnen und Bannern vertreiben, was normalerweise den Einsatz von Knüppeln und Stöcken nach sich zog. Vielfalt war keine Attraktion mehr, und die Versammlungen der sogenannten Gelbwesten auf den Straßen im Zentrum Londons waren ein Beweis für das Schrumpfen des geistigen Horizonts, das mit dem Errichten von Barrikaden einhergeht. Milosz Jerzinsky – Old Miles – hatte seine frühen Jahre nicht damit verbracht, Kommunisten aus der Ferne zu bekämpfen, um dann im Alter von Faschisten vor seiner Haustür in die Mangel genommen zu werden. Außerdem lief der Pachtvertrag für seinen Laden noch genauso viele Jahre, wie er das Rentenalter nun bereits überschritten hatte, und die spiegelbildliche Darstellung dieser Zeitspannen galt ihm als Omen. Er hatte also, wie er seiner verbliebenen Kundschaft gestand, die Silberlinge der Immobilienhaie genommen; er brach seine Zelte ab; er machte sich auf den Weg. Sein Laden würde bis zum letzten Tag unverändert bleiben, und dieser brach heute um Mitternacht an. Damit würde die letzte Konferenz enden, die im oberen Raum abgehalten wurde; eine Versammlung von Stammgästen und Gelegenheitsbesuchern, die die Stunden Glas für Glas herunterzählten und allein durch ihre Anwesenheit bewiesen, dass der Lobgesang eines längst verstorbenen Kunden auf den Laden von Old Miles seine Berechtigung hatte: Egal, wann man hinkommt, immer besteht die Kundschaft mindestens zur Hälfte aus Spionen.
Doch jetzt würde niemand mehr kommen, dachte Old Miles.
Er hatte gerade die letzten drei Schachteln seiner russischen Zigaretten – eine tödliche Marke, die nur einem Selbstmörder schmecken konnte – an einen dicken Mann in einem schmuddeligen Mantel verkauft, der aussah, als würde er in einem Wettbüro arbeiten, entweder hinter dem Kassengitter oder auf einem Hocker unter dem Fernseher, wo er zusah, wie der Inhalt seiner Lohntüte auf der Rennbahn von Doncaster davongaloppierte. Doch während er auf sein Wechselgeld wartete, blickte er sich so düster konzentriert um, als würde er sich die Einrichtung des kleinen Ladens für immer einprägen. Vielleicht hatte er zu seiner Zeit mehr als nur das eine oder andere Gehalt verloren. Vielleicht hatte er ein ganzes Archiv an Misserfolgen in seinem hässlichen Kopf gespeichert, und vielleicht sprach Old Miles ihn deswegen an, während er das Kleingeld in seine wartende Hand zählte. »Wir schließen«, sagte er.
»Hab ich gehört.«
»Das hier hat keine Zukunft.«
Der Mann grunzte. »Es sieht so aus, als hätte es nicht mal eine Gegenwart.«
»Waren Sie noch nie hier?«
Der Mann antwortete nicht. Er starrte das Kleingeld an, als hätte Old Miles ihm zu wenig rausgegeben oder ihm eine ungültige Währung in die Hand gedrückt. Schließlich schob er die Münzen in seine Hosentasche und sah Old Miles in die Augen. »Ich hab von Ihrem Laden gehört, aber nie einen Fuß reingesetzt.«
»Aber diese Marke können Sie nirgendwo sonst in dieser Gegend gekauft haben.«
»Vielleicht können Sie deshalb mit Ihrem Laden nicht überleben«, erwiderte der Mann. »Neugier ist schlecht fürs Geschäft.«
»Da könnte etwas dran sein«, räumte Old Miles ein. »Aber bis jetzt habe ich Überleben als eines meiner Talente betrachtet.« Er nickte in Richtung der Tür zu seiner Linken. »Wollen Sie mit nach oben gehen?«
»Sie sind nicht mein Typ.«
»Es gibt einen kleinen Umtrunk. Ein Treffen von gleichgesinnten Freunden.« Er lehnte sich näher heran. »Sie sind ein Aktiver gewesen, oder? So was merke ich meistens.« Er zog sich zurück. »Nennen Sie es eine Totenwache.«
»Ich bin nicht der sentimentale Typ.«
»Aber Sie sehen aus, als würden Sie gerne ein Gläschen trinken.«
Der dicke Mann zog wie aus dem Nichts eine Zigarette hervor. Sie sah aus wie eine von denen, die Old Miles ihm gerade verkauft hatte – der Tabak fast schwarz, die Hülse lose im Filter –, aber er konnte sie gewiss nicht mit einer Hand aus der Packung befreit haben. Er steckte sie sich in den Mund. »Na ja«, sagte er. »Ich schaue mal kurz rein, vielleicht treffe ich alte Bekannte.«
»Und wenn Sie ein alter Bekannter wären?«, erwiderte Old Miles. »Wie würde man Sie dann nennen?«
»Weiß der Teufel«, gab Jackson Lamb zurück und verschwand durch die Tür, auf die der Ladenbesitzer gedeutet hatte.
Die Spezialität des Hauses war rotes Fleisch.
Wenn man der Speisekarte nicht traute, brauchte man sich nur die Gäste anzusehen.
Diana Taverner zog Bilanz: Abgesehen vom Servicepersonal war sie die einzige Frau hier, und sie hatte nichts dagegen. Gleichberechtigung bedeutete nichts, wenn man sich seinen Platz am Tisch nicht verdiente; ein Tisch, der in diesem Fall im privaten oberen Raum eines Pubs stand, und zwar eines von jenen, über die in der Sonntagsbeilage berichtet wird und die einen berühmten Koch haben. Er hatte sich vorhin unter sie gemischt, sich vorgestellt, erklärt, welche Fleischstücke er servieren wollte, und hätte um ein Haar noch gefragt, ob sie die verdammte Kuh kennenlernen wollten. Diana schätzte gutes Essen, aber die damit verbundenen Rituale konnten ermüdend sein.
Jemand schlug mit der Gabel gegen ein Glas, mehrmals hintereinander. Die Gesellschaft verstummte.
»Ich danke Ihnen.«