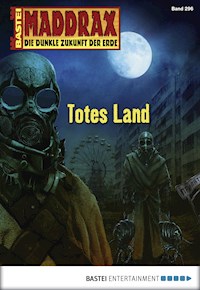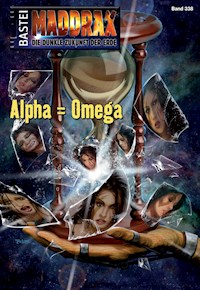1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
Amitola Jones rannte. Zumindest versuchte sie es. Doch allmählich schwanden ihr die Kräfte. Der sandige Untergrund griff wie mit gierigen Fingern nach ihren Schuhen und ließ sie mehr taumeln als laufen.
Ein Fuß vor den anderen. Und noch einmal. Jeder Schritt eine gewaltige Anstrengung.
"Lass mich in Ruhe!", rief - nein keuchte - sie.
Die Böen, die in dieser Nacht vom Meer ins Landesinnere wehten, rissen ihr die Worte von den spröden Lippen. Nicht, dass es einen Unterschied machte. Selbst wenn das ... das Etwas, das hinter ihr her war, sie hörte, würde es sie umbringen. Oder Schlimmeres mit ihr tun.
Viel Schlimmeres ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Ich bringe den Tod
Briefe aus der Gruft
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Timo Wuerz
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-6293-0
„Geisterjäger“, „John Sinclair“ und „Geisterjäger John Sinclair“ sind eingetragene Marken der Bastei Lübbe AG. Die dazugehörigen Logos unterliegen urheberrechtlichem Schutz. Die Figur John Sinclair ist eine Schöpfung von Jason Dark.
www.john-sinclair.de
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Ich bringe den Tod
von Oliver Fröhlich
Amitola Jones rannte. Zumindest versuchte sie es. Doch allmählich schwanden ihr die Kräfte. Der sandige Untergrund griff wie mit gierigen Fingern nach ihren Schuhen und ließ sie mehr taumeln als laufen.
Ein Fuß vor den anderen. Und noch einmal. Jeder Schritt eine gewaltige Anstrengung.
»Lass mich in Ruhe!«, rief – nein keuchte – sie.
Die Böen, die in dieser Nacht vom Meer ins Landesinnere wehten, rissen ihr die Worte von den spröden Lippen. Nicht, dass es einen Unterschied machte. Selbst wenn das … das Etwas, das hinter ihr her war, sie hörte, würde es sie umbringen. Oder Schlimmeres mit ihr tun.
Viel Schlimmeres …
Sie drehte sich um und sah nichts als den schmalen, mondbeschienenen Strand von Kill Devil Hills. Links das Meer, rechts die Dünen.
Dennoch wusste sie, dass sie nicht allein war. Sie fühlte es. Zwischen den Gräsern der Hügel, hinter den großen Sandbaggern, in der Finsternis neben der Bootshütte eines Fischers, irgendwo dort in den nächtlichen Schatten lauerte es. Spielte mit ihr.
Trotzdem blieb sie stehen und versuchte zu Atem zu kommen. Wenigstens für zwei, drei Sekunden.
Sie beugte sich leicht vor, legte die Hände auf die Oberschenkel und schnaufte rasselnd ein und aus. Wenn doch nur das Ziehen in der Lunge endlich nachließe.
Ihr Blick flirrte über den Strand.
Nichts zu sehen.
Hatte sie es vielleicht doch geschafft, ihren Verfolger in der Dunkelheit abzuhängen? Oder ließ er sie absichtlich vorerst in Ruhe und erst noch ein paar Tage zappeln? So wie er es mit Brad getan hatte?
Der Gedanke an ihren Freund versetzte ihr einen Stich, der stärker schmerzte als die Schnittwunde am Oberarm.
Brad …
Was mochte aus ihm geworden sein? Ob er aus der Stadt geflohen war? Oder ob … ob …
Sie weigerte sich, die Frage zu Ende zu führen.
Stattdessen glitt ihr Geist in die Vergangenheit. Der denkbar ungünstigste Augenblick, so allein und blutend, verfolgt von was auch immer. Das war ihr durchaus bewusst. Aber sie konnte nicht anders.
Vier Tage war es her, dass Brad sie in seinem Haus nach einigen gemeinsamen Bieren lange wortlos angesehen und dann gesagt hatte: »Hinter mir ist ein Monster her. Seit ein paar Tagen schon.«
Zuerst hatte es Amitola für einen Scherz gehalten, doch selbst, als er darauf beharrte, die Wahrheit zu sprechen, nahm sie ihn nicht ernst. Sie lachte ihn aus, fragte ihn, wie dieses Monster denn ausgesehen habe, und lachte noch lauter bei seiner Antwort.
»Ich weiß es nicht. Es hält sich stets im Schatten.«
Er hatte sie angefleht, ihm zu glauben, er liebte sie doch und würde sie niemals belügen. Und so weiter.
Aber es ging nicht. Sie konnte ihm nicht glauben. Sie wollte es nicht. Nicht mit einem Vater wie ihrem, dem großen Häuptling und Geisterversteher Motega Jones, der sie Tag für Tag mit den alten indianischen Legenden nervte und ihr eine Ohrfeige versetzte, wenn sie genervt die Augen verdrehte.
Dem Mann, der sie irgendeinem obskuren Reinigungsritual unterziehen würde, wenn er von Brad wüsste, einfach aus dem Grund, weil er ein Weißer war, und diese Weißen schließlich nichts vom Leben verstanden, von der Welt neben der Welt, weil sie ihn in der Bar auslachten, wenn er von dem Koyotendämon Korahotla erzählte, von Tahmelahastis, dem stets Wiederkehrenden, oder von Lakarosna, dem Windflüsterer. Ja, nicht einmal die Geschichte von Croatoan nahmen sie ernst, diese Weißen.
Sie hielten das Verschwinden der Siedler aus der Kolonie Roanoke vor Hunderten von Jahren für ein Rätsel, gewiss, gut geeignet für ein paar gruselige Erzählungen am Lagerfeuer oder um den Kindern Angst zu machen, aber tief in ihrem Inneren verspotteten sie jeden, der mehr dahinter vermutete.
Nein, Motega Jones mochte die Weißen nicht. Oft genug hatte er eine Nacht im Gefängnis verbracht, weil ihm am Abend zuvor der Blick eines Weißen nicht gefallen hatte, weil er zu herablassend, zu spöttisch, zu was auch immer gewesen war und er sich dadurch zu einer Schlägerei hatte provozieren lassen. Und niemals würde er akzeptieren, dass sich seine Tochter in einen von ihnen verliebt hatte.
Lange würde sie es nicht mehr daheim aushalten, in diesem totemgefüllten Schrein, den ihr Vater ein Wohnzimmer nannte, umnebelt vom Duft verbrannter Kräuter und leiernden Gesängen.
An ihrem 21. Geburtstag würde sie ausziehen. Ein halbes Jahr noch, dann hätte sie es hinter sich. Und bis es so weit war, genoss sie jede Stunde, die sie ihrem verschrobenen, zum Jähzorn neigenden Vater entkam. Jede Minute, die sie ohne Geister, Dämonen und Legenden bei Brad verbringen konnte.
Und nun kam auch er mit solchen Geschichten an? Ihr war egal, ob er sie nur auf den Arm nehmen wollte, ob der Alkohol aus ihm sprach oder ob er wirklich an den Mist glaubte, den er da von sich gab. Sie war nicht bereit, ihm zu glauben.
Sie – war – nicht – bereit!
Es folgte, was folgen musste: ein unschöner Streit mit lauten Worten und noch lauterem Türenschlagen.
Seitdem hatte sie Brad nicht mehr gesehen.
Ein Tag verging, dann ein zweiter. Am dritten rührte sich bei ihr das schlechte Gewissen, gepaart mit der Erkenntnis, überreagiert zu haben. Ein Wesenszug, den sie von ihrem Vater geerbt hatte. Also rief sie Brad an. Er meldete sich nicht. Kein einziges Mal von den inzwischen einhundertdreimal, die sie es versucht hatte, ging er ans Telefon.
Am vierten Tag verwandelte sich das schlechte Gewissen in Wut. Sollte er doch Mister Unnahbar spielen! Irgendwann würde er sie vermissen und angekrochen kommen. Oh ja, das würde er.
Doch er kam nicht. Wie auch? Das Haus von Motega Jones war Tabuzone für ihn, weil er um seine Gesundheit fürchtete, und er machte stets einen großen Bogen darum, um nur ja keinen Verdacht aufkommen zu lassen.
Abends wälzte sich Amitola im Bett, der Gedanke an Brad ließ sie aber nicht in den Schlaf finden. Also stand sie kurz vor Mitternacht wieder auf und beschloss, aus dem Zimmer zu schleichen, Brad zu besuchen und ihm zu verzeihen. Eine Zwanzigjährige, die aus dem Fenster kletterte, um sich zu ihrem Freund zu stehlen. Was für eine Erniedrigung, die sie sich da selbst zufügte.
Sie huschte durch die Straßen von Kill Devil Hills – und kam sich vom ersten Augenblick an beobachtet vor.
Zuerst glaubte sie, ihr Vater hätte ihr Entweichen bemerkt und folgte ihr, um zu sehen, wohin sie ging. Doch dieses Verhalten passte nicht zu ihm. Er hätte ihr nachgerufen, dass sie auf der Stelle umkehren und ihm gefälligst sagen solle, warum sie mitten in der Nacht durch die Gegend schleicht.
Als Nächstes dachte sie, Brad hätte entgegen seinen Gewohnheiten das Haus beobachtet und sich ihr auf die Fersen gesetzt. Aber weshalb die Heimlichtuerei? Andererseits …
Sie blieb stehen. »Brad? Bist du das?«
Niemand antwortete. Aber bewegte sich dort zwischen dem Haus der Hendricks und der Clines nicht etwas im Schatten? Hinter den Büschen? Sie war sich nicht sicher, fühlte aber zum ersten Mal eine leichte Nervosität.
Ich weiß nicht, wie das Monster aussieht. Es hält sich stets im Schatten.
Plötzlich drängte sich Brads Aussage mit Urgewalt in ihr Bewusstsein. War es möglich, dass er nicht gelogen hatte, als er …
Nein! Unfug!
Sie kämpfte das ungute Gefühl nieder und ging weiter. An der Wäscherei und dem Antiquitätengeschäft vom alten Barlow vorbei, in dem seit Wochen ein Schild mit der Aufschrift Komme gleich wieder hing. Nachdem Jesse Barlow kürzlich an einem Herzinfarkt gestorben war, hielt Amitola das für eher unwahrscheinlich.
Sie nahm die Abkürzung über den Hof von Justin Siglers Gebrauchtwagenhandel und erreichte schließlich die Wohnsiedlung in Strandnähe, in der Brad das Haus seiner Eltern geerbt hatte.
Während des ganzen Wegs drehte sie sich immer wieder um, spähte nach einem Verfolger, nach Bewegungen im Schatten, aber sie sah niemanden.
Überhaupt niemanden.
Seit es vor Monaten in Kill Devil Hills zu einigen gewaltsamen und rätselhaften Todesfällen gekommen und unweit der Küste angeblich sogar eine riesige Insel erschienen war1), hielten sich die Leute nachts lieber in ihren Häusern auf. Seitdem glich der Ort nach Sonnenuntergang meistens einer Geisterstadt.
Und dennoch wusste sie, dass da jemand in den Schatten lauerte.
Etwas.
Reiß dich zusammen! Du lässt dich von dem Geschwätz deines Vaters und von Brads Gruselgeschichten ganz irre machen.
Wahrscheinlich. Doch was war mit diesem leichten Geruch, der in der Luft hing? Dem deutlich schwächeren Bruder des Gestanks, den sie als kleines Mädchen im Garten der alten einsamen Miss Holbrook gerochen hatte? Dem penetrant süßen Aroma ihres toten Hundes Fido, der angekettet in der Hütte hinter dem Haus vor sich hin verwest war, weil Miss Holbrook selbst seit Wochen tot im Bett gelegen und den armen Kerl deshalb nicht mehr hatte füttern können?
Das bildest du dir ein!, schalt sie sich. Vermutlich stand nur irgendwo eine länger nicht geleerte Abfalltonne offen.
Amitola trat vor Brads Haus und klingelte.
Nichts.
Kein Licht ging an. Keine Schritte erklangen hinter der Tür.
Sie umrundete das Gebäude einmal und entdeckte ein gekipptes Fenster im Obergeschoss. Das war aber auch schon alles, was darauf hindeutete, dass Brad zu Hause war.
Wieso machte er ihr dann nicht auf? War er so sauer auf sie, dass …
Plötzlich schwappte der süßliche Gestank über sie hinweg, als hätte ihr jemand Miss Holbrooks Fido unter die Nase gebunden. Sie fuhr herum, sah eine schattenhafte Gestalt, doch bevor sie mehr erkennen konnte, blitzte etwas Gebogenes im Mondlicht silbrig auf.
Eine Klinge!, schoss es ihr durch den Kopf, da ratschte auch schon der Ärmel ihrer Bluse entzwei.
Im nächsten Augenblick war die Gestalt verschwunden.
Amitola blickte an ihrem Arm hinab, sah den hängenden, blutgetränkten Stofffetzen, und mit einem Mal brandete der Schmerz in Wellen gegen sie.
Es dauerte zwei oder drei Sekunden, bis sie den Schock überwand – und bis ihr klar wurde, dass sie wie angewurzelt dastand und für den Angreifer ein leichtes Ziel darstellte. Angst fiel über sie her wie ein ausgehungerter Wolf.
Sie warf sich herum. Rannte los. Hin zum Strand.
Wie dumm die Idee war, merkte sie zu spät. Der Sand bremste sie, niemand würde ihre Hilferufe über die Meeresbrandung hinweg hören. Keiner würde sie um diese Uhrzeit sehen. Schließlich versteckten sich alle in ihren Häusern.
Ihr ach so aufgeklärter Verstand hatte ausgesetzt und den Instinkten das Kommando überlassen. Und der Instinkt sagte: Flieh! Egal wohin!
Also floh sie.
Ohne genau zu wissen, vor wem. Oder vor was.
Doch mit jedem ermüdenden Schritt im Sand wurde es ihr klarer. Sie rannte vor Brads Monster davon! Vor dem Ding, das sich stets im Schatten hielt.
Manchmal schloss es zu ihr auf, und der Verwesungsgestank nahm zu. Doch immer, wenn sie dachte, dass ihr Verfolger sie eingeholt hätte, ließ der Geruch wieder nach.
Und nun stand sie hier am Strand, rang um Atem, klammerte sich wie eine Ertrinkende an den Bruchstücken ihres aufgeklärten Verstands fest, wusste zugleich, dass sie sich getäuscht, dass Brad die Wahrheit gesagt hatte und dass selbst die absurde Geschichte der Insel vor der Küste und der Monster, die angeblich von dort aufs Festland gelangt waren, dass all dies der bitteren Realität entsprach und sie das nächste Opfer werden würde.
So wie Brad, der sich nicht mehr gemeldet hatte, weil er es nicht mehr konnte, weil er nämlich tot war. Tot, tot, tot! Erlegt von dem Ding, das nun hinter ihr her war.
Sie fühlte, wie die Panik in ihr wuchs, und vermochte sich doch nicht dagegen zu wehren.
Ein Ruck ging durch ihre Gestalt. Nein! So durfte es nicht enden!
Von dem dunklen Umriss eines Sandbaggers hundert Meter entfernt löste sich ein Schemen. Etwas schien ihn zu umwehen, vielleicht ein Umhang. Mehr konnte sie im Mondschein nicht erkennen.
Weg! Ich muss hier weg!
Sie drehte sich um und stapfte weiter durch den Sand. Die kurze Atempause hatte sie kaum zu Kräften kommen lassen. Weiterhin fühlten sich ihre Beine schwer wie Blei an.
Wieder hüllte sie der ekelhafte Toter-Fido-Gestank ein. Im nächsten Augenblick zerriss der Stoff ihrer langen Hose mit einem lauten Ratschen. Gleichzeitig durchströmte sie ein Schmerz in der Wade, wie sie ihn vom Arm kannte.
Er ist hier! Direkt hinter mir!
Amitola wirbelte herum, warf die Arme hoch und schrie ihre Wut und Angst in die Nacht hinaus. Doch da war niemand. Auch der Geruch war wieder verschwunden.
Sie begriff. Das Monster spielte mit ihr. Ein grausames Katz-und-Maus-Spiel, an dessen Ende die Maus sterben würde.
»Lass mich zufrieden!«, rief sie. Schluchzend fügte sie an: »Bitte! Ich hab dir doch nichts getan.«
Ihr Blick irrte über den Strand.
Die Dünen! Wieso war sie in ihrer Panik nicht eher darauf gekommen? Vielleicht gelang es ihr dort, den Angreifer abzuschütteln. Es war ihre letzte Chance.
Sie stapfte und taumelte weiter. Schweiß lief ihr über die Stirn und in die Augen, dass es brannte.
An dieser Stelle war der Strand nicht besonders breit, und sie erreichte den Anstieg rasch.
Los, rauf mit dir! Beeil dich!
Doch unter ihren Füßen gab der Sand nach, und mit jedem Meter, den sie schaffte, rutschte sie einen halben zurück.
Das Atmen schmerzte. Die Luft schien keinen Sauerstoff mehr zu spenden. Seitenstechen quälte sie, von dem Brennen im Arm und der Wade ganz abgesehen.
Am liebsten hätte sie sich fallen lassen, auf den Rücken gedreht, den Mond betrachtet und gewartet. Auf den finalen Angriff. Auf das Monster. Auf das Erlöschen der Angst.
Aber sie gab nicht auf! Nicht sie, die Tochter des großen Häuptlings und Geisterverstehers Motega Jones.
Sie erreichte die Spitze der Düne. Ihre Knie zitterten, die Muskeln in den Beinen pochten.
Hastig drehte sie sich um, blickte den Abhang hinab. Von hier oben musste sie ihren Verfolger doch sehen, oder nicht?
Aber da war niemand. Hatte sie es geschafft?
Gerade, als sie sich einen Hauch der Hoffnung erlauben wollte, schwappte der Verwesungsgeruch über sie.
Sie warf sich herum – und da stand er. Ein großer, schwarzer Schatten. Irgendwie hatte er ihr den Weg abgeschnitten.
Ehe sie Einzelheiten erkennen konnte, fuhr ihr eine Klinge in die Hüfte.
Sie schrie auf und brach in die Knie. Kippte vornüber. Rollte die Düne auf der anderen Seite hinunter.
Sand wirbelte auf und drang ihr ihn die Augen.
Endlich blieb sie liegen. Schwer atmend drehte sie sich auf den Rücken.
Hoch mit dir!
Es ging nicht. Alle Kraft war aus ihrem Körper gewichen.
Das Monstrum baute sich vor ihr auf. Durch den Schleier aus Tränen, die den Sand aus den Augen zu spülen versuchten, konnte sie es nur verschwommen sehen.
Aber sie konnte es riechen.
Und hören.
»Ich danke dir für deine Gabe«, sagte es in einer fremden Sprache, die sie dennoch verstand, und klang dabei beinahe freundlich. »Für deine Angst, deine Hoffnung und deine Schreie.«
Nein!, dachte sie. Was auch immer geschieht, meine Schreie wirst du nicht bekommen!
Sie irrte sich. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis sich ihr Vorsatz in Luft auflöste.
Die gebogene Klinge fuhr auf sie nieder. Wieder und wieder. Und sie schrie wie noch nie zuvor in ihrem Leben.
Ihr letzter Gedanke, bevor das Monstrum sie von ihrem irdischen Dasein erlöste, galt Brad und ihrem Vater.
Es tut mir leid. Ich hätte euch glauben sollen.
☆
Rudy Grenville saß auf der mittleren Stufe einer der langen Treppen, die von den Strandhäusern in Kill Devil Hills zum Meer führten, und sah in die Nacht hinaus, wie er es so oft in den letzten Monaten getan hatte.
Der Mond und die Sterne spiegelten sich im Wasser des Atlantiks und übersäten die Wellen mit tanzenden Funken. Ein faszinierendes Schauspiel, für das Rudy dennoch keinen Blick hatte. Ihn interessierte nur die Horizontlinie. Solange er sie sehen konnte, war alles in Ordnung. Denn das bedeutete, dass die Insel Toghan nicht aus ihrer Entrückung neben der Welt zurückgekehrt war.
Noch nicht.
Ihm war klar, dass es sich dabei nur um eine Frage der Zeit handelte. Deshalb hatte er dem FBI-Agenten Abe Douglas und dem Geisterjäger John Sinclair auch versprochen, die Augen offen zu halten.
Es verging kein Tag, an dem Rudy nicht an die schrecklichen Ereignisse des vergangenen Jahres dachte. An die Drengars, die von der Insel gekommen waren – sechsbeinige, wie gehäutet wirkende Hundekreaturen. An die Toten. An den Herrscher von Toghan, den Kroagh agh Toghan, dessen verfälschter Name Croatoan mit Rudys Zutun Eingang in die Geschichts- oder besser: Legendenbücher der USA gefunden hatte. An den Fluch, mit dem ihn diese dämonische Gestalt vor über vierhundert Jahren geschlagen hatte. Den Fluch des ewigen Lebens.
Ein Gutes hatte die Sache aber doch: Seit seiner Begegnung mit dem Croatoan schlummerte ein Funken toghanischer Magie in Rudy, die es ihm ermöglichte, die Ankunft des entrückten Landes lange vor jedem anderen zu bemerken. So blieb ihm hoffentlich im Ernstfall genügend Zeit, Abe oder John zu alarmieren.
Wahrscheinlich würde er dem FBI-Agenten den Vorzug geben, wenngleich Sinclair über die besseren Waffen verfügte. Doch Abe Douglas musste nicht erst von England in die Staaten fliegen. Außerdem hatte er mit ihm in den vergangenen Monaten häufiger in Kontakt gestanden, beispielsweise als das FBI Rudy eine neue Identität verschafft hatte.
Als der alte, verschrobene Sonderling Grenville konnte er schließlich nicht mehr auftreten. Erstens war wegen seines Fluchs ein Polizist ums Leben gekommen, zweitens steckte er nun wieder im Körper eines jungen Mannes. Etwas, das sich den Bewohnern von Kill Devil Hills nur schwer würde erklären lassen.
Sein neuer Name lautete Clark Donaghue. Er arbeitete als selbstständiger Pool-Reiniger. Ein Job, für den er sich deshalb entschieden hatte, weil er als Kunden nur Besitzer von Häusern in Strandnähe annahm, sodass er auch während der Arbeit das Meer stets im Blick behalten konnte.
Wenn er ehrlich zu sich selbst war, hatte der Identitätswechsel wenig gebracht. Die Leute begegneten auch seinem vorgetäuschten Ich mit spürbarer Skepsis. Lag es daran, dass er angeblich neu im Ort war? Oder daran, dass er in seinem ehemaligen Haus wohnte, dem Haus des »alten Sonderlings Grenville«?
Offiziell hatte er es nach dem Tod seines früheren Ichs ersteigert und mit Abes Hilfe gründlich ausgemistet und hergerichtet. Die Zeiten, in denen er inmitten von Gerümpel und – wollen wir die Dinge beim Namen nennen, Rudy, nicht wahr? – Müll lebte, um eventuelle Besucher abzuhalten, gehörten der Vergangenheit an. Trotzdem betrachteten es die Ortsansässigen weiterhin als »die Bruchbude von diesem gruseligen Alten, der den armen Warren Bromfield ermordet hat.«
Das Gedächtnis einer Kleinstadt eben. Unbestechlich, nachtragend, gnadenlos.
Wie oft hatte er seit seiner offiziellen Ankunft aufgeschnappt, was die Leute hinter seinem Rücken tuschelten?
»Hast du gehört?«, sagten sie. »Dieser Neue, Donaghue oder so ähnlich, wohnt in Grenvilles Haus. Ich hab es damals ja nicht selbst miterlebt, aber der Neffe meiner Putzfrau hat mit eigenen Augen gesehen, wie der Alte durchgedreht ist und Bromfield ihn erschießen musste. Und dann – ich weiß, wie unglaublich das klingt – ist Grenville einfach wieder aufgestanden, während Warren wie Wachs geschmolzen ist!«