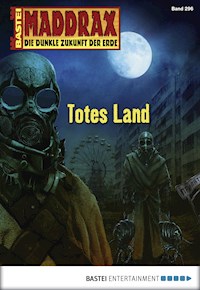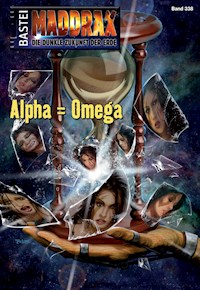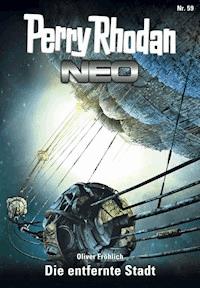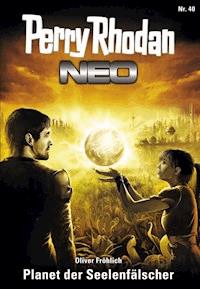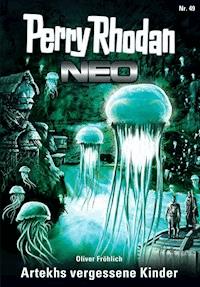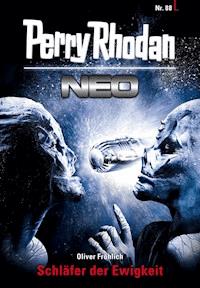Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan-Erstauflage
- Sprache: Deutsch
In der Milchstraße schreibt man das 6. Jahrtausend nach Christus, genauer das Jahr 5658. Das entspricht dem Jahr 2071 NGZ nach der galaxisweit gültigen Zeitrechnung. Über dreitausend Jahre sind vergangen, seit Perry Rhodan die Menschheit zu den Sternen führte und sie seither durch ihre wechselvolle Geschichte begleitet. Noch vor Kurzem wirkte es, als würde sich der alte Traum von Partnerschaft und Frieden aller Völker der Milchstraße und der umliegenden Galaxien endlich erfüllen. Terraner, Arkoniden, Gataser, Haluter, Posbis und all die anderen Sternenvölker stehen gemeinsam für Freiheit und Selbstbestimmtheit ein, womöglich umso stärker, seit ES, die ordnende Superintelligenz dieser kosmischen Region, verschwunden ist. Als die Liga Freier Galaktiker erfährt, dass in unmittelbarer galaktischer Nähe ein sogenannter Chaoporter gestrandet sei, entsendet sie mit der RAS TSCHUBAI das größte Fernraumschiff der Liga, um den Sachverhalt zu klären. Denn es heißt, von FENERIK gehe eine ungeheure Gefahr für die Milchstraße aus. Perry Rhodan leitet als Allianz-Kommissar die Mission, die ihn bis in die Andromeda vorgelagerte Kleingalaxis Cassiopeia führt. Schon früh stößt er auf Hinweise, die das Gerücht bestätigen: FENERIK ist in Cassiopeia und dort auf unterschiedliche Weise höchst aktiv. Unterstützung ist dem Terraner daher hochwillkommen, und alsbald steht er VOR TROJAS TOREN ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 3107
Vor Trojas Toren
Zwischenfall auf Gondophares – ein Diktator greift nach der Macht
Oliver Fröhlich
Cover
Vorspann
Die Hauptpersonen des Romans
1. Die Einsamkeit des Exponats
2. Die Vorsicht der Trojaner
3. Die Verzweiflung des Exponats
4. Die Rückkehr der Trojaner
5. Die Freiheit des Exponats
6. Die Erfahrungen der Trojaner
7. Der Auftrag des Exponats
8. Der Widerstand der Trojaner
9. Das Geheimnis des Exponats
10. Die Gnade der Trojaner
Leserkontaktseite
Glossar
Risszeichnung Ornamentkugelraumer der Gharsen
Impressum
In der Milchstraße schreibt man das 6. Jahrtausend nach Christus, genauer das Jahr 5658. Das entspricht dem Jahr 2071 NGZ nach der galaxisweit gültigen Zeitrechnung. Über dreitausend Jahre sind vergangen, seit Perry Rhodan die Menschheit zu den Sternen führte und sie seither durch ihre wechselvolle Geschichte begleitet. Noch vor Kurzem wirkte es, als würde sich der alte Traum von Partnerschaft und Frieden aller Völker der Milchstraße und der umliegenden Galaxien endlich erfüllen.
Terraner, Arkoniden, Gataser, Haluter, Posbis und all die anderen Sternenvölker stehen gemeinsam für Freiheit und Selbstbestimmtheit ein, womöglich umso stärker, seit ES, die ordnende Superintelligenz dieser kosmischen Region, verschwunden ist.
Als die Liga Freier Galaktiker erfährt, dass in unmittelbarer galaktischer Nähe ein sogenannter Chaoporter gestrandet sei, entsendet sie mit der RAS TSCHUBAI das größte Fernraumschiff der Liga, um den Sachverhalt zu klären. Denn es heißt, von FENERIK gehe eine ungeheure Gefahr für die Milchstraße aus.
Perry Rhodan leitet als Allianz-Kommissar die Mission, die ihn bis in die Andromeda vorgelagerte Kleingalaxis Cassiopeia führt. Schon früh stößt er auf Hinweise, die das Gerücht bestätigen: FENERIK ist in Cassiopeia und dort auf unterschiedliche Weise höchst aktiv. Unterstützung ist dem Terraner daher hochwillkommen, und alsbald steht er VOR TROJAS TOREN ...
Die Hauptpersonen des Romans
Perry Rhodan – Der Terraner muss sich als Freund der Menschen Cassiopeias beweisen.
Harper LeCount – Der Trojaner führt Fremde ins Herz seines Volkes.
Thies Overgaard – Der Trojaner durchlebt einen Albtraum.
Khosen – Der herrliche Diktator beweist seine Macht.
Anesti Mandanda
Du denkst, du könntest nachempfinden, wie es mir ergangen ist?
Du glaubst, du könntest dich
in die Situation hineinversetzen?
In all die Gefühle und
in die Verzweiflung bei dem Gedanken,
dass sich bis an mein Lebensende nichts mehr daran ändern würde?
Glaubst du das wirklich?
Denk besser noch einmal
darüber nach!
(Gespräche mit Gefangenen, Shara Verner)
1.
Die Einsamkeit des Exponats
Immer wieder hörte Thies Overgaard die Stimme seiner Großmutter. Sie erzählte ihm eine Geschichte, wie sie es früher so oft getan hatte. Nur hatten ihm die von damals besser gefallen – die ihrer oder der Phantasie anderer entsprungenen, wundervollen Ausschnitte aus den fiktiven Leben fiktiver Personen, denen Gramma Ellis mit ihrem knarzigen, samtenen Bass echtes Leben einhauchte.
Sogar die überlieferten aus der alten Zeit vor der Gründung des Trojanischen Imperiums, aus einer Epoche, ehe es die Menschheit für möglich gehalten hatte, zu den Sternen zu reisen, hatten ihm mehr Freude bereitet. Märchen, Fabeln und Sagen, die Gramma Ellis von ihrer eigenen Gramma erzählt bekommen hatte, und diese wiederum von ihrer Gramma.
Geschichten, die den kleinen Thies in den Schlaf begleiteten. Welche, die ihn trösteten. Und solche, die ihn etwas über das Leben lehren sollten.
Zumindest war das früher so gewesen. Im Augenblick erzählte die Stimme nur eine einzige Geschichte. Die des Reisenden. Als Kind hatte Overgaard sie geliebt, doch nun wollte er sie nicht mehr hören. Er ertrug sie nicht.
Gramma Ellis war tot. Sie war gestorben, lange bevor aus dem kleinen Thies der erwachsene Thies geworden war. Weit vor den Tagen der Finsternis auf diesem Bruchstück des Imperiums, den er seither Troja-Stigma nannte. Jene Tage hatten aus dem erwachsenen Overgaard einen gebrochenen Overgaard gemacht, ihn mit einem Stigma versehen, tief eingebrannt in seine Seele.
Seit damals wachte er Nacht für Nacht schweißgebadet und mit Atemnot auf. Der Sekundenbruchteil, bis die Positronik das Licht im Schlafzimmer einschaltete, fühlte sich dabei stets an, als wollten ihn die Klauen des Albtraums zurück in die Dunkelheit zerren.
Trotzdem wäre Overgaard im Augenblick lieber wieder auf Troja-Stigma oder, noch besser, in der Finsternis seines Schlafzimmers. Dort müsste er wenigstens nicht die Stimme seiner Großmutter und die immer gleiche Geschichte hören. Und zumindest im Schlafzimmer könnte er sich bewegen.
Selbstverständlich wusste er, dass Gramma Ellis nicht zu ihm sprach. So schlimm stand es nicht um ihn. Noch nicht.
Sein Unterbewusstsein hatte lediglich die Geschichte des Reisenden aus den Tiefen der Erinnerung gekramt, und seitdem geisterte sie ihm als Endlosschleife durch den Kopf. Sie übertönte sogar die monotone Stimme des winzigen, humanoid wirkenden, aber vermutlich maschinellen Wesens, das jenseits des Bernsteingefängnisses schwebte und ihn mit einer schier endlosen Heldensaga über die Frühgeschichte der Gharsen vollplapperte.
Seit wann steckte er in dieser durchscheinenden Hülle fest?
Er wusste es nicht.
Fünf Stunden? Sechs? Oder womöglich einen Tag?
Der Gedanke nahm ihm den Atem und ließ sein Herz schneller schlagen. Er fühlte Schweiß auf der Stirn. Gerne hätte er ihn weggewischt, ehe er ihm in die Augen rann, aber das war unmöglich. Die Kunsthaut, die ihn umgab, gewährte nur minimalen Spielraum.
Er konnte nicht sehen, ob die Schicht tatsächlich seinen gesamten Körper einhüllte. Dazu hätte er den Kopf neigen und an sich hinabschauen müssen. Aber egal, ob er mit den Fingern wackelte, den Beinen zuckte oder die Schultern hob, nach einem, maximal zwei Millimetern stieß er auf ein Hindernis.
Obwohl sein Kerker nahezu durchsichtig war und lediglich einen bernsteinernen Schleier über sein Blickfeld legte, kam sich Overgaard eingesperrt vor. Nun, er war eingesperrt.
Es fühlte sich an, als dränge die Kunsthaut von allen Seiten auf ihn ein und zerquetschte ihn. Ohne dass er sich dagegen wehren konnte, reagierte sein Körper auf die dümmste vorstellbare Art: einem Fluchtreflex. Die Muskeln in den Beinen und im Rücken spannten sich an, bereit loszuschnellen und Overgaard rennen zu lassen, so schnell es ging, weg, bloß weg, irgendwohin in Sicherheit. Nur würde das nicht geschehen können, und allein das Wissen darum ließ die Muskeln noch mehr verkrampfen.
Reiß dich zusammen!, ermahnte er sich. Niemandem war damit geholfen, wenn er in Panik geriet. Am allerwenigsten ihm selbst.
Ein kluger Ratschlag. Jemand, der Troja-Stigma nicht erlebt hatte, mochte ihn befolgen können. Ihm gelang es nicht.
Die hauchdünne Schicht der Eingewöhnung und des Sich-Abfindens, die sich um seinen Geist gelegt hatte, barst. Vielleicht ließ auch die Medikation nach, mit der ihn sein Gefängnis offenbar ruhigzustellen versuchte.
Mit einem Mal fühlte er sich wie vor fünf oder sechs Stunden – oder vor einem Tag? –, als er zum ersten Mal aus der Bewusstlosigkeit erwacht war.
Sein Atem ging schnell und flach. Er glaubte, ersticken zu müssen, wollte um sich schlagen, schreien, wollte raus aus seinem Gefängnis.
Thies Overgaard schloss die Augen, zwang sich, alles auszublenden und sich stattdessen auf die Luft zu konzentrieren, die in seine Lungen und wieder hinaus strömte. Einatmenausatmeneinatmenausatmen.
Komm schon! Das kannst du besser.
Er dachte an die Techniken, die ihm seine Therapeutin beigebracht hatte.
Einatmen ausatmen einatmen.
Allmählich wurde er ruhiger. Zumindest ein bisschen.
Einatmen, ausatmen.
Ein – aus. Ein – aus.
Die Spannung der Muskeln ließ nach.
Overgaard versuchte, nicht daran zu denken, dass dieser Zustand nicht lange anhalten würde. Dafür sorgte zweifellos bald sein hinterhältiges Gedächtnis, das ihn weiter in Endlosschleife mit der Stimme von Gramma Ellis und der Geschichte des Reisenden quälte, die ihn so sehr an seine eigene erinnerte.
... doch das Schiff geriet in einen Sturm, und das Ruderboot, in dem sich Gulliver zu retten versuchte, kenterte. Mit letzter Kraft kämpfte er sich durch die aufgepeitschte See und erreichte den Strand, wo er erschöpft einschlief. Aber, o weh, als er wieder erwachte, ...
Sei still, Gramma! Ich will das nicht hören!
... als er wieder erwachte, fand er sich mit Schnüren an Armen, Beinen und Haaren an den Boden gefesselt und zu keiner Bewegung fähig.
Sei still! Bitte!
Die winzigen Wesen aus dem Volk der Liputensier, die ihn gefangen hielten, gaben ihm zu essen und zu trinken. Aber befreien, mein kleiner Thies, befreien mochten sie ihn nicht. Stattdessen erfreuten sie sich an ihrem wertvollen Fundstück, betrachteten es mit vielen Ahs und Ohs, kletterten auf ihm herum. Gewiss, sie kümmerten sich um ihn, führten zu seiner Zerstreuung Theaterstücke auf, doch wie es ihm tief in seinem Inneren ging, schien sie nicht zu interessieren.
Overgaard öffnete die Augen. Erneut fiel sein Blick auf das vielleicht 30 Zentimeter große Maschinenwesen, das vor ihm schwebte und gerade die Sage von Thopsan, dem Galeristen, vortrug. Nach Überwindung der ersten sprachlichen Hürden hatte sich die Maschine als Dhoshaphard vorgestellt. Ob das ein Eigenname oder eine Tätigkeitsbezeichnung war, wusste Overgaard nicht. Es interessierte ihn auch nicht. Er sah in der Maschine seinen eigenen, privaten Liputensier, der ihm zur Zerstreuung ein Schauspiel darbot.
Das Schlimme an Grammas Geschichte war, dass sich Overgaard nicht mehr an das Ende erinnern konnte. Hatte sich Gulliver schließlich befreit und war entkommen? Oder war er gezwungen gewesen, bis an sein Lebensende die Qualen zu ertragen, von denen sich seine Kerkermeister nicht einmal bewusst waren, dass sie sie ihm zufügten?
Welche Rolle spielt es, was aus dem Kerl in einer uralten Erzählung geworden ist? Meinst du, nur weil es Ähnlichkeiten gibt, müsste deine Geschichte genauso enden? Du bist hier nicht in Liputanien, sondern in ...
Ja, wo eigentlich?
Er war sich nicht sicher. Der Schock nach dem ersten Erwachen und die Erkenntnis, bewegungslos gefangen zu sein – wieder einmal! –, hatten seinem Gedächtnis geschadet.
Die Erinnerung an das Davor, an die letzten Ereignisse vor dem Erwachen, verschwammen in dichtem Nebel.
Sein Schiff, die ROMEO CHO, war unter dem Kommando von Major Harper LeCount auf dem Planeten Fajem gelandet, das wusste Thies Overgaard noch. Eine dumme Idee, denn nur kurz danach hatte das Volk der Gharsen, von dem Overgaard nie zuvor gehört hatte, kurzerhand die Errichtung einer Diktatur über Fajem erklärt und ein striktes Startverbot für sämtliche Raumschiffe ausgesprochen. Oberhaupt der Gharsen war ein Kerl namens ...
... namens ...
... Khosen! Ja, so hieß er.
Er bezeichnete sich selbst als »herrlichen Diktator«, obwohl nach Overgaards Auffassung die Bezeichnung »selbstherrlich« besser gepasst hätte.
Was Major LeCount dazu veranlasst hatte, sich dem Verbot zu widersetzen, wusste Overgaard nicht mehr. Falls er es je gewusst hatte. Vielleicht ließ sich der Kommandant von einem Wildfremden nicht gerne Befehle erteilen. Vielleicht hatte er gefürchtet, die Gharsen könnten das Trojanische Imperium finden und ihm schaden, wenn sie auf die ROMEO CHO aufmerksam wurden. Aus welchem Grund auch immer, LeCount hatte den Start angeordnet. Und die Gharsen damit erst recht auf das Schiff aufmerksam gemacht.
Kurz nach der Flucht, da ...
An dieser Stelle setzte der Nebel ein. Overgaard erinnerte sich nur noch an Schreie der Besatzung, Schmerzen, Verwirrung, Schmerzen, Chaos und Schmerzen. Als endlich die Ohnmacht ihre Finger nach ihm ausstreckte, ergab er sich dankbar in ihren Griff.
Aufgewacht war er ohne Schmerzen, doch leider auch ohne Orientierung und Bewegungsfreiheit.
Vier oder fünf Panikanfälle und genauso viele medikamentös induzierte Ruhephasen später wusste er nicht wesentlich mehr. Er starrte in einen weiten Raum oder eine Halle von unbestimmter Höhe. Die Decke lag oberhalb des Sichtbereichs, den er nur mit Augenbewegungen absuchen konnte. Gelegentlich schwebten Gegenstände verschiedenster Art an ihm vorbei: Hiebwaffen mit langen Dornen und knorrigen Griffen, reich verzierte Schalen, ein grün glänzender Raumanzug von fremdartiger Fertigung, aber auch nicht identifizierbare Dinge aus Metall, Holz, Stein und sonstigen Materialien, bei denen es sich genauso gut um Werkzeuge wie um Waffen oder Artefakte handeln konnte.
Ein Museum!, wurde ihm zum ersten Mal klar. Du bist ein Ausstellungsstück in einer bizarren Art von Museum!
In einigen Metern Entfernung stand die Skulptur eines humanoiden Wesens auf einem Sockel, die ihm zuvor nicht aufgefallen war, vermutlich weil er bisher vorwiegend mit seinen inneren Befindlichkeiten beschäftigt gewesen war und nicht über den Sagen vorlesenden Liputensier hinausgeblickt hatte. Die Statue war außerordentlich lebensecht geformt, von den Falten der Kleidung über die Struktur der Haut an den Händen bis hin zum Gesicht, das die Züge von ...
Die Wahrheit sickerte nur langsam in sein Bewusstsein ein.
Illustration: Swen Papenbrock
Die Skulptur trug nicht bloß die Züge von Shara Verner, einem Besatzungsmitglied der ROMEO CHO. Die Skulptur war Shara Verner, wie er gefangen in einer beinahe hautengen Hülle.
Sie sah zu ihm herüber, blickte ihm direkt in die Augen, lächelte ein wenig. Doch das Lächeln wirkte traurig, verzweifelt und voller Schmerz. Ihre Lippen bewegten sich, als spräche sie, aber Overgaard hörte ihre Worte nicht.
In diesem Augenblick trat jemand zwischen ihn und Shara, gut drei Meter groß mit für menschliche Begriffe überdimensioniert langen Beinen. In einer der sechsfingrigen Hände lag eine Apparatur, ein Kästchen, womöglich eine Steuerung. Ein Finger huschte darüber, und der Neuankömmling glitt in die Tiefe.
Eine perspektivische Täuschung, begriff Thies Overgaard. Nicht der Neuankömmling sank herab, sondern er selbst stieg in die Höhe, bis er in das Gesicht des Wesens sehen konnte. Aus einem spitz nach hinten verlaufenden ovalen Kopf mit silbrig-blauem Fell starrten ihm zwei große, blaue Augen entgegen. Der Mund war nach vorne gestülpt und wies leichte Trichterform auf.
Ein Gharse. Aber nicht irgendeiner, sondern der, der ihn ...
Der Nebel in Overgaards Gedächtnis riss ein wenig auf. Er erinnerte sich, dass er zwischen dem Angriff auf die ROMEO CHO und dem ersten Erwachen in diesem Museum nicht ununterbrochen ohnmächtig gewesen war. Gelegentlich war er in einen Zustand schläfriger Benommenheit gewechselt, weiterhin gelähmt, aber mit schmerzenden Gliedern wie bei einem fürchterlichen Muskelkater.
Bilder und Töne trudelten durch seinen Geist, fanden sich zusammen, formten sich zu einer Erinnerung: ein Gharse, der sich über ihn beugte, eine Hand nach ihm ausstreckte, ihm mit dem Finger über die Stirn strich, wie er fünf oder sechs Stunden – oder einen Tag? – später über die kästchenförmige Steuerung streichen würde, ihm in die Wange kniff und sagte: »Ich beanspruche dieses hier.«
Vor Overgaard stand der Gharse, der ihn gefangen genommen hatte. Oder gejagt? Erbeutet?
Er fühlte Hitze in sich aufkochen. Für einen Augenblick glaubte er, dass die Gefängnishaut unter seinem Atem und der Wut, die aus den Poren seines Körpers sickerte, beschlug und ihm die Sicht raubte, doch dann bemerkte er, dass es Tränen waren, die ihm den Blick verschleierten.
Wie gerne hätte er dieser Kreatur seinen Hass entgegengeschleudert, sie beleidigt und beschimpft, einfach nur um Dampf abzulassen und dieses fürchterliche Gefühl loszuwerden, innerhalb der Kunsthaut vor Verzweiflung zu platzen.
»Wo bin ich?«, fragte er stattdessen. Overgaard hatte einen langen, schmerzhaften Weg seit Troja-Stigma beschreiten müssen, aber wenn er auf diesem Weg eines gelernt hatte, dann, dass es nur selten half, seine Emotionen explosionsartig zu entladen. Egal, wie befreiend es sich anfühlen mochte. »Warum tut ihr uns das an?«
Die Worte kamen nuschelig aus seinem Mund. Wie es sich eben anhörte, wenn man mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt war und beim Sprechen den Unterkiefer nur um einen Millimeter bewegen konnte, ehe er an die Grenze des Kerkers stieß.
»Erspar dir die Mühe, mit mir reden zu wollen«, sagte der Gharse. »Das Dhosdru lässt keinen Laut von innen nach außen, solange ich es nicht gestatte. Und weshalb sollte ich mich mit den Nichtigkeiten befassen, die du von dir gibst?«
Overgaard wusste nicht, ob der Gharse seine Sprache sprach, ob er einen Translator benutzte oder ob gar die ihn umgebende Hülle übersetzte. Das Dhosdru, wie sein Kerkermeister es genannt hatte.
»Was willst du von mir?«, brachte er hervor. Sicher, der Gharse hörte ihn nicht, dennoch konnte er es sich nicht verkneifen.
»Es dürfte für dich nicht von Bedeutung sein«, fuhr das Wesen jenseits des Dhosdru fort, »aber die Höflichkeit gebietet es, dass ich mich dir vorstelle. Mein Name lautet Mhassrod. Ich bin dein Besitzer.«
Besitzer? Der Begriff hallte mit der Gewalt eines Glockenschlags durch Overgaards Bewusstsein. Seine Knie wurden weich, und vielleicht wäre er in sich zusammengesackt, hätte ihn die künstliche Haut nicht in seiner Position festgehalten.
»Ich bin enttäuscht von dir«, sagte Mhassrod. »Selbstverständlich weiß ich, dass Exponate häufig eine gewisse Zeit der Eingewöhnung brauchen, ehe sie eine Zierde für die Galerie darstellen. Du jedoch bist eine Schande! Warum nur habe ich mir ausgerechnet dich ausgesucht?«
Etwas zerbrach in Overgaard. Wut und Hass auf den Gharsen waren wie weggeblasen, stattdessen fühlte er sich ... schuldig? Plötzlich wünschte er sich nichts dringender, als seinem Besitzer zu gefallen. Dann käme der vielleicht gelegentlich vorbei, betrachtete ihn, spräche zu ihm und, ja, öffnete auf diese Art ein winziges Tor nach draußen.
Als sich Overgaard dieser Gedanken bewusst wurde, kehrten Hass und Wut zurück, doch diesmal richteten sie sich gegen ihn selbst. Wie konnte er sich nur so erniedrigen?
»Warum?«, flüsterte er. Die Tränen, die sich während der letzten Minuten in seinen Augen gesammelt hatten, liefen über und perlten ihm an den Wangen hinab. »Warum bin ich eine Schande?«
»Die Medikamente, die das Dhosdru bisher auf dich verwenden musste«, sagte Mhassrod, als würde er Overgaards Frage beantworten, »haben meine letzten fünf lebenden Exponate zusammen nicht verbraucht. Die halbe Besatzung der KUPFER & GRANIT verspottet mich deswegen. Ich weiß nicht, welche Lebenserwartung Exponate deiner Spezies haben, aber diesen Aufwand kann ich unmöglich bis zu deinem natürlichen Tod ...«
Der Rest des Satzes schwamm bedeutungslos an Overgaard vorbei, denn die letzten Worte übertönten alles, was danach noch kam.
Bis zu deinem natürlichen Tod.
So lange wollten sie ihn in dieser Hülle eingeschlossen lassen? Nein, das konnten die Gharsen nicht machen. Das durften sie nicht!
Sein Magen zog sich zusammen. Das Herz setzte einen Augenblick aus und raste danach umso schneller. Die Muskulatur im Rücken verspannte sich.
»Nein!«, schrie er. »Nein! Nein! Nein!«
Er wollte um sich schlagen, prallte aber sofort gegen die Gefängnishaut, woraufhin sich die Muskulatur noch mehr verspannte.
»Geht das schon wieder los!«, sagte Mhassrod. »Was soll ich nur mit dir machen?«
Overgaard hätte durchaus eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung vorschlagen können.
Lass mich frei!
Doch ehe sich die Worte formten, fühlte er ein Kribbeln im Nacken. Ein Geruch nach Kampfer und Alkohol kroch zwischen ihm und dem Dhosdru entlang und drang ihm in die Nase.
Ich bekomme meine Medizin, dachte er noch, dann schwanden ihm die Sinne.
Das Schlimmste war das irrationale
Gefühl, ersticken zu müssen.
Versteht mich nicht falsch, die
Sauerstoffversorgung im Dhosdru war
ausgezeichnet, vermutlich auf unsere
Organismen abgestimmt.
Aber allein das Wissen, dass sich die
Schauhaut nur um eine Winzigkeit
zusammenzuziehen brauchte,
um mir die Luft zu rauben, reichte aus,
mich in Panik zu versetzen.
(Gespräche mit Gefangenen, Hadrion Kurn)
2.
Die Vorsicht der Trojaner
In der Zentrale der BJO BREISKOLL lag eine spürbare Anspannung.
Dann trat der OXTORNE-Kreuzer am 6. Juli 2071 NGZ aus dem Linearraum. Am Tag zuvor hatte Volascou Rosman, Besatzungsmitglied der ROMEO CHO, von der Geschichte des Trojanischen Imperiums berichtet – und nun sahen die Galaktiker den Gegenstand der Erzählung zum ersten Mal mit eigenen Augen, wenn auch nur im Panoramaholo.