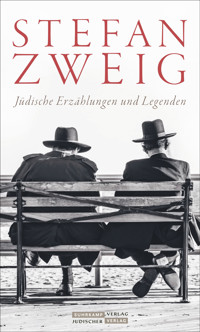
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jüdischer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stefan Zweig ist einer der erfolgreichsten Autoren deutscher Sprache. Berühmt wurde er durch seine romanhaften Biografien, aber sein Werk zeichnet sich besonders durch eine Vielzahl an Novellen aus, die bekannteste ist wohl die Schachnovelle, sein letztes Werk, die posthum 1942 in Brasilien erschien.
Auch wenn Zweigs jüdische Herkunft in seinen Werken keine prominente Rolle spielt, und er den jüdischen Kontext in seinen Werken nie besonders herausgestellt hat, darf dessen Bedeutung für Zweigs Schaffen nicht unterschätzt werden. In den sechs hier versammelten Novellen und Legenden »Im Schnee«, »Die Wunder des Lebens«, »Untergang eines Herzens«, »Rahel rechtet mit Gott«, »Buchmendel« und »Der begrabene Leuchter« gelingt es Zweig, die jüdische Thematik immer wieder subtil aufscheinen zu lassen.
Die Texte stammen aus den Jahren 1901 bis 1936 und sind teils als eigenständige Publikationen, teils in Sammelbänden erschienen. In dieser Form werden sie hier erstmals gemeinsam veröffentlicht.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Stefan Zweig
Jüdische Erzählungen und Legenden
Herausgegeben von Stefan Litt
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Jüdischer Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2022.
© Jüdischer Verlag GmbH, Berlin 2022
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagfoto: Dave Wall / plainpicture
eISBN 978-3-633-77317-6
www.suhrkamp.de
Jüdische Erzählungen und Legenden
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Im Schnee
Die Wunder des Lebens
Untergang eines Herzens
Rahel rechtet mit Gott
Buchmendel
Der begrabene Leuchter
Nachwort des Herausgebers
Weiterführende Literatur
Fußnoten
Informationen zum Buch
Im Schnee
Eine kleine deutsche Stadt aus dem Mittelalter, hart an der Grenze von Polen zu, mit der vierschrötigen Behäbigkeit, wie sie die Baulichkeiten des vierzehnten Jahrhunderts in sich tragen. Das farbige, bewegliche Bild, das sonst die Stadt bietet, ist zu einem einzigen Eindrucke herabgestimmt, zu einem blendenden, schimmernden Weiß, das hoch über den breiten Stadtmauern liegt und auch auf den Spitzen der Türme lastet, um die schon die Nacht die matten Nebelschleier gezogen hat.
Es dunkelt rasch. Das laute, wirre Straßentreiben, die Tätigkeit vieler schaffender Menschen dämpft sich zu einem verrinnenden, wie aus weiter Ferne klingenden Geräusche, das nur der monotone Sang der Abendglocken in rhythmischen Absätzen durchbricht. Der Feierabend tritt seine Herrschaft an über die abgemüdeten, schlafersehnenden Handwerker, die Lichter werden immer vereinzelter und spärlicher, um dann ganz zu verschwinden. Die Stadt liegt wie ein einziges, mächtiges Wesen im tiefen Schlafe.
Jeder Laut ist gestorben, auch die zitternde Stimme des Heidewindes ist in einem linden Schlafliede ausgeklungen; man hört das leise Lispeln der stäubenden Schneeflocken, wenn ihre Wanderung ein Ziel gefunden …
Plötzlich wird ein leiser Schall vernehmbar.
Es ist wie ein ferner, eiliger Hufschlag, der näher kommt. Der erstaunte schaftrunkene Wächter der Tore geht überrascht ans Fenster, um hinauszuhorchen. Und wirklich nähert sich ein Reiter in vollem Galopp, lenkt gerade auf die Pforte zu, und eine Minute später fordert eine rauhe, durch die Kälte eingerostete Stimme Einlass. Das Tor wird geöffnet, ein Mann tritt ein, der ein dampfendes Pferd zur Seite führt, das er sogleich dem Pförtner übergibt; und seine Bedenken beschwichtigt er rasch durch wenige Worte und eine größere Geldsumme, dann eilt er mit hastigen Schritten, die durch ihre Sicherheit die Bekanntschaft mit der Lokalität verraten, über den vereinsamten weißschimmernden Marktplatz hinweg, durch stille Gassen und verschneite Wege, dem entgegengesetzten Ende des Städtchens zu.
Dort stehen einige kleine Häuser, knapp aneinander gedrängt, gleichsam als ob sie der gegenseitigen Stütze bedürften. Alle sind sie schmucklos, unauffällig, verraucht und schief, und alle stehen sie in ewiger Lautlosigkeit in den verborgenen Gassen. Es ist, als hätten sie nie eine frohe, in Lust überschäumende Festlichkeit gekannt, als hätte nie eine jubelnde Freude diese erblindeten, versteckten Fenster erbeben gemacht, nie ein leuchtender Sonnenschein sein schimmerndes Gold in den Scheiben gespiegelt. Einsam, wie verschüchterte Kinder, die sich vor den anderen fürchten, drücken sie sich zusammen in dem engen Komplexe der Judenstadt.
Vor einem dieser Häuser, dem größten und verhältnismäßig ansehnlichsten, macht der Fremde halt. Es gehört dem Reichsten der kleinen Gemeinde und dient zugleich als Synagoge.
Aus den Ritzen der vorgeschobenen Vorhänge dringt ein heller Lichtschimmer und aus dem erleuchteten Gemache klingen Stimmen im religiösen Gesang. Es ist das Chanukkafest, das friedlich begangen wird, das Fest des Jubels und des errungenen Sieges der Makkabäer, ein Tag, der das vertriebene, schicksalsgeknechtete Volk an seine einstige Kraftfülle erinnert, einer der wenigen freudigen Tage, die ihnen das Gesetz und das Leben gewährt hat. Aber die Gesänge klingen wehmütig und sehnsuchtsvoll, und das blanke Metall der Stimmen ist rostig durch die Tausend vergossenen Tränen; wie ein hoffnungsloses Klagelied tönt der Sang auf die einsame Gasse und verweht …
Der Fremde bleibt einige Zeit untätig vor dem Hause, in Gedanken und Träume verloren, und schwere, quellende Tränen schluchzen aus seiner Kehle, die unwillkürlich die uralten heiligen Melodien mitsingt, die tief aus seinem Herzen emporfließen. Seine Seele ist voll tiefer Andacht.
Dann rafft er sich auf. Mit zögernden Schritten geht er auf das verschlossene Tor zu, und der Türklopfer fällt mit wuchtigem Schlage auf die Türe nieder, die dumpf erzittert.
Und das Erzittern vibriert durch das ganze Gebäude fort …
Augenblicklich verstummt von oben der Gesang, wie auf ein gegebenes, verabredetes Zeichen. Alle sind blass geworden und sehen sich mit verstörtem Blick an. Mit einemmale ist die Feststimmung verflogen, die Träume von der siegenden Kraft eines Juda Makkabi, dem sie im Geiste alle begeistert zur Seite standen, sind versunken, das glänzende Reich der Juden, das vor ihren Augen war, ist dahin, sie sind wieder arme, zitternde, hilflose Juden. Die Wirklichkeit ist wieder auferstanden.
Furchtbare Stille. Der bebenden Hand des Vorbetenden ist das Gebetbuch entsunken, keinem gehorchen die bleichen Lippen. Eine entsetzliche Beklemmung hat sich im Zimmer erhoben und hält alle Kehlen mit eiserner Faust umkrampft. –
Sie wissen wohl, warum.
Ein furchtbares Wort war zu ihnen gedrungen, ein neues, unerhörtes Wort, dessen blutige Bedeutung sie an ihrem eigenen Volke fühlen mussten. Die Flagellanten[1] waren in Deutschland erschienen, die wilden gotteseifrigen Männer, die in korybantischer[2] Lust und Verzückung ihren eigenen Leib mit Geißelhieben zerfleischten, trunkene, wahnsinnswütende Scharen, die Tausende von Juden hingeschlachtet und gemartert hatten, die ihnen ihr heiligstes Palladium, den alten Glauben der Väter gewaltsam entreißen wollten. Und das war ihre schwerste Furcht. – Gestoßen, geschlagen, beraubt zu werden, Sklaven zu sein, alles hatten sie hingenommen mit einer blinden, fatalistischen Geduld; Überfälle in später Nacht mit Brand und Plünderung hatte jeder erlebt und immer wieder lief ein Schauder durch ihre Glieder, wenn sie solcher Zeiten gedachten.
Und vor einigen Tagen war erst das Gerücht gekommen, auch gegen ihr Land, das bisher die Geißler nur dem Namen nach gekannt, sei eine Schar aufgebrochen und sollte nicht mehr ferne sein. Vielleicht waren sie schon hier?
Ein furchtbarer Schrecken, der den Herzschlag hemmte, hat jeden erfasst. Sie sehen schon wieder die blutgierigen Scharen mit den weinberauschten Gesichtern mit wilden Schritten in die Häuser stürmen, lodernde Fackeln in der Hand, in ihren Ohren klingt schon der erstickte Hilferuf ihrer Frauen, die die wilde Lust der Mörder büßen, sie fühlen schon die blitzenden Waffen. Alles ist wie ein Traum, so deutlich und lebendig. –
Der Fremde horcht hinauf, und als ihm kein Einlass gewährt wird, wiederholt er den Schlag, der wiederum dumpf und dröhnend durch das verstummte, verstörte Haus zittert. –
Inzwischen hat der Herr des Hauses, der Vorbeter, dem der weiß herabwallende Bart und das hohe Alter das Ansehen eines Patriarchen gibt, als erster ein wenig Fassung gewonnen. Mit leiser Stimme murmelt er: »Wie Gott will.« Und dann beugt er sich zu seiner Enkelin hin, einem schönen Mädchen, das in ihrer Angst an ein Reh erinnert, welches sich mit flehenden großen Augen dem Verfolger entgegenwendet: »Sieh hinaus, wer es ist, Lea!«
Das Mädchen, auf dessen Miene sich die Blicke aller konzentrieren, geht mit scheuen Schritten zum Fenster hin, wo sie den Vorhang mit zitternden, blassen Fingern hinwegschiebt. Und dann ein Ruf, der aus tiefster Seele kommt: »Gottlob, ein einzelner Mann.«
»Gott sei gelobt«, klingt es wie ein Seufzer der Erleichterung, von allen Seiten wieder. Und nun kommt auch Bewegung in die starren Gestalten, auf denen der furchtbare Alp gelastet hat, einzelne Gruppen bilden sich, die teils in stummem Gebete stehen, andere besprechen von Angst und Ungewissheit die unerwartete Ankunft des Fremden, der jetzt zum Tore eingelassen wird.
Das ganze Zimmer ist von einem schwülen, drückenden Duft von Scheiten und der Anwesenheit so vieler Menschen erfüllt, die alle um den reichbedeckten Festtisch versammelt gewesen waren, auf dem das Wahrzeichen und Symbol des heiligen Abends, der siebenarmige Leuchter,[3] steht, dessen einzelne Kerzen matt durch den schwelenden Dunst brennen. Die Frauen sind in reichen, schmuckbesetzten Gewändern, die Männer in den wallenden Kleidern mit weißen Gebetbinden angetan. Und das enge Gemach ist von einer tiefen Feierlichkeit durchweht, wie sie nur die echte Frömmigkeit zu verleihen vermag.
Nun kommen schon die raschen Schritte des Fremden die Treppe herauf, und jetzt tritt er ein.
Zugleich dringt ein fürchterlicher, scharfer Windstoß in das warme Gemach, den das geöffnete Tor hereinleitet. Und eisige Kälte strömt mit der Schneeluft herein und umfröstelt alle. Der Zugwind löscht die flackernden Kerzen am Leuchter, nur eine zuckt noch ersterbend hin und her. Plötzlich ist dadurch das Zimmer in ein schweres, ungemütliches Dämmerlicht gehüllt, es ist, als ob sich jäh eine kalte Nacht von den Wänden herabsenken möchte. Mit einem Schlage ist das Behagliche, Friedliche verflogen, jeder fühlt die üble Vorbedeutung, die in dem Verlöschen der heiligen Kerzen liegt, und der Aberglaube macht sie wieder von neuem erschaudern. Aber keiner wagt ein Wort zu sprechen. –
An der Türe steht ein hochgewachsener, schwarzbärtiger Mann, der kaum älter sein dürfte als dreißig Jahre, und entledigt sich rasch der Tücher und Decken, mit denen er sich gegen die Kälte vermummt hatte. Und im Augenblicke, wo seine Züge im Dämmerschein der kleinen, flackernden letzten Kerzenflamme sichtbar werden, eilt Lea auf ihn zu und umfängt ihn.
Es ist Josua, ihr Bräutigam aus der benachbarten Stadt.
Auch die andern drängen sich lebhaft um ihn herum und begrüßen ihn freudig, um aber bald zu verstummen, denn er wehrt seine Braut mit ernster, trauriger Miene ab, und ein schweres sorgenvolles Wissen hat breite Furchen in seine Stirn gegraben. Alle Blicke sind ängstlich auf ihn gerichtet, der seine Worte gegen die strömende Flut seiner Empfindungen nicht verteidigen kann. Er fasst die Hände der Zunächststehenden, und leise entringt sich das schwere Geheimnis seinen Lippen:
»Die Flagellanten sind da!«
Die Blicke, die sich auf ihn fragend gerichtet haben, sind erstarrt, und er fühlt, wie die Pulse der Hände, die er hält, plötzlich stocken. Mit zitternden Händen hält sich der Vorbeter an dem schweren Tische an, dass die Krystalle der Gläser leise zu singen beginnen und zitternde Töne entschwingen. Wieder hält die Angst die verzagten Herzen umkrallt und presst den letzten Blutstropfen aus den erschreckten, verwüsteten Gesichtern, die auf den Boten starren.
Die letzte Kerze flackert noch einmal und verlöscht …
Nur die Ampel beleuchtet noch matt die verstörten, vernichteten Menschen, die das Wort wie ein Blitzstrahl getroffen hat.
Eine Stimme murmelt leise das schicksalsgewohnte, resignierte »Gott hat es gewollt!«.
Aber die übrigen sind noch fassungslos.
Doch der Fremde spricht weiter, abgerissen, heftig, als ob er selbst seine Worte nicht hören wollte.
»Sie kommen – viele – Hunderte. – Und vieles Volk mit ihnen. – Blut klebt an ihren Händen – sie haben gemordet, tausende – alle von uns, im Osten. – Sie waren schon in meiner Stadt …«
Ein furchtbarer Schrei einer Frauenstimme, dessen Kraft die herabstürzenden Tränen nicht mildern können, unterbricht ihn. Ein Weib, noch jung, erst kurz verheiratet, stürzt vor ihn hin.
»Sie sind dort?! – Und meine Eltern, meine Geschwister? Ist ihnen ein Leid geschehen?«
Er beugt sich zu ihr nieder und seine Stimme schluchzt, wie er leise zu ihr sagt, dass es wie eine Tröstung klingt:
»Sie kennen kein menschliches Leid mehr.«
Und wieder ist es still geworden, ganz still … Das furchtbare Gespenst der Todesfurcht steht unter ihnen und macht sie erzittern … Es ist keiner von ihnen, der nicht dort in der Stadt einen lieben Toten gehabt hätte.
Und da beginnt der Vorbeter, dem Tränen in den silbernen Bart hinabrinnen und dem die spröde Stimme nicht gehorchen will, mit abgerissenen Worten das uralte, feierliche Totengebet[4] zu singen. Und alle stimmen ein. Sie wissen es selbst nicht, dass sie singen, sie wissen nicht von Wort und Melodie, die sie mechanisch nachsprechen, jeder denkt nur an seine Lieben. Und immer mächtiger wird der Gesang, immer tiefer die Atemzüge, immer mühsamer das Zurückdrängen der emporquellenden Gefühle, immer verworrener die Worte, und schließlich schluchzen alle in wildem, fassungslosen Leid. Ein unendlicher Schmerz hat sie alle brüderlich umfangen, für den es keine Worte mehr gibt.
Tiefe Stille …
Nur ab und zu ein tiefes Schluchzen, das sich nicht unterdrücken lassen will …
Und dann wieder die schwere, betäubende Stimme des Erzählenden:
»Sie ruhen alle bei Gott. Keiner ist ihnen entkommen. Ich allein entfloh durch Gottes Fügung …«
»Sein Name sei gelobt«, murmelt der ganze Kreis in instinktivem Frömmigkeitsgefühl. Wie eine abgebrauchte Formel klingen die Worte aus dem Munde der gebrochenen zitternden Menschen.
»Ich kam spät in die Stadt, von einer Reise zurück; die Judenstadt war schon erfüllt von den Plünderern … Man erkannte mich nicht, ich hätte flüchten können – aber es trieb mich hin, unwillkürlich an meinen Platz, zu meinem Volke, mitten unter sie, die unter den geschwungenen Fäusten fielen. Plötzlich reitet einer auf mich zu, schlägt aus nach mir – er fehlt und schwankt im Sattel. Und da plötzlich fasst mich der Trieb zum Leben – eine Leidenschaft gibt mir Kraft und Mut, ich reiße ihn vom Pferde und stürme selbst auf seinem Ross in die Weite, in die dunkle Nacht, zu euch her; einen Tag und eine Nacht bin ich geritten.«
Er hält einen Augenblick inne. Dann sagt er mit festerer Stimme: »Genug jetzt von dem allen! Zunächst was tun?«
Und von allen Seiten die Antwort:
»Flucht!« – »Wir müssen fliehen!« – »Nach Polen hinüber!«
Es ist das einzige Hilfsmittel, das alle wissen, die abgebrauchte, schmähliche und doch unersetzliche Kampfesart des Schwächeren gegen den Starken. An Widerstand denkt keiner. Ein Jude sollte kämpfen oder sich verteidigen? Das ist in ihren Augen etwas Lächerliches und Undenkbares, sie leben nicht mehr in der Zeit der Makkabäer, es sind wieder die Tage der Knechtschaft, der Ägypter gekommen, die dem Volke den ewigen Stempel der Schwäche und Dienstbarkeit aufgedrückt haben, den nicht Jahrhunderte mit den Fluten der Jahre verwaschen können.
Also Flucht!
Einer hatte die schüchterne Ansicht geltend machen wollen, man möge den Schutz der Bürger in Anspruch nehmen, aber ein verächtliches Lächeln war die Antwort gewesen. Ihr Schicksal hatte die Geknechteten immer wieder zu sich selbst und zu ihrem Gotte zurückgeführt. Ein Vertrauen auf einen dritten kannten sie nicht mehr.
Man besprach nun alle näheren Umstände. Alle diese Männer, die immer so sehr darauf aus gewesen waren, Geld zusammen zu scharren, stimmten jetzt überein, dass man kein Opfer scheuen müsste, um die Flucht zu beschleunigen. Jedes Besitztum mußte zu barem Gelde gemacht werden, wenn auch unter den ungünstigsten Umständen, Wagen waren zu beschaffen, Gespann und das Notdürftigste zum Schutze gegen die Kälte. Mit einem Schlage hatte die Todesfurcht ihre Ghetto-Eigenschaft verwischt, ebenso wie sie die einzelnen Charaktere zu einem einzigen Willen zusammen geschmiedet. In allen den bleichen, abgemüdeten Gesichtern arbeiteten die Gedanken einem Ziele zu.
Und als der Morgen seine lohenden Fackeln entflammte, da war schon alles beraten und beschlossen. Mit der Beweglichkeit ihres Volkes, das die Welt durchwandert hatte, fügten sie sich dem schweren Banne der Situation, und ihre letzten Beschlüsse und Verfügungen klangen wieder in ein Gebet aus.
Jeder ging, seinen Teil am Werke zu vollbringen.
Und im leisen Singen der Schneeflocken, die schon hohe Wellen in den schimmernden Straßen getürmt hatten, starb mancher Seufzer dahin …
_________________
Dröhnend fiel hinter den letzten Wagen der Flüchtenden das große Stadttor zu.
Am Himmel leuchtete der Mond nur als schwacher Schein, aber sein Glanz versilberte die Myriaden Flocken, die übermütige Figuren tanzten, sich in den Kleidern versteckten, um die schnaubenden Nüstern der Pferde flitterten und an den Rädern knirschten, die sich nur mühsam den Weg durch die dicken Schneemassen bahnten.
Aus den Wagen flüsterten leise Stimmen. Frauen, die ihre Erinnerungen an die Heimatstadt, die in sicherer, selbstbewusster Größe noch knapp vor ihren Augen lag, mit wehmütigen, leise singenden Worten austauschten, helle Kinderstimmen, die nach tausend Dingen fragten und forschten, die aber immer stiller und seltsamer wurden und endlich mit einem gleichmäßigen Atmen wechselten, klangen melodisch von dem sonoren Tone der Männer ab, die sorgenvoll die Zukunft berieten und leise Gebete murmelten. Alle waren eng aneinander geschmiegt durch das Bewusstsein ihrer Zusammengehörigkeit und aus instinktiver Furcht vor der Kälte, die aus allen Lücken und Löchern wie mit eisigem Atem hereinblies und die Finger der Lenker erstarren machte.
Der erste Wagen hielt an.
Sofort blieb die ganze Reihe der übrigen stehen. Aus allen den wandernden Zelten sahen blasse Köpfe nach der Ursache des Stockens. Aus dem ersten Wagen war der Älteste gestiegen, und sämtliche folgten seinem Beispiele, denn sie hatten den Grund der Rast erkannt.
Sie waren noch nicht weit von der Stadt; durch das weiße Geriesel konnte man noch undeutlich den Turm erkennen, der sich wie eine drohende Hand aus der weiten Ebene erhebt, und von dessen Spitze ein Schimmer ausgeht, wie der eines Edelsteines an einer beringten Hand.
Hier war alles glatt und weiß, wie die erstarrte Oberfläche eines Sees. Nur hie und da zeigten sich in einem abgegrenzten Raum kleine, gleichmäßige Erhöhungen, unter denen sie ihre Lieben wussten, die hier ausgestoßen und einsam, wie das ganze Volk, fern von ihrer Heimatstatt ein stilles, ewiges Bett gefunden hatten.
Tiefe Stille, die nur das leise Schluchzen durchbricht.
Und heiße Tränen rinnen über die erstarrten, leiderfahrenen Gesichter herab, und werden im Schnee zu blanken Eistropfen.
Vergangen und vergessen ist alle Todesfurcht, wie sie den tiefen, stummen Frieden sehen. Und alle überkommt mit einemmale eine unendliche, tränenschwere, wilde Sehnsucht nach dieser ewigen, stillen Ruhe am »guten Ort«,[5] zusammen mit ihren Lieben. Es schläft soviel von ihrer Kindheit unter dieser weißen Decke, soviel selige Erinnerungen, so unendlich viel Glück, wie sie es nie mehr wieder erleben werden. Das fühlt jeder und jeden fasst die Sehnsucht nach dem »guten Ort«.
Aber die Zeit drängt zum Aufbruch.
Sie kriechen wieder in die Wagen hinein, eng und fest gegeneinander, denn während sie im Freien die schneidende Kälte nicht verspürt, schleicht jetzt wieder das eisige Frösteln in ihre bebenden, zitternden Körper hinauf und schlägt die Zähne gegeneinander. Und im Dunkeln des Wagens finden sich die Blicke mit dem Ausdrucke einer unsagbaren Angst und eines unendlichen Leides …
Ihre Gedanken aber ziehen immer wieder den Weg zurück, den die breiten Furchen der Gespanne in den Schnee eingezwängt, zurück zum Orte ihrer Sehnsucht, zum »guten Ort«.
Es ist Mitternacht vorbeigezogen. Die Wagen sind schon weit weg von der Stadt, mitten in der gewaltigen Ebene, die der Mond hell überflutet und die von den schimmernden Reflexen des Schnees wie mit weißen, wallenden Schleiern umwoben ist. Mühsam stapfen die starken Rosse durch die dicke Schicht, die sich an den Rädern zäh anheftet, langsam, fast unmerklich holpern die Gefährte weiter; es ist, als ob sie jeden Augenblick stehen bleiben würden.
Die Kälte ist furchtbar geworden und schneidet wie mit eisigen Messern in die Glieder, die schon viel von ihrer Beweglichkeit eingebüßt haben. Und nach und nach ist auch ein starker Wind erwacht, der wilde Lieder singt und an den Wagen rasselt. Wie mit gierigen Händen, die sich nach den Opfern ausrecken, reißt es an den Zeltdecken, die unablässig geschüttelt werden und nur mehr mit Mühe von den starren Händen stärker befestigt werden können.
Und immer lauter singt der Sturm und in seinem Lied verklingen die betenden, leise lispelnden Stimmen der Männer, deren eiserstarrte Lippen nur mehr mit Anstrengungen die Worte formen können. Unter dem schrillen Pfeifen erstirbt das fassungslose, zukunftsbange Schluchzen der Frauen und das eigensinnige Weinen der Kinder, denen die Kälte den Druck der Müdigkeit genommen.
Ächzend rollen die Räder durch den Schnee.
Im letzten Wagen schmiegt sich Lea an ihren Bräutigam an, der mit trauriger, monotoner Stimme von dem großen Leide erzählt. Und er schlingt den starren Arm fest um ihren mädchenhaften, schmalen Körper, als wollte er sie gegen die Angriffe der Kälte und gegen jeden Schmerz behüten. Und sie sieht ihn mit dankbaren Blicken an und in das Gewirre von Klagen und Stürmen verrinnen einige sehnsuchtszärtliche Worte, die beide Tod und Gefahr vergessen machen …
Plötzlich ein harter Ruck, der alle zum Schwanken bringt.
Und dann bleibt der Wagen stehen.
Undeutlich vernimmt man von den vorderen Gespannen her durch die tosende Flut des Sturmes laute Worte, Peitschenknall und Gemurmel von erregten Stimmen, das nicht verstummen will. Man verlässt die Wagen, eilt durch die schneidende Kälte nach vorne, wo ein Pferd des Gespannes gestürzt ist und das zweite mit sich gerissen hat. Um die Rosse herum die Männer, die helfen wollen, aber nicht können, denn der Wind stößt sie wie schwache, achtlose Puppen, und die Flocken blenden ihre Augen und die Hände sind erstarrt, kraftlos, wie Holz liegen die Finger aneinander. Und weithin keine Hilfe, nur die Ebene, die im stolzen Bewusstsein ihrer Unendlichkeit sich ohne Linien in dem Schneedämmer verliert und der Sturm, der ihre Rufe achtlos verschlingt.
Da wird wieder das traurige, volle Bewusstsein ihrer Lage in ihnen wach. In neuer, furchtbarer Gestalt greift der Tod wieder nach ihnen, die hilflos zusammenstehen in ihrer Wehrlosigkeit gegen die unbekämpfbaren, unversiegbaren Kräfte der Natur, gegen die unabwendbare Waffe des Frostes.
Immer wieder posaunt der Sturm ihnen da Worte ins Ohr: Hier musst du sterben – sterben. –
Und die Todesfurcht wird in ihnen zu resignierter hoffnungsloser Ergebenheit.
Keiner hat es laut ausgesprochen, allen kam der Gedanke zugleich. Sie klettern unbeholfen, wie es die steifen Glieder gestatten, in die Wagen hinein, eng aneinander, um zu sterben.
Auf Hilfe hoffen sie nicht mehr.
Sie schmiegen sich zusammen, jeder zu seinen Liebsten, um im Tode beisammen zu sein. Draußen singt der Sturm, ihr ewiger Begleiter, ein Sterbelied, und die Flocken bauen um die Wagen einen großen, schimmernden Sarg.
Und langsam kommt der Tod. Durch alle Ecken und Poren fließt die eisige, stechende Kälte herein, wie ein Gift, das behutsam, seines Erfolges sicher, Glied auf Glied ergreift …
Langsam rinnen die Minuten, als wollten sie dem Tode Zeit geben, sein großes Werk der Erlösung zu vollführen …
Schwere, lange Stunden ziehen vorbei, deren jede verzagte Seelen in die Ewigkeit trägt.
Der Sturm singt fröhlich und lacht in wildem Hohn über dieses Drama der Alltäglichkeit. Und achtlos streut der Mond sein Silber über Leben und Tod.
Im letzten Wagen ist tiefe Stille. Einige sind schon tot, andere in dem halluzinatorischen Bann, mit dem das Erfrieren den Tod verschönt. Aber alle sind sie still und leblos, nur die Gedanken schießen noch wie heiße Blitze wirr durcheinander …
Josua hält seine Braut mit kalten Fingern umspannt. Sie ist schon tot, aber er weiß es nicht …
Er träumt …
Er sitzt mit ihr in dem duftdurchwärmten Gemach; der goldene Leuchter flammt mit seinen sieben Kerzen und alle sitzen sie wieder beisammen wie einstmals. Der Abglanz des Freudenfestes ruht auf den lächelnden Gesichtern, die freundliche Worte und Gebete sprechen. Und längst gestorbene Personen kommen zur großen Türe herein, auch seine toten Eltern, aber es wundert ihn nicht mehr. Und sie küssen sich zärtlich und sprechen vertraute Worte. Und immer mehr nahen, Juden in altväterlichen, verblichenen Trachten und Gewändern und es kommen die Helden, Juda Makkabi und alle die andern; sie setzen sich zu ihnen und sprechen und sind fröhlich. Und immer mehr nahen. Das Zimmer ist voll von Gestalten, seine Augen werden müde vom Wechsel der Personen, die immer rascher wandeln und durcheinander jagen, sein Ohr dröhnt von dem Wirren der Geräusche. Es hämmert und dröhnt in seinen Pulsen, heißer, immer heißer –
Und plötzlich ist alles still, vorbei …
Nun ist die Sonne aufgegangen und die Schneeflocken, die noch immer niederhasten, schimmern wie Diamanten. Und wie von Edelsteinen schimmert es auf den breiten Hügel, der über und über mit Schnee bedeckt, sich über Nacht aus der Ebene erhoben hat.
Es ist eine frohe, starke Sonne, beinahe eine Lenzsonne, die plötzlich zu leuchten begonnen hat. Und wirklich ist auch der Frühling nicht mehr fern. Bald wird er alles wieder knospen und grünen lassen und wird das weiße Linnen nehmen von dem Grabe der armen, verirrten, erfrorenen Juden, die in ihrem Leben einen Frühling nie gekannt …
Vorlage: Jüdischer Almanach 1902-1903, teilweise veränderte Neuausgabe, Berlin: Jüdischer Verlag, S. 157-168
Die Wunder des Lebens
Die graue Nebelfahne hatte sich tief über Antwerpen gesenkt und hüllte die Stadt ganz in ihr dichtes, drückendes Tuch. Die Häuser verflossen bald in einem feinen Rauch, und die Straßen führten ins Ungewisse: über ihnen aber ging wie ein Wort Gottes aus den Wolken ein dröhnendes Klingen und ein surrender Ruf, denn die Kirchtürme, aus denen die Glocken mit gedämpfter Stimme klagten und baten, waren zerronnen in diesem großen wilden Nebelmeer, das Stadt wie Land erfüllte und ferne im Hafen die unruhigen, leise grollenden Fluten des Ozeans umschlang. Hie und da kämpfte ein matter Lichtschein mit dem feuchten Rauche und suchte ein grelles Schild zu beleuchten, aber nur das verschwommene Lärmen und Lachen harter Kehlen verriet die Schenke, in der sich die Frierenden und die des Wetters Unlustigen zusammengefunden hatten. Die Gassen waren leer, und wenn Gestalten vorbeikamen, so war es nur wie ein flüchtiger Streif, der rasch in Nebel zerrann. Trostlos und müde war dieser Sonntagmorgen.
Nur die Glocken riefen und riefen ohne Unterlass, wie verzweifelt, dass der Nebel ihren Schrei erstickte. Denn die Andächtigen waren spärlich; die fremde Ketzerei hatte Fuß gefasst im Lande, und wer nicht abtrünnig geworden, war lässiger und matter im Dienst des Herrn, so dass eine morgendliche Nebelwolke genügte, um viele ihrer Pflicht zu entfremden. Alte, verhutzelte Frauen, die ihre Rosenkränze emsig surrten, arme Leute in schlichtem Sonntagsgewand standen wie verloren in den tiefen dunklen Hallen der Kirche, aus denen das schimmernde Gold der Altäre und Kapellen und das leuchtende Messgewand wie eine milde und sanfte Flamme entgegenstrahlte. Wie durchgesickert durch die hohen Wände war der Nebel, denn auch hier wohnte die traurig-fröstelnde Stimmung der verlassenen, versponnenen Straßen. Und kalt, herbe, ohne den sonnigen Strahl war auch die Morgenpredigt: sie galt den Protestanten und war von wildem Zorn getragen, in dem sich Hass mit starkem Kraftbewusstsein vermählte, denn die Zeiten der Milde schienen vorbei, und von Spanien her kam den Klerikern die frohe Kunde, dass der neue König mit lobenswerter Strenge dem Werk der Kirche diene. Und mit den schildernden Drohungen des letzten Gerichtes vereinten sich dunkle Worte der Mahnung für die nächste Zeit, die vielleicht unter einer zahlreichen Hörerschar durch das raunende Gestühle weitergerauscht wären, so aber, in der dunklen Leere dröhnend und hohl zu Boden fielen, wie erfroren in der nasskalten schauernden Luft.
Während der Predigt waren zwei Männer rasch beim Hauptportal eingetreten, für den ersten Augenblick unkenntlich durch den hoch aufgeschlagenen hüllenden Mantel und das tief ins Antlitz verstürmte Haar. Der größere löste sich mit einem jähen Ruck aus der nassen Hülle: ein klares, nicht aber ungewöhnliches Gesicht, zu dessen wohlbehäbigem, bürgerlichem Schnitt die reiche Kaufherrntracht wohl passte. Der andere war absonderlicher, wenn auch nicht phantastisch gekleidet: seine sanften und ruhigen Bewegungen harmonierten mit seinem etwas grobknochig-bäuerlichen, aber gutherzigen Gesicht, dem die weiße Wucht der herabwallenden Haare die Milde eines Evangelisten verlieh. Sie verrichteten beide eine kurze Andacht; dann winkte der Kaufherr seinem älteren Begleiter zu, ihm zu folgen, und sie gingen langsam und mit behutsamen Schritten in das Seitenschiff, das fast ganz im Dunkel lag, weil die Kerzen unruhig im feuchten Raume zitterten und vor den farbigen Scheiben die schwere Wolke lag, die sich noch immer nicht erhellen wollte. Vor einer der kleinen Seitenkapellen, die meist Stiftungen und Gelöbnisse der erbgesessenen Familien enthielten, blieb der Kaufherr stehen, und mit der Hand gegen einen der kleinen Altare hindeutend, sagte er kurz: »Hier ist es.«
Der andere trat näher und legte die Hand über das Auge, um die Dämmerung besser zu durchdringen. Der eine Altarflügel trug ein lichtes Bild, das im Dunkel nur noch weicher und milder in seiner Tönung zu werden schien und den Blick des Malers sogleich fesselte. Es war die Muttergottes mit dem vom Schwert durchbohrten Herzen, ein Bild, ganz sanft und versöhnungsvoll trotz seines Schmerzes und seiner Traurigkeit. Ein seltsam süßer Kopf war die Maria, nicht so sehr Mutter Gottes wie träumerische blühende Jungfrau, der ein leiser schmerzlicher Gedanke die lächelnde Anmut spielender Sorglosigkeit nimmt. Schwarze, dicht herabfließende Haare umschlossen zärtlich angepresst ein schmales, blassleuchtendes Gesicht, aus dem die Lippen rot entgegenbrannten, wie eine purpurne Wunde. Wundersam fein waren die Züge, und manche Linie, wie der schmale und sichere Schwung der Augenbrauen legten einen fast begehrlichen Schein und eine spielerische Schönheit über das zarte Antlitz, aus dem die dunklen Augen versonnen träumten, wie aus einer andern vielfarbigeren und süßeren Welt, der sie ein banger Schmerz entführt. Die Hände waren sanft ergebungsvoll gefaltet, und die Brust schien noch leicht schreckhaft zu erbeben vor der kalten Berührung des Schwertes, dem entlang die blutende Spur ihrer Wunde verströmte. All dies war in wundersamen Glanz getaucht, der ihr Haupt golden überflammte, und selbst ihr Herz glühte nicht wie warmes rauschendes Blut, sondern wie das mystische Licht des Kelches im farbigen Scheine der sonnedurchleuchteten Kirchenscheiben. Und die fließende Dämmerung nahm noch den letzten Schein der Weltlichkeit dieses Bildes, so dass der Heiligenschein über diesem süßen Mädchenhaupte so lebendig glühte wie wahrhaftiges Schimmern der Verklärung.
Beinahe ungestüm raffte sich der Maler aus seiner nachhaltigen und bewundernden Betrachtung auf.
»Das hat keiner von den Unsrigen gemalt.«
Der Kaufherr nickte zustimmend mit dem Kopf.
»Ein Italiener war es. Ein junger Maler. Aber das ist eine ganze Geschichte. Ich will sie Euch von Anfang an beginnen, und Ihr selbst sollt es sein, wie Ihr wisst, der ihr den Schlussstein setzt. Doch seht: die Predigt ist zu Ende, wir wollen für Historien andern Platz suchen als die Kirche, wiewohl ihr unser Bemühen und gemeinsam Werk gelten wird. Lasst uns gehn!«
Der Maler blieb noch zögernd einige Augenblicke stehen, ehe er sich vom Bilde abwandte, das immer leuchtender zu werden schien, in dem Maße, als die rauchige Finsternis sich zu erhellen strebte und der Dunst immer goldener um die Fenster sich wölbte. Und es war ihm fast, als würde, wenn er andächtig betrachtend zurückbliebe, die sanftschmerzliche Falte dieser Kinderlippen sich in ein Lächeln verlieren und neue Holdseligkeit ihm offenbaren. Doch sein Begleiter war schon vorausgegangen, und er musste seinen Schritt beschleunigen, um ihn noch beim Portale zu erreichen. Gemeinsam, wie sie gekommen waren, traten sie aus der Kirche.
Aus dem schweren Nebelmantel, den der Vorfrühlingsmorgen der Stadt umgehängt hatte, war ein matter, silberner Flor geworden, der wie ein Spitzengewebe sich an den gegiebelten Dächern verfangen. Das enggesteinte Pflaster glänzte feuchtatmend wie Stahl, und schon begann sich das erste Sonnenflimmern goldig darin zu spiegeln. Der Weg der beiden ging durch die schmalen verwinkelten Gassen dem hellen Hafen zu, wo der Kaufherr wohnte. Und da sie langsam dahinschritten, in Gedanken und Erinnerung verloren, führte des Kaufherrn Geschichte schneller hin zum Ziele als ihrer Schritte träumerischer Gang.
»Ich hab Euch schon erzählt«, begann er, »dass ich in jungen Jahren in Venezia war. Und um nicht lang zu zögern: ich trieb es nicht sehr christlich. Statt meines Vaters Kontor[6] zu verwalten, saß ich in Schenken mit dem jungen Volk, das dort den lieben Tag in Saus und Braus verbringt, trank, spielte, wusste auch schon manches freche Lied und manchen bittern Fluch über den Tisch zu donnern, wie die andern. An Heimkehr dacht ich nicht. Das Leben war mir leicht, wie meines Vaters Worte, die er mir dringender und drohender von Hause schrieb: man kannte mich und hatte ihn gewarnt, dass mich das Luderleben noch verschlingen würde. Ich lachte nur, manchmal mit Ärgernis: ein rascher Schluck von diesem dunkelsüßen Wein schwemmte mir alle Bitterkeiten weg, und tat’s nicht er, so tat’s ein Dirnenkuss. Die Briefe riss ich auf und bald entzwei: mich hatte ganz der böse Rausch gefasst, ich dachte nie mehr loszukommen. Doch eines Abends ward ich alles frei. Sehr seltsam war’s, und manchmal fühl ich’s heute noch so, als hätte sichtbarlich ein Wunder meinen Weg gebahnt. Ich saß in meiner Schenke: heut noch seh’ ich sie mit ihrem Qualm und Dunst und meinen Kneipgesellen. Auch Dirnen waren mit, und eine war sehr schön; wir trieben’s selten toller als in dieser Nacht, die stürmisch war und sehr unheimlich. Plötzlich, als eben eine unzüchtige Historie dröhnendes Lachen weckte, trat mein Diener ein und gab mir einen Brief, den der Kurier von Flandern gebracht hatte. Ich war sehr ärgerlich, weil ich die Briefe meines Vaters ungern sah, denn sie mahnten mich unablässig an meine Pflicht und an ein christlich Tun, zwei Dinge, die ich längst im Wein ersäuft hatte. Ich wollt’ ihn nehmen: da sprang der eine meiner Kneipgesellen auf, ein schöner Bursch, geschickt und aller ritterlichen Künste Meister. ›Lass doch den Unkenschrei! Was geht’s dich an!‹ rief er und warf den Brief hoch, riss seinen Degen rasch heraus und stieß geschickt das niederflatternde Blatt tief in die Wand, dass die blaue geschmeidige Klinge zitterte. Er zog sie vorsichtig zurück – der geschlossene Brief blieb an seiner Stelle. ›Da klebt die Fledermaus!‹ lachte er. Die andern schlugen in die Hände, die Dirnen sprangen freudig zu ihm auf, man trank ihm zu. Ich lachte selbst, trank mit, zwang mich zu toller Fröhlichkeit, in der ich Brief und Vater, Gott und mich vergaß. Wir gingen fort, ohne dass ich noch des Briefes dachte, zu einer andern Schenke,[7] wo unsre Fröhlichkeit zur Torheit wurde. Ich war berauscht wie nie, und eine der Dirnen war schön wie die Sünde.« –
Der Kaufherr blieb unwillkürlich stehen und strich sich mit der Hand mehrmals über die Stirne, gleichsam, als wollte er ein unerfreuliches Bild von sich abstreifen. Der Maler merkte rasch die Peinlichkeit der Erinnerung und sah ihn nicht an, sondern ließ seinen Blick wie neugierig auf einer raschsegelnden Galeone ruhen, die sich mit vollen Segeln dem Hafen näherte, in dessen farbigem Gewirre die beiden langsam angelangt waren. Das Schweigen dauerte nicht lange, und der Erzähler fuhr mit Hastigkeit fort.
»– Ihr könnt Euch denken, wie es wurde. Ich war jung und verwirrt, sie frech und schön. Wir gingen zusammen, und ich war voll Unrast und Begierde. Aber ein Sonderbares geschah. Als ich in ihren buhlerischen Armen lag und sich ihr Mund an meinen presste, da ward diese Zärtlichkeit mir nicht wilder, gern erwiderter Genuss, sondern in wunderbarer Weise mahnten mich diese Lippen an den sanften Abendgruß im Elternhause. Mit einem Male, wundersam und kaum glaublich, fiel mir in den Armen der Dirne meines Vaters zerknüllter, zerstoßener, ungelesener Brief ein und mir war, als fühlte ich den Stoß des Gesellen in meiner blutenden Brust. Ich fuhr auf, so unvermittelt und blass, dass mich die Dirne erschreckten Blickes befragte, was mir zugestoßen sei. Aber ich schämte mich meiner törichten Angst, und ich schämte mich dieses fremden Weibes, in dessen Bett ich gelegen und deren Schönheit ich genossen, ohne ihr den törichten Gedanken eines Augenblickes anvertrauen zu wollen. Aber in dieser Minute hat sich mein ganzes Leben gewandelt, und heut wie damals fühle ich, dass nur Gottes Gnade solches wirken kann. Ich warf ihr Geld hin, das sie widerwillig nahm, weil sie fürchtete, dass ich sie verachte, und sie nannte mich einen deutschen Narren. Ich aber hörte nicht mehr, sondern stürmte fort in die kalte Regennacht und schrie wie ein Verzweifelter in die dunklen Kanäle hinaus nach einer Gondel. Endlich kam eine, die sich ihre Fahrt mit Gold aufwiegen ließ, aber mein Herz pochte in einer so jähen, unbarmherzigen und unbegreiflichen Angst, dass ich an nichts anderes dachte als an den Brief, den mir ein Wunder so jählings wieder in Erinnerung gebracht. Als ich bei der Schenke angelangte, brach die Begierde nach diesen Zeilen aus wie ein zehrendes Fieber; ein Rasender stürmte ich jäh in die Schenke, ohne der freudig-erstaunten Rufe meiner Genossen zu achten, sprang auf einen gläserklirrenden Tisch, riss den Brief von der Wand und rannte weiter, ohne das tolle Hohnlachen und zornige Fluchen hinter mir zu beachten. An der nächsten Ecke entfaltete ich den Brief mit zitternden Händen. Der Regen strömte nieder vom verwölkten Himmel, und der Wind riss an dem Blatt in meiner Hand. Ich ließ aber nicht früher ab, als bis ich mit überquellenden Augen alles entziffert hatte. Es waren nicht viel der Worte: meine Mutter sei zum Sterben krank, und ich möchte nach Hause kommen. Kein Wort des Tadels und Vorwurfs wie sonst. Aber wie brannte mein Herz in tiefster Scham, als ich sah, dass des Degens Klinge mitten durch meiner Mutter Namen gestoßen war …«
»Ein Wunder, ein offenbarliches Wunderzeichen, nicht allem Volke verständlich, aber wohl dem, für den es erstanden«, murmelte der Maler, als der Erzähler tiefbewegt in Schweigen versunken war. Eine Zeitlang gingen sie wieder wortlos nebeneinander her. Fernüber leuchtete schon das prächtige Haus des Kaufherrn ihnen entgegen. Als der Kaufherr aufblickend es bemerkte, fuhr er hastig fort.
»Lasst mich kurz sein, lasst mich Euch verschweigen, in welchem Schmerz und reuevollem Wahnsinn ich diese Nacht verlebte. Lasst Euch nur sagen, dass mich der nächste Morgen kniend auf den Stufen der Markuskirche fand, wo ich in brünstigem Gebete der Muttergottes einen Altar gelobte, wenn sie mir vergönnen wollte, meiner Mutter Gruß und Verzeihung zu erlangen. Am selben Tage reiste ich ab, reiste Stunden und Tage der Verzweiflung und Angst nach Antwerpen, stürmte wild und verzweifelt zu meiner Eltern Haus. Vor dem Tore stand meine Mutter, gealtert und blass, doch wohlauf. Als sie mich sah, breitete sie mir jubelnd die Arme entgegen, und ich weinte vieler Tage Sorge und vieler vergeudeter Nächte Schmach an ihrem Herzen aus. Mein Leben ist seitdem ein anderes geworden, ich darf beinah sagen ein gutes. Das Liebste, das ich hatte, jenen Brief, habe ich eingesargt in den Grundstein dieses Hauses, das meiner Hände Arbeit geschaffen hat, und mein Gelübde habe ich zu lösen gesucht. Bald nach meiner Ankunft ließ ich den Altar errichten, den Ihr gesehn habt, und bot alle Mühe auf, ihn würdig zu schmücken. Da ich aber unbekannt war in den Geheimnissen, nach denen Ihr Eure Kunst zu werten wisst, und der Muttergottes ein würdiges Bild weihen wollte, so wie sie mir ihr Wunder geoffenbart, schrieb ich an einen treuen Freund nach Venedig, er möge mir den Tüchtigsten der Maler senden, den er kenne, dass er mir das Werk meines Herzens würdig vollende.
Monate vergingen. Eines Tages stand ein junger Mann vor meiner Tür, berief sich seiner Sendung und entbot mir Gruß und Brief meines Freundes. Der italienische Maler, dessen wunderbaren und seltsam traurigen Gesichtes ich mich noch wohl besinne, glich durchaus nicht den lärmenden und großsprecherischen Kumpanen meiner Venezianer Zechgelage. Eher hätte man ihn als Mönch empfangen, denn als Maler, weil sein Habitus schwarz und lang war, seine Haare schlicht gereiht und sein Antlitz von jener vergeistigten Blässe der Nachtwachen und Asketen. Der Brief bestätigte nur jenen günstigen Eindruck und zerstreute meine Bedenken ob der Jugend des Meisters; die alten Maler, schrieb mir mein Freund, seien in Italien stolzer als Fürsten, und es hielte schwer, sie auch mit dem verlockendsten Angebot aus ihrer Heimat zu entfernen, wo sie umringt seien von Freunden und Frauen, von Fürsten und Volk. Diesen jungen Meister habe nur der Zufall bestimmt: die Sehnsucht, wegen eines ihm unbekannten Grundes Italien zu verlassen, sei ihm dringender gewesen als alles Geldes Angebot, denn man kenne auch daheim des jungen Malers Wert und wisse ihn zu ehren.
Es war ein stiller verschlossener Mann, den mir mein Freund gesandt. Nie habe ich von seinem Leben etwas erfahren, nur dunklen Andeutungen entnahm ich, dass eine schöne Frau schmerzlichen Anteil an seinem Geschicke habe und er um ihretwillen die Heimat verlassen. Und, wiewohl ich keinen Beweis dafür habe und mich solches Tun ketzerisch und unchristlich anmutet, so meine ich, dass jenes Bild, das Ihr gesehn und das er im Verlauf weniger Wochen ohne Vorbild und mühsame Bereitung aus der Erinnerung gemalt, jener Frau Züge erhalte, die er geliebt. Denn immer, wenn ich zu ihm kam, fand ich ihn, wie er das gleiche süße Antlitz, das Ihr gesehen, von neuem versuchte oder träumend in seiner Betrachtung verweilte. Und als ich nach des Bildes Vollendung in heimlicher Angst ob der Gottlosigkeit, eine Dirne als Gottesmutter zu malen, ihm anbefahl, für das zweite Bild eine andere Gestalt zu wählen, da blieb er stumm. Und des nächsten Tages, als ich zu ihm ging, war er ohne ein Wort des Abschieds von hinnen gereist. Ich trug Bedenken, mit diesem Bilde den Altar zu schmücken, doch der Priester, den ich befragte, verstattete es ohne jegliches Besinnen …«
»Und er hat recht getan«, fiel der Maler beinahe erregt ein. »Denn woher sollten wir die holde Schönheit unserer lieben Frauen zu schildern wissen, wenn nicht von der Schönheit jeder Frau, die uns begegnet. Sind wir nicht nach Gottes Bilde geschaffen und muss nicht, um das Vollkommenste darzubieten, das Vollendetste unter den Menschen eine, wenngleich nur matte Folie des Unsichtbaren sein! Seht! Ich, den ihr bestimmt, das zweite Bild zu schaffen, ich bin einer der Armen, die nicht zu malen wissen ohne die Natur, denen es nicht gegeben ist, von innen zu bilden, sondern die in mühsamer Nachzeichnung des Wahrhaftigen ihr Werk erschaffen. Nicht meine Liebste würde ich wählen, um die Mutter Gottes würdig zu bilden, denn es wäre sündhaft, die Unbefleckte durch einer Sünderin Antlitz zu sehen, aber ich würde nach Schönheit spüren und diejenige malen, deren Antlitz mir am meisten unserer Gottesmutter Züge zeigte, wie ich sie in meinen frommen Träumen erschaut. Und glaubt, obgleich eines sündigen Menschen Antlitz, wenn Ihr in frommer Hingebung es schafft, bleibt nichts von Schlacken der Begehrlichkeit und Sündhaftigkeit in diesen Zügen, ja dieser wunderbaren Reinheit Zauber wirkt oft weiter als ein Zeichen in der irdischen Frauen Angesicht. Dies Wunder meint ich oftmals selbst zu sehn.«
»In jedem Fall – Euch traue ich. Ihr seid ein reifer Mann, der viel geduldet und gelebt, und so Ihr keine Sünde darin findet …«
»Im Gegenteil! Ich find’ es lobenswert, und nur die Protestanten wie anderen Sektierer eifern gegen den Schmuck des Gotteshauses!«
»Da habt Ihr recht. Doch bitt’ ich Euch, beginnt bald mit dem Bild, denn wie eine Sünde brennt dies ungelöste Gelübde auf mir. Durch zwanzig Jahre vergaß ich an das zweite Bild: erst jüngst, als ich meines Weibes gramvolles Angesicht sah, wie sie am Krankenbette meines Kindes weinte, fühlte ich diese Schuld und erneute mein Gelübde. Und Ihr wisst, auch diesmal hat die Muttergottes ein Wunder der Genesung dort gewirkt, wo alle Ärzte sich mit Verzweiflung abgewandt hatten. Ich bitte Euch, zögert nicht lange mit dem Werk.«
»Ich tue, was ich kann, doch frei herausgesagt, fast nie in meiner langen Schaffenszeit ist mir ein Werk so schwer erschienen, denn wenn es nicht als eines Stümpers leichtfertiges Gefüge neben dieses jungen Meisters Bild erscheinen soll – von dessen Wirken ich mehr zu wissen begehrte – muss Gottes Hand mit meinem Werke sein.«
»Der fehlt seinen Treuen nie. Lebt wohl! Und schreitet wohlgemut zum Werk. Ich hoffe, Ihr bringt mir bald frohe Kunde ins Haus.«
Der Kaufherr schüttelte ihm vor seiner Pforte noch einmal innig die Hand und sah vertrauensvoll in die klaren Augen des Malers, die wie ein helleuchtender Gebirgssee, den verwitterte Zacken und Schroffen umgrenzen, aus dem derbdeutschen, kantigen Gesichte entgegenblauten. Der hatte noch ein entgegnendes Wort auf den Lippen, verschluckte es aber mutig und fasste mit festem Drucke die dargebotene Hand. In innig verstehenden Gefühlen schieden die beiden.
Der Maler ging langsam den Hafen entlang, wie es stets seine Gewohnheit war, wenn ihn nicht die Arbeit an seine Stube fesselte. Er liebte dieses wilde, farbenreiche Bild, darin die Arbeit ungebrochen pulste, und manchmal setzte er sich auf einen Taupflock nieder, um irgendeines Schaffenden seltsame Körperbiegung nachzubilden und der schwierigen Kunst der Verkürzungen ein Fußbreit Weges abzuringen. Ihn störte nicht der laute Ruf der Schiffer, das Rasseln der Wagen und das Meer, das sich mit seinem gleichtönigen lallenden Geschwätze an die Ufer warf, ihm waren jene Blicke gegeben, die zwar nicht leuchten vom Abglanz innerer selbstgeschauter Bilder, die aber in allem Lebenden, so gleichgültig es auch sich gebärden mag, jenen Strahl erkennen, der ein Kunstwerk zu erleuchten vermag. Darum ging er auch immer ins Leben, wo es sich am farbigsten ausstrahlte und verwirrende Fülle wechselnder Reize ausatmete; zwischen dem Matrosenvolk streifte er mit langsamen Schritten und suchendem Auge, ohne dass ihn jemand zu verlachen wagte, denn unter dem vielen lärmenden unnützen Volk, das ein Hafen ansammelt, so wie der Strand die tauben Muscheln und zerbröckelndes Gestein, fiel er durch sein stilles Gebaren und die Ehrwürdigkeit seiner Mienen auf.
Diesmal aber stand er bald von seiner Suche ab. Des Kaufherrn Geschichte hatte ihn im tiefsten berührt, weil sie leise auch an ein eigenes Schicksal gestreift, und selbst der Kunst sonst so hingebender Zauber versagte heute seinen Dienst. Über allen Frauenantlitzen, und ob sie auch nur plumpe Fischergestalten waren, leuchtete der milde Glanz des Muttergottesbildes von des jungen Meisters Hand. Unschlüssig wandelte er in träumerischen Gedanken eine Zeitlang dem sonntäglich geputzten Getriebe entlang; dann aber mühte er sich nicht mehr, dem sehnsüchtigen Drange zu widerstehen, und durch das dunkle Netz der winkeligen Gassen suchte er wieder zur Kirche zurück zu jener milden Frau wundersamem Konterfei.
_____________
Einige Wochen gingen seit jener Unterredung dahin, in welcher der Maler seinem Freunde die Vollendung des Bildes für den Altar der Gottesmutter zugesagt hatte, und noch immer blickte die unberührte Leinwand vorwurfsvoll den alten Meister an, der sie beinahe zu fürchten begann und die Stunden immer lieber auf der Straße zubrachte, um nicht die grausame Mahnung und den schweigenden Vorwurf seiner Mutlosigkeit fühlen zu müssen. In diesem Leben regsamer Arbeit, das vielleicht sogar zu viel gewirkt hatte, um prüfend in sich selbst zu schauen, war seit jenem Tag, da der Maler des jungen Meisters Bild erblickt, eine Wendung geschehen; Zukunft und Vergangenheit waren jählings aufgerissen und blickten ihn an, wie ein leerer Spiegel, in den nur Dunkelheit und Schatten strömen. Und nichts Furchtbareres gibt es, als den Schauer eines Lebens, das schon auf dem letzten Grat seines Aufstieges aufblickt vom mutvollen Schreiten und dann von sinnender Angst befallen, es habe den Fehlweg eingeschlagen, die Kraft verliert, die letzten leichtesten Fußtapfen nach vorwärts zu machen. Mit einem Mal schien dem Maler, der in seinem Leben schon hundert und aberhundert frommer Darbildungen gemalt, die Fähigkeit zerronnen, eines Menschen Angesicht würdig zu gestalten, dass es ihm selbst so schiene, als sei es göttlichen Wesens würdig. Er hatte Frauen gesucht, solche, die ihr Antlitz verkauften für die Stunde der Nachbildung, solche, die ihren Leib verkauften, Bürgersfrauen und sanfte Mädchen, deren Gesicht überleuchtet war vom durchglühenden Schimmer innerer Reinheit; aber stets, wenn sie nahe vor ihm standen und er den Pinsel ansetzen wollte zum ersten Strich, da fühlte er ihre Menschlichkeit. Er sah die blonde gefräßige Behäbigkeit in der einen, die wilde verhaltene Gier, sich im Liebeskampfe auszutoben, in der anderen, er fühlte die leere Glätte hinter den kurzen glänzenden Mädchenstirnen und erschrak beim plumpen Schritt und bei der verbuhlten Hüftenbiegung der Dirnen. Und die Welt ward ihm mit einem Male so öde, alle diese Menschen, die er um sich sah: der Atem der Göttlichkeit schien ihm ausgelöscht, überwuchert von dem blühenden Fleische dieser begehrlichen Frauen, die nichts mehr wussten von dem mystischen Magdtum und den sanften Schauern unbefleckter Hingebung an die Träume einer anderen Welt. Er schämte sich, die Mappen aufzuschlagen, die sein eigenes Werk enthielten, denn ihm schien, als hätte er sich selbst wie von der Erde entfernt und sei sündig gewesen, indem er plumpe Bauern zu Blutzeugen des Heilands und grasse Weiber zu seinen Dienerinnen erwählt. Dumpfer und drückender wölkte sich diese Stimmung über ihn herab. Er sah sich als jungen Knecht hinter seines Vaters hartem Pfluge gehen, lange bevor er zur Kunst entlief, mit harten Bauernhänden die Egge in die schwarze Erde stoßen und fragte sich, ob er nicht besser getan, gelbes Korn zu säen und Kindern wohlgehüteten Bestand zu wahren, als mit plumpen Fingern an Geheimnissen und Wunderzeichen zu rütteln, die nicht für ihn geschaffen. Sein ganzes Leben schien ihm in den Fugen zu wanken, emporgekeilt durch die flüchtige Erkenntnis einer Stunde, durch ein Bild, das seine Träume durchschwebte und seiner wachen Minuten Folter und Seligkeit war. Denn es war ihm nicht mehr möglich, die Muttergottes in seinen Gebeten anders zu empfinden, als sie auf jenem Bilde war, welches so holdseliges Konterfei bot und doch so abgewandt war von der Schönheit aller irdischen Frauen, die ihm begegnet, so verklärt in dem Scheine fraulicher Demut mit göttlicher Ahnung. Aller Frauen Bild, die er geliebt, verfloss in dem trügerischen Dämmer der Erinnerung in die wundersame Hülle dieser Gestalt. Und als er sich mühte, zum ersten Male, nicht dem Wirklichen abzulauschen, sondern eine Muttergottes nach dem Phantasiebilde zu schaffen, das ihn durchschwebte, Maria mit dem Kinde, sanft lächelnd und in froher, ungetrübter Seligkeit, da sanken seine Finger, die den Pinsel führen wollten, kraftlos nieder, wie vom Krampf gelähmt. Denn der Strom versiegte, die Fertigkeit der Finger, des Auges Worte zu sprechen schien hilflos gegenüber jenem hellen Traum, den er mit seinem inneren Blick so deutlich sah, als sei er aufgemalt auf einer starren Wand. Wie ein Feuer brannte dieser Schmerz der Unfähigkeit, den schönsten und treuesten seiner Träume in die Wirklichkeit tragen zu können, wenn die Wirklichkeit nicht selbst aus ihrer Fülle eine Brücke bot. Und er stellte sich die bange Frage, ob er sich selbst noch Künstler nennen dürfe, da ihm solches geschah, und ob er sein Leben lang nicht nur ein mühsam bildender Handwerker gewesen sei, der nur Farben nebeneinander gefügt, wie ein Kärrner die Steine zu einem Bau.
Solche selbstquälerische Betrachtung ließ ihn keinen Tag ruhen und trieb ihn mit zwingender Gewalt aus seiner Stube, wo ihn die leere Leinwand und die sorgsam bereiteten Utensilien wie höhnische Stimmen verfolgten. Mehrmals wollte er dem Kaufherrn seine Not beichten, aber er fürchtete, dass dieser zwar fromme und auch wohlgesinnte Mann ihn nie ganz verstehen könnte und eher an eine ungeschickte Ausflucht werde glauben wollen, als an seine Unfähigkeit, ein solches Werk zu beginnen, wie er sie schon in großer Zahl und zum allgemeinen Beifall der Meister und Laien vollendet hätte. Und so irrte er gewöhnlich ratlos und rastlos in den Straßen umher, geheim erschreckend, wie ihn der Zufall oder eine verborgene Magie aus seinen wandelnden Träumen immer wieder vor jener Kirche erwachen ließ, gleichsam als binde ihn ein unsichtbares Band an dieses Bild oder eine göttliche Kraft, die seine Seele selbst im Traume regiere. Manchmal trat er ein, mit der geheimen Hoffnung, dass er Makel und Fehl entdecken könne und so der zwingende Zauber gebrochen sei; vor dem Bilde aber vergaß er gänzlich, des jungen Meisters Schöpfung neidlich nach Kunst und Handwerk zu messen, sondern er fühlte es wie Schwingen um sich rauschen, die ihn auftrugen in Sphären sanfteren und verklärteren Genießens und Anschauens. Und erst wenn er die Kirche verließ und begann, seiner selbst und eigenen Bemühens zu gedenken, fühlte er den alten Schmerz mit doppelter Gewalt.
Eines Nachmittags war er wieder durch die hellerleuchteten Straßen geirrt, und diesmal fühlte er seine quälerischen Zweifel milder werden. Von Süden her war der erste Frühlingswind gekommen und trug, wenn auch nicht die Wärme, so doch die Helle vieler heranblühender Lenztage in sich. Zum ersten Male schien dem Maler jener graue stumpfe Glanz, den sein eigener Gram über die Welt gelegt, sich zu lösen und Gottes Gnade in sein Herz zu rauschen, wie immer, wenn das große Auferstehungswunder in flüchtigen Zeichen sich verkündete. Eine klare Märzsonne wusch alle Dächer und Straßen blank, die Wimpel wehten bunt im Hafen, der zwischen den sanft sich wiegenden Schiffen hervorblaute, und im steten Lärmen der Stadt brauste es wie jubelndes Singen. Ein Pikett[8] spanischer Reiter trabte über den Platz; man sah sie heute nicht mit feindlichen Blicken, wie sonst, sondern freute sich des sonnigen Widerspiels ihrer Rüstungen und der blinkenden Helme. Die weißen Hauben der Frauen, die der Wind mutwillig zurückschlug, wiesen frische und farbige Gesichter; über das Pflaster aber trappte flink der holzschuhklappernde Tanz der Kinder, die sich bei den Händen fassten und singend in Ringelreihen sich drehten.
Auch in den sonst so dunklen Hafengassen, denen sich nun der immer froher werdende Wandler zuwandte, flackerte ein leichter Schimmer, wie ein sinkender Regen des Lichts. Die Sonne konnte nicht ganz ihr leuchtendes Angesicht zwischen diese vorgeneigten Giebeldächer blicken lassen, denn die neigten sich dicht zusammen, schwarz und verknittert, wie uralte Hauben zweier Mütterchen, die in stetem geschwätzigem Gespräche stehen. Aber von Fenster zu Fenster gab sich das spiegelnde Leuchten weiter, wie wenn funkelnde Hände flirrend hinabgriffen und es hin- und herschnellten in übermütigem Spiel. Und manchen Fleck gab es, da das Leuchten still und mild blieb, wie ein träumendes Auge in der ersten Dämmerung des Abends. Denn unten, auf der Straße, lag das Dunkel, unbeweglich und seit Jahren, nur selten im Winter unter schneeigem Mantel geborgen. Und die da wohnten, trugen in ihren Augen die Unlust und Traurigkeit steter Dämmerung; nur die Kinder, denen die Seele brannte vor Sehnsucht nach Licht und Helle, ließen sich von diesem ersten Strahl des Frühlings vertrauensvoll verführen und spielten in leichter Gewandung auf dem schmutzigen, holperigen Pflaster, in ihrer Unbewusstheit tief beglückt durch den schmalen, blauen Streif, der zwischen den Dächern lugte, und durch den goldenen Tanz der Sonnenkringel.
Der Maler ging und ging, ohne ein Müdewerden zu fühlen. Es war ihm, als sei auch ihm ein geheimer Jubel beschieden und als sei jedes Sonnenfunkens flüchtiger Schein Gottes leuchtender Gnadenstrahl, der zu seinem Herzen ginge. Alle Bitternis war verloschen in seinem Angesicht, das so milde und begütigend durchleuchtet war, dass die spielenden Kinder aufstaunten und ihn fürchtig grüßten, weil sie einen Priester in ihm zu sehen meinten. Er ging und ging, ohne an Ziel und Ende zu denken, denn in seinen Gliedern drängte der neue Frühlingstrieb, wie in alten verknisterten Bäumen die Blüten bittend an den haltenden Bast klopfen, dass er ihre junge Kraft aufschießen lasse ins Licht. Sein Schritt war froh und leicht wie der eines Jünglings; frischer und lebendiger schien er zu werden, obgleich der Weg schon Stunden währte, und rascher, geschmeidiger Takt maß die rasch zurückgelegten Strecken.
Plötzlich hielt der Maler wie versteinert inne und fuhr sich mit der Hand schützend über die Augen, wie einer, den ein blitzender Strahl verletzt oder ein schrecksames und unglaubliches Ereignis. Aufschauend zum sonneüberleuchteten Schein eines Fensters hatte er den vollen Strahl des zurückspiegelnden Lichtes schmerzhaft in den Augen gefühlt, aber durch jenen Nebel von Purpur und Gold war eine seltsame Erscheinung, ein wunderbares Trugbild auf dem wirrenden Scharlachschleier erschienen: die Madonna jenes jungen Meisters, träumerisch und leise schmerzlich zurückgelehnt, wie auf jenem Bild. Ein Schauer überlief ihn, die grausame Angst der Enttäuschung vereint mit jenem selig zitternden Rausch eines Begnadeten, dem die wundersame Vision der Gottesmutter nicht im Dunkel eines Traumes, sondern in Tageshelle erschienen, ein Wunder, das viele bezeugten und wenige wirklich erschaut hatten. Noch wagte er den Blick nicht zu erheben, weil er sich nicht stark genug fühlte, um den niederschmetternden Augenblick unseliger Entscheidung auf seinen zitternden Schultern tragen zu können, weil er fürchtete, dass diese eine Sekunde sein Leben noch grimmiger zerstampfen könnte, als die unerbittliche Selbstqual seines verzagten Herzens. Erst als seine Pulse langsamer und ruhiger gingen und er nicht mehr schmerzvoll ihren Hammerschlag in der Kehle spürte, raffte er sich auf und sah langsam, unter der überschattenden, zitternden Hand zu jenem Fenster auf, in dessen Rahmen ihn das verführerische Bild gesehen.





























