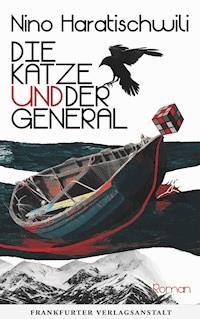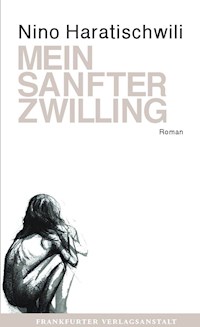Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beruhend auf einer wahren Geschichte stellt die erfolgreiche Theaterautorin Nino Haratischwili in ihrem ersten Roman die Frage nach Authentizität. Das Buch "Die Eiszeit" von Jeanne Saré wird in den Siebziger Jahren ein großer Verkaufserfolg, vor allem in feministischen Kreisen. Das hasserfüllte Buch der jugendlichen Selbstmörderin Saré animiert mehrere Leserinnen zum Suizid. Nun, in der Jetztzeit, machen sich in Paris einige Menschen auf die Suche nach Saré. Was hat der Verleger des Buches, ein grantiger älterer Herr mit Saré zu tun? Warum gibt es keine Zeugnisse? Und wie konnte das Buch derart wirken? Nino Haratischwili beschreibt auf schwindelerregende Weise, welche Bedeutung Geschichten für das Leben haben können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nino Haratischwili
JUJA
Roman
Feststehend, vollendet können wir uns begreifen.
(Helmut Krausser, »Melodien«)
Juja / Ein Lied
Ich will nichts, Juja.Ich bin ausgetrocknet,Wie eine trockene Pfütze.Und in meinem HerzenIst’s leerIst’s kalt.
Und die Fabrikrohre qualmen,Und du küsst mich auf die Lippen,Aber die versprochenen Regen –Wo bleiben sie?
Heute wieder ein besoffener Abend,Aber so scheint’s mir leichter.Und sogar Sterne leuchten heller:Ro-man-tik!
Und wir lösen einander auf, JujaWie Säuremittel, oder was auch immer.Und wir müssen den SchmerzGemeinsam tragen:Den gläsernen …
Und auf dem Fluss, wieder die alten BooteSo viel älter als ich,Aber trotzdem kommt jeder anIrgendwoIrgendwoIrgendwo … an.
(Zemfira: »Juja«, auf dem Album »Vendetta«)
TEIL 1
1. DIE EISZEIT / BUCH 1 (1953)
»Ich war einEMBRYOund wusste alles. Ich wurde ins Leben gepresst und vergaß mein Wissen. Ich wurde ins Lebengefickt. Man entnahm mir mein Wissen. Ich will Rache.
Ich war viel. Ich kannte die acht Seiten des Mondes. Ich habe im Hades alle Toten umarmt. Ich habe alle Gesichter gehabt.
Ich gehe und gehe und wachse und dies ist mein Mord. Jeder Schritt – eine Tortur, da niemals Frieden, da niemals Stille, da niemals Ich. Ich war einEMBRYOund wusste alles und dann wurde ich gefressen, durch das blutende Geschlecht und durch viel Geschrei. Ich vergaß mein Wissen.
Alle Bäumeentflammten, als ich fortschritt, alle Häuser stürzten ein und alle Augenverfinstertensich. Mich berührte nichts. Das Nomadenland wurde zu meinem Bett.
Dann ward ich zum Staub und wurde vergewaltigt, auf der Wiese, alles Lebendige unter mich begrabend.
Dann schritt ich durch alle Gewässer der Welt,flogüber alle Kirchenspitzen und Altäre, ich schrie dabei. Keiner hörte mich. Ich wurde stumm. Ein stummes Staubkorn.
Die Welt krachte ein und ich wurde unter ihr begraben. Ich will wieder einEMBRYOsein. Im Blut wachsend und Allwissend.
Ich wollte nach Hause. Doch es gab ein Erdbeben, die Erde machte einen starken Stoß, dann übergab sie sich.
Ich wollte mit Gott reden, der dabei gewesen war, als man mich ins Lebenfickte. Aber er kam nicht und so sagte ich – jetzt wird alles einerlei: Ich stifte den Wahnsinn, um danach zu meinem Achill in den Hades zu gehen. Ich entziehe ihn allen Frauen und dann werde ich in seinen toten Armen einschlafen und selbst zu Eis werden.
Und in 13.090.090.300 Jahren taue ich auf. Und mein Glück kommt.
Das beschloss ich und überquerte die Wüste, die aussah wie ein leerer Schädel. Und ich kroch weiter mit meinen Skorpionen, die ich streichelte und die ich nachts, in der Einsamkeit der Nächte, briet und verschlang. Ihr Gift machte mich stark und ich ging weiter. Ich schrieb Achill Briefe in den Sand. Ich bahnte den Weg für uns zwei.
Doch liebte ich, um zu wissen, wie absolut sinnlos die Liebe war.
Und so sprach ich zu meinen Eidechsen und Schlangen: ›Ich kann nicht eure Eva sein. Sie starb, da sie die Rippe des Mannes nicht in sich behalten wollte. Sie ging fort und wurde zum Asketen und lebte 999 Jahre im Reich der Stille und ihr Mann vergewaltigte die Bäume und aus seinem Samen entstanden noch mehr Söhne … Er wurde verrückt und als die Söhne begannen, sich zu bekämpfen, brachte er sich um. Er vermisste seine Eva. So traurig.‹ Und meine Schlangen nickten mir zu und weinten mit mir.
›Und was wurde aus Eva?‹, fragte die rote Eidechse mit der alten Haut und dem verhurten Leben.
›Tja, sie lebte in der Abgeschiedenheit, weinte nachts, weil sie alleine war, und dann kam sie zurück und sah ihren toten Mann und ihre vielen Söhne, die sie nie geboren hatte und sie alle nahmen sie zur Frau und sie weinte und fragte Gott: Warum wirfst du mir die Sünde vor, wenn du mich zur Einzigen machtest und wusstest, meine Söhne würden mich besteigen? Sie weinte und weinte und schließlich erhängte sie sich am eigenen Haar.‹
Die Eidechse, die mich zu lieben begann, streichelte meine Stirn und schluchzte leise auf.
Später erzählte sie mir, sie hätte gehurt und gesündigt und hätte ihr Leben lang ein Stadtschildkrötenmännchen geliebt. Doch es war durch die Menschen überzüchtet und hätte sie nicht beachtet und dann hätte sie zu allem Nein gesagt und wäre fort und lebe seitdem so, in dieser Stille. Ich umarmte sie und trank die Milch der Bäume und wurde schön.
Der Sand schlief mit mir jede Nacht, da ich so schön geworden war.
Ich sah meine Eidechse nie wieder, sie hatte mich zu Gewässern gebracht und hatte mir gewunken und ich war fast gerührt gewesen. Ich wusste nicht weiter und verfiel in einen Traum von einem Traum und erwachte und war allein. Dies war furchtbar. Dann kam Ophelia zu mir und küsste mir die Brüste und sagte: ›Geh ins Kloster, geh ins Kloster!‹
Ich aber sagte, ich wolle nur ins Nichts, müsse aber erst Alles passieren. Sie sagte, es gäbe kein Nichts und ich jagte sie fort.
Dannflogich über die Gewässer, ich bestach den Wind und entblößte mich, verkaufte mich und schließlich unterschrieb er meinen Pakt und nahm mich mit. Ich erzählte ihm, einst einEMBRYOgewesen zu sein und er schaute mich mit düsteren Augen an und sagte: Wie schade, dass du jetzt einMENSCHbist.
Ruhig und dunkel war mein neues Nomadenland, in dem er mich absetzte. Ein Schloss stand in der Ferne und ich ging dahin. Ich wollte essen und baden. Das Schloss war jedoch leer und düster, und Spinnen und alte Männer lebten dort. Sie ließen mich ein, schwiegen mich an und gaben mir eine Brühe. Ich aß und schwieg und vermisste meine Eidechse, die ich Danaida nannte.
Die Männer sagten, sie wären hier, weil sie Verbrecher seien. Ich streichelte ihre alte Haut und ekelte mich, doch sie taten mir leid. Ich sagte, dass ich ihnen vielleicht vergeben könne und dass sie frei seien. Sie lachten mich aus und bespuckten mich und nannten mich Gotteslästerin, die Reue sei doch der einzige Grund, warum sie noch am Leben seien. Und soflogich raus, nachts, auf die Straße, die ins Nirgendwo führte und schrie und schrie so laut, dass das ganze Schloss in Flammen aufging und ich war glücklich. Für wenige Sekunden war ich das.
Ich ging weiter und kam zu den Menschen. Zu den Städten und den Monstern, die in den Städten hausten. Kam zu den Hunden, die hungrig rumlungerten und mir die Füße leckten, da ich ihnen Liebeswörterzuflüsterte. Ich kam zu den Menschen …
Opheliaflüstertemir weiterhin zu, mich verhöhnend: ›Du irrst dich …‹«
Sie schritt durch die Rue de la Grande-Chaumière. Sie hatte kurze, nein, lange Haare, dunkelbraun und spröde. Sie trug einen Männermantel und war blass, sehr blass. So musste sie sein. Zerbissene Lippen hatte sie und spitze, kleine Zähne. Sie war mager und hatte wundgeriebene Brustwarzen, die beim Gehen schmerzten. Sie schritt mit einer Stofftasche um die Schulter und offenen, wässrigen Augen, die stur vor sich hinschauten. Ihre Fingernägel – rosa und abgekaut. Die Nase spitz und errötet, vielleicht war sie erkältet und schlaflos. Sicher war sie das.
Sie blieb vor einem Schaufenster stehen, da stand eine Puppe in einem Hochzeitskleid. Sie blickte auf die Puppe, schaute ihr in die Augen und wollte sie erwürgen. Dann sah sie ihr Spiegelbild und schlug mit dem Gesicht gegen die Fensterscheibe, das Glas war stärker als sie, nichts passierte, nur ihre Nase begann zu bluten. Eine alte Dame hinter dem Fenster schrie kurz auf und sie rannte davon. Sie wischte mit dem Ärmel im Blut, verschmierte es am Kinn und dann ließ sie es sein.
Sie war siebzehn. Sie hatte gerade den Eros entdeckt, der sie manchmal in ihrem Zimmer besuchte und mit ihr Schach spielte, ohne ein Wort mit ihr zu wechseln. Er war blond und winzig, warm und rosa, und sie mochte ihn.
Plötzlich musste sie lachen. Ihre Augen, grau und leer, lachten auf. Ja, die Augen … Sie müssten grau sein und sehr klar und irgendwie tot, doch schön und hässlich zugleich. So müssten sie sein.
Sie blieb kurz stehen, sie war schnell gelaufen und machte jetzt halt. Suchte in ihrer Tasche nach Tabak und fand ihn, drehte sich eine Zigarette und suchte ein Streichholz. Fand keins und fragte ein Mädchen danach, das an ihr vorbeiging. Das Mädchen schaute sie etwas erstaunt an, dann überlegte sie und sagte: »Moment.« Sie wühlte in ihrer kleinen, grünen Damentasche und holte eine Streichholzschachtel hervor. Auf der Schachtel war ein Werbebild für ein Hotel irgendwo in der Provence.
»Sie haben Urlaub gemacht?«
»Wie bitte?«
»Diese Streichhölzer …«
Das Mädchen war hübsch. Sie hätte gern gewusst, ob das Mädchen mit einem Liebhaber oder noch mit ihren Eltern dagewesen war. Und außerdem schien sie Geld zu haben.
»Ach, ja, das ist aber lange her …«
Sie verzögerte das Spiel. Es machte Spaß. Aus dem Mädchen würde eines Tages eine schöne Dame werden mit einem Schoßhündchen und einer Garage mit automatischem Tor.
»Ich war noch nie in der Provence. Ist es schön dort?«
»Ja, sehr schön …«
Sie schien irritiert, aber nicht abgeneigt, also neugierig, also konnte es was werden. Bei solchen funktionierte der direkte Angriff am Besten.
»Hier in der Nähe ist die ›Crèmerie‹, ein nettes Lokal. Würdest du mir eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen spendieren? Ich würde dir dann eine schöne Geschichte erzählen.«
Die junge Frau starrte sie erschrocken an. Jetzt schien sie das Blut zu bemerken.
»Ich … ich muss gehen … mein Bruder …«
»Du hast doch gar keinen Bruder. Ich erzähle dir eine schöne Geschichte. Ich bin nur hungrig.«
»Ich weiß nicht … was willst du?«
»Ich habe es dir doch gerade gesagt. Mehr will ich nicht.«
»Ich gebe dir Geld und …«
»Nein, ich will nicht, dass du mir Geld gibst. Nur Kaffee und Kuchen.«
»Ich …«
»Komm einfach mit …«
Das Mädchen folgte ihr tatsächlich. Sie versuchte, das getrocknete Blut wegzuwischen.
»Ich bin einfach gegen ein Fensterglas gelaufen, hab es nicht bemerkt …«, erklärte sie und lachte. Das Mädchen lächelte verwirrt. Sie gingen in die ›Crèmerie‹ und nahmen am Fenster Platz. Der Kellner erkannte sie, wollte etwas sagen, sie blickte ihn an, er sah das andere Mädchen und verstummte.
Sie bestellte einen Kaffee und ein Stück Walnusstorte. Das Mädchen studierte verlegen das Menü.
»Ich empfehle dir eine heiße Schokolade und ein Croissant mitPfirsichfüllung, hier schmecken die Dinger himmlisch.«
Das Mädchen bestellte das Empfohlene. Sie schwieg und versuchte, sie nicht anzuschauen, dann nahm sie ein Zigarettenetui aus der grünen Tasche und steckte sich eine lange Zigarette zwischen die apricot geschminkten Lippen.
Sie streifte das Streichholz am Schachtelrand, spürte kurz die Flamme an ihrer Fingerkuppe, genoss den Duft und zündete ihr schließlich die Zigarette an.
»Ich heiße Saré. Und du?«
»Fanny.«
»Danke für die Einladung.«
»Ja …«
»Ich erzähl dir jetzt eine Geschichte.«
Sie begann von Niobe zu sprechen. Von ihren sieben Kindern und von ihrem Ruhm und Reichtum und ihrem Stolz und dass sie den Göttern nicht die Opfer brachte und damit die Leto erzürnte, die das Unheil über ihre Familie schickte und ihre Söhne töten ließ durch Apollon und Artemis, wie Niobe trotzdem stolz blieb und wie sie vor ihren Augen ihren Mann und die Töchter vernichtete und wie Niobe erstarrte in ihrem Schmerz und um Gnade bat und wie sie schließlich zum Stein wurde, der nicht aufhörte zu weinen. Fanny hörte ihr gebannt zu. Natürlich.
»Du kanntest die Geschichte nicht, stimmt’s?«
»Ich kannte sie nicht, nein.«
»Und so steht sie da, auf einem Berg, die zum Stein gewordene Königin und nichts kann sie wieder zum Leben erwecken.«
»Es ist traurig.«
»Ja, das auch.«
»Ich muss gehen.«
»Ich komme mit dir raus. Ich bin satt.«
»Warum machst du das?«
»Was?«
»Na ja. Das Ganze … erst mit der Geschichte und …«
Fanny starrte sie an. Ihre Augen – verwüstet und feurig. Sie mochte sie. Und sie wußte es. Sie gingen zusammen raus.
»Warst du mit deinem Liebhaber in der Provence?«
»Wie bitte?«
»Dein Urlaub?«
»Hm … er ist mein Verlobter.«
Fanny hatte schöne, blaue Augen und einen Schmollmund. Man hätte ihr Gedichte schreiben müssen … Ihr Verlobter schien Mist gebaut zu haben, das spürte sie. Denn Fannys Augen leuchteten nicht mehr, wenn sie das Wort Verlobter sagte.
»Du hast noch ein bisschen Blut unter der Nase.«
»Mach es weg. Bitte.«
Fanny war etwas größer als sie, sie beugte sich über sie und holte ein Taschentuch, weiß und bestickt, aus der Tasche ihres Mantels und versuchte das Blut wegzuwischen, aber das Blut war trocken, fest und Jahrhunderte alt.
»Du musst das Tuch mit deinem Speichel befeuchten.«
Sie näherte ihr Gesicht Fannys Gesicht und wartete. Fannys Blick – scheu. Aber dann presste sie ihre Lippen auf Fannys Lippen, und Fanny, überrumpelt und verängstigt, streckte impulsiv die Zunge raus und leckte ihr das Blut weg. Dann wandte sich Fanny ab und ging mit schnellen Schritten davon, erschrocken über die eigene Tat.
Sie schritt die Rue de la Grande-Chaumière entlang und blieb vor dem Schaufenster mit der Puppe stehen. Sie warf sich gegen das Glas, doch es passierte nichts. Sie schlug mit ihrer Tasche dagegen, es passierte trotzdem nichts.
»Ichverfluchedich! Ich hasse dich, du lebloses Miststück!«, schrie sie und dann … dann starb die Puppe und die ganze Straße verstummte, während die Wüste heimlich haydnsche Lieder sang. Bald würde sie zurück können …
Und der Traum eines Traums wurde wach und streichelte ihre Knöchel und leckte ihre Schläfen, sie wusste, es würde einmal vorbei sein …
Sie hatte jetzt eine andere Frau eingeweiht und fühlte sich gut. Sie schritt weiter …
2. BRUDER (1967)
Mutter: Trinkst du Tee, Chérie?
Bruder: Nein, Mutter, danke.
Mutter: Aber, Patrice, du musst doch diesen Kuchen probieren. Madeleine hat ihn extra für dich mitgebracht.
Bruder: Vielleicht später. Danke, Madeleine. Es ist sehr nett von dir …
Madeleine: Du gehst bald fort. Wir werden dich sehr vermissen, Patrice, aber wir sind sehr stolz auf dich. Das weißt du!
Mutter: Ja, es ist unglaublich. Im Wochenblatt wurde die Erzählung abgedruckt und ein Journalist von der Lokalzeitung war auch da. Er fragte sogar mich über Patrice aus. Es ist so aufregend …
Madeleine: Gott hat dich gesegnet, Patrice. Du musst stolz auf dich sein. In Paris wartet eine große Zukunft auf dich.
Bruder: Ich schreibe einfach nur Sachen und ihr macht ein solches Ereignis daraus.
Mutter: Aber, Patrice, das sind keine Sachen! Das sind wundervolle Novellen. Wie edel sie sind – und dieser Meinung bin nicht nur ich. Richtige Prachtstücke. Du sollst nicht so reden.
Madeleine (wird das Thema unangenehm): Und was wirst du studieren?
Bruder: Literaturwissenschaften und Französisch.
Madeleine: Wirklich wundervoll. Mein Jean will nach Lyon, er bekommt da eine Anstellung, in einer Bank, habe ich euch schon davon erzählt?
Mutter: Wirklich? Wie wundervoll.
Madeleine: Er ist sehr erfreut. Er will es zum Filialleiter bringen. Vielleicht kann er eines Tages hier bei uns eine Filiale leiten.
Mutter: Natürlich, Chérie.
Die Schwestern kommen heim. Man hört das Herumgekichere in der Diele. Er will eine Zigarette rauchen, oben, auf dem Balkon. Doch die Tortur geht weiter. Ein endloses Meer ist noch zu durchschwimmen.
Anne-Marie und Simone kommen rein. Simone trägt ein blödes Kleid, fällt ihm auf. Es steht ihr überhaupt nicht. Außerdem ist es draußen noch zu kühl für dieses Kleid. Aber Mone ist erträglicher als Anne. Findet er, auch wenn Anne besser aussieht und auch bessere Chancen im Leben hat, wie Mutter sagt. Zum Glück kann er weiter von der Zigarette träumen.
Madeleine: Ach, die Mädchen, lasst euch sehen. Wie hübsch ihr geworden seid. Wie alt bist du jetzt, Simone?
Simone: 19, Tante Madeleine.
Madeleine ist eine fette Kuh. Er hasst sie und will sie erwürgen und abschlachten und tief begraben und nie wieder sehen und nie wieder hören und nie wieder …
Bruder: Das sieht blöde aus, Mone.
Simone: Lass mich in Ruhe.
Mutter: Patrice, dass du immer so grob sein musst zu deinen Schwestern.
Madeleine: Ach, das ist das Alter, Chérie, mein Jean war auch so zu der Kleinen. Aber jetzt ist er sehr lieb.
Mutter: Na hoffentlich, hoffentlich. Zieht euch um, wascht euch die Hände und kommt, es gibt Kuchen. Tante Madeleine war so nett …
Anne quetscht sich zu ihm auf das Sofa. Sie ist schlank und blond und hat größere Titten als ihre ältere Schwester und malt sich die Lippen heimlich rot an, wenn sie aus dem Haus geht. Er weiß, dass Anne ihn hasst. Sie hasst ihn wegen ihres Geheimnisses aus der Novembernacht und er weiß es. Es macht nichts. Er will sie nicht verraten, aber manchmal erpressen – das tut gut.
Madeleine: Ich habe die Erzählung gelesen, wollte ich noch sagen, und fand sie verblüffend reif für dein Alter. Auch Jean las sie und fand sie gut.
Bruder (denkt): Du alte Fotze, halt die Klappe, ich hasse dich, ich kotze gleich …
Madeleine (seinenGedankenflussnicht wahrnehmend): Die Stelle, wo der Ritter verwundet wird, die hat mich sehr berührt. Wie du auf solche Sachen kommst, wirklich, unglaublich.
Mutter: Ja, das fragen wir uns alle, dieses Mittelalterliche faszinierte ihn allerdings schon seit dem Kindergarten. Weißt du noch, Patrice, wie ihr diesen Aufsatz in der Schule schreiben musstet? Über den Roland … den mochtest du so.
Bruder: Hm.
Simone kommt wieder ins Wohnzimmer rein. Sie hat sich tatsächlich die Hände gewaschen. Nimmt sich einen Teller und bringt einen für ihre Schwester mit. Wenn Mutter tot ist, wird Simone ihre Rolle übernehmen – das steht bereits fest. Absolut fest.
Simone:Hervorragend.Hast du den gebacken, Tante Madeleine?
Madeleine: Ja. Tu ich doch immer.
Simone: Wirklich zauberhaft. Musst mir unbedingt das Rezept geben.
Madeleine (lacht wie eine Hyäne,findeter): Gerne doch, gerne, liebe Monie.
Wie er diesen Namen hasst – Monie, Monie, wie ein Hamstername klingt er …
Bruder: Ich geh schon mal hoch, wenn die Damen gestatten.
Mutter (lacht blöd,findeter): Ach, bleib doch ein bisschen bei uns, Chérie. Seit du so viel schreibst, sieht man dich eh so selten.
Madeleine: Tja, das ist das Schicksal, das der Familie des Künstlers vorherbestimmt ist.
Mutter: Hahaha.
Pause, nichts geschieht. Anne beginnt zu essen und leckt sich dabei manchmal denZeigefingerab, was er zum Kotzenfindet. Sie macht ständig Sachen, die er zum Kotzenfindet. Mit Mone kann man wenigstens noch ein paar Wortewechseln.Pause,Pause, Pause.
Bruder denkt an sie. Wie gut, dass so was keiner wissen kann. Dann geht er nach oben. Unten noch die alten Geräusche, Mone isst jetzt auch den Scheißkuchen. Madeleine sieht aus wie einedurchgefickteGiraffe. Ermüdet, irritiert, zu langer Hals. Sie reden sicher weiterhin über ihn und seine »tolle Zukunft«.
Er freut sich auf Paris, weiß aber keinen Anfang. Doch alles ist besser als das hier. Er steht auf dem Balkon und raucht. Eine zerquetschte Packung Gitanes in seiner Hosentasche. Bald wird es ganz dunkel. Er freut sich auf das Klappern der Schreibmaschine. Nur nachts schreibt er, was er wirklich schreiben will. Texte, die etwas bedeuten. Texte, die groß sind und dunkel und heiß und bedrohlich. Und dann kann er sich lieben.
Diese Scheißstadt, die immer so tot sein muss und gleichgültig, dieser Teich und diese Idioten, diese Scheißidioten, die, die stolze Bürger sein sollen und diese Messen am Sonntag in der Kathedrale, in der die, die mehr Kohle haben, vorn sitzen dürfen. Er und seine Familie sitzen in der Mitte, besser fände er es, in der letzten Reihe zu sitzen, wäre immerhin was. Bloß dieser Scheißdurchschnitt immer, den hält er nicht aus. Die Wanduhr tickt im Zimmer, auf der Kommode stehen ein gerahmtes Bild von ihm und seiner Familie und dann noch eins von Vater, ganz links.
Er war sieben, als sein Vater starb, er denkt nicht viel an ihn, hofft nicht mal mehr, dass er anders gewesen wäre, war er eben nicht und erfindetes normal, mittlerweile. Mutter denkt, er schreibt, weil Vater starb und er traumatisiert ist. Er sieht auf die bestickte Decke unterm Foto. Wie ekelhaft dieser Verniedlichungsdrang überall …
Er raucht und der Himmel färbt sich violett, kurz kann er die Luft spüren. Und er spürt, dass bald der Sommer kommen wird, dass er gehen kann. Er kann so vieles erahnen, kennt keinen genauen Anfang, egal, immerhin wird es einen Anfang geben.
Der Rauch steigt nach oben, es ist angenehm warm. So ruhig. Ein paar ferne Stimmen klingen herüber, doch sie sind fast idyllisch, als gehörten sie nicht den Menschen, die er kennt und … die er nicht kennen will. Manchmal ist alles in Ordnung,findeter. Im Vergleich zu den letzten Jahren war dieses Halbjahr echt in Ordnung. Es war beinahe angenehm und er weiß, dass es an den Nächten liegt, in denen er schreibt.
Es liegt an ihr! Sie wird da sein in dieser Stadt, mit der er kaum etwas verbindet, außer einemAusflugmit Mutter und Anne. (Mone war krank. Arme Mone. Blöde Mone). Das ist jetzt auch schon ewig her. Ihn interessiert die Stadt auch nicht besonders. Dort kann er eben in Ruhe lesen und schreiben und Kurse besuchen. Das ist alles.
Schritte. Er sieht Annes blonde Mähne und dann ihr dummes Grinsen.
Anne: Gibst du mir eine?
Bruder: Wenn sie kommt, nehme ich dir das Ding aber nicht ab … Dann erwischt sie dich. Mir egal.
Anne: Ich werfe dann die Kippe weg.
Ihr Bruder zuckt die Achseln, gibt ihr eine Zigarette, sie holt eine Streichholzschachtel aus der Tasche ihres Hemdes, das sie aufder nackten Haut trägt. Er weiß, dass sie Büstenhalter ablehnt und Mutter sie deswegen immer wieder beschimpft.
Bruder: Ist die dumme Kuh endlich weg?
Anne: Nein, verdammt. Sie macht mich wahnsinnig.
Bruder: Mone sah heute echt blöd aus. Ist viel zu kühl für dieses Kleid.
Anne: Was mischst du dich da ein? Dass dich alles was angehen muss. Wieso? Ich frage doch auch nichts.
Bruder: Warum bist du immer so eklig?
Anne: Ach, Bruder … Ich verstehe dich nicht. Wirklich nicht. Du hast nicht mal Freunde, das ist doch krank!
Bruder: Halt den Mund!
Anne: Nein, oder dass du nie verliebt bist … Ich meine …
Bruder: Anne, halt den Mund, fang nicht wieder damit an, das nervt!
Sie rauchen und schweigen. Das Schweigen verschluckt alles und alle in diesem Haus. Irgendwann werden sie als Skelette enden, aufgefressen vom Schweigen. Er will nichts hören. Er will seine erkaufte,erpresste Freiheit genießen und daran ersticken, an nichts anderem.
Anne: Patrice, nimm mich mit, nach Paris. Ich hasse sie alle, das weißt du doch, nimm mich mit … Wenn ich auch nur noch ein paar Wochen bleibe, sterbe ich.
Er ist wütend auf sie: Warum muss sie bloß immer dieses blöde Zeug von sich geben? Dann muss er an diesen Novembernachmittag denken, als er nach Hause kam und die Tür ihres Zimmers halb offen stand und sie auf dem Boden, vor ihrem Bett kniete. Dort saß dieser Typ aus der Hockeymannschaft der Schule, nichts im Kopf und viele Muskeln, er hielt die Augen geschlossen und stöhnte, während sie seinen Penis ableckte. Er starrte hin, dann rannte er und rannte und musste weinen … Sie hatte seine Schritte gehört. Jetzt muss er wieder daran denken.
Wie gut, dass er bald geht.
Sie weiß, dass er daran denkt. Er denkt auch an all die Gewehre in Vaters Zimmer, die Mutter putzt und putzt. Alles bleibt so, wie es war, bevor er tot war, bevor man anrief und ihnen sagte, dass er tot war, und dies sagte ihnen eine Blondine namens Claudine, von der Versicherungsgesellschaft, er starb in ihrem Bett. Mutterpflegtall seine Gewehre, als könnten sie ihn wieder lebendig machen.
Anne hat große Augen, wässrig und manchmal schön,findeter. Der Himmel ist dunkel geworden. Madeleine setzt sich ins Auto, man sieht sie nicht. Anne drückt sich gegen die Wand, die Zigaretten glimmen in der Dunkelheit, sie rauchen jetzt schon ihre nächsten Zigaretten und sagen nichts.
Mone lacht kurz auf. Mutter ist sicher beleidigt, dass die zwei sich nicht von Madeleine verabschiedet haben. Anne wirkt nachdenklich. Er hasst sie trotzdem und kann nicht ertragen, wenn sie so dumm daher redet und so dumm lacht und so dumm weint und so dumm isst und dabei schmatzt und sich die Finger ableckt und sich daran so erfreut. Anne ist eine, die man nicht bemitleiden kann.
Der Himmel wird ruhig und schweigsam und das Licht am Hauseingang leuchtet weiter, nachdem Mutter die Tür zugemacht hat. Zweimal dreht sich der Schlüssel im Schloss. Er denkt an das Rauschen in seinen Ohren, während des Tippens. Alles wird gut.
Anne: Patrice, nimm mich mit …
Bruder: Hör auf, mach die Schule zu Ende und dann kannst du auch gehen.
Anne: Kann ich nicht da zur Schule gehen?
Bruder: Nein, du musst hier zur Schule gehen. Außerdem würde Mutter es nie zulassen.
Anne: Lass das … Bitte, bitte. Ich sterbe hier!
Bruder: Nein, wirst du nicht. Du hast doch Freunde hier, hä?
Anne: Tut mir leid, vorhin, das habe ich nicht so gemeint.
Bruder: Egal, es geht nicht.
Anne: Aber …
Bruder: Gehe bitte, ich muss schreiben …
Sie schaut ihn kurz verwirrt an. Er ist zufrieden, sie ist beleidigt. Sie wirkt sehr verängstigt, er sieht ihre Silhouette, hört, wie sie mit der Spitze ihres Lackschuhs gegen den Boden schlägt, tip, tip und dann dreht sie sich um, drückt die Zigarette an der Wand aus. Sie bleibt stehen undflüstertnur …
Anne: Ich hasse euch alle …
Sie geht. Er steht da, plötzlich ist es kalt geworden, so kalt, er will ins Haus, aber die Dunkelheitflüstertetwas, er will es hören, kann aber nicht, hat es nie gekonnt. Warum hat sie wieder so was Blödes gesagt und ihm die Laune verdorben? Mutter ruft von unten nach ihm. Ihm ist zum Heulen zumute. Alles wird gut, oder? Der Himmel zuckt nur mit den Achseln.
3. APIDAPI (2004)
Es ist Frühling und alle sind natürlich sehr, sehr glücklich und sie sitzt natürlich da und denkt an nichts und das Loch im Bauch wird immer größer. Und alles ist neblig und sie hat keine Lust zu gar nichts, zwingt sich an all die wichtigen Sachen zu denken, die sie machen muss, doch die sind im Nachhinein total unwichtig und dumm und all das nur, weil sie weibisch ist und genau das an sich hasst. Die banalste Geschichte, saublöd und uninteressant und unspektakulär … Nur nicht für sie. Wie sehr sie all diese Leute beneidet, die strahlend und angetrunken auf ihren Rädern radeln und sich mit Leuten verabreden und leichte Kleider tragen, da ihnen nie kalt ist. Und die abends ausgehen und einen Hund besitzen und ihrePflanzengießen und immer up to date sind und immer grinsen und neueste Haarschnitte haben. Und … der ganze Schwachsinn.
Morgens fährt sie zur Akademie, fährt mit dem alten Fahrstuhl zum Büro hoch, sitzt im Büro, bereitet etwas vor, tippt, geht in die Teeküche, raucht eine, geht wieder ins Büro und fragt sich, warum sie so zeitig gekommen ist, und geht dann, nachdem sie anderthalb Stunden totgeschlagen hat, in den Vorlesungsraum und redet und redet.
Letzten Sommer war sie sogar in Kanada, Natururlaub mit Spa und allem drum und dran, richtig luxuriös, erste Klassegeflogen, doch es hat nichts genutzt. Na ja. Eine Midlife Crisis? Wie lächerlich alles sein kann, fragt sie sich und geht in der Mittagspause einen Espresso trinken, da sie wieder mal schlecht geschlafen hat.
Einsam, ob sie einsam sei, fragte neulich ihre Schwester, die Rad fährt, zwei Kinder hat, einen Bauernhof in Belgien besitzt, Soul hört und immer sehr aufgeregt über Politik redet. Sie schweigt und antwortet: »Nein, eher trübselig …« Oder etwas in der Art. Sie schweigt, wartet bis die Schwester auflegt, doch die tut es nicht und wird es niemals tun, sie ist nämlich nett, nett und nochmals nett. Sie redet davon, dass sie nach Belgien kommen solle, zwei Wochen auf dem Land, Kinder, Ponys und Grillen und Tischtennis und sie könnten dort doch Party machen, es wären ja eine Menge nette Leute da. Dann sagt sie: »Ich glaube, das hat etwas mit der Trennung zu tun, alles hätte anders ausgehen können, hättest du nicht so hartnäckig auf der Scheidung beharrt und warum nur …« Bla bla bla. »Du warst vorher anders, Laura, echt anders.« Schließlich meint sie dann doch: »Du fehlst uns sehr.« »Uns«, das sind: sie selbst, die Kinder, der Hund und ihr Mann, der Belgier, der Laura nicht leiden kann. Damit war das Gespräch beendet.
Letzten Mittwoch rief Jeremy an, der Lover, so hatte sie ihn genannt, als er zwei Jahre in Lauras Bett hauste, vor einer Ewigkeit, als sie noch selbst nett war; und er fragte nach ihr und meinte, sie solle doch gerade jetzt, wo sie den zweiten Doktortitel bekommen habe und diese »great« wissenschaftliche Arbeit verfasst habe, von der »alle« redeten – da solle sie sich doch gerade »great« fühlen. Sie hörte nicht hin, sie dachte daran, wie es hatte sein können, dass sie mit ihm zwei Jahre lang geschlafen hatte und ihn für besonders gehalten hatte? Auch wenn sie damals noch nett und jung war, wie hatte es sein können? Jeremy, der englische Lover, der ultimative Mann für alle Frauen! Sie war sogar stolz gewesen, damals, dass er bei ihr hängen geblieben war und nicht bei irgendeiner anderen … Wie peinlich. Das alles war peinlich.
Er hatte immer »L’ora« zu ihr gesagt und sie hatte es schön gefunden, nicht sexy, sondern schön … Pur, hatte sie sogar dazu gesagt, und nun fand sie es genauso lächerlich wie ihren zweiten Doktor, wie ihr Dasein. Wie konnte man seinem Klischeeentfliehen?
Abends gab es Bücher und ihre Notizhefte und ein paar Telefonate, alles sehr kurz und höflich, es gab Kneipen zum Abendessen und Abendtrinken, Einladungen zu Events und tollen Partys und ihre Absagen und manchmal goss sie ihrePflanzen, spät. Dann kam die Nacht, die Schlaflosigkeit, Unruhe, Ekel und der Rest ein Schweigen.
Sie war es auch leid geworden, alles unbedingt recherchieren zu müssen, alles genauherausfindenzu müssen, und hatte es aufgegeben. Sie wollte nur noch eine tolle Wohnung besitzen und sie wollte nichts mehr müssen. Irgendwie war der Druck weg. Trennung? Danach hatte Jeremy auch gefragt, was hätte sie sagen sollen – na ja, ist schon okay.
Sie war gern bei ihm gewesen, sehr gern. Hatte mit 31 geheiratet, sie hatten sich drei Jahre gekannt.
»Ich bin abgestürzt, im Sprudel aller Weltlieben, war eifersüchtig und habe ihn verabscheut; es war sehr intensiv und unglaubwürdig und ich liebte seinetwegen sogar das Leiden und wurde zum weibischsten aller Weiber. Ich habe sogar sein Kind vom Kindergarten abgeholt, habe ihn da ja auch romantisch kennengelernt, als ich meine Nichte abholte, die von der netten Schwester, und ihn da getroffen, er holte seinen Sohn ab und sah gut aus und ich war gerade dabei, eine wissenschaftliche Reise zu planen und da sah ich ihn. Am nächsten Tag ging ich erneut meine Nichte abholen, keine Ahnung warum, er dachte, dass sie meine Tochter sei, das imponierte mir, zum ersten Mal im meinem Leben gefiel mir der Gedanke daran, eine Mutter zu sein und ich dachte an eine Affäre, schon, das ja, er sah ja gut aus.
Ich meine, ich hatte es bis dahin geliebt, eine Nacht mit jemanden zu verbringen, in einem Appartement, und dann Kaffee zu trinken und das vielleicht paar Mal zu wiederholen und dann zu gehen und er zufrieden, ich zufrieden und alles klar, ja, Klarheit sowieso, aber weißt du … Ich meine … dann sprach er mich an und er war an dem Tag ohne Auto und ich fuhr ihn samt seinem Sohn, der übrigens nicht süß aussah, wie ich fand, nach Hause und er bedankte sich und fragte, ob wir mal zusammen essen gehen würden, ja einfach so, fragte er, ich ging ja davon aus, dass er verheiratet war und er muss sich ja auch gedacht haben, dass es zu meinem Kind, also meiner Nichte, einen Vater gab, aber ich sagte: ›Ja, warum nicht?‹ So begann die romantischste Geschichte aller Zeiten … Er war geschieden, ich war frei und nach dem Restaurant gingen wir zu mir, er fand meine Wohnung ›geschmackvoll‹. Wir tranken Wein, aßen getrocknetePflaumenvom Asiamarkt an der Ecke, die kaufe ich immer, mag die nämlich sehr und dann … dann war es Wahnsinn, Himmel auf Erden, und er war so charmant und seine gebrochene Nase und diese vollen Lippen und dass er barfuß durch die Wohnung ging und wie er meinen Hals küsste und, und, und …
Es wurde eine lange Affäre, fast zwei Jahre, ab und zu, einmal im Monat oder zweimal die Woche, wie es eben ging. Manchmal las ich und er schaute mir zu oder fragte nach irgendwelchen sachlichen Dingen und ich redete und redete und er erzählte mir, dass er Arzt sei und ich dachte immer, dass er lügt, aber er war Arzt …
Ich liebte ihn, wollte Hunderte von Kindern von ihm, war sogar bereit, für ihn und seine Kinder fett zu werden, liebte seine Brusthaare und hasste seine Art, beim Orgasmus zu schweigen und liebte die Düsterheit in seinem Blick, weißt du … Irgendwann lief es nicht mehr so fantastisch.
Eines Tages ging er und kam nicht mehr und ich heulte, aber es war okay, fuhr nach Belgien, verbrachte eine nette Zeit mit netten Freunden und meiner netten Schwester, ich vergaß ihn und dann traf ich ihn, im Kino und er sagte kurz: ›Laura …‹ Und ich musste aufs Klo und heulen und ich hatte ihn eben genau sieben Monate nicht gesehen und dann legte er seinen Arm um mich, wir fuhren das erste Mal zu ihm undficktendie Nacht zu Tode … Es war great, wirklich great …
Und dann fragte er, ob wir nicht heiraten wollten und ich stammelte: ›Ich muss weg, ich muss weg, ich muss zur Akademie!‹ und am gleichen Abend rannte ich hin und sagte: ›Ja, ja, unbedingt‹ Irgendwie, irgendwie würde es gehen.«
All dies hätte sie sagen können, dem Lover oder der Schwester oder irgendwem, doch es würde eh nichts bringen. Nur manchmal dachte sie daran, dass es ein schlimmer Anblick war, ein totes Kind aus dem Leib gezerrt zu bekommen, alles andere hielt sich im Rahmen, man hätte ja an arme Kinder in Afrika denken können, an Weltschmerz und Armut oder die Prostituierten in Thailand, und zwar wirklich unironisch, man könnte ja alles relativieren, nur dieser Anblick, damals am heißen Juliabend, in der Klinik, er war so schlimm gewesen, war furchtbar und beängstigend und herzzerreißend, ihr Blut hatte bedrohlich gerochen und sie hatte Angst bekommen und das Baby trotzdem halten wollen und ansehen und ihm gar einen Namen gegeben: David. Ja, man hätte über alles reden können.
Ihr Ehemann und sie und das totgeborene Baby und ihr Leben im Allgemeinen und na ja …
Vor vier Monaten war sie zum zweiten Mal Doktor geworden, hatte sich das erste Mal die Haare dunkler gefärbt, hatte sich ein neues Auto gekauft undAPIDAPIdarauf geklebt. Es war irgendein Werbeschild, rosa Buchstaben und sehr kitschig, doch sie fand es unglaublich lustig, den Klang von diesen Buchstaben, und klebte ihn auf ihren Wagen. Das Auto wirkte weniger schick durch den Aufkleber und alle meinten, sie sei milder geworden …
Alle würden sie bestimmtAPIDAPInennen, vor allem die Studenten und die Jungs würden sicher nicht mehr irgendwelche erotisch-perversen Fantasien ausleben können, nachts im Bett, im Studentenwohnheim, an sie denkend, da der Name ja so albern war, es sei denn, sie waren pädophil veranlagt.
Wie lustig.
Und sie war herumgefahren mit ihremAPIDAPI(der Wagen hieß jetzt auch so) und einmal hatte sie sogar die Mappen kurz mitAPIDAPIunterschrieben und als sie den Preis der Königlichen Akademie verliehen bekommen hatte (Beste Forschungsarbeit,danke, danke, Frau Van Den Ende), hatte sie sogar den Gedanken gehabt, einfach so, eine Danksagung anAPIDAPIzu machen, damitsich alle darüber den Kopf zerbrechen, hatte sich aber nicht getraut.
APIDAPIwurde bald zu einem anderen Ich, zum besten Freund, zu etwas in ihr, zum Lieblingsteddy, zum geduldigen Welpen an ihrer Seite. Sie putzte das Schildchen am Wagen regelmäßig und fand sich unglaublich komisch.
Sie liebte ihren Job, war eine gute Dozentin, eine gute Kunstwissenschaftlerin, begabt in Sprachen …
Ach, Jeremy, du Lover du, ich kann dir nichts sagen, man schweigt sich an und so lebt man. Ich forsche und forsche und dufickstundfickstdich durchs Leben (tun wir ja alle ein bisschen, sei mir nicht böse) aber lass mich bitte in Frieden. Das hatte sie gedacht, nach dem mühsamen Telefonat und hatte sich einen Grappa genehmigt. So lief’s, so lief’s.
4. DIE EISZEIT / BUCH 1 (1953)
»Ich werde nicht mehr reden. Ich bin nur ein Staubklotz, schwerer als ein Stein …
Heute Nacht kommt der kleine Eros zu mir, ich werde mit ihm Schach spielen und dann wird die Zeit still stehen und nichts, nichts uns umgeben. Auch der Raum wird raumlos und geräuschlos und stumm, wir sind verloren, sagte mir nachts Ophelia, nichts und niemand kommt und rettet …
Das Alleinsein umgibt meine Schläfen, ich bin ruhig, sage ich zu mir. Aber ich lüge.
Ich frage nichts mehr, ich denke an meine Eidechsen, ich denke an meine toten Freunde, der Wahrheit entzogen, im Nichts verloren; ich beneide sie, ich habe überlebt, nur weil ich ein Mensch war. Aber auch ich lerne den Stillstand.
Ich bin ein Gerüst, ein Gerüst meinesICHS. Ich bin nur ein kleiner, spazierender Hass, ich gehe und weiß nicht wohin, mein Weg ist rund, kugelrund, endet nie. Während ich gehe, verblute ich, doch niemand sieht die Blutspuren in der schwarzen Erde.
Ich möchte fort, zurück in die Wüste, wie kommt es, dass ich hier gelandet bin? Ich war doch einEMBRYOund wusste alles. Ich werde langsam schwanger am Schweigen.
Ich kenne das Du nicht, denn beides trage ich in mir, ich habe tausend Geschlechter in mir, ich verleugne die Tatsachen.«
Du bist einsam. Was wäre, gestände sie es sich ein? Nein, sie darf es nicht, noch nicht. Sie soll noch ihren Wuchtgöttern dienen. An all das glauben, woran sie glauben will. Das ist wichtig.
Sie hat ein kleines Zimmer gemietet in der Rue Bonaparte, im Dachgeschoss, es kostet wenig Miete; der Hausmeister, ein alter Greis, taugt nichts. Die Concierge – eine Alkoholikerin und halb blind vor Schnaps.
Sie weiß nur noch nicht, wo sie anfangen soll. Sie will sich so sehr mit dem Tod duellieren. Das wäre vielleicht ein Anfang.
Sie ging von zu Hause fort. Ein kleiner Ort, nicht allzu weit von Paris, doch weit genug. Eine Mutter und zwei Schwestern. Nicht viel an Hab und Gut, doch genug. Vater gab es keinen, es hieß, er sei im Krieg verschollen.
Sie konnte eh immer nur mit Gespenstern sprechen, die Menschen langweilten sie. In der Mädchenschule der Heiligen Rita gab es Probleme, man sagte, sie sei ein »ungezogenes Mädchen.« Nach der 9. Klasse ging sie ab. Die Frau, die sie geboren hatte, die sie nicht Mutter nannte, wollte sie ins Internat geben, doch sie verließ nachts den Ort. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen.
In der Gemeinde gab es einen Maler, aus dem nichts geworden war, der Kinder unterrichtete, und den mochte sie. Er hinkte ein wenig. Auch das mochte sie. Er sagte zu ihr, sie sei eine »Künstlernatur«. Auch er erwies sich als ein Narr.
Sie klaute Geld und ging. Die Frau, die sie geboren hatte, würde eine Weile nach ihr suchen, doch hatte sie ohnehin genug Sorgen und zu jener Zeit suchten so viele Menschen nach ihren Männern, Frauen und Kindern, dass sie nicht weiter auffallen würde.
Sie zieht sich aus. Das Zimmer – kalt. Keine Heizung. Für Wärme kein Geld. Geld ist so hässlich. Einen Ort zum Alleinsein brauchte sie. Ihre Kammer. Für ihre Kammer schlief sie früher ab und zu mit den Männern aus der Eckkneipe, in der sie manchmal ein Bier trinken ging. Einem schnitt sie mit einem Rasiermesser in den Oberschenkel, er hatte so furchtbar gestunken und Dinge von ihr verlangt, die sie nicht tun wollte. Erfluchteund schimpfte und sie rannte davon; seitdem ging sie nicht mehr in die Kneipe.
Sie zieht sich aus. Ein kleiner Spiegel an der Wand, links. Sonst nichts. Die Leere ist wichtig. Sie hat lange Haare, ja, muss lange Haare haben. Kleine Brüste, etwas zu groß geratene Knie, blass ist sie und kalt. Die Königin aus der Arktis. Ein trauriges Liebeslied singend, steigt sie in die Badewanne (ein Schrottteil, das sie mit dem Mann aus dem Gemüseladen hochgetragen hat, dem sie ihre Brüste gezeigt hat für seine Arbeit), die mitten im Zimmer steht. Lauwarmes Wasser. Kalte Füße, sehr kurz geschnittene Nägel. Wie blass sie ist. Ihr Bauch – hart undflach. Keine schöne Frau, aber sie hat einen Orkan in sich. Alle Schönheit durch ihren Willen niederschmetternd. Schönheit ist so vergeblich und übel riechend.
Sie steigt ins Wasser, lehnt den Kopf zurück. Sie breitet die Beine aus, lässt sie aus der Badewanne hängen. Die Lilien steigen aus dem Wasser empor. Das Wasser wird zum Sand, gräbt sie ein, sie lacht und bewegt sich hin und her. Ihre Schamhaare bilden einen dunklen Fleck im Kristall des Wassers. Sie kehrt nach Babylon zurück. Sie lacht und lacht, jemand klopft an die Decke. Verreckt doch alle!
Aus ihrem Haar wachsen Schlangen, Ungeheuer tragen sie auf Händen. Bald wird Nacht. Sie liegt in der Badewanne, vertreibt den Hunger. Aus ihrem langen, formlosen Arm wird eine Armee. Ihre Armee, die sie beschützt.
5. FRAU (2004)
Lynn kommt bald heim. Essen machen. Es ist so schwer, von dieser Couch aufzustehen und zu gehen, etwas zu tun. Schnell dieScotchflascheverstecken.
Alle sagen, sie hätte Probleme. Sie hat keine. Keine mehr. Ihre Probleme sind tot. Ein paar Hotdogs gibt es im Kühlschrank, die kann man im Ofen aufwärmen.
Sie war eine schöne Frau. Hoch gewachsen, etwas dürr vielleicht, doch viele Männer waren scharf auf sie. Gewesen.
Der Fernseher läuft. Ein fetter Mann redet irgendeinen Schwachsinn über eine aussterbende Rasse von Gürteltieren. Interessiert sie einen Scheißdreck.JETZT EINE BADEWANNE, JETZT EIN BLUTBAD ANRICHTEN …Das wäre jetzt gut, nicht aber dieser Fette im Bildschirm, noch dazu in einer Latzhose und diese Hotdogs. Warum nur? Was hat sie damit zu tun? Nichts … ach, ja, Lynn. Sie kommt bald heim.
IN DIE STEPPE GEHEN UND HEULEN WIE EIN GRAUER, EINSAMER WOLF …Wie kann man nur so leer sein?
Ach, Francesca, hör doch auf, würde ihr Sohn sagen, der für immer Fünfjährige, der nie mehr wachsen wird. Hotdogs machen Winke-Winke, die gleiche Armbewegung, die sie als Kind machen musste, wenn die Grannies weggefahren sind, die Lieben. Sie mochte ihre Oma nicht, Opa war okay.
Ist dieScotchflascheweg? Schon versteckt, hinter der Waschmaschine, da sieht Lynn eh nicht nach. Lynn, Lynn … Sie hat in zwei Wochen Geburtstag, wie furchtbar, sie wird immer älter, während der Sohn für immer fünf bleibt. Tja, Darling, that’s life – sagen die Hotdogs.
Ernüchternd, diese Wände, diese Küche, dieser Boden mit den ach so bekannten Flecken. Bald ist Abend, es wird kühl, die Autos hören auf zufluchenund sie kann ein bisschen Musik hören, vielleicht, oder ins »Milly’s« gehen. Oder vielleicht kann sie Lynn zum Freilichtkino überreden.
»Mom?«
»Ja, Lynny?«
»Bin schon daaa.«
»Gut, ich mache ein paar Hotdogs warm und es gibt noch ein bisschen Salat. Hast du Hunger?«
»Eigentlich nicht, Mom.«
Die Stimme ist fern, sie ist gleich nach oben gegangen. Toll. Die Hotdogs bräunen im Ofen. Zum Glück. Sie hätte gern gesehen, ob Lynn geschminkt aus der Schule kam. Sie kommt aber eh bald runter, und dann sieht sie, ob sie gerade ihr Gesicht gewaschen hat oder nicht. Lynn, die Gute.
ALL DIE TRAURIGEN LIEBESLIEDER UND SONNENUNTERGÄNGE UND DIE FALLENGELASSENEN T-SHIRTS AUF LEERENPARKPLÄTZEN; ROSA UND BLAU MIT AMERIKANISCHER FLAGGE DRAUF ODER MIT DER AUFSCHRIFT:LOVE ODER: PEACE UND ALL DIE SINNLOS GEWORDENEN WORTE. SO SCHMECKT DIE WELT, NACHDEM MAN AUS DEM KARUSSELL RAUSGESPRUNGEN IST, ALS DAS PFERDCHEN NOCH VOLL IM SCHWUNG WAR …
»Ich trink einen Eistee, du auch?«
Jetzt ist Lynn da. Und natürlich war sie geschminkt gewesen, das Gesicht ist frisch gewaschen. Bestimmt stark geschminkt. Dumm gelaufen, würde sie gern sagen, wird sie aber nicht. Lynn trägt ein langes Hemd und eine alte Leinenhose. Sie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrer Mom, aber keine auffallende. Ist besser so. Am Tisch wieder die bemühte Lockerheit von Lynn.
»Alles in Ordnung, Mom?«
»Ja, klar.«
»Hast du was …«
»Nein, ich habe nichts getrunken. Lust auf Kino, heute Abend?«
»Nee, Mom, lieber nicht, ich bin schon mit ein paar Freunden verabredet, wir gehen tanzen. Bist du sauer?«
»Nein, ist okay.«
»Gut, ein Glas Eistee?«
»Nein, danke.«
»Schaust du fern?«
»Nee, eigentlich nicht.«
»Dann mache ich’s aus. Es nervt.«
»Okay. Wie war’s in der Schule?«
»Ganz okay.«
»Hm.«
»Geh doch aus, ruf Jen an oder … Würde dir gut tun.«
»Lynn?«
»Ja, Mom?«
»Ich … ich …«
»Was, Mom?«
ICH KANN NICHT MEHR. ICH WÜRDE SO GERN IN 1000KLEINE TEILCHEN ZERSPRINGEN UND FLIEGEN KÖNNEN. WÄRE JA GEWICHTSLOS … ES TUT WEH, LYNN, DU BIST SO SCHÖN GEWORDEN. DU HAST ALLES VERGESSEN, ICH KANN ES NICHT. LYNN, MEIN LIEBLING, ICH KANN EINFACH NICHT. UND MANCHMAL DENKE ICH, ICH KÖNNTE AUFHÖREN ZU ATMEN UND NICHTS WÄRE ANDERS, ALS HÄTTE ES MICH NICHT GEGEBEN, WEISST DU? NIE, NIE, ALS HÄTTE ES MICH ÜBERHAUPT NICHT GEGEBEN. LYNNY, ICH BIN AM ARSCH …
»Ja?«
»Du hast etwas gesagt.«
»Ach, ja, war nicht so wichtig, hab’s vergessen.«
»Alles okay, Mom?«
»Ja, Lynn.«
»Sag doch nicht immer meinen Namen.«
»Ich tue es doch gar nicht.«
»Doch, nach jedem Satz sagst du: Lynn.«
»Aber, Lynn …«
»Siehst du …«
»Na gut, ich sag es nicht mehr.«
»Du siehst blass aus, Mom. Geh ein bisschen spazieren, ruf jemanden an, gehe aus, wäre echt gut.«
»Ja, vielleicht mach ich das, vielleicht sollte ich …«
Lynn steht auf, lächelt kurz. Sie beugt sich leicht, sie ist groß, fast die Größte in ihrer Klasse und ungeschickt in ihrem neu erwachten Körper. Sie trägt immer so hässlich breite Sachen, die ihren Körper verdecken und schminkt sich dabei wie eine vom Strich; als würde ihr Gesicht nicht zu dem Körper gehören, den sie versteckt.
Lynn hat in zwei Wochen Geburtstag. Ihre Locken hat sie mit einem Kugelschreiber hochgesteckt. Lynn, die Gute.
Lynn berührt leicht ihre Schulter, kumpelhaft und korrekt, wie Lynn immer ist, und rennt nach oben. Auf dem Tisch ein leeres Glas, eine Spur bräunlicher Flüssigkeit bleibt übrig. Dann riecht sie es und hört es. Die Hotdogs im Ofen, die verbrennen und verkohlen. Sie rennt zum Ofen und stellt ihn ab, doch es ist zu spät.
Die Hotdogs verkohlt. Das Glas leer und der Fernseher aus.
Lynn oben, sie unten, und draußen schleicht die Dämmerung heran.
6. OLGA (1986)
Warum man sie Olga genannt hatte, hatte sie vergessen. Bis zu dem Tag, an dem Olgas Leben sich katastrophal ändern sollte, war nichts Gravierendes passiert.
Olga hatte ihre Vorlesungen besucht und war dann mit ihrem Hund spazieren gegangen, einem goldenen Spaniel, Lydia. Olga war 23 Jahre alt und ein nettes Mädchen, hatte russische Vorfahren, konnte aber kein Wort Russisch und hieß auch nicht Olga, hatte einen noch durchschnittlicheren Namen, einen westeuropäischen, doch das ist jetzt egal.