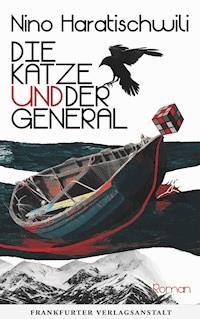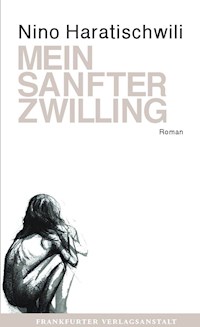Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Georgien, 1900: Mit der Geburt Stasias, Tochter eines angesehenen Schokoladenfabrikanten, beginnt dieses berauschende Epos über sechs Generationen. Stasia wächst in der wohlhabenden Oberschicht auf und heiratet jung den Weißgardisten Simon Jaschi, der am Vorabend der Oktoberrevolution nach Petrograd versetzt wird, weit weg von seiner Frau. Als Stalin an die Macht kommt, sucht Stasia mit ihren beiden Kindern Kitty und Kostja in Tbilissi Schutz bei ihrer Schwester Christine, die bekannt ist für ihre atemberaubende Schönheit. Doch als der Geheimdienstler Lawrenti Beria auf sie aufmerksam wird, hat das fatale Folgen ... Deutschland, 2006: Nach dem Fall der Mauer und der Auflösung der UdSSR herrscht in Georgien Bürgerkrieg. Niza, Stasias hochintelligente Urenkelin, hat mit ihrer Familie gebrochen und ist nach Berlin ausgewandert. Als ihre zwölfjährige Nichte Brilka nach einer Reise in den Westen nicht mehr nach Tbilissi zurückkehren möchte, spürt Niza sie auf. Ihr wird sie die ganze Geschichte erzählen: von Stasia, die still den Zeiten trotzt, von Christine, die für ihre Schönheit einen hohen Preis zahlt, von Kitty, der alles genommen wird und die doch in London eine Stimme findet, von Kostja, der den Verlockungen der Macht verfällt und die Geschicke seiner Familie lenkt, von Kostjas rebellischer Tochter Elene und deren Töchtern Daria und Niza und von der Heißen Schokolade nach der Geheimrezeptur des Schokoladenfabrikanten, die für sechs Generationen Rettung und Unglück zugleich bereithält. "Das achte Leben (Für Brilka)" ist ein epochales Werk der auf Deutsch schreibenden, aus Georgien stammenden Autorin Nino Haratischwili. Ein Epos mit klassischer Wucht und großer Welthaltigkeit, ein mitreißender Familienroman, der mit hoher Emotionalität über die Spanne des 20. Jahrhunderts bildhaft und eindringlich, dabei zärtlich und fantasievoll acht außergewöhnliche Schicksale in die georgisch-russischen Kriegs- und Revolutionswirren einbindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1803
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Inhalt
Prolog oder Die Partitur des Vergessens
Buch 1 – Stasia
Buch 2 – Christine
Buch 3 – Kostja
Buch 4 – Kitty
Buch 5 – Elene
Buch 6 – Daria
Buch 7 – Niza
Buch 8 – Brilka
Es sind die Zeiten, die herrschen, nicht die Könige.
Georgisches Sprichwort
Für meine Großmutter, die mir 1000 Geschichten und ein Gedicht schenkte.
Für meinen Vater, der mir eine Tasche voller Fragen hinterließ.
Und für meine Mutter, die mir sagte, wo ich die Antworten suchen soll.
PROLOGoder DIE PARTITUR DES VERGESSENS
2006
Eigentlich hat diese Geschichte mehrere Anfänge. Ich kann mich schwer für einen entscheiden. Da sie alle den Anfang ergeben.
Man könnte diese Geschichte in einer Berliner Altbauwohnung beginnen – recht unspektakulär und mit zwei nackten Körpern im Bett. Mit einem siebenundzwanzigjährigen Mann, einem gnadenlos talentierten Musiker, der gerade dabei ist, sein Talent an seine Launen, an die unstillbare Sehnsucht nach Nähe und an den Alkohol zu verschenken. Man kann die Geschichte aber auch mit einem zwölfjährigen Mädchen beginnen, das beschließt, der Welt, in der sie lebt, ein Nein ins Gesicht zu schleudern und einen anderen Anfang für sich und ihre Geschichte zu suchen.
Oder man kann ganz weit, zu den Wurzeln, zurückgehen und dort beginnen.
Oder man fängt die Geschichte mit allen drei Anfängen gleichzeitig an.
In dem Moment, wo Aman Baron, den man meist unter dem Namen »der Baron« oder auch nur »Baron« kannte, mir gestand, dass er mich herzzerreißend schlimm, unerträglich leicht, zum Schreien laut und sprachlos leise liebte – das mit einer etwas kränkelnden, geschwächten, illusionslosen und bemüht harten Liebe –, verließ meine zwölfjährige Nichte Brilka ihr Amsterdamer Hotel und ging Richtung Bahnhof. Sie trug nur eine kleine Sporttasche bei sich, besaß kaum Bargeld und hatte ein Thunfischsandwich in der Hand. Sie wollte nach Wien und kaufte sich ein billiges Wochenendticket, das an Regionalzüge gebunden war. An der Rezeption hatte sie einen handgeschriebenen Zettel hinterlassen, auf dem stand, dass sie nicht vorhabe, mit der Tanzgruppe wieder in ihre Heimat zurückzukehren, und es vergeblich sei, nach ihr zu suchen.
In genau diesem Moment zündete ich mir eine Zigarette an und bekam einen Hustenanfall – teils aus Überforderung wegen dem, was ich zu hören bekam, teils wegen des Rauches, an dem ich mich verschluckt hatte. Aman, den ich selbst niemals »den Baron« nannte, kam sofort zu mir, klopfte mir so hart auf den Rücken, dass mir die Luft wegblieb, und sah mich fassungslos an. Auch wenn er nur vier Jahre jünger war als ich, fühlte ich mich um Jahrzehnte älter, und außerdem war ich gerade auf dem besten Weg, eine tragische Figur zu werden. Ohne dass es jemandem groß auffiel, denn ich war mittlerweile eine Meisterin der Blendung.
An seinem Gesichtsausdruck erkannte ich seine Enttäuschung – meine Reaktion hatte er nach seinem Geständnis nicht erwartet. Vor allem nicht, nachdem er mir angeboten hatte, gemeinsam mit ihm auf die Tournee zu gehen, die er in zwei Wochen antreten wollte.
Draußen begann es leicht zu regnen, es war Juni, ein warmer Abend mit schwerelosen Wolken, die den Himmel schmückten wie kleine Wattebäuschchen.
Als ich den Anfall überstanden und Brilka den ersten Zug ihrer Odyssee bestiegen hatte, riss ich die Balkontür auf und ließ mich auf das Sofa fallen. Ich hatte das Gefühl zu ersticken.
Ich lebte in einem fremden Land, hatte den Kontakt zu den meisten Menschen, die ich einst geliebt hatte und die mir früher etwas bedeutet hatten, abgebrochen und eine Gastprofessur angenommen, die zwar meine Existenz sicherte, aber nichts mit mir zu tun hatte.
An dem Abend, an dem er mir sagte, dass er mit mir normal werden wolle, fuhr Brilka, die Tochter meiner toten Schwester und meine einzige Nichte, nach Wien, an einen Ort, den sie sich als ihre Wahlheimat ausgemalt hatte, als ihre persönliche Utopie, und das alles aus Verbundenheit mit einer toten Frau. Diese tote Frau, meine Großtante und somit Brilkas Urgroßtante, hatte sie in ihrer Fantasie zu ihrer Heldin gemacht. Sie plante, in Wien die Rechte für die Lieder ihrer Urgroßtante zu bekommen.
Und den Spuren dieses Gespensts folgend, hoffte sie auf Erlösung und die endgültige Antwort auf die gähnende Leere in sich. Aber das alles ahnte ich damals noch nicht.
Nachdem ich mich auf das Sofa gesetzt und mein Gesicht in die Hände gelegt hatte, nachdem ich mir die Augen gerieben und Amans Blick so lange es ging ausgewichen war, wusste ich, dass ich wieder würde weinen müssen, aber nicht jetzt, nicht in diesem Moment, wo Brilka aus dem Zugfenster das alte, neue Europa an sich vorüberziehen sah und zum ersten Mal seit ihrer Ankunft auf dem Kontinent der Gleichgültigkeit lächelte. Ich weiß nicht, was sie beim Verlassen der Stadt mit diesen winzigen Brücken sah, das sie zum Lächeln brachte, aber das ist nicht mehr wichtig. Hauptsache, sie lächelte.
Ich würde weinen müssen, dachte ich in gerade dem Moment. Um es nicht zu tun, drehte ich mich um, ging ins Schlafzimmer und legte mich hin. Lange musste ich nicht auf Aman warten, eine Trauer wie die seine kann man sehr schnell heilen, wenn man Heilung mit dem Körper anbietet – vor allem, wenn der Kranke siebenundzwanzig ist.
Ich küsste mich selbst aus meinem Dornröschenschlaf.
Und als Aman seinen Kopf auf meinen Bauch legte, verließ meine zwölfjährige Nichte die Niederlande und fuhr in ihrem nach Dosenbier und Einsamkeit stinkenden Abteil über die deutsche Grenze, während viele hundert Kilometer entfernt ihre nichts ahnende Tante einem siebenundzwanzigjährigen Schatten die Liebe vortäuschte. Sie durchquerte Deutschland, in der Hoffnung, voranzukommen.
Nachdem Aman eingeschlafen war, stand ich auf, ging ins Bad, setzte mich auf den Rand der Badewanne und begann zu weinen. Mit Jahrhunderttränen beweinte ich die Vortäuschung der Liebe, die Sehnsucht nach dem Glauben an die Worte, die einst mein Leben so stark geprägt hatten. Ich ging in die Küche, ich rauchte eine Zigarette und starrte aus dem Fenster. Es hatte aufgehört zu regnen, und aus irgendeinem Grund wusste ich, dass etwas geschah, etwas in Gang gesetzt worden war, irgendetwas außerhalb der Wohnung mit den hohen Decken und den verwaisten Büchern. Mit den vielen Lampen, die ich so eifrig gesammelt hatte, als Ersatz für den Himmel, als eine Illusion des wahren Lichts. Die Beleuchtung meines eigenen Tunnels. Aber der Tunnel war geblieben, die Lichter hatten mich nur kurz, nur vorübergehend trösten können.
Vielleicht muss man noch sagen, dass Brilka ein sehr hochgewachsenes Mädchen war, fast zwei Köpfe größer als ich, was bei meiner Größe nicht so schwer ist, eine raspelkurze Jungenfrisur und eine John-Lennon-Brille trug, in alte Jeans und ein Holzfällerhemd gekleidet war, mit perfekt gerundeten Kakaobohnenaugen, die stets nach Sternen suchten, mit einer endlos hohen Stirn – hinter der viel Kummer verborgen lag. Gerade war sie ihrer Tanzgruppe entflohen, die einen Gastauftritt in Amsterdam hatte, sie tanzte die Männerparts, weil sie für die folkloristischen, sanften Frauentänze aus unserer Heimat ein wenig zu schrill, zu groß, zu düster war. Nach langem Bitten erlaubte man ihr schließlich, als Mann verkleidet aufzutreten und die wilden Gebärden zu tanzen; ihr langer Zopf war im letzten Jahr dieser Erlaubnis zum Opfer gefallen.
Sie durfte Kniesprünge und Degengefechte aufführen, die ihr schon immer besser gelangen als die wellenförmigen, verträumten Bewegungen der Frauen. Sie tanzte und tanzte für ihr Leben gern, und nachdem man ihr für das holländische Publikum auch einen Solopart gab, weil sie so gut war, so viel besser als die jungen Männer, die sie anfangs belächelt hatten, verließ sie die Truppe, auf dem Weg zu ihren Antworten, die ihr auch der Tanz nicht geben konnte.
Am nächsten Abend rief mich meine Mutter an, die mir jedes Mal drohte, zu sterben, wenn ich nicht bald zurückkäme in meine Heimat, aus der ich vor vielen Jahren geflohen war. Sie teilte mir mit zittriger Stimme mit, dass »das Kind« verschwunden sei. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, von welchem Kind die Rede war und wie das Ganze mit mir zusammenhing.
– Also, noch mal, wo genau ist sie gewesen?
– In Amsterdam, was ist mit dir los, verdammt? Hörst du mir nicht zu? Sie ist gestern abgehauen und hat eine Nachricht hinterlassen. Ich wurde von der Gruppenleiterin angerufen. Man hat alles auf den Kopf gestellt und …
– Warte, warte, warte. Wie kann ein elfjähriges Mädchen aus einem Hotel verschwinden, vor allem, wenn sie …
– Sie ist zwölf. Sie ist im November zwölf geworden. Du hast es natürlich vergessen. Wie konnte es denn auch anders sein.
Ich nahm einen tiefen Zug von meiner Zigarette, bereitete mich auf das Unheil vor, das mir bevorstand. Denn nach der Stimme meiner Mutter zu urteilen, würde ich mich nicht so schnell aus der Affäre ziehen und verschwinden können; meine allerliebste Beschäftigung der letzten Lebensjahre. Ich wappnete mich für die obligatorischen Vorwürfe, die allesamt darauf zielten, mir weiszumachen, welch eine schlechte Tochter und welch ein gescheiterter Mensch ich war. Dinge, die ich auch ohne meine Mutter allzu gut wusste.
– Okay, sie ist zwölf geworden, ich habe es eben vergessen, aber das trägt nun nichts zur Sache bei. Hat man die Polizei eingeschaltet?
– Ja, was denkst du denn? Man sucht sie.
– Dann wird man sie auch finden. Sie ist ein kleines, verzogenes Mädchen mit einem Touristenvisum, wie ich vermute, und sie …
– Hast du eigentlich noch einen Funken Menschlichkeit in dir?
– Tut mir leid. Ich versuche nur, laut zu denken.
– Umso schlimmer, wenn es deine Gedanken sind.
– Mama!
– Sie werden sich bei mir melden. In maximal einer Stunde, sagten sie, und ich bete, dass man sie findet, schnell findet. Und dann will ich, dass du hinfährst, wo immer sie auch ist, sehr weit wird sie nicht gekommen sein, und ich will, dass du sie holst.
– Ich …
– Sie ist die Tochter deiner Schwester. Und du wirst sie holen. Versprich es mir!
– Aber …
– Tu es!
– Oh Gott. Ist ja gut.
– Und nimm den Namen Gottes nicht in den Mund.
– Darf ich jetzt nicht mal »Oh Gott« sagen, oder was?
– Du wirst sie zu dir holen. Und dann setzt du sie in den Flieger.
In der gleichen Nacht fand man sie in einer kleinen österreichischen Stadt, kurz vor Wien. Wo sie auf einen Anschlusszug wartete und von der österreichischen Polizei aufgegriffen und auf die Wache mitgenommen wurde. Meine Mutter weckte mich und teilte mir mit, ich solle nach Mödling fahren.
– Wohin?
– Mödling heißt die Stadt. Schreib es dir auf.
– Ist ja gut.
– Du weißt doch nicht mal, welchen Tag wir heute haben.
– Ich schreibe es mir auf! Wo zum Teufel ist das?
– In der Nähe von Wien.
– Und was hat sie dort verloren?
– Sie wollte wohl nach Wien.
– Wien?
– Ja, Wien. Muss dir doch bekannt vorkommen.
– Ich habe es verstanden.
– Und nimm deinen Ausweis mit. Sie wissen, dass die Tante das Kind abholt. Und haben deinen Namen notiert.
– Können die sie nicht einfach in einen Flieger setzen?
– Niza!
– Okay, ich ziehe mich schon an. Ist gut.
– Und ruf an, sobald du sie hast.
Sie knallte den Hörer auf.
So fängt diese Geschichte an.
Warum Wien? Warum das alles nach der Nacht meiner Flucht vor den Tränen? Das hatte alles seinen Grund, aber dann müsste ich an einer ganz anderen Stelle zu erzählen beginnen.
Ich heiße Niza. In meinem Namen ist ein Wort enthalten, ein Wort, das in unserer Muttersprache »Himmel« bedeutet. »Za«. Vielleicht war mein bisheriges Leben die Suche nach diesem einen Himmel, den man mir schon von Geburt an als Versprechen mit auf den Weg gegeben hatte. Meine Schwester hieß Daria. In ihrem Namen ist das Wort »Chaos« enthalten. »Aria«. Das Zerwühlen und Aufwühlen, das Durcheinanderbringen und Nicht-mehr-Zurechtrücken. Ich bin ihr verpflichtet. Ich bin ihrem Chaos verpflichtet. Ich bin immer schon verpflichtet gewesen, in ihrem Chaos meinen Himmel zu suchen. Vielleicht geht es aber einfach um Brilka. Um Brilka, deren Name in der Sprache meiner Kindheit nichts bedeutet. Deren Name unbeschriftet und unstigmatisiert ist. Um Brilka, die sich diesen Namen selbst gegeben hat und so lange darauf beharrt hat, dass man sie so nennt, bis die anderen ihren wirklichen Namen vergaßen.
Und auch wenn ich es dir nie gesagt habe: Ich würde dir dabei so gern helfen, Brilka, so unglaublich gern, deine Geschichte anders und neu zu schreiben. Um dies nicht nur sagen, sondern auch beweisen zu können, schreibe ich dies hier nieder. Nur deshalb.
Ich verdanke diese Zeilen einem Jahrhundert, das alle betrogen und hintergangen hat, alle die, die hofften. Ich verdanke diese Zeilen einem lange andauernden Verrat, der sich wie ein Fluch über meine Familie gelegt hatte. Ich verdanke diese Zeilen meiner Schwester, der ich nie verzeihen konnte, dass sie in jener Nacht ohne Flügel losgeflogen ist, meinem Großvater, dem meine Schwester das Herz herausgerissen hat, meiner Urgroßmutter, die mit mir einen Pas de deux tanzte, als sie dreiundachtzig war, meiner Mutter, die Gott suchte … Ich verdanke diese Zeilen Miro, der mich mit Liebe wie mit einem Gift infizierte, ich verdanke diese Zeilen meinem Vater, den ich nie wirklich kennenlernen durfte, ich verdanke diese Zeilen einem Schokoladenfabrikanten und einem weiß-roten Oberleutnant, einer Gefängniszelle, aber auch einem Operationstisch mitten in einem Klassenraum, einem Buch, das ich nie geschrieben hätte, wenn … Ich verdanke diese Zeilen unendlich vielen vergossenen Tränen, ich verdanke diese Zeilen mir selber, die die Heimat verließ, um sich zu finden, und sich doch zunehmend verlor; ich verdanke aber diese Zeilen vor allem dir, Brilka.
Ich verdanke sie dir, weil du das achte Leben verdienst. Weil man sagt, dass die Zahl Acht gleichgesetzt ist mit der Ewigkeit, mit dem wiederkehrenden Fluss. Ich schenke dir meine Acht.
Uns verbindet ein Jahrhundert. Ein rotes Jahrhundert. Auf immer und Acht. Du bist dran, Brilka. Ich habe dein Herz adoptiert. Ich habe meines weggeschleudert. Nimm meine Acht an.
Du bist das Zauberkind. Du bist es. Durchbrich den Himmel und das Chaos, durchbrich uns alle, durchbrich diese Zeilen, durchbrich die Gespensterwelt und die wirkliche Welt, durchbrich die Umkehrung der Liebe, des Glaubens, verkürz die Zentimeter, die uns immer vom Glück trennten, durchbrich das Schicksal, das keines war.
Durchbrich mich und dich.
Durchlebe alle Kriege. Passiere alle Grenzen. Ich widme dir alle Götter und alle Rosenkränze, alle Verbrennungen, alle geköpften Hoffnungen, alle Geschichten. Durchbreche sie. Denn du hast die Mittel dazu, Brilka. Die Acht, denke daran. In dieser Zahl werden wir alle für immer miteinander verwoben sein und immer aneinander lauschen können, durch die Jahrhunderte hindurch.
Du wirst es können.
Sei alles, was wir waren und nicht waren. Sei ein Leutnant, eine Seiltänzerin, ein Matrose, eine Schauspielerin, ein Filmemacher, eine Pianistin, eine Geliebte, eine Mutter, eine Krankenschwester, eine Schriftstellerin, sei rot und weiß oder blau, sei Chaos und Himmel und sei sie und ich und sei all dies nicht, tanze vor allem unzählige Pas de deux.
Durchbrich diese Geschichte und lass sie hinter dir.
Geboren wurde ich am 8. November 1973, in einer Dorfklinik, nicht weiter erwähnenswert, in der Nähe von Tbilissi, Georgien.
Es ist ein kleines Land. Es ist auch schön, dem kann ich nichts entgegensetzen, sogar du wirst mir zustimmen, Brilka. Mit Bergen und einer steinigen Küste am Schwarzen Meer. Die Küste ist zwar im Laufe des letzten Jahrhunderts um einiges geschrumpft, dank der großen Zahl an Bürgerkriegen, dämlichen politischen Entscheidungen, hasserfüllten Konflikten, aber ein schöner Teil davon ist noch da.
Auch wenn du die Legende allzu gut kennst, Brilka, möchte ich sie an dieser Stelle kurz erwähnen, um dir deutlich zu machen, worauf ich hinauswill; die Legende, nach der unser Land folgendermaßen entstand:
Gott teilte eines schönen, sonnigen Tages seine von ihm erschaffene Erdkugel in Länder auf (das muss noch lange vor dem Turmbau zu Babel gewesen sein) und veranstaltete einen Jahrmarkt, auf dem alle Menschen sich lautstark überboten, um die Gunst von Gott buhlend, in der Hoffnung, so das beste Fleckchen Erde abzukriegen (ich vermute, die Italiener waren die Effektivsten in der Kunst der Beeindruckung und die Tschuktschen hatten es nicht so recht drauf). Nach einem langen Tag war die Welt in viele Länder aufgeteilt und Gott müde. Aber Gott – so weise wie eh und je – hatte für sich natürlich eine Art Urlaubssitz zurückbehalten, das schönste Fleckchen Erde: reich an Flüssen, an Wasserfällen, an saftigen Früchten und – er muss es geahnt haben – mit dem besten Wein der Welt. Und als sich die aufgeregten Menschen auf den Weg in ihre neue Heimat gemacht hatten, wollte sich der liebe Gott unter einem schattigen Baum ausruhen, wo er einen schnarchenden Mann entdeckte (bestimmt mit einem Schnurrbart und einer gemütlichen Wampe, so habe ich ihn mir zumindest immer vorgestellt). Er war bei Aufteilung nicht dabei gewesen, und Gott wunderte sich. Er weckte ihn und fragte, was er hier tue und warum er kein Interesse an einer eigenen Heimat habe. Der Mann lächelte mild (vielleicht hatte er sich bereits ein, zwei Gläschen Rotwein genehmigt) und meinte (da gibt es verschiedene Versionen der Legende, aber einigen wir uns auf diese), dass er auch so zufrieden sei, die Sonne scheine, es sei ein herrlicher Tag und er würde sich mit dem begnügen, was Gott für ihn übrig hätte. Und der liebe Gott, gütig wie eh und je, beeindruckt von der Lässigkeit und dem nicht vorhandenen Ehrgeiz des Mannes, schenkte ihm sein eigenes Urlaubsparadies, also Georgien, das Land, aus dem du, Brilka, ich und die meisten Menschen, von denen ich in unserer Geschichte berichten werde, stammen.
Was ich damit sagen will, ist: Bedenke, dass diese Lässigkeit (sprich Faulheit) und der nicht vorhandene Ehrgeiz (das Fehlen von Argumenten) in unserem Land als wahrlich erhabene Eigenschaften gelten. Bedenke auch, dass trotz einer tiefreichenden Identifikation mit dem lieben Gott (natürlich dem orthodoxen Gott und keinem anderen) es die Menschen dieses Landes nicht davon abhält, an alles zu glauben, was auch nur ansatzweise märchenhaft, geheimnisvoll oder legendär anmutet – und das muss keineswegs nur die Bibel sein.
Ob es die Riesen in den Bergen sind, die hauseigenen Gespenster, die bösen Blicke, die einen Menschen ins Unglück stürzen können, die einen Fluch nach sich ziehenden schwarzen Katzen, die Macht des Kaffeesatzes oder die Wahrheit, die nur die Karten enthüllen (heutzutage, sagtest du ja, ließe man sich sogar neue Autos mit Weihwasser bespritzen, um möglichst unfallfrei zu bleiben.).
Das Land, ehemals die goldene Kolchis, die den Griechen das Geheimnis der Liebe in Form des Goldenen Vlieses hat mitgeben müssen, da die widerspenstige und bis zur Besinnungslosigkeit verliebte Königstochter Medea das so befahl.
Das Land, das bei seinen Bewohnern liebenswerte Eigenschaften wie die heiliggesprochene Gastfreundschaft und weniger liebenswerte Eigenschaften wie Faulheit, Opportunismus und Konformismus begünstigt (das wird keineswegs von der Mehrheit so wahrgenommen, auch darin sind wir uns beide einig).
Das Land, in dessen Sprache es kein Geschlecht gibt (keineswegs gleichzusetzen mit Gleichberechtigung).
Ein Land, das im letzten Jahrhundert nach 135 Jahren zaristischer und russischer Schirmherrschaft es genau vier Jahre lang schaffte, eine Demokratie zu errichten, bis sie dann schließlich erneut von den größtenteils russischen, aber auch georgischen Bolschewiken gestürzt und als Sozialistische Republik Georgien und somit als eine Teilrepublik der Sowjetunion proklamiert wurde.
In dieser Union blieb das Land für die nächsten siebzig Jahre.
Es folgten mehrere Umbrüche, blutig niedergemetzelte Demonstrationen, etliche Bürgerkriege, schließlich die lang ersehnte Demokratie, obwohl die Bezeichnung eine Frage der Perspektive und der Auslegung geblieben ist.
Ich finde, dass unser Land durchaus sehr komisch sein kann (nicht nur tragisch, will ich damit sagen). Dass in unserem Land auch das Vergessen sehr gut möglich ist, einhergehend mit dem Verdrängen. Verdrängen von eigenen Wunden, von eigenen Fehlern, aber auch von zu Unrecht zugefügtem Schmerz, von Unterdrückung, von Verlusten. Trotzdem hebt man ja das Glas und lacht. Das finde ich beeindruckend, wirklich, angesichts der wenig erfreulichen Dinge, die das letzte Jahrhundert mit sich gebracht hat und an deren Folgen die Menschen bis heute leiden (auch wenn ich dich hier bereits widersprechen höre!).
Es ist ein Land, aus dem außer den großen Henkern des 20. Jahrhunderts auch viele wunderbare Menschen stammen, die ich persönlich sehr liebte und liebe. Manche von ihnen sind geflohen, manche haben sich auf der Suche verlaufen, manche leben nicht mehr, manche sind zurückgekehrt, manche haben ihre großen Tage bereits hinter sich oder hoffen noch auf sie, aber die meisten kennt keiner.
Ein Land, das bis heute seinem Goldenen Zeitalter zwischen dem 10. und dem 13. Jahrhundert nachweint und hofft, eines Tages wieder den einstigen Glanz zurückzugewinnen (ja, Progress heißt in unserem Land gleichzeitig immer auch Regress).
Traditionen erscheinen wie ein fahler Abglanz dessen, was sie einst waren. Das Streben nach Freiheit gleicht der sinnlosen Suche nach ungewissen Ufern, denn man hat sich vor allem in den letzten achtzehn Jahren nicht einmal darauf verständigen können, was genau man unter Freiheit versteht.
Und so gleicht das Land, in dem ich vor zweiunddreißig Jahren auf die Welt gekommen bin, heute einem König, der immer noch mit einer glänzenden Krone und einem prachtvollen Mantel dasitzt, Befehle erteilt, schaltet und waltet – ohne wahrzunehmen, dass sein ganzer Hof längst geflohen und er allein ist.
Verursache keine Unannehmlichkeiten – so lautet das oberste Gebot in diesem Land. Das hast du mir einmal auf unserer Fahrt gesagt, und ich habe es mir gemerkt (ich habe mir alles gemerkt, was du mir auf unserer Fahrt gesagt hast, Brilka). Und ich füge dem noch hinzu:
Lebe gefälligst so, wie deine Eltern gelebt haben, sei selten, besser nie allein. Alleinsein ist gefährlich und unnütz. Das Land vergöttert die Gemeinschaft und misstraut dem Einzelgänger. Tritt in Cliquen, mit Freunden, in familiären Gemeinschaften und Interessenkreisen auf – alleine bist du wenig wert.
Pflanze dich fort, wir sind ein kleines Land und müssen fortbestehen – dieses Gebot ist gleichgesetzt mit dem ersten Gebot. Sei immer stolz auf dein Land, verlerne nie deine Sprache, finde das Ausland, egal welches, schön, spannend und interessant, aber niemals, nie, nie besser als deine Heimat.
Finde immer Macken und Eigenschaften bei den Menschen anderer Nationen, die in Georgien mindestens skandalös wären, und rege dich darüber auf: der Geiz im Allgemeinen, also der nicht vorhandene Wille, dein ganzes Geld für die Gemeinschaft auszugeben, die mangelnde Gastfreundschaft, also der fehlende Willen, bei jedem Besuch dein ganzes Leben umzustellen, die schwache Trink- und Essbereitschaft, also die Unfähigkeit, bis zum Umfallen zu saufen, ein nicht vorhandenes musikalisches Talent – das wären solche Eigenschaften.
Verhalte dich tendenziell offen, tolerant, verständnisvoll und an anderen Kulturen interessiert, solange diese die Besonderheit und Einzigartigkeit deiner Heimat achten und stets bejahen.
Sei (in den letzten achtzehn Jahren wieder) gläubig, gehe in die Kirche, hinterfrage nichts, was mit der orthodoxen Kirche zu tun hat; denke nicht eigenständig, bekreuzige dich jedes Mal, wenn du eine Kirche siehst (das ist sehr en vogue, sagtest du!), also ungefähr zehntausend Mal am Tag, wenn du dich in der Hauptstadt befindest. Kritisiere nichts, was heilig ist – das heißt ungefähr alles, was mit diesem Land zu tun hat.
Sei fröhlich und heiter, denn das ist die Mentalität des Landes, und Trübsinnige mag man in unserem sonnigen Georgien nicht. Auch das wirst du allzu gut kennen.
Betrüge niemals deinen Mann, und wenn dein Mann dich betrügt – verzeih ihm, denn er ist ein Mann. Lebe vor allem für die anderen. Denn die anderen wissen eh immer besser, was für dich gut ist.
Als Letztes will ich noch hinzufügen, dass ich trotz meines jahrelangen Kampfes um und mit diesem Land es nicht geschafft habe, es zu ersetzen, es mir auszutreiben, wie einen bösen Geist, der einen befallen hat. Kein Reinigungsritual, kein Verdrängungsmechanismus war mir bisher dabei behilflich. Denn überall, wo ich hinkam, mich von diesem Land immer weiter entfernend, suchte ich nach dieser vergeudeten, um mich gestreuten, verschwendeten, ungenutzten Liebe, die ich dort zurückgelassen habe.
Ja, es ist ein Land, das keinerlei Ehrgeiz an den Tag legen will, am liebsten alles geschenkt bekommen würde, weil man ja so liebevoll, nett, freudig und heiter ist und der Welt (an guten Tagen) ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann.
In diesem Land kam ich also am 8. November 1973 auf die Welt. Eine Welt, die mit anderen Dingen beschäftigt war, als dass meine Ankunft groß aufgefallen wäre. Der Watergate-Skandal, die Antikriegskampagnen gegen Vietnam, der Militärputsch in Griechenland, die Ölkrise und Elvis hielten die westliche Welt auf Trab, während der östliche Teil unter Breschnew und der sowjetischen Nomenklatura in dumpfer Stagnation versank. Eine Stagnation, die beinhaltete, dass man mit allen Mitteln die Erhaltung der Macht und damit die Ablehnung jeder Art von Reformen behauptete und immer mehr die Augen vor der aufblühenden Korruption und dem Schwarzmarkt verschloss.
So oder so hörte man in beiden Teilen der Welt zum ersten Mal The Great Gig in the Sky von Pink Floyd. Im Westen öffentlich, im Osten heimlich.
Und Wyssozki sollte über jene Zeiten noch singen:
Der ewige Zirkus,
wo wie Seifenblasen
Versprechen platzen,
juble, wer kann.
Große Veränderungen?
Nichts als Phrasen.
Das alles mag ich nicht,
das kotzt mich an.
Außer meiner Geburt und dem Sturz meiner Schwester passierte an diesem Tag nichts Besonderes. Bis vielleicht auf die Tatsache, dass meine Mutter an jenem Tag in ihrem ewigen Krieg mit ihrem Vater und in der ewigen Hoffnung auf das Verständnis ihrer weiblichen Familienmitglieder die Geduld verlor und anfing zu schreien.
»Bist du eine Hure?«, soll mein Großvater sie angebrüllt haben, und meine Mutter soll weinend zurückgeschrien haben: »Wenn überhaupt, bin ich ein Hurenkind!«
Zwei Stunden später setzten die Wehen ein.
In den Streit involviert: mein herrischer Großvater, meine infantile Großmutter und meine zunehmend die Kontrolle über ihr Leben verlierende Mutter.
Das andere Ausnahmeereignis des Tages, unmittelbar bevor die Wehen begannen, war die Gehirnerschütterung meiner zweieinhalb Jahre älteren Schwester.
Sie hatte einige Tage zuvor mit unserem Großvater die nahe liegende Pferdezucht besucht und sich dort in die Araber und die dagestanischen Ponys verliebt, so dass mein Großvater sie am Tag meiner Geburt auf ein Pony setzte und sie nur lose um die Taille festhielt, als sich das Pony plötzlich losriss und das Kind abwarf. Es ging so schnell, dass mein Großvater es nicht schaffte, sie aufzufangen.
Sie fiel und prallte wie ein schwerer Kürbis zu Boden, der zwar mit Stroh ausgelegt, für meine weiche und rosige Schwester aber hart genug war.
Während mein Großvater sich verzweifelt auf seine Enkelin stürzte, die Pferdezüchter anklagte und ihnen drohte, »den ganzen Verein« zu schließen, fing meine Mutter an zu stöhnen, aufgewühlt von dem Streit und den verletzenden Worten, die im »Grünen Haus«, dem Haus meiner Kindheit, noch lange nachhallten. Meine Großmutter, die sich bei solchen – und es gab wirklich viele – lauten Auseinandersetzungen zwischen ihrem Mann und ihrer Tochter als eine Art Schiedsrichter aufspielte, und da sie keine Partei ergriff, den Zorn der beiden Seiten nur noch steigerte, rannte sofort in die Küche, wo meine Mutter saß, und griff, ohne etwas zu sagen, zum massiven Telefon, das an der Küchenwand hing.
Die Wehen dauerten genau acht Stunden.
Zur selben Zeit, in der meine Mutter in Begleitung ihrer korpulenten Mutter in das Dorfkrankenhaus kam, wurde meine Schwester Daria, meist Daro, Dari oder Dariko genannt, auch in ein Krankenhaus eingeliefert.
»Aua!«, schrie Daria. Und »Aaaa!«, schrie ihre Mutter. »Mamaaaa!«, heulte Daria, und ihre Mutter stöhnte: »Mamaaaaa!«
Mein Großvater setzte sich in den weißen Lada seiner Tochter, da sein geliebtes Sammlerauto Tschaika (die »Möwe«, offiziell GAZ 13 genannt und nur der sowjetischen Elite vorbehalten), das er pflegte und liebte wie ein Kind, zu langsam für die Landstraße war, und raste in das beste Tbilisser Krankenhaus, wo man Daria eine leichte Gehirnerschütterung attestierte. Und mir, einige Kilometer weiter und einige Stunden später – auf die Welt gekommen zu sein.
Mein lautes Geschrei zwang meine erschöpfte Mutter, den Kopf zu heben, mich anzusehen und zu erkennen, dass ich niemandem ähnlich sah, um dann wieder auf den improvisiert wirkenden Geburtsstuhl zurückzufallen.
Meine Großmutter erfasste mich als Erste mit vollem Bewusstsein: Ich sei ein »Baby mit einem übernatürlich entwickelten Harmoniebedürfnis«, urteilte sie, schließlich sei ich mitten im Streit auf die Welt gekommen.
Was das Bedürfnis nach Harmonie angeht, sollte sie sich gewaltig irren.
Mein Großvater, der meine Schwester aus dem Krankenhaus wieder nach Hause transportiert hatte – ihr war Bettruhe verordnet worden –, erhielt telefonisch die Nachricht, dass ich, »schmächtig und dunkelhaarig«, nun da sei und mich einer »stabilen Gesundheit« erfreue. Er setzte sich auf die Terrasse, wickelte sich in seine alte Matrosenjacke, um die sich meine Schwester und ich so oft zanken sollten, und schüttelte immer wieder nur den Kopf.
Während seine Mutter einen Willkommenskuchen buk, ihren heißgeliebten Obstlikör (diesmal die Sorte Sauerkirsche) aus dem Keller holte und eine Geburtstagsfeier plante, saß mein Großvater immer noch reglos da, fassungslos über die erneute Schandtat seiner Tochter, und konnte außer Kopfschütteln nichts tun. Meine Geburt zwang ihn, einmal wieder einer Enkeltochter seinen eigenen Nachnamen, also »Jaschi«, zu geben, denn ich wurde in wilder Ehe gezeugt. Diesmal nicht nur mit einem Deserteur und Landesverräter, wie im Falle des Erzeugers meiner Schwester, sondern mit einem schlichtweg kriminellen Mann, der bei meiner Geburt im Gefängnis saß.
»Dieses Kind ist ein Produkt von Elenes Schamlosigkeit, ihrer Verdorbenheit und besiegelt meine endgültige Niederlage im Kampf um ihre Ehre, ich habe also keinerlei Grund, mich zu freuen oder irgendetwas zu feiern. Das Mädchen, auch wenn es dafür nichts kann, ist die fleischgewordene Verkörperung allen Übels, das ihre Mutter über uns gebracht hat.« So sein erster Satz, schließlich, nach der mehrfachen Aufforderung seitens seiner Mutter, meiner Urgroßmutter, doch bitte eine Reaktion auf die Ankunft seines zweiten Enkelkinds zu zeigen.
Ja, an der Stelle hatte er nicht einmal so unrecht, und ich kann ihm diese Worte angesichts der Umstände, in die ich hineingeboren wurde, nicht verübeln.
Die fünf Tage, die ich mit meiner Mutter im Krankenhaus blieb, in denen meine Großmutter mit Hühnerbrühe und eingelegtem Gemüse täglich das Wochenbett ihrer Tochter aufsuchte, blieb mein Großvater zu Hause und wachte am Bett von Daria, die nicht begreifen konnte, warum sie nicht aufstehen durfte, und so unterhielt er sie mit allerlei Geschichten, Spielen, Zeichentrickserien (er hatte extra ein Fernsehgerät in ihr Zimmer gestellt), und weder wusste Daria von meiner Existenz, noch wusste meine Mutter etwas von der Gehirnerschütterung ihrer Erstgeborenen.
Daria war das vergötterte und bewunderte Kind im Reich unseres mächtigen Großvaters, dazu bestimmt, angehimmelt und angestaunt zu werden. Bis sie – aber ich greife vor, bis dahin würden noch viele Jahre vergehen, in denen sie die Rolle des von allen angehimmelten Juwels bravourös verkörpern sollte.
BUCH 1
STASIA
Nein, unter fremde Sterne entweichen – kann’s nicht. Fremder Fittich wärmt nicht lang.Damals war ich unter meinesgleichen,Dort, wo auch mein Volk ins Unglück sank.Achmatowa
Es klingelte und keine ihrer Schwestern machte auf. Immer wieder wurde an der Klingelschnur gezogen, und sie schaute weiterhin reglos in den Garten. Den ganzen Morgen schon regnete es und machte ihre Stimmung der ganzen Welt zugänglich, sichtbar. Der Regen, der graue Himmel, die feuchte Erde stellten sie bloß und gaben der ganzen Welt Einblick in ihre Wunden.
Der Vater war noch nicht da und die Stiefmutter war mit der Kleinen Stoffe kaufen, mit der neuen prächtigen Kutsche von Papa. Sie rief nach ihren Schwestern, niemand antwortete. Dann erhob sie sich langsam und zwang sich die Stufen hinunter, um die Tür zu öffnen.
Vor der Tür stand ein junger Mann in einer weißen Uniform. Sie hatte ihn noch nie zuvor gesehen und trat ein wenig irritiert von der schweren Eichentür zurück.
– Guten Tag, Sie müssen Anastasia sein? Darf ich mich vorstellen? Simon Jaschi, Oberleutnant der Weißen Garde und ein Freund ihres Vaters. Wir sind verabredet, darf ich reinkommen?
Also kein einfacher Offizier, ein Leutnant, ein Oberleutnant dazu. Sie nickte nur stumm und reichte ihm die Hand. Er war stattlich, groß und breitschultrig, mit schlanken Gliedern und knochigen Händen, die ziemlich behaart waren, unpassend zu diesem herausgeputzten Herrn, es schien, als würde die Natur sich durch die Uniform drängen.
Er nahm seine perfekt sitzende Kopfbedeckung ab, die sie ein wenig lächerlich fand, und trat ein. Sie wunderte sich schon, wo denn alle anderen steckten, und überhaupt schien das ganze Haus wie ausgestorben, das merkte sie erst jetzt.
Aus der Küche roch es nach Kaffee und Kuchen, aber niemand war darin, sie führte den Gast hindurch ins Empfangszimmer, in dem die Tür zum Garten offen stand. Es regnete ins Zimmer und die weißen Gardinen flatterten im feuchten Wind. Sie stürzte zur Tür und machte sie schnell zu. Der Regen war für sie eine Bedrohung, bei seinem Anblick wollte sie schon wieder weinen, unvorstellbar in der Anwesenheit des fremden Mannes.
Ihr fiel ein, dass er sie erkannt und mit ihrem Namen angesprochen hatte, obwohl sie vier Schwestern waren. Dabei war er noch nie bei ihnen zu Hause gewesen, das merkte sie an seinen umherschweifenden, neugierigen Blicken. Es war eine Falle. Ja, das war es. Jetzt verstand sie die plötzliche Leere im Haus. Er war es also. Um ihn ging es. Er war der zornige Gott, durch den sie ihre Strafe erhalten sollte. Er war der Zukunftsgarant. Er war der Schlachter, er war der Henker. Sie wurde blass und taumelte aus dem Raum.
– Ist alles in Ordnung?, rief er ihr nach.
– Oh, ja, ja. Ich hole nur schnell Kaffee und Kuchen. Sie mögen doch Kaffee?, rief sie aus der Küche, wo sie sich an die Wand gelehnt hatte und die Tränen mit den Ärmeln abwischte. Nichts mehr würde werden, wie es war. Und das hatte sie schlagartig verstanden, schlagartig hatte sie sich vergewissern können, dass die Kindheit vorbei war. Dass sie auf einmal ein anderes Leben haben würde, dass alles, all ihre Träume, Wünsche, Visionen sich auf diesen Menschen reduzieren würden, auf die weiße Russenuniform, wahrscheinlich ein Untergebener des dicken, ungebildeten Gouverneurs von Kutaissi, wie schrecklich!
Sie wollte sich übergeben, aber der Kaffee dampfte aus der Kanne und die symmetrisch geschnittene Schokoladentorte aus Papas Konditorei wartete darauf, dem Gast angeboten zu werden.
Und so wurde die Schokoladentorte ihre erste Opfergabe, die sie ihrem Henker darbot. Zum Verzehr. So, wie sie all ihre Zukunftsversprechen, die ihr das Leben Nacht für Nacht ins Ohr geflüstert hatte, diesem Vollstrecker zur Tötung würde anbieten müssen, indem sie anfing, sein Leben zu leben, in dem sie keinen Platz finden, in dem sie fremd sein, in dem sie nirgends ankommen würde. Sie biss sich auf die Lippen und unterdrückte den Schmerz, den sie dabei empfand.
Sie trug das silberne Tablett mit dem dampfenden Kaffee und dem Porzellangeschirr hinüber. Der Mann saß mit übergeschlagenen Beinen in Papas Sessel und starrte auf den grünen Garten, der vom schweren Regen ertränkt und begraben wurde, mitsamt den kleinen Frühlingsblumen, die aus der Erde drängten, gierig nach Leben und nach Wärme.
– Oh, das ist köstlich. Ihr Vater ist ein wahres Genie. Und solch ein guter Mensch. Solch ein Zurückhaltender, ein Mann der Demut. Heutzutage findet man kaum noch solche Männer. Jemand pflanzt einen Baum, und die ganze Gemeinde muss es mitbekommen. Keiner vollbringt noch gute Taten heutzutage, jedenfalls nicht, ohne sie an die große Glocke zu hängen. Ihr Vater ist nicht so einer. Ich bin sehr stolz, zu seinem Bekanntenkreis zählen zu dürfen. Und ihre Maman. Sie ist bezaubernd.
– Sie ist meine Stiefmutter.
– Oh.
– Nehmen Sie ruhig. Wir haben noch genug von dem Kuchen da. An Süßem mangelt es hier nie.
– Ja, ich kenne die Kreationen ihres Vaters. Diese köstlichen Mandeltörtchen, und wie großartig doch seine Pflaumenmousse ist! Sie ist ein wahrer Traum.
– Und woher kennen Sie Papa, wenn ich fragen darf?
– Ich … Ich habe ihm einmal einen Gefallen erwiesen, falls man das so sagen darf.
– Sie sagten eben, man soll nicht darüber sprechen, wenn man etwas Gutes getan hat. Das sei wahre Größe, so habe ich Sie verstanden.
– Sie sind aber sehr genau.
– Das bin ich wohl.
– Der Kuchen ist traumhaft. Warum kosten Sie ihn nicht?
– Ich esse davon täglich genug. Danke.
– Ich habe ihm nur einen Gefallen erwiesen. Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute Tat war, die ich begangen habe.
– Ein Gefallen beinhaltet in seiner Natur, dass er gut ist.
– Das hängt ganz von der Betrachtung ab, meinen Sie nicht auch? Jeder Mensch blickt auf die Dinge aus der eigenen Perspektive, die man nicht unbedingt mit den anderen teilt.
– Das meinte ich nicht. Es gibt Dinge, da sollten die Menschen alle gleich sein. Und auch die gleiche Ansicht teilen.
– Und diese Dinge wären?
– Zum Beispiel, dass die Sonne wundervoll ist und dass der Frühling Wunder wirken kann, dass das Meer tief und das Wasser weich ist. Dass Musik magisch ist, wenn man sie gut spielt. Dass Zahnschmerz eine furchtbare Angelegenheit und Ballett die schönste Sache der Welt ist.
– Verstehe. Sie tanzen für ihr Leben gern, nicht?
– Ja, das tue ich.
– Und Sie mögen mich nicht, weil sie glauben, dass ich diese Einstellung mit Ihnen nicht teile?
– Woher sollte ich das wissen?
– Sie glauben es. Sie vermuten es.
– Ich vermute rein gar nichts.
– Das glaube ich Ihnen nicht.
– Hören Sie, ich gebe zu: Ja, ich glaube, dass Sie viele meiner Ansichten nicht teilen, schon allein weil Sie im Militär dienen und ich dem Militär nicht zugetan bin. Was gibt es da zu lachen?
– Tut mir leid. Sie amüsieren mich.
– Ach, wie schön. Wenigstens hat einer von uns gute Laune.
– Reiten Sie?
– Was?
– Ob Sie reiten?
– Ja, natürlich reite ich.
– Im Damenstil, nehme ich an?
– Ich bevorzuge den Männerstil.
– Herrlich! Würden Sie mit mir morgen einen Ritt durch die Steppe wagen?
– Ich habe morgen Ballettunterricht.
– Ich kann auf Sie warten.
– Ich weiß nicht.
– Oder haben Sie Angst?
– Wovor sollte ich Angst haben? Vor Ihnen sicherlich nicht.
– Dann ist es abgemacht?
– Hören Sie, ich weiß nicht, was mein Vater Ihnen über mich erzählt hat. Aber es stimmt bestimmt nicht. Ich weiß nicht, was er Ihnen versprochen hat, aber auch das kann ich sicherlich nicht einhalten. Ich riskiere gern Ihren und meines Vaters Zorn, aber ich habe nicht vor, Ihnen etwas vorzumachen. Ich werde Sie nicht lieben. Warum lachen Sie schon wieder?
– Sie sind noch besser, als Ihr Vater Sie beschrieben hat.
– Was hat er Ihnen versprochen?
– Nichts. Er hat nur gesagt, dass ich Sie ab und zu besuchen darf.
– Damit ich Sie später heirate und nicht mehr tanzen darf?
– Damit wir uns kennenlernen.
– Sie sind viel älter. Das ist nicht angebracht.
– Ich bin achtundzwanzig.
– Trotzdem sind Sie viel älter. Elf Jahre ist ein großer Altersunterschied.
– Ich wirke sehr jung.
– Sie kennen sich in Ballett überhaupt nicht aus.
– Ich habe Sie beim Privatkonzert bei Mikeladses tanzen sehen.
– Wirklich?
– Ja.
– Und?
– Sie waren ganz gut.
– Ganz gut? Ich war sehr gut.
– Vielleicht. Sie meinen doch, dass ich mich nicht auskenne.
– Na ja, jeder Laie hat Anspruch auf eine Meinung.
– Oh, wie großzügig von Ihnen.
– Sie tragen keinen Schnauzer.
– Und, was bedeutet das?
– Das gehört sich nicht so.
– Nach der neusten Mode schon.
– Ich bin konservativ.
– Das wirkt aber nicht so.
– Sie kennen mich nicht.
– Ich habe Sie gesehen, da waren Sie vierzehn und haben dem Violinkonzert der Maxim-Brüder gelauscht. Wir saßen Seite an Seite und Sie waren so gerührt, dass Sie geweint haben und Ihre Tränen dann mit dem Kleiderärmel abwischten. Sie haben kein Seidentaschentuch benutzt. Das gefiel mir. Und dann sind Sie aus dem Saal gestürmt. Und Monate später sah ich Sie im Zirkus, der damals auf den Hügeln das große Zelt aufgebaut hatte. Und Sie haben einen Bratapfel gegessen und sich die Finger abgeleckt. Sie benutzten kein Seidentaschentuch. Wie es sich gehört. Und später sah ich Sie auf dem Neujahrsball, das war ihr erster Ball, beim Bürgermeister. Sie waren bezaubernd bei ihrem ersten Tanz, nur Ihr Partner war ein Trottel und konnte Sie nicht führen. Ständig trat er Ihnen auf die Füße und Sie verzogen jedes Mal das Gesicht. Sie kamen raus und wischten sich die kleinen Schweißperlen mit dem Kleiderzipfel von der Stirn ab. Kein Seidentaschentuch. Dann setzten Sie sich auf die Steintreppe und sahen zum Himmel auf. Da habe ich beschlossen, dass es Zeit wird, Sie kennenzulernen.
– Warum sollte ich Sie kennenlernen wollen?
– Weil ich einer bin, der auch nie ein Taschentuch benutzt.
– Was soll das bedeuten?
– Jemand, der einen Schleier braucht, einen Gegenstand, und sei der auch aus Seide, zwischen sich und der Welt, hat Angst vorm Leben. Er hat Angst, Dinge zu erleben, sie wirklich zu spüren. Und ich finde das Leben viel zu kurz und viel zu wundervoll, um es nicht wirklich anzusehen, um es nicht wirklich anzupacken, um es nicht wirklich zu leben.
– Sie wollen damit sagen, wir sind uns ähnlich?
– Nein, ich meine nur, dass wir eine ähnliche Lebenseinstellung haben.
– Trotzdem werde ich Sie nicht heiraten und mit Ihnen nach Moskau ziehen.
– Ich bin doch gar nicht in Moskau. Ich bin hier.
– Sie dienen den Russen, ich mag keine Russen. Man sagt, bald wird es Aufstände geben. Es sei unruhig in Russland. Es gibt Gerüchte. Außerdem, auch Papa fuhr nach Russland und holte sich die Frau hierher, als er das zweite Mal heiratete. Ich weiß, wie es in der Welt zugeht.
– Und wie geht es da zu?
– Na ja, für uns Damen nicht gerade vorteilhaft.
– Ein richtiger Blaustrumpf also.
– Was soll das denn schon wieder sein?
– In Europa gibt es Frauen, die der Meinung sind, dass sie und die Männer gleich sind. Und für diese Rechte kämpfen sie. Blaustrümpfe, so heißen sie.
– Und haben recht, wenn sie kämpfen. Aber ein ausgesprochen dummer Name, finde ich.
– Wenn das so ist, dann können wir einen richtigen Ritt durch die Steppe machen. Da können wir schauen, wie gleich Männer und Frauen sind.
– Ich bin nicht der Meinung, dass sie gleich sind. Ich bin der Meinung, dass Frauen besser sind.
– Umso besser. Dann bis morgen also.
– Warten Sie … Sie wissen doch gar nicht, wo ich meinen Ballettunterricht nehme.
– Ich werde Sie schon finden. Und richten Sie Ihrem Vater beste Grüße aus. Sie brauchen mich nicht hinauszubegleiten. Eine richtige emanzipierte Dame sollte immer sitzen bleiben.
– Eine was Dame?
– Eine, die für ihre Rechte kämpft.
Er ging mit leichten, schnellen Schritten und einem verschmitzten Grinsen hinaus. Stasia blieb erstarrt sitzen und konnte selber nicht glauben, was gerade geschehen war. Man durfte den eigenen Henker nicht mögen, man durfte mit ihm nicht flirten. Man durfte ihm nicht mehr Opfergaben darbieten als nötig. Man durfte mit ihm nicht im Herrenstil reiten. Und dann lachte sie auf. Der Regen hatte aufgehört und die Blumen sprossen aus der Erde hervor. Überall drang wieder Leben durch, samt den vielen und süßen Versprechen. Stasia öffnete die Tür zum Garten und lief hinaus. Die Erde war feucht und ihre Füße blieben im Schlamm stecken. Aber das hielt sie nicht davon ab, im matschigen Garten einen Pas de deux zu tanzen.
Sie trafen sich und ritten durch die Steppe, beide im Männerstil. Sicherlich sah sie dabei unglaublich anmutig und selbstsicher aus. Von klein auf hatte sie reiten gelernt und am liebsten nahm sie die rassigen Kabardiner und ritt sie ungesattelt. Sie hielt sich gern in der kargen Landschaft der Steppe auf. Die alte Höhlenstadt kannte sie wie ihre eigene Westentasche. Auch wenn dort Menschen ständig verloren gingen, in diesem geheimnisvollen Labyrinth aus Steintreppen, ineinander verschachtelten Räumen und Verstecken, Stasia fand immer ihren Weg zurück. Den Weg aus der Höhlenstadt, die vor Jahrhunderten auf Befehl der mächtigen Königin des Landes in den riesigen Berg geschlagen worden und die mittlerweile zu einer verlassenen Landschaft geworden war, aus der heraus die Gespenster sangen. Ja, man konnte sie hören, wenn man die Augen fest genug zumachte und die eigenen Gedanken im Kopf zum Verstummen brachte. Und bestimmt war der Oberleutnant noch beeindruckter von ihrem Können. Bestimmt unterhielten sie sich über allerlei, und Stasia forderte ihn oft zum Wettrennen heraus.
Sie fingen an, sich täglich zu gemeinsamen Ausritten zu verabreden. Stasia war bald so begeistert von diesen gemeinsamen Stunden in der Steppe, dass sie an manchen Tagen sogar das Tanzen vergaß.
Natürlich musste sich unsere siebzehnjährige Stasia verlieben. Der weiße Oberleutnant erfreute sich an Stasias Vertrauen, das von Tag zu Tag, von Ausritt zu Ausritt, wuchs. Und er glaubte fest daran, dass sie sich guttun würden, dass er genau solch eine eigenwillige Frau brauchte, und dieser feste Glauben musste unweigerlich Stasia imponieren.
Auch verehrte Simon Jaschi die Familie des Schokoladenfabrikanten und diese Sympathie wurde vom Vater der Angebeteten erwidert. Anastasia sollte bei der Wahl ihres Zukünftigen keine Widerstände erfahren, wie im Falle ihrer zweitältesten Schwester, die immer, wenn sie sich in einen Herrn verguckte, mit dem Missfallen des Vaters rechnen konnte. Der weiße Oberleutnant dagegen schien Vaters erste Wahl.
Und da es wirre Zeiten waren und man nicht wusste, wie das Blatt sich wenden würde, musste man schnell handeln. Auch in Liebesdingen.
Der weiße Oberleutnant hatte tatsächlich eine Kadettenschule in Petersburg besucht, als das Petersburg mit den schönen Bällen und dem süßlich-französischen Akzent noch existierte, und nur kurz im Russisch-Japanischen Krieg gekämpft, wo er verwundet, zum Oberleutnant ernannt und wieder in die Heimat zurückgeschickt worden war. Diese Verwundung rettete ihn vor dem Einsatz im Ersten Weltkrieg. Nach der Genesung hatte man ihn in seinem verschlafenen Heimatstädtchen in der Verwaltung eingeteilt, wo er die Kriegskorrespondenz auswertete.
Simon beeilte sich nicht, um eine Versetzung zu bitten. Die politische Lage war undurchschaubar und er nicht entschlossen genug, er hatte in seinem Leben noch keine Ideologie als Heimat finden können, die seinen weiteren Weg bestimmen würde.
In jener Zeit gab es unzählige Ideologien und politische Gruppierungen, die tagtäglich wie Pilze aus dem Boden schossen, in kleinen Dachzimmern, Kantinenkellern und dunklen Hinterhofwohnungen, und die alle die Lösung jeglicher Probleme für sich entdeckt zu haben glaubten oder genauestens wussten, wie man dem geknechteten russischen Volk eine rosige Zukunft garantierte.
Simon entstammte einer gutbürgerlichen Familie: Sein Vater, ein angesehener Arzt, hatte seinem einzigen Sohn eine gute Bildung ermöglicht. Bereits früh geprägt durch demokratisch-liberales Gedankengut, hatte Simon in den Militärkreisen der Kadettenschule Kontakte zu Liberalen geknüpft und an einigen Versammlungen teilgenommen. Aber zeitgleich nahm er wahr, dass die Liberalen zu schwach und viel zu wenig zielsicher schienen, um einer ernsthaften Bedrohung, wie der Sozialismus es eine war, standzuhalten, sollte es darauf ankommen. Und dass die Sozialisten immer lauter, immer fordernder und unerschrockener agierten, nahm Simon ebenfalls wahr.
Man erzählte sich allerlei Verschwörungstheorien und Legenden über die Anführer, die in der Mehrzahl bereits inhaftiert waren oder sich ins Ausland abgesetzt hatten.
Simon sympathisierte kaum mit den Sozialisten, zu brachial, zu wenig raffiniert, zu laut waren sie für seine gutbürgerlichen Ohren, aber gleichzeitig wollte er am Ende nicht auf der falschen Seite stehen. Er musste handeln. Er musste sich entscheiden, aber zu sehr zögerte er noch, zu wenig transparent waren die Ereignisse, zu viel schien noch möglich.
Bereits an der Front war er mit einigen Ideen in Berührung gekommen und gründete, nach der Verwundung in die Heimat zurückbeordert, einen Zirkel zum »Studium der philosophischen Schriften der alten Griechen«, um mit anderen Verwirrten und Suchenden zu einer Erkenntnis zu kommen, die ihn weiterbringen würde. Simon Jaschi fühlte sich weder als ein Reformer noch als ein Revolutionär. Als ein der Obrigkeit ergebener Soldat diente er widerspruchslos dem Militär, samt dessen klaren Hierarchien, der Disziplin und der Aufgabenteilung. Er liebte klare Strukturen, geregelte Verhältnisse, bei denen jeder seinen Platz genau kannte. Simon war ein rationaler Mensch. Er war galant, nachgiebig, eher mürrisch und nachdenklich vom Charakter her, kein Mann der glühenden Ideen und Taten. Er hatte auch nichts gegen den Zaren, vielleicht ein wenig Mitleid mit den Bauern, wie es sich damals für die Obrigkeit schickte.
Aber eine merkwürdige Eigenheit Simon Jaschis mag dem Schokoladenfabrikanten besonders gefallen haben, um ihn für eine gute Partie für seine Tochter zu halten: Simon war ein sentimentaler Zeitgenosse und ein großer Anhänger alles Vergangenen. Er liebte Puschkins Russland, er erträumte sich die großen napoleonischen Bälle, wurde regelrecht rührselig bei Schwanensee. So erwärmte sich in den Augen meines Ururgroßvaters sein Herz doch für alles, was mit dem von Gott gesandten König, also dem Zaren, und somit einer klaren strukturierten Welt zu tun hatte.
So eigenartig und verwunderlich es für einen solch jungen Mann gewesen sein mochte, es kam dem Weltbild meines Ururgroßvaters sehr entgegen. Simons Herz gehörte dem alten Russland, der europäischen Elite, dem schönen und glanzvollen Leben der guten alten Zeit – oder eher dem, was er sich darunter vorstellte.
Traditionsbewusst zu sein bedeutete für meinen Ururgroßvater, die Werte der Elite zu leben, bescheiden zu sein und mit ausgezeichneten Manieren ausgestattet, dabei nicht allzu genussfreundlich und doch nicht puritanisch. Und genau wissend, welche gesellschaftliche Schicht für welche Zwecke geschaffen war, welcher Mensch in der Gesellschaft welchen Platz einzunehmen hatte. Denn Ururgroßvater entstammte dem verarmten georgischen Kleinadel, hatte eine Konditorlehre in einem noblen Kurhotel auf der Krim absolviert, war dort recht schnell vom Lehrling zum Leiter der Chocolaterie aufgestiegen und hatte durch seine Kunst viele reiche Adelige als Stammkunden gewinnen können, deren Gunst er genoss und deren Unterstützung er es auch verdankte, dass er schließlich für zwei Jahre nach Budapest zu einem Meisterchocolatier kam, der zuvor für den Wiener Hof gearbeitet hatte.
In ganz Europa sammelte mein Ururgroßvater Erfahrungen, er bereiste einige exzellente Konditoreien in Westeuropa und entschloss sich doch, gegen die Erwartungen seiner Vorgesetzten, in seine Heimat zurückzukehren, um dort ein eigenes Geschäft zu gründen.
Er hatte, und leider verfüge ich über keine gesicherten Informationen darüber, wo genau er die Rezeptur seiner unvergleichlichen Schokolade entwickelte, eine magische Geheimformel entdeckt: Er hatte ein Rezept in der Tasche, das den Geschmack Heißer Schokolade revolutionieren sollte.
Dieses Rezept, oder besser gesagt: die Heiße Schokolade, die daraus resultierte, sollte ich an dieser Stelle als einer der Hauptfiguren unserer Geschichte einführen, Brilka.
Da ich die Zutaten des Getränks leider nicht preisgeben darf (unter keinen Umständen, auf gar keinen Fall, nie, nie, niemals), muss ich Worte finden, um das Unbeschreibliche zu beschreiben. Mir ist leider auch nicht bekannt, ob mein Ururgroßvater diese Rezeptur von einer anderen abgeleitet oder ob er sie selbst entwickelt hat, wie ein Kriegsgeheimnis hat er sie gehütet. Aber eins steht fest: Bei seiner Rückkehr in seine Heimat hatte er die Garantie für seinen späteren Erfolg bereits in der Tasche (von den Nebenwirkungen seiner magischen Schokolade war bis dahin noch nichts bekannt).
Vorerst war es ein Rezept für eine schlichte Heiße Schokolade Wiener Art. Also nicht auf Kakao-, sondern auf Schokoladenbasis. Erst wurde die Schokolade hergestellt, dann geschmolzen und mit anderen Zutaten vermischt.
Aber etwas an dieser Zusammensetzung und Zubereitung machte diese Schokolade so besonders, einmalig, unwiderstehlich, bestürzend. Schon ihr Geruch war so verlockend und so intensiv, dass man nicht anders konnte, als dorthin zu eilen, woher er kam.
Die Schokolade war zäh und dickflüssig, schwarz wie die Nacht vor einem schweren Gewitter, und wurde in kleinen Portionen, heiß, aber nicht zu heiß, in kleinen Tassen und – im Idealfall – mit Silberlöffeln verzehrt.
Der Geschmack war unvergleichlich, der Genuss glich einer geistigen Ekstase, einer überirdischen Erfahrung. Man verschmolz mit der süßen Masse, man wurde eins mit dieser köstlichen Entdeckung, man vergaß die Welt um sich herum und verspürte ein einmaliges Glücksgefühl. Alles war, wie es sein sollte, sobald man diese Schokolade kostete.
Genau um die Jahrhundertwende war das, als er mit seiner Geheimrezeptur in der Tasche aus Budapest in seine Heimat zurückkehrte. Mein Ururgroßvater war stolz auf das Erreichte und glaubte, dass man die Galanterie und das Exquisite von Paris oder Wien auch auf die georgische Provinz übertragen und den Geschmack der Leute beeinflussen und verändern konnte.
Nach der Rückkehr heiratete er eine Schülerin der Klosterschule der Heiligen Gottesmutter, eine fromme und schweigsame, man könnte sagen, zur Schwermut neigende Frau namens Ketevan. Sie hatte mit dem russischen Reich nichts am Hut, empfand die georgische Annexion durch Russland als den fatalsten Fehler der gesamten georgischen Geschichte und weigerte sich lebenslang, Russisch zu sprechen. Er hatte sich in sie verliebt, es war keine arrangierte Ehe, doch leider auch keine glückliche. Sie vertrat andere Werte, sah in Russland den Ursprung allen Übels, während mein Ururgroßvater in Russland eine Chance für Georgien sah und die Meinung vertrat, dass die Russen dem Kaukasus erst den Zugang zur Weltkultur ermöglicht und den Analphabetismus beim Volk und die Gier des georgischen Kleinadels bekämpft hatten. Er war prozaristisch und genoss alle Privilegien, die ihm seine kollaborierende Lebensweise bot. Seine Frau wurde jedoch nie müde zu behaupten, dass Georgien nichts weiter als eine Kolonie und die slawische Kultur der Untergang der kaukasischen sei.
– Wir haben selbst unseren großen Nachbarn gerufen, ihn zu uns eingeladen, versuchte mein Ururgroßvater in den ersten Monaten seiner Ehe seine Frau umzustimmen.
– Wir haben sie als Helfer eingeladen, nicht als Besatzer, erwiderte Ketevan. – Unser König war ermattet von etlichen Besatzungen und Streifzügen der muslimischen Nachbarn, sah keinen anderen Ausweg mehr und suchte eben von zwei Übeln das seiner Meinung nach kleinste aus, als er den Zaren bat, einen Schutzvertrag zu unterzeichnen. Einen Schutzvertrag mit der Betonung auf Schutz. Falls ich dich daran erinnern darf.
– Ja aber, meine Liebe, faktisch hieß es doch, dass wir von nun an dem großen Zarenreich unterstellt sein würden, das wusste unser König, als er die Russen ins Land holte.
– Sicherlich, mein Teurer, aber er wird wohl nicht gewusst haben, dass unsere nördlichen Nachbarn diese Einladung nicht für ein paar Jahre, sondern für einige Jahrhunderte in Anspruch nehmen würden.
Ketevan gab sich nicht geschlagen.
– Ich denke, dass es falsch ist, meine Liebe, ständig das Bild von David und Goliath zu bemühen und es als Parabel für unser Land zu verstehen, ich denke, dass wir es uns sehr einfach machen, indem wir dies annehmen. Denn zu viele Georgier haben daraus ihren Nutzen gezogen, Ketevan, dem wirst du doch zustimmen müssen?!
– Die Anpassung hierzulande ist stets eine geheuchelte, und im Kern dieser Anpassung findest du immer eine Sehnsucht nach dem Ureigenen vor. Ich spreche von wahren Georgiern und keinen Verrätern, erwiderte Ketevan und warf ihrem Ehemann einen verächtlichen Blick zu.
Ketevan mischte sich kaum in die Geschäfte meines Ururgroßvaters ein, sie war eine gute Haushälterin und auch gesellschaftlich wusste sie sich zu präsentieren, sie gebar ihm zwei Töchter, aber die Liebe und die Zuneigung der Eheleute war spätestens nach der Geburt der zweiten Tochter erloschen.
Ketevan widmete sich der Frömmigkeit, betete und unterhielt gute Beziehungen zur Kirche und den Priestern, während ihr Mann sein Geschäft Die Chocolaterie eröffnete, von allen seitdem die »Schokoladenfabrik« genannt und mein Ururgroßvater nur noch der »Schokoladenfabrikant«. Das Geschäft florierte, der Umsatz stieg von Jahr zu Jahr und der Ruf des Schokoladenfabrikanten festigte sich.
Er war enttäuscht darüber, dass seine Frau seinen Erfolg nicht schätzte, die finanziellen und sozialen Privilegien der Familie keineswegs zu nutzen und den wachsenden Wohlstand nicht zu genießen schien. Er hatte sich von ihr Unterstützung und Zuspruch erhofft, wie er sie von anderen bekam. Fünf Jahre nach seiner Rückkehr führte er eine stadtbekannte Konditorei und plante Niederlassungen im ganzen Land; später, auf dem Gipfel seines Erfolges, hoffte er, würde er das ganze Zarenland mit den besten Schokoladenwaren beliefern können.
Man produzierte paradiesische Torten und Kuchen aller Art. Trüffelschokolade, Bitterschokolade, Vollmilchschokolade mit Aprikosengelee, Walnuss- und Traubensorten, aber auch Exotisches wie Schokoladentarte mit schwarzem Pfeffer, Kirschlikörbonbons im Minzschokoladenmantel, Schokoladenkekse mit Feigencremefüllung oder Nougatschokolade mit Wassermelonengelee. Die Chocolaterie vollbrachte es, die französische Pâtisserie und die österreichische Backtradition mit osteuropäischer Opulenz zu vereinen.
Jeden Morgen um sechs Uhr in der Früh ging er in die Konditorei und mischte in die riesigen, von den Mitarbeitern vorbereiteten Schokoladenmischungen für die jeweiligen Sorten seines Sortiments seine eigene Zutatenmischung hinzu, wodurch erst die besondere Note entstand. Niemand konnte die Formel entschlüsseln und genau das machte seine Waren so unwiderstehlich.
Bislang hatte er seine spezielle Zutatenmischung nur in kleinster Dosis all seinen Schokoladenprodukten beigegeben, gewissermaßen nur als ergänzende Geschmacksnote, aber den größten Zauber entfaltete seine Rezeptur in der Heißen Schokolade.
Da der große Erfolg seiner magischen Formel ihn bestärkte und mit ehrgeizigen Expansionsplänen liebäugeln ließ, plante er, das Sahnehäubchen seiner Kreationen – die Heiße Schokolade – erst auf dem Gipfel seines Ruhms und Erfolgs in Tbilissi, Moskau oder Petersburg aus der Tasche zu zaubern, um alle und jeden in einen der Ohnmacht nahen Zustand zu versetzen.
Trotz oder wegen seines Erfolges hatte der Schokoladenfabrikant, auf einen Nachfolger hoffend, sich geschworen, seine eigene Rezeptur in der Familie zu belassen und zunächst geheim zu halten.
Laut Stasia rettete diese Entscheidung unsere Familie, wenn nicht sogar unser ganzes Land vor dem endgültigen Ruin.
Neben seinem Beruf nahm mein Ururgroßvater als Ehrenbürger am gesellschaftlich-kulturellen Leben der Stadt teil, verkehrte in hohen Kreisen der lokalen Politik, war der Begründer des einzigen Herrenclubs der Stadt (ganz nach europäischer Manier), der Schirmherr etlicher Literatur-, Theater- und Philosophiezirkel, saß im Vorstand der »Gesellschaft für Tradition und Ehre« und war nebenbei noch einer der reichsten Bürger der kleinen Stadt, die er zum »Nizza des Kaukasus« machen wollte, wenn Tbilissi schon als Paris des Kaukasus galt.
Seine Frau kümmerte sich wenig um diese Äußerlichkeiten, beschäftigte sich lieber mit Bibelstudien und der strengen Erziehung der beiden Töchter. Sie musste jedes Mal überredet werden, an irgendwelchen gesellschaftlichen Ereignissen teilzunehmen, und war auch nicht besonders reiselustig, was dem Schokoladenfabrikanten keineswegs gefiel. Auch ihre übertriebene Religiosität reizte ihn. Er spürte, dass er dadurch den Zugang zu seinen Kindern verloren hatte, die unter der strengen Überwachung der Mutter und der gläubigen Gouvernanten ebenfalls zu frommen, schüchternen und keineswegs europäischen Mädchen heranwuchsen.
Den Kampf an der weiblichen Front in seinem eigenen Hause schien er, mit gravierenden Folgen, zu verlieren.
Ein Sohn musste her! Die weibliche Überzahl in seinem Hause war einfach zu bedrohlich geworden. Er brauchte einen Nachfolger, einen Mann, der den Kampf gegen das andere Geschlecht mit ihm an seiner Seite würde führen können. Da die Eheleute schon längst kein gemeinsames Ehebett mehr teilten, wusste er – das würde ihn große Überredungskunst und viel Zeit abverlangen. Außerdem waren Ketevan die beiden Geburten sehr schwergefallen und sie erfreute sich keiner allzu starken Gesundheit, sie würde nicht so leicht davon zu überzeugen sein, sich auf eine weitere Schwangerschaft einzulassen.
Obwohl er seiner Frau mehrfach erklärte, dass es sich ausschließlich um eine Erbangelegenheit handele, die Schokoladenfabrik schließlich einen männlichen Erben brauche, blieb sie unbeeindruckt und tröstete ihn damit, dass seine beiden Töchter ja heiraten würden und ein geschäftstüchtiger Schwiegersohn ebenfalls eine gute Problemlösung darstelle.
Er musste sich also anderer Mittel bedienen, um seine Frau dazu zu überreden, ihm einen Nachfolger zu gebären. So beschloss er, seine beste Schöpfung, die Heiße Schokolade, für sie zu kochen, denn je konzentrierter die Zutatenmenge desto größer auch die Wirkung der Rezeptur.
In Anwesenheit eines kleinen Streichquartetts, das er eigens für sie in der bereits für die Besucher geschlossenen Schokoladenfabrik auftreten ließ, bei Kerzenschein und umhüllt von dem berauschenden Duft seiner eigener Kreation, stellte er ihr die schönste Porzellantasse hin, die er in seinem Geschäft auftreiben konnte, und ließ sie die Schokolade löffeln, dabei mit Engelszungen auf sie einredend, sie davon überzeugend, wie unverzichtbar ein männlicher Nachfolger in seinem Falle sei.
Wie so oft nach ihr, erwachte auch in Ketevan die ungezügelte Gier nach mehr und so flehte sie in den darauf folgenden Tagen ihren Mann an, für sie weiterhin die Heiße Schokolade zu kochen. Und so konnte endlich mein Ururgroßvater ein Ultimatum zu seinen Gunsten stellen: Würde sie sich auf eine weitere Schwangerschaft einlassen, würde er ihr im Laufe der kommenden neun Monate täglich die Heiße Schokolade zubereiten. Ihr Widerstand war gebrochen, und die Sehnsucht nach dem köstlichsten Geschmack der Welt ließ ihr keine andere Wahl, als sich auf sein Angebot einzulassen und widerstrebend einzuwilligen.
Und so kam es, dass sie nach neun Monaten wieder in ihrem Schlafzimmer, von einem Landarzt und zwei Hebammen umsorgt, in den Wehen lag. Mehrere Stunden dauerte es, bis man ein gesundes, wohlgeformtes Mädchen aus ihr holte (die Mutter seufzte nur enttäuscht). Sie dachte, alles sei gut überstanden, als der Arzt besorgt rief, dass es noch weiterginge. Ein Zweites sei auf dem Weg. Nach weiterem Pressen und Schreien gelangte schließlich noch ein Mädchen ans Tageslicht.
Aber das zweite Kind wollte partout nicht schreien. Etwas stimme mit den Lungen nicht, attestierte der Arzt, das Kind sei blau angelaufen, kriege keine Luft, und er klopfte ihm heftig auf den Rücken. Wenige Minuten nach der Geburt musste man den Tod der Zweitgeborenen feststellen (es waren eineiige Zwillinge gewesen).
Die erste jedoch, die man auf den Namen Anastasia taufte, schien gesund und munter und schrie aus vollem Hals nach der Muttermilch.
Kurze Zeit später starb Ketevan an einer Lungenentzündung, die sie sich im Wochenbett zugezogen hatte; schnell, ohne große Qualen, nachdem sie Anastasia das letzte Mal die Brust gegeben hatte.