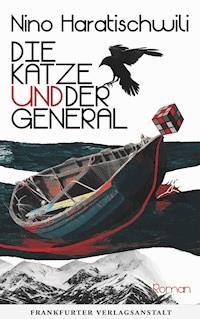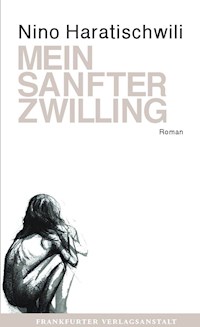
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Die Geschichte einer Liebe zwischen zwei Menschen, die sich unmöglich lieben können - wegen des Schicksalsschlags, der sie zusammen gebracht hat. Eine fatale Liebe zwischen zwei Menschen die sich nur übereinander definieren können und doch immer wieder versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ivo und Stella, Wahlverwandte und Schicksalsgenossen seit frühester Kindheit, sind in leidenschaftlicher und destruktiver Liebe miteinander verbunden. Jeder Versuch ohne einander zu leben, sich dem Reigen wilder erotischer Begegnungen und hasserfüllter Streits zu entziehen, scheitert. Es ist eine namenlose Gier, die die beiden immer wieder zueinander treibt und ein tief verborgener Groll, der sie hindert, je miteinander glücklich zu sein. Haratischwilis Roman erzählt die Geschichte dieser großen Liebe und fatalen Leidenschaft und enthüllt dabei, Schritt für Schritt, Schicht für Schicht ein Familiendrama, das Stella und Ivo wie Zwillinge für immer aneinander kettet. In Rückblenden erzählt Stella die Geschichte ihrer Familie, ab dem Moment, in dem Ivo in ihr Leben tritt. Von der Affäre ihres Vaters Frank mit Ivos Mutter. Von den Nachmittagen in dem abgeschiedenen Haus am Hafen, wo sich das Paar trifft und die Kinder zusammen spielen und die Erwachsenen beim Liebesspiel beobachten. Über ihre Eltern kommen sich Ivo und Stella näher und versuchen deren Geheimnis, so gut es geht, vor der Außenwelt zu hüten, in der es Ivos Vater und Stellas Mutter und Schwester gibt. Die Affäre endet mit einem Schlag, als Ivos Vater eines Nachmittags überraschend von einer Geschäftsreise nach Hause kommt. Mein sanfter Zwilling erzählt sprachgewaltig, melancholisch, gravitätisch wie die herbstliche See und mit scharfem Blick für die Abgründe und Unwägbarkeiten der menschlichen Natur von einem erschütternden Familiendrama, einer verlorenen Kindheit, und einer großen Liebe, die in dieser Welt keinen Ort findet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nino Haratischwili
MEIN SANFTER ZWILLING
Roman
»Der Körper des anderen, der einen hindert, seine Seele zu sehen.
Oh, wie ich diese Mauer hasse!«
Marina Zwetajewa
1. TEIL: DORT
Ich sehe dein Gesicht an: so blass, so friedlich, und ich verspüre immer noch das alte, vertraute Gefühl und misstraue ihm, noch während ich es empfinde. Ich frage mich, wie es sein kann, dass ich nichts anderes spüre als diese Nähe. Auch jetzt …
Ich werde dieses Gefühl niemandem erklären können: Ich darf es nicht empfinden angesichts der Geschehnisse, angesichts der Zukunft, meiner Zukunft. Aber es ist so, und langsam nehme ich sie hin, diese Bewegung, die alles zu überdauern scheint.
Allein stehe ich da, zum ersten Mal, in jeglicher Bedeutung des Wortes: gedanklich, körperlich, seelisch. Aber auch diesmal scheint mein Gefühl, dein Gefühl, also das Gefühl, das ich nun, hier, dein Gesicht vor meinen Augen, verspüre, jegliche Angst zu überwinden, sie auszublenden. Es bleibt nur diese ungeheure Nähe, diese Sanftmut.
Ich weiß nicht, wie es sein kann, dass du mir immer diese sanfte Nähe hast geben können; denn kein Gefühl kann sanft sein, weil Sanftheit in sich schon begreift, dass sie nicht währt, dass sie eine Erscheinung ist, die nadelstichartig auftaucht und sich im Nichts verliert. Aber meine Sanftheit dauert an, sie ist eine andere, sie ist dauerhafter als alles andere in meinem Leben. Und ich habe schon lange aufgehört, sie zu hinterfragen …
So sitze ich hier, ein paar Tage vor meiner Abreise. Ich sitze hier, am Strand, an deinem und meinem Strand, von wo aus wir immer in das kalte Wasser hinausgeschwommen sind, im Sand, der kühl und feucht ist, weil es seit zwei Tagen regnet.
Ich werde gleich meine Haare abschneiden und den neuen Gedanken und dem kühlen Wind kahl begegnen. Strähne für Strähne werde ich leichter, gewichtsloser und vielleicht auch freier. Ich sitze in unserer Bucht, wo sich keiner außer uns hin verirrt hat, weil der Ort so kalt und rau scheint; ich sitze hier, wo ich dir das erste Mal meine Liebe habe darbieten wollen und du sie noch nicht hast annehmen können, wo wir so viele Morgen- und Abendstunden verbracht haben, in den Zeiten, nachdem du wieder die Sprache erlernt hattest; wo wir so oft unsere Geheimnisse, Versprechen, Wünsche, Pläne dem Meer zugeflüstert haben.
Ich sitze hier. Ich sehe dich an, und ich empfinde den Urrausch der Nähe, ich tanze diesen Rausch am Grab der Einsamkeit, denn nichts anderes ist die Nähe für mich als eine Verleugnung jeglicher Einsamkeit, ein Sieg aller elementaren, dionysischen Gier.
Ich bin sanft, ich bin weich wie Wolle, und mein Inneres ist seidig glatt – ganz als wäre ich ein Baby, ein Fötus, geborgen, erwünscht und unberührt von der Welt.
Du hast mir so oft gesagt, ich hätte vergessen, wer ich sei, und vielleicht stimmt es sogar. Und vielleicht habe ich es mit dir auch nie gewusst. Vielleicht habe ich es erst erkannt, als ich aufhörte, diese Sanftheit in mir zu bekämpfen, vielleicht erst, als ich mich an ihr satt gegessen hatte, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich nicht du bin, nicht mehr. Und genauso wenig wie das Alleinsein, die Stille, die Fragen, die nach all dem kommen werden, die sich vielleicht in dem Wort Zukunft zusammenfassen lassen, macht mir diese Erkenntnis Angst. Ich werde weinen müssen. Alles Einverleibte werde ich hervorwürgen müssen, und keiner wird meine Stirn dabei halten, auch das ist mir bewusst. Aber was macht das schon?
Ich sehe dein Gesicht an. Du bist schön. Nach wie vor bist du wunderschön, und ich muss lächeln. Ich sehe dein Gesicht an und denke, dass ich dir dankbar bin für diese sanfte Nähe und diese grausame Fremdheit. Dass ich diese Nähe – auch wenn ich das Gefühl niemals mehr mit jemandem teilen kann und es damit irgendwann zum Sterben verurteilt ist – loslasse.
Ich sehe dich an.
1.
Eigentlich fing es mit dem Ende an.
An diesem Morgen rief Tulja an und sagte, er sei da. Sie hatte mich geweckt. Mark hatte Theo zur Schule gebracht, und ich war im Bett geblieben – mit dem schlechten Gewissen, nicht aufgestanden zu sein, kein Frühstück gemacht und keine Rolle gespielt zu haben bei dem gemeinsamen Morgen mit meiner Familie –, trotzdem war ich liegen geblieben, die Überwindung meines schlechten Gewissens war leichter, als ich befürchtet hatte, und mein Morgenschlaf es wert, jede Sekunde des grauen Hamburger Morgens zu verpassen.
Nicht lange nachdem die Tür ins Schloss gefallen war, fing das Telefon an zu klingeln, und als es nicht aufhörte, quälte ich mich fluchend, der Vergeudung kostbarer Schlafminuten wegen fast den Tränen nah, aus dem Bett und kroch auf allen vieren zum Telefon, das auf der Kommode lag. Als wäre es ein Naturgesetz, wurde es immer an den unpassendsten Stellen abgelegt.
– Wach auf, ich weiß, dass du da bist. Er ist wieder da.
– Mein Gott, Tulja, weißt du, was du mir gerade antust? Ich habe seit den letzten hundert Jahren zum ersten Mal eine Portion Schlaf bekommen, und jetzt kommst du und weckst mich auf. Also bitte, kannst du nicht später …
– Nein, kann ich nicht. Versteh endlich! Er ist da, mein Gott, wach auf! Ich kann es nicht fassen. Er ist einfach so reingeplatzt, unser kleiner Adonis, du kannst dir nicht vorstellen, wie gut er aussieht. Morgens um sieben ruft er mich an und sagt, er sei in der Stadt, er wolle eine Weile hier bleiben, er wolle …
– Tulja, wer? Von wem redest du, um wen geht es, verdammt noch mal?
– Ivo, Ivo, unser Ivo!
Mir fiel fast das Telefon aus der Hand. Vielleicht ist es mir sogar aus der Hand gefallen, und ich erinnere mich nicht mehr. Ich war so aus der Fassung gebracht, dass ich zurücktaumelte und mich auf die Bettkante setzte. Besser gesagt, ich fiel.
Kein Tag meiner bewussten Erinnerung, an dem ich nicht an ihn gedacht, mich nicht gefragt hatte, was er wohl machte, wo er war, wie es ihm ging. Aber in den sieben Jahren waren diese Gedanken zur Routine geworden, die ruhig, unaufgeregt, selbstverständlich war, so dass ich der festen Überzeugung war, sie hätten nichts mit der Realität zu tun. Ich hatte meinen Ivo, der in meinem Kopf lebte und um den ich mich sorgte, aber der eigentliche, der wirkliche Ivo aus Fleisch und Blut, den hatte ich seit sieben Jahren nicht mehr gesehen, er war aus meinem Leben verschwunden, war seinen Weg gegangen, der so weit entfernt von meinem lag, dass jeder Schritt, den er auf diesem Weg gegangen war, ihn immer mehr von mir entfernt hatte.
– Was hat er hier verloren?, war das Gescheiteste, was mir einfiel.
– Woher soll ich das wissen! Er ist erst seit einer Stunde bei mir und gerade raus, um Zigaretten zu kaufen. Da musste ich dich einfach anrufen …
– Aber er muss doch irgendetwas gesagt haben?
– Ist doch egal, mein Gott. Er ist da, das ist erst mal das Wichtigste. Er will eine Weile hierbleiben, hat er gesagt, und ich werde nicht versuchen, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.
– Hat er nach mir gefragt?
– Ich habe ihn erst mal eine Stunde lang abgeküsst, der Arme konnte gar nicht mehr sprechen, ich glaube, ich habe ihn beinahe erwürgt.
Ich erkannte in Tuljas Stimme die beinahe schon vergessene Aufregung wieder, die von ihr Besitz ergriff, immer wenn von ihm die Rede war. Eine Mischung aus mütterlichem Stolz auf ein vom Leben benachteiligtes Kind, das umso deutlicher und ausdrücklicher geliebt werden musste, und aus einem gewissen Stolz auf sich selbst, denn Ivo verkörperte all das, was ihr erstrebenswert erschien, und sicherlich sah sie den Einfluss ihrer Erziehung in ihm am stärksten präsent.
– Was soll ich jetzt tun? In Jubelgeschrei ausbrechen? Und wieso rufst du ausgerechnet mich an? Ich meine, was erwartest du von mir?, sagte ich hilflos und ärgerte mich sofort über meine dämliche Frage, weil ich mich von einer Sekunde auf die andere wieder in die Rolle des kleinen Mädchens, Tuljas Zögling, hineinmanövriert hatte. Es entstand eine Schweigepause in der Leitung. Ich wusste genau, dass Tulja sehr widersprüchlich handelte, gänzlich von ihren Emotionen eingenommen, und nicht immer lange überlegte, bevor sie etwas sagte oder tat, aber in diesem Punkt misstraute ich ihr, weil ich nie ganz dahintergekommen war, in all den Jahren nicht, was sie eigentlich wirklich darüber dachte, über Ivos und meine Geschichte, wie viel genau sie wusste und was sie dazudichtete, was sie sich ausmalte und was genau sie hatte verhindern wollen.
– Oh, es klingelt, er ist zurück. Ich muss ihm aufmachen. Ich rufe dich in ein paar Stunden wieder an. Oder er ruft dich selbst an. Auf alle Fälle erwarte ich dich demnächst hier.
Ich wollte ihr etwas erwidern, aber Tulja hatte schon aufgelegt. Mein Schlafbedürfnis war schlagartig gewichen, ich war hellwach. Ich versuchte meine Gedanken zu ordnen, ging in die Küche, machte Kaffee und setzte mich an die Bartheke, um die Mark so lange gekämpft und die ich noch nie gemocht hatte. Ich zitterte am ganzen Körper, und meine Augen brannten. Ich hielt die Kaffeetasse umklammert und sah aus dem Fenster in den grauen Nieselregen. Ein gewohntes Bild, an das ich mich nie gewöhnen würde. Mein Blick fiel auf meine feuchten Finger und meinen Ehering – schmal, dezent, bei dem ich mich so lange habe nicht entscheiden können, ob er nun der richtige war, um mich mein Leben lang zu begleiten.
Ich wusste, dass sich alles ändern würde, ich wusste, dass es am besten wäre, mich dagegen zu wehren – Mark anzurufen und ihn zu bitten, mich auf seine Geschäftsreise mitzunehmen, den Kleinen zu den Großeltern zu bringen und irgendwohin zu verschwinden, bis die Wolken vorübergezogen waren.
Eines Tages hatte er zurückkommen müssen. Ich hatte es erwartet, mir diesen Moment schon oft ausgemalt und alles Erdenkliche in meinem Kopf durchgespielt. Ich hatte mich gewappnet, mich in einer vermeintlichen Sicherheit gewiegt. Aber bis heute hatte sich alles in meinem Kopf abgespielt. Bis jetzt war ich die Puppenspielerin gewesen und hatte die Fäden in der Hand gehalten.
Die Jahre mit ihm und die vielen durchfochtenen Kriege wegen, mit oder ohne Ivo hatten mir die Sicherheit im Umgang mit unserer Vergangenheit nicht genommen; ich hatte mich bewährt, und ich hatte ihn in meinem Leben behalten. Ungeachtet aller guten Ratschläge hatte ich unsere Kinderfotos aufgestellt, hatte Mark die offizielle Version unserer Geschichte erzählt, hatte an seinen Geburtstagen grußlose Päckchen an ihn geschickt – solange ich noch seine Adresse besaß – und bei Geburtstagen immer wieder Toasts auf ihn ausgebracht, was nicht selten zu hitzigen Diskussionen, sogar zu Gebrüll am Tisch führte.
Ich hatte ihn einbalsamiert in eine abgeschlossene Vergangenheit, hatte ihm jeglichen Raum, sich zu entwickeln, genommen, auch dies war mir durchaus bewusst. Ich hatte ihn als das Kind, den Jungen, den Mann in meinem Kopf behalten, der sein Leben mit mir geteilt hatte, der existent war in mir, in meinem Kosmos. Er aber war weg. Er war weg aus meinem Leben und weg aus seinem Leben, das ich so lange als meines betrachtet hatte.
Ich riss mich aus meinen Gedanken, ging ins Badezimmer, nahm eine Dusche, trank noch einen Kaffee und zog mir eine schwarze Hose an. Ich stand vor dem Schrank und versuchte, mich für ein Oberteil zu entscheiden, bekam einen Blackout und starrte die in die Regale gestopften Pullis, T-Shirts und Blusen an. Ich starrte und starrte, als läge darin die Lösung, die Klärung, die Ruhe versteckt, die ich jetzt so dringend benötigte. Ich sah sein Gesicht vor mir, sein Gesicht von damals, als ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, und ich legte mir automatisch die Hand auf die Lippen, um nicht aufzuschreien.
Ja, eigentlich fing das Ganze mit dem Ende an. Aber so war es immer gewesen in meinem Leben: Das Familiengefüge, in dem ich aufgewachsen bin, wir aufgewachsen sind, war immer verkehrt. Irgendwann traute ich mich nicht mehr, meine Verwandtschaft mit Possessivpronomina zu benennen. Denn wenn ich sagte, mein Vater oder meine Mutter, mein Bruder oder meine Großmutter, musste ich immer ein eigentlich hinzufügen.
– Dein Vater? Und warum wohnst du nicht bei ihm?
– Weil meine Eltern geschieden sind.
– Und warum wohnst du nicht bei deiner Mutter?
– Weil sie in Amerika lebt.
– Aber warum hat sie dich nicht mitgenommen?
– Weil wir es so beschlossen haben.
– Und kommt sie manchmal hierher?
– Nein, wir fahren immer zu ihr.
– Und wieso wohnst du bei Tulja?
– Sie ist die Tante meines Vaters, also meine Großmutter.
– Und wieso wohnst du nicht bei deiner richtigen Großmutter?
– Sie ist meine richtige Großmutter, wir haben keine andere Großmutter.
– Und wieso trägt deine Schwester deinen Namen und dein Bruder nicht?
– Weil mein Bruder adoptiert ist und er den Namen seiner Eltern behalten hat.
Um all das zu vermeiden, sagte ich später: Das ist Leni. Das ist Tulja. Das ist Ivo. Das ist …
Ich erwachte aus meinem komatösen Zustand mit einem dunkelblauen T-Shirt in der Hand und zog es mir über. Es erinnerte mich an meinen Mann, an mein Kind, daran, dass ich im Hier war, im Jetzt, und dass alles, woran sich mein Hirn gerade festklammerte, vergangen war. Ich atmete tief durch und zwang mich zu einem Lächeln, ich musste wieder Boden unter den Füßen spüren.
Ich suchte das Telefon, das diesmal unter die Bettdecke abgetaucht war, und rief in der Redaktion an.
– Hey, Leo. Ich wollte mich ein paar Tage abmelden, ich muss für die Biennale recherchieren und werde erst Mittwoch wieder ins Büro kommen, ist das okay für euch?
– Oh … verstehe. Aber was ist mit morgen? Du kommst doch morgen Abend zu uns zum Essen. Nadias Überraschungsfeier, du weißt?
Das hatte ich ganz vergessen.
– Gib mir einfach morgen noch mal Bescheid, ich versuche wenigstens kurz aufzutauchen, okay?
– Ist alles okay?
– Ja. Wieso?
– Du klingst so gehetzt.
– Nur der übliche Familienstress. Kennst es ja.
– Okay, ich klingle morgen kurz durch. Versuch zu kommen. Es wäre ihr wichtig. Ja?
– Ich geb mir Mühe. Mach’s gut.
Ich legte auf und schämte mich, dass ich meiner kleinen Familie unterstellt hatte, mich zu stressen. Auch dieses alte Muster kannte ich: dass ich log, dass ich für Ivo log. Ich hatte es so lange nicht mehr tun müssen, und obwohl diese Lüge recht harmlos war, schämte ich mich und wünschte, ich wäre vorher nicht ans Telefon gegangen, wünschte, Tulja, die alte Kuh, hätte mich nie angerufen. Und schon wieder wehrte ich mich dagegen – gegen die Tatsachen. Gegen die Tatsache, ein Leben zu akzeptieren, das außerhalb meiner Vorstellung stattfand.
Ich ging in mein Arbeitszimmer und schaltete den Laptop an. Nach einer Stunde gab ich es auf, saß heulend am Schreibtisch, hielt das Foto meines Sohnes umklammert – als letzten Anker, als letzten Anhaltspunkt –, presste das Gesicht auf die Tischoberfläche, die Augen zusammengekniffen, und war kurz davor, aus voller Kehle um Hilfe zu schreien.
2.
Auch Ivos Ankunft in unserer Familie war ein Ende, mit dem alles anfing.
Seine Mutter, mit der mein Vater ein Verhältnis gehabt hatte – war tot. Sein Vater vorerst im Gefängnis, wo er einige Jahre später auch starb. Und er selbst verstummt – sich weigernd, auch nur ein Wort an jemanden zu richten. Und ich – die Einzige, die seine Sprache verstehen und für ihn sprechen konnte, was auch der einzige Grund war, warum man Ivo bei uns ließ.
Ich war damals sieben und meine Schwester elf.
Unsere Eltern hatten sich gerade getrennt, und meine Mutter zog ziemlich schnell nach der Scheidung in die USA, um für einen großen Pharmakonzern zu arbeiten, wo sie irgendwelche schädlichen Chemikalien zusammenmixte, in der Hoffnung, die Schäden würden eine hellere und gesündere Zukunft rechtfertigen. Und sie zog dahin wegen James, ja, richtig, James, den sie später heiratete. Sie hatte uns vor die Wahl gestellt, und meine Schwester und ich entschieden uns, obwohl aus heutiger Sicht vollkommen unvorstellbar – aus sehr verschiedenen Gründen dafür, bei unserem Vater zu bleiben, obwohl er eigentlich der Hauptgrund dafür war, dass unsere Familie und unser Leben auseinanderfielen. Aber so kam es nun …
Meine Mutter hatte auf das Sorgerecht verzichten müssen, obwohl es ihr zustand, sie war müde, sehr müde. Wir alle waren müde. Wäre sie vor Gericht gegangen, wären wir niemals bei Vater geblieben, das hätte man ihm niemals erlaubt, aber sie entschied sich dagegen. Die Frage – im Falle eines Sorgerechtsstreits –, ob Mutter Ivo bekommen und vor allem, ob sie ihn überhaupt hätte adoptieren wollen, habe ich nie wirklich für mich beantworten können.
So wie man es Vater eigentlich nie hätte erlauben dürfen, Ivo zu adoptieren. Aber merkwürdigerweise blieben wir alle bei ihm.
Meine Schwester hatte sich von meiner Mutter abgewandt – sie konnte nicht begreifen, warum sie einen Mann verlassen wollte, der Grund dafür war, eine Frau zu erschießen, sie blieb bei Papa aus Trotz, denn bis zu dem Zeitpunkt war er ihr mehr oder weniger fremd gewesen. Im Gegensatz zu mir hatte sie als Kleinkind keine allzu starke Bindung zu ihm, sie blieb, um Mutter zu verletzen, der sie nicht verzeihen konnte, dass sie vorhatte zu gehen, dass sie einen anderen Mann lieben lernte, dass sie es in Erwägung zog, für ihr Glück zu kämpfen, im Notfall auch ohne uns.
Ich blieb bei ihm, weil ich Angst hatte, man würde Mama Ivo nicht geben und uns somit voneinander trennen.
Meine Mutter, hysterisch und wie eine Furie kreischend, stritt sich mit unserem Vater; ein Dreivierteljahr dauerte das Kreischen, und am Ende setzte sie sich einfach vor meiner Schwester und mir hin und fragte, wo wir Kinder denn gern leben würden. Heute denke ich, dass es das Ehrlichste und Aufrichtigste war, was sie als Mutter für uns tun konnte: uns unsere Freiheit zu lassen. Uns nicht zwangsweise in die erdrückende Fremde eines anderen Landes zu versetzen. Und trotzdem verzieh es ihr meine Schwester nie, und trotzdem blieb immer ein Loch in mir, eben weil sie uns vor diese Entscheidung gestellt hatte, der wir niemals gewachsen hätten sein können.
Sie überließ uns unserem immer schlimmer herumvögelnden und trinkenden Vater, der sich des Sohnes seiner toten Geliebten annahm. Mein Vater, der diesmal aus Schuldgefühlen anfing, alles abzuschleppen, was weiblich war und zwei Beine hatte, der seinen Job verlor und nun auf Kosten seiner Kinder lebte, die die Mutter dank Pharmaindustrie und James unterhielt. Vater war völlig überfordert, und das war der Moment, in dem Tulja in unser Leben trat.
Tulja war die Tante meines Vaters, eine mehrfach geschiedene, kinderlose Dame, damals noch mittleren Alters, sie hatte als Haus eine umgebaute Scheune, fuhr einen alten Truck und besaß keine Katzen, obwohl man das bei ihr erwartet hätte. Sie liebte Gedichte und alle Dichter, die tot waren, hörte italienische Opernarien und lebte von einem alten Bootsverleih, den ihr ihr zweiter oder dritter Mann hinterlassen hatte. Merkwürdigerweise sprach sie kaum über ihre Ehemänner. Denn ihr Leben bestand aus einer Vielzahl von Geschichten, von erfundenen und von wahren Geschichten, an die sie selbst irgendwann so fest glaubte, dass sie zu einer einzigen großen Lebensgeschichte verschmolzen und es unmöglich wurde, Reales von Erfundenem zu trennen. Reales wirkte bei Tulja immer erfunden. Sie glaubte an Astrologie, Mystik und an die Natur. Sie habe persisches Blut in ihren Adern, behauptete sie, und ein Gesicht wie eine babylonische Königin – das sah man! –, sehr besondere Gesichtszüge, die auch mein Vater geerbt hatte und denen man unter anderem seine Anziehung auf Frauen zuschrieb.
Als ich neun wurde, zogen wir zu ihr ans Meer, nach Niendorf, in ein verschlafenes Küstendorf. Meine Schwester, Ivo und ich. Mein Vater nahm uns an den Wochenenden zu sich, und die Julimonate verbrachten wir in Newark, New Jersey, wo Mama gemeinsam mit James für Merck & Co chemische Experimente durchführte. Im Sommer taten wir immer so, als wäre unser Leben mit Vater märchenhaft und Tulja ein kleiner Pluspunkt zusätzlich, denn unsere Scheune, unser alkoholkranker Vater samt seinen schnell wechselnden Damen, unsere absolut wahnsinnigen Bootstouren, die wir auf eigene Faust unternahmen, und Tuljas widerliche Quittenmarmelade – all das erschien uns viel angenehmer als Newark und Mutters verzweifelte Versuche, uns an sich zu binden.
Das Merkwürdige daran war, dass es von uns dreien letztlich nur Ivo war, der ihr das Gefühl gab, auch weiterhin unsere Mutter zu sein, und ihr die Sicherheit vermittelte, dass wir sie keinesfalls würden ersetzen können, geschweige denn ersetzen wollen. Das war so, seitdem er sich gefangen und die Sprache wiedergefunden hatte und er in den Newarker Sommern unserer Mutter eine Illusion der Nähe vorgegaukelt hatte.
Jeder von uns litt an unserer nicht vorhandenen Familie. Ivo schwieg, ich versuchte möglichst unauffällig zu bleiben, am besten unsichtbar zu werden und mich nur darauf zu konzentrieren, als eine Art Sprachrohr für Ivo zu dienen, und meine vier Jahre ältere Schwester Leni kapselte sich zunehmend ab. Sie schien die sichtbarsten Schäden davongetragen zu haben, obwohl sie es sich nicht eingestehen wollte. Sie begann mit Schuldzuweisungen, gab vor allem unserer Mutter und Ivo für alles die Schuld und verlernte es zu lächeln.
Auch Mutter litt, stritt sich mit James und überhäufte uns mit unzähligen sinnlosen Geschenken oder unternahm hektische Ausflüge mit uns in unzählige Wild- oder Nationalparks. Sie setzte sich noch auf unsere Bettkanten, als wir aus dem Alter längst heraus waren, in dem wir uns über Gutenachtgeschichten gefreut hätten.
Ich vermisste sie schrecklich, war aber zu stolz, ihr das zu zeigen, und tat andauernd so, als wäre unser Leben die pure Normalität. Ich spielte die unkomplizierte Tochter, und Ivo, der schon damals ein phänomenales Gespür für Menschen hatte, fügte sich, war weich, anschmiegsam, redselig, voller Lust auf die lästigen Wandertouren und Ausflüge, voller ehrlicher Begeisterung für alles, was meine Mutter mit uns veranstaltete.
Wir fanden uns damit ab, gewöhnten uns daran, dass unser Leben so war, wie es war, nachdem Leni endlich damit aufgehört hatte, Ivo zu bestrafen, dafür, dass er das Unglück ihrer Familie verkörperte. So war es eine fast glückliche Kindheit, ein wenig verrückt, ein wenig abenteuerlich, ein wenig verwahrlost und fast übervoll mit Liebe, die die verstörten Erwachsenen uns angedeihen ließen und die nie recht gesund sein konnte, oder uns zumindest in nicht gesunder Form verabreicht wurde.
So weit die Version meines Lebens, die ich später meinem Mann, meinen Freunden und ein paar guten Bekannten anvertraute. Ich habe viel dafür getan, dass man uns zugestand, uns als Familie zu bezeichnen. Den Rest machte ich mit mir aus. Den Rest machte ich mit Ivo aus.
Er rief an, nachdem ich mir das verheulte Gesicht gewaschen und mir noch eine Tasse Kaffee eingegossen und die Hoffnung aufgegeben hatte, den Tag wie gewohnt in eine gewisse Ordnung zu bekommen und zu überstehen.
Er erklärte nichts, sagte nur, er werde vorbeikommen, ob ich da sei, ob ich etwas dagegen habe. Er sei in der Stadt unterwegs, da könne er mich doch sehen. Ich antwortete nichts, ich nickte nur stumm. Er versprach, in vierzig Minuten da zu sein.
Die Zeit, die mir blieb, verbrachte ich in eine Decke eingewickelt auf dem Balkon. Ich schaute auf die Straße hinunter. In der Ferne das Tuten der Schiffe, und das Geräusch wiegte mich in einen traumartigen Zustand. Und endlich hörte mein Kopf auf zu dampfen und zu ächzen. Ich machte mir nicht die Mühe, mich zu schminken, um mir ein Gesicht aufzumalen, das meine Angst überdecken könnte.
Er kam pünktlich. Ich stand lange an der Tür, bevor ich ihm öffnete, versuchte meinen Atem unter Kontrolle zu bekommen. Er trug eine schwarze Lederjacke, sein Haar war wie immer sehr kurz geschoren. Er erschien mir größer als in meiner Erinnerung, und ich fragte mich, ob auch Erwachsene noch weiter wachsen oder ob die Zeit diesen Effekt verursacht. Er lächelte mich an, hielt eine winzige Blume in der Hand; es war ein Schneeglöckchen aus Tuljas Garten – ich musste lachen.
Wir sagten nichts, er begann wie eine Hyäne in meiner Wohnung herumzuschleichen, begutachtete die Zimmer, blieb vor den Fotos stehen, die auf einem Regal aufgestellt waren. Er betrachtete lange das Bild von Theo und stellte es abrupt wieder hin. Irgendwann setzte er sich an unsere Bartheke und meinte:
– Die Theke ist ja richtig unspießig!
Das war der erste Satz, den ich nach fast sieben Jahren von Ivo zu hören bekam. Danach fragte er, ob er etwas zu trinken haben könnte.
– Gin Tonic, so was wäre toll. In so einer Wohnung habt ihr bestimmt Gin und Tonic, oder?
– Mark und ich trinken ab und zu Gin, deswegen müsste noch welcher da sein, nicht weil ich denke, dass es in so einer Wohnung Gin geben muss. Und die Bartheke ist völlig in Ordnung!
– Hey, fühlst du dich etwa angegriffen?
– Lass das.
Nachdem ich den Satz ausgesprochen hatte, fühlte ich mich ein wenig sicherer. Und sehr schnell war die Erinnerung wieder da, sehr schnell war diese böse Leichtigkeit zurückgekehrt.
Ich gab nach, ich gab auf und mixte ihm einen Gin Tonic. Ich musste nicht lange überlegen, ich schenkte auch mir ein Glas ein. Es war ein Uhr mittags.
Er lächelte und drückte sein Glas an die Lippen.
– Du bist älter geworden. Aber die kleinen Lachfalten, ich mag sie, und du hast irgendwie dunklere Haare bekommen. Ich find übrigens deine Wohnung nicht schlecht. Aber schon seltsam, dass du jetzt so lebst. Wie auch immer, Tulja scheint ja sehr angetan von deinem Mann, das ist doch ein gutes Zeichen.
Tulja musste das Blaue vom Himmel gelogen haben, denn sie hielt Mark für einen Langweiler und hatte mir sogar zuerst Hausverbot angedroht, als ich ihr verkündet hatte, ihn zu heiraten.
– Ist das so, stöhnte ich und trank einen Schluck. Die wärmende, leicht benebelnde Wirkung des mittäglichen Alkohols machte mich endgültig frei von mir selbst.
– Ich bin froh, dich zu sehen. Du siehst wunderschön aus. So wie ich mir immer vorgestellt habe, dass du mit Mitte dreißig aussiehst. Du bist wirklich eine, die spät erblüht. Deine besten Jahre werden noch kommen!
– Ivo, was redest du da für einen Unsinn! Es ist eine Frechheit, dass du hier plötzlich so einfach auftauchst. Wo warst du so lange? Warum hast du mir nie geantwortet, warum hast du …
– Das war unser Deal.
– Scheiß auf den Deal. Ich hatte Angst um dich. Ich …
– Frank hat immer gewusst, wo ich mich aufhielt. Tulja wusste auch Bescheid, daher. Und Gesi hat dir bestimmt jede Woche etwas von mir erzählt.
– Du weißt genau, was ich meine. Du glaubst doch nicht, dass ich jemanden nach dir frage, wo du lebst oder auf welchem Kontinent du dich gerade aufhältst!
– Du hast es so gewollt, Stella. Also mach mir keine Vorwürfe. Du hast es so beschlossen.
– Und warum sitzt du dann hier, wenn ich beschlossen habe, dass wir uns nicht mehr sehen?
– Weil ich mich aus Prinzip nie an Abmachungen halte.
Ich sah ihn an und musste ein Lachen unterdrücken. Er war nach wie vor schön, von der fast schon traurigen, beängstigenden Schönheit eines einsamen Menschen. Eines Menschen, der an sich selbst verzweifelt. Seine leicht mandelförmigen Augen – dunkelgrau, wässrig, mit mädchenhaften Wimpern – waren nach wie vor voller Geheimnisse, die ich so lange zu entschlüsseln versucht hatte, und auch sein spitzbübisch-leichtes Grinsen um die Mundwinkel herum war unverändert geblieben. Meine Liebe zu ihm war wie eine Wunde, die niemals wirklich heilen wollte.
– Also, um es kurz zu machen: Ich lebe immer noch in New York. Wenn man das als Leben bezeichnen kann.
Er holte seine Zigaretten aus der Tasche. Ich überlegte, wann ich meine letzte Zigarette geraucht hatte.
– Ich bin viel unterwegs, habe mich selbstständig gemacht, die Aufträge sind ganz gut, ich nehme alles, was die anderen nicht machen. Die letzten drei Monate war ich in Kabul. War manchmal schon ein wenig ungemütlich. Aber ich und mein Freund Krieg, wir verstehen uns immer noch blendend. Ich bin nicht verheiratet, sonst hätte ich die Familie sicherlich zur Hochzeitsfeier eingeladen. Gesi sehe ich oft. James kränkelt in letzter Zeit, aber Gesi kommt mich besuchen, wenn ich in New York bin, und wir streiten uns weiterhin über Tierversuche und Giftstoffe. Aber das macht ja nichts. Die Welt ist gleich geblieben, ist schon ein Wunder, dass ich sie nicht habe retten können. Du siehst, mir geht’s gut, Stella. Du hast mir ab und zu gefehlt. Das war’s eigentlich. Und mit der Liebe klappt es auch ganz gut für die zwei, drei Monate, die ich an einem Ort verbringe.
Er war aufgestanden und schaute aus dem Fenster.
– Ich würde gern dein Kind sehen!, sagte er plötzlich, und ich stellte fest, dass sein Deutsch durch das Englische weicher geworden war und es seiner Stimme schmeichelte.
– Du kannst ihn kennenlernen.
– Und werde ich auch deinen Mann kennenlernen?
– Ja, du kannst auch meinen Mann kennenlernen.
Eine Weile sahen wir beide aus dem Fenster. Schließlich fasste ich Mut und fragte ihn:
– Wieso bist du wiedergekommen?
– Ich hatte auf einmal das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wer ich bin. Ich denke, man kann sein Leben nicht auf fast forward stellen. Das habe ich aber getan, und eine ganze Weile hat es funktioniert. Ich muss nun aber zurückspulen. Ich muss zurückspulen, und das geht nicht ohne Frank, ohne Tulja, ja sogar Leni brauche ich vielleicht, aber vor allem brauche ich dich, Stella. Ich muss wieder hier sein, eine Weile muss ich das. Dein Gin Tonic ist wunderbar gemixt. Früher konntest du es nicht. Ich vermute, eine Errungenschaft der letzten Jahre.
– Wir haben das Kapitel endgültig abgeschlossen, Ivo. Und ich denke nicht, dass es richtig wäre, jetzt …
– Wir haben gar nichts abgeschlossen, mach dir doch nichts vor.
Seine Stimme wurde auf einmal kalt, distanziert, leicht verächtlich. Diese ungemeine Kälte, die er ausstrahlte, wenn er Angst hatte, zurückgewiesen zu werden. Wie hatte er mir damit wehgetan, obwohl ich wusste, dass sie gespielt war, dass er nur so tat, aber er spielte es so überzeugend, dass es unmöglich war, in dem Moment nicht davon getroffen zu sein.
– Es ist abgeschlossen, Ivo, ich habe ein neues Leben. Ich habe andere Prioritäten jetzt. Vor allem habe ich ein Kind, dessen Glück mir wichtiger ist als irgendwelche Befindlichkeiten. Ich habe meinen Frieden gefunden.
– Deinen Frieden hast du also gefunden? Schön, sehr schön. Pass auf, Stella, du musst mir helfen, und vielleicht kann ich dann dir helfen.
– Helfen, mir helfen? Mir ist bereits geholfen, ich brauche keine anderweitige Hilfe. Und dir? Wie soll ich dir helfen? Wie stellst du dir das vor? Du bist deinen Weg gegangen. Du bist ein anderer als der von damals. Du hast jetzt andere Erfahrungen, andere Gefühle, andere Gedanken. Ich kann nicht so tun, als läge keine Zeit dazwischen. Es macht mir was aus, nach wie vor, ich bin verwirrt, überfordert, weil du hier bist, und ich bin froh, vielleicht auch erleichtert, dich hierzuhaben. Aber ich weiß nicht, was ich tun kann. Wenn du reden willst, dann reden wir, aber das war’s dann auch, Ivo.
– Ich muss mich nur ein wenig erinnern. Und du kannst mir dabei helfen, nicht wahr?
Ich verweigerte ihm eine Antwort, und so blickten wir beide für ein paar Minuten schweigend in unsere Gläser. Das Telefon läutete, ich sprang auf und begann, es zu suchen. Das verhasste Telefon versprach mir einen Aufschub, gab mir die Möglichkeit, zu entfliehen. Ich fragte mich, warum ich mich wieder so hoffnungslos ausgeliefert fühlte – Ivo, unserer Vergangenheit oder dem, was nun kommen sollte –, aber ich verspürte Erleichterung, im Telefonhörer eine fremde Frauenstimme zu hören.
– Wer spricht da?
Der Name sagte mir nichts.
– Hier ist die Betreuerin von Theos Nachmittagsgruppe. Ich wollte fragen, weil Theo ist nicht abgeholt worden, und montags ist er normalerweise nicht in meiner Gruppe. Da geht er immer zum Fußballtraining, wenn ich mich nicht irre, und da wollte ich einfach …
Und schon wieder hasste ich das Telefon!
– Oh mein Gott! Ich bin in zwanzig Minuten da. Könnten Sie so lange …?
– Ja, sicher, kein Problem.
– Mein Mann und ich, wir haben da was durcheinandergebracht.
Schon wieder log ich.
Ivo war aufgestanden und befasste sich wieder mit den im Regal aufgestellten Familienfotos.
– Ich muss los. Ich muss Theo abholen.
– Das können wir doch zusammen machen.
– Ich glaube, es ist besser, wenn ich allein gehe.
– Doch, klar. Da kann ich ihn kennenlernen.
– Das ist wirklich nicht der passendste Augenblick, Ivo!
Aber er hatte schon sein Glas geleert und seine Lederjacke in die Hand genommen. Ich spürte den Alkohol, den ich tagsüber überhaupt nicht gewohnt war. In meinen Ohren schwirrte es, als wäre ein merkwürdiger Tinnitus ausgebrochen, ich schwitzte.
Wir rannten die Treppen hinunter, ich warf mir im Laufen den Mantel über. Ivo schien entspannt und leicht amüsiert – wie immer.
Als ich versuchte das Auto aufzuschließen und mir der Schlüssel aus der Hand rutschte, gab er mir grinsend ein Zeichen, mich auf den Beifahrersitz zu setzen.
– Lass mich machen, meinte er, und ich gab erleichtert nach. Zum zweiten Mal an dem Tag war ich kurz vor einer Heulattacke.
Er fuhr schnell und selbstsicher, wissend, dass er gerade diese ihm eigene Selbstzufriedenheit ausstrahlte, die mich furchtbar ärgerte und reizte; ich dachte darüber nach, ob er in all seinen Scheißkrisengebieten, wo er für seine ach so wahrhaften und enthüllenden Berichte recherchieren musste, auch so selbstsicher und so lässig wirkte. Ob er in zerbombten Städten und in den mit Leichen übersäten Straßen auch so amüsiert und leger herumspazierte. Seiner selbst sicher und immer ein wenig über anderen stehend, immer seiner selbst ein wenig mehr bewusst als die anderen und immer ein wenig freier, souveräner, undurchschaubarer.
Ich weiß, ich kann mich genau erinnern, wann er damit angefangen hatte. Ich erinnere mich, wie er anfing, die Zigaretten bis auf die Filter zu rauchen, an seinen Nägeln zu kauen und Frauen angriffslustig zu mustern; ich erinnere mich an seinen traurigen Blick, der von anderen immer als herausfordernd verstanden wurde, und ich erinnere mich an seine Notizbücher, die er immer vollschrieb bis an die Ränder, als würde er kleine Anker in den Ozean werfen.
– Jetzt nach links.
Ein paar kurze Anweisungen, das war das Einzige, was ich auf der Fahrt zu Theos Schule herausbrachte.
Er rauchte, obwohl es Marks Auto war und er den Gestank bemerken und sich darüber ärgern würde, aber ich wagte nicht, Ivo darauf aufmerksam zu machen, da ich die ganze Zeit über die »gewollt unspießige Bartheke« nachdenken musste und nicht wollte, dass er mich weiterhin bewertete.
Er hatte das Fenster heruntergekurbelt und blickte sich neugierig wie ein Schuljunge um. Er schien die Stadt wiederzuerkennen oder sie eben nicht mehr zu kennen, sie verwundert zum ersten Mal zu Gesicht zu bekommen – ich konnte es nicht einschätzen.
Ich ließ ihn im Auto warten. Theo saß im Raum der Nachmittagsgruppe im Erdgeschoss und kaute an einer Mohrrübe. Er zog ein beleidigtes Gesicht, schien aber nicht beleidigt genug, um nicht sofort aufzuspringen und auf mich zuzurennen. Ich bedankte mich bei der Betreuerin, versuchte, entspannt und selbstsicher zu wirken, als wäre das Ganze einfach nur ein kleines Missverständnis.
Ich habe lange keine Kinder haben wollen, eigentlich habe ich nie Kinder haben wollen, genau aus dem Grund, weil ich mich der Mutterrolle nicht gewachsen fühlte, und ich spürte lange bevor ich mit Theo schwanger wurde, dass ich, was auch immer ich tun würde, nie gut genug sein würde. Weder für mich noch für mein Kind.
– Wo ist Papa?, fragte Theo und steckte den Rest der Mohrrübe in seine Jackentasche. Die anderen Kinder, meist ältere, saßen still da, zeichneten oder machten Hausaufgaben, sie ignorierten Theo. Auch er sagte keinem auf Wiedersehen, außer seiner Betreuerin.
– Ich bin heute dran. Weißt du doch.
– Und wieso hast du dann vergessen, mich abzuholen?
– Ich habe dich nicht vergessen. Ich bin doch hier. Ich habe mich nur verspätet.
– Hast du gearbeitet?
– Nein, ich komme zu spät, weil wir Besuch haben.
– Besuch?
Seine dunkelbraunen Augen begannen zu strahlen, und die Wut über meine Verspätung schien vergessen.
– Ein mir sehr wichtiger Mensch. Ein Familienmitglied. Ich habe dir schon einmal von ihm erzählt, wenn du dich erinnerst.
– Von deiner oder Papas Familie?
– Nein, von meiner Familie.
Ich sagte schon seit Jahren nicht mehr Bruder, wenn ich Ivo meinte. Keiner in unserer Familie sprach von ihm als meinem Bruder. Aber es wunderte mich, dass ich es jetzt zu Theo nicht sagte. Ich versuchte ehrlich und respektvoll mit ihm umzugehen; mit derselben Ernsthaftigkeit, mit der Tulja uns erzogen hatte. Vielleicht hatte es uns die Leichtigkeit geraubt, aber es hatte uns alle drei zu selbstständigen Menschen gemacht.
Wir näherten uns dem Parkplatz, auf dem das Auto stand. Ivo sah aus dem Fenster und rauchte eine neue Zigarette. Er beobachtete uns, ich wusste das, obwohl ich sein Gesicht aus der Ferne noch nicht erkennen konnte.
– Das ist Papas Auto, sagte er, und in dem Moment hätte ich ihn am liebsten geschüttelt dafür, dass er dieses Besitzdenken, diese, wie Tulja sagen würde, kapitalistische Kinderkrankheit so offen zur Schau stellte. Ich war nicht auf vieles stolz aus meiner Kindheit. Vielleicht auf unsere Freiheit, auf Ivo, darauf, dass wir immer besser schwimmen konnten als die anderen, und darauf, dass wir immer alles teilten. Besitz war in unserem Haus verpönt. Marks Kindheit glich meiner nicht mal ansatzweise. Er sah nichts Schlechtes darin, förderte es sogar, dass sein Sohn früh erkannte, worauf er Anspruch hatte.
– Meins ist in der Werkstatt, Liebling, sagte ich und umschloss Theos kleine Hand ein wenig fester. Er versuchte den Griff zu lockern, aber ich ließ es nicht zu, und während wir unsere kleine Machtprobe austrugen, standen wir schon vor dem Wagen. Ivo stieg aus und reichte meinem Sohn die Hand. Theo schaute zu ihm hoch, befreite seine Hand aus meiner und erwiderte den Händedruck.
– Das ist Ivo, Theo, sagte ich und sah die beiden abwartend an. Der Anblick der beiden war befremdlich und verhieß eine kolossale Änderung, die ich keineswegs auf mich zu nehmen bereit war.
– Du hast aber einen komischen Namen, sagte mein sechsjähriger Sohn und stieg ins Auto. Wir haben ein Foto von dir zu Hause.
– Wirklich?
– Ja. Da siehst du aber anders aus. Da hast du die Haare anders.
– Das stimmt wohl. Da waren nicht nur meine Haare anders, glaube ich.
– Was denn noch?
Ich überlegte, dass ich Ivo vielleicht hätte warnen sollen, sich keinesfalls auf Theos Fragen einzulassen, denn sie würden nie ein Ende nehmen. Im Normalfall zeigte Theo kaum Interesse an seiner Umwelt und an seinen Mitmenschen, aber wenn einmal seine Neugier erwacht war, schien sie nicht enden zu wollen. Ich wünschte mir manchmal, dass diese Neugier lenkbar wäre, denn nicht alles, was ihn interessierte, interessierte mich – und umgekehrt.
– Na ja, ich würde sagen: alles.
Theo schien darüber nachzudenken. Ivo sah mich fragend an.
– Wo soll es denn hingehen, meine Herrschaften?, rief Ivo gespielt heiter und sah mich an.
– Erst nach Hause, ich muss mich schnell umziehen, und dann zum Fußball. Ich darf nicht zu spät kommen, verstehst du?, sagte Theo im Befehlston von der Rückbank, und ich erwiderte nichts, nahm seine herrische Art einfach hin und nickte.
Auf der Fahrt hörte Theo nicht auf zu fragen: Wo Ivo denn gewesen sei, warum er uns nicht öfters besucht habe, warum er rauche und dass Papa in seinem Auto eigentlich keine Raucher haben wolle; er erzählte von seinem Fußballtraining und von seinem besten Freund, dessen Vater eine Kaninchenzucht betreibe; erzählte von dem ganz großen Pavillon, in dem sein Vater arbeitete und zu dem er manchmal gehen durfte; er erzählte, dass er Tulja einmal im Armdrücken besiegt habe und dass er Lenis ältesten Sohn doof finde, weil der Mädchen mochte und so eingebildet sei, seit er ein Moped bekommen hatte.
Zu Hause machte ich ihm ein Butterbrot, für etwas Warmes reichten meine Fantasie und die Zeit nicht aus, ich war zudem gänzlich von Ivos Anwesenheit in Anspruch genommen und von der Frage, was sein Hiersein für mich bedeutete.
Theo holte den Rest seiner Mohrrübe aus der Tasche und deponierte sie demonstrativ oben auf dem Früchtekorb. Als ich ihm vorschlug, die Mohrrübe wegzuwerfen, weil sie ziemlich unappetitlich aussehe, wurde er wütend und beharrte darauf, es sei seine Mohrrübe, mit der er machen könne, was er wolle. Ivo schien von seinem Einblick in unseren Alltag amüsiert und schaute neugierig mal zu mir, mal zu Theo.
Ich hatte den ununterdrückbaren Wunsch, mich im Schlafzimmer zu verbarrikadieren und bis spät in der Nacht allein gelassen zu werden. Und schon wieder gab ich nach. Die angefressene Mohrrübe blieb auf dem Obst liegen: als Symbol der kapitalistischen Kinderkrankheit, wie Tulja es zu sagen pflegte, als Zeichen meiner Ohnmacht.
Zu dritt fuhren wir im Auto meines Mannes zum Fußballplatz meines Sohnes. Von außen betrachtet schien das Bild zu stimmen, mit einer kleinen Ausnahme: Der Mann stimmte nicht. Der Mann, der hier eigentlich ins Bild gepasst hätte, stand wahrscheinlich gerade im Studio und schnitt einen seiner Dokumentarfilme: mein Mann, der keine blasse Ahnung davon hatte, dass an diesem Morgen unser gesamtes gemeinsam erkämpftes Beisammensein, unser Alltag, unsere Gewohnheiten, unsere Versprechen, unsere Gemeinsamkeiten und Differenzen, unsere Nächte, unsere Urlaubspläne und unsere Feiern, die wir so gerne gemeinsam vorbereiteten und ausrichteten, in Frage gestellt wurden. Und dass ich nichts dagegen tat, sondern im Gegenteil mit einem ausgeliehenen Leben, in einem ausgeliehenen Wagen und mit einem ausgeliehenen Mann zum Fußballplatz fuhr und mich fragte, wie es so schnell passieren konnte, dass sich alles, einfach alles um mich herum so falsch anfühlte. Wie viel riskierte ich für eine vergangene, niemals irgendein Glück verheißende Beziehung zu einem Menschen, für die ich in den sechsunddreißig Jahren, die ich auf der Welt war, keinen Namen gefunden hatte.
3.
An den Rest des Tages erinnere ich mich nur vage.
Irgendwann, nachdem er mich nach Hause und das Auto meines Mannes in die Garage gefahren hatte, verschwand Ivo. Er sagte nur, er habe noch etwas zu erledigen. Ich war wie benebelt, fragte nichts mehr.
Später kam Mark samt Theo, den er vom Fußball, und mit meinem Wagen, den er aus der Werkstatt abgeholt hatte, nach Hause.
Wir aßen Abendbrot, und Mark löcherte mich mit Fragen nach Ivo und was sein plötzliches Auftauchen zu bedeuten habe. Ich denke, er war eifersüchtig, wollte dann mit mir schlafen und sich auf diese Art und Weise vergewissern, dass alles noch beim Alten war. Er wollte eine Bestätigung, und ich gab sie ihm. Ich schlief mit ihm und versuchte anwesend zu wirken.
Als er eingeschlafen war, setzte ich mich auf und betrachtete lange meinen nackten Körper. Ich weiß nicht, warum ich das tat. Ich weiß nicht, welche Art der Bestätigung ich suchte.
Am nächsten Tag brach dann der Wahnsinn los. Plötzlich schien die ganze Familie wieder intakt. Sogar Mutter rief an und wollte wissen, ob Ivo gut angekommen sei und wie unsere Reaktionen auf seine Rückkehr gewesen wären.
Mein Leben ging zu meiner Überraschung ungestört weiter. Ich saß am Laptop, ich fuhr Theo zur Schule, ich telefonierte, ich bemühte mich um Mark.
Am Abend kreuzte meine Schwester in unserer Wohnung auf. Lenis Haare schimmerten in künstlichem, mit Henna gefärbtem Rot, und ihre Tasche quoll über von dem Spielzeug ihres jüngsten Kindes.
Leni hatte ihr Leben lang versucht, ihre, wie sie es nannte, verfehlte Kindheit gutzumachen. Sie hatte Sozialwissenschaften studiert und dann angefangen, Kinderbücher zu schreiben. Der Erfolg ließ auf sich warten, bis sie ihren Mann kennenlernte, der einen Kinderbuchverlag leitete, und seit diesem Moment konnte sie von ihrem Schreiben leben. Sie begann, sich von Tulja abzuwenden, für die sie sich immer mehr zu schämen schien. Sie bekam drei Kinder und zog in eine noble Villengegend. Ihre neue Rolle spielte sie perfekt: Bei allen Zusammenkünften erklärte sie den Familienmitgliedern und anderen anwesenden Personen, wie man Kinder erzieht, wie man die Welt kindgerecht umgestalten sollte, wie man Kinderbücher schreibt. Als sei das eigentliche Ziel unseres Lebens Kinderkriegen, Kindererziehen und Kinderbuchschreiben.
Ich habe mich wohl nur deshalb von Leni nie wirklich gelöst, weil ich sie brauchte: Sie war für mich eine Bestätigung für alles, was war, worüber man aber nie sprach, was alle wussten und woran sich keiner in unserer Familie erinnern wollte, das sie aber, zwar anders als Ivo und ich indirekt, jedoch ebenfalls miterlebt hatte. Wodurch sie genauso beschädigt worden war. Was sie genauso versuchte, hinter sich zu lassen. Und sie war die Bestätigung für die einzige klare Aussage meines Lebens: Leni war meine Schwester, und bei ihr musste ich kein eigentlich hinzufügen.
Nachdem sie ihren dritten Sohn bekommen und die Hoffnung auf ein Mädchen aufgegeben hatte, dem sie rosa Rüschenkleider kaufen und niedliche blonde Zöpfe flechten konnte, wurde es jedoch für mich schwierig, die fast unerträgliche Biederkeit, die sie ausstrahlte, ihre Schönheit, die immer provinzieller wurde und die darin mündete, dass sie zunahm und sich die Haare mit Henna färbte, zu ertragen. Ebenso die Tatsache, dass sie einen Golf fuhr, weil sie Angst hatte, in ihrer Vorstadtidylle mit einem größeren Modell provozierend zu wirken.
– Tulja lädt uns ein für Samstag. Wir alle sollen kommen. Die Wiederkehr des verlorenen Sohnes feiern. Was sagt man dazu?, meinte sie spitz und setzte sich auf die Couch, um im nächsten Augenblick wieder hochzuspringen und in meinen Küchenschränken nach einem gesunden Tee zu stöbern. Eine ihrer Eigenschaften, mit der ich in den letzten Jahren immer weniger klarkam, war Lenis dauerfrustrierter Sarkasmus.
– Er war schon hier.
– Was? Du hast ihn schon gesehen? Das Phantom der Oper ist wieder bei dir aufgetaucht? Einfach zauberhaft. Und was sagt der Herr? Wie stehen seine Aktien?
– Er sieht gut aus. Er braucht eine kleine Pause.
– Ich bin überrascht, nein wirklich. Und dass ihn Gesi einfach so zu uns fahren lässt!
Leni spielte gern die verlassene Tochter und vergaß dabei, dass sie diejenige war, die mit elf Jahren lauthals dagegen protestiert hatte, nach Newark zu ziehen. Sie wies Mutter die Rolle der Schuldigen zu und war froh darüber, dass sie Mutter zum Sündenbock für alles ausrufen konnte, was nicht richtig lief. Sie hatte so gut wie keinen Kontakt mit ihr und weigerte sich von Anfang an, mit ihren Kindern bei ihr Urlaub zu machen.
– Ist es ein Verbrechen, dass Gesi ihn gelegentlich sieht?
– Und schon wieder fängst du damit an.
– Wie meinst du das?
– Na ja, du nimmst ihn schon wieder in Schutz.
– Ich nehme ihn nicht in Schutz. Es ist einfach so.
Sie sah mich misstrauisch an und suchte weiter in meinen Schränken. Mir fiel auf, dass dieser Anblick eigentlich sehr ungewöhnlich war – Leni allein, ohne Kinder. Ich versuchte mich zu erinnern, wann dies das letzte Mal der Fall gewesen war, und kam nicht darauf. Leni hatte von Anfang an ihre Mutterrolle demonstrativ angenommen und damit der ganzen Welt klargemacht, dass eine Frau, die von der eigenen Mutter verlassen worden war, selbst keine schlechte Mutter sein musste. Leni meisterte ihr Familienleben in Perfektion – und das sollten gefälligst alle erfahren.
Sie fand einen Tee, der ihren biologischen Ansprüchen genügte, und bereitete ohne mich zu fragen auch mir eine Tasse zu. Auch das zeichnete Leni aus: Sie wusste immer, was für die anderen gut und was schlecht war.
– Ich bin froh, dass er wieder da ist.
Ich bemühte mich, wie schon tausendmal, um eine gewisse Ehrlichkeit ihr gegenüber.
– Ich zweifele daran, ob du weißt, was für dich gut ist und was nicht. Du kennst ihn ja, solltest du jedenfalls. Also zieh selbst die notwendigen Schlussfolgerungen aus seinem Besuch.
– Was soll das jetzt bitte heißen?
– Es war für uns alle das Beste, dass er nach Amerika gegangen ist. Es war für uns alle das Beste, dass er weggegangen ist. Und weggeblieben ist. Erst danach hast du dein Leben in den Griff bekommen. Erst als er weg war, ist Vater ruhiger geworden. Erst als Ivo weg war, wurde sogar Tulja ausgeglichener. Es war einfach besser so. Er hat uns kein Glück gebracht!
Leni hatte nie aufgehört, in Ivo die Wurzel allen Übels zu sehen, so wie sie nie aufgehört hatte, Mutter für etwas die Schuld zu geben, wofür sie am allerwenigsten Schuld trug. Aber Leni war stur, und nichts schien sie vom Gegenteil überzeugen zu können, sobald sie sich einmal in ihrer Meinung festgefahren hatte.
Ich sah ihr Gesicht an. Ihr Gesicht, das einmal sehr hübsch gewesen war, hellblaue Augen und volle Lippen, die so viele zum Küssen verleitet hatten, mit ihrem sonnengebräunten Teint und ihren hervorstehenden Wangenknochen. Wenn man nur ihr Gesicht betrachtete, losgelöst von ihrem trägen Körper, ihrer Kleidung, ihrem Auftreten – dann war sie eine wunderschöne Frau, die von der ganzen Familie die besten Gesichtszüge vererbt bekommen hatte: die kleine Stupsnase von meiner Mutter, den vollen Mund von meinem Vater, die runden, klaren Augen von Tulja. Aber sobald sie den Mund aufmachte, sobald man auf ihre Körperhaltung achtete, trat etwas fast schon Grausames zum Vorschein: eine angestrengte Gestik, musterhaft gestreckte Schultern, ein Ansatz zum Doppelkinn, ungepflegte Hände und die matronenhafte Weichheit des Körpers. Diese Erkenntnis tat mir im Herzen weh, und schon wieder hatte ich dieses unsägliche Gefühl, nicht in meinem Leben zu stehen – ich war wie eine Schauspielerin in einem der Fernsehdokumentarfilme meines Mannes.
– Ich mag jetzt keinen Fencheltee.
– Ach, hör doch auf, ab und zu muss man sich was Gutes tun.
– Aber der tut mir nicht gut; ich mag überhaupt keinen Fencheltee. Ich kriege Bauchkrämpfe davon.
– Niemand kriegt Bauchkrämpfe von Fencheltee.
– Ich hasse Fenchel.
Leni sah mich mit strafendem Blick an, der ausdrückte, dass ich absolut falschlag, dass ich mich überhaupt falsch ernährte, dass ich die absolut falschen Tees trank.
Sie trank ihren gesunden Tee und sah sich um. Als würde sie am Zustand meiner Wohnung den meines Leben ablesen können.
– Und, wirst du kommen?, fragte ich sie, um die unangenehme Stille zu durchbrechen.
– Was meinst du, wohin?
– Am Samstag, zu Tulja?
– Da muss ich wohl hin, oder? Sonst wird mir der heilige Familiensegen entzogen. Gerade Tulja ist so was von aus dem Häuschen. Sie hat ja ihren heiß geliebten Jungen wieder. Wenn man es sich recht überlegt, war Ivo immer der bessere Enkel, der bessere Sohn, das bessere Kind, besser jedenfalls, als wir es je waren. Unglaublich.
Leni, die Eifersüchtige. Als Älteste hatte sie sich den Realitäten, den Katastrophen unserer Vergangenheit mehr stellen müssen als wir. Vielleicht hatte sie daher das Gefühl des Nichtgenügens nie überwunden. Vielleicht war ihr ganzer Kinderwahn eine einzige Flucht, eine einzige Sehnsucht nach einer heilen Kindheit.
– Hast du schon mit Papa gesprochen?, fragte ich beiläufig und sah auf die Uhr. Als könne mich Theo, den Mark bald nach Hause bringen müsste, vor dieser Tortur retten. Auf der Theke standen die dampfenden Tassen mit dem strengen Fenchelgeruch wie ein Symbol unseres schwesterlichen Scheiterns, neben dem Obstkorb, auf dem immer noch der Rest von Theos Möhre thronte.
– Vater wird kommen, samt seiner Tussi. O Gott! Hast du sie das letzte Mal an seinem Geburtstag mal genauer angesehen? Es ist ja unglaublich: Sie sieht aus wie eine Kröte.
– Immerhin ist sie nicht sechsundzwanzig Jahre jünger als Vater. Wenigstens das Alter stimmt zwischen den beiden.
– Ach, Blödsinn. Bei der stimmt es vorne und hinten nicht. Und sie kommt aus einem nicht unbedingt noblen Milieu, das kann man aus hundert Metern Entfernung sehen, und dann dieser schreckliche Dialekt! Ich krieg das Kotzen!
– Krieg dich wieder ein. Sie ist jetzt mehr als zwei Jahre mit ihm zusammen. Das muss man erst mal können!
– Papa ist nach wie vor ein stattlicher Mann, er würde eine Bessere abkriegen, manchmal denke ich, er hat nur Mitleid mit ihr; in ihrem Alter, in ihrer Stellung, da kriegt sie doch keinen vernünftigen Kerl mehr ab.
Leni liebte Vater. Sie vergötterte ihn regelrecht und sah ihn als das Opfer unseres grausamen Schicksals. Die Welt war ungerecht zu Frank, seine Frau, seine Kinder hatten ihm nicht geholfen; er, der edle Ritter, hatte einen Jungen adoptiert, einen verwahrlosten, armseligen und von allen im Stich gelassenen Jungen, und auch der hatte ihm keine Dankbarkeit gezeigt. Leni schaffte es, alle Tatsachen, Erinnerungsfetzen so hinzubiegen, so zu verdrehen, dass sie das Bild ergaben, was sie vom Vater haben, vor allem aber erhalten wollte.
– Sei nicht immer so gehässig. Sie ist gut für ihn.
– Was heißt denn bitte schön gehässig? Sie ist eine ordinäre Nutte. Mehr nicht. Mit ihren blondierten Haaren und ihrem Make-up, als wäre sie in einem verdammten Hollywoodfilm …
Leni wollte noch irgendetwas hinzufügen, aber da läutete ihr Handy; ihr Mann schien verärgert, ob sie vergessen habe, dass der Karateunterricht des Zweitgeborenen ausfalle, und sie solle ihn doch bitte abholen. Leni, völlig panisch, dass ihr in ihrer Mutterrolle dieser kleine Fehler unterlaufen war, sprang auf und warf dabei ihre Tasche um. Eine Gummiente, ein Plastikauto, dem ein Rad fehlte, ein mit Kuli bemaltes Kinderüberraschungsei und eine Dose Gleitgel kullerten auf den Steinfußboden meiner Küche.
Die Dose mit dem Gleitgel war schmal, rosa und mit Glitzersternen geschmückt; sie passte gut in die Spielzeugwelt ihrer Tasche. Als Leni sah, dass ich das Glitzerobjekt bemerkt hatte, tat sie so, als sei es das Normalste der Welt; wie nebensächlich sammelte sie alles – das Gleitgel demonstrativ als Letztes – auf und steckte es zurück in ihre Tasche. Wir hatten, seitdem wir erwachsen geworden waren, die stillschweigende Abmachung, Stillschweigen zu bewahren über Dinge, die etwas über uns selbst aussagen konnten. Also ersparte ich mir den Kommentar.
Doch als sie im Flur stand und im Begriff war, meine Wohnung zu verlassen, rutschte es mir heraus:
– Ihr treibt es wohl wild, was?
Ich grinste, und es tat gut, wieder fünfzehn zu sein und sich so offensichtlich für das Sexualleben seiner Schwester interessieren zu dürfen.
– Was für eine dämliche Frage, Stella!
Leni war rot angelaufen, und ich wusste, dass sie sich verkrampfte und insgeheim die Hände zu Fäusten ballte.
– Wieso? Das interessiert mich einfach!
– Was interessiert dich? Ob und wie ich mit meinem Mann schlafe?
– Ja, warum nicht? Ich meine, du bist meine Schwester, früher habe ich dich so was fragen dürfen.
– Früher ist aber nicht jetzt, sagte sie und rannte hinaus. Aus dem Treppenhaus hörte ich sie rufen:
– Bis Samstag!
Ich schloss die Tür hinter ihr zu, lehnte mich daran und fing an zu lachen. Die Situation war so absurd, und gleichzeitig erschrak ich über mein eigenes Gelächter; ich erschrak, weil ich wusste, dass der Bruch mit gewohnten Mustern einzig und allein mit dem Früher zu tun hatte, und dieses Früher hieß Ivo.
Tulja kündigte an, sie mache eine Jahrhundertfeier und jeder, der ihrer Einladung nicht folge, gehöre nicht mehr zu ihrem Familienkreis. Ich rief Vater an, Vater rief Leni an, Leni rief mich an; Tulja rief Vater an, Vater beklagte sich über Tuljas einnehmende, bemutternde Art, ich tröstete Vater, Leni rief mich an und schimpfte über Vater und dass er sich nicht schonen würde. Tulja traf mit Mutter Absprachen. Mutter rief wieder mich an, schimpfte über Lenis Taktlosigkeit und äußerte Befürchtungen, sie würde Ivos Rückkehr verderben. Und so ging das die ganze aufgeregte Woche lang.
Ivo hatte sich in der Niendorfer Strandscheune einquartiert und genoss Tuljas Zuwendung. Er selbst rief niemanden von uns an und nahm es hin, dass Tulja eine Willkommensfeier samt Wiedervereinigung der Familie plante.
Mark hatte gerade einen Vertrag für einen neuen Dokumentarfilm unterschrieben und war damit beschäftigt, seine Reise zu den Drehorten auf Zypern zu organisieren. Theo und ich blieben meist allein.
Die Verabredung für die Feier meiner Kollegin hatte ich natürlich verpasst, alle in der Redaktion schienen es mir übelzunehmen. Leo, unser Chefredakteur, nahm es mir doppelt übel, weil er es auf Nadia, auf deren Party ich gefehlt hatte, abgesehen hatte und er unbedingt auf meine Unterstützung samt Verkuppelungsversuch gebaut hatte. Ich arbeitete an einem Artikel über eine Kunstbiennale, die »modern, bahnbrechend und wegweisend« sein sollte und die in Wirklichkeit nur altbacken, bieder und völlig konservativ war. Ich bat um die Verschiebung der Abgabefrist, was die allgemeine Stimmung nicht unbedingt verbesserte.
Zu meinem Beruf gehörte es, in gewissen Momenten zu lügen. Dinge, die völlig sinnentleert waren, als »modern, bahnbrechend und wegweisend« darzustellen und Kunststücke, Künstlerinterviews, Filmpremieren und Buchpräsentationen – völlig dekadent, absolut eitel und bar jeglicher Ideen – als wichtig anzupreisen. Aber nun erschien mir das berufliche Lügen völlig unmöglich.
Theo schien gereizt, irgendetwas beschäftigte ihn, und er jammerte und nörgelte. Die Möhre blieb weiterhin im Korb liegen, und er ließ Mark und mich einen Schwur ablegen, dass wir sie weder wegwerfen noch essen würden. Die Frage, worum es ihm bei der Möhre ging, war zu viel für mein wundes Hirn, und ich tat sie beiseite, um mich später, nach dem Samstag, damit zu beschäftigen.
– Ich fliege schon am Freitag nach Nikosia, sagte Mark und machte seinen Jeansreißverschluss auf. Ich kam gerade aus der Dusche, in seinen Bademantel eingehüllt. Ich weigerte mich, einen Bademantel zu kaufen.
– Und was ist mit Tuljas Einladung?, fragte ich.
– Ich kann meinen Flug nicht verschieben.
– Ich muss da hingehen.
– Ich sag ja nichts.
– Ich nehme Theo mit und übernachte da. Wir kommen dann Sonntag zurück.
– Er hat Sonntag sein Training.
– Ach ja. Dann versuch ich, Sonntag früh wegzukommen.
– Bist du dir sicher, dass du hinwillst?
– Mark …
– Ist ja gut, ich habe nur gefragt.
– Ich wünschte, du wärst dabei.
– Hey, das ist deine Familie, du kennst sie ja alle, sie werden dich schon nicht auffressen.