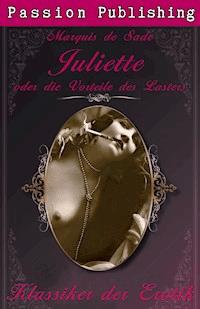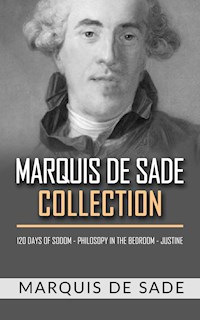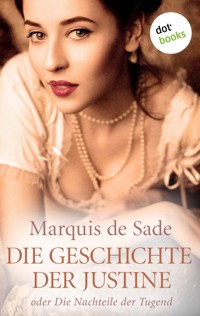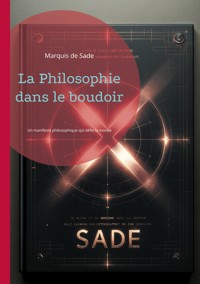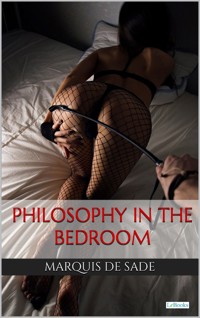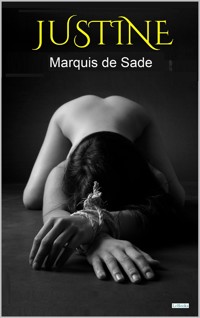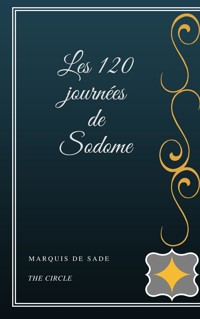1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Erotik bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Überarbeitete Fassung mit einem aktuellen Aufsatz zu Autor und Werk und einem älteren Nachwort. Nach dem Tod der Eltern verlassen die mittellosen Schwestern Justine und Juliette die Klosterschule. Die bisexuelle, grausame und lasterhafte Juliette wird Prostituierte, lernt einflussreiche Freunde kennen, begeht eine Vielzahl von Verbrechen und erlangt Reichtum und Glück. Die tugendhafte Justine hingegen erlebt ein Unglück nach dem anderen und wird von den Menschen gepeinigt und für ihre Moral bestraft. Nachdem Juliette das Klosterstift verlassen hat, in dem sie aufgewachsen ist, wird sie zur erfolgreichen Prostituierten. Auf ihrem Weg durch die Betten der feinen Gesellschaft begegnet sie Noirceuil, dem Mörder ihrer Eltern. Der von ihr widerwillig bewunderte Giftmischer macht sie mit Staatsminister Saint-Fond bekannt. Durch diesen gelangt sie in einen Kreis hochmögender Perverser. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Marquis de Sade
Juliette
oder Die Vorteile des Lasters
Marquis de Sade
Juliette
oder Die Vorteile des Lasters
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 4. Auflage, ISBN 978-3-943466-87-4
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Autor und Werk
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Nachwort
Isolation und Schreibzwang
Noirceuils Zierpuppe
Der arme Bauer Martin de Grange
Die Versuchung des Pater Claudius
Der Vulkan
Kurzdefinition der Begriffe Sadismus und Sadomasochismus
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Erotik bei Null Papier
Die 120 Tage von Sodom
Justine
Erotik Früher
Fanny Hill
Venus im Pelz
Juliette
Casanova – Geschichte meines Lebens
Gefährliche Liebschaften
Traumnovelle
Die Memoiren einer russischen Tänzerin
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Autor und Werk
Nachdem Juliette das Klosterstift verlassen hat, in dem sie aufgewachsen ist, wird sie zur erfolgreichen Prostituierten. Auf ihrem Weg durch die Betten der feinen Gesellschaft begegnet sie Noirceuil, dem Mörder ihrer Eltern. Der von ihr widerwillig bewunderte Giftmischer macht sie mit Staatsminister Saint-Fond bekannt. Durch diesen gelangt sie in einen Kreis hochmögender Perverser. Ehrgeiz des erlauchten Zirkels ist es, mittels sadomasochistischer Praktiken, möglichst viele Frauen zu Tode zu foltern. Juliette findet an der Idee Gefallen und tötet eine Gespielin, die sich ihr zuvor verweigert hat. Daraufhin versichert sich Saint-Fond ihrer Dienste als Mordgesellin. Allerdings macht Juliette sich angreifbar, als der Minister plant, zwei Drittel der französischen Bevölkerung verhungern zu lassen. Auf der Flucht vor ihrem Verfolger lernt sie Graf Lorsagne kennen, den sie heiratet, um ihn zu beerben, sobald er aus dem Weg geräumt ist.
Sie begibt sich - finanziell saniert - nach Italien. Eine Ausnahmeerscheinung, unter den dortigen Gleichgesinnten, ist der begabte Minski: Die schmackhaft zubereitete Kammerzofe Juliettes serviert er auf nacktem Mädchenrücken. Zum Dessert präsentiert Minski einen raffinierten Mechanismus, mit dessen Hilfe 16 Menschen gleichzeitig ums Leben gebracht werden können.
Im zivilisierten Florenz sowie in Neapel wohnt Juliette Aufführungen bei, deren Reiz im künstlerisch inszenierten Massenmord besteht. Selbstverständlich schaut sie nicht nur unbeteiligt zu: Einigen ihrer Freundinnen verhilft Juliette zu akuter Sterblichkeit.
Sexuelle Begegnungen mit amoralischen Machthabern bestimmen die Handlung des Romans. Darin schildert der Autor ausführlich zahlreiche verbrecherische, sadomasochistische Szenen. Ruhepunkte sind lediglich die weltanschaulichen Äußerungen der Protagonisten.
»Juliette oder die Vorteile des Lasters« gehört ursprünglich zu einem zehnbändigen Werk de Sades, das 1797 unter dem Titel »Die neue Justine oder das Unglück der Tugend - sowie die Geschichte der Juliette, ihrer Schwester« erscheint. Sechs der zehn Bände umfassen die »Juliette«, welche als amoralischer Gegenentwurf zu ihrer tugendhaften Schwester Justine konzipiert ist. Beide Romane sagen aus, dass Tugend sich nicht lohne, Laster sich hingegen auszahle. De Sade geht davon aus, dass der Mensch triebhaft zur Zerstörung des Mitmenschen angelegt, das Gute demnach unnatürlich sei. Bereits die 1787 geschriebene Urfassung der »Justine« – »Juliette« entsteht 1796 als Folgeroman – enthält diese Grundaussage.
Der 1740 geborene Donatien-Alphonse-François de Sade führt das exzessive Leben junger Aristokraten, bis seine Orgien selbst für die zügellosen Sitten jener Epoche untragbar werden. Er wird mehrfach zu Festungshaft und zum Tode verurteilt. Die Todesurteile werden wieder aufgehoben. Sämtliche Schriften verfasst der Marquis in Haft, verzeichnet jedoch kaum wirtschaftliche Erfolge, zumal er sich zu den einträglichsten Romanen, »Justine« und »Juliette«, nicht bekennt. Das Ende seines Lebens verbringt er in einer Irrenanstalt, wo er Schreibverbot erhält und in Isolation gehalten wird. Dort stirbt de Sade im Jahr 1814. Seine Grabstätte ist heute nicht mehr auffindbar.
Beeinflusst ist das literarische Schaffen de Sades einerseits vom Schrifttum der Aufklärung (unter anderem von Thiry d’Holbach und Voltaire), andererseits von seiner Wahrnehmung des Ancien Régime. Es herrscht das Recht des Stärkeren, der lediglich durch einen noch Skrupelloseren aufgehalten wird. Motivation ist der Trieb zum Bösen, der keiner Rechtfertigung bedarf: Ein Mord kann um des Tötens willen geschehen, ohne jeden Zweck, aus einer bloßen Laune heraus.
I.
Justine und ich wurden im Kloster Panthemont erzogen, Sie wissen, dass diese Abtei berühmt ist und dass aus ihr die hübschesten, ausschweifendsten Frauen von Paris hervorgehen; Euphrosine, jenes junge Mädchen, das sich aus dem Elternhaus entfernt hatte, um sich in die Arme der Wollust zu werfen, war dort meine Genossin gewesen, und da ich von ihr und einer ihr befreundeten Nonne die ersten Grundsätze der Moral zu hören bekommen hatte, muss ich, wie ich glaube, Ihnen vorerst sowohl von der einen, wie von der anderen erzählen.
Die Nonne, um die es sich handelt, hieß Délben. Sie war seit fünf Jahren Äbtissin des Hauses und dreißigjährig, als ich ihre Bekanntschaft machte. Man konnte unmöglich hübscher sein. Ihr Gesichtsausdruck war sanft, ihre Haare blond, und große blaue Augen erregten das Interesse jedermanns. Als Opfer des Ehrgeizes ihres älteren Bruders, der dadurch reicher werden wollte, war die Délben mit zwölf Jahren in ein Kloster gesteckt worden, und erst nach langen inneren Kämpfen hatte sie sich an den Gehorsam gewöhnt; sehr früh reif und mit allen Philosophen vertraut, hatte sich die Délben in ihrer Abgeschiedenheit bloß zwei oder drei Freundinnen bewahrt; die besuchten und trösteten sie, und da sie sehr reich war, konnte sie sich alle Bücher und Erleichterungen verschaffen, die sie wollte.
Euphrosine war fünfzehn Jahre alt, als ich Freundschaft mit ihr schloss, und sie war seit achtzehn Monaten Schülerin der Délben, als beide mir vorschlugen, an meinem dreizehnten Geburtstag mich ihrer Gesellschaft anzuschließen. Euphrosine war braun, groß und sehr schlank, hatte sehr hübsche Augen und viel Geist und Lebhaftigkeit. Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, dass der Hang zur Wollust bei Frauen, die von der Welt zurückgezogen leben, der einzige Beweggrund zum vertraulichen Verkehr ist. Die Oberin, die sich mit meiner Erziehung befassen sollte, lud mich eines Tages zum Frühstück ein. Es war unglaublich heiß, und die außerordentliche Glut der Sonne diente sowohl ihr wie der mitanwesenden Euphrosine als Entschuldigung für die Bekleidung, in der ich sie vorfand. Sie waren nämlich beide, von einem Gazehemd abgesehen, das durch ein großes rotes Band festgehalten war, ganz nackt.
»Seit Sie in dieses Haus eingetreten sind«, sprach Madame Délben zu mir und küsste mich leicht auf die Stirn, »habe ich immer gewünscht, Sie näher kennenzulernen; Sie sind sehr hübsch und scheinen Geist zu besitzen und derartige junge Mädchen haben ein Anrecht auf mich. Aber Sie erröten ja, kleiner Engel, das verbiete ich Ihnen; die Scham ist ein Hirngespinst, sie ist eine Gewohnheit. Die Natur, die den Mann und das Weib nackt geschaffen hat, kann ihnen unmöglich auch Scham für diesen Zustand eingeflößt haben. Aber wir werden über all dies noch plaudern, jetzt entkleiden Sie sich, wie wir es sind.« Dann näherten sich die beiden Schelminnen mir lachend, und als ich mich in demselben Zustand befand wie sie, begann die Délben mich mit Küssen zu bedecken, die einen ganz anderen Charakter trugen. »Wie schön meine Juliette ist«, rief sie bewundernd aus. »Wie ihre hübschen kleinen Brüste schon zu zittern beginnen. Sie sind größer wie deine, Euphrosine, obwohl sie erst dreizehn Jahre alt ist.« Die Finger unserer entzückenden Oberin kitzelten die Rosenspitze meiner Brüste, und ihre Zunge wand sich in meinen Mund hinein. Sie bemerkte bald, dass ihre Liebkosungen auf mich so stark einwirkten, dass mir beinahe übel wurde.
»Teufel!«, rief sie aus, denn sie konnte sich nicht länger halhalten. »Schämen wir uns nicht länger mehr, meine Freundinnen, weg mit allem, was die Reize der Natur vor unseren Augen verbirgt!« Und sie warf den dünnen Schleier, der sie bisher bedeckt hatte, von sich, sodass sie nunmehr unseren Augen schöner als Venus erschien. Euphrosine, die es ihr rasch nachmachte, zeigte mir nicht ebensoviel Reize, aber dafür, welche Augen und welchen Geist besaß sie. Sie können sich vorstellen, wie ich durch den Anblick der beiden erregt war. Im Taumel des süßesten Rausches trug mich die Délben auf ihr Bett, bedeckte mich mit Küssen. »Einen Augenblick«, sprach sie mit glühendem Gesicht, »ordnen wir unsere Verzückungen ein wenig, denn nur so genießt man wahrhaftig.« Bei diesen Worten spreizte sie meine Beine auseinander, legte sich platt auf das Bett mit dem Kopf zwischen meine Schenkel und leckte mich, während meine Genossin ihr den gleichen Dienst leistete.
Die Hure war lebhaft erregt und verschlang gierig die Ergüsse, die ihre wollüstigen Bewegungen in mir hervorriefen. Manchmal unterbrach sie sich, um mich in meinem Freudentaumel zu beobachten. »Wie schön sie ist!«, rief dieses Freudenmädchen aus: »Kitzle mich, Euphrosine, ich möchte in ihren Ergüssen ertrinken.« Einige Augenblicke später rief sie aus: »Wechseln wir jetzt ein wenig, Euphrosine, wartet, meine kleinen Engel, ich will euch jetzt beide gleichzeitig kitzeln.« Sie legte uns eine neben die andere auf das Bett, und auf ihren Rat kreuzten sich unsere Hände, sodass wir uns gegenseitig erregen konnten. Ihre Zunge drang zuerst in die Scheide Euphrosines ein, dann verließ sie meine Genossin, um sich in die meine zu stürzen. Nach einigen Augenblicken drehte uns die Schelmin um, sodass wir ihr den Popo darboten, und sie kitzelte uns von unten, während sie uns den Popo leckte. Dann erhob sie sich wie eine Bacchantin: »Ihr müsst mir jetzt denselben Dienst leisten!«, rief sie. »Ich werde in deinen Armen liegen, Juliette, und deinen Mund küssen. Dabei wirst du mir dieses Godemiché in meine Scheide hineintreiben», fuhr sie fort, und gab mir ein derartiges Ding, »und du, Euphrosine, du wirst dich mit meinem Popo befassen. Du wirst ihn mit diesem kleinen Werkzeug kitzeln.« Dann wandte sie sich wieder zu mir: »Du darfst meine Klitoris nicht im Stich lassen, Juliette, reibe sie, bis sie blutet, ich bin abgehärtet und erschöpft und bedarf starker Dinge. Ich will mich in euren Armen auflösen, ich möchte bei euch zwanzigmal nacheinander entladen.«
O Gott, wie arbeiteten wir, unmöglich könnte eine Frau besser bedient werden. Schließlich erhoben wir uns.
»Ich kann dir nicht genug meine Freude ausdrücken«, sprach das entzückende Geschöpf zu mir, »deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Du bist ein reizendes Kind und ich will dich an allen meinen Vergnügungen teilnehmen lassen. Frage nur Euphrosine, ob sie zufrieden mit mir ist.«
»Oh, Geliebte, meine Küsse mögen es dir beweisen«, sprach unsere junge Freundin und stürzte sich in die Arme der Délben. »Du hast meinen Geist geformt, du hast ihn von den stumpfsinnigen Vorurteilen der Kindheit befreit. Oh, wie glücklich ist Juliette, dass du dir mit ihr dieselbe Mühe geben willst.«
»Ja«, erwiderte Mme. Délben, »ich will mich mit ihrer Erziehung befassen. Ich will in ihr, wie bei dir, die niederträchtigen, religiösen Torheiten vernichten, die das ganze Lebensglück eines Menschen stören können. Jetzt aber wollen wir essen gehen, meine Freundinnen, wir müssen das einbringen, was wir verloren haben.«
Ein wundervolles Mahl, das wir nackt einnahmen, gab uns die nötigen Kräfte, von neuem anzufangen. Wieder kitzelten wir uns und stürzten uns in tausenderlei Verirrungen der Wollust.
Auf diese Weise verging ein Monat, nach Verlauf dessen Euphrosine das Kloster und ihre Familie verließ, um sich in die Arme der Wollust zu werfen. Sie besuchte uns nachher noch einige Male, und wir waren genug verderbt, ihr keinen Vorwurf über ihren Lebenswandel zu machen. »Sie hat es gut gemacht«, sprach Mme. Délben zu mir, »ich habe schon tausendmal dieselbe Laufbahn ergreifen wollen, und ich hätte es auch getan, wenn die Männer in mir dieselbe Leidenschaft erwecken würden wie die Frauen; trotzdem jedoch begreife ich es, dass man Männer liebt, wie ich überhaupt alles verstehen kann, das mit der Wollust im Zusammenhang steht.«
»Die obersten Grundsätze meiner Philosophie«, fuhr Mme. Délben fort, die sich, seit sie Euphrosine verloren hatte, mir enger anschloss, »bestehen darin, der öffentlichen Meinung zu trotzen. Du kannst dir nicht vorstellen, meine Teure, wie sehr ich mich über alles lustig mache, was man von mir sprechen kann.«
»Wie!«, rief ich aus. »Ihr Ruf ist Ihnen gleichgültig?«
»Durchaus, meine Teure. Ich gestehe sogar, dass ich weder Genuss davon habe, einen schlechten Ruf zu besitzen, wie wenn er gut wäre. Oh, Juliette, merke dir, der Ruf ist ein Gut, das gar keinen Wert besitzt, er entschädigt uns niemals für die Opfer, die wir ihm bringen. Ober alles dies werden wir noch plaudern.
Ich habe dir schon gezeigt, meine Freundin, dass ich mich mit dir abgeben will. Deine Unschuld und deine Reinheit beweisen mir, dass du eines Führers auf dem Dornenpfad des Lebens bedarfst.«
In der Tat gab es nichts zweifelhaftes wie der Ruf der Mme. Délben. Eine Nonne, der ich empfohlen worden war, teilte mir mit, dass sie ein gefallenes Weib sei und dass sie fast alle Pensionärinnen des Klosters bereits verdorben hatte. Sie sei eine Frau ohne Ehre, ohne Gesetz, ohne Religion, sagte man, die ihre Grundsätze schamlos vor aller Welt zeigte und die schon lange abgesetzt worden wäre, wenn sie nicht soviel Einfluss besessen hätte. Ich lachte über diese Ermahnungen. Ein einziger Kuss der Délben, ein einziger ihrer Ratschläge besaß mehr Macht über mich als alle diese Warnungen. Hätte sie mich in den Abgrund mitziehen wollen, so wäre es mir lieber gewesen, mit ihr zugrunde zu gehen, als mit jemand anderem in die Hölle zu kommen.
Aber unsere liebenswürdige Oberin zeigte mir bald, dass nicht ich allein sie beschäftigte, sondern dass auch andere sich in ihren Vergnügungen teilten. »Komme morgen Nachmittags zu mir«, sprach sie eines Tages, »Elisabeth Flavia, Mme. de Volmar und Seinte Elmé werden auch anwesend sein.«
»Wie«, rief ich aus, »du vergnügst dich mit allen diesen Frauen?«
»Aber, wie, du glaubst, dass ich mich damit begnüge? In diesem Haus sind dreißig Nonnen, und zweiundzwanzig davon sind durch meine Hände gegangen. Wir haben achtzehn Novizinnen, und eine einzige ist mir noch unbekannt. Ihr seid sechzig Pensionärinnen, und nur drei haben sich mir widersetzt. Oh, Juliette, meine Wollust ist eine Epidemie, sie verdirbt alles, was mich umgibt, die Gesellschaft kann glücklich sein, dass ich mich bei dieser milden Form, Böses zu tun, begnüge.«
»Ah, was würdest du sonst tun?«
»Was weiß ich. Die Gedanken eines so verderbten Geistes, wie der meinige ist, sind wie die ungestümen Wogen eines Flusses, der seine Ufer überschwemmt.
Oh, Juliette, lebe so wie ich glücklich im Verbrechen, denn ich begehe viele, meine Teure, gewöhne dich daran, und du wirst nicht mehr leben können, ohne welche zu begehen; dann werden alle menschlichen Gesetze und Übereinkünfte dir lächerlich erscheinen, du wirst aus allen menschlichen Tugenden Laster machen, und alle Laster werden dir zur Tugend werden, dann wird ein neues Weltall vor dir entstehen, ein verzehrendes, wonnevolles Feuer wird durch deine Adern strömen und wird jenes elektrische Fluidum entzünden, auf dem das Leben beruht. Alle Wesen, die dich umgeben, erscheinen dir dann nur mehr als vom Geschick zugesandte Opfer deines perversen Herzens. Es wird keine Fesseln, keine Ketten mehr für dich geben, alles wird rasch in der Glut deiner Begierden verschwinden. Du wirst von Ausschweifung zu Ausschweifung schreiten, niemals aber darfst du dich der Verlockung widersetzen, dann würden dir alle erblühten Freuden wieder verlorengehen. Du wirst nichts kennen, wenn du nicht alles kennengelernt hast, und wenn du einmal so furchtsam sein solltest, einzuhalten, wird dir alles Glück auf Nimmerwiedersehen entschlüpfen.«
Nun fragte mich Mme. Délben, wie weit ich in religiösen Dingen hielte. »Ich habe meine erste Kommunion noch vor mir«, war meine Antwort.
»Ah, desto besser«, fuhr sie fort, indem sie mich umarmte, »ich will dir diese Narrenposse ersparen, mein Engel. Wenn man dir von der Beichte spricht, so sage, dass du noch nicht vorbereitet bist. Die Vorsteherin bei den Novizen ist meine Freundin, sie ist von mir abhängig, und ich will dich ihr empfehlen. Was die Messe anbelangt, so wirst du leider ebenso wie ich dazu erscheinen müssen. Aber sieh mal hier diese kleine Büchersammlung«, sprach sie, indem sie auf ungefähr dreißig in Maroquinleder gebundene Bücher wies, »ich will dir diese Werke leihen, und du brauchst sie bloß während des Gottesdienstes zu lesen, um nichts davon hören zu müssen.«
»Oh, meine Freundin«, rief ich aus, »wie bin ich dir zu Dank verpflichtet. Mein Herz und mein Verstand gehen willig auf deine Ratschläge ein. Was du mir über die Moral gesagt hast, ist mir nicht so neu, als dass es mir nicht schon durch den Sinn gegangen wäre, aber ich habe von dir nicht erwartet, dass du die Religion so verabscheuen würdest. Ich habe ihre Gesetze nur mit dem äußersten Widerwillen befolgt, und du bereitest mir unendliches Vergnügen, wenn du mir versprichst, mich auch hierüber aufzuklären.«
Nun hörte man die Gesellschaft ankommen, und das hinderte die Délben, meine brennende Neugierde zu befriedigen. »Ruhe, Ruhe«, sagte sie zu mir, »denken wir jetzt ans Vergnügen. Küsse mich, Juliette, ich verspreche, dir eines Tages alles mitzuteilen.«
Wir müssen nun unsere eintretenden Freundinnen beschreiben. Frau von Volmar hatte den Schleier vor ungefähr sechs Monaten genommen. Sie war kaum zwanzig Jahre alt, groß, schmal, kastanienbraun und besaß neben einem leuchtenden Teint eine wundervolle Gestalt. Sie war eine der Lieblinge von Madame Délben, und nach ihr die sinnlichste aller Teilnehmer an dieser Orgie.
Seinte Elmé war eine siebzehnjährige Novizin, von reizendem Aussehen, die außer wundervollen Augen von sehr sinnlicher Glut einen herrlichen Busen besaß. Zwei Pensionärinnen, Elisabeth und Flavia, waren dreizehn beziehungsweise sechzehn Jahre alt.
Die ersten Begrüßungen dauerten nicht lange, da jeder die Ursache der Zusammenkunft kannte und bald zur Tagesordnung übergehen wollte. Allein ich muss gestehen, dass mich ihre Redensarten in Erstaunen setzten. Selbst in einem Bordell konnte man dergleichen nicht so leicht hören, und ihre Zurückhaltung der Welt gegenüber stand in seltsamem Gegensatz zu der kräftigen Schamlosigkeit, die sie bei diesen Zusammenkünften zeigten.
»Ich glaube nicht, dass ich heute eine Nummer zustande bringen werde«, sagte Frau von Volmar im Eintreten zur Délben, »ich bin erschöpft, meine Teure, denn ich habe die Nacht mit Fontenille verbracht. Ich bete diese kleine Schelmin an, und man hat mich auch in meinem Leben nie besser gekitzelt. Ich habe niemals noch so viele Nummern gemacht. Oh, meine Gute, wir haben Dinge aufgeführt!«
»Unglaublich, nicht wahr?«, sagte die Délben. »Nun denn, ich will, dass wir heute Abend noch viel, viel Außergewöhnlichere anstellen.«
»Teufel, dann beeilen wir uns aber«, sagte Seinte Elmé, »ich bin geil, denn ich habe allein geschlafen.«
»Einen Augenblick«, sagte die Oberin, »wir haben noch eine Aufnahmezeremonie zu vollziehen. Ich nehme Juliette in unsere Gesellschaft auf, und ich muss dabei die herkömmlichen Formalitäten anwenden.«
»Wen … Juliette?«, fragte erstaunt Flavia, die mich noch nicht gesehen hatte. »Ich kenne dieses hübsche Mädchen noch gar nicht. Du wichst also, Herzchen«, fuhr sie fort, indem sie mich auf den Mund küsste. »Du bist also geil wie wir und ein Freudenmädchen wie wir.« Und die Schelmin fasste gleichzeitig nach meiner Scham und meinem Busen. »Lass sie doch«, sagte die Volmar, die meine Röcke hinten emporgehoben hatte und nun meinen Popo prüfte, »sie muss zuerst aufgenommen sein, bevor wir uns an ihr befriedigen.«
»Délben, sieh doch die Volmar an«, sagte Elisabeth. »Sie küsst Juliette auf den Popo; wahrscheinlich hält sie sie für einen kleinen Knaben und will ihn nun von hinten lieben.«
»Weißt du nicht«, sagte Seinte Elmé, »dass die Volmar ein Mann ist. Sie hat eine Klitoris, die drei Zoll lang ist.« Dann trat auch sie zu mir heran und prüfte mich von allen Seiten. »Tatsächlich ist die kleine Schelmin gut gebaut«, fuhr sie fort, »und ich schwöre, dass ich noch vor Abend den Geschmack ihres Samens kennengelernt haben werde.«
»Einen Augenblick nur, meine Damen«, sagte die Délben, indem sie die Ordnung wieder herzustellen versuchte. — »Aber hol dich der Teufel, beeile dich!«, sagte Seinte Elmé, »ich bin geil! Worauf wartest du denn? Herunter mit den Kleidern, Freundinnen!« Und sofort konnte man sechs herrliche Mädchen sich bewundern sehen.
»Jetzt aber können Sie mir ein wenig Gehorsam nicht verweigern«, sagte die Delbén gebieterisch. »Hören Sie zu: Juliette wird sich auf dieses Bett legen, und Sie werden eine nach der anderen mit ihr anfangen, was Ihnen gefällt. Beim Weggehen werde ich eine jede empfangen und Sie sollen dann an mir vollenden, was Sie an Juliette begonnen haben. Aber ich werde mich nicht beeilen und werde erst entladen, wenn ich euch alle auf mir gehabt haben werde.«
Die Befehle der Oberin wurden genau ausgeführt. Alle waren sehr geil, und ich glaube, dass Sie nicht ungehalten sein werden, wenn ich Ihnen erzähle, was jede von mir haben wollte. Da das Alter maßgebend war, kam Elisabeth als erste daran. Die hübsche Kleine prüfte mich überall, und nachdem sie mich mit Küssen bedeckt hatte, glitt sie zwischen meine Schenkel und rieb sich an mir, bis wir beide erschöpft waren. Auf sie folgte Flavia, die sorgsamer vorging. Nach tausend entzückenden Plänkeleien legten wir uns in entgegengesetzter Richtung zueinander, und unter unseren Zungen sprangen bald Gießbäche von Scheidenwasser hervor. Nun nahte Seinte Elmé. Sie legte sich aufs Bett und ließ mich auf ihr Gesicht sitzen, derart, dass ihre Nase in mein hinteres Loch und ihre Zunge in mein vorderes eindrang. Ich war dabei über sie gebeugt und leckte sie gleichfalls. Meine Finger kitzelten ihren Hintern und bald überzeugten mich fünf Ergüsse, dass ihr Bedürfnis wirklich nicht geheuchelt war.
Die Volmar wollte nur meinen Popo haben. Sie bedeckte ihn mit Küssen, und nachdem sie den engen Weg mit ihrer rosigen Zunge hergerichtet hatte, wälzte sie sich auf mich, steckte ihre Klitoris in meinen Hintern und stieß langsam zu. Dabei küsste sie mich feurig auf den Mund, züngelte dann ein wenig mit mir und kitzelte mich vorne. Das Lumpenweib ging aber noch weiter. Sie band mir ein Godemiché um und hieß auch mich in ihren Hintern hineinfahren. Ich stieß so zu, dass sie vor Lust fast starb.
Nach dieser letzten Arbeit nahm ich meinen Platz auf dem Körper der Délben ein.
Freuden der Tafel folgten auf die der Liebe. Ein herrliches Mahl erwartete uns, aber nachdem wir verschiedene Weine und andere Getränke hinuntergegossen hatten, begannen wir wieder unsere wohllüstigen Spiele. Es bildeten sich drei Gruppen. Seinte Elmé, die Delbén und die Volmar durften sich als älteste jede eine von uns anderen aussuchen. Durch Zufall oder Fügung fiel ich der Délben zu. Elisabeth war von Seinte Elmé und Flavia von der Volmar gewählt worden. Jede Gruppe war so aufgestellt, dass sie die zwei anderen sehen konnte, und man kann sich nicht vorstellen, was wir aufführten! Wir kitzelten uns bis zur Bewusstlosigkeit.
Etwas war mir aufgefallen, und das war die seltsame Vorsicht, die man für die Jungfernhaut der Pensionärinnen bezeigte. Mit denen, die auch später im Kloster verbleiben sollten, ging man nicht so zart um. »Ihre Ehre hängt daran«, sagte nun die Délben, die ich darüber befragte, »wir wollen uns gern mit diesen jungen Mädchen unterhalten, aber warum ihnen Schaden zufügen? Nein, so verdorben wir auch sind, wir sind doch so tugendhaft, unsere Freundinnen vor Unheil zu bewahren.« Diese Rücksicht dünkte mich sehr zartfühlend. Aber verbrecherisch, wie ich schon damals war, hatte ich von nun ab nur den einen brennenden Wunsch, eine meiner Genossinnen zu entjungfern, wie ich schon vorher den Gedanken gehabt hatte, selbst vergewaltigt zu werden.
Die Délben bemerkte bald, dass ich ihr Seinte Elmé vorzog. Ich betete dieses entzückende Mädchen tatsächlich an, und ich war außer Stande, ohne sie zu leben. Es war aber nur eine natürliche Neigung, die mich wieder zur Delbén zurückzog, denn unsere Oberin war ungemein geistvoller als sie.
»Da ich sehe, dass du leidenschaftlich wünschst, zu entjungfern oder selbst entjungfert zu werden«, sagte mir eines Tages diese reizende Frau, »würde es mich nicht wundern, wenn Seinte Elmé dir dieses Vergnügen schon versprochen hätte. Sie läuft entschieden keinerlei Gefahr, denn sie muss, gleich mir, ihr Leben in diesem Kloster verbringen. Aber, Juliette, wenn sie sich auch an dir vergehen würde, könntest du dich niemals verheiraten, und wer weiß, wie viel Unglück noch aus diesem Fehltritt entstehen würde. Jedoch du weißt, mein Engel, wie sehr ich dich liebe. Schwöre mir, mit Seinte-Elmé nicht weiter zu verkehren, und ich will alle deine Wünsche befriedigen. Du kannst im Kloster dasjenige Mädchen aussuchen, deren Erstlinge du haben willst, und ich selbst will dir die deinigen nehmen. Um aber in diese Geheimnisse eingeführt zu werden, musst du mir nochmals dein heiliges Wort geben, mit Seinte Elmé nicht mehr zu sprechen, oder meine Rache kennt keine Grenzen.« Da ich auf die versprochenen Genüsse brannte, versprach ich alles.
»Nun gut«, sagte die Délben nach einem Probemonat, »hast du gewählt? Wen willst du entjungfern?«
Sie werden sicherlich nicht erraten, meine Freunde, auf wen meine wollüstigen Augen gefallen waren? Auf dieses Mädchen, das Sie hier vor sich sehen, auf meine Schwester. Aber Madame Délben kannte sie nur zu gut und riet mir ab.
»Nun gut«, sagte ich, »so gib mir Laurette. Ihre Kindlichkeit, ihr hübsches, kluges Gesicht, ihre vornehme Abstammung reizt mich ungemein.« Die Oberin sah kein Hindernis, da die junge Waise nur einen entfernt wohnenden Onkel als Vormund besaß, und ich opferte ihre Unschuld schon in Gedanken hin.
Am Vorabend des zur feierlichen Handlung bestimmten Tages lud mich die Délben ein, bei ihr zu schlafen.
Die Délben küsste mich wieder und wieder. Ihre Liebkosungen wurden dabei immer feuriger.
»Nun also, da du entjungfert werden willst«, sprach sie zu mir, »will ich dich sofort zufriedenstellen.« In trunkener Wollust bewaffnete sich die Schelmin mit einem Godemiché. Erst kitzelte sie mich, um, wie sie sagte, die Schmerzen einzuschläfern, dann aber fuhr sie so kräftig darauf los, dass meine Jungfernschaft beim zweiten Stoße weg war. Man kann sich nicht vorstellen, was ich litt; aber bald folgten auf die brennenden Schmerzen der Trennung die sanften Freuden des Genusses.
Die Délben, die nichts erschöpfen konnte, war noch lange nicht müde. Sie ritt kräftig weiter, während sie mit mir züngelte, bis ich endlich nach einer Stunde um Gnade bat. »Tu du jetzt an mir dasselbe, was ich an dir gemacht habe«, sagte sie. »Ich bin toll vor Wollust, denn ich wurde während der Arbeit nicht befriedigt. Auch ich möchte jetzt fertig werden.«
Ich wurde nun aus der verzärteltsten Geliebten der leidenschaftlichste Liebhaber. Ich nahm sie vor, und ich glaube, es gab kein Weib, das liebestoller und im Genuss verzückter war als sie. Zehnmal nacheinander wurde sie in meinen Armen fertig, und ich glaubte schon, sie würde mir überhaupt zerfließen.
»O meine Teure«, fragte ich, »ich glaube, je mehr Geist man besitzt, desto mehr genießt man die Freuden der Wollust.«
»Sicherlich«, erwiderte die Délben, »und der Grund hierfür ist sehr einfach. Die Wollust verträgt keine Fesseln und sie ist nie süßer, wie wenn sie alle zerrissen hat. Nun, je mehr Geist einer hat, desto mehr Fesseln wird er lösen und desto größeren Genuss wird er haben.«
»Ich glaube auch, dass die Verfeinerung der Organe viel dazu beiträgt«, erwiderte ich. — »Daran kann man nicht ernsthaft zweifeln«, war die Antwort, »je glatter der Spiegel ist, desto besser wirft er das Bild der Gegenstände zurück, die sich in ihm beschauen.«
Nachdem wir nun beide erschöpft waren, erinnerte ich meine Erzieherin an ihr Versprechen bezüglich der Entjungferung Laurettes.
»Ich habe das nicht vergessen«, erwiderte Madame Delbén, »und sobald ihr heute Abend in die Schlafgemächer geht, musst du zu entschlüpfen trachten. Die Volmar und Flavia kommen auch; wegen des übrigen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Du bist jetzt in unsere Geheimnisse eingeweiht, sei mutig, Juliette, und ich werde dir erstaunliche Dinge vorführen.«
Ich verließ nun meine Freundin, um in unser Haus zurückzukehren. Wie groß aber war mein Erstaunen, als ich erzählen hörte, dass eine Pensionärin sich aus dem Kloster geflüchtet habe. Ich fragte rasch nach ihrem Namen: Es war Laurette. »Laurette«, rief ich aus, und setzte dann zur Seite hinzu: »Oh, mein Gott, und gerade auf sie habe ich gerechnet, gerade sie entflammte meine Wünsche.« Ich fragte nach Einzelheiten, aber niemand konnte mir Auskunft geben, ich eilte zur Délben, um sie zu benachrichtigen, allein ich fand ihre Türe verschlossen und ich konnte sie vor der vereinbarten Stunde unmöglich auffinden. Ah! Wie mir die Zeit langsam verging!
Endlich schlug die Stunde. Die Volmar und Flavia waren vorangegangen, und ich traf sie schon bei der Délben an.
»Nun, wie wirst du dein Wort halten«, fragte ich die Oberin, »Laurette ist nicht mehr hier. Wer soll sie ersetzen?« Und dann fügte ich ein wenig ärgerlich hinzu. »Ah, ich sehe wohl, dass ich niemals den Genuss haben werde, den Sie mir versprochen haben.«
»Juliette«, antwortete mir Madame Délben mit sehr ernster Miene, »das oberste Gesetz der Freundschaft ist das Vertrauen. Wenn du eine der unseren sein willst, musst du dir mehr Vorsicht und weniger Argwohn angewöhnen. Ist es denn wahrscheinlich, dass ich dir ein Vergnügen verspreche, um es dann nicht zu halten, und mutest du mir nicht mehr Geschicklichkeit und Macht zu, als ich benötige, um deinen Wünschen nachzukommen? Folge uns, alles ist still. Habe ich dir übrigens nicht gesagt, dass du seltsame Dinge sehen wirst?«
Die Délben zündete eine kleine Laterne an und ging voraus. Die Volmar, Flavia und ich folgten ihr zur Kirche nach. Wie groß war mein Erstaunen, als sie dort eine Gruft öffnete und in das Heim des Todes hinabstieg! Meine Genossinnen folgten stillschweigend nach, allein mir war es nicht möglich, ein wenig Furcht zu verbergen. Jedoch die Volmar beruhigte mich, und bald befanden wir uns in unterirdischen, als Grabstätte für die toten Klosterfrauen bestimmten Räumen. Wir schritten fort, ein Stein hob sich, und über fünfzehn bis sechzehn Stufen gelangten wir in eine Art künstlerisch geschmückten Saal, dessen Luftöffnungen nach den Gärten hinausgingen.
Oh, meine Freunde! Wen sollte ich hier treffen! Laurette, geschmückt wie die Jungfrau, die man ehemals im Bacchustempel opferte, dann den Abbé Ducroz, den Großvikar des Bischofs von Paris, einen dreißigjährigen Mann, der speziell mit der Aufsicht über Panthemont betraut war, und schließlich Pater Télème, den schönen Beichtvater unserer Novizinnen und Pensionärinnen.
»Sie hat Angst«, sagte die Délben, indem sie zu den zwei Männern hintrat und mich ihnen vorführte. »Erfahre denn, du Unschuld«, fuhr sie fort, indem sie mich küsste, »dass wir hier nur um zu lieben und um Greueltaten zu begehen, zusammenkommen. Wenn wir in die Region des Todes hinabsteigen, geschieht es nur, um von den Lebenden so weit als möglich entfernt zu sein. Wenn man so verderbte Neigungen hat wie wir, möchte man sich am liebsten ins Innere der Erde verkriechen, um besser die Menschen und ihre unsinnigen Gesetze fliehen zu können.«
Ich muss gestehen, dass — soweit ich auch schon vorgeschritten war — mich dieses Debüt stutzig machte.
»Himmel«, sagte ich erregt, »was werden wir denn in diesen Gewölben begehen?«
»Verbrechen«, antwortete mir Madame Délben, »wir werden dich lehren, wie du es machen musst. Aber verspürst du vielleicht Schwäche und habe ich mich in dir geirrt?«
»Fürchte nichts«, erwiderte ich lebhaft, »ich verspreche dir, über nichts zu erschrecken.«
Nun befahl die Délben der Volmar, mich zu entkleiden.
Als ich nackt dastand, bemerkte der Großvikar: »Sie hat den schönsten Popo der Welt.« Und alsbald bedeckten Küsse und Liebkosungen meine Backen. Dann griff der Gottesmann nach meiner Muschel, während er das Glied in meinen Hintern einzuführen trachtete. Er drang mühelos hinein, und im selben Augenblick bewarb sich Télème um meine Scheide. Beide entluden, und ich muss gestehen, dass ihnen bald voller Genuss nachfolgte.
»Juliette«, sagte jetzt meine Oberin, »wir haben Ihnen eben die beiden größten Genüsse verschafft, die eine Frau erleben kann. Sagen Sie uns jetzt offen, welcher der größere war.«
»Wahrhaftig, Madame«, erwiderte ich, »beide haben mich so ergötzt, dass ich unmöglich entscheiden kann. Und noch jetzt empfinde ich in der Erinnerung eine solche Erregung, dass ich unfähig bin, klar zu sehen.« »Wir müssen sie nochmals vornehmen«, sagte Télème, »nur werden der Abbé und ich jetzt die Plätze wechseln, und wir bitten die schöne Juliette, sich genau Rechenschaft über ihre Empfindungen abzulegen.«
»Gerne«, erwiderte ich, »ich glaube wie Sie, dass ich nur bei einer Wiederholung werde entscheiden können.«
Neue Trankopfer für die cyprische Göttin beschlossen diese zweite Probe, und man befragte mich jetzt.
»Oh, meine Freundin«, sprach ich zur Délben, »wenn ich die Wahrheit sagen soll, so muss ich gestehen, dass das Glied, das in meinen Hintern eindrang, mir viel lebhaftere Genüsse bereitet, wie das, das meinen Vorderteil durchbohrte. Ich bin jung, unschuldig, furchtsam und wenig für die eben genossenen Freuden geschaffen; es wäre also möglich, dass ich mich über die Art und Weise dieser Genüsse täusche. Da Sie mich aber nach dem gefragt haben, was ich empfand, so sage ich das offen heraus.«
»Küsse mich, mein Engel«, sprach Madame Délben zu mir, »du bist unserer würdig. Ah, zweifellos gibt es kein Vergnügen, das sich mit dem im Popo vergleichen ließe. Die armen einfältigen Mädchen, die sich diesen Genuss nicht zu vergönnen wagen! Niemals wird sie die Göttin von Paphos mit ihrer Gunst beschenken! Ah, man liebe mich von hinten!«, rief sie aus und kniete sich auf ein Sofa.
Ihr Wunsch wurde ausgeführt. Nach der Reihe kamen ihre beiden Liebhaber dran. Nun schritten wir an die Entjungferung Laurettes.
Da ich bestimmt war, die Rolle des Hohepriesters zu spielen, bekleidete man mich mit dem größten künstlichen Glied, das zu finden war.
Laurette wurde auf einen Schemel gebunden, und zwar derart, dass ihre beiden weit auseinandergespreizten Beine einerseits und ihre Arme andererseits mit Ringen an der Erde befestigt waren. In dieser Stellung bot das Opfer am besten den schmalen, zarten Körperteil dar, den die Lanze durchbohren sollte. Télème musste ihren Kopf stützen und sie zur Geduld ermahnen. Dieser Gedanke – sie in die Hände ihres Beichtvaters zu bringen, wie wenn sie auf der Folter läge — ergötzte die grausame Délben außerordentlich. Ducroz sollte mich von hinten besteigen.
Bevor ich an die Arbeit kam, wollte Ducroz vorerst meine Einfahrt erleichtern. Er befeuchtete die Scheidenwände Laurettes und mein Godemiché mit einer schlüpfrigen Flüssigkeit, die ein leichtes Eindringen begünstigt. Trotzdem wurde Laurette fürchterlich zerrissen. Allein man ermunterte mich von allen Seiten, und ich selbst war derart aufgeregt, dass ich mich wie der glühendste Liebhaber benahm. Die Maschine drang ein, aber die Blutbäche, die unter ihr hervorsprangen und die grässlichen Schreie des Opfers kündeten uns an, dass die Operation nicht gefahrlos verlaufen sei. Tatsächlich war die arme Kleine so verwundet, dass wir für ihr Leben fürchteten. Ducroz, der es bemerkte, gab es auch der Délben durch ein Zeichen zu verstehen, sodass diese näher trat. »Die Hure ist unser Eigentum«, rief sie aus, »schonen wir sie nicht. Ich habe niemandem über sie Rechenschaft abzulegen.«
Sie werden begreifen, wie mich derartige Redensarten ermutigten. Wohl bewusst, dass nur meine Ungeschicklichkeit an dem Unglück Schuld war, verdoppelte ich trotzdem meine Anstrengungen. Endlich stak alles drin, Laurette wurde ohnmächtig. Ducroz liebte mich von hinten, während der entzückte Télème den Kopf der Sterbenden zwischen seine Beine presste und sich an ihrem hübschen Gesicht kitzelte. »Wir müssen Hilfe holen«, sagte er zur Délben. »Ach wo, nur Samen nützt uns jetzt«, erwiderte die Äbtissin, »Samen ist die einzige Hilfe, die ihr zukommen soll.« Wir fuhren alle in unserer Tätigkeit fort und gerieten fast alle gleichzeitig in Verzückung. Die drei Freudenmädchen auf dem Altar entluden, während ich mit meinem Samen das Godemiché befeuchtete und Ducroz meinen Popo überschwemmte.
Unsere Erschöpfung und die Notwendigkeit, Laurette ins Leben zurückzurufen, wollten wir uns noch weiter an ihr ergötzen, zwangen uns, jetzt innezuhalten. Man band sie los, und sie wurde gedrückt, gequetscht und geohrfeigt, bis sie wieder zu sich kam. »Was hast du denn?«, fragte die Délben in rohem Ton. »Bist du denn so schwach, dass ein leichter Angriff dich schon in die Hölle jagt?«
»Ach, Madame, ich kann nicht mehr«, sagte die arme unglückliche Kleine, deren Blut in Strömen floss, »man hat mir einen empfindlichen Schmerz zugefügt; ich werde daran sterben.«
»Gut«, sagte kaltblütig die Oberin, »jüngere Mädchen wie du haben derartige Angriffe gefahrlos überstanden, so setzen wir unsere Tätigkeit fort.« Und ohne weitere Anteilnahme wurde das Opfer nunmehr ebenso wie früher, jetzt auf dem Bauch liegend, angebunden und nachdem sich die Délben mit ihrem Gefolge wieder hingelegt hatte, schickte ich mich an, die Festung von der anderen Seite zu nehmen. Diesmal musste mich Télème hinten bearbeiten, und Ducroz war damit beauftragt, mir die Klitoris zu kitzeln. Allein die Schwierigkeiten waren unüberwindlich. Entweder war mein Instrument in Unordnung geraten oder ich stieß nicht richtig zu, kurz, ich geriet wieder in die Scheide, was meinem Opfer von neuem einen Schmerzensschrei entlockte. Nun wurde die Délben unruhig und beauftragte Ducroz, mir mit seinem eigenen Glied den Weg zu bahnen, und wie Sie sich denken können, missfiel ihm dieser Auftrag durchaus nicht. Da der Schuft kein Verschieben und Verrücken zu befürchten hatte, war er im Verlaufe eines Augenblickes im Innersten des jungfräulichen Heiligtums. Er zerstörte roh den Hauch der Unberührtheit und war eben im Begriff zu entladen, als ihm die Oberin befahl, zurückzuziehen. »Teufel noch einmal!«, sagte er, indem er schäumend vor Wollust sein die deutlichen Spuren des Sieges zeigendes Glied herauszog. »Ah, ich folge, aber ich werde mich im Popo Juliettes schadlos halten.«
»Nein«, antwortete die Délben, die um unser Vergnügen ebenso besorgt war wie um ihr eigenes, »der Popo meiner Juliette ist jetzt Télèmes Eigentum, und ich dulde nicht, dass man ihn in seinem Rechte schmälert. Aber da du einen solchen Ständer hast, du Verbrecher, so stecke ihn der Volmar von hinten hinein. Wenigstens wird sie mich dann besser kitzeln.«
»Ja, ja«, sagte die Volmar, »hier ist mein Hinterer, steck ihn mir hinein, du Schuft, noch niemals habe ich solche Sehnsucht gehabt, von hinten gefickt zu werden, wie gerade jetzt.« Alles geschah nach Wunsch und innerhalb einer Minute fühlte die arme Kleine mein Instrument im Grunde ihres Hintern. Ihr Schreien wuchs nachgerade ins Grässliche, aber Télème und die Délben ermunterten mich so lebhaft, dass Laurettes Hintern bald das erlebte, was eben ihrer Scheide zugestoßen war.
Danach traten wir in einen kleinen benachbarten Kellerraum, wo die vorzüglichsten Gerichte und erlesensten Weine bereits auf uns warteten. Wir setzten uns zu Tisch. Laurette bediente uns, und ich konnte bald an dem Ton, in dem die Gesellschaft mit ihr sprach, sowie an der Behandlung, die sie erlitt, bemerken, dass die arme Kleine schon nur mehr als Opfer angesehen wurde. Je mehr die Geister sich erhitzten, desto ärger wurde sie misshandelt. Sie machte keinen Gang, ohne dass sie einen Schlag oder eine Ohrfeige erhalten hätte, und für die leichteste Unachtsamkeit wurde sie von uns furchtbar bestraft. Ich übergehe die Vorgänge beim Mahle mit Stillschweigen, Freunde; nur soviel will ich sagen, dass sie an alles heranreichten, was ich seither an derartigen Dingen gesehen habe.
Wir waren noch beim Essen, als ein von der Mutter geschickter Lakai eintrat, der der Oberin von dem schrecklichen Unglück unseres Hauses und der Krankheit meines Vaters Mitteilung zu machen hatte. Man verlangte nach meiner Schwester und mir, und wir mussten auf der Stelle aufbrechen. »Himmel«, sagte Madame Délben, »ich habe vergessen, deine Jungfernschaft wieder herzustellen; warte, mein Engel, hier nimm dieses Gefäß; in ihm ist eine Myrthenessenz, mit welcher du dich während neun Tagen morgens und abends einreiben musst. Du kannst beruhigt sein, dass du am zehnten Tag ebenso Jungfer sein wirst, wie wenn dir nie etwas geschehen wäre.« Dann übergab sie uns dem Diener, indem sie uns ermahnte, sobald als möglich zurückzukehren, und wir reisten ab.
Mein Vater starb. Sie wissen, welche Unglücksfälle seinem Tode folgten: Meine Mutter schloss gleichfalls nach einem Monat die Augen, und wir standen verlassen da. Justine, die von meinem geheimen Verkehr mit der Oberin nichts wusste, erfuhr auch nichts von dem Besuch, den ich ihr einige Tage nachher abstattete und der zu sehr geeignet ist, den Charakter dieser einzigartigen Frau zu enthüllen, als dass ich ihn mit Schweigen übergehen könnte. Vor allem verweigerte mir die Délben den Eintritt, und ich musste das, was ich zu sagen hatte, durch das Gitter vorbringen. Als ich mein Erstaunen merken ließ und unsere Freundschaft geltend machte, erwiderte sie: »Mein Kind, dieses ganze Elend vergisst man, wenn man nicht mehr zusammen lebt, und was mich betrifft, so muss ich sagen, dass ich mich an keine einzige von den Geschichten erinnere, von denen Sie mir sprachen. Was die Not anlangt, von der Sie bedroht sind, so erinnern Sie sich an das Schicksal der Euphrosine. Sie warf sich ohne Zwang der Hurerei in die Arme, tuen Sie es, weil Sie vom Elend verfolgt werden. Das ist das einzige, was Sie tun können, und das einzige, wozu ich Ihnen rate.Aber besuchen Sie mich dann nicht mehr. Vielleicht sind Sie erfolglos, Sie benötigen dann Geld oder Empfehlungen und ich könnte Ihnen weder eines noch das andere geben.« — Bei diesen Worten brach die Délben die Unterredung ab und ließ mich in einem Erstaunen zurück, das vielleicht weniger lebhaft gewesen wäre, wenn ich einen philosophisch geschulten Geist besessen hätte. So aber hing ich den traurigsten Gedanken nach. Ich kehrte sofort um und fasste den festen Entschluss, den Ratschlag dieses bösartigen Geschöpfes zu befolgen, so gefährlich es auch werden konnte. Ich erinnerte mich zum Glück an den Namen und die Adresse der Frau, von der Euphrosine einstens gesprochen hatte, als ich, ach!, noch nicht gedacht hatte, diese Hilfe benötigen zu müssen. Ich eilte zu ihr. Die Duvergier empfing mich ungemein liebenswürdig. Das vorzügliche Mittel der Délben täuschte sowohl ihren Kennerblick, wie auch jeden anderen, ich trennte mich von meiner Schwester und trat in das Haus ein, um hier eine von der ihren ganz verschiedene Laufbahn einzuschlagen.
Da meine Existenz nunmehr vollständig von meiner neuen Wirtin abhing, tat ich alles, was sie mir empfahl. Allein kaum befand ich mich allein, als ich von neuem über die Undankbarkeit der Délben nachzudenken begann. Ach, sprach ich zu mir, warum stößt sie mich in meinem Unglück zurück? Ist die reiche Juliette etwas anderes als die arme Juliette? Wie kommt es denn, dass man den Überfluss liebt und das Elend flieht? Ich begriff noch nicht, dass das Unglück dem Reichtum eine Last ist, ich wusste noch nicht, dass es ihn erschreckt und dass aus dieser Furcht die Antipathie entspringt. Aber, fuhr ich in meinen Gedanken fort, befürchtet denn diese ausschweifende, ja verbrecherische Frau nicht, dass ich sie verraten könnte? Wieder eine Kinderei von mir. Ich kannte noch nicht die Frechheit, die das Laster besitzt, wenn es durch den Reichtum und den Einfluss gestützt wird. Madame Délben war die Vorsteherin eines berühmten Pariser Frauenklosters, sie bezog eine jährliche Rente von 60 000 Francs und hatte zum ganzen Hof und den vornehmsten Kreisen der Stadt Verbindungen. Wie sehr musste sie ein armes Mädchen, wie ich war, verachten!
Allein ich war schon derart verdorben, dass dieses Beispiel einer offenbaren Ungerechtigkeit mir eher gefiel als es mich abstieß, obwohl ich doch darunter zu leiden hatte. Gut! sagte ich zu mir, ich muss also bloß danach trachten, ebenfalls reich zu werden, dann kann ich ebenso schamlos sein und dieselben Rechte und Freuden genießen, wie diese unverschämte Frau. Hüte dich, tugendhaft zu sein, denn das Laster triumphiert stets und das Elend verachtet man. Aber da ich nichts habe, wie soll ich der Armut entgehen? Zweifellos durch verbrecherische Handlungen. Was liegt daran? Die Ratschläge der Délben hatten bereits mein Herz und meinen Geist befruchtet und ich fuhr in Gedanken fort: Ich glaube nicht, dass es etwas ›Böses‹ gibt, ich bin überzeugt, dass das Verbrechen ebenso in den Absichten der Natur liegt wie die Keuschheit und die Tugend. Stürzen wir uns also in diese lasterhafte Welt, in der die größten Betrüger am weitesten vorwärts kommen. Da die Gesellschaft nur aus Schwindlern und deren Opfern besteht, so müssen wir selbstverständlich die Rolle der ersteren wählen. Die Eigenliebe kommt dabei besser weg.
Gestärkt durch diese Überlegungen wartete ich mit Ergebenheit die kommenden Ereignisse ab, wohl entschlossen, mein Schicksal um jeden Preis zu verbessern.
Meine Lehrjahre, die ich bei der Kupplerin Duvergier verbrachte, waren recht bitter und verdarben mich derart, dass ich Einzelheiten übergehen möchte, um nicht vor Ihren Augen ein Gemälde von ungeheuerlichen Ausschweifungen aufrollen zu müssen.
Madame Duvergier hatte nur sechs Frauen bei sich, aber mehr als dreihundert standen in ihren Diensten. Zwei fünf Fuß acht Zoll hohe Lakaien mit unmenschlichen Gliedern und zwei vierzehn- bis fünfzehnjährige Jockeys standen ebenfalls den Liebe-suchenden zur Verfügung, und genügten diese nicht, so hatte sie immer Ersatz in achtzig außer Hause lebenden Männern bereit. Das Haus der Duvergier lag entzückend inmitten eines Gartens, sodass die Zusammenkünfte vollkommen mit dem Schleier des Geheimnisses umgeben waren. Die Einrichtung war herrlich, und die Boudoirs ebenso wollüstig wie verschwenderisch ausgeschmückt. Sie besaß einen ausgezeichneten Koch und sehr gute Weine. So viele Annehmlichkeiten mussten natürlich teuer erkauft werden, und das einfachste Tête-à-tête kostete schon mindestens zehn Louis. Verderbt und gottlos, Kupplerin aller großen Herren, von der Polizei unterstützt, beging die Duvergier Dinge, die ihr niemand wieder nachmachte.
Während sechs Wochen verkaufte diese geschickte Gaunerin meine Jungfernschaft an mehr als fünfzig Personen, indem sie jeden Abend das, was die Ungeduld zerrissen hatte, mit einer Salbe wieder heilte. Da sich alle diese Jungfernräuber sehr plump benahmen, will ich Ihnen die Einzelheiten schenken.
Fünfzehn oder sechzehn Männer passierten in einem Monat mit mehr oder weniger seltsamen Zwischenfällen meinen Körper, als ich zu einem Mann geschickt wurde, der sich dabei so seltsam benahm, dass ich es erzählen muss. Wie wird es Sie überraschen, zu erfahren, dass dieser Mann Noirceuil war. In seinem unglaublichen Raffinement wollte dieser entzückende Mann, dass seine Frau Zeuge seiner Ausschweifung sei und ihm dabei diene. Beachten Sie wohl, dass man mich noch immer für jungfräulich hielt und dass Noirceuil nur mit an diesem Körperteil unberührten Mädchen zu tun haben wollte. Madame de Noirceuil war sehr hübsch und höchstens zwanzig Jahre alt. Sie war jung an ihren ungefähr vierzigjährigen und zügellos ausschweifenden Mann gebunden worden, und so können Sie sich wohl denken, was dieses arme Geschöpf alles hatte erdulden müssen. In dem Boudoir, in das ich eintrat, erwarteten mich beide. Kaum war ich da, als auf ein Klingelzeichen zwei fast nackte Knaben von sechzehn und achtzehn Jahren erschienen. »Man sagt, mein Herzchen, dass Sie den schönsten Popo der Welt haben«, sagte Noirceuil zu mir; »lassen Sie mich ihn doch sehen. Madame«, fuhr er, zu seiner Gemahlin gewandt, fort. — »Mein Herr, Sie fordern Dinge«, erwiderte diese arme Frau. – »Ganz einfache, Madame, sie beschäftigen sich damit schon so lange, dass Sie daran gewöhnt sein könnten. Vorwärts, Madame, entkleiden Sie doch dieses kleine Mädchen.« Ich errötete für diese arme Frau und wollte ihr die Mühe ersparen und mich selbst ausziehen, als Noirceuil mich daran hinderte und seine Gattin derart anfuhr, dass sie schließlich gehorchen musste. Während dieses Vorspiels ließ sich Noirceuil von seinen Lustknaben küssen und bearbeitete sie mit den Händen; der eine von ihnen kitzelte ihm den Popo, der andere das Glied. Sobald ich nackt war, führte mich Madame Noirceuil auf Befehl ihres Gatten zu ihm hin, und der Schuft küsste mir die Backen mit wollüstiger Geilheit. Bald befanden sich die beiden Lustknaben, dank den geschickten Händen seiner Gattin, in demselben Zustand wie ich. Noirceuil sowie seine Frau waren nun gleichfalls entkleidet, und der Schuft wählte vorerst niemanden aus, sondern erwies vorerst, unabhängig von dem Geschlecht, jedem Popo dieselbe Huldigung. Nachdem er schließlich genügend erregt war, befahl er seiner Gattin, mich bäuchlings auf das Kanapee zu legen, und nachdem er meinen Hintern zur Erleichterung genügend mit der Zunge befeuchtet hatte, musste sie sein Glied in meinen Popo einführen. Noirceuil hat, wie Sie wissen, ein Glied, das sieben Zoll im Umfang und elf in der Länge misst. Infolgedessen konnte ich ihn nur unter ungeheuren Schmerzen empfangen. Trotzdem jedoch drang er bis zu den Hoden hinein, während auf der anderen Seite einer der Freudenknaben in seinem Popo verschwand. Dann ließ der Wüstling seine Frau in derselben Haltung neben mich legen, und nun musste sie sich denselben Exzessen aussetzen, denen er sich auf meinem Körper hingab. Es war nämlich noch ein Glied frei geblieben, Noirceuil ergriff es, und während er mich bearbeitete, führte er es in den zarten Popo seiner teuren Ehehälfte ein. Einen Augenblick lang schien sie Widerstand leisten zu wollen, aber ihr grausamer Gatte hielt sie mit starkem Arm nieder. »Nun bin ich zufrieden«, sagte er, als alles im Gange war; »ich werde geliebt, ich bearbeite eine Jungfrau von rückwärts und meiner Frau geschieht das Gleiche. Nichts fehlt mehr an meinem vollständigen Ergötzen.«
»Oh, mein Herr!«, rief die ehrbare Gattin aus. »Sie wollen mich also zur Verzweiflung bringen!«
»Selbstverständlich, Madame, und ich muss Ihnen mit aller Offenheit, die Sie an mir kennen, gestehen, dass ich viel weniger Genuss hätte, wenn Sie sich wohler fühlen würden.«
»Sittenloser Mensch!«
»Ganz richtig, sittenlos, fahren Sie fort, fahren Sie fort, Madame, ich habe auch keine Grundsätze und bin schließlich ein scheußlicher Mensch! Schmähen Sie mich nur weiter, Sie ahnen nicht, wie Beschimpfungen eines Weibes auf mich wirken. Ah, Juliette, halten Sie sich, es fließt schon!«
»Ich behalte dich hier, Juliette, du wirst nicht mehr zur Duvergier zurückkehren.«
»Aber, mein Herr, Ihre Frau . ..«
»Sie wird dir untergeben sein. Du wirst in meinem Haus herrschen, und nur dir wird man gehorchen. Das Verbrechen besitzt eine solche Macht über mich, dass alles, was seinen Stempel trägt, mir teuer wird. Die Natur hat mich zur Liebe geschaffen. Komm, Juliette, ich bin erregt, zeige mir deinen hübschen Popo, damit ich mich in ihm vertiefe. Ich sterbe vor Vergnügen, wenn ich daran denke, dass das Opfer meiner Geilheit auch das meines Geizes ist.«
»Ja, Noirceuil, liebe mich; ich zittere bei dem Gedanken, die Geliebte des Henkers meiner Eltern zu werden.«
Ich blieb nun in seinem Hause. Noirceuil wollte mich nicht einmal zur Duvergier zurückkehren lassen, um mein Gepäck abzuholen. Am nächsten Tage stellte er mich seiner Dienerschaft und seinen Bekannten als Cousine vor, und ich wurde beauftragt, in seinem Hause die Honneurs zu machen. Es war mir jedoch unmöglich, einen Augenblick unbenützt vorbeistreichen zu lassen, der mir Gelegenheit gab, zu meiner ehemaligen Matrone zurückzukehren. Ich war weit davon entfernt, sie ganz aufzugeben. Aber um mehr Nutzen zu haben vermied ich den Anschein, als wolle ich mich ihr an den Hals schmeißen. »Komm, komm, teure Juliette«, sprach die Duvergier, als sie mich sah, »ich erwartete dich schon mit Ungeduld, ich habe dir tausenderlei Dinge zu sagen.«
Wir schlossen uns in ihr Zimmer ein, und nachdem sie mich umarmt und beglückwünscht hatte, sprach sie: »Höre mich an, Juliette, ich weiß nicht, wie du dir deine neue Stellung vorstellst, aber wenn du dir unglücklicherweise einbilden solltest, dass deine Stellung als ausgehaltenes Mädchen dich dazu verpflichtet, treu zu sein, und zwar gegenüber einem Mann, der jährlich sieben- bis achthundert Mädchen sieht, dann wärest du, mein Engel, sicherlich in einem großen Irrtum befangen. So reich auch ein Mann sei und so gut er uns tun möge, wir schulden ihm dennoch keinerlei Dankbarkeit. Denn wenn er uns mit Wohltaten überhäuft, so tut er es doch nur um seiner selbst willen.«
»Nun, Madame«, erwiderte ich, »ich werde zu Ihnen kommen, sowohl wegen des Vorteils wie wegen des Genusses. Ich teile Ihnen aber gleich mit, dass ich nicht unter fünfzig Louis zu haben sein werde.«
»Du wirst sie bekommen, du wirst sie bekommen«, erwiderte die Duvergier hocherfreut, »ich wollte nur deine Zustimmung haben, das Geld spielt keine Rolle. Sei folgsam, willig und widerstrebe niemals, dann will ich dir Berge von Gold verschaffen.«
Da es spät war und ich fürchtete, Noirceuil könnte über die lange Dauer meines Wegbleibens beunruhigt sein, verließ ich bald das Haus.
Madame de Noirceuil sah nicht ganz gleichgültig zu, wie mir der Haushalt übertragen wurde. Es verging kein Tag, an dem sie nicht vor Hass gegen mich geweint hätte. Ich wohnte viel besser wie sie, wurde besser bedient, konnte mich schöner kleiden und besaß einen Wagen für mich allein, so kann man sich vorstellen, dass sie nur Wut und Verachtung für mich übrig hatte.
Sie können sich jedoch denken, dass Noirceuil nicht nur aus Liebe derart gegen mich handelte. Er sah in meiner Gesellschaft ein Mittel zum Verbrechen. Denn nichts war so geregelt wie die Verfehlungen dieses Verbrechers. Gleichmäßig jeden Tag lieferte ihm die Duvergier eine Jungfrau, die nicht älter als fünfzehn und nicht jünger als zehn Jahre sein durfte; für jede zahlte er hundert Francs und die Duvergier haftete mit fünfundzwanzig Louis, wenn Noirceuil beweisen konnte, dass das Mädchen nicht mehr vollkommen jungfräulich war. Trotz dieser Vorsichtsmaßregel wurde er doch jeden Tag getäuscht, wie Euch mein Beispiel beweist. Die Sitzung fand gewöhnlich abends statt. Die zwei Lustknaben, Madame de Noirceuil und ich fanden uns regelmäßig ein und Noirceuils zarte und unglückliche Gattin war jeden Abend das Opfer seiner sonderbaren Verirrungen. Später zog sich alles zurück, und ich aß mit Noirceuil allein zu Abend, der schließlich in meinen Armen einschlief.
Ich muss es Euch endlich eingestehen, meine Freunde, dass ich begierig war, die Grundsätze Dorvals in Anwendung zu bringen. Meine Finger brannten mir, ich wollte um jeden Preis stehlen. Ich zweifelte nicht an meiner Geschicklichkeit, wusste aber noch nicht, wie ich sie anwenden sollte. Ich hatte bei Noirceuil leichtes Spiel, denn er schenkte mir vollständiges Vertrauen und war sehr reich und unordentlich. Es gab keinen Tag, an dem ich ihm nicht zehn oder zwölf Louis stehlen hätte können, ohne dass er es gemerkt hätte. Durch einen seltsamen Gedankengang ließ ich mich jedoch bestimmen, einem Wesen, das so verderbt war wie ich, keinen Schaden zuzufügen. Auch ein zweiter Grund war maßgebend für mich: ich wollte durch mein Stehlen wehe tun. Dieser Gedanke brachte meinen Kopf in Aufruhr. Was aber hätte ich begangen, wenn ich Noirceuil bestohlen hätte. Ich betrachtete sein Eigentum als das meine, und in einem Wort, wenn Noirceuil ein anständiger Mann gewesen wäre, hätte er keine Gnade gefunden. Er war ein Verbrecher, folglich achtete ich ihn. Ich ging aufs Ganze los, hatte Gelegenheit, viele Männer zu sehen, und konnte leicht ein besseres Objekt wie Noirceuil finden. Sollte mir aber dieses Glück nicht zustoßen, so wäre ich doch durch die Duvergier schadlos gehalten, denn schon einige Tage nach meinem ersten Besuch ließ sie mich bitten, zu ihr zu kommen.
Ich sollte mit einem Millionär zusammentreffen, der bei seinen Vergnügungen durchaus nicht sparte und jeden, der seinen schandvollen Ausschweifungen diente, mit Bergen Goldes bezahlte.
Sechs entzückende Mädchen aus dem Hause der Duvergier sollten mich auf meinem Gang zu diesem Krösus begleiten; ich allein jedoch sollte Gegenstand seiner Anbetung werden, und meine Genossinnen folgten mir bloß als Priesterinnen nach.
Als wir einlangten, ließ man uns in ein mit brauner Seide ausgeschlagenes Kabinett eintreten, und unsere Führerin befahl uns, uns auszukleiden. Als ich nackt war, umhüllte sie mich mit einem schwarzen, silbergestickten Schleier, um mich vor meinen Genossinnen auszuzeichnen.
Endlich trat Mondor ein. Er war sechsundsechzig Jahre alt, klein und untersetzt, besaß aber ein lebhaftes und sinnliches Auge. Vorerst prüfte er meine Genossinnen und nachdem er jede belobt hatte, trat er an mich heran und sagte mir eine jener derben Liebenswürdigkeiten, die man nur im Wörterbuch der Zuhälter findet. »Wohlan«, sagte er zu seiner Dienerin, »wenn die Damen bereit sind, können wir ja an die Arbeit gehen!« Der nun folgende Wollustakt bestand aus drei Szenen. Während ich das sehr schwache Leben Mondors mit meinem Mund erwecken musste, stellten sich meine sechs Genossinnen in drei Gruppen auf, die die sapphische Liebe in wollüstiger Weise zum Ausdruck brachten. Jeden Augenblick wechselten sie die Stellungen, und diese Vorgänge dauerten eine halbe Stunde, bevor ich auch nur ein wenig Fortschritt in dem Zustand des Sechzigers bemerkte. »Schöner Engel«, sprach er zu mir, »ich glaube, dass diese Huren mir nur noch einen Ständer machen werden. Zeigen Sie mir doch Ihre Backen, denn wenn es möglich wäre, einzudringen, dann müsste es gleich sein.« Aber Mondor hatte seine Kräfte überschätzt. »Ich sehe, ich muss doch noch ein wenig mehr erregt sein«, sagte er nach einigen verzweifelten Anstrengungen. »Ihr müsst Euch alle Sieben um mich aufstellen.« Nun bewaffnete uns die Haushälterin mit Rutenbündeln, und jede von uns musste den alten runzeligen Hintern des armen Mannes der Reihe nach auspeitschen, der dabei die Reize der sechs anderen abtastete. Schließlich blutete, schwitzte und keuchte er und entlud. Danach bat er mich noch allein in ein Kabinett, und ich benutzte die Gelegenheit, um ihm ein umfangreiches Päckchen zu stehlen. Er hatte nichts bemerkt, ich kleidete mich wieder an, und wir fuhren in zwei Wagen fort, nachdem wir reichlich bezahlt worden waren.
»O Gott«, sagte ich, nachdem ich zu Noirceuil zurückgekehrt war und in aller Ruhe mein nunmehriges Eigentum betrachten konnte, »ist es möglich, dass der Himmel gleich meinen ersten Diebstahl so sehr begünstigt?« Das Päckchen enthielt Zahlungsanweisungen auf sechzigtausend Francs.
Ich zögerte nicht, die bei Mondor gestohlenen sechzigtausend Francs so gut als möglich anzulegen; ich musste den Diebstahl vor Noirceuil verbergen, da er ihm gleichzeitig ein Beweis für meine Untreue gewesen wäre und mein Geliebter vielleicht befürchten könnte, ich hätte mich auch an seinem Eigentum vergriffen; und so hielt ich es für das Klügste, nichts zu sagen und bloß meine Einkünfte auf die gleiche Art zu vermehren.
Noirceuil, der mich durchaus nicht liebte, gab trotzdem sehr viel Geld für mich aus. Ich empfing von ihm vierundzwanzig-tausend Francs jährlich, und wenn Sie dazu die Rente von zwölftausend Francs, die ich mir selbst geschaffen hatte, fügen, können Sie ermessen, dass es mir nicht schlecht ging. Ich kümmerte mich sehr wenig um die Männer, und alle meine Begierden wurden durch zwei entzückende Frauen befriedigt. Manchmal gesellten sich noch deren Freundinnen zu uns, und es gab dann keine Verirrung, die nicht bei uns stattgefunden hätte.
Eines Tages bat mich eine dieser Freundinnen um Hilfe für einen ihrer Verwandten, dem ein unangenehmes Abenteuer zugestoßen war. Sie sagte, ich möge nur ein Wort meinem Geliebten gegenüber laut werden lassen, dessen Einfluss beim Minister groß genug sei, um alles in Ordnung zu bringen. Sie fügte noch hinzu, dass der junge Mann auf meinen Wunsch kommen würde, um mir seine Geschichte selbst vorzutragen. Wider Willen von dem Wunsche erfasst, jemanden glücklich zu machen, sagte ich zu, und der junge Mann erschien. Himmel, wie groß war mein Erstaunen, als ich in ihm Lubin erkannte; ich tat mein Möglichstes, um meine Verwirrung zu verbergen. Ich versprach ihm, zu helfen, und der Verräter ging weg, indem er mich noch versicherte, dass er glücklich sei, mich, die er so lange gesucht habe, gefunden zu haben. Einige Tage vergingen, ohne dass etwas Neues vorgefallen sei. Ich suchte mich über die unglücklichen Folgen, die diese Begegnung haben konnte, in Sicherheit zu wiegen, als eines Abends beim Verlassen der Comédie Italienne sechs Männer meinen Wagen anfielen, mich aussteigen ließen und mich mit dem Rufe: »Nach dem Gefängnis!«, in einen Wagen stießen.
»Himmel«, sprach ich zu mir, »ich bin verloren!« Dann aber fasste ich mich und fragte die Männer: »Meine Herren, irren Sie nicht?«
»Ich bitte um Entschuldigung, mein Fräulein, wir täuschen uns«, erwiderte einer der Verbrecher, in dem ich bald Lubin erkannte, »wir täuschen uns, denn wir sollten Sie zum Galgen führen! Haben wir jedoch bis jetzt einige Rücksicht auf Herrn de Noirceuil nehmen müssen, so wird dies mit einiger Verzögerung dennoch hoffentlich bald geschehen.«
»Nun«, erwiderte ich, »wir wollen sehen, jedoch geben Sie wohl acht, dass diejenigen, die sich jetzt als Stärkere fühlen und sich so kühn mir gegenüber benehmen, nicht einmal ihr Vorgehen bereuen.« Wir langten an, und man warf mich in ein finsteres Loch, in dem ich während sechsunddreißig Stunden schmachten musste.
Sie werden vielleicht zu erfahren wünschen, meine Freunde, wie es nunmehr in meinem Innern aussah, und ich will Ihnen offen antworten: Ich war ruhig wie im Glück und bloß verzweifelt, einen Augenblick auf die Stimme der Tugend gehört zu haben. Trotzdem jedoch empfand ich ein wenig Beunruhigung. Empfand ich die aber nicht, als ich noch glücklicher war?
Ich befand mich gerade am zweiten Tage meiner furchtbaren Haft, als meine Tür unter großem Lärm geöffnet wurde. »Oh, Noirceuil!«, rief ich aus, als ich meinen Geliebten erkannt hatte. »Welcher Gott führt Sie zu mir und wie kann ich noch Ihr Interesse erregen, nachdem ich ein so großes Unrecht begangen habe?«