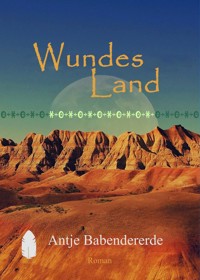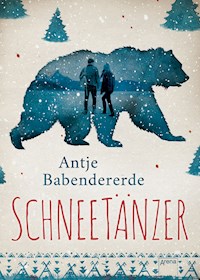Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GOYAlibre
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Sim heißt eigentlich Simona und will um jeden Preis auffallen. Und das tut sie wie ein bunter Hund im Reservat Pine Ridge im Nordwesten der USA, mit ihren merkwürdigen kurzen Haaren, ihren verrückten Klamotten und dem schiefen Lächeln. Doch als sie die unzertrennlichen Freunde Jimi und Lukas kennenlernt, ändert sich etwas für sie. Denn der blinde Lukas zeigt ihr eine ganz neue Sicht auf die Welt und auf sich selbst. Und in den attrativen Jimi verliebt sie sich Hals über Kopf. Doch die Dinge in Pine Ridge sind nicht so, wie sie scheinen. Während die Ereignisse sich überschlagen, die ihrer dreier Leben für immer verändern soll, muss Sim erkennen, dass sie sich für einen der beiden Jungen entscheiden muss. Für Lukas oder für Jimi.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antje Babendererde
Julischatten
Die Autorin
Antje Babendererde,geboren 1963, wuchs in Thüringen auf.Nach einer Töpferlehre arbeitete sie als Arbeitstherapeutinin der Kinderpsychiatrie. Seit 1996 ist sie freiberufliche Autorinmit einem besonderen Interesse an der Kultur, Geschichteund heutigen Situation der Indianer. Ihre einfühlsamen Romanezu diesem Thema für Erwachsene wie für Jugendliche fußen aufintensiven Recherchen und USA-Reisen und werdenvon der Kritik hochgelobt.
Impressum
Aus folgenden Quellen wurde zitiert:Medusa’s Child: Damnatio Memoriae, »Wounded Knee«, »Damnatio Memoria«,T-Recs Music, 2010.Annie Pazzogna: »Inipi – Das Lied der Erde«,Arun-Verlag, Engerda, 1998.Erste Veröffentlichung als E-Book 2012 2012© 2012 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Frauke SchneiderUmschlagtypografie:KCS GmbH · Verlagsservice & Medienproduktion, Stelle/HamburgISBN 978-3-401-80129-2www.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.de
Widmung
Für Ulli
Der Vergangenheit hinterherzujagen,ist eine beschissene Art zu leben.Ernest HemingwayNo way to runNowhere to hideNo chance for a fightAus dem Lied »Wounded Knee«von Medusa’s Child
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Drei Monate später, ein Montag Ende Oktober.
Nachwort
1. Kapitel
Verbannung. Anders konnte Sim das, was ihr bevorstand, nicht bezeichnen. Sie starrte aus dem kleinen Fenster auf die endlose weiße Wolkenlandschaft, die sich unter ihr erstreckte wie die Weiten der Arktis. Ihre Eltern schickten sie in die Verbannung. Die Erziehungsmaßnahmen waren gescheitert, ihre Geduld war am Ende, sie wussten nicht mehr weiter.
Du trinkst zu viel, Simona.
Sim presste ihre Stirn an die Plexiglasscheibe und schloss die Augen. Mit sechzehn bestand das Leben aus einer ganzen Reihe von Problemen und der Alkohol war nichts weiter als ein Mittel, sie für eine Weile verschwinden zu lassen. Simsalabim und weg.
Am liebsten mochte sie Tequila. Der mexikanische Agavenschnaps war zwar teuer (sie war auf Taschengeld angewiesen), aber das Trinkritual gefiel ihr: erst das Salz auf der Zunge, dann der Schnaps in der Kehle und zum Schluss der Biss in ein Stück Zitrone. Die Geschmacksnerven der Zunge meldeten: salzig und sauer. Den Alkohol registrierten sie gar nicht.
Tequila wird aus dem süßen Herz der blauen Agave gebrannt, das die mexikanischen Ureinwohner Das Haus des blauen Mondes nennen. Konnte etwas mit einem so schönen Namen verwerflich sein? Der Agavenschnaps half Sim, sich zu entspannen, er verbesserte ihre Laune, machte sie mutig. Er war ein guter Freund, verlässlicher als alle anderen, und ihn in ihrer Nähe zu wissen, war ein beruhigendes Gefühl. Aber sie konnte auch gut ohne ihn auskommen, obwohl ihre Eltern zuletzt vehement das Gegenteil behauptet hatten.
So ein Blödsinn. Sie wusste genau, wann sie aufhören musste – bis auf das eine Mal, in der Nacht vor ihrem sechzehnten Geburtstag. Das war ein Ausrutscher gewesen, so etwas konnte schließlich jedem passieren. Sogar Merle, Sims Superschwester, war mal sturzbetrunken von einer Party nach Hause gebracht worden. Sie hatte zwei Wochen Hausarrest bekommen und die Sache war vergessen.
So lief das bei Familie Klinger: Für Merle (die Perle) zwei Wochen Stubenarrest und für Sim sechs Wochen Verbannung. Ihre Eltern und Merle, das passte in einen Rahmen – nur Sim hatte immer das Gefühl herauszufallen. Das fing beim Aussehen an und endete bei ihrer umfassenden Talentlosigkeit. Als ob sie und Merle nicht aus demselben Genpool stammten.
Irgendwann hatte Sim ihre Eltern gefragt, ob sie adoptiert worden war und sie vielleicht den Zeitpunkt verpasst hatten, ihr das zu sagen – aber sie hatten nur gelacht.
Sim wohnte mit ihren Eltern auf dem Land, in Weisburg, einem kleinen Dorf in Thüringen mit dreihundert Seelen. Ihr Vater war Internist und arbeitete im nahe gelegenen Provinzkrankenhaus.
Als sie noch kleiner war, hatte Sim das Landleben gemocht. Das Wiehern der Pferde auf der Weide des Nachbarn, das kleine Schwimmbad am Rande des Dorfes, die Obstwiese, die zum Grundstück gehörte, der nahe Wald. Dass ihre Mutter Lehrerin war und sie im Auto zur Schule mitnehmen konnte, ersparte ihr und Merle die Fahrt mit dem Schulbus, führte allerdings auch dazu, dass sie die Verabredungen der anderen Kinder aus Weisburg oft nicht mitbekamen, die auf der Heimfahrt im Bus ausgemacht wurden. Für einen Großteil der Dorfbewohner waren sie nach all den Jahren immer noch die Zugezogenen, auch wenn ihre Eltern sich einbildeten, inzwischen dazuzugehören, bloß weil ihr Vater brav zu den Gemeindeversammlungen ging und ihre Mutter jedes Jahr einen Kuchen für das Dorffest backte.
Die Tatsache, dass in diesem Nest nichts, aber auch gar nichts los war, was einen Teenager dazu animieren könnte, keinen Blödsinn zu machen, kam Sims viel beschäftigten Eltern überhaupt nicht in den Sinn. Ihr Maßstab war Merle-Perle, die personifizierte Tüchtigkeit. Sie sang im Schulchor, besuchte die Aristoteles-AG (ein Verein jugendlicher Hobbyphilosophen) und nahm Violinstunden an der Musikschule. Doch das war noch nicht genug. In ihrer verbliebenen Freizeit machte Sims Schwester sich im Tierheim nützlich und gab dem Jungen des Nachbarn (einer kleinen Dumpfbacke) Nachhilfe in Mathe.
Es war aussichtslos, da noch mithalten zu wollen. Sim blieb nichts, womit sie die Anerkennung ihrer Eltern erringen konnte, denn in allem, was sie anfing, war Merle um Längen besser. Sim zog in ihrer Freizeit mit Nadja und ein paar anderen ums Dorf und trank, was gerade da war.
Als eines Sonntagmorgens die Polizei vor der Tür stand, wurden Herr und Frau Klinger unsanft aus ihren Träumen gerissen. Jemand war ins dorfeigene Freibad eingebrochen und hatte Geld aus der Kasse mitgehen lassen. Hinweise von Leuten, deren Grundstück ans Freibad grenzte, deuteten darauf hin, dass ihre Tochter Simona an diesem Einbruch beteiligt war.
Einbruch. Das klang nach Verbrechen. Dabei hatte der Abend ganz harmlos angefangen. Es war eine warme Sommernacht gewesen und sie hatten zusammen im Bushäuschen gesessen und Bier getrunken. Am Ende waren nur noch sie und Cook (der eigentlich Alexander Koch hieß), ihre beste Freundin Nadja und Kull, der Sohn des Bürgermeisters, übrig gewesen.
Im Nachhinein konnte Sim nicht einmal mehr sagen, wer eigentlich die idiotische Idee gehabt hatte. Mit einer Flasche Whisky waren sie zum Freibad gezogen und durch ein Loch im Maschenzaun gekrochen. Im Mondlicht hatten sie zusammen die Flasche geleert und waren im Becken geschwommen (nackt). Es war romantisch gewesen. Sim hatte sich frei und erwachsen gefühlt. Und schön. Bereit für alles, was kommen mochte und was sie seit Wochen in ihren Tagträumen herbeisehnte: dass aus Cook und ihr ein Paar wurde.
Immer, wenn sie an diese Nacht zurückdachte, ging ihr eine Liedzeile der alten DDR-Rockband Lift im Kopf herum, deren Musik ihre Mutter so oft hörte: Fällt der Mond in ihren Teich, wird in ihrem Schattenreich jede Frau katzengrau. Königin bis in den Tau.
Der Mond fiel nicht in den Teich, sondern ins Schwimmbecken. Diese Nacht würde Sim nicht vergessen. Niemals. Nicht nur wegen des Mondes und des blödsinnigen Einbruchs. In dieser Nacht war ihre Welt in Scherben gefallen.
Einen Versuch, den Einbruch abzustreiten, machte Sim erst gar nicht. Dazu fehlte ihr an diesem schrecklichen Morgen einfach die Kraft. Vor Enttäuschung und Scham war sie wie gelähmt und leugnen wäre ohnehin sinnlos gewesen. Sie sah völlig verheult aus und abgesehen davon hatte besagter Nachbar sie dabei beobachtet, wie sie durch den Zaun gestiegen waren.
Sim und Nadja waren fünfzehn, Cook und Kull gerade noch siebzehn. Alle vier wurden sie vom Jugendrichter zu je zwanzig Arbeitsstunden verdonnert: das Becken im Freibad reinigen (eine ziemlich schmierige Angelegenheit), Büsche und Blumen pflanzen, Papierkörbe leeren. Außerdem mussten sie für die kaputte Tür aufkommen und das gestohlene Geld ersetzen.
Sie waren das Topthema im Dorf. Cook würdigte sie keines Blickes mehr und sein Freund Kull verbreitete überall, dass das Ganze Sims Idee gewesen war und sie Cook dazu angestiftet hatte, die Tür zum Badhäuschen aufzubrechen. Sim rechtfertigte sich nicht, es wäre ohnehin zwecklos gewesen. Sie ließ die Leute denken, was sie wollten. Kull war der Sohn des Bürgermeisters und Cook sein bester Freund. Es war von vornherein klar, wem sie mehr glauben würden.
Das lag jetzt ein Jahr zurück. Damals hatte Sim versucht, die Sache mit Cook zu vergessen. Über das, was in jener Nacht passiert war, redete sie mit niemandem. Was wirklich wehtut, behält man lieber für sich.
Wem hätte sie auch davon erzählen sollen? Ihrer Mutter etwa? Oder ihrem Vater? Undenkbar. Merle schied auch aus – sie war nach dem Abi für ein freiwilliges soziales Jahr nach England gegangen. Und was Nadja, ihre (ehemals) beste Freundin anging: Nadja konnte Sim nicht verzeihen, in was für einen Schlamassel sie sie geritten hatte, und war seit jener Nacht unversöhnlich. Nicht mal in der Schule wechselten sie noch ein Wort miteinander. Nadja erzählte allen, Sim sei völlig durchgeknallt, und scheinbar fiel es den meisten nicht schwer, ihr zu glauben.
Manche Menschen wurden mit einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein geboren, doch Sim gehörte nicht dazu. Sie wollte und konnte mit niemandem über diese Nacht reden, über den Film, der in Endlosschleife in ihrem Kopf ablief. Aber ganz alleine schaffte sie es dann doch nicht, damit klarzukommen. Und weil sie nicht noch einmal so gedemütigt und verletzt werden wollte, machte sie dicht.
In dieser Zeit wurde sie zur störrischen Einzelgängerin und der Tequila ihr treuer Gefährte.
Sim war auf der Suche nach Anerkennung, Freundschaft, Liebe. Aber gleichzeitig hatte sie Angst davor, sich zu verlieben und die Tür zu ihrem Herzen noch einmal so weit zu öffnen. Die Mauern, die sie um sich baute, waren dick und hoch. Sie ließen niemanden rein und sie selbst nicht mehr raus. Ihr Leben rutschte immer mehr aus den Fugen, bis zwei Jungen aus dem Dorf sie in einer Nacht vor fünf Wochen halb ertrunken aus dem Dorfteich fischten. Sim hatte 2,1 Promille im Blut, ihr Kopf war schwer wie Zement und sie konnte sich an nichts mehr erinnern, als sie im Krankenhaus zu sich kam – mit einer Nadel im Arm, die durch einen Schlauch mit einem Beutel Kochsalzlösung verbunden war.
Es war ihr sechzehnter Geburtstag.
Ihre Eltern gerieten in helle Panik und kannten kein Pardon: Eine stationäre Entgiftung oder während der Sommerferien sechs Wochen zu Tante Johanna in die USA, das waren Sims Optionen.
Die Wahl fiel ihr nicht schwer, auch wenn die Reise nicht das war, wonach es sich im ersten Moment anhörte. Die Schwester ihres Vaters wohnte nämlich nicht in New York oder San Francisco und auch an keinem coolen Ort in der Wildnis, wo nachts die Wölfe im Wald heulten.
Nein, Sim saß in einer winzigen Propellermaschine mit siebenunddreißig Sitzen und war auf dem Weg nach Rapid City, South Dakota, irgend so ein Nest im Wilden Westen, das unter der weißen Wolkendecke lag. Tante Jo würde sie abholen und mit ihr nach Pine Ridge fahren, das Indianerreservat, in dem ihre Tante seit neun Jahren lebte, mitten im Nirgendwo.
Johanna – Jo – war das schwarze Schaf der Familie, bevor Sim ihr diesen Rang abgelaufen hatte. Auf Wunsch ihrer Eltern sollte Jo Violinistin werden (laut Opa Werner hatte sie das Zeug dazu), hatte sich jedoch auf einer ihrer Reisen quer durch die USA in einen Lakota-Indianer namens James Kills A Hundred verliebt und beschlossen, ihn zu heiraten. Sims Großeltern waren verzweifelt. Ihr Vater versuchte, seine Schwester dazu zu bewegen, sich das mit dem Heiraten noch einmal zu überlegen. Aber Tante Johanna packte ihre Siebensachen und verschwand für immer zu ihrem Liebsten nach Pine Ridge, South Dakota.
Sim hatte ihre Tante damals glühend dafür bewundert. Sie war acht Jahre alt und ihre Fantasie lief auf Hochtouren. Tante Johanna, die im Tipi hauste, am offenen Feuer kochte, wilde Pferde ritt, einen Typen mit Zöpfen zum Mann hatte und jetzt Jo Kills A Hundred hieß. Toll. Sie war schon immer Sims Lieblingstante gewesen, aber nun wurde sie ihr großes Vorbild. Wenn es sich schon nicht vermeiden ließ, erwachsen zu werden, dann wollte sie wenigstens so sein wie ihre abenteuerlustige Tante.
Damals fing Sim an, englische Wörter zu lernen, damit sie gewappnet war, in die Fußstapfen ihrer Tante zu treten. Als Zwölfjährige besaß sie einen reichhaltigen englischen Wortschatz, dessen Existenz sie jedoch gut zu verbergen wusste. Schließlich sollte niemand aus ihrer Familie etwas von ihren Auswanderplänen wissen.
Ein paar Jahre später hörte Sim ihre Eltern munkeln, dass Onkel James trank und Tante Johanna geschlagen hätte. Ihr Vater flog nach South Dakota, um seine Schwester in den sicheren Schoß der Familie zurückzuholen. Aber davon wollte Jo nichts wissen. Das ist mein Leben, hatte sie zu ihm gesagt, und mir gefällt es.
Ihr Vater kehrte todunglücklich ohne seine Schwester nach Hause zurück. Und Sim bewunderte Tante Jo nur noch mehr.
Inzwischen war Jo geschieden und hieß wieder Klinger. Sie unterhielt einen kleinen Laden, der sich »Horse Hill Arts & Crafts Shop« nannte. Darin verkaufte sie Kunstgewerbliches von Leuten aus dem Reservat an Touristen und Rohmaterial wie Perlen, Leder, Schnüre an die Indianer. Das Geschäft lief einigermaßen, zumindest konnte sie inzwischen davon existieren. Das war auch schon alles, was Sim über das Leben ihrer Tante wusste.
Als Kind hatte Sim sämtliche Indianerbücher gelesen, die sie in die Finger bekam, und hatte jeden Indianerfilm gesehen. Sie war ein Wildfang. Sogar in der Schule trug sie Stirnbänder und selbst genähte Hemden mit indianischen Mustern. Sie baute Buden im Wald, kletterte auf Bäume und alles, was die anderen Mädchen in ihrem Alter interessierte (Vampire, Prinzessinnen, Nagellack und BHs), fand sie langweilig. Stattdessen nähte sie einen kleinen Lederbeutel mit Fransen, packte besondere Steine, Mäuseknöchlein und ihre Milchzähne (und die der Katze) hinein und trug den Medizinbeutel verborgen unter ihren Kleidern auf der Brust. In ihren Träumen streifte sie durch die Prärie und der Held auf dem rabenschwarzen Pferd (natürlich ohne Sattel) wartete ungeduldig hinter dem nächsten Busch auf sie, um sie in sein Tipi zu entführen.
Damit war es schlagartig aus, als nach ihrem zwölften Geburtstag etwas über sie hereinbrach, das sich Pubertät nannte und jegliche Kommunikation mit Erwachsenen unmöglich machte. Sim fand, dass ein einziges Wort mit acht Buchstaben nicht umfassen konnte, was mit ihr passierte. Das Chaos von tausend Fragen in ihrem Kopf, die nach einer Antwort suchten. Das Auf und Ab ihrer Gefühle, das einer Achterbahnfahrt glich. Die Selbstzweifel vor dem Spiegel. Das plötzliche Klar-Sehen. Der Wunsch, unsichtbar zu sein, und gleichzeitig die große Hoffnung, von den Jungen beachtet zu werden und für einen von ihnen etwas Besonderes zu sein. Doch keiner machte sich bei Sim die Mühe, zweimal hinzusehen.
Neben ihrer hübschen Schwester fühlte sie sich wie eine graue Maus. Sim war mittelgroß und die Farbe ihrer störrischen Haare lag irgendwo zwischen Braun und Blond. Sie war weder dick noch dünn (abgesehen von ihren Beinen, die definitiv zu dünn waren), weder geistreich noch begabt, weder witzig noch musikalisch. Das einzig Auffällige an ihr war dieser kleine Makel, der ihr seit ihrer Geburt anhaftete: Sim war mit einer Lippenspalte geboren, landläufig Hasenscharte genannt. Jedes fünfhundertste Kind kam mit solch einer Fehlbildung auf die Welt. Genau genommen war also nicht mal das etwas Besonderes.
Ihre Mutter behauptete, sie hätte großes Glück gehabt, weil bei ihr nicht der Gaumen, sondern nur die Lippe von der Fehlbildung betroffen war, was mit einer einzigen Operation behoben werden konnte, als Sim ein paar Monate alt gewesen war.
Glück nannte ihre Mutter das: mit einer fetten Narbe in der Oberlippe herumzulaufen, während sich um einen herum alles um Schönheit und Perfektion drehte. Sie hatte diese Narbe schließlich mitten im Gesicht, dort, wo alle zuerst hinschauten. Ohne Narbe hätte sie wenigstens ein hübsches Lächeln gehabt, aber so geriet es immer ein bisschen schief. Deshalb lächelte Sim selten. Sie fand, es passte einfach nicht zu ihr.
Ihre schräge Kleidung aber war etwas, das ihr ganz allein gehörte, etwas, womit sie die Leute in ihrer Umgebung schockieren und von der Narbe ablenken konnte.
Zuerst kam die Grufti-Ära. Sie färbte ihre Haare schwarz, schminkte sich mit viel Schwarz und trug ausschließlich schwarze Klamotten. Unter dem dicken schwarzen Lippenstift war ihre Narbe kaum noch zu erkennen. Sim sah aus wie ein unglücklicher Rabe. Merle amüsierte sich über ihre Verwandlung. Ihre Eltern hielten es für eine pubertäre Phase und hofften, dass es vorübergehen würde, genauso wie ihre Indianermacke.
Ging es auch.
Sim verwandelte sich in eine Punkerin: kahler Schädel mit einem roten Iro (für den sie jeden Morgen eine Stunde brauchte, damit er stand wie ein Brett), zerrissene Klamotten, jede Menge Ketten und Piercings, Stachelhalsband und sogar einen Stecker in der Zunge, den zu stechen verflucht wehgetan hatte. Aus welcher Mülltonne sie denn gekrochen sei, hatte ihr Lehrer sie eines Tages entgeistert gefragt.
Sogar Merle war schockiert, zumindest das hatte Sim mit ihrem Outfit erreicht. Ihre Eltern verhielten sich immer noch tapfer, ließen sie jedoch wissen, dass sie sich lächerlich machte. Davon abhalten konnten sie Sim nicht. Insgeheim hofften sie, dass ihre Tochter zu Verstand kommen würde, ehe sie sich vollkommen entstellt hatte.
Damals kam Sim sich vor wie in einem tiefen Schlammloch. Sie ruderte mit Händen und Füßen, um nicht im zähen Schlick zu versinken, der ihr Leben war. Am Ufer standen ihre Eltern, die Großeltern, ihre Lehrer, sogar Merle, ihre ach so perfekte Schwester. Sie riefen und streckten hilfreich die Arme nach ihr aus, wollten ihr heraushelfen auf festen Boden, hinein in die Welt der Erwachsenen.
Aber dort wollte Sim gar nicht hin. Sie war noch nicht bereit, in die Haut eines Erwachsenen zu schlüpfen. Also trat und strampelte sie verzweifelt weiter. Bis sie Cook entdeckte, sich verliebte und hoffte, er würde derjenige sein, der ihr zurück an Land half. Doch ausgerechnet Cook war es, der sie in ihr Schlammloch zurückstieß.
War die große Liebe Schicksal oder eine rein chemische Angelegenheit – das hatte sie sich seither immer wieder gefragt. Wurden wir zu Opfern von Hormonen und biochemischen Vorgängen, die wir nicht im Griff hatten, wenn wir uns verliebten? Wissenschaftler hatten Parallelen zwischen den chemischen Vorgängen im Gehirn von Verliebten und denen von zwangsneurotischen Patienten entdeckt. Liebe war also so etwas wie eine Krankheit, eine Krankheit, gegen die man sich nicht impfen lassen konnte. Dieser Gedanke half Sim.
Auf dem Flughafen in Denver, wo Sim zwischengelandet und nach der Einreiseprozedur in diese kleine Propellermaschine umgestiegen war, hatte man sie angestarrt, als käme sie aus einer Freakshow. Es war wie in Weisburg: Die Leute sahen nur die schrägen Klamotten, nicht sie. Aber Denver war nicht die thüringische Provinz, sondern eine amerikanische Hauptstadt, da sollten die Menschen an auffälliges Styling gewöhnt sein – oder etwa nicht?
Das, was Sim inzwischen trug, ließ sich in keine Schublade mehr stecken. Sieben Löcher mit Silberringen im rechten Ohr und drei im linken Ohr. Ihre Klamotten: schwarze Lederstiefel mit weißen Punkten, kunstvoll zerrissene Nylons, bunte Oberteile, Kleider und kurze Röcke aus Stoffen, die sie selber zuschnitt, bleichte, batikte, färbte und neu zusammennähte – mit Knöpfen, Pailletten und Spitze besetzte. Sie nannte es die Sim-Phase. Es war eine Mischung aus allem, was es so gab, Hauptsache, nichts passte zusammen. Hauptsache, es lenkte von dem ab, was darunter war.
Meistens funktionierte das auch.
»Unsere Tochter sieht aus wie ein Paradiesvogel«, hatte ihr Vater mit einem tapferen Lächeln behauptet. »Nein, wie eine Vogelscheuche«, hatte ihre Mutter widersprochen.
Sim wünschte, sie wäre adoptiert. Dann hätte sie wenigstens ein Ziel gehabt. Sie hätte sich auf die Suche nach ihren richtigen Eltern machen können. Aber das mit dem Wünschen war so eine Sache – meistens funktionierte es nicht. Deshalb saß sie jetzt neben diesem Cowboy im karierten Hemd und war unterwegs ins Nirgendwo.
Kurz vor dem Landeanflug auf Rapid City riss die Wolkendecke auf und Sim sah endloses weites Grasland unter sich. Kaum mal ein Baum, geschweige denn Häuser. Ein großes gelbgrünes Nichts, das in der Ferne in eine bizarre Kraterlandschaft überging.
Von ihrem Vater wusste sie, dass Tante Jo einsam wohnte, ungefähr sechs Meilen vom nächsten Ort entfernt, der Manderson hieß. Ihre Google-Earth-Recherche vor ihrer Abreise war ernüchternd gewesen und hatte den Gedanken an das Wort Verbannung heraufbeschworen.
Sim hatte ihre Tante Jo ewig nicht mehr gesehen und fragte sich, ob sie wohl miteinander klarkommen würden. Die Schwester ihres Vaters war immer eine lustige Tante gewesen, sie hatte die Dinge stets leicht genommen – im Gegensatz zu ihrem Bruder. Hoffentlich hatte sich Tante Jo nicht verändert und war inzwischen genauso drauf wie ihre Eltern. Sim hatte keine Lust, sich jeden Tag irgendwelche Moralpredigten oder Vorträge über das wahre Leben anhören. Obwohl das am Ende immer noch besser war als die Entzugsklinik, in die ihre Eltern sie einsperren wollten. Davor hatte sie ziemlichen Schiss gehabt und war auch jetzt noch froh, dass es eine Alternative gegeben hatte.
Im Pine-Ridge-Indianerreservat waren der Besitz und das Trinken von Alkohol unter Strafe verboten. Wer von der Polizei erwischt wurde, musste Strafe zahlen und für acht Stunden hinter Gitter. Diese Tatsache hatte ihren Vater auf die Idee gebracht, sie zu Tante Jo zu schicken.
Was sie in Pine Ridge erwartete, war Sim immer noch nicht klar. Sie wusste nur, dass sie ihrer Tante im Laden und bei den Pferden helfen sollte. Pferde hätten therapeutische Wirkung, hatte Jo ihren Eltern am Telefon versichert. Sim hatte nichts gegen Pferde, solange sie sich auf der anderen Seite des Zaunes befanden, aber das interessierte offensichtlich niemanden. Sie traute keinem Tier, das größer war als sie selbst. Abgesehen davon: Ihr ganzes Leben war ein Fiasko und sie machte sich wenige Hoffnungen, dass sechs Wochen umgeben von Armut plus ein bisschen Pferdetherapie daran etwas ändern würden.
Der Cowboy neben ihr schlug seine Zeitschrift zu und Sim blickte hoch. Über den Sitzen leuchtete das Anschnallzeichen auf. In zehn Minuten würden sie landen.
2. Kapitel
Der Regionalflughafen von Rapid City lag ein paar Meilen außerhalb der Stadt, mitten in der Prärie. Der kleine Flieger wackelte ziemlich beim Landeanflug und Sim war froh, als sie endlich sicheren Boden unter den Füßen hatte.
Während sie in der kleinen Halle am Gepäckband stand und auf ihre Reisetasche wartete, blickte sie sich nach ihrer Tante um. Der Flieger war mit Verspätung gelandet, Tante Jo hätte längst da sein müssen. Sim war todmüde, fror in der klimatisierten Halle und wollte nur noch ins Bett.
Einer nach dem anderen verschwanden die Reisenden durch die Drehtür nach draußen und mit ihnen die Verwandten und Bekannten, die sie abgeholt hatten.
Immer noch keine Spur von Tante Jo. Langsam wurde Sim mulmig zumute und ihre Müdigkeit wandelte sich in nervöse Unruhe. Was, wenn ihre Tante einen Unfall gehabt hatte? Wenn es dunkel wurde und niemand kam, um sie abzuholen? Wenn sie zurückfliegen und am Ende doch noch in diese blöde Entzugsklinik musste?
Sim kam sich abgeschoben vor, verlassen, ausgesetzt. Aber heulen würde sie bestimmt nicht. Aus ihrer Unruhe wurde Wut. Innerlich verfluchte sie ihre Eltern und diese blödsinnige Idee mit dem Indianerreservat, als sich die große Drehtür erneut bewegte und zwei junge Männer mit dunklen Men-in-Black-Brillen die Eingangshalle betraten. Sie steckten in schmuddeligen T-Shirts und weiten, tief sitzenden Jeans. Sim schätzte sie auf achtzehn oder neunzehn und trotz der grässlichen Klamotten verdienten sie einen näheren Blick.
Der mit der verdrehten Baseballkappe auf dem Kopf war schlank und ein Stück größer als sein Begleiter, der durchtrainiert aussah und dessen rechter Arm dunkel war von Tätowierungen. Der Große hatte seine Hand auf der Schulter des anderen und sie lachten über etwas, das sie sich gerade erzählt hatten. Als der Tätowierte einer vollbusigen Scarlett Johansson hinterherblickte, sah Sim den langen Pferdeschwanz, der bis zur Hälfte seines Rückens reichte.
Mitten in der Eingangshalle blieben die beiden Indianer stehen. Pferdeschwanz nahm seine Sonnenbrille ab und hängte sie in den Halsausschnitt seines T-Shirts. Der andere war so cool, dass er seine Brille auch im Gebäude aufbehielt.
Sim merkte, wie sie taxiert wurde. Sie konzentrierte sich auf das Gepäckband, doch nach ein paar Sekunden siegte die Neugier und ihr Blick wanderte wieder zurück zu den beiden Indianern, die immer noch an derselben Stelle standen. Jetzt sah sie, dass Pferdeschwanz ein Stück Pappe in der Hand hielt und es langsam vor seine Brust hob. Darauf stand in Großbuchstaben: SIMONA.
Das Herz sank ihr in die Knie und ein ungläubiger Seufzer kam aus ihrer Kehle. Das. Darf. Doch. Nicht. Wahr. Sein.
Jimi Little Wolf war auf einiges gefasst gewesen, nur nicht darauf, dass Jos Nichte wie ein roter Igel aussah. Wie ein überfahrener Igel. Aber viel Auswahl gab es sonst nicht in der Empfangshalle des Flughafens.
Einen Moment lang starrte er das Mädchen an, sich durchaus darüber im Klaren, das ihm und Lukas dieselbe intensive Begutachtung zuteilwurde. Sein Blick wanderte vom Kopf des Mädchens zu ihren Füßen und wieder zurück. So ein Wesen hatte er noch nie gesehen. Flammend rotes Haar, das in kleinen Spitzen vom Kopf abstand, die auf der linken Seite platt gedrückt waren. Lange, rot bestrumpfte Beine – wie ein Storch. Sie steckten in schwarzen Lederstiefeln mit weißen Punkten. Der superkurze Rock war zusammengenäht aus bunten Stoffresten, die in ausgefransten Zipfeln endeten. Unter dem völlig zerlöcherten grünen T-Shirt lugte knallroter Stoff hervor.
Das Gewicht des Rucksacks schien das Mädchen nach hinten zu ziehen. Es hob die Hand zum Gruß und verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln.
»Ich sehe was, was du nicht siehst«, sagte Jimi zu Lukas, »und das ist…«
»Hübsch?«, fragte Lukas erwartungsvoll.
»Darüber reden wir später, okay?«, brummelte Jimi.
Zusammen bewegten sie sich auf das kunterbunte Mädchen zu.
»Hi«, sagte Jimi, als sie bei ihm angelangt waren. »Bist du Simona?« Sie war genauso groß wie er und sah ihm direkt in die Augen.
»Wo ist meine Tante?«, fragte sie argwöhnisch. »Ist etwas passiert?«
Ihre Stimme war unerwartet dunkel und kräftig. Die schwarz umrandeten Augen hatten dieselbe Farbe wie reife Stachelbeeren: helles Gelbgrün. Trotz einer Schicht Make-up im Gesicht war die hässliche Narbe in ihrer Oberlippe nicht zu übersehen. Als ob die Lippe in zwei Hälften geteilt und wieder zusammengenäht worden war. Jimi gab sich redlich Mühe, nicht auf diese Narbe zu starren, stattdessen musterte er Simonas rechte Ohrmuschel, die vom Ohrläppchen aufwärts mit zahlreichen kleinen Silberringen durchbohrt war.
»Keine Sorge«, antwortete er schließlich. »Deine Tante hatte einen Wasserrohrbruch, und gerade als sie zum Flughafen wollte, kamen die Männer mit ihren Geräten, um den Schaden zu beheben. Sie hat Lukas und mich beauftragt, dich abzuholen.« Er räusperte sich. »Ich bin Jimi.«
Der Blick des Mädchens wanderte misstrauisch von ihm zu Lukas.
»Hi«, sagte der mit einem breiten Grinsen. (Lukas’ Timing war ein Phänomen.)
»Lass dich von seinem debilen Gesichtsausdruck nicht irritieren«, sagte Jimi zu ihr. »Er ist vollkommen harmlos und will nur spielen.«
Jos Nichte war offensichtlich nicht zu Späßen aufgelegt. »Woher weiß ich, dass ihr die Wahrheit sagt?«, fragte sie und verschränkte die bleichen Arme vor der Brust. Sie hatte blau lackierte Fingernägel und an ihren Handgelenken baumelte ein Gewirr aus zerschlissenen Armbändern mit metallenen Anhängern, die leise klimperten. Sie starrte auf Jimis tätowierten Arm, als wäre er eine Boa constrictor.
»Gar nicht.« Inzwischen war er leicht genervt. »Du kannst mitkommen oder hier versauern, ganz wie du willst.«
Was natürlich großer Blödsinn war. Jo würde ihm den Kopf abreißen, wenn er ohne ihre Nichte zum Horse Hill zurückkäme. Die Kohle, die er dringend brauchte, könnte er in den Wind schreiben und er würde natürlich auch keinen anderen Job mehr von Simonas Tante bekommen.
Lukas schnaubte leise neben ihm, sein Griff an Jimis Schulter wurde fester.
»Ach kommt schon, ich hab bloß Spaß gemacht«, sagte er mit versöhnlicher Stimme. »Sehen wir etwa nicht aus wie ein Empfangskomitee?« Er breitete seine Arme aus und setzte sein charmantestes Lächeln auf. Offenbar gehörte dieses deutsche Mädchen nicht zu denen, die Indianer toll finden, was, das musste er zugeben, eine völlig neue Erfahrung für ihn war.
Es war nicht das erste Mal, dass er jemanden für Jo vom Flughafen abholte. Einige ihrer Gäste waren schon bei der Ankunft mit indianischem Schmuck behängt wie Weihnachtsbäume mit Lametta und begannen meist sofort, über ihre Leidenschaft für die Kultur der amerikanischen Ureinwohner zu reden. Manchmal konnte Jimi sich das Lachen über ihre Bemühungen, nicht in eins der vielen kulturellen Fettnäpfchen zu treten, kaum noch verkneifen.
Er erinnerte sich an die kleine blonde Lehrerin aus Österreich mit dem üppigen Vorbau und den Angelina-Jolie-Lippen, die er noch in der Kurve hinter der Rockyford-Schule in Jos Pick-up flachgelegt und ihr damit zu ihrer ersten spirituellen Erfahrung im Reservat verholfen hatte.
Doch Jos Nichte sah nicht so aus, als ob sie sich überhaupt etwas aus spirituellen Erfahrungen machte. Finster starrte sie auf das Laufband, wo jetzt eine große, mit Aufklebern bekleisterte Reisetasche auftauchte.
Sie beugte sich vor, aber Jimi war schneller. »Gehen wir?« Triumphierend hielt er ihre Tasche in der Hand.
Simona warf ihm einen müden und frustrierten Blick zu. »Wie lange fahren wir denn bis zu meiner Tante?«
»Anderthalb Stunden. Warum?«
»Ich muss mal.«
Jimi deutete nach rechts, wo sich in einem Gang die Toiletten befanden. Simona schien ihm immer noch nicht zu trauen, denn ihr Blick lag lauernd auf seiner Hand, die ihre Tasche festhielt.
»Willst du die lieber mitnehmen?« Langsam brachte ihn ihr Verhalten auf die Palme.
Auf einmal gab sich das Mädchen geschlagen und verschwand in Richtung Toilette. Erleichtert atmete Jimi aus.
»Was hat sie denn?«, fragte Lukas.
»Ganz einfach: Sie traut uns nicht.«
Lukas’ rechte Hand tastete wieder nach Jimis Schulter. »Ich würde dir auch nicht trauen, wenn ich ein Mädchen wäre«, sagte er. »Sei einfach ein bisschen netter zu ihr, Champ. Sie ist seit was weiß ich wie vielen Stunden unterwegs und bestimmt furchtbar müde.«
Typisch Luke, dachte Jimi. Er hatte immer für alle und alles Verständnis. »Müde kann sie ja von mir aus sein«, entgegnete er. »Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie zickig ist.« Von Jos Nichte hatte er sich einfach mehr erwartet – in jeglicher Hinsicht. Jo Klinger war die einzige weiße Frau im Reservat, die er respektierte.
»Du bist ja bloß frustriert, weil sie dich nicht anhimmelt.«
Jimi stieß empört Luft durch die Zähne. »Wohl kaum.«
Ein paar Minuten später kam Simona von der Toilette zurück. Ihr Blick hellte sich auf, als sie Jimi und Lukas und vor allem ihre Tasche sah. Verdammt, was ging der eigentlich im Kopf herum? Glaubte sie etwa, dass Lukas und er mit ihren schrägen Klamotten abhauen würden, um sie bei Ebay zu versteigern?
»Sie kommt«, raunte Jimi und Lukas setzte wieder sein Lächeln auf, das das Herz jeder Schwiegermutter zum Schmelzen gebracht hätte.
»Hoka hey!«, sagte Jimi mit einem lautlosen Seufzer, als das Mädchen wieder bei ihnen angelangt war. »Auf geht’s, Simona! Deine Tante wartet.«
»Sim«, sagte sie.
»Wie?« Irritiert sah Jimi sie an.
Sie nahm ihm das Pappschild aus der Hand und verdeckte mit ihrer klimpernden Rechten die letzten drei Buchstaben ihres Namens. »Nur Sim, okay?«
Er zuckte mit den Achseln. »Meinetwegen.«
Vor dem Flughafengebäude stellte Jimi Sims Tasche ab und zog die selbst gedrehte Zigarette hervor, die über seinem rechten Ohr steckte. Er schob sie zwischen die Lippen, zündete sie an und nahm einen Zug. Sim beobachtete jede seiner Bewegungen mit ihren Stachelbeeraugen.
Sie liefen zum Parkplatz, wo Jo Klingers alter Chevrolet stand, ein Pick-up mit geschlossener Ladefläche. Der 1975er-Silverado war von blassgelber Farbe und hatte weiße Seitenstreifen. Mit seinem klapprigen Aufbau sah er aus wie ein echter Oldtimer. Jimi machte es Spaß, die Kiste zu fahren, auch wenn sie ein Spritfresser war und gelegentlich streikte.
Er ging zum Heck des Trucks und öffnete die hintere Klappe, um Sims Tasche auf die Ladefläche zu stellen. Dann schloss er die Klappe wieder, stieg in die Fahrerkabine und setzte sich hinter das Lenkrad. Mit den Fingern an der Karosse lief Lukas um den Wagen herum, öffnete die Beifahrertür und machte eine einladende Handbewegung.
Jimi blickte zur Seite und sah Sims hellen, misstrauischen Blick. Sie traute dem Gefährt genauso wenig wie ihm und Lukas, aber ihr blieb keine Wahl. Zögerlich kletterte sie auf die rissige Sitzbank, aus der an manchen Stellen bröseliger Schaumgummi quoll, und stellte den Rucksack zwischen ihre Füße. Lukas schob sich neben sie und zog mit einem lauten Knall die Beifahrertür zu.
Der Truck begann zu vibrieren, als Jimi den Motor startete. Er jagte den ersten Gang rein und die Kiste rollte los. Zugegeben, die Geräusche, die der Silverado von sich gab, klangen beängstigend, aber der Truck hatte Bremsen (was nicht selbstverständlich war für einen Res-Car) – und er fuhr (was ebenfalls nicht selbstverständlich war für einen Res-Car). Jimi hoffte, dass die Kiste ihn nicht im Stich ließ, so wie vor zwei Wochen. Er wollte dieses seltsame Mädchen so schnell wie möglich bei Jo abliefern.
Wie konnte man bloß in solchen merkwürdigen Klamotten herumlaufen, in Sachen, die selbst die Heilsarmee aussortiert hätte? Jimi wusste nicht, ob er Sim(ona) ihres schrägen Outfits wegen bemitleiden oder ob er ihren Mut bewundern sollte. Das konnte lustig werden, wenn sie erst in dieser Verkleidung im Reservat herumspazierte. Jo tat ihm ein bisschen leid, denn es würde sich schnell herumgesprochen haben, dass das Mädchen ihre Nichte war. Hoka hey! Diesmal dachte er es nur und sprach es nicht laut aus. Auf geht’s! Bringen wir es hinter uns.
Keine Gurte. Vor hundert Jahren, als dieser Pick-up gebaut worden war, hatte noch niemand ans Anschnallen gedacht. Zu dritt saßen sie in der alten Kiste, zusammengedrängt wie in einer Sardinenbüchse. Lukas rechts neben Sim und Jimi am Steuer. Die tiefbraunen Arme der Jungen so dicht neben ihrer blassen Haut.
Ich bin ein Bleichgesicht, dachte sie.
Der Mai und die ersten beiden Juniwochen waren kühl und regnerisch gewesen in Deutschland, sodass Sims Haut bisher kaum einen Sonnenstrahl abbekommen hatte. Hier war der Himmel blassblau und es war immer noch unglaublich warm draußen, obwohl der Tag sich dem Ende neigte. Unter dem aromatischen Zigarettenrauch, der durch die Fahrerkabine zog, konnte Sim den Schweiß der beiden Jungen riechen. Sie zog die Schultern zusammen und klemmte ihre Hände zwischen die Schenkel, um sich so dünn wie möglich zu machen. Solange es sich vermeiden ließ, wollte sie keinen von ihnen berühren.
Vom Rückspiegel, also genau vor ihr, baumelte ein Traumfänger mit zerzausten Federn. Sim hatte von ihrer Tante zum zehnten Geburtstag einen wunderschönen großen Traumfänger geschickt bekommen, mit einem schwarzen Netz in einem mit rotem Leder umwickelten Weidenring, an dem gepunktete Federn baumelten. Er hing zu Hause über ihrem Bett. Die guten Träume sollten sich im Netz verfangen und über die Federn in den Kopf des Träumers geleitet werden. Die schlechten Träume fielen angeblich durch das Loch in der Mitte und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Ihr hatte der Traumfänger nichts genützt, denn in den letzten Monaten war sie oft von verwirrenden Träumen geplagt worden und schweißgebadet daraus erwacht. Es funktionierte nur, wenn man auch daran glaubte, so wie die Indianer.
Jimi schnippte die Kippe aus dem offenen Fenster. Sim betrachtete seine braunen Hände auf dem vibrierenden Lenkrad.
Irgendein Typ sang im Radio. »Indians, Indians, Indians. Let me tell you about Indians…« Lukas und Jimi grinsten vor sich hin und sangen mit.
Ganz normale Jungs, Sim.
Da ganz offensichtlich keiner der beiden an Konversation interessiert war (kein »Wie-war-dein-Flug?« – oder so etwas in der Art), steckte sie die Stöpsel ihres iPods in die Ohren und versuchte, sich zu entspannen. Was natürlich nicht funktionierte – unter diesen Umständen. Schließlich tat sie so, als wäre sie an der Landschaft links und rechts der Straße interessiert. Dabei warf sie zunächst einen verstohlenen Blick auf ihren linken Sitznachbarn.
Aus Jimis lockerem Pferdeschwanz waren ein paar Strähnen entwischt und klebten an seiner Schläfe. Er trug jetzt wieder seine Sonnenbrille, aber sie wusste, dass seine Augen dunkelbraun waren. Er hatte kantige Gesichtszüge mit breiten Wangenknochen und schrägen Augen. Über seiner Oberlippe schimmerte dunkler Flaum und seine Wangen waren zerfressen von Aknenarben.
Die Tätowierungen auf seinem Arm, das konnte sie jetzt sehen, stellten Tiere dar: einen Wolf (auf dem beachtlichen Bizeps), eine Schlange, die sich um sein Handgelenk wand, und über der Ellenbeuge ein Adler, der – wenn Jimi den Arm bewegte – aussah, als würde er fliegen.
Sim blickte wieder geradeaus. Sie wollte nicht zu lange auf die grauschwarzen Tattoos starren, denn ihr Interesse würde Jimi vielleicht irgendeine spöttische Bemerkung entlocken.
Wenn Jimi schalten musste, drückte er Sim jedes Mal seinen Ellenbogen mit dem Adlerschnabel in die Rippen, deshalb rückte sie ein Stück nach rechts, in der Hoffnung, dass Lukas ihr Platz machen würde. Aber er saß, wo er saß, und jetzt berührten sich ihre Oberschenkel auf der ganzen Länge.
Sim biss die Zähne zusammen.
Mit den Fingern seiner Linken trommelte Lukas den Takt der Musik auf sein Knie, mit der Rechten hielt er sich am Griff über der Tür fest. Auf seiner Brust lag ein schimmernder geflochtener Zopf, dick wie ein Seil. Er musste ihren Blick bemerkt haben, denn jetzt wandte er sich ihr lächelnd zu. Schnell schaute sie wieder nach vorn.
Es irritierte Sim, dass seine Augen von Anfang an hinter schwarzen Brillengläsern verborgen gewesen waren. An den Augen eines Menschen konnte man erkennen, ob man ihm trauen konnte oder ob er ein gefährlicher Irrer war. Zugegeben, wie gefährliche Irre sahen alle beide nicht aus, aber Sim fühlte sich dennoch unwohl zwischen ihnen.
Trotz der offenen Fenster schwirrte die Luft in der Fahrerkabine vor Testosteron. Wie konnte Tante Jo ihr das bloß antun? Und vor allem: Was hatte sie diesen beiden Machos über sie erzählt? Wussten die Jungs, dass sie nicht aus freien Stücken hier war? Und kannten sie den Grund dafür?
Die Straße vom Flughafen ins Reservat führte nach Osten – später machte sie einen Bogen in südliche Richtung. Sie fuhren durch welliges Grünland, in dem Bäume eine Seltenheit waren. Der Wind wehte über die Gräser und formte silbrig grüne Wellen. Ein Ozean aus Gras.
Als Lukas ihren Arm berührte, zuckte Sim zusammen. »Was hörst du denn da?«, fragte er. »Klingt gut.«
Sie zog die Stöpsel aus den Ohren. »Medusa’s Child«, antwortete sie, »ist eine Schweizer Band.« Das Lied, das gerade spielte, hieß Wounded Knee. Sim mochte die Musik und die Jungs von der Band waren cool, sie hatte sie mal live auf einem Konzert erlebt.
»Aber sie singen auf Englisch«, stellte Lukas fest.
»Jap.« Es lief immer noch Musik aus dem Radio und Sim hatte ihren iPod nicht sonderlich laut gestellt. Dieser Lukas musste Ohren haben wie eine Fledermaus.
»Cooles Teil«, bemerkte Jimi. Es war das Erste, was er von sich gab, seit sie losgefahren waren.
»Schön klein«, erwiderte sie unnötigerweise. Den iPod hatte sie sich von ihren Eltern zum Geburtstag gewünscht und auch bekommen. Ihr sechzehnter Geburtstag, den sie im Krankenhaus verbracht hatte, mit einer Nadel im Arm. Noch jetzt wurde ihr übel, wenn sie daran dachte, wie elend sie sich gefühlt hatte.
»Alles okay mit dir?« Lukas wandte ihr das Gesicht zu.
»Alles bestens.«
Immerhin, er versuchte wenigstens, nett zu sein, während Jimi höchstens Interesse für ihren iPod aufbrachte.
»Seid ihr eigentlich Brüder?«
»Ja«, sagte Jimi.
»Nein«, antwortete Lukas im selben Atemzug.
Langsam wurde es doch spannend.
»Wir sind keine leiblichen Brüder«, klärte Lukas sie auf.
»Blutsbrüder?«, fragte Sim und biss sich auf die Lippen. Das war ihr so herausgerutscht.
Lukas wandte ihr erneut das Gesicht zu, seine Mundwinkel zuckten. Schließlich lächelte er amüsiert und präsentierte dabei sein weißes Gebiss mit einem angeschlagenen Schneidezahn. »Ja, so was in der Art«, sagte er. »Wir sind Hunka-Brüder.«
»Hunka-Brüder?«
»Wird man durch eine Zeremonie«, meldete sich Jimi zu Wort.
Sim nickte. Zeremonie. Klar. Welcome to Indian Country, Simona Klinger!
Lukas erzählte von einer Pflegemutter, bei der sie beide lebten, und dass sie seit ihrem siebten Lebensjahr befreundet waren. Trotz seines lädierten Schneidezahns sprach er deutlich und sie konnte ihn gut verstehen. In der Schule war sie immer unter den Besten gewesen in Englisch – das einzige Fach, in dem sie hin und wieder eine Eins nach Hause gebracht hatte.
Die Straße wurde zur Baustelle, loser Schotter und abgefräster Asphalt. Jimi musste das Tempo drosseln und Sim stützte sich mit ausgestreckten Armen am staubigen Armaturenbrett ab. Kurz nachdem sie den Highway, der weiter in Richtung Osten führte, verlassen hatten, wurde die Straße schmaler, dafür aber auch wieder besser.
Lukas war unterdessen in Schweigen verfallen, aber Sim stöpselte ihren iPod nicht wieder ein.
Sie kamen durch einen kleinen Ort, der sich Scenic nannte. Die grob zusammengenagelten Bretterbuden links und rechts der Straße schienen aus einem alten Wildwestfilm zu stammen. Jimi fuhr jetzt im Schritttempo und Sim sah, dass es sich bei den Hütten um eine Bar nach der anderen handelte. Bei einigen Gebäuden waren die Fenster mit Bretterkreuzen vernagelt. Eine Bar – vergessene Weihnachtsbeleuchtung zierte die verwitterte Fassade und das Dach war mit zahllosen Kuhschädeln bestückt – war jedoch geöffnet und ein Klappschild wies darauf hin, dass es Budweiser gab. Ein kaltes Bier, dachte Sim, wäre jetzt genau das richtige Heilmittel für ihr Unwohlsein.
Auf dem Dach der Bar stand in schwarzer Schrift, eingerahmt von den bleichen Kuhschädeln, der Spruch: Indians allowed.
»Das ist der Longhorn Saloon«, erklärte Jimi, als sie die Bar passiert hatten. »Früher hieß es No Indians allowed, aber das No haben sie irgendwann mit weißer Farbe überpinselt. Der Saloon ist cool, Sägemehl auf dem Boden und alte Sättel als Barhocker.« Er sprach schnell und Sim hatte einige Mühe, seinem verwaschenen Englisch zu folgen. »Touristen trauen sich da kaum noch rein«, fuhr er fort, »zu viele betrunkene Indianer…« Er grinste.
Sim stockte der Atem. Wusste er etwas? War das eine Anspielung gewesen?
Sie suchte nach Worten für einen Kommentar, aber Jimi erwartete offensichtlich keinen. Er schaltete in einen höheren Gang, trat wieder aufs Gas und die Meilen flogen rasch dahin. Das Gras, bemerkte Sim erst jetzt, war nicht mehr grün, sondern von einem blassen Gelb. Anscheinend regnete es in South Dakota nur selten. Es war erst Mitte Juni und alles schien bereits verdorrt zu sein.
Bald veränderte sich die Landschaft zu beiden Seiten der Straße und kalkweiße Felsen in bizarren Formen tauchten auf. Es sah aus, als wäre die filzig braungelbe Haut der Erde aufgebrochen und ihre Knochen ragten daraus hervor. Je tiefer sie in dieses wüstenhafte Gebiet hineinfuhren, umso mehr schwand die Grasdecke und pilzförmige Gebilde wechselten sich mit Spitzkuppeln und Felstafeln ab. Hier sah es aus wie auf dem Mond. Jedenfalls wirkte die Gegend nicht sonderlich einladend. Amerika, das war ein fremdes Land, aber sie war unversehens auf einem fernen Planeten gelandet. Sim wurde noch mulmiger zumute.
»Die Ausläufer der Badlands«, erklärte Jimi, der Sims Blick bemerkt hatte. »Bei Sonnenuntergang sehen sie besonders irre aus.«
Neben ihr gab Lukas ein kaum hörbares Schnauben von sich und Sim brummte ein gelangweiltes »Hmm«. Von irren Sonnenuntergängen wollte sie lieber nichts wissen. Nicht von einem Typen wie diesem Jimi.
Die Abendsonne näherte sich dem gezackten Horizont und überpinselte die grau-weißen Felsen mit einem rötlichen Schimmer, der immer intensiver wurde, bis es schien, als würden die Felswände glühen. Es sah irre aus. Wie es wohl sein würde, in dieses Felsgewirr hineinzulaufen, sich darin zu verlieren, alles zu vergessen? Eine andere zu werden. Metamorphose. Transformation. Ein Flügelkleid überwerfen und davonfliegen.
»Willkommen im Res«, sagte Jimi und holte sie in die Wirklichkeit zurück. Der Adler auf seinem tätowierten Arm entfaltete seine Flügel, als er auf ein Schild an der rechten Straßenseite wies.
SIE BETRETEN DAS PINE-RIDGE-INDIANERRESERVAT, HEIMAT DER OGLALA SIOUX. LAND VON RED CLOUD, BLACK ELK UND CRAZY HORSE.
Namen, die Sim aus ihren Büchern von früher kannte. Aber wer diese Männer waren, hatte sie längst vergessen.
Das nächste Verkehrsschild, eine Geschwindigkeitsbegrenzung, war durchsiebt von Einschusslöchern und Sim schluckte trocken. Jimi ignorierte das Schild und jagte den Pick-up auch weiterhin mit sechzig Meilen die Stunde (mehr gab die Kiste vermutlich nicht her) über die Landstraße.
»Wie lange bleibst du im Res?«, erkundigte sich Lukas.
Für ihre Antwort brauchte Sim nicht lange zu überlegen, sie hatte die Tage ihrer Verbannung mehr als einmal gezählt und es waren doch nicht weniger geworden. »Genau vierzig Tage.«
»Das klingt, als wärst du nicht sonderlich begeistert davon, hier zu sein«, bemerkte er und wandte ihr fragend das Gesicht zu.
»Ich kenne meine Tante nicht besonders gut«, sagte sie schnell. Anscheinend wussten die beiden doch nichts über den Grund ihres Aufenthaltes. »Wir haben uns vor vier Jahren das letzte Mal gesehen und ich weiß nicht, wie sie jetzt drauf ist.«
Damals war Sims Großvater sechzig geworden und Tante Jo zu diesem Anlass nach Deutschland gekommen. Aber sie hatten kaum Gelegenheit gehabt, miteinander zu reden, weil ihre Tante ständig umlagert gewesen war von neugierigen Familienmitgliedern, die sie über ihr Leben im Indianerreservat ausfragten.
»Deine Tante ist in Ordnung«, sagte Lukas. »Wird dir bestimmt gefallen bei ihr.«
Jimi drehte das Radio lauter. Die Musik kannte Sim. Es war John Trudells unverkennbarer Sprechgesang. In den vergangenen Jahren hatte Tante Jo ihr immer eine CD mit indianischer Musik zum Geburtstag und eine zu Weihnachten geschickt, darunter war auch »Bone Days« von John Trudell gewesen.
How do we sell our Mother? Crazy Horse, we hear what you say.
Schon wieder Crazy Horse, dachte sie und versuchte, sich daran zu erinnern, was sie in ihrer Indianerphase über ihn gelesen hatte. Crazy Horse war ein berühmter Häuptling der Lakota gewesen, aber mehr wollte ihr dazu nicht einfallen. Nun, das sollte nicht das Problem sein. Immerhin hatte sie volle sechs Wochen, um ihre Erinnerungen aufzufrischen.
Sie hatten eine Schule passiert und kurz darauf machte die Straße einen scharfen Linksknick. Die knochigen Felsen wichen hügeligem Grasland. Täler und Anhöhen wie Wellen aus schimmerndem Gold. Das Land war leer. Nur hier und da ein paar Sträucher oder eine Baumgruppe. Das graue Asphaltband der Straße war durchbrochen von schwarzen Teerflicken und abgrundtiefen Löchern. Krater war wohl das bessere Wort. Jimi umfuhr sie schnittig, als würde er jedes Schlagloch persönlich kennen.
Die Behausungen, die wie hingewürfelt am Straßenrand und zwischen den Hügeln auftauchten, waren auf Hohlblocksteine aufgebockte Wohntrailer (sie erinnerten Sim an große Bauwagen) und hier und da auch mal ein Holzhaus. Meist waren die Buden umgeben von irgendwelchem Krempel, der schon vor langer Zeit ausgedient hatte: Autoreifen, Kühlschränke, Klobecken. Dazwischen buntes Plastikspielzeug und achtlos hingeworfene Fahrräder. Eine Reifenschaukel, ein Trampolin. Autos in verschiedenen Stadien des Verfalls.
Irgendwann tauchte ein weißes Hinweisschild mit der Aufschrift »Horse Hill Arts & Crafts« auf und kurz darauf lenkte Jimi den Pick-up nach links auf eine Auffahrt. Die ansteigende Schotterpiste war gesäumt von unzähligen kurzstieligen Sonnenblumen. Nach einer langen Kurve erblickte Sim ein großes Blockhaus und mehrere Nebengebäude.
Das Haupthaus schmiegte sich auf halber Höhe an den Hang und seine hellen Rundbalken leuchteten in der Abendsonne in einem warmen Orangerot. Auf den breiten Holzstufen, die zum oberen Eingang führten, saß ein großer weißer Hund.
Jimi parkte den Pick-up vor dem Haus, und nachdem die Jungen ausgestiegen waren, nahm Sim ihren Rucksack und kletterte ebenfalls aus der Fahrerkabine. Ein paar wild aussehende Katzen huschten davon und versteckten sich unter einem langen Trailer mit türkisfarbener Blechverkleidung, der – quer zum Hügel – dem Blockhaus gegenüberstand. Der Hund kam schwanzwedelnd auf sie zugelaufen und beschnupperte Sims rot bestrumpfte Beine gründlich.
»Hey, Juniper«, sagte Jimi. Juniper sah aus wie ein weißer Wolf und war ziemlich fett. Während Jimi sich nicht weiter um die Hündin kümmerte, kniete Lukas nieder und verteilte großzügig Streicheleinheiten. Er klaubte Kletten und Zecken aus Junipers Fell und nannte sie liebevoll »Little Mum«.
Die Hundedame war also nicht fett, sondern trächtig.
Sim schaute sich um. Das Blockhaus mit seinem massiven Unterbau schien auch den Laden ihrer Tante zu beherbergen. Zu ebener Erde gab es einen separaten Eingang, daneben eine Bank mit einem Tisch. In den großen Fenstern zu beiden Seiten der Tür sah Sim Plakate und Traumfänger in verschiedenen Größen.
Eine Holztreppe führte zu einer kleinen Veranda und zum oberen Eingang – vermutlich in den Wohnbereich. Die dunkelroten Vorhänge hinter den Fenstern waren zugezogen.
Zwei alte Autos, eine graue Limousine und ein roter Sportwagen mit eingedellter Fahrertür und einem weißen Blitz auf der Motorhaube, parkten vor dem Trailer. Weiter hinten stand ein rostiger Pferdeanhänger, der einmal blau gewesen war. Ein paar Meter unterhalb des Trailers vervollständigten ein Schuppen und eine kleine Blockhütte (die vermutlich noch aus der Goldgräberzeit stammte) das Gebäudeensemble.
Der Hügel hinter dem Wohnhaus musste der Horse Hill sein, nach dem Tante Jo ihre Residenz und den Laden benannt hatte. Hinter einem Drahtzaun entdeckte Sim Pferde, große Tiere, die mit den Köpfen nickten, als wollten sie die Ankömmlinge begrüßen.
Sim schluckte. Das war alles. Pferde, Katzen, eine trächtige Hündin. Es gab keine Nachbarn, keinen Baum, keinen Strauch. Die Blumen im Steingarten vor dem Haus schienen um ihr Überleben zu kämpfen. Tante Jo wohnte tatsächlich in einer absoluten Einöde. Sim fragte sich, wie sie es hier sechs lange Wochen aushalten sollte, ohne einen Koller zu kriegen.
In diesem Moment sprang die Ladentür auf und ihre Tante kam mit langen Schritten auf sie zu. Jo war braun gebrannt und hager, die kurzen braunen Haare von silbernen Fäden durchzogen. Sie trug Jeans und ein dünnes kariertes Hemd über dem weißen T-Shirt. Mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht streckte sie ihre Männerhände nach Sim aus.
»Mona«, sagte sie und erdrückte Sim fast in ihrer Umarmung. Unwillkürlich zog sie ihre Schultern hoch und versteifte sich. Mona, so hatte Merle sie genannt, als sie geboren wurde und ihre damals dreijährige Schwester ihren Namen nicht richtig aussprechen konnte. Manchmal hatten auch ihre Eltern und Großeltern sie Mona gerufen, aber Sim mochte diese Abkürzung nicht. Mona klang brav und altmodisch. Sim passte viel besser zu ihr.
Jo schob ihre Nichte auf Armeslänge von sich und musterte sie. »Gut siehst du aus«, rief sie voller ehrlicher Begeisterung.
Sim warf einen verstohlenen Seitenblick auf Lukas und Jimi. Lukas verzog keine Miene, aber Jimi grinste übers ganze Gesicht. Idiot, dachte sie.
»Jungs, habt vielen Dank, dass ihr eingesprungen seid«, wandte sich Jo an die beiden, »ihr habt was gut bei mir.« Sie drückte Jimi ein paar Dollarscheine in die Hand. Er schob sie mit einer lässigen Geste in die Gesäßtasche seiner Jeans und bedankte sich. Jo sprach gerade eine Einladung zum Abendessen aus, als das lang gezogene Heulen eines Wolfs ertönte. Es kam aus Jimis Hosentasche. Juniper spitzte die Ohren.
Jimi kramte sein Handy hervor, hielt es ans Ohr und entfernte sich ein paar Schritte. Sim sah ihm nach. Das war wirklich der freakigste Klingelton, den sie je gehört hatte.
Nach zwei Minuten kam Jimi zu ihnen zurück. »Sorry«, sagte er, »aber ich habe noch was zu erledigen.«
Trotz Sonnenbrille (er trug sie immer noch, obwohl die Sonne sich längst verabschiedet hatte) bemerkte Sim ein Aufflackern von Enttäuschung im Gesicht von Lukas.
»Ich hoffe, die beiden haben dich gut unterhalten?« Jo zwinkerte Sim zu.
Sie zuckte betont gleichgültig mit den Achseln.
»Wir müssen los«, sagte Jimi. »Man sieht sich.« Er legte Lukas eine Hand auf die Schulter, was offensichtlich Nichts wie weg hier bedeutete.
»Bis bald.« Lukas hob eine Hand zum Gruß und lächelte.
»Bye«, sagte Sim.
Jimi schob seinen Freund zu dem alten roten Sportwagen mit dem weißen Blitz über der Motorhaube, der vor dem Trailer parkte. Anscheinend war Jimi derjenige, der bei den beiden das Sagen hatte.
»Und denkt daran, ich brauche euch zum Heumachen«, rief Jo ihnen nach. »Möglichst bald.«
Sie stiegen in den Wagen und fuhren davon. Sim blickte ihnen nach. Über die Heckscheibe von Jimis Flitzer zog sich ein Spinnennetz aus feinen Rissen.
»Sind die beiden eigentlich schwul?«, wandte sie sich an ihre Tante. Das würde immerhin erklären, warum Jimi und Lukas die Finger nicht voneinander lassen konnten.
Jo warf den Kopf in den Nacken und begann, laut und herzhaft zu lachen. »Oh nein, ganz sicher nicht.« Wieder lachte sie, bis ihr die Tränen kamen. »Aber falls du versucht haben solltest, Lukas Brave schöne Augen zu machen, dann war das zwecklos. Er ist blind wie ein Maulwurf.«
»Was?« Ungläubig starrte Sim ihre Tante an. »Das habe ich überhaupt nicht gemerkt.«
»Vielleicht deshalb, weil du nur Augen für Jimi Little Wolf hattest.« Fragend musterte sie Sim. »Oder liege ich da falsch?«
»Ich habe keinem von beiden schöne Augen gemacht«, sagte Sim und hatte Mühe, sich das Grinsen zu verkneifen. Jimi Kleiner Wolf und Lukas Mutig.
»Das ist auch besser so. Die beiden haben nämlich den Ruf, die größten Herzensbrecher im Umkreis von hundert Meilen zu sein, und du solltest dich vor ihnen in Acht nehmen.«
»Du schickst zwei Schürzenjäger, um mich vom Flughafen abholen zu lassen? Gehört das auch zum Therapieprogramm?« Sie sah ihre Tante aufmerksam an.
Jo hatte die gleichen, weit auseinanderstehenden hellen Augen und dieselbe Adlernase wie sie. Überhaupt war die Ähnlichkeit zwischen ihnen verblüffend. Auf einmal wusste Sim, wie sie in dreißig Jahren aussehen würde. Und dass sie ganz sicher nicht adoptiert war.
Jo zuckte mit den Achseln, sie ging nicht auf ihren Seitenhieb ein. »Sie waren gerade da, als die Monteure kamen, und Jimi ist der Einzige hier, der meinen Silverado mit Gangschaltung fahren und reparieren kann. Der Toyota ist im Eimer.« Sie nickte hinüber zu der grauen Limousine.
»Arbeitet er öfter für dich?«
Jo nickte. »Jimi ist ein guter Handwerker, er kann fast alles reparieren. Und Lukas, der kennt sich bestens mit Pferden aus.«
»Wohnen die beiden weit weg von hier? Sie haben etwas von einer Pflegemutter erzählt.«
»Bernadine Jumping Eagle. Zurzeit kümmert sie sich um zwölf oder dreizehn Pflegekinder. Sie wohnt drüben in Manderson.« Jo musterte ihre Nichte mit einem amüsierten Blick. »Hey, höre ich da etwa doch so etwas wie Interesse herausklingen?«
»Na ja, sonst gibt es hier ja nicht viel Abwechslung, wie es scheint.« Sim machte eine umfassende Handbewegung.
»Nur keine voreiligen Schlüsse ziehen«, sagte ihre Tante, »hier passiert mehr, als du denkst.« Sie stupste Sim unters Kinn. »He, Mona, du bist endlich einmal woanders! Genieß es einfach.« Sie unterbrach sich für einen Moment, bevor sie fortfuhr. »Aber dass du erst betrunken in den Dorfteich fallen musstest, bevor sie dich mal zu mir lassen, finde ich ganz schön deprimierend.«
Noch einmal nahm Jo Sim fest in den Arm und sie spürte, wie stark ihre Tante war. Peinlich berührt über Jos Offenheit wand Sim sich aus der Umarmung.
»Ich wollte dich schon früher besuchen«, sagte sie. »Aber Paps hat behauptet, du vegetierst in einem Loch, das könne er nicht verantworten.«
Besuchen war wohl nicht das richtige Wort. Ein paar Tage, nachdem Sim vierzehn geworden war (Beginn der Punk-Phase), hatte sie heimlich ihren Rucksack gepackt, fest entschlossen, nach Amerika abzuhauen und von nun an bei ihrer Tante zu leben – frei und ungehindert von den quälenden Einschränkungen der westlichen Zivilisation. Aber ihr Plan war aufgeflogen, bevor sie ihn in die Tat hatte umsetzen können. Um sich größeren Ärger vom Hals zu halten, hatte sie einfach vorgegeben, Sehnsucht nach Tante Jo gehabt zu haben.
»Da ist was dran.« Jo seufzte. »Es hat eine Weile gedauert, bis ich nach der Scheidung wieder auf die Beine kam. Aber jetzt vegetiere ich nicht mehr in einem Loch, wie du siehst. Es war übrigens unser alter Trailer dort drüben, den dein Vater damit meinte. Die Bude ist fünfunddreißig Jahre alt. Dreißig Jahre entsprechen in etwa hundert Trailerjahren.« Ihre Tante zuckte mit den Achseln. »Klaus war schockiert, dass ich so leben konnte.«
»Was meinte er mit so?«
»Ohne Wasser und Strom. Ohne funktionierendes Bad und WC.«
Sim wurde blass und Jo lachte über ihr Gesicht. »Keine Angst, Schätzchen, du wirst allen lebenswichtigen Komfort haben.«
»Kino, Schwimmbad, Eiscafé, Livemusik?«, zählte Sim hoffnungsvoll auf.
Jo wiegte nur lächelnd den Kopf hin und her. Sie schnappte sich Sims Tasche. »Gehen wir nach oben und reden drinnen weiter. Ich mache den Laden dicht und dann gibt es Abendessen.«
3. Kapitel
Lukas bedauerte, dass Jimi die Einladung zum Essen ausgeschlagen hatte. Er mochte Jo und war gerne bei ihr. In ihrem Blockhaus war es gemütlich und sauber (es war das gemütlichste und schönste Haus, in dem er je gewesen war). Er mochte den Geruch von Holz in den Räumen und die Duftexplosion exotischer Gewürze, wenn er den Küchenschrank über dem Herd öffnete. Die Deutsche konnte gut kochen. Sie benutzte die Gewürze für ihre fremdartigen Gerichte, die sich von dem, was Lukas sonst zu essen bekam, wenn er mit Jimi zu Big Bat’s, Subway oder zu Taco Bell ging, ziemlich unterschieden. Ganz zu schweigen vom ewigen Dosenfutter, das ihn zu Hause bei Bernadine erwartete.
Jo hatte einen kleinen Garten hinter dem Haus, in dem sie Gemüse, verschiedene Salatpflanzen, Tomaten und Kräuter anbaute. Den Samen ließ sie sich aus Deutschland schicken und den besten Salat im ganzen Res gab es bei ihr. Genauso wie den besten Kaffee und die köstlichste Schokolade.
Aber Jimi hatte einen Anruf bekommen und musste einer Frau aus Porcupine ein Beutelchen Stachelschweinborsten vorbeibringen, die sie dringend für eine Halskette brauchte – ein Geschenk für eine Namensgebungszeremonie. Das war ein triftiger Grund und Lukas musste ihn akzeptieren.
Zweimal im Monat fuhr Jimi mit Bernadines Sohn Tyrell den weiten Weg bis nach Denver, um dort bei einem Großhändler billig Perlen, Leder, verschiedenfarbige Stoffe, künstliche Sehne und andere Grundmaterialien für kunsthandwerkliche Arbeiten einzukaufen, die Bernadine dann mit einer kleinen Gewinnspanne an die Leute im Reservat weiterverkaufte. Damit machte sie Jo Klinger und ihrem Laden zwar Konkurrenz, aber Jo hatte deswegen nie ein böses Wort verloren. »Leben und leben lassen« war ihre Devise, ganz im Gegensatz zu vielen Einheimischen im Res, die sich gegenseitig nicht das Fleisch in der Suppe gönnten. Die alten Tugenden der Lakota, zu denen neben Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit und Tapferkeit auch Großzügigkeit gehörte, waren im Kampf ums tägliche Überleben verschütt gegangen.
Die besagten Stachelschweinborsten hatte Jimi allerdings nicht vom Großhändler aus Denver, sondern von einem unglücklichen Stachelschwein, das er letzte Woche auf dem Weg nach Pine Ridge über den Haufen gefahren hatte.
Lukas’ Magen knurrte. Seit dem Frühstück hatte er nichts Ordentliches mehr zwischen die Zähne bekommen. Bestimmt hatte Jo etwas Besonderes gekocht für ihre Nichte. Wie gerne würde er jetzt mit Jo und Sim im Blockhaus am Tisch sitzen und ihren Gesprächen lauschen. Wenn Jo Sommergäste hatte, dann erfuhr er jedes Mal etwas Neues aus der Welt, die hinter den Reservatsgrenzen lag. Fremde Länder faszinierten ihn, vielleicht deshalb, weil sie unerreichbar für ihn waren.
Manchmal wechselten Jos Landsleute in seinem Beisein Worte in ihrer Muttersprache. Er mochte den poltrigen, gewittrigen Klang der deutschen Worte. Jimi dagegen behauptete, wenn Deutsche sich unterhielten, würde es immer nach Streit klingen.
Vor allem aber interessierte ihn Sim, die anscheinend nicht freiwillig hier war. Als Jimi seinen Mustang vom Schotterweg auf die Asphaltstraße lenkte, hielt Lukas es nicht länger aus. »Nun erzähl schon, wie sieht sie aus?«
»Keine Ahnung«, antwortete Jimi nach einigem Zögern, »jedenfalls nicht wie ein Mädchen.«
Nicht wie ein Mädchen? »Wie dann?«
»Na ja, eher wie ein komischer Vogel. Sie trägt keine… wie soll ich sagen… üblichen Klamotten.«
»Kannst du ein bisschen ins Detail gehen?« Lukas platzte beinahe vor Neugier. »Wie wär’s, wenn du sie mir einfach beschreibst, ohne deine geschätzte Wertung, bitte.«
Jimi seufzte dramatisch und legte los: »Sie ist ein richtiges Bleichgesicht mit heller Haut, an die vermutlich nie ein Sonnenstrahl gelangt. Gelbgrüne Stachelbeeraugen, so dick mit schwarzer Schminke umrandet, dass sie aussieht wie ein Waschbär. Rot gefärbte Stachelhaare, Storchenbeine und Titten winzig wie Mäusenasen. Ach ja und sie hat da diese hässliche Narbe in der Oberlippe.«
Lukas amüsierte sich über den Zoo in Jimis Beschreibung. Jimi Little Wolf war in den vergangenen Jahren ein Meister der Beobachtungskunst geworden und Lukas wusste das zu schätzen. Durch Jimis Fantasie wurde seine dunkle Welt bunter und größer. Während er ihm die schräge Kleidung von Jos Nichte schilderte und von ihren blauen Fingernägeln erzählte, entstand ein Bild in Lukas’ Kopf, ein Bild von einem bunten, geheimnisvollen Mädchen mit winzigen Brüsten und einer furchtbaren Narbe im Gesicht.
Die meisten Leute glaubten, Lukas könne nicht viel anfangen mit Farben. Aber das war ein Irrtum. Er war nicht von Geburt an blind gewesen – sieben Jahre lang hatte er sehen können. Bis zu dem Unfall, bei dem seine Mutter starb und sein Leben in undurchdringliches Schwarz getaucht wurde. Doch die Farben waren in seinem Kopf. Er kämpfte beharrlich darum, sie nicht an die Dunkelheit zu verlieren. Indem er sie mit Eigenschaften, Gerüchen und Gefühlen verband, versuchte er, sie festzuhalten.
Die Farbe Grün war der Duft frisch geschnittenen Grases, Gelb so gemütlich wie ein Nickerchen am Nachmittag. Weiß war so weich wie der Flaum einer Adlerfeder und Braun der bittersüße Kakaogeschmack von Schokolade. Die Farbe Blau war die Weite des Himmels, Rot bedeutete glühende Hitze und Blut und Hass. Schwarz war so sanft wie die Nüstern eines Pferdes, war die Fülle von schwerem Indianerhaar.


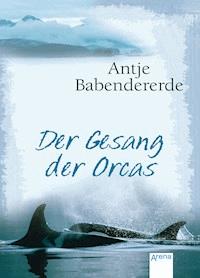
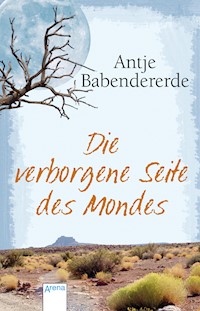

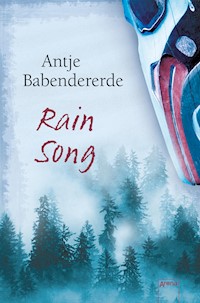

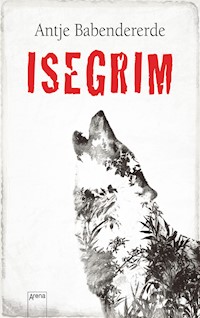

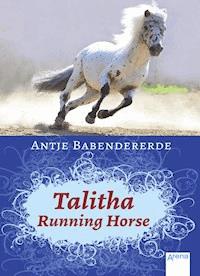

![Triff mich im tiefen Blau [Ungekürzt] - Antje Babendererde - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/75f072b5b02089501721ce263e658ce1/w200_u90.jpg)