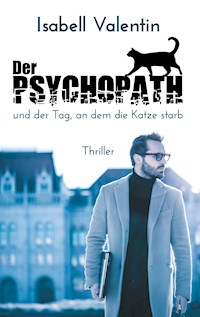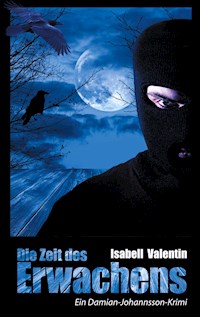Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kain
- Sprache: Deutsch
Seit jeher spürte Kain, dass er anders ist. Seine Augen, die in Momenten des Zorns oder bei flüchtigen Lichtspielen in einem unheimlichen Rot aufglühen, machen ihn zur Zielscheibe von Aberglauben und Furcht. Als der Dämon Barnabas aus der Unterwelt emporsteigt, um Kain sein wahres Erbe zu offenbaren, bricht dessen Welt in tausend Scherben. Er soll der Antichrist sein? Verzweifelt versucht Kain, dieser Bestimmung zu entfliehen. Aber nun, da sein Geheimnis gelüftet ist, wird Kain unbarmherzig von den Rittern des Lichts gejagt, deren Aufgabe es ist, die Herrschaft des Antichristen zu verhindern und ihn zu töten. Kain flieht. Himmel und Hölle auf seinen Fersen. Auf seiner Flucht muss Kain nicht nur um sein Leben kämpfen, sondern auch um seine Identität. Ist es möglich, gegen die Natur des eigenen Blutes aufzubegehren? Oder ist jeder Versuch, dem Bösen zu widerstehen, nur ein weiterer Schritt auf dem Weg in die Finsternis? "Kain: Sohn der Finsternis" ist ein atemberaubender Ritt durch die Grauzone zwischen Gut und Böse. Eine Geschichte über die Macht der Entscheidung und die Frage, ob unser Schicksal in Stein gemeißelt oder durch unsere Taten formbar ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Kinder Hannah, Noah & Ben.Eure Fantasie und euer Licht inspirieren mich jeden Tag.Möget ihr immer den Mut haben, euer eigenes Schicksal zu schreiben.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Prolog
Mit schweren Schritten ging Kain durch die Ruinen der einst so prächtigen Breitsaalkirche. Seine Tränen fielen auf den staubbedeckten Boden, während er die Verwüstung um sich herum kaum wahrnahm. Zerborstene Buntglasfenster warfen ein bunt schillerndes Lichtspiel auf die Trümmer der zersplitterten Kirchenbänke. Doch Kains Blick war starr auf den Altar aus weißem Marmor gerichtet. Dort lag sie, still und reglos, wie eine Skulptur aus Alabaster. Ihre bleiche Haut schimmerte im diffusen Licht, das durch die zerbrochenen Fenster fiel. Ihre leicht geöffneten Lippen schienen noch den letzten Hauch des Lebens festzuhalten.
Kain hob seinen Blick zur gewölbten Decke, wo das goldene Gottessymbol in der stilisierten Sonne thronte. Gerade er hatte wohl von allen Menschen auf dieser Erde das wenigste Recht, zu Gott zu sprechen. Und doch wollte er ihm eine Erklärung abgeben, bevor er endgültig und für alle Ewigkeit von den Feuern der Hölle verschlungen wurde. Und so begann er, mit leiser, brüchiger Stimme, die nichts mehr von seiner Jugend verriet:
„Mein Großvater sagte einmal zu mir: Alles, was du sagst und alles, was du tust, bestimmt, wer du bist. Mit jedem Satz beeinflusst du das Bild, das die Menschen von dir haben. Ein einziges Wort kann dich zum Helden oder zum Feigling machen. Mit jedem Handeln erschaffst du deine Welt neu. Wähle deine Worte und Taten mit Bedacht, denn du wählst damit dein Leben.“
Kain pausierte, seine Augen glitten zu der reglosen Gestalt auf dem Altar.
„Aber was, wenn dir diese Wahl verwehrt bleibt? Was, wenn andere schon das Buch deines Lebens geschrieben haben und du nur noch als Marionette durch die Handlung stolperst?“ Er ballte die Fäuste und sein Atem ging schneller, als er versuchte, die aufsteigende Emotion zu bändigen. „Mein Name ist Kain, und ich hatte keine Wahl!“
Kapitel 1
Pfarrer Liebtreu trat abrupt auf die Bremse seines altgedienten, verrosteten VW Jetta. Der Wagen kam mit einem schlingernden Geräusch zum Stillstand. Seine Hände krampften sich um das Lenkrad, die Knöchel traten weiß hervor. Mit aller Willenskraft gelang es ihm schließlich, seinen Griff zu lockern. Doch sein Blick war unablässig auf das grauenhafte Bild gerichtet, das vor ihm lag. Dies war ein Zeichen. Dessen war er sich gewiss. Ein düsteres Omen. Das Böse hatte in seiner kleinen Gemeinde Einzug gehalten und sie verflucht.
Langsam öffnete er die quietschende Fahrertür und stieg aus seinem Fahrzeug. Er konnte es nicht fassen. Die Straße war übersät mit leblosen Körpern. Hunderte Dohlen lagen reglos auf dem Asphalt. Diese schwarzen Rabenvögel, die normalerweise so lebhaft und gesellig durch die Lüfte flogen, waren vom Himmel gefallen. Einige von ihnen zuckten noch. Vereinzelt hörte der Pfarrer einen kläglichen Schrei, während die hellblauen Augen der Tiere starr vor Angst waren. Und dieses grauenhafte Geräusch, wenn ein weiterer kleiner Körper vom Himmel fiel und ein weiteres Leben abrupt beendet wurde.
„Es ist 22.00 Uhr“, erklang eine angenehme Männerstimme aus den Lautsprechern seines Autos. „Willkommen zu den Schwarzwald Nachrichten mit Kurt Lück. In den US-Bundesstaaten Arkansas, Louisiana, Kentucky und in Schweden ist es erneut zu einem mysteriösen Vogelsterben gekommen. Laut den örtlichen Behörden fielen die Tiere tot vom Himmel. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen erneuten Ausbruch der Vogelgrippe. Die Ursache des massenhaften Vogelsterbens ist jedoch noch unklar."
„Und nun auch hier.“ Pfarrer Liebtreu schauderte. „Doch ich kenne die Ursache. Seit dieses Kind geboren wurde, streckt das Böse seine Hände nach uns aus. Gott steh uns bei.“
Kapitel 2
Kain lehnte mit dem Rücken gegen die kalte Wand des Schulgebäudes. Die schwache Mittagssonne malte sanfte Schatten auf dem Boden. Ein gequälter Schrei ließ ihn zusammenfahren. Sein Blick fiel auf die Gruppe von Elftklässlern, die sich wie Raubtiere um ihr Opfer drängten – Joschi Baumann, ein kleiner Fünftklässler, dessen Augen voller Panik weit aufgerissen waren. Unbarmherzig schubsten die älteren Jungen ihn hin und her, als wäre er ein Spielzeug. Kain seufzte schwer und zwang sich, den Blick auf sein Englischbuch zurückzulenken. Er spürte Verachtung für die Mobber, die einen Schwächeren peinigten, und das zu viert gegen einen. Das war einfach nicht fair! Aber er durfte sich nicht einmischen. Er musste unauffällig bleiben, kein Aufsehen erregen.
Wegen seiner Augen hatte er selbst oft unter solchen Fieslingen gelitten. Am schlimmsten war die Angst. Nicht seine eigene, sondern die, die andere vor ihm hatten, wenn seine Wut entfesselt wurde. Furchtbare Dinge konnten geschehen, wenn er die Kontrolle verlor. Dinge, die ihm entglitten und ihn bereits dreimal dazu gezwungen hatten, die Schule zu wechseln. Er hatte seiner Mutter versprochen, dass so etwas nicht wieder passieren würde und die einzige Chance, dieses Versprechen zu halten, war, sich von jedem Ärger fernzuhalten. Es war auch nicht nur die Schule. In Santasheim, dem Dorf, in dem er mit seiner Mutter lebte, begegnete man ihm mit Furcht und Anfeindungen. Wie oft hatte man ihn hinter vorgehaltener Hand Teufelsbrut oder Dämon genannt, nur wegen seines Aussehens. Keines der anderen Dorfkinder durfte mit ihm spielen. Er musste jeden Sonntag mit seiner Mutter in die Kirche gehen und sich das unsinnige Gebrabbel von Pfarrer Liebtreu anhören, nur um zu beweisen, dass er wie jeder andere, ein Kind Gottes und keine Satansbrut war. Er hasste das! Nein, er durfte nicht eingreifen. Die Situation könnte außer Kontrolle geraten.
„Bitte nicht meinen Rucksack! Ich habe ihn erst geschenkt bekommen. Der war teuer!“, flehte Joschi mit tränenerstickter Stimme.
Kain konnte es hören, ebenso wie das gehässige Lachen der älteren Schüler. Unwillkürlich glitt sein Blick zurück zum Geschehen. Die Elftklässler hatten Joschis Rucksack genommen und warfen ihn mit einem triumphierenden Lächeln in den Müllcontainer.
„Willst du deinen Rucksack zurück?“, höhnte Philipp, der Anführer der Gruppe, ein großer Junge mit scharfen Gesichtszügen. Joschi nickte zaghaft.
Kain schüttelte den Kopf. Wie konnte der Kleine nur so naiv sein? Der Kreis der Mobber zog sich enger um ihr Opfer. Ihre Lippen waren zu einem fiesen Grinsen verzogen. Joschi wimmerte und kauerte sich zusammen, hockte sich einfach auf den Boden und machte sich klein, die Arme fest um seine Beine geschlungen, das Gesicht darin verborgen. Aber Monster verschwanden nicht, nur weil man sie nicht mehr ansah. Das wusste Kain aus Erfahrung. Die Elftklässler packten Joschi, der panisch aufschrie. Sie zerrten ihn zum Müllcontainer.
Kain klappte das Englischbuch mit einem dumpfen Schlag zu und erhob sich langsam. Bedächtig schritt er auf die Gruppe zu. „Lasst ihn in Ruhe.“
Er hatte es nicht geschrien, ja noch nicht einmal mit besonders viel Nachdruck gesagt, und doch brachte es die Angreifer zum Innehalten. Die Gruppe drehte sich um. Kains Herz schlug bis zum Hals, als er spürte, dass die Aufmerksamkeit nun auf ihm lag. „Was hast du gesagt?“, fragte der Anführer und ging auf ihn zu. Kain senkte den Blick und kämpfte gegen die flammende Wut an, die in ihm brodelte. Nichts Gutes konnte daraus entstehen. Erst als er direkt vor den fünf Schülern stand, schaute er wieder auf. „Ich habe gesagt: Lasst Joschi in Ruhe! Es reicht!“
Die Gesichter der Jungen erstarrten und wurden blass, dann verzerrten sie sich vor Entsetzen. Philipps Schrei riss auch die anderen Mobber aus ihrer Schreckensstarre und sie rannten davon. Kain seufzte. Er benötigte keinen Spiegel, um zu wissen, dass seine Augen sich wieder verändert hatten. Sie hatten diesen rötlichen Ton angenommen, so wie sie es immer taten, wenn er wütend war. Er fischte den Schul-Rucksack aus dem Müllcontainer und reichte ihn Joschi. Zitternd starrte der kleinere Junge ihn an. Jeglicher Dank blieb aus, denn der Fünftklässler drehte sich abrupt um und floh.
„Gern geschehen“, brummte Kain und ließ den noch immer ausgestreckten Arm sinken. Mit gerunzelter Stirn betrachtete er Joschis Rucksack, als wäre es dessen Schuld, dass er nun hier alleine stand. Er stellte ihn vor dem Container ab, ging zu seinen eigenen Sachen zurück und packte diese zusammen. Warum hatte er sich auch eingemischt? Er sollte es inzwischen besser wissen. Hoffentlich löste dieser Vorfall nicht wieder eine Welle von Anfeindungen aus.
Kapitel 3
Boris Seltau stand am Rande seiner Weide. Der Nebel hing noch immer schwer über den sanften Hügeln des Schwarzwaldes, obwohl es schon Mittag war. Die Luft war erfüllt vom Duft feuchter Erde und dem metallischen Hauch von Blut. Seine Schafe, sonst so friedlich und gelassen, waren zu einem zitternden, blökenden Knäuel zusammengedrängt. Ihre Augen rollten wild in den Höhlen, blank vor Panik. Sie schienen hin- und hergerissen zwischen dem Drang, bei ihrem Hirten Schutz zu suchen, und dem Instinkt, zu fliehen. Boris konnte es ihnen nicht verübeln. Was auch immer hier geschehen war, es hatte eine Spur des Schreckens hinterlassen.
Mit einem tiefen Seufzer fuhr sich Boris über das wettergegerbte Gesicht. Seine rauen Finger spürten die ungewohnte Feuchtigkeit auf seinen Wangen. Verwundert betrachtete er sie. Er, Boris Seltau, der alte Sturkopf von Santasheim, weinte? Die Leute im Dorf nannten ihn einen „harten Brocken“, und er wusste, dass es nicht immer als Kompliment gemeint war.
Doch der Anblick dieser Tragödie trieb selbst ihm die Tränen in die Augen.
„Entschuldigung, sind Sie Herr Seltau?“ Die Stimme ließ Boris herumfahren. Sein Blick fiel auf einen jungen Mann, der wie ein Fremdkörper in der rauen Landschaft wirkte. Teure Stadtkleider, perfekt frisiertes Haar. Boris unterdrückte ein Stöhnen. Das Landesumweltamt hatte ihm einen Sesselfurzer geschickt, einen Bürokraten, der wahrscheinlich noch nie Dreck an den Schuhen gehabt hatte. Vermutlich hatte er genauso viel Ideologie im Hirn wie Gel auf den Haaren. Jemand, der ihm erklären würde, dass der Wolf ein höchst missverstandenes Tier sei. Wir müssen nur lernen, im Einklang mit ihm zu leben. Den Zahn würde er ihm gleich ziehen!
„Ja, der bin ich“, brummte Boris.
„Ich bin hier, um die Situation zu bewerten, Herr Seltau. Wir sollten uns die Schäden ansehen.“
Boris schnaubte. „Die Schäden, hm? Sie sprechen wohl von dem Massaker an meinen geliebten Schafen. Kommen Sie mit. Ihre feinen Schuhe werden Sie sich wohl ruinieren“, raunzte er den Jüngling an. Er öffnete das quietschende Gatter und wartete ungeduldig, bis der Beamte zögernd die Weide betrat. Sorgfältig verschloss Boris das Tor wieder. Das Letzte, was er jetzt brauchte, war eine Herde panischer Schafe, denen er durch den halben Schwarzwald hinterherjagen musste.
Der junge Mann blickte entsetzt auf seine einst makellosen Lederschuhe, die nun im schlammigen Boden versanken. Boris konnte sich ein schadenfrohes Grinsen nicht verkneifen.
„Hat letzte Nacht ordentlich geschüttet“, erklärte er, während er in seinen robusten Gummistiefeln voran stapfte. „Der Lehmboden hier hält die Nässe wie ein Schwamm.“
Doch jede Spur von Humor verschwand aus Boris’ Gesicht, als sie nur wenige Meter weiter auf das erste Opfer stießen. Sein Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Das einst prächtige Schaf lag leblos im blutgetränkten Gras, sein Körper nicht einfach nur getötet, sondern regelrecht zerfetzt. „Mein Gott“, murmelte er, die Stimme kaum mehr als ein Flüstern. „Was
war das nur für eine Bestie?“ Boris spürte, wie sich seine Nackenhaare aufstellten. Nervös sah er zum Waldrand hinüber. Wer wusste schon, was sich hinter dieser dunklen Wand aus Tannen verbarg? Er fühlte sich beobachtet. Um dieses Gefühl abzuschütteln, ging er zum nächsten gerissenen Schaf. Hinter ihm kämpfte der junge Mann vom Landesumweltamt mit jedem Schritt gegen den schlammigen Boden an. Seine einst blitzblank polierten Lederschuhe waren längst zu unförmigen, braunen Klumpen verkommen.
„Das ist schrecklich“, hauchte der Beamte, als sie auf die nächsten Opfer stießen. Fünf weitere Schafe lagen leblos im Gras, ihre weißen Felle blutgetränkt und zerfetzt. Boris knirschte mit den Zähnen, seine schwieligen Hände ballten sich zu Fäusten. „Das war kein gewöhnlicher Angriff“, murmelte er, während er sich zu einem der Schafe hinunterbeugte. Eine tiefe Wunde klaffte an seiner Flanke. „Die Wölfe müssen in einen Blutrausch verfallen sein. Sehen Sie sich das an“, forderte Boris den Beamten auf, „Diese Bisse …“
Der junge Mann räusperte sich nervös. „Nun, Herr Seltau, wir müssen vorsichtig mit voreiligen Schlüssen sein. Das müssen keine Wölfe gewesen sein. Es könnte sich auch um eine Meute verwilderter Hunde handeln. Wir werden DNA-Proben nehmen müssen, um …“
„DNA-Proben?“, unterbrach Boris ihn barsch. Seine Augen funkelten vor unterdrücktem Zorn. „Meine Tiere wurden regelrecht massakriert, und Sie wollen mir mit Bürokratie kommen?“
Plötzlich hielt er inne. Sein scharfer Blick hatte etwas an einem der toten Schafe entdeckt. Er ging in die Hocke, ignorierte das Blut, das seine Hose durchtränkte. „Kommen Sie her“, befahl er dem Beamten, „und sehen Sie sich das an.“
Am Huf des Schafes klebte Blut, vermischt mit schwarzen Fellbüscheln. Sein Herz schlug schneller. „Das Schaf hat sich gewehrt. Hat seinen Angreifer erwischt.“
Der Beamte beugte sich vor, zog ein Probenbehältnis aus seiner Tasche. Mit zitternden Händen nahm er eine Probe. „Das … das dürfte für die DNA-Analyse reichen“, murmelte er.
Plötzlich hielt er inne, seine Nase kräuselte sich. „Das ist seltsam“, sagte er verwirrt und schnupperte an dem Behältnis.
„Es riecht nach … Schwefel? Das verstehe ich nicht.“
Boris spürte, wie sich eine eisige Faust um sein Herz legte. Seine schlimmsten Befürchtungen schienen sich zu bewahrheiten. Wenn sein Verdacht zutraf, würde er keinen Cent Entschädigung für seine gerissenen Schafe sehen. Denn kein Versicherer, kein Amt würde ihm abnehmen, was er zu wissen glaubte: Es waren weder Wölfe noch Hunde, die seine Schafe getötet hatten. Es war schlimmer: Geschöpfe der Hölle waren über seine Herde hergefallen! Geschöpfe, die wegen des Jungen bis zu ihrem Dorf vorgedrungen waren.
Sein Blick wanderte wieder nervös zum Waldrand. Der Wind, der über die Weide fegte, trug ein fernes, unheimliches Heulen mit sich. Boris und der Beamte tauschten einen Blick aus.
„Herr Seltau“, flüsterte der junge Mann, seine vorherige Arroganz wie weggeblasen, „Wir sollten gehen! Ich habe, was ich benötige.“
Boris nickte, während er den Horizont absuchte. „Sie werden vom Ergebnis Ihrer Untersuchung überrascht sein. Wenn ich recht habe, dann hat etwas die Schafe gerissen, das Ihre Wissenschaft nicht erklären kann. Und wenn wir nicht schnell handeln, wird es nicht bei meinen Schafen bleiben.“
Der Beamte sah ihn verwundert an. „Was meinen Sie?“ Seltau schüttelte den Kopf und stapfte davon. „Es ist das Böse“, murmelte er leise vor sich hin. „Das Böse hat in Santasheim Einzug gehalten.“
Kapitel 4
Der Bus nach Santasheim ruckelte über die holprige Landstraße. Kain starrte gedankenverloren aus dem Fenster. Die letzten Häuser hatten sie bereits hinter sich gelassen. Nun zogen Wiesen und Felder an ihnen vorbei. Für einen kurzen Moment vergaß er all seine Sorgen und lauschte dem einschläfernden, dunklen Brummen des Busses.
Ein leises Tuscheln hinter ihm durchbrach die Monotonie. Kain spitzte die Ohren. Hatte er gerade seinen Namen gehört? Er drehte sich langsam um und erstarrte. Dort saßen einige Jugendliche aus seiner Schule – unter ihnen Philipp, der Anführer jener Gruppe, die den kleinen Joschi so grausam schikaniert hatte.
Philipps Augen funkelten boshaft, als sich ihre Blicke trafen. Ein hämisches Grinsen umspielte seine Lippen. Kain schluckte hart. Philipp kam ebenfalls aus Santasheim. Was, wenn er zu Hause angerufen und von dem Vorfall mit Kains roten Augen erzählt hatte? In dem kleinen Dorf wurde er immer wieder zum Ziel von Anfeindungen und musste sich jeden Schritt und jedes Wort genau überlegen, um ja kein Missfallen zu erregen.
Als der Bus in Santasheim hielt, stieg er mit zitternden Knien aus. Philipp trat hinter ihm aus dem Bus, der seine Türen schloss und davonfuhr. Kain warf einen nervösen Blick über die Schulter und entfernte sich zügig von dem anderen Jungen. Doch Philipp hielt sein Handy triumphierend in die Höhe, lachte heiser und rief: „Heute bist du dran! Heute jagen wir den Dämon zurück in die Hölle.“
Die Worte trafen Kain wie ein Schlag. Panik wallte in ihm auf. War etwas gegen ihn geplant? Er vergaß seinen Stolz und hetzte mit hämmerndem Herzen die Dorfstraße entlang. Er musste so schnell wie möglich nach Hause. In jedem Schatten vermutete er einen Angreifer, jedes Geräusch ließ ihn zusammenzucken. An der nächsten Ecke blieb er wie angewurzelt stehen.
Vor ihm stand eine Gruppe Dorfbewohner und versperrte ihm den Durchgang. Ihre Gesichter waren zu hasserfüllten Fratzen verzerrt. In ihren Händen blitzten Baseballschläger, Messer, Beile und Mistgabeln im Licht der untergehenden Sonne. Er kannte diese Menschen. Sie waren seine Nachbarn. Er kannte sie von den Dorffesten, aus dem kleinen Tante-Emma-Laden oder aus den Gottesdiensten. Und sie kannten ihn, seit er auf der Welt war. Sie sollten es doch besser wissen!
„Da ist er!“, brüllte jemand.
Kain wirbelte herum und rannte durch die engen Gassen von Santasheim. Immer wieder glaubte er, etwas Abstand gewonnen zu haben, nur um hinter der nächsten Biegung auf neue Verfolger zu stoßen.
„Fangt ihn“, „Schnappt ihn euch“, „Tötet den Dämon“, tönte es hinter ihm her. Kain verlor seinen Rucksack. Es war ihm egal. Seine Beine schmerzten, seine Lunge brannte. Er holte alles aus seinem Körper heraus.
So wurde er hin und her gehetzt, bis ihn die Kräfte verließen. Er taumelte mehr, als er rannte. Er kletterte durch ein kleines Loch in einem Zaun. Dutzende Hände griffen nach ihm.
„Dämon. Du bist verantwortlich für den Fluch, der auf unserem Dorf liegt.“
Er schrie auf, riss sich los und lief weiter. Seine Verfolger hatten es schwerer, über den Zaun zu kommen. Sein keuchender Atem war so laut, dass er seine eigenen Gedanken kaum mehr hören konnte. Wohin sollte er fliehen? Wem konnte er noch vertrauen? Kain stolperte, fing sich im letzten Moment mit einigen großen Schritten wieder auf und lief weiter. Er musste vor sich schauen. Wenn er hinfiel, war alles aus. In seinen Seiten stach es entsetzlich. Er versuchte, es zu ignorieren.
Die Kirche. Groß und stolz ragte sie vor ihm empor. Sollte er dort Zuflucht suchen? Ein Messer sauste knapp an seinem Ohr vorbei und blieb im Stamm einer Tanne stecken. Er hatte keine Wahl. Bald hatten sie ihn.
Seine einzige Hoffnung war der abergläubische, verbohrte Pfarrer Liebtreu. Würde ausgerechnet er ihm helfen? Was, wenn der Pfarrer selbst diese Hetzjagd angezettelt hatte? Dann war er verloren.
Mit letzter Kraft sprintete Kain auf das massive Holzportal zu. Hinter sich hörte er das Johlen und Schreien der Meute, die immer näher kam. Er rannte zur großen Eingangstür, zog daran, rüttelte, aber das widerstandsfähige Holz gab keinen Zentimeter nach. „Nein!“, entfuhr es ihm in einem verzweifelten Aufschrei.
Entsetzt drehte er sich um. Die Ersten hatten ihn erreicht. Bauer Heinrich, ein stämmiger Mann mit rotem Gesicht und einer Mistgabel in der Hand, stürmte mit grimmigem Blick auf ihn zu. Kain warf sich in letzter Sekunde zur Seite, sein Herz schlug wild in seiner Brust. Die Gabel bohrte sich mit einem dumpfen, splitternden Krachen in die Kirchentür und blieb zitternd stecken. Neben Bauer Heinrich stand Boris Seltau. Kain duckte sich unter seinen Armen hindurch und erreichte die Seitentür. Er drückte den Griff hinunter, zog daran.
Quietschend öffnete sie sich. Aus den Augenwinkeln sah Kain etwas auf sich zu rasen. Automatisch duckte er sich. Ein schwerer Holzknüppel, von der Dicke eines Oberschenkels, traf die geöffnete Tür oberhalb seines Kopfes. Kain rannte in die Kirche, zog die beschädigte Tür hinter sich zu.
„Pfarrer Liebtreu!“, rief er verzweifelt. „Bitte helfen Sie mir!“ Doch nur das Echo seiner eigenen Stimme antwortete ihm.
Die Tür wurde wieder aufgerissen. Kains einzige Hoffnung, im geweihten Raum der Kirche einen gewissen Schutz zu finden, wurde zerstört, als die wütende Gruppe in das Gebäude stürmte. Es wurden immer mehr, die langsam durch die Eingangstür der Kirche traten. Sie hatten keine Eile mehr. Es gab kein Entkommen für Kain.
„Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch doch nichts getan!“, schrie er. Rückwärts wich er immer weiter ins Innere der Kirche zurück. Stolperte über eine Fußbank. Entfernte sich kriechend von der aufgebrachten Menge. Er zitterte so sehr. Auch wenn er die Kraft dazu gehabt hätte, wusste er nicht, ob er mit diesen wackligen Knien noch einmal aufstehen konnte.
„Nein, bitte … ich bin kein Dämon. Ich bin ein normaler Junge“, flehte Kain. Er sah in die Gesichter seiner Verfolger. Was hatte er denn jemals verbrochen, um diesen Hass zu verdienen?
„Pfarrer Liebtreu!“, schrie Kain erneut. Tränen rannen über seine Wangen.
Der Pfarrer trat aus dem Schatten, sein Gesicht maskenhaft starr und bleich. „Kain …“, begann er zögernd. „Was hast du getan?“
„Nichts!“, schluchzte Kain. „Bitte, Sie müssen mir glauben! Sie wollen mich töten!“
Der Pfarrer zögerte, sein Blick flackerte zwischen Kain und der wütenden Meute hin und her. Die Sekunden dehnten sich zu einer Ewigkeit.
„Wir haben das Böse von dem Sie immer predigen, den Dämon, Herr Pfarrer. Kain Schwarz ist es. Und nun werden wir Santasheim endgültig von diesem Fluch befreien“, sagte Boris Seltau. Er hob seinen Knüppel und ging auf Kain zu.
Dieser schrie entsetzt auf, robbte sich zu Pfarrer Liebtreu und griff verzweifelt nach dem Saum seiner Soutane. Flehend blickte er in die Augen des Geistlichen.
„Helfen Sie mir bitte …“, seine Worte wurden immer leiser, immer unverständlicher, unter dem heftigen Schluchzen.
„Nein … nicht in dieser Kirche. Hier wird kein Blut vergossen“, sagte Pfarrer Liebtreu schwach.
„Gut.“ Herr Seltau, der die Sprecherrolle des Mobs übernommen hatte, nickte. „Schaffen wir ihn nach draußen.“ Er packte den schreienden Jungen unter seinen Arm, um ihn aus der Kirche zu tragen. Kain klammerte sich mit seiner letzten Kraft an die Soutane des Pfarrers. Draußen kam quietschend ein Wagen zum Stehen. Die hysterische Stimme seiner Mutter, Marianne Schwarz, drang in das Gotteshaus. Sie rief verzweifelt nach ihm. Verlangte durchgelassen zu werden.
„Nein, wartet“, sagte der Pfarrer zu der Menschenmenge. „Was, wenn ihr euch irrt? Was, wenn der Junge kein Dämon ist? Dann klebt das Blut eines unschuldigen Kindes an unseren Händen. Und dann … dann sind wir wahrlich verloren.“
Die Menge verharrte, blickte sich unsicher an.
„Aber Herr Pfarrer, Sie sagten doch, dass es an uns liegt. Dass wir etwas unternehmen müssten“, beharrte Seltau. „Ja, aber nicht so. Ihr könntet euch irren.“
„Er hat rote Augen. Wie deutlich soll es denn noch sein. Jeden Sonntag predigen Sie uns, dass es an uns liegt, den Fluch zu brechen. Also lasst ihn uns brechen!“, rief Seltau in die Menge, die zustimmend jubelte.
„Nein. Nicht meinen Kain!“ Seine Mutter hatte sich bis zu ihnen durchgekämpft.
„Boris, was machst du da? Lass mein Kind los, ich bitte dich. Er hat doch nichts getan!“
In Boris Seltaus Gesicht zeigte sich kurz ein Hauch von Unsicherheit, dann verhärteten sich seine Züge wieder. „Heute, im Morgengrauen, wurden sechs meiner Schafe gerissen, ach was sag’ ich, zerfetzt. Eines meiner Schafe hat seinen Angreifer mit dem Huf verletzt. Das Blut der Bestie roch nach Schwefel! Kain ist ein Dämon, Marianne. Dein Mann hat es gewusst. Deshalb wollte er den Jungen schon mit drei Jahren umbringen. Du hättest ihn machen lassen sollen. Dann wäre das Böse nicht in unser Dorf eingefallen und uns allen eine Menge Leid erspart geblieben.“
„Mein Mann war psychisch krank. Er hatte Wahnvorstellungen. Wäre er in jener Nacht nicht ums Leben gekommen, dann hätten sie ihn für immer in eine geschlossene Anstalt geschickt. Und da werden sie euch auch hinschicken, wenn ihr mein Kind umbringt. Euch alle!“, schrie seine Mutter. Bei ihren letzten Worten sah sie Pfarrer Liebtreu an.
Gemurmel erhob sich. Der Pfarrer knetete seine Hände, sah von einem zum anderen. Kain sah die Entschlossenheit bröckeln und seine Mutter redete fieberhaft weiter.
„Ihr veranstaltet eine Hetzjagd auf einen unschuldigen Jungen, nur weil seine Augen fremdartig aussehen. Wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. Er war heute Morgen in der Schule. Er hat keine Höllenmonster heraufbeschworen, die Schafe reißen. Das waren wahrscheinlich ganz gewöhnliche Hunde oder Wölfe.“
„Schwefel! Das Blut roch nach Schwefel. Und heute Mittag wurden Philipp und seine Freunde in der Schule von deinem Sohn terrorisiert. Dabei haben seine Augen wieder dämonisch rot geleuchtet. Sei nicht so blind, Marianne. Er ist böse!“
„Ich bitte euch, gebraucht euren gesunden Menschenverstand!“, schrie seine Mutter.
Wieder Gemurmel. Aber die gewünschte Wirkung blieb aus.
„Was werden die anderen von euch halten, eure Familien, eure Freunde und Bekannte, wenn ihr für einen gemeinschaftlichen Mord angeklagt werdet. Das geht mit Sicherheit durch alle Zeitungen des Landes, wenn nicht sogar noch weiter. Denkt mal nach, was ihr damit euren Familien antut. Eurem Ruf!“
In einer so kleinen Gemeinde war jeder auf seinen Ruf bedacht. Das Leben war viel öffentlicher, als in der großen Stadt. Niemand wollte unangenehm auffallen. Eine betretene Stille legte sich über die Menge.
„Setz den Jungen ab, Boris“, sagte Liebtreu. „Aber Herr Pfarrer. Sie sagten doch …“, stammelte Seltau. Doch Pfarrer Liebtreu schüttelte vehement den Kopf. „Nichts dergleichen habe ich gesagt. Ich habe mit alldem nichts zu tun. Diesen Mob habt ihr ohne mein Wissen und ohne meine Zustimmung gebildet. Nun beendet die Sache. Noch ist nichts passiert.“
Seltau blickte sich unsicher um. Immer mehr Menschen verließen das Kirchengebäude. Die Gruppe löste sich auf. Widerstrebend setzte er den Jungen ab. Kain flüchtete sich sogleich in die Arme seiner Mutter.
„Wie Sie denn meinen, Herr Pfarrer“, murmelte Seltau, bevor auch er ging.
Kapitel 5
Die majestätischen Türme des Kölner Doms ragten in den grauen Himmel empor, während Pfarrer Liebtreu und Pater Giorgio Mancini eilig durch das angrenzende Domforum schritten, direkt gegenüber dem Westportal des Doms. Im Inneren des Forums dominieren die hellen Betonsteinplatten, die trotz der 300.000 Menschen, die jährlich über sie gingen, noch die edle, granitähnliche Optik aufwiesen. Sie bildeten einen einladenden Kontrast zu den riesigen Glasflächen, die in ein rautenförmiges, metallisches Netz eingefasst waren und das Erdgeschoss auf ganzer Höhe bedeckten. Die hohen Decken, offenen Räume und ein quadratischer Lichthof, der alle fünf Stockwerke erhellt, vermitteln ein Gefühl von Weite und Transparenz. Doch für diese architektonischen Besonderheiten hatten die zwei Besucher kein Auge.
Die schwarze Soutane von Pfarrer Liebtreu wogte hinter ihm, als er durch das Gebäude stürmte. Seine entschlossenen Schritte hallten wie Schüsse auf dem steinernen Boden, begleitet von den schnell trippelnden Schritten seines Freundes, Pater Giorgio Mancini.
„Nun halte doch einen Moment inne, amico mio. Was du hier vorhast, wird deine Reputation zerstören, sie wird dich zerstören, per l’amor di Dio!“, rief Mancini.
Liebtreu schnaubte. „Das ist mir gleich! Es geht hier um sehr viel mehr als meine Reputation. Ich muss das Böse aufhalten, bevor es zu spät ist. Verstehst du denn nicht. Ich kann dem nicht länger alleine entgegentreten. Ich benötige Hilfe.“ Abrupt blieb er stehen. „Ich bin zu schwach. Womöglich hatte ich die Möglichkeit, das Böse zu vernichten … ach was sage ich da … ich hätte einfach nur zulassen müssen, dass das Böse vernichtet wird, aber ich bekam Zweifel. Ich war mir nicht sicher. Und wenn ich mich geirrt hätte … die Konsequenzen wären fürchterlich gewesen. Nein, ich brauche Hilfe!“ Wieder setzte er sich in Bewegung, schritt entschlossen durch die Einrichtung des Gesamtverbands der katholischen Kirchengemeinde. Sie bogen um eine Ecke. Pfarrer Liebtreu ging zielstrebig auf die große Tür zu, hinter der eine Delegation von Bischöfen und Kardinälen tagte. Ein junger Priester, der an einem Schreibtisch neben der Tür sass, sprang auf und stellte sich ihnen in den Weg.
„Entschuldigen Sie. Dies ist eine geschlossene Gesellschaft. Sie können hier nicht rein.“ Seine Stimme war leise. Er brauchte nicht laut zu sein. Seine stattliche Größe und breite Schultern vermittelten mehr als deutlich seine Entschlossenheit.
„Mein Name ist Liebtreu. Ich bin der Gemeindepfarrer von Santasheim im Schwarzwald. Ich habe mein Kommen per Mail angekündigt.“
Die Mundwinkel des Hünen zuckten unwillig nach unten. „Ja, ich erinnere mich. Ihre Bitte um Anhörung wurde abgelehnt. Ebenfalls per Mail. Also, bitte gehen Sie!“
„Was ich zu sagen habe, ist von ungeheurer Dringlichkeit. Es geht um nicht weniger als um das ewig Böse, das in unsere Welt gekommen ist. Wir müssen uns dem mit unserem ganzen Glauben entgegenstellen, bevor es zu spät ist.“
„Dann haben Sie gewiss Ihren Bericht Kardinal Hoffmann schriftlich zukommen lassen. Er wird sich zur gegebener Zeit bei Ihnen melden.“
„Aber …“, Liebtreu hielt inne. Es hatte keinen Zweck. Sein junger Kollege würde ihn niemals durchlassen. Seine Schultern sackten nach vorn. „Nun gut“, flüsterte er und senkte seinen Kopf. Ergeben drehte er sich um und entfernte sich langsam. Pater Mancini setzte zu ein paar tröstenden Worten an, doch Liebtreu hob abwehrend die Hand. Er musste auf jedes Geräusch lauschen. Da war es! Der Klang von den Schritten des Hünen. Er ging zu seinem Schreibtisch zurück. Jetzt hörte er das Kratzen des Stuhls auf dem steinernen Boden. Liebtreu wirbelte herum und rannte wieder auf die Tür zu. Den wütenden Protestschrei des Priesters ignorierend, riss er die schwere Flügeltür auf und stürmte in den Raum. Erstaunte und schockierte Gesichter blickten ihm entgegen.
„Sie müssen mich anhören! Mein Name ist Pfarrer Elmond Liebtreu. In meiner Gemeinde befindet sich ein kleiner Ort namens Santasheim. Dieses kleine Dorf wird von dunklen Mächten bedroht.“
Eine schwere Hand legte sich auf seine Schultern. „Ich bitte um Verzeihung, meine Exzellenzen und Eminenzen. Ich habe diesem Herrn bereits deutlich gemacht, dass er keinen Zutritt hat. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass er mich überrumpelt hat.“ Die kräftigen Finger bohrten sich schmerzhaft in Liebtreus Schulter. „Abmarsch – und zwar flott!“, knurrte der Hüne in sein Ohr.
Kardinal Hoffmann erhob sich. „Sie wurden von diesem Mann überrumpelt?“, fragte er spöttisch und sah zwischen dem großen Mann und der dürren, alten Gestalt von Liebtreu hin und her. „Ich habe Ihre Fähigkeiten wohl überschätzt“, fügte er hinzu. Liebtreu spürte, wie der Priester zusammenzuckte, als ob er geschlagen worden wäre. Fast tat ihm sein junger Kollege leid, der mit gesenktem Kopf dastand. Doch er musste sein Anliegen vorbringen, solange er noch die Möglichkeit dazu hatte. Aus den Augenwinkeln bemerkte er seinen Freund Pater Mancini, der sichtlich nervös von einem Fuß auf den anderen trat.
„Das uralte Böse hat sich in Santasheim eingenistet. Zahlreiche Omen deuten darauf hin. Tote Vögel, die massenhaft vom Himmel fallen, unerklärliche Tode …“
„Pfarrer Liebtreu, ich habe Ihre Berichte gelesen, die mit regelmäßiger Beharrlichkeit bei mir eintrudeln, und Sie kennen meine Meinung dazu.“ Der Kardinal wandte sich seinen Kollegen zu und schüttelte abwertend den Kopf.
„Dann müssen Sie Ihre Meinung überdenken! Erst gestern wurden sechs Schafe auf einer Weide gerissen, von Bestien, deren Blut nach Schwefel roch! Wir sind die Kirche, die Verfechter des Glaubens. Wer, wenn nicht wir, soll sich dem Bösen entgegenstellen, das in den Schatten lauert und das Leben Unschuldiger bedroht. Mit jedem Tag, an dem wir nichts dagegen unternehmen, wächst seine Macht.“
Kardinal Hoffmann schlug seine Hände auf den Tisch. Etliche Gläser klirrten durch die Wucht der Erschütterung. „Schluss jetzt!“, schrie er. „Es ist genug! Höfliche Worte finden bei Ihnen offensichtlich kein Gehör. Genauso wie die vielen … wirklich vielen ablehnenden E-Mails, die ich Ihnen schon geschickt habe. So lassen Sie es mich ganz deutlich ausdrücken: Ich halte
Sie für gefährlich, Liebtreu. Sie und Ihr religiöser Fanatismus. In welchem Jahrhundert leben wir denn hier? Sie reden davon, die Menschen zu beschützen, doch Sie sind es, von dem die Gefahr ausgeht. Sind durch Ihre Hetze nicht beinahe ein Junge und seine Mutter zu Schaden gekommen? Erst letzte Woche?
Ja, ich habe davon gehört. Der Junge wurde von einem wütenden Mob fast umgebracht! Von Menschen, die Sie gegen diesen Jugendlichen aufgehetzt haben.“
„Dieser Jugendliche ist das Böse!“, hielt Liebtreu lautstark entgegen.
„So ein Unsinn! Was hat der Junge jemals getan …?“
Der Kardinal unterbrach sich mitten im Satz, als sein Kollege neben ihm aufstand. Bedächtig faltete der Mann seine Hände hinter dem Rücken und umrundete den Tisch, bis er direkt vor Liebtreu stand. Er schien viel zu jung für eine solche Position zu sein und doch verfolgten die anderen Würdenträger jeden seiner Schritte mit gespannter, ehrfürchtiger Stille. „Nun denn, erzählen Sie mir von diesem Jungen“, forderte er Liebtreu auf.
Der Pfarrer schluckte. „Sein Name ist Kain. Kain Schwarz. Er kam an einem 6. Juni um 6 Uhr auf die Welt.“
„6.6., um 6 Uhr. Dreimal die Sechs. Die Zahl des Teufels“, murmelte der junge Kardinal.
„Ich bitte Sie, Kardinal Michael. Tausende andere Menschen sind zu einem solchen Zeitpunkt auf die Welt gekommen. Sie sollten Liebtreu nicht noch in seinen Wahnvorstellungen bestärken“, warf Kardinal Hoffmann ein.
Der Kardinal namens Michael brachte ihn mit einem einzigen Blick zum Schweigen. Liebtreu fragte sich, wer dieser Mann war, der solchen Respekt innehatte. Das Erste, was bei ihm auffiel, waren seine langen, dunkelbraunen Haare, die ihm bis zu seinem Kardinalsgürtel reichten und seine Missbildung, ein großer Buckel, den auch das Kardinalsgewandt und die Haare nicht verbergen konnte. Dennoch stand er nicht vorn-übergebeugt, sondern kerzengerade vor Liebtreu. „Was ist Ihnen noch aufgefallen, Herr Pfarrer?“
„Bei seiner Taufe … als das Taufwasser über seinen Kopf floss, färbten sich seine Augen rot, als würde das Feuer der Hölle in ihnen wüten und er schrie aus Leibeskräften. In diesem Moment ahnte ich, dass dieses Kind von bösen Mächten besessen war. Stumm, aber inbrünstig betete ich zu Gott, dass er das Böse aus diesem Kind treiben solle. Laut betete ich mehrmals das Vater-unser, betete zum Erzengel Michael, dass er dieses arme Kind vom Bösen befreie und machte großzügig vom geweihten Wasser Gebrauch. Ich gebe zu, ich versuchte, durch Exorzismus dieses arme Kind zu befreien, ohne zu wissen, dass es nicht vom Bösen besessen, sondern das Böse persönlich war.“
Kardinal Hoffmanns Augen verengten sich zu Schlitzen. „Ein Exorzismus darf nicht auf eigene Faust und nach eigenem Ermessen durchgeführt werden. Dafür gibt es strenge Regeln, die unbedingt eingehalten werden müssen. Schon seit 1999 ist es verpflichtend, dass eine medizinische Untersuchung im Vorfeld eines Exorzismus vorgenommen wird. Wir wollen keinen zweiten Anneliese-Michel-Fall, bei dem ein Mensch stirbt und wir vor Gericht stehen.“
„Nein, so war es nicht!“, fiel ihm Liebtreu ins Wort. „Ich bin sehr behutsam vorgegangen. Ich wollte auch die Eltern und die Gemeinde nicht allzu sehr verstören und ich dachte, ein Dämon in einem Säugling könne kaum sehr mächtig sein.“
Kardinal Hoffmann ignorierte Liebtreus Worte und sprach unbeeindruckt weiter: „Auch muss der Exorzismus von dem Diözesanbischof genehmigt werden. Dieser ruft einen speziell ausgebildeten Exorzisten herbei. Das ist auch nichts, was man eben mal so alleine macht. Ein großer Exorzismus wird grundsätzlich von zwei Geistlichen durchgeführt.“
„Es war nur ein Kleiner“, rechtfertigte sich Liebtreu. Ohne noch einmal das Wort zu ergreifen, drehte sich Kardinal Michael um und verließ den Raum.
Besiegt, aber nicht entmutigt, unternahm Liebtreu einen letzten Versuch, die anderen Würdenträger zu überzeugen, bevor ihn das subtile Kopfschütteln seines Freundes stoppte. Er wusste, dass er sein Glück bereits zu weit getrieben hatte. Schweren Herzens verließ er das Gebäude und hob seinen Blick zu den zwei markanten Türmen der Kirche. Der imposante gotische Bau des Doms mit seinen filigranen Spitzbögen und kunstvollen Steinfiguren zog ihn jedes Mal wieder in seinen Bann. Fast glaubte er, die göttliche Präsenz hier spüren zu können. Er wendete sich zu Pater Mancini. „Danke, dass du an meiner Seite warst, als ich mein Anliegen vorgetragen habe. Dieses Wagnis wären wohl nicht viele eingegangen. Du bist ein wahrer Freund, Giorgio.“
Giorgio Mancini nickte mit traurigen, braunen Augen und heruntergezogenen Mundwinkeln. „Was wirst du jetzt tun?“
Liebtreu schüttelte den Kopf. „Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt in den Dom gehen und beten. Möglicherweise weist mir dort eine Eingebung den richtigen Weg.“
„Soll ich dich begleiten?“
„Nein, nicht nötig. Ich wäre jetzt offen gestanden ganz gerne ein wenig alleine.“
„Also gut, amico mio. Pass auf dich auf. Gott sei mit dir!“, verabschiedete sich Mancini.
„Und mit dir“, erwiderte Liebtreu.
Die gewaltigen Portale des Kölner Doms schwangen auf und Pfarrer Liebtreu trat ein. Sein Herz fühlte sich so schwer an, wie die jahrhundertealten Steine, die sich über ihm zu schwindelerregenden Höhen auftürmten. Er versuchte, die Touristen
auszublenden, als er langsam durch das Mittelschiff ging. Seine Schritte auf dem abgenutzten Marmorboden hallten wie ein leiser Herzschlag in der Ehrfurcht gebietenden Stille.
Er ließ sich in eine der vorderen Eichenholzbänke sinken. Das alte Holz ächzte leise unter seinem Gewicht. Die Last seiner Verantwortung drückte ihn nieder, schien ihn förmlich in den Boden pressen zu wollen. Seine Augen wanderten über die majestätischen gotischen Bögen, die sich wie steinerne Äste eines himmlischen Waldes über ihm verzweigten.
„Ist dies eine Prüfung, Herr?“, flüsterte er, seine Stimme kaum mehr als ein Hauch in der gewaltigen Kathedrale.
Plötzlich brachen die lange zurückgehaltenen Emotionen aus ihm hervor. Heiße Tränen rannen über seine Wangen, tropften auf seine gefalteten Hände. „Ich fürchte, dann versage ich
kläglich“, schluchzte er leise. „Ich benötige deine Hilfe, Herr. Bitte, ich weiß nicht weiter. Wie kann ich meine Gemeinde vor dem Bösen schützen?“
Sein Blick hob sich zum imposanten Hochaltar, ein Meisterwerk aus schwarzem Marmor. Die weißen Figuren der Propheten, Apostel und Heiligen, die in ihren steinernen Nischen der Marienkrönung beiwohnten, schienen auf ihn herabzublicken. Ihre ausdruckslosen Gesichter, von Jahrhunderten gezeichnet, boten keinen Trost. Keiner konnte ihm eine Antwort geben.
Kapitel 6
Kain saß mit seiner Mutter am robusten Esstisch aus altem Eichenholz, jeder in seine Arbeit vertieft. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee zog durch den Raum. Seine Finger tippten nervös auf dem Touchscreen seines Schul-Tablets, während er versuchte, sich auf seine Hausaufgaben zu konzentrieren.
„Lässt dich dieser Philipp in der Schule in Ruhe?“, fragte ihn seine Mutter, während ihre Finger flink über die Tastatur ihres Laptops flogen.
Kain schreckte aus seinen Überlegungen hoch und verfluchte sich innerlich. Er fühlte sich nirgends mehr sicher und war nur noch ängstlich.
„Ja, er schaut, dass er mir aus dem Weg geht.“
Marianne nahm ihre Lesebrille ab und legte sie neben dem Laptop auf den Tisch. Die Excel-Tabelle auf ihrem Bildschirm sah kompliziert aus, doch im Moment ignorierte sie diese und musterte ihn eindringlich. „Und sonst? Hat sich etwas in der Schule herumgesprochen? Hast du mit jemandem Ärger oder wirst du gemobbt?“
Kain runzelte unbehaglich die Stirn. „Nein, ich … alles ist gut“, log er. In Wirklichkeit bemerkte er ständig versteckte Seitenblicke, die andere ihm zuwarfen, und leise Gespräche, die begannen, wenn er an Mitschülern vorbeiging. Kain konnte nur vermuten, aber irgendwelche Gerüchte mussten sich in der Schule verbreitet haben. Während des Unterrichts hatte er sich einen Sitzplatz ganz hinten ausgesucht, und in jeder Pause verzog er sich mit einem Buch hinter den mächtigen Lindenbaum, wo er darauf hoffte, von niemandem beachtet zu werden. Die Angst saß ihm noch immer in den Knochen. Er wurde erst letzte Woche von einem wütenden Mob durchs ganze Dorf gejagt. Kains Herz raste bei der Erinnerung an die Hetzjagd. Jetzt, wo er endlich in Sicherheit war, fühlte er sich ausgelaugt und leer. Morgens aus dem Bett aufzustehen und sich dem Tag zu stellen, war schon schwer genug.
Er hatte keine andere Wahl, als die Zeit an der Schule durchzustehen, und danach würde er einen Platz auf diesem riesigen Planeten finden, an dem die Menschen ihm nicht voller Argwohn und falscher Vorstellungen gegenübertraten. Sollte es diesen Ort nirgendwo geben, bliebe ihm noch die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten und ausschließlich mit getönten Gläsern nach draußen zu gehen.
Seine Mutter hatte einen Dreiviertel-Job bei MedTRON, einem Pharmakonzern in Freiburg. In den Ferien jobbte er auch immer dort. So verdiente er sich etwas dazu und musste nicht so lange alleine in Santasheim hocken, bis seine Mutter von der Arbeit nach Hause kam. Nicht, dass er einen Babysitter benötigte, aber er vertraute den Menschen in seinem Dorf schon lange nicht mehr, fühlte sich alleine unter Feinden. Und das nicht erst seit dem Vorfall.
„Was hältst du von Kontaktlinsen?“ Seine Mutter schaute verwirrt auf. „Was?“
„Ich könnte mir dunkelbraune Kontaktlinsen kaufen. Die würden die seltsame Färbung meiner Iris verdecken. Denkst du, sie könnten auch das rötliche Glühen kaschieren, falls es wieder auftritt?"
Seine Mutter starrte mit zusammengepressten Lippen auf die Excel-Tabelle, an der sie gerade arbeitete. Kain wusste, sie mochte es nicht, wenn er glaubte, anders sein zu müssen, als er war. Doch dieses Mal hielt sie ihm keinen Vortrag darüber, dass er wunderbar war, genauso wie Gott ihn erschaffen hatte.
Dieses Mal nickte sie nur. „Wir können es ausprobieren. Wenn dir ein paar Kontaktlinsen das Leben leichter machen, sollten wir es versuchen.“
Kain spürte, wie sich etwas in seiner Brust löste. Ihre unerwartete Zustimmung ließ ihn aufatmen. Er wagte ein zaghaftes Lächeln und fragte sich insgeheim, ob die Kontaktlinsen ihm tatsächlich ein Stück Normalität schenken könnten. Zumindest für eine Weile. In Gedanken sah er sich schon mit normalen, dunklen Augen. Niemand würde ihn seltsam anstarren oder aus Furcht die Straßenseite wechseln. Er wäre dann einfach nur Kain. Ein ganz normaler Junge. Warum war ihm der Gedanke nicht schon früher gekommen?
Seine Mutter bat ihn noch, den Müll hinauszutragen. Als er ins Freie trat, war es schon dunkel geworden, doch die Straßenlaterne spendete genügend Licht, um den Weg zur Tonne zu erhellen. Die kühle Abendluft ließ ihn leicht erschaudern. Als