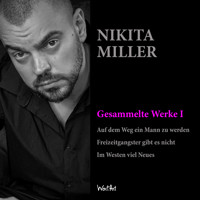Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Wohin führt der Weg eines jungen Mannes, der mit nichts als Gewalt und Ablehnung großgeworden ist? Die Geschichte handelt von meinem deutschrussischen Freund Slava Saizew … der bereits mit elf mein Drogendealer ist … der mit fünfzehn Jahren Rache an seiner Familie nimmt und ihr Furchtbares antut … der in der Unterwelt aufsteigt und das Böse in all ihren Facetten sieht … ein Genie, großgezogen von falschen Menschen … ein Genie, das alles im Griff zu haben scheint, bis sein Kommilitone Nikolay sich versehentlich an den Falschen vergreift …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VORWORT
Ich will dich gar nicht lange aufhalten. Vorworte sind wie Mückenstiche – lästig, unnötig. Die graue Substanz der Literatur: Man weiß, sie ist da, will sie aber nicht sehen. Und doch liest man sie, aus Angst, das Wesentliche des Werkes zu verpassen. Am Ende ist es aber immer dasselbe: endlose, leere Dankesreden, voll von Namen, die dir nichts sagen und dir egal sind. Dazu Anekdoten von überwundenen Hürden, die der Autor auf dem Weg zu seinem missverstandenen Meisterwerk gemeistert hat.
Was ist also an meinem Vorwort besonders? Nichts. Der gleiche Mist. Ein endloser, banaler Kampf mit der Eitelkeit, diesmal ohne Dankesreden, einfach aus Angst, jemanden zu vergessen. Die wahren Schöpfer, die stillen Architekten dieses Werkes, bedürfen keines Lobes. Sie kennen ihre Bedeutung und lachen über die Eitelkeit der Welt. Ohne sie wäre nichts passiert.
Vor über fünfzehn Jahren habe ich angefangen, dieses Buch zu schreiben. Damals war jedes Kapitel eine eigene Kurzgeschichte, die ich auf Facebook und Blogs veröffentlicht habe. Reine Dialoge, kurze Erzählungen, wie ein Theaterstück. Meine erste Geschichte war das Weihnachtsessen zwischen Nikolaj und seiner Familie, geboren aus tiefster Wut und unnachgiebigem Frust. Sie schlug online ein wie eine Bombe. Danach kamen die Kurzgeschichten der Johnson-Brüder und »Neues Fell«. Dann löschte ich alles und dachte: »Mach ein Buch daraus.«
Aber wie? Du kannst dein Skript an Verlage schicken, wo es untergehen wird unter einem Berg aus Hoffnungen und Selbstüberschätzung. Als würdest du in einen Hurrikan hineinflüstern. Jeder Autor hält sich für ein Genie. Ist er nicht erfolgreich, sieht er sich als missverstanden oder gibt dem Markt, dem Schicksal, dem Zeitgeist oder gar Gott die Schuld. Die, die keine Genies zu sein glauben, sind es oft. Halt dich fern von Leuten, die sich als Genies bezeichnen. Sie sind meist Wichser mit Minderwertigkeitskomplex. Wahre Schönheit weiß nichts von ihrer Schönheit.
Dieses Buch wurde von mehr als zehn Verlagen abgelehnt. Ich hab irgendwann aufgehört zu zählen. Es wäre ein Trost, hätte man mir gesagt, ich könne nicht schreiben und die Story sei scheiße. Ich wäre zwar am Boden zerstört, würde tagelang in einer leeren Badewanne sitzen und weinen, während meine Frau meinen Rücken mit einem nassen Schwamm streichelt. Aber wenigstens hätte ich Gewissheit und könnte es nach ein paar Monaten abhaken. Ersetz deine Illusion durch eine neue und zieh weiter.
Aber nein. Sie sagten mir Sachen wie: »Warum kommt da die italienische Mafia drin vor? Deutschland hat doch mit ganz anderen Gangs Probleme.«
Welche das sind, wollten sie mir nicht sagen. Mussten sie auch nicht. Wir alle sehen die Nachrichten. Die arabischen Clans sind aber nicht die gefährlichsten. Sie sind die lautesten. Was sie nicht harmlos macht. Aber die wahre Gefahr, die Italiener, die Albaner, die Russen, die Tschetschenen, haben kein Publikum. Du siehst sie keine Interviews geben, du siehst sie nicht auf TikTok und Social Media. Sie sind unsichtbar. Hab ich denen im Verlag aber nicht gesagt. Stattdessen sagte ich: »Ich kenne leider niemanden, der zu diesen ANDEREN Gangs Kontakt hat.«
Und dann sagten sie mir: »Heißt das etwa, die Geschichte ist wahr?«
Manche Sachen stimmen. Manche Sachen stimmen nahezu eins zu eins. Manche Sachen sind frei erfunden und manche sind wilder Bullshit. Du wirst es merken. Versprochen.
Sie sagten mir auch Sachen wie: »Die Geschichte ist viel zu brutal.«
Ihr druckt doch auch anderen brutalen Shit.
»Sind aber Bestseller aus dem Ausland.«
Bullshit.
»Zu brutal.« Punkt. Aus.
Dann druckt doch Kinderbücher.
Sie sagten mir noch Sachen wie: »Warum sind die Gangster so frauenfeindlich? Das stößt mir sehr auf. Muss ich in heutiger Zeit so was wirklich noch lesen?«
Das sind Gangster. Deren Handeln, selten deren Haltung, geht mit der Zeit.
Dann sagten sie mir Sachen wie: »Warum wird in diesem Buch nicht gegendert?«
Ich hoffe sehr, dass die Bibel eines Tages überarbeitet wird und darin eine Passage hinzugefügt wird, dass Leute wie du in die Hölle kommen. Sage ich aber nicht.
Stattdessen sagte ich: »Gangster gendern nicht.«
Dann sagten sie mir: »Es geht um den Erzähler. Du schreibst ja Sachen wie ›unsere Lehrer‹. Du musst ja nicht Lehrer*innen schreiben. Schreib doch ›Lehrkräfte‹ oder ›Lehrer und Lehrerinnen‹.«
Gib mir sofort mein Skript zurück und hör auf, mich zu duzen.
Sie sagten auch Sachen wie: »Mach doch daraus lieber ein Comedybuch.«
Ich bin es leid, mich ständig über meinen Schmerz lustig zu machen.
»Aber da sind doch sehr viele, sehr witzige Stellen in diesem Buch. Manches ist sogar aus deinem Programm, oder?«
Das Buch vegetiert seit Jahren auf meiner Festplatte. Ich hätte niemals gedacht, dass das jemals gedruckt werden würde. Also habe ich immer wieder Auszüge davon für mein Programm verwendet.
»Dann schreib doch einfach was Witziges. Nenn es Russenhocke und schreib Dialoge mit Viktor.«
Du hast echt Glück, dass ich in Therapie gehe. Das weißt du aber, oder?
Dann fragten sie mich Sachen wie: »Wer ist die Figur, die diese Geschichte erzählt?«
Löst sich auf, wenn du das Buch zu Ende liest.
»Da ist aber sehr viel Mindfuck drin und es wirft sehr viele Fragen auf und ist manchmal verwirrend.«
Wird alles aufgelöst. Vertrau mir. Lies es einfach zu Ende.
»Aber es wirkt manchmal so konfus.«
Lies es zu Ende.
»Das klingt alles so depressiv in deinem Buch. Schreib doch lieber ein Buch über Depressionen. Das kommt bei den Leuten derzeit super an.«
Wollte ich auch mal machen, aber dann hab ich einen Therapieplatz bekommen.
In meiner Fantasie habe ich bereits meinen Flammenwerfer ausgepackt und röste das Büro. All die Bücher und Skripte dort fangen schnell Feuer. Die Arbeiter rennen brennend im Kreis. Einer von denen brutzelt vor meinen Füßen in sich zusammen. Ich beuge mich zu ihm runter, und zünde mir an seiner Flamme eine Zigarre an.
Letzten Endes habe ich einen Verlag gefunden, der mir bis heute einzureden versucht, ich hätte geilen Scheiß geschrieben. So geil, dass sie jetzt ein verflucht aufwendiges Hörspiel (kein Hörbuch!) mit großartigen Synchronsprechern daraus machen. Die Arbeiten laufen schon. Seither warte ich darauf, dass ich endlich aufwache und man mir lachend sagt: »Sorry, war ein Glitch in der Matrix.«
Wie dem auch sei: Genieß die Story. Du entscheidest mit, ob sie weitergeht. Ob es eine Trilogie wird, oder ob nach diesem Buch hier Schluss ist und ich nur noch Comedy mache. Vielleicht kriege ich auch einen kompletten Zusammenbruch und ziehe mich infolgedessen zurück nach Island und betreibe als Guðjón Sigurðsson die Zucht von Rindern, Schafen und Ziegen.
Vielen Dank für deinen Support! Vielen Dank, dass es dich gibt! Vielen Dank, dass du es liest! Wer auch immer das Buch gerade in seinen Händen hält: Fühle dich von mir auf die Stirn geküsst.
Jetzt habe ich mich doch bedankt. Ich bin eben ein Heuchler, was soll ich sagen.
0
Ich öffne die Augen und muss direkt erbrechen. Keine Ahnung, wieso und schon gar nicht, wohin. Licht, derart grell, als würde ich eine in die Fresse kriegen, starre ich erst einmal hinein. Sehr schwer, nicht hineinzustarren, wenn es von allen Seiten auf dich einballert. Ich wäre nicht weniger blind, würde ich meine Augen geschlossen halten, hoffe aber darauf, dass ich mich an diese grelle Helligkeit endlich mal gewöhne.
So langsam erkenne ich mein Erbrochenes. Ich hab nahezu alles getroffen. Den Tisch, den Boden, die Wand, mich selbst, nur den Eimer zu meiner Rechten nicht. Hättest ihn eben links von mir platzieren sollen. Hast du sogar, stell ich gerade fest.
»Passiert das jedes Mal?«, höre ich eine männliche Stimme fragen.
»Fast«, antwortet irgendeine Frau.
Allmählich kann ich sie sehen, zumindest ihre Silhouetten. Kein Wunder, dass ich so lange brauche, um mich an diese Helligkeit zu gewöhnen. Hier drin ist alles weiß. Die Wände, die Frau, also ihr Kittel, einfach alles. Der Typ neben ihr ist dunkler. Viel dunkler. Ach ja, gefesselt bin ich auch, stelle ich gerade fest. Meine Handgelenke via Handschellen an den Stuhllehnen, der Stuhl fest in den Boden geschraubt. Das Einzige, was ich bewegen kann, ist mein Kopf. Gottseidank, sonst hätte ich die beiden vorhin voll erwischt. Sollte ich mir beim nächsten Mal merken. Diese Höflichkeitsnormen sind zu fest in meinem Geist implementiert. Ist doch klar, dass du, wenn du gefesselt in so einem Raum aufwachst, dem Gesprächspartner erstmal ins Gesicht kotzt. Ist doch klar, dass die beiden nichts Gutes im Schilde führen. Ganz klar, dass du im Arsch bist und glasklar, dass du hier so schnell nicht wieder rauskommst. Wahrscheinlich nie. Fuck!
»Mit wem spreche ich?«, höre ich sie fragen.
Oder hab ich das gefragt? Eigentlich sollte ich das fragen. Vielleicht habe ich das auch. Bin ich eine Frau? Ich schüttle die Hüften, wenig Spielraum, aber ich spüre meinen Kasper darin baumeln. Sagte ich schon, dass ich ebenfalls komplett weiß gekleidet bin? Oh Mann, das ist einer dieser Momente, wie ich ihn nur aus Filmen kenne. Du wachst eines Tages auf und musst feststellen, dass dein ganzes Leben nur ein Traum war oder eine Einbildung. Dass nichts real war… oder ist. Oder, dass du in irgendeiner Irrenanstalt festsitzt oder einem Forschungslabor, wahrscheinlich sogar herausfindest, dass du nicht einmal Mensch bist, sondern irgendein Klon oder Alien. Wobei ich bis heute davon überzeugt bin, dass Aliens auch nur Milliardäre von anderen Planeten sind.
»Mit wem spreche ich?«, fragt sie wieder, während irgendwelche Typen, verpackt in Mundschutz und Kittel, hastig wie Heinzelmännchen mein Erbrochenes aufwischen und wieder verschwinden.
»Mit wem spreche ich?«, frage ich zurück.
»Er weiß nicht mehr, wer wir sind?«, fragt sie der Typ.
»Du sagtest, du seist das Produkt aus Jimmy und Johnny«, sagt sie mir, »und dann bist du ohnmächtig geworden.«
»Aber nicht zum ersten Mal, oder?«, frage ich.
»Nein, nicht zum ersten Mal.«
»Wie lange haltet ihr mich schon gefangen?«, frage ich.
»Du siehst dich als Gefangenen?«
»Sieht so Gastfreundschaft aus?«, sage ich. »Seid ihr irgendein perverses, skandinavisches Pärchen oder so was? Schneidest du mir gleich die Kehle durch, während er mir einen bläst?«
»Wie ist dein Name?«, fragt sie mich.
»Wie ist dein Name?«, frage ich zurück.
»Doktor Jueck.«
»Oh nein«, seufze ich. »Sagt mir jetzt nicht, ich hätte irgendeine multiple Persönlichkeitsstörung oder so was. Dass ich draußen irgendwie rumlaufe als Fritz Langhorst oder so was und kleine Jungs zerstückle, während ich jetzt gerade hier als ehemaliger Arzt oder so was sitze, Doktor Hans Stinkebaum oder so, und euch davon überzeugen muss, dass ich mich an nichts erinnere. Ist es das?«
»Wer sind Jimmy und Johnny?«, fragt der Typ.
»Zwei Brüder«, sage ich.
»Aber wer sind sie?«
Okay, jetzt kann ich klar sehen. Sie, Mitte vierzig, hübsche Braut. Glaube ich. Ist alles relativ. Ich finde sie hübsch. Er sieht okay aus. Dunkler, bärtiger Kerl in einem Anzug, vielleicht fünfzig, vielleicht jünger. Wen interessiert’s?
»Bist du das Produkt aus Jimmy und Johnny?«, fragt sie mich.
»Was? Nein. Glaub nicht.«
»Warum hast du das gesagt?«
»Keine Ahnung«, seufze ich angestrengt. »Ein Versprecher?«
»Dann …«
»Ja, ja, ja«, unterbreche ich sie, »ich weiß, was ein Freud’scher Versprecher ist!«
»Glaubst du, es war einer?«, fragt sie in einem Ton, der mir fast schon naiv erscheint.
»Keine Ahnung«, sage ich. »Vielleicht, vielleicht nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich bin, warum ich hier bin, wer ihr seid. Seid ihr meine Eltern? Seid ehrlich. Ich ruf auch nicht das Jugendamt. Wie alt bin ich eigentlich?«
»Was denkst du?«
»Ach, fuck you!«, seufze ich. »Ohne Scheiß! Immer diese Gegenfragen! Ich bin ganz klar in einer Klapse. Nur Psychiater reden so ... Und Bullen.« Ich deute auf den Typen neben ihr: »Du bist bestimmt Bulle, oder?«
Er nickt.
»Wen habe ich umgebracht und wieso?«, frage ich.
»Du hast niemanden umgebracht«, sagt sie.
»Red keinen Scheiß!«, lache ich.
»Was weißt du über Zeshan?«, fragt sie mich.
»Nur Gerüchte«, zucke ich die Schultern. »Geschichten, nicht mal aus erster Hand.«
»Und Jimmy und Johnny?«
»Noch weniger«, sage ich. »Nur Mythen. Lagerfeuergeschichten. Wilder Dreck.«
»Bist du ihnen mal begegnet?«, fragt sie mich.
Ich schüttle den Kopf.
»Und Zeshan?«, fragt sie.
Wieder schüttle ich den Kopf.
»Nikolaj?«
»Cole?«, frage ich heiter.
»Kennst du ihn?«, fragt sie.
»Klar, kenne ich Cole. Was ist mit ihm?«
»Ist er ihnen begegnet?«, fragt sie. »Jimmy und Johnny.«
»Mehr oder weniger«, zucke ich die Schultern.
»Warum sagst du, du seist das Produkt aus Jimmy und Johnny?«, fragt sie.
»Das habe ich nie gesagt!«, sage ich. »Das ergibt keinen Sinn. Slava hatte das immer wieder gesagt. Kennt ihr Slava?«
»Den kennen wir«, sagt sie.
»Sehr gut sogar«, fügt der Bulle hinzu.
»Oh, ich verstehe«, lächle ich. »Wir sind wegen Slava hier. Was hat er angestellt?«
»Viel«, sagt sie.
»Sehr viel«, fügt er hinzu.
»Ihr zwei seid die reinsten Cartoon-Figuren«, lache ich.
»Was bedeutet das?«, fragt sie. »Das Produkt aus Jimmy und Johnny?«
»Slavas Vater«, sage ich, »hat gern diese Prügelfilme geguckt. Bud Spencer und so einen Scheiß. Hat seine Fäuste so genannt. Jimmy und Johnny. Pam-Pam! Und Slava ist das Produkt davon.«
»Und was hat das mit den Brüdern zu tun?«, fragt der Bulle.
»Gar nichts«, sage ich. »Dummer Zufall. Hey, wollt ihr mir nicht sagen, warum ich hier bin?«
»Jedes Mal«, sagt sie, »wenn ich das tue, fällst du in Ohnmacht.«
»Also bin ich in einer Klapse. Das heißt, ich hab Chancen hier rauszukommen, oder? Gesunde Menschen kommen frei.«
»So gesehen«, schmunzelt sie schulterzuckend.
»Dafür muss ich aber meine Leute in die Pfanne hauen«, stelle ich fest. »Ich weiß nicht, ob ich da groß helfen kann. Alles, was ich weiß, ist Jahre her. Und alles, von dem ihr glaubt, dass ich es weiß, sind Gerüchte.«
»Dann haust du also niemanden in die Pfanne«, sagt der Bulle.
»Aber ich belaste Leute«, sage ich. »Ich belaste Slava.«
»Slava lebt nicht mehr«, sagt Jueck.
»Wirklich?«
»Wirklich«, sagt der Bulle.
Ich öffne die Augen und muss erbrechen, kriege aber nichts aus mir raus. Wasser, Magensäure, vielleicht noch etwas steinalten Fraß, womöglich noch Futter aus der Grundschule. Alles, was ich sehe, ist dieses grelle Licht und zwei Figuren, zumindest deren Silhouetten, die vor mir sitzen.
»Mit wem spreche ich?«, höre ich eine Frau fragen.
»Jueck?«, frage ich zurück.
»Du weißt, wer ich bin?«
»Vage.« Ich starre zu Boden. Bin erschöpft. »Der Bulle heißt Musa, oder?«
»Das ist richtig«, sagt er.
»Warum bin ich hier?«, frage ich.
»Weißt du, wo du bist?«, fragt sie.
»Ein Labor. Ihr Wichser führt irgendwelche Studien an mir durch.«
»Er erinnert sich?«, fragt Musa sie.
»Pscht!«, faucht sie ihn an.
»Irgendein verkacktes Experiment«, nuschle ich ins Licht. »Ihr habt mir was gespritzt, irgendwas an mir getestet. Ich hab Scheiße gebaut und jetzt sucht ihr nach Fehlern.«
»Weißt du, warum du hier bist?«, fragt sie.
»Hab ich doch gerade gesagt!« Gott sind die nervig. »Wahrscheinlich hab ich irgendwas unterschrieben oder so und jetzt … wann ist das vorbei?«
»Bald«, sagt sie. »Sehr bald. Du machst große Fortschritte.«
»Wer sind Jimmy und Johnny?«, nervt der Bulle mich wieder.
»Deine Eltern«, sage ich.
»Wie ist dein Name?«, fragt sie.
»Hab ich überhaupt noch einen Namen?«, stelle ich lachend fest.
Ich kann die beiden noch immer nicht sehen. Ich bin fertig, durch den Wind, erschöpft, ausgelaugt. Starre ins Leere, zu Boden, sabbere vor mich hin und flehe eine höhere Macht an, mich endlich zu erlösen, falls da überhaupt eine existiert. Wieder mal der Beweis, dass Religion nur eine Phase ist, die Leute durchlaufen, weil sie angepisst sind, dass sie auf ihre tiefgreifenden Fragen keine Antworten bekommen.
»Erzähl mir von den Johnson-Brüdern«, sagt sie.
»Hast du eine Lieblingsgeschichte?«, fragt mich der Bulle.
»Wozu?«, stöhne ich angestrengt in den Boden.
»Wir möchten wissen«, sagt er, »ob die etwas über Slavas Tod wissen.«
»Slava ist tot?«, lache ich. »Du kannst Slava nicht töten. Der Wichser ist viel zu schlau für jeden von uns. Ich … muss mich hinlegen …«
»Erzähl uns deine Lieblingsgeschichte«, höre ich einen von ihnen sagen. Keine Ahnung, wen. Beide klingen gleich. Wie ein verzerrtes Tape aus einem Walkman, der gerade baden geht.
»Erzä…ähl… u…u…uns … deine … Lieb…lings…geschichte …«
Ich folge einfach meinen Neigungen. Ich hab das Gefühl, ich schlafe. Aber wenn du weißt, dass du schläfst, dann schläfst du nicht und falls doch, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du wieder aufwachst. Vielleicht bin ich wach und erzähle diese verdammte Geschichte. Zumindest träume ich von ihr.
Slava warf mir das immer wieder vor: »Du träumst und bist gleichzeitig wach. Wieso bekommst du das nur im Schlaf hin?«
Also leiere ich ihnen die Geschichte runter: »Diese ach so geile Geschichte, auf die ihr beiden so scharf seid, spielt in Österreich. Oder war es die Schweiz? Ich weiß es nicht mehr …«
BUCH 1 DIE JOHNSON-BRÜDERPART I
1
Diese ach so geile Geschichte, auf die ihr beiden so scharf seid, spielt in Österreich. Oder war es die Schweiz? Ich weiß es nicht mehr. Für mich sieht das eine aus wie das andere. Berge, Frischluft, verstörender Dialekt. Egal. Diese beiden Typen schlendern also durch die leere Altstadt. Keine Menschenseele weit und breit. Fehlen nur noch ein Heuballen, der durch die Szene weht und ein, zwei Krähen, die den beiden hinterherstarren.
Klingt bedrohlich, oder? Große, junge, rauchende Typen in Schwarz, mitten in der Nacht, die sich laut streiten. Auf den ersten Blick vielleicht. Sieht man genauer hin, dann versteht man, was ich meine: Milchgesichter, schlank, schlaksig, viel zu große Anzüge. Könnten Elfjährige auf Stelzen sein. Auf der einen Seite haben wir Johnny. Das ist der Typ mit der Hornbrille aus Gläsern so dick wie Flaschenböden und der hohen Stirn. Der Typ, der das seidene blonde Haar über seine Halbglatze gekämmt hat. Und der andere, der aussieht wie Jimmy Neutron, heißt tatsächlich James ... also Jimmy. Wilder Scheiß, oder? Gegelter Berg von braunem Haar, als hätte ihm ein Elefant auf den Kopf geschissen.
Jimmy und Johnny also. Könnte der Titel für eine platte Sitcom aus Amerika sein. Okay, jetzt seid ihr drin.
»Warte!«, ruft Johnny. »Da! Da vorne! Der Tierladen, dann um die Ecke … ja, da ist die kaputte Laterne und rechts gegenüber! Ha! Da vorne ist es! Jetzt weiß ich’s wieder!«
»Du orientierst dich an Bildern?« Jimmy sieht ihn an, als läge ein fauler Geruch in der Luft.
»Na und? Und du bist ein Wichser. Wen interessiert’s?«
»Du hast die Orientierung einer Frau«, sagt Jimmy.
»Halt’s Maul, ich muss mich konzentrieren.«
»Im Ernst. Ein Mann orientiert sich wie ein Vogel, sieht die Umgebung von oben. Eine Frau orientiert sich an Bildern, als wäre sie in einem verkackten Bilderbuch. Hast du noch Zigaretten?«
»Eine noch.« Völlig verwirrt blickt Johnny umher, während er sich die Panzergläser sauberwischt.
»Ja und?«, faucht Jimmy ihn an. »Gib her. Kriegst du Sozialhilfe, oder was?«
»Das ist Schwachsinn, was du da redest.« Johnny wirft Jimmy seine Schachtel zu.
»Was?«
»Dieses Orientierungsding.«
»Ist aber so!« Jimmy steckt sich die Kippe an und wirft die leere Schachtel zerknüllt auf die Straße. »Feuer, bitte.«
»Geschlechter sind Bullshit«, sagt Johnny. »Eine Folgeerscheinung der Erziehung.«
»Hey, hör auf mit diesem Scheiß! Fang du nicht auch damit an!«
»Was ist der Unterschied zwischen Hundeweibchen und Hundemännchen? Oder Katzenweibchen und -männchen? Worin unterscheiden die sich? Vom Verhalten, meine ich.«
»Ich bin kein Tierexperte«, zuckt Jimmy die Schultern. »Feuer, Johnny.«
»Sobald das Baby seine ersten rosa Schuhe bekommt, wird es in Richtung Weiblich erzogen.«
»So ein Schwachsinn!«, ruft Jimmy. »Der Hormonhaushalt ist doch bei beiden komplett verschieden! Willst du mir sagen, dass Schwulsein auch von der Erziehung abhängt?«
»Das ist ein ganz anderes Thema«, sagt Johnny, »Schwule sind Kranke, die dringend behandelt werden müssen.«
»Warum müssen? Die haben Spaß dabei. Die sind glücklich, es ausleben zu dürfen. Solange ich nicht zusehen muss, wie die …«
»Okay«, ermahnt ihn Johnny, indem er ihm seinen Zeigefinger vors Gesicht hält. »Ich hab’s kapiert! Okay?«
»Johnny«, versucht Jimmy seinen Bruder zu besänftigen. »Homosexualität ist genetisch bedingt. Das entsteht nicht durch Erziehung.«
»Ein Homo-Gen? Dein Ernst? Was hat das für einen Sinn? Ich meine, was denkt sich die Natur dabei?«
»Vielleicht möchte sie dadurch verhindern«, sagt Jimmy, »dass kranke Idioten wie du sich vermehren.«
»Hey!«
»Johnny, das ist Fakt. Das ist in jeder Studie aufzufinden. Die haben das schon als Babys in sich. Gibst du mir jetzt endlich Feuer?«
»Was ist, wenn das Homo-Gen durch schwere Ereignisse entsteht? Mit psychischen Folgen und so was, weißt du?«
»Nein, Mann«, seufzt Jimmy. »Das wurde mal bei Zwillingen nachgewiesen. Gleiche Eltern, gleiche Erziehung, aber einer von beiden ist dann ans andere Ufer, um Jesus zu verärgern, okay?«
»Aber was ist, wenn … Ach egal!«, winkt Johnny ab.
»Auf was willst du eigentlich hinaus? Wen interessiert das, ob Schwule naturschwul sind oder das erst erlernen müssen?«
»Wir haben uns verlaufen«, faucht Johnny.
»Nein, da vorne ist die kaputte Laterne. Und da gegenüber ist die Bar, oder nicht?«
Johnny nickt.
»Und hör auf, so eine Scheiße zu reden«, setzt Jimmy nach. »Dass Schwule Kranke sind und so was.«
»Sind sie aber.«
»Behalt das für dich! Das will keiner hören! Die Welt rudert anders. Vor sechzig Jahren hättest du dafür noch Applaus bekommen. Geh mit der Zeit, du Arsch!«
»Steck die Kippe weg. Da drinnen darfst du nicht rauchen … Warum wirfst du sie weg?! Das war die letzte!«
2
Die Brüder betreten also eine Bar, die kurz vorm Schließen ist. Keine Sau da, bis auf einen Säufer, der mit dem Kopf auf dem Tresen pennt und dabei eine riesige Liane an Sabber zu Boden hängen lässt, und einen Barkeeper, der hinter dem Tresen die Gläser poliert.
»Habt ihr noch offen?«, ruft Johnny durch den Raum, sodass der Säufer wie auf Knopfdruck aufspringt: »Klar, haben wir offen!«
Ich nenne diesen Typen nicht nur deswegen einen Säufer, weil er unter der Woche um vier Uhr morgens an einem Tresen schläft. Kann genauso gut sein, dass er müde ist, einen langen Arbeitstag hatte, depressiv ist oder nicht nach Hause will, aus welchen Gründen auch immer. Ich nenne ihn nicht nur deswegen einen Säufer, weil er schon kilometerweit gegen den Wind so riecht, unterernährt ist, eine kaputte, pockennarbige Haut hat, seine Hände ständig zittern und er sich nur schwer aufrecht halten kann. All das kann ich dank meines Vaters ausblenden oder mir schönreden. Es ist die Art, wie er spricht. Als würde er Achterbahn fahren. Deswegen nenne ich ihn einen Säufer.
Die Brüder setzen sich zu ihm an die Bar.
»Whisky«, sagt Jimmy.
»Wasser«, sagt Johnny.
Und während der Barkeeper die Getränke serviert, fragt ihn Jimmy: »Ho, Chef. Was hältst du von dieser Theorie?«
»Nein, nein, warte«, unterbricht ihn Johnny.
»Was ist?«, faucht Jimmy ihn an. »Ich will ihn nach seiner Meinung fragen.«
»Nein, vorher frag ich ihn nach deiner Theorie.«
»Was sind das wieder für Angewohnheiten?«, ruft Jimmy. »Du kannst nicht einfach …«
»Warte, warte, warte …«, zeigt Johnny ihm seine Handflächen. »Warte, okay? Wir sollten unsere Themen sequentiell abarbeiten. Und zuallererst kam deine Navi-Theorie.«
»Sequentiell?«, fragt Jimmy.
»Der Reihe nach.«
»Dann sag das doch!«
»Hab ich doch!«
»Ho! Chef!«, zischelt Jimmy, während der Barkeeper einschenkt. »Was würdest du sagen? Sind Männer typisch Mann und Frauen typisch Frau von Natur aus oder sind sie erst durch ihre Erziehung so geworden?«
»Frauen sind auf alle Fälle psychisch stärker als Männer«, sagt Johnny.
»Wo hast du den Scheiß jetzt her?«, ruft Jimmy.
»Ist so.«
»Auf wen trifft das zu?«
»Auf dich, du Wichser!«, sagt Johnny. »Schon vergessen? Antonella Versace.«
»Ah, nein. Diesen Dingen bin ich übrigens auf den Grund gegangen. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass ich in sie verliebt war.«
Wieder wendet sich Johnny an den Barkeeper: »Chef, wie siehst du das? Drei Jahre ist er ihr hinterher gerannt. Hat ihr Bilder gemalt. Und er kann malen. Und wie er das kann. Er hat ihr ständig Blumen geschenkt, ihr Briefe und Liebesbekundungen hinterhergeworfen. Mir Referate über sie vorgeheult.«
»Hey«, wirft Jimmy ein. »Ich bin nicht nur gefährlich, ich kann auch romantisch sein.«
»Aha, wie eine Kerze«, sagt Johnny.
»Warum hat sie abgelehnt?«, fragt der Barkeeper.
»Sie war vergeben«, sagt Jimmy. »Aber sie war trotzdem an mir interessiert. Ich spürte es. Mehr als deutlich.« Er nippt laut schlürfend an seinem Whisky. »Sie hat diesen Schwachkopf sogar geheiratet und ist jetzt todunglücklich mit ihm … wie ich gehört hab.«
»Wie du gehört hast?«, lacht Johnny. »Du meinst wohl eher, wie du es dir erhofft hast!«
»Und wenn schon!« Schulterzuckend blickt Jimmy lachend in die Runde. »Wer wünscht der Liebe seines Lebens nicht alles Schlechte?«
»Seh’ ich absolut genauso!« Der Säufer ext sein Glas und schmettert es grölend auf den Tresen. »Verrecken sollen sie alle!«
»Qualvoll!« Jimmy das Gleiche: Glas exen, schmettern, grölen.
»Brennen sollen sie!«
Der Säufer und Jimmy stoßen an, schreien im Chor: »Hua!«
»Hey, warum ist mein Glas leer?«, brüllt der Säufer. »Chef!«
Der Barkeeper schenkt beiden nach.
»Na jedenfalls«, Johnny wendet sich wieder an den Barkeeper, »hat sie ihm das Herz gebrochen. Du hättest mal seine Liebesbriefe lesen sollen. Ein Wortkünstler.« Johnny küsst Zeigefinger und Daumen.
»Aus tiefster Seele geschrieben«, sagt Jimmy kopf-schüttelnd. »Wo waren wir gerade? Wie sind wir auf dieses Thema gekommen?«
»Warum du nicht in sie verliebt warst«, sagt der Barkeeper.
»Ah ja, richtig!«, ruft Jimmy. »Pass auf! Jahre später traf ich sie in einem Café. Ich dachte, ich sei über sie hinweg. Und als ich sie sah: Ich war hin und weg. Herzrasen und …«
»Oh ja, das kenn ich.« Der Säufer nickt, blickt nachdenklich, schmunzelt und schwelgt in Erinnerungen.
»Naja, ich stehe also da«, fährt Jimmy fort, »und sie sieht mich an und ich sie. Und all diese Gefühle kommen wieder in mir hoch. Also gehe ich zu ihr hin und frage, ob ich mich zu ihr setzen darf.«
»Du gehst einfach hin und fragst, ob du dich zu ihr setzen darfst?«, fragt Johnny.
»Gott, nein!«, seufzt Jimmy. »Zuerst frage ich sie, wie es ihr geht, und sie dann mich und was sie hier so macht und was ich hier so mache und bla, bla, bla! Halt doch endlich die Schnauze und lass mich diese verschissene Geschichte erzählen! Ich setze mich also zu ihr, wir trinken Kaffee, gehen spazieren und plötzlich: Regen. Keine Haltestelle in der Nähe, ich wohne um die Ecke und … wir sind also bei mir, quatschen, knutschen und …«
»Warte, wann war das?«, fragt Johnny. »Das hast du mir nie erzählt!«
»Ich wollte es bei einem Happy End belassen«, zuckt Jimmy grinsend die Schultern.
»Was du jetzt erzählst, ist ein verfluchtes Happy End!«
»Okay«, seufzt Jimmy, »ich wollte es als dramatische Liebesgeschichte belassen. Gefiel mir besser. Wirkte filmischer.«
»Und was dann?«, fragt der Barkeeper. »Hat dich die Leere gepackt?«
Jimmy hält plötzlich inne, stiert den Barkeeper an wie normale Leute womöglich Jesus oder die Ninja Turtles anstieren würden. Sorry für diese absurde Auflistung, aber Leute, denen Jesus am Arsch vorbeigeht, würden ausflippen, wenn sie die Ninja Turtles sehen und umgekehrt. Reichliche Studien, die ich während unzähliger Kiffergespräche geführt habe, belegen das. Fragt nicht weiter.
Also Jimmy ist völlig neben der Spur. Er starrt den Barkeeper fassungslos an: »Verflucht … Ja … Genau das ist es … Das ist es! Verdammt noch mal, ja! Eine Leere. Ich küsse sie, und all der Zauber war dann weg! Es war nichts mehr da! Sie kam mir auch nicht mehr so schön vor! Ihre Stimme wirkte irgendwie nervig! Ihr Geschwätz dümmlich und … Ich mag da jetzt nicht ins Detail gehen. Jedenfalls war dieses eigentliche Gefühl nicht mehr da! Sie war in meinen Augen nicht mehr attraktiv! Ich empfand nichts mehr für sie! Absolut nichts. Es war …«
»Leer«, wiederholt der Barkeeper.
»Gottverflucht! Ja!« Jimmy ext sein Whiskyglas. Der Barkeeper schenkt sofort nach. »Es war nichts mehr da! Was sagt man dazu?«
»Du warst in deine Idee verliebt«, schmunzelt der Barkeeper. »Du warst verliebt in deinen Ehrgeiz, nicht in sie. Du warst besessen von deinem Eroberungsdrang.«
»Krasser Scheiß.« Fassungslos schüttelt auch Johnny den Kopf. »Und dann?«
»Och, nichts mehr«, seufzt Jimmy, »Ich hab sie gevögelt, am nächsten Morgen nach Hause gefahren und die nächsten zwei Wochen ihre Nachrichten und Anrufe ignoriert. Letzten Endes ist sie wieder mit ihrem bisherigen Freund zusammengekommen und hat ihn geheiratet.«
»Diese Schlampe«, sagt der Säufer.
»Mit einer verliebten Frau kann ein Mann alles machen, was sie will«, zuckt Jimmy wieder die Schultern.
»Als ob sie so einen Scheiß wollte!«, faucht Johnny ihn an.
»Als ob du weißt, was Frauen wollen!«
»Chef«, wendet Johnny sich wieder an den Barkeeper. »Bist du verheiratet?«
»Verwitwet.«
»Sorry, Chef.«
»Schon gut, ist Jahre her.«
»Chef, mein Bruder Jimmy hier: ledig.« Er zieht Jimmy am Ohr, doch dieser schlägt ihm die Hand weg, sodass er selbst fast vom Barhocker fällt. »Er hält nicht viel von der Ehe. Und du, du kennst beide Seiten. Was würdest du meinem Bruder raten? Ich bin seit Jahren glücklich verheiratet.«
»Ja, das ist wahr«, bestätigt Jimmy mit erhobenem Zeigefinger. »Aber das liegt daran, dass du in einem anderen Leben ein sehr guter Mensch warst. Anders kann ich mir das nicht erklären. Vielleicht auch ein Fehler in der Matrix.«
»Aber ist es nicht herrlich«, sagt Johnny, »jemanden neben dir zu haben, der dich in all deinen Entscheidungen unterstützt und die Hälfte deiner Last mitträgt und …«
»Johnny!«, ruft Jimmy. »Deine Argumente zählen hier nicht! Wir einigten uns auf Fehler in der Matrix.«
»Was sind das eigentlich für Studien, aus denen du solche Resümees ziehst?«, fragt ihn Johnny.
»Intuitive Denkprozesse«, zuckt Jimmy die Schultern. »Und hör endlich auf, ständig irgendwelche französischen Fremdwörter von dir zu geben. Du wirkst mehr schwul als schlau.«
»Jimmy …«, droht ihm Johnny wieder mit dem Zeigefinger.
»Eins kann ich euch aber sagen!«, unterbricht Jimmy hastig seinen Bruder. »Alle Frauen, egal ob Anwältin, Ärztin, Krankenschwester, ganz egal was, alle sind sie dämlich! Vor kurzem habe ich eine Frau …«
»Absolut!«, unterbricht ihn der Säufer. »Strohdumm sind sie! Alle!«
»Vor kurzem habe ich …«
»ALLE!«, schreit der Säufer.
»Ist ja gut!«, schreit Jimmy ihn an. »Vor kurzem habe ich also eine Frau kennengelernt«, fährt er in ruhigem Ton fort. »Wir haben wochenlang gedatet. Lief gut. Gute Gesellschaft. Viel gelacht. Ich war sehr witzig. Wichtiges Indiz, weil: Pass auf. Ich will sie küssen und sie meint, sie dachte, wir seien nur Freunde. Wie beschränkt kann eine Frau nur denken? Als würde ich so viel Geld und Zeit für eine Freundschaft opfern.«
»Ich denke, du bist es hier, der beschränkt denkt«, sagt der Barkeeper.
Alle lachen los. Außer Jimmy, der blickt ahnungslos in die Runde.
»Manche Leute liegen so weit hinten«, sagt Johnny, »dass sie denken, sie seien in Führung.«
Wieder brechen sie in wildes Gelächter aus, bis auf Jimmy.
»Jimmy!«, lacht sein Bruder ihn aus. »Ist doch offensichtlich. Je näher sie dich kennengelernt hat, desto mehr hat sie realisiert, was für ein Vollidiot du bist. Sie hat das Interesse an dir verloren.«
»Wieso lacht sie dann über meine Witze?«
»Vielleicht hat sie über dich gelacht«, sagt Johnny.
»Vielleicht waren es gute Witze«, zuckt der Barkeeper die Schultern.
»Wieso sagt sie nicht einfach, was Sache ist?«, fragt Jimmy. »Ist das so schwer?«
»So wie du?«, fragt Johnny. »Mit wochenlangem Ignorieren?«
»Um sie nicht zu verletzen.«
»Du bist eben ein toller Mensch.« Prostend hebt Johnny sein Wasserglas. »Danke, dass es dich gibt.«
»Okay, Johnny. Okay, wenn ich so ein Schwachkopf bin, wie du sagst, und das wohl zu Recht, denn du kennst mich in- und auswendig, also wenn dem so ist: Was ist mein Makel?«
»Frauen stehen auf Arschlöcher!«, ruft der Säufer.
»Auf Männer mit eigener Persönlichkeit, die sich nicht fügen. Dem stimme ich zu«, sagt Johnny.
»Sag ich doch: Arschlöcher!«
Alle lachen, trinken aus. Der Barkeeper schenkt nach. Eine Weile Stille. Als hätte jeder von ihnen etwas zu verarbeiten. Vielleicht liegt das auch nur daran, dass die Männer vom vielen Lachen und Schreien erschöpft sind. Während das Lachen des Säufers manisch wirkt, wirkt das des Barkeepers heiter und herzlich. Seine Augen formen sich dabei immer zu kleinen Schiffchen und doch verraten sie tiefe Trauer und bitteren Zynismus. Durch den grauen Vollbart und die buschigen Augenbrauen ist das schwer zu erkennen. Seine Glatze, seine dunkle Haut, seine kräftige Statur, sein stetiger Drang zu lächeln, geben einem das Gefühl, dass er sich nicht so leicht unterkriegen lässt.
»Okay«, lallt Jimmy plötzlich in die Stille. »Ich glaube, ich hab’s kapiert.«
»Wirklich?«, fragt Johnny lachend. »Du hast es kapiert?«
Auch der Säufer muss wieder lachen.
»Nein, nein.« Wie im Schulunterricht hebt Jimmy den Zeigefinger, jedoch nur kurz, da er deswegen fast wieder vom Hocker gefallen wäre. »Worauf ich hinaus will, ist … Da gab es doch mal diesen Rocker. Er war optisch ein typischer Rocker. Lange Haare, schwarze Lederklamotten, Bart, Motorrad und so weiter. Dann verliebt er sich. Und die Frau ändert ihn von Grund auf. Seine Haare schneidet er, seinen Bart rasiert er, seinen Kleidungsstil ändert er.«
»Und dann hat sie ihn verlassen?«, fragt der Barkeeper.
»Besser. Er kommt nach Hause und erwischt seine Frau mit einem anderen Mann im Bett. Und der sieht haargenau so aus wie der Rocker früher.«
»War das nicht ein Song?«, fragt Johnny.
»Kann sein, ich weiß es nicht mehr.«
»Doch, doch«, sagt Johnny. »Und am Ende des Songs fragt er sie, weshalb sie das getan hat. Er hatte sich nur ihr zuliebe geändert. Und sie sagt ihm, du bist nicht mehr der Mann, in den ich mich einst verliebt hatte. Du warst frei, du warst wild, und so weiter.«
»Genau«, lallt Jimmy. »Genau so war das! Verrückter Scheiß, nicht?«
»Eine Frau versucht ihren Mann zu verändern«, sagt Johnny, »und hofft dabei, dass sie es nicht schafft.«
»Ich dachte, das sei erziehungsbedingt!«, ruft Jimmy. »Ein Mann tut das nicht?«
»Ich meinte damit …«
»Gib doch endlich zu, dass du nur Scheiße redest! Mich wundert’s, dass deine Zähne noch nicht braun sind!«
»Ey Chef«, wendet Johnny sich hastig an den Barkeeper. »Erlaube mir die Frage, deine Ehe … Warst du glücklich?«
»Es gab Höhen und Tiefen.«
»Niemals war er glücklich«, lacht Jimmy. »Erinnerungen sind dein schlimmster Feind. Das sind keine Fakten. Nur Interpretationen. Darf ich?« Er deutet auf die Zigarette in seinem Mund. Doch ehe der Barkeeper antworten kann, gibt ihm Johnny bereits Feuer: »Wo hast du die her?«
»In der Jacke gefunden«, nuschelt Jimmy.
Widerwillig, um die Stimmung nicht zu trüben, stellt der Barkeeper ihm einen Aschenbecher hin.
»Was würdest du meinem Bruder Jimmy raten?«, fragt Johnny den Barkeeper. »Heiraten oder nicht?«
»Spielt keine Rolle«, lächelt der Barkeeper. »Bereuen wirst du beides.«
Alle lachen laut los.
»Nicht übel«, sagt Johnny.
»Nicht übel?«, fragt Jimmy, während er sein Glas ext. »Das lasse ich mir auf meinen Grabstein meißeln!«
Wieder lachen alle wild drauf los.
»Jungs, ihr seid klasse!« Der Säufer wirft seine Arme um die beiden Brüder. »Ich muss es sagen! Ihr seid einfach der Wahnsinn! Nein, nein, diese Verbindung zwischen euch, das ist etwas Heiliges! Ihr seid spitze, Jungs! Einfach nur spitze! Chef, schenk uns nach!«
Der Barkeeper schenkt nach. Doch der Säufer ist diesmal der Einzige, der trinkt.
3
»Dein Name ist?«, fragt der Barkeeper Johnny.
»John.«
»John? Ein guter Name.«
»Danke, hab ich zum Geburtstag bekommen.«
»John.«
»Genau. Oder Johnny. Alle sagen Johnny.«
»Und deiner ist?«
»James. Oder Jimmy.«
»Und ihr seid Brüder«, sagt der Barkeeper.
»Korrekto.«
»Jimmy und Johnny?«
»Jep.«
»Weißt du, wie unser Nachname lautet?«, fragt Johnny.
»Wie?«
»Du wirst denken, wir verarschen dich.«
»Sag.«
»Johnson.«
»Joh…? Was? Johnson? Komm schon.«
»Ich sag’s dir.«
»James und John Johnson? Wirklich?«
»Sag das drei Mal schnell hintereinander«, sagt Jimmy.
»John Johnson? Wirklich?«
»Klingt wie ein Pornostar«, sagt der Säufer.
»Hey, ich hab das mal meine Eltern gefragt«, sagt Johnny. »Ich frag sie: ›Was soll der Scheiß. Was habt ihr euch dabei gedacht?‹«
»Naja, gute Marketingstrategie.« Der Barkeeper zuckt die Schultern. »Man wird sich immer an euch erinnern. Darf ich dich eigentlich was Persönliches fragen?«, wendet sich der Barkeeper plötzlich an Jimmy.
»Achtundzwanzig Zentimeter«, lallt Jimmy, woraufhin die Männer wieder in wild lachendes Gegröle ausbrechen.
»Hey«, wirft Johnny plötzlich in die Runde, »wisst ihr, was Jimmys erster Anmachspruch war?«
»Was wird das jetzt?«, wird Jimmy plötzlich nüchtern. »Bist du behindert?«
»Er sagte: ›Hey, wollen wir mal zusammen ins Kino gehen? Ich zahl auch‹«
»Wer kann da widerstehen?«, fragt der Barkeeper.
»Hey, ich weiß noch, als dich ein Mädchen angesprochen hat!«, entgegnet Jimmy. »Wir waren in einer Disco und sie sagte ihm, was für schöne Augen er hätte und Johnny sagte dann: ›Guck deine mal an!‹«
Johnny lacht laut los: »Scheiße! Das hatte ich schon total verdrängt!«
Alle lachen, bis auf Jimmy, der sich die nächste Zigarette ansteckt: »Feuer, Johnny.«
»Hey, du hast Kippen!«, ruft Johnny.
»Ich hatte Kippen. Feuer.«
»Du schnorrst den ganzen Abend schon Zigaretten von mir!«
»Nicht den ganzen. Feuer.«
»Gib mir eine!«
»Ich hab keine mehr!«, nuschelt Jimmy. »Ich schwöre es dir! Ich hab sie gerade in meiner Jacke gefunden.«
»Okay«, ruft Johnny in die Runde. »Eigentlich versuchte Jimmy sein Glück bei Frauen schon viel früher. Seine ersten Versuche startete er im Kindergarten. Jimmy wollte ein Mädchen mit einem Furz zum Lachen bringen.«
»Johnny«, seufzt sein Bruder. »Feuer.«
»Passt auf«, fährt Johnny lachend fort. »Weil Jimmy aber keinen Furz zur Verfügung hatte, versuchte er mit vollster Gewalt einen herauszupressen und hat sich vor ihren Augen einfach in die Hose geschissen!«
Ihr hemmungsloses Lachen gleicht jetzt dem einer Horde Hyänen. Johnny schlägt Jimmy immerzu auf den Rücken, doch Jimmy, ohne eine Miene zu verziehen, erhebt sich und wendet sich von der Gruppe ab.
»Verflucht sei dein Erinnerungsvermögen, Johnny«, seufzt er, während er seine Zigarette in die Ecke wirft.
»Das erinnert mich an Dali«, sagt der Barkeeper, während er sich die Tränen abwischt.
»Der Künstler?«, fragt Johnny.
»Weil er nicht wusste«, fährt der Barkeeper fort, »wie er die Aufmerksamkeit einer Frau bekommen sollte, schmierte er sich komplett mit Exkrementen voll und tanzte vor ihr nackt herum.«
»Scheiße Jimmy! Da hat dich jemand überboten!«, schreit Johnny lachend.
»Ich glaub nicht«, sagt Jimmy, während er nach draußen blickt. »Das Ziel war es, die Aufmerksamkeit einer Frau zu bekommen und das haben wir beide erreicht.«
»War es nicht dein Ziel, sie zum Lachen zu bringen?«, fragt der Barkeeper.
»Auch das habe ich erreicht.« Jimmy blickt unruhig durch den Raum. Als wäre er nervös, als wäre er in Eile. Immerzu sieht er aus dem Fenster.
»Ist das der Humor, mit dem du immerzu versuchst, deine Dates zu beeindrucken?«, ruft der Barkeeper Jimmy zu.
»Wir brechen auf« wendet Jimmy sich plötzlich wieder der Gruppe zu. »Man soll immer aufhören, wenn’s am schönsten ist.«
»Warte, Jimmy!«, ruft sein Bruder heiter. »Chef, eins noch. Deine Ehe … würdest du noch mal heiraten wollen?«
»Nein.«
»Nein?«
»Sie war die beste Frau, die ich mir überhaupt vorstellen kann.«
»Gab es da keine Intrigen?«, fragt Johnny. »Mani-pulationen? Hinterhalte?«
»Doch, jetzt, wo du es sagst.«
»Siehst du?«, ruft der Säufer.
»Aber auf eine sanftmütige Weise«, fährt der Barkeeper fort.
»Sanftmütig!?« Wie ein Schimpanse hämmert der Säufer lachend immerzu sein Glas auf den Tresen.
»Was meinst du mit sanftmütig, Chef?«, fragt Johnny.
»Ich war früher ein leidenschaftlicher Pilzsammler«, erzählt der Barkeeper. »Wir hatten ein Haus an einem Waldrand. Ich war dort fast jeden Morgen Pilze sammeln. Ich liebe es, sie zu sammeln, sie zuzubereiten, Rezepte auszuprobieren.«
»Klingt nach der reinsten Meditation«, sagt Johnny.
»Meine Frau liebte es, spazieren zu gehen«, fährt der Barkeeper fort. »Ich hasste es. Sie wollte, dass ich sie begleite, aber ich wollte nicht. Und weil sie so dringend wollte, dass ich sie begleite, nahm sie mein Pilzhandbuch und studierte es. Dort fand sie eine Pilzart, die besonders nach Regen sprießt und die Information, wo sie wächst. Sie wartete also auf den nächsten Regen. Als er dann vorbei war, kam sie zu mir und sagte, ich solle nach draußen gehen, weil dort jene Pilzsorte gerade sprieße. Und nicht nur das. Sie hat sogar meine Kochbücher durchstöbert und wusste, wie ich diese Pilze dann zubereiten konnte. Ich wurde weich und sie bekam ihren Spaziergang mit mir.«
Eine schwere Stille hängt plötzlich über ihnen.
»Ich sage euch«, fährt der Barkeeper fort. »Ein Mann, der versucht, sich gegen solche Intrigen einer Frau zu wehren, ist ein Dummkopf.«
»Meine Ex-Frau«, fängt der Säufer plötzlich an. »Meine Ex-Frau hat meinem Sohn mal ein rotes T-Shirt für die Schule gekauft! Dabei hat er ausdrücklich gesagt, er wolle kein rotes! Er hasst Rot! Alles ist okay, außer rot! Sie aber tut es trotzdem! Sie legt ihm das T-Shirt aufs Bett und als er nach Hause kommt und es sieht, beginnt ein Riesentheater! Er schreit sie an und brüllt und jault und … Ich wusste gar nicht genau, um was es geht! Sie aber tut gar nichts. Sie blickt nur traurig zu Boden!«
»Und da bekommst du Mitleid mit deiner Frau«, sagt Jimmy, ohne den Blick vom Barkeeper abzuwenden.
»Na klar!«, fährt der Säufer fort. »Sie kauft ihm Klamotten für die Schule und er brüllt sie an und … Zu meiner Zeit hatten wir nicht die Freiheit, uns auszusuchen, was wir tragen! Wir mussten alles tragen, was man uns vorgelegt hat und waren dankbar dafür!«
»Die Erde dreht sich«, sagt Johnny.
»Also brülle ich den Jungen an«, erzählt der Säufer weiter, »schicke ihn auf sein Zimmer, streiche ihm das Abendessen! Später am Abend geht meine Frau in sein Zimmer, bringt ihm heimlich Abendessen und entschuldigt sich bei ihm! Noch dazu rechtfertigt sie mein Verhalten damit, ich sei im Stress wegen der Arbeit, er möge doch Verständnis haben!«
»Sie hat ihn gegen dich aufgehetzt«, sagt Jimmy, während er und sein Bruder den Barkeeper fixieren. Der Barkeeper aber hält dem stand.
»Meine Frau hat auch immer mit dem Mund gedacht!«, quatscht sich der Säufer in Rage. »Tagein, tagaus. Bla bla bla! Manchmal frage ich mich, ob sie überhaupt mit mir gesprochen hat oder einfach nur den Müll in ihrer Birne loswerden wollte! Ich sag euch eins! Wenn ihr von einer Frau alles wissen wollt, dann stellt ihr keine Fragen!«
»Meine Frau konnte alles für sich behalten«, sagt der Barkeeper.
»Meine auch«, lächelt Johnny. »Es gibt Ausnahmen, mein Freund«, er greift dem Säufer an die Schulter. »Hier. Schau dir Jimmy an! Er entspricht auch nicht dem typischen Mann!«
»Er scheißt sich in die Hose, um einer Frau zu impo-nieren!«, sagt der Barkeeper.
Wieder brechen, bis auf Jimmy, alle in Gelächter aus.
»Sag mal, Chef«, fragt ihn Jimmy plötzlich gereizt. »Wie ist deine Frau gestorben?«
Stille.
»Hast du sie auf dem Gewissen, Chef?«, setzt Jimmy nach.
»Jimmy«. Johnny legt seine Hand auf die seines Bruders.
»Er sagt doch selbst«, bleibt Jimmy ernst, »er ist im Reinen damit, rückt aber nicht mit der Sprache raus. Also entweder ist er nicht im Reinen damit oder hat was mit ihrem Tod zu tun.«
Der Barkeeper wird plötzlich nervös. Starrt die beiden an. Ausdruckslos. Zumindest versucht er das. Seine glasigen Augen und ein zitternder Unterkiefer verraten ihn jedoch.
»Sie war sehr krank«, schluchzt der Barkeeper.
»Krebs?«, fragt Jimmy.
»Ein Virus.«
»Ein Virus? Und weiter?«
»Jimmy!«, faucht Johnny.
»Johnny, er kann für sich selbst sprechen, nicht wahr Chef?«
»Ein Virus hat sie von innen aufgefressen«, sagt der Barkeeper. »Einen Nerv nach dem anderen. Letzten Endes lag sie blind und bewegungslos im Sterbebett und ist irgendwann im Schlaf erstickt.«
Die Unterlippe des Barkeepers bebt förmlich. So stark, dass selbst der Säufer es merkt.
»Scheiße, Jimmy!«, seufzt Johnny. »Was ist auf einmal los mit dir?«
»Habe ich etwas Falsches gesagt?«, fragt der Barkeeper.
»Jungs, jetzt ist aber gut!«, wirft der Säufer ein. »Kommt schon!«
Doch der Barkeeper und Jimmy fixieren einander. Alles um sie herum verpufft, als wären nur sie beide in diesem Raum.
»Chef, was ist das für ein Gefühl«, lächelt Jimmy, »jemanden zu töten?«
»Jimmy«, seufzt sein Bruder. »Er hat es verstanden. Hast du doch, nicht wahr, Chef?«
»Ich … ich … ich verstehe das Ganze nicht«, sagt der Barkeeper.
»Aber du weißt, worum es hier geht, oder nicht?«, fragt Jimmy.
»Ich … ich … ich verstehe es nicht.«
»Ich glaube, du weißt es. Du willst es nur nicht wahrhaben«, sagt Jimmy.
»Jimmy, hör endlich auf!«, sagt Johnny. »Er hat’s kapiert. Hast du doch, nicht wahr, Chef?«
Der Barkeeper nickt zögernd.
»Du hast keine Ahnung, wer ich bin, oder?«, fragt Jimmy.
Der Barkeeper zittert am ganzen Körper.
»Ich glaube, er weiß nicht mal, warum wir hier sind«, sagt Johnny.
Der Barkeeper nickt, wenn auch nur zögernd. Er hatte sich geschworen, auf diesen Moment vorbereitet zu sein. Sowohl mental als auch physisch. Er hatte sich geschworen, sich zu wehren, bis zum Schluss zu kämpfen. Sich durch nichts unterkriegen zu lassen. Für seine Tat einzustehen. Sie war nicht falsch. Sie war nicht verwerflich. Sie war ein Segen. Sowohl für ihn, als auch für sie. Besonders für sie.
»Was?«, ruft der Säufer. »Warum seid ihr hier?«
»Gibt es etwas, das ich tun kann«, nuschelt der Barkeeper stotternd in seinen Bart, »oder … ich meine …«
»Fürchte nein, Chef«, sagt Jimmy. »Ist ’ne Einbahnstraße.«
»Geld?«, fragt der Barkeeper.
»Ist was Persönliches, Chef.« Verlegen lächelnd zuckt Johnny die Schultern.
»Lasst es mich erklären«, fleht der Barkeeper.
»Wir kennen die Fakten«, sagt Johnny. »Du hast deine Frau umgebracht und jemanden aus ihrer Familie damit sauer gemacht.«
»Mich«, sagt Jimmy.
»Ihn«, deutet Johnny auf seinen Bruder. »Ich stand ihr nicht so nah.«
»Ich hatte dich gewarnt«, sagt Jimmy. »Erinnerst du dich? Lass sie leben, hab ich gesagt. Finger weg.«
»Sie war sehr krank«, sagt der Barkeeper. »Sie hat sehr gelitten.«
»Spielt keine Rolle«, zuckt Johnny die Schultern. »Letzten Endes war sie unsere Mutter.«
Die beiden Brüder sehen ihn an. Wie er dasteht. Sein Gesicht tränenüberströmt. Dieser so kräftige Mann mit seiner tiefen, rauen Stimme. Jetzt nur noch ein Häufchen Elend, verzweifelt, zitternd. Er sieht den beiden Brüdern in die Augen, hofft etwas darin zu finden. Etwas, das ihm sagt, dass alles wieder gut wird. Immerhin haben sie sich so gut verstanden. Irgendwas. Wenigstens einen Funken von Bedauern.
»Jungs!«, ruft der Säufer. »Was ist hier los?«
Jimmy zieht aus seiner Innentasche eine schallgedämpfte Pistole und schießt dem Säufer in den Kopf. Ehe der Barkeeper realisieren kann, dass sich der halbe Schädel seines Gastes auf seinem Bartresen verteilt hat, hat Johnny ihm bereits ins Gesicht geschossen.
»Hör auf, dich ständig vor anderen über mich lustig zu machen!«, schreit Jimmy seinen Bruder plötzlich an, während er seine Waffe wieder einsteckt.
»Anders verstehst du ja nicht, wann Schluss ist! Ach …«, winkt Johnny ab, »das hätten wir gleich machen sollen.« Genervt gibt er zwei weitere Schüsse auf die Leiche des Barkeepers ab.
»Konnte ich doch nicht wissen«, faucht Jimmy, während er sich die nächste Zigarette anzündet, »dass der Säufer hier die ganze Nacht abhängt!«
»Du Wichser! Gib mir endlich eine Zigarette!«
»Das ist diesmal wirklich die letzte! Wirklich!«
Beide Brüder verlassen die Bar …
BUCH 2KANINCHENKAMPF
0
»… beide Brüder verlassen die Bar.«
Stille. Die zwei Schwachköpfe starren mich an, als hätten sie die ganze Zeit über nicht zugehört. Ich glaube, die versuchen immer noch herauszufinden, wer von denen Jimmy, wer Johnny war. Gott war das nervig, als die ständig versucht hatten, das untereinander zu klären. »Nein, Johnny war der mit der Ehe und dem braunen Haar.« »Nein Jimmy hatte das braune Haar.« »Ja, aber er war nicht verheiratet.« »Genau.«
Idioten. Puh.
»Krasse Geschichte«, sagt der Bulle endlich. »Kennst du ihn?«
Jetzt schiebt er mir ein Foto von irgendeinem bärtigen Typen zu.
»Keine Ahnung«, sage ich.
»Das ist der Barkeeper«, sagt der Bulle. »Drei Kopfschüsse. Das war persönlich.«
»Der Scheiß ist wirklich passiert?«, frage ich.
»Der Scheiß ist wirklich passiert«, sagt der Bulle. »Kennst du ihn?«
Wieder ein Bild. Irgendein junger Typ mit Frau und einem kleinen Jungen. Wirken allesamt glücklich. Fast schon beneidenswert.
»Das andere Opfer«, sagt er.
»Der Säufer?«, frage ich erstaunt. Ich hatte ihn mir ganz anders vorgestellt.
»Was weißt du über ihn?«, fragt mich Doktor Jueck.
»Nichts!« Da kann ich wirklich nur die Schultern zucken. »Zur falschen Zeit am falschen Ort, denk ich mal. Die ganze Geschichte wäre ein cooler Werbespot gegen Alkoholismus.«
»Findest du, ja?«, fragt der Bulle.
»Bisschen«, muss ich grinsen. »Was wollt ihr von mir hören? Ihr meint, Slava hatte mit den Johnson-Brüdern zu tun?«
»Definitiv«, sagt der Bulle.
»Wach auf, mein Sohn.«
Ich gehorche. Bin wach, sitze wie auf Knopfdruck nahezu aufrecht. Keine Ahnung, warum, aber diese Stimme wirkt sehr vertraut … andererseits aber auch verdammt beunruhigend.
»Weißt du noch, wer ich bin ich?«
Dieser Akzent, diese Statur, dünn, fast schon mager, faltig, alter Mann. Ich liege in meinem Bett, stelle ich fest, falls das überhaupt mein Bett ist oder gar mein Zimmer. Klein, eng, sowohl das Bett, als auch der Raum. Dunkelheit, bis auf die kleine Leselampe am Schreibtisch. Hab ich überhaupt Fenster? Der Typ sitzt an meiner Bettkante, streicht mit der Hand über meinen Kopf, als würde er mir jeden Moment einen Gutenachtkuss aufdrücken … oder mir in die Hose fassen. Kommt ganz darauf an, ob ich an meinen Großvater oder an meinen Onkel denke.
»Mein Sohn«, lächelt er mich an. Oder zeigt mir vielmehr wie ein Raubtier seine teils vergoldeten, größtenteils kaputten Zähne.
Einerseits hab ich so eine Angst, dass ich kurz davor stehe, aus beiden Ausgängen wie ein Jetpack loszugehen, andererseits scheint mir diese Angst, beinahe schon Panik oder gar Nahtoderfahrung, vertraut zu sein. Ich gehe schon fast so weit zu sagen, dass ich sie vermisst habe.
»Sind wir verwandt?«, frage ich aus einem Impuls heraus.
»Nein«, lächelt er.
Jetzt erkenne ich ihn. Das kann nicht sein: »Pawel?«
»Schön, dich wiederzusehen, Junge.« Wieder streicht er mir mit seiner Hand über meinen … mir fällt erst jetzt auf, dass ich eine Glatze habe.
»Pawel?«, frage ich wieder. »Ich dachte, du bist tot.«
Er lächelt.
»Ich brauche deine Hilfe«, sagt er. »Sie suchen meinen Sohn.«
»Slava lebt?«
»Natürlich lebt er. Er lebt und hat seinen Frieden gefunden.«
»Was machst du hier?«, frage ich.
»Erzähle ich dir gleich. Als erstes musst du hier raus.«
Ich öffne die Augen. Ich war wohl wieder eingepennt. Keine Ahnung mehr, wann und wo. Und ich bin es allmählich leid, das immer wieder festzustellen.
»Schlaf weiter, Junge«, höre ich Pawels Stimme.
Ruckartig richte ich mich auf und erkenne, dass ich auf seinem Rücksitz gepennt habe. Wir fahren, eigentlich fährt er. Ich lasse mich fahren. Landschaft, Berge, See, bewölkt und doch … wunderschön. Derart, dass ich weinen muss.
»Mein Gott!« Hastig öffne ich das Fenster.
»Spring mir bloß nicht aus dem Auto!«, lacht Pawel.
»Die Luft!«, rufe ich, während ich wie ein Hund meinen Kopf aus dem Fenster, dem Wind entgegenstrecke, den Mund weit offen, die Augen geschlossen. Dieser Geruch von … ich weiß es nicht. Natur eben. Er erinnert mich an den Schwarzwald. Wo ich aufgewachsen bin.
Ich schreie, ich rufe, ich juble, ich bin wieder im Wagen. Völlig aus der Puste, mein Herz rast. Lange ist es her, dass ich so glücklich war. War ich das jemals? Andernfalls könnte ich es nicht benennen, oder?
»Pawel«, schluchze ich.
»Sprich.«
»Es kommt mir vor, als … als hätte ich diese Luft seit Ewigkeiten nicht mehr gerochen! Zehn Jahre oder so was!«
»Fünfundzwanzig, Junge.«
»Was?«
»Seit fünfundzwanzig Jahren halten sie dich schon gefangen.«
Wieder wache ich auf. Diesmal liege ich auf einem Liegestuhl, direkt an einem See, eigentlich in einem See. Pawel hat mich wohl hierhergetragen, mir meine Socken und Schuhe ausgezogen und mich samt Stuhl in den See gestellt. Ich weiß noch alles! Sein Besuch in meinem Zimmer, die Autofahrt! Das ist das erste Mal, dass ich mich bis ins Detail erinnere, ohne zu kotzen!
»Pawel! Ich erinnere mich an dich!«
»Das ist schön, Junge.«
Pawel kniet hinter mir am Ufer vor einem Grill und dreht die Schaschlikspieße.
»Ich erinnere mich an die Autofahrt!«, rufe ich. »An deinen Besuch in meinem Zimmer! Ich erinnere mich an die letzten beiden …«
»Weil du seit einer Weile keines von diesen Medikamenten mehr hattest«, sagt er, während er mir einen Spieß bringt. »Hier, probier mal.«
»Aber ich hab immer noch diese Blackouts«, sage ich.
»Dein Körper entgiftet. Das wird dauern, bis das komplett weg ist.«
Vor lauter Hunger verbrenne ich mir meinen Mund an dem Spieß und lasse ihn vor Schreck und Schmerz ins Wasser fallen.
»Langsam, Junge.« Pawel nimmt den Spieß aus dem Wasser und holt mir einen neuen.
Gott schmeckt das gut!
»Langsam, ruhig«, lacht er. »Es ist heiß.«
Ich halte es nicht mehr aus. Das Gepuste und das vorsichtige Anknabbern. Ich tauche den Spieß ins Wasser und verschlinge das Fleisch nur so wie ein wildes Tier.
»Junge, wir haben nicht mehr so viel Zeit«, sagt er. »Du hast viel zu lange geschlafen. Ich erkläre dir alles, aber du musst mir helfen. Ich muss meinen Sohn finden.«
Und hier werde ich skeptisch. Ich weiß, ich habe einen Schaden. Man redet mir das nicht nur ein, ich merke selbst, dass etwas mit mir nicht stimmt. Keine glorreiche Erkenntnis. Aber ich habe noch genug Grips in mir, um, was Pawel angeht, zu sagen, da stimmt etwas nicht. Ich gehe in mich und überlege. Denn Pawel Saizew war für mich immer ein Mann, für den, meiner Erinnerung nach, Freiheit höchste Priorität hatte. Wobei ich hier wirklich sagen muss, dass …«
1
Pawel Saizew, war für mich immer ein Mann, für den, meiner Erinnerung nach, Freiheit höchste Priorität hatte. Wobei ich hier wirklich sagen muss, dass seine Definition von Freiheit völlig verzerrt war. Allein schon deswegen, weil er die Frau und das Konzept von Ehe und Familie für maßgebende Feinde der Freiheit hielt. Ich weiß nicht, was er Schreckliches in seiner Kindheit durchleben musste, um so zu werden, wie er geworden war. Und das nicht nur wegen seiner feindseligen Haltung Frauen gegenüber, sondern hauptsächlich aufgrund dessen, was er seiner Familie angetan hatte. Dazu komme ich noch. Ich glaube, man kann anhand seiner Handlungen von selbst erahnen, wie Pawels Kindheit ungefähr ablief.
Einerseits kann ich Pawels Gemüt verstehen. Der Mann kommt aus der Sowjetunion. Von sich hatte Pawel selten erzählt und wenn, dann nur bruchstückhaft und extrem übertrieben, sodass er immer als Held aus der Geschichte hervortrat. Eher hatte er von seinen Großeltern erzählt, bei denen er aufgewachsen war. Und ich weiß, dass sein Großvater zu Zeiten Stalins im Gulag für die Hinrichtungen zuständig war. Er hatte täglich mit so vielen Hinrichtungen zu tun, dass die Regierung für ihn und die anderen Wärter Masseure bestellt hatte. Masseure, die ihre Zeigefinger massieren sollten, um die Sehnenscheidenentzündung zu kurieren, die sie sich im Abzugsfinger eingefangen hatten, weil sie so oft abdrücken mussten. Ich weiß nicht, wie viele sein Großvater ausgeknipst hatte. Ich meine, er hatte irgendwann ab hundert aufgehört zu zählen. Stalin hatte damals eine Verhaftungsquote eingeführt, die jeder Polizist täglich zu erfüllen hatte, andernfalls wurde der Polizist selbst der Spionage beschuldigt und in den Gulag deportiert. Ich sage das einfach, um nur mal ein Gefühl dafür zu geben, wie viele dorthin täglich deportiert wurden.
Und jetzt stell dir vor, du musst mit so einem Großvater aufwachsen. Was glaubst du, wie viel Frust so ein Typ an dir ablädt, erst recht, wenn er sich zusätzlich sein Leben lang damit quälen muss, dass auch sein Sohn irgendwann in den Gulag deportiert worden war, jedoch mit dem Vermerk »Bitte keine Post zustellen«, was bedeutete, dass er hingerichtet wurde. Bis heute weiß niemand, weshalb Pawels Vater deportiert wurde. Ich glaube, er wusste es selbst nicht mal. In der Regel liefen die Verhöre dort so ab, zumindest hatte Pawel es mir damals so erzählt, dass sie dich fragen: »Warum bist du hier?«
Und der Gefangene entgegnet meist: »Das sollten Sie mir doch eigentlich sagen, oder nicht?«
»Nein. Du sagst uns, warum du hier bist und wir entscheiden, wie wir dich bestrafen sollen.«
Und solange du darauf nicht antworten kannst, verbringst du einsame Zeiten in einer dunklen, versifften Zelle. Letzten Endes lag es, glaube ich, daran, dass Pawels Onkel in Europa lebte, was Stalin jeden Grund gab, Pawels Vater der Spionage zu bezichtigen. Ich meine, schlag das Geschichtsbuch auf. Stalin war paranoider als ein Homosexueller in einem muslimischen Dorf. Und somit wurde auch Pawels Mutter deportiert, immerhin war sie die Frau eines Spions. Dort starb sie in weniger als vier Monaten an … keine Ahnung. Sagen sie dir nicht. Kann alles sein. Die Strapazen der Zwangsarbeit, Unterernährung, Totschlag, wer weiß. Pawels Großvater, aufgrund seiner vorbildlichen Arbeitsleistung, wurde begnadigt, entlassen und durfte seinen Enkel Pawel behalten und großziehen, dem er Gott weiß was antat, damit dieser so enden musste wie er eben geendet ist. Ach ja, und sie durften nicht mehr in Russland leben. Also »ab in den nächsten Zug nach Kasachstan«, hat man ihnen gesagt. Sei’s drum, er ist nicht die Hauptfigur in dem Ganzen.
Pawel wuchs also in einer schäbigen Kleinstadt in Kasachstan auf, hatte hier und da Affären, Prügeleien, ein massives Alkoholproblem, immerzu Schwierigkeiten mit den Behörden und lebte finanziell und materiell mit dem absoluten Minimum. Zusammen mit seinem besten Freund, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnern kann, teilte er sich eine fünfzehn Quadratmeter kleine Studentenwohnung. Der beste Freund starb sehr jung, hat sich volllaufen lassen und ist zu Hause im Schlaf an seinem Erbrochenen erstickt. Pawel absolvierte sein Studium als Wirtschaftsingenieur, wurde nach dem Tod seines besten Freundes trocken und wanderte einige Tage nach dessen Tod in die Ukraine aus.
Damals war die Ukraine im Vergleich zu Kasachstan die USA der Sowjetunion: Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Zumindest wurde das den Menschen so verkauft. Ich erzähle nur weiter, was Pawel mir damals erzählt hat. Jedenfalls war das sehr lange, bevor all die Unruhen, der Bürgerkrieg und der Krieg gegen Russland das Land verunstalteten. Und lange vor der Auflösung der Sowjetunion und der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine. Er meinte, in Kasachstan gäbe es nicht viel zu holen. Allein das Land selbst: derart flach, das Panorama ein nahezu endloses Nichts. Wenn dein Hund wegläuft, könntest du ihn zwei Wochen später immer noch in der Ferne davonrennen sehen.
In der Sowjetunion bekamst du als Single keine Mietwohnung. Und so lernte Pawel mit Mitte zwanzig in der Ukraine seine damals achtzehnjährige Frau Darja kennen, schwängerte und heiratete sie nach nur wenigen Wochen Beziehung, und von da an verlor er völlig den Verstand. Es fing damit an, dass er sich durch die Ehe mit ihr derart in seiner Freiheit eingeschränkt fühlte, dass er immerzu das Haus verlassen musste und draußen wie ein Tiger im Käfig Kreise zog. Er wurde sehr leicht reizbar, seine Wutanfälle häuften sich. Er begann wieder mit dem Trinken und schlug seine Frau. Jedoch besaß er noch den »Anstand«, so sagte er es mir, sich selbst einzureden, dass schwangere Frauen nur im Notfall, am besten gar nicht, geschlagen werden dürfen. Er verließ somit die Wohnung und ließ sich für lange Zeit nicht mehr blicken. Per Post sendete er immerzu Briefumschläge, gefüllt mit Geld für Miete und Verpflegung.
Als sein Sohn, Veaceslav Saizew, also Slava, zur Welt kam, ließ er sich noch immer nicht blicken. Irgendwann kamen auch keine Geldumschläge mehr, sodass Darjas Eltern für die Verpflegung aufkommen mussten. Doch da auch sie alles andere als wohlhabend waren, konnten sie ihre Tochter nicht mehr lange versorgen, sodass Darja ihre Wohnung kündigen und zurück zu den Eltern ziehen musste.
Nach sechs Monaten ließ Pawel sich endlich wieder bei ihr blicken. Aufgebracht, panisch erklärte er ihr, er habe während all der Zeit nach einer Fluchtmöglichkeit aus der Sowjetunion gesucht. Die Revolution nahe und die Union sei am Zusammenbrechen. Sie müssten sofort ihre Koffer packen. Das Ganze endete im Streit, begleitet von sehr viel Geschrei. Im Vergleich dazu, was er ihr sonst immer antat, verlief es dieses Mal nur mit mäßiger Gewalt. Kurz gesagt, sie wurde von ihm mehrmals gepackt und gegen diverse Möbelstücke geworfen. Ihre Eltern mischten sich ein, das Geschrei nahm zu. Auch seinen Schwiegervater schrie Pawel an, sie müssten das Land verlassen, hier gäbe es keine Zukunft, Deutschland sei die Rettung, und so weiter. Auch ihn warf er durch den Raum. Schreiend, von Zorn geleitet, verließ er wieder die Wohnung.
Wochen später tauchte er wieder auf, tränenüberströmt, um Verzeihung bittend. Er erzählte Darja und seinen Schwiegereltern von Deutschland. Dass er dort seine Cousins besucht habe und dass dort eine völlig andere Welt mit völlig anderer Mentalität herrsche. Sein Staunen war kaum in Worte zu fassen. Zumindest für ihn. Und er versprach seiner Frau eine bessere Zukunft. Er schwor ihr, dass er dort bereits einen Job hätte. Sein Cousin hätte ihm was bei sich auf dem Bau verschafft. Es sei nur vorübergehend, bis er Deutsch gelernt hätte und danach endlich das machen könne, was seinem Studium entspräche. Sie war unschlüssig. Ihre Eltern rieten ihr davon ab. »Glaub ihm kein Wort« und so weiter. Pawel griff in seine Tasche und zeigte ihr einen Batzen Geldscheine, umgerechnet an die fünfzehntausend Mark oder mehr.