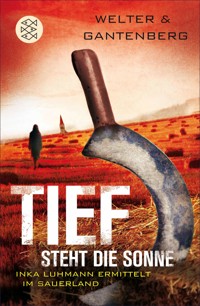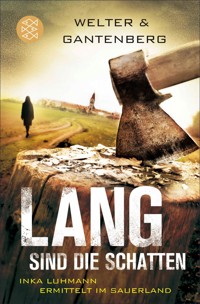8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inka Luhmann ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Die Botschaft der Toten Mord mit Stichmuster: Kommissarin Inka Luhmanns erster Fall im Sauerland, der vielleicht uneitelsten Region Deutschlands Schock im Sauerland: im Garten des örtlichen Ex-Schützenkönigs liegt eine Leiche - Augen, Ohren und Mund sind mit groben Stichen zugenäht. Neu-Kommissarin Inka Luhmann hat es nicht leicht bei nervösen Hotelbesitzern und misstrauischen Schützenbrüdern, denn nicht sie, sondern ihr Mann stammt aus der Gegend. Selbst Polizist, macht er im Rollentausch auf Elternzeit, schmeißt den Haushalt und berät Inka gern inoffiziell bei ihren Ermittlungen. Als eine weitere Leiche auftaucht, ebenso vernäht wie die erste, fragt sich Inka: Was bedeutet das? Und wie kann sie die Morde stoppen, bevor es noch ein Opfer gibt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Sammlungen
Ähnliche
Oliver Welter Michael Gantenberg
Kalt geht der Wind
Inka Luhmann ermittelt im Sauerland
FISCHER E-Books
Inhalt
1
Freitag, 2:24 Uhr
Kein Mond war der beste Mond. Zumindest, wenn man nicht gesehen werden wollte. Die beiden Männer saßen Seite an Seite auf dem Mittelsteg ihres Angelbootes und legten sich kräftig in die Riemen. Eine schweißtreibende Angelegenheit in hüfthohen Gummihosen mit angesetzten Stiefeln.
»Ich sag’ dir, den ganzen Baumarktscheiß kannst du komplett in die Tonne treten.«
Wie bei jedem ihrer nächtlichen Ausflüge ließ der Größere der beiden seiner Abneigung gegen minderwertige Ausrüstungsgegenstände freien Lauf.
»Du sagst vielleicht, hey, es ist nur eine Verpackung. Aber ich sage: Wer keinen Wert aufs Detail legt, darf sich nicht wundern, wenn alles schiefgeht«, fuhr er fort.
Der Kleinere verdrehte die Augen und sah über den schwarzen Spiegel des Hennesees zum gegenüberliegenden Ufer. Die Lichter von Meschede brachen sich auf der Wasseroberfläche. Das leise diffuse Rauschen der Stadt wehte mit dem sanften Wind herüber. Tiefschwarzes Wasser gluckste träge gegen die Planken des Bootes.
Die beiden wussten, dass sie nur noch heute Nacht Beute machen konnten. Ab morgen würden drüben am Ufer, etwas außerhalb der Stadt, die Vorbereitungen für das alljährliche Schützenfest beginnen. Über eine Woche Ausnahmezustand. An nächtliche Ruhe war dann nicht zu denken.
»Und weil du Wert aufs Detail legst, hast du die Plane eigenhändig bei Vollmond von jungfräulichen Bergtrollmädchen flechten lassen«, seufzte er.
»Nee, bei Ikea geklaut.« Das hatte der Kleinere jetzt nicht erwartet, bekam aber umgehend die fällige Erklärung.
»Fünfzehn Einkaufstüten, auseinandergeschnitten, zusammengenäht und fertig. Ich meine, die wollen schließlich nicht, dass den Kunden im Laden ihr ganzer Billigmist auf dem Boden zerdeppert. Also machen sie was? Richtig. Anständige Tüten bauen.«
Der Kleinere atmete durch. Es gab Diskussionen, auf die ließ man sich besser nicht ein. Vor allem, wenn man bis zur Morgendämmerung noch einiges vorhatte.
Er sah zum Heck ihres Bootes. Auf den Planken lagen die zur Plane mutierten fünfzehn Ikea-Tüten und warteten auf ihren Einsatz. Der Inhalt, den sie diskret verbergen sollten, weilte noch direkt unter dem Boot am Grund des Sees. Die Männer waren jetzt in Ufernähe angekommen. Ihr Zielgebiet, in dessen schilfig schlammigem Schutz sich ihre Beute mit Vorliebe verbarg.
»Bist du sicher, dass das ein Waller ist?«, fragte der Größere.
»Und was für einer. Kann ein Echolot lügen?«, antwortete der Kleinere und sah von einer armbanduhrgroßen Apparatur um sein Handgelenk auf. Das grünliche Leuchten des Monochromdisplays ließ sein Grinsen unnatürlich strahlen. Er sah zum nahen Uferstreifen, der sich dunkel von der noch dunkleren Wasseroberfläche absetzte. Dahinter stiegen Luxusgärten schemenhaft und sanft zu den Villen der Besserverdienenden an. Bonzengegend. Sie durften nur nicht zu nah an die Grundstücke geraten. Wer wusste schon, welche Art Alarmanlagen die hier installiert hatten.
»Und warum bewegt der Waller sich nicht?«
»Weil er lauert.«
»Jau, auf uns …«, freute sich der Größere und kalkulierte im Geiste schon mal etliche Kilos zu einem verdammt lukrativen Gesamtpreis zusammen. Den würde der Küchenchef eines Restaurants oben in Schmallenberg dafür schon berappen müssen.
»Biss!«
Der Kleinere sprang auf und riss den Größeren aus seinen Träumen. Die kompakte Raubfischrute bog sich mit einem Ruck zur Oberfläche des Sees. Die Multirolle spulte die dicke Hemingway-Schnur mit einem sonoren Sirren ab. Fünfzig Meter Schnur für eine Wassertiefe von nicht mehr als drei Metern, das musste reichen.
»Gibt’s doch nicht, ’n echter Waller!«
Die anfängliche Skepsis des Größeren war purer Jagdleidenschaft gewichen.
»Leise! Willst du, dass die uns erwischen?«
Die Ermahnung war berechtigt. Die Wallerbestände waren in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen, weswegen die Obere Fischereibehörde in Meschede eine Schonzeit verhängt hatte. Und der Fischmeister der Behörde war ein harter Hund. Die Missachtung der Schonzeiten in seinem Gewässer nahm er persönlich. Nicht selten war er sogar bereit, seine Freizeit und seinen Schlaf dem Kampf gegen Wilddiebe und Schwarzangler zu opfern. Eine Gefahr, die die Männer im Boot aber bewusst einkalkulierten. Schließlich waren die Schwarzmarktpreise für den Fisch entsprechend hoch.
»Und?«
Der Größere hatte sich wieder unter Kontrolle. Mit geschickten Ruderbewegungen hielt er die Position des Bootes stabil, während der Kleinere einen Fuß auf die Seitenwand gestützt hatte. Im bevorstehenden Kampf mit dem Waller brauchte er Standfestigkeit und Würde. Erstaunt bemerkte er weitaus weniger Widerstand an der Rute als erwartet.
»Das Mistvieh wehrt sich nicht mal, das faule Stück.«
»Typisch Waller, fett und träge«, grinste der Größere.
Der Kleinere zog die Schnur Meter für Meter ein. »Hast du das Gaff?«
Der Größere ließ die Ruder sinken und winkte mit einer Art Stock, an dessen Ende matt ein Haken schmimmerte. Sein Blick wanderte an die Stelle, wo die Angelschnur des Kleineren im nassen Dunkel des Sees verschwand. Noch Sekunden, dann würde der Große den Haken des Gaffs unter den Kiemendeckel des Wallers schieben. Die Augen des Kleineren sprühten vor Beutegier. Er rollte die Schnur immer schneller auf. Schon schimmerte ihnen ein verschwommener Körper aus dem Dunkel des Sees entgegen. Ein ziemlich großer Körper.
»Wow, das ist ja ein echtes Monster.«
Der Größere merkte es in der Sekunde, in der er seinen Gaffhaken in etwas trieb, was ihm zu teigig für Wallerkiemen erschien und gleichzeitig zu knochig für einen Fisch. Der Kleinere reagierte, als sein Komplize ihre Beute an das Boot heranzog.
»Ja, aber es ist kein Waller!«
Der schwere Angelhaken hatte sich in die Schulter eines leblosen Frauenkörpers gebohrt. Im schwachen Licht der Stadt in der Ferne erkannten die beiden, dass es sich kaum um einen Unfall handeln konnte. Augen, Ohren und Mund der jungen Frau waren mit akkuraten Stichen zugenäht.
»Scheiße.«
Der Kleinere schaltete entsetzt sein Echolot aus, während der Größere sich auf der Stelle übergab.
2
Samstag, 9:20 Uhr
»Herzlichen Glückwunsch!«
Inka Luhmann blickte auf den nagelneu glänzenden Autoschlüssel, der unmittelbar vor ihrer Nase baumelte. In seiner lächerlichen Vollkommenheit wurde er nur übertroffen von dem breiten Verkäufergrinsen des Autohändlers dahinter. Wäre jetzt ein Sonnenstrahl auf seine extraweißen Zähne gefallen, ein leises »Pling« hätte Inka nicht gewundert.
Umso enttäuschter war der Mann über ihre Reaktion.
»Den geben Sie besser meinem Mann. Ist sein Auto«, sagte sie und schob den ausgestreckten Arm samt Schlüssel einen halben Meter nach rechts. Zu Henne.
»Oh, verstehe.« Der Verkäufer war ein wenig irritiert, aber Profi genug, seine Fahrzeugauslieferungsprozedur auf Anfang zu spulen und für Henne zu wiederholen.
»Herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto, Herr Luhmann.« Und diesmal war er ungleich erleichterter, weil Henne sein strahlendes Lächeln eins zu eins erwiderte. Stolz wie ein Erstklässler, dem man gerade seine Schultüte in die Hand drückte.
Was bei einem Kerl wie Henne schon etwas befremdlich aussah, dachte Inka. Denn Hendrik, wie Henne eigentlich hieß, war eher der Typ »Kerl wie ein Baum«. Eins neunzig groß und ein klassischer »Triple B«, wie Inkas Freundinnen ihn bei ihrer ersten Begegnung mit vielsagendem Grinsen eingestuft hatten. Blond, breite Schultern, Bart. Genau die Art Holzfäller mit Hirn, die Inka schon immer weiche Knie bereitet hatte. Auch wenn das, womit Henne, einige Dates später, nach Inkas Knien auch ihr Herz erobert hatte, natürlich nicht nur sein Aussehen war, sondern seine weiche Stimme, sein trockener Humor und vor allem seine Grübchen, wenn er lächelte.
Und das tat er oft. Gut, nicht mehr so oft wie früher, als Tom und Mia noch nicht da waren, aber immer noch oft genug, um Inka das Gefühl zu geben, in ihrer Beziehung sei das in Ordnung, was in Ordnung sein musste. Die Basis, ihre Liebe zueinander. Den Rest holte sich nun mal gerne der Alltag.
Heute allerdings nicht. Heute war ein echter Feiertag. Jedenfalls wenn man nach Hennes Grübchen ging. Die hatten sich mittlerweile zu wahren Gruben ausgewachsen. Der Autoschlüssel war in seiner Pranke verschwunden, und der Verkäufer setzte zum Höhepunkt seiner Show an.
»Wenn Sie mir dann bitte in den Präsentationsbereich folgen würden.«
»Zur Übergabe«, flüsterte Henne aufgeregt. Inka lächelte nachsichtig.
»Danke, wäre ich nicht drauf gekommen …«
Sie folgten dem Verkäufer in Richtung des gleißend hellen Zentrums des Autohauses. In dessen Mitte verdeckte, angestrahlt von gefühlten zehntausend Watt, eine edle Fließplane einen großen Gegenstand. Der sah in Abmessung und Form verdächtig genau nach dem Auto aus, das Inka und Henne wochenlang geplant, konfiguriert, durchgerechnet und dann umgeplant, umkonfiguriert und umfinanziert hatten.
»Der Kerl schwenkt jetzt aber nicht noch Weihrauch, oder?«, fragt Inka.
Henne sah sie gespielt tadelnd an.
»Wie oft zieht jemand für dich die Plane von deinem Neuwagen? Das ist so was wie die Geburtsstunde. Das muss zelebriert werden.«
Männer, dachte Inka. Ein neues Spielzeug und die Sonne ging nicht mehr unter. Dumm nur, dass dieses Spielzeug gut und gerne ihr halbes Jahresgehalt auffraß. Und zwar nicht ihr altes, das der Kriminaloberkommissarin aus Dortmund. Sondern das neue. Das der Dezernatsleiterin Abteilung Kapitalverbrechen der Kriminalpolizei Brilon.
Andererseits musste Inka sich eingestehen, ein neues Auto war wirklich keine so schlechte Idee. Nüchtern betrachtet – und Inka betrachtete Dinge beruflich bedingt gerne nüchtern –, war eine Familie nun mal auch eine logistische Herausforderung. Sie selbst, Henne, Tom, Mia und »Böse«, Inkas großer, ewig haarender und schlechterzogener Hund, hatten so ihre Bedürfnisse an Schul-, Kindergarten-, Einkaufs- und Freizeittouren. Und die waren mit Inkas alter Möhre einfach nicht mehr zu bewerkstelligen gewesen.
Noch entscheidender als alle Vernunfterwägungen war allerdings etwas anderes. Eine Art unausgesprochene Übereinkunft zwischen Inka und Henne. Denn das neue Auto war mehr als ein fahrbarer Untersatz mit genügend Stauraum. Es war ein Versprechen. Ein Versprechen darauf, dass Inkas und Hennes Plan funktionierte. Und der beinhaltete nichts weniger als die Umkehrung aller sauerländischen Familientraditionen. Auch wenn so ziemlich alle, denen Inka davon erzählt hatte, eindringlich davor gewarnt hatten. Der Tenor: »Okay, super, dass du arbeiten gehst, Inka. Und dazu noch in Vollzeit. Aber Henne und Hausmann …?!«
Die sauerländische Phantasie schaltete sich ein und entwickelte schnell Untergangsszenarien von kartenspielenden Männern, verwahrlosten Haushalten und Kindern, die von Haustieren erzogen wurden. Und wenn Inka ehrlich war, auch sie selbst konnte sich nicht ganz frei von allen Befürchtungen machen. Aber weniger, weil sie den Übertreibungen von Familie und Freundinnen glaubte, sondern eher, weil sie ihren Mann kannte. Henne war für alles schnell zu begeistern, aber genauso schnell langweilten ihn die Dinge wieder. Sie hatte einen Sprinter auf eine Marathonstrecke geschickt.
Umso überraschender war Inkas erstes Zwischenfazit nach den ersten Wochen »Henne allein zu Haus«. Die Kinder beherrschten noch ihre Muttersprache, die Wohnung war stets aufgeräumt, und alle, inklusive Böse, machten einen entspannten Eindruck. Mit Ausnahme vielleicht von Inkas vormals weißen Unterwäschegarnituren, die sich einen leichten Stich ins Rosa eingefangen hatten. Kollateralschäden, meinte Henne. Und Inka war fast froh darüber, denn der Bulle in ihr wusste: Wenn etwas zu perfekt lief, lief etwas falsch. Aber so war alles bestens. Henne hatte die Sache im Griff. Oder »alles auf seinem Home-Radar«, wie er es ausdrückte.
»Mama, guck mal!« Mia, Inkas und Hennes sechsjährige Tochter, riss sie mit gewohnt erstklassigem Timing aus ihren Überlegungen. Gut, so schlecht war ihr Timing auch nicht, denn sie hing kopfüber nur an den Kniekehlen über der ziemlich wackeligen Fensterbank eines zweistöckigen Plastikhauses in der Kinderspielecke. Und noch schlimmer, Tom, Mias zwei Jahre jüngerer Bruder, war wie immer drauf und dran, es seiner großen Schwester nachzutun. Zehn Sekunden später und beide würden unten liegen, zwischen Buntstiften, Ausmalheften und den Bauklotzruinen der letzten Kunden mit Familie. Was offenbar unter Hennes »Home-Radar« geblieben war, wie ein Blick in sein verklärtes Gesicht bestätigte.
»Komme!«, rief Inka in Richtung der Kinder und entschuldigte sich bei Henne und dem Verkäufer. »Macht mal ohne mich weiter.« Aber das hätte sie genauso gut den sorgfältig gestapelten Winterreifen-Sonderangeboten neben ihr erzählen können. Keine Reaktion, die Männer folgten gebannt einem scheinbar geschlechtsspezifischen Initiationsritus des 21. Jahrhunderts.
Inka eilte mit Böse zur Spielecke und pflückte Tom und Mia routiniert aus der Gefahrenzone.
»Mama, wann gehen wir wieder?!«, wollte Mia wissen.
»Sobald wir unser neues Auto haben, Schatz.«
»Aber das steht doch schon da«, meinte Tom nicht ganz zu Unrecht.
»Ich weiß, Tom. Aber aus irgendeinem Grund kann man damit nicht einfach wegfahren. Ich glaube, wir müssen es irgendwie vorher … kennenlernen.«
Was Tom zu Inkas Überraschung verstand, und was im selben Moment von dramatischer Musik bestätigt wurde. Der Verkäufer trat vor das Auto, zog die Plane von der blitzenden Karosse und sorgte für ein andächtiges »Aaah« aus Hennes Mund. Eine Reaktion, die Inka so bei ihm auch noch nicht gesehen hatte. Sie, die Kinder und der Hund kamen gerade noch rechtzeitig zurück, um ihn sagen zu hören:
»Inka, Mia, Tom, Böse. Darf ich vorstellen: unser neues Auto …«
Begeisterung bei den Kindern, Umarmungen, Hundegebell. Sofort wollten alle das neue Auto erkunden. Anfassen, reinklettern, kennenlernen eben.
Bis Henne sie jäh innehalten ließ.
»Halt!«
Totenstille. Inka sah in ratlose Gesichter und sprachlos offene Münder. Die des Verkäufers, Mias, Toms, Böses und ihr eigenes, das sie im spiegelnden Lack des Autos erkannte.
»Familie, ich sagte neues Auto. Mit Betonung auf neu!«, ergänzte Henne.
Inka fing sich als Erste. »Und das heißt?«, fragte sie irritiert.
»Dass es auch behandelt wird wie ein Neuwagen. Wir setzen uns anständig rein, passen auf, dass wir dabei keine Kratzer machen und halten uns an ein paar Regeln. Kein Essen, kein Trinken, weder während der Fahrt noch davor oder danach. Und ich will erst recht keine Schuhabdrücke kleiner als Größe 35 auf der Rückseite der Vordersitze.«
Inka glaubte es nicht. »Aber atmen dürfen wir noch?«
»Klar. Nur nicht gegen die Fensterscheibe und dann abrubbeln. Das gibt Schlieren.«
Und auch wenn Henne dabei lächelte, etwas fehlte. Seine Grübchen. Für Inka ein untrügliches Zeichen für eine böse Vorahnung. Wenn dieses Auto so etwas wie ein Versprechen auf das Funktionieren ihres Planes war, dann war Hennes plötzlicher Patriarchenanfall ein Versprechen auf dessen grandioses Scheitern. Inka war klar, mit Männern in diesem Modus kann man nicht reden. Man kann sie nur überzeugen. Und zwar mit einem »So nicht!«, das keine Fragen offenließ.
Inka sah sich um. Und fand, was sie suchte. Neben den Reifenangeboten stand ein Hochglanzregal mit frisch gespülten Tassen, Gläsern und Servietten neben einer Thermoskanne, einer Karaffe Wasser und einer kleinen Schale mit Müsliriegeln. Sie wandte sich an den Verkäufer.
»Darf ich?«
Ein überfreundliches Nicken.
»Selbstverständlich. Wir haben aber auch noch andere Erfrischungen.«
»Danke, aber es ist nicht für mich.« Die irritierten Blicke des Verkäufers und ihrer Familie folgten Inka zu dem Display. Inka nahm sich die Wasserkaraffe, packte einen Müsliriegel aus und stellte sich damit vor Böse.
»Bereit, alle zerkauten Schuhe dieser Welt wiedergutzumachen?« Ein Bellen signalisierte Zustimmung. Inka verteilte ein paar Handvoll Wasser auf dem Rücken des Hundes. Dann warf sie den Müsliriegel mit einer geschickten Bewegung mitten in den geöffneten Kofferraum des Wagens.
»Hol ihn dir!« Böse gehorchte zum ersten Mal in seinem Leben aufs Wort, machte einen Satz in den Kofferraum und schnappte sich den Riegel. Dann tat er, was nasse Hunde nun mal nicht lassen können. Wie in Zeitlupe streckte er sich, und keine Sekunde später wanderte eine Welle wilden Fellschüttelns von seiner Nasenspitze über den Kopf, den Hals, den großen haarigen Körper bis hin zum Ende seines Schwanzes. Ein Wirbel aus Hundehaaren und Wassertropfen verteilte sich auf Sitzen, Scheiben und Armaturen im Inneren des Autos, wie die Reste einer pürierten Frucht im Küchenmixer.
Die Fassungslosigkeit in Hennes Blick hatte Inka in diesem Ausmaß bislang nur ein einziges Mal gesehen. Das war Jahre her und hatte mit einem Schnelltest zu tun, den sie heimlich im Bad gemacht hatte.
»Inka … Was hast du getan?!«, stammelte Henne.
Die Männer fingen sich und eilten zum Kofferraum, als müssten sie einen Komapatienten wiederbeleben. Böse sprang heraus und setzte sich neben Inka, die den Arm um Tom und Mia legte und ihren Mann mit einem ernsten Blick bedachte.
»Ich habe unser Familienleben gerettet«, antwortete Inka entspannt. »Und zwar davor, dass wir uns zu Sklaven eines Neuwagens machen.« Sie lächelte. »Ist der erste Fleck mal im Polster, geht man gleich viel entspannter damit um, nicht wahr?«
Den Blicken der Männer nach zu urteilen würde es noch dauern, bis sich diese Erkenntnis durchsetzte. Henne und der Verkäufer betrachteten fassungslos den Kofferraum, als wollten sie ihn durch Handauflegen wieder in seinen jungfräulichen Urzustand versetzen.
Das Klingeln eines Handys durchbrach die Stille. Inkas Handy. Im Display die Nummer ihrer Dienststelle. Sie ging ran, horchte einige Sekunde und legte auf.
»Tut mir leid, Mama muss los.«
Während Henne und der Verkäufer die Sprache anscheinend noch immer nicht wiedergefunden hatten, setzten sich Tom und Mia samt Böse mit routinierter Enttäuschung auf den Rücksitz. Inka selbst schwang sich auf den Fahrersitz des Neuwagens und stellte Sitz und Rückspiegel ein, bevor sie sich an die Männer am Kofferraum wandte.
»Was ist jetzt? Kann man damit auch fahren?«
3
Samstag, 10:30 Uhr
»Fast wie Schweden, nur halb so teuer.«
Inka sah über die leicht windgekräuselte Oberfläche des Hennesees auf die dichtbewaldeten Hügel der anderen Uferseite. Da war es wieder. Hennes einzigartiges Lockargument, mit dem er sie aus dem Ruhrgebiet in »sein« Sauerland gelockt hatte. Jede Menge Wald, Wasser und Berge. Ein Paradies. Nicht nur für Bullen. Auch für Familien und Kinder. Und nach anfänglicher Skepsis musste Inka ihm recht geben, auch wenn ihr noch kein Elch über den Weg gelaufen war.
Grün war die Farbe, die hier fast alles dominierte. Auf den Dächern der Kiefernwälder, den üppigen Wiesen und Weiden, sogar auf der Wasseroberfläche. Wenn auch nur als Spiegelung der Umgebung. Schon nach den ersten Wochen Brilon hatte Inka sich nicht nur daran gewöhnt, sie vermisste es sogar, wenn sie länger als ein, zwei Tage ihre Eltern in Dortmund besuchte. Und heute hätte es sie vermutlich nicht einmal überrascht, wenn ein Stück grünen Himmels zwischen den tiefhängenden Wolken die Orgie in Chlorophyll perfekt gemacht hätte.
Umso greller leuchteten die Farbtupfer um Inka herum. Das Rotweiß der Flatterbänder, das Signalgelb der Spurennummerierung, das Weiß der Overalls der Techniker. Willkommen in der romantischen Welt der Tatortermittlungen.
Ein Streifenwagen hatte am Präsidium auf Inka gewartet und sie in halsbrecherischer Fahrt über verstopfte Landstraßen und eine fast leere Autobahn hierhergebracht, auf das stattliche Anwesen von Wolfgang Hesterkamp, dem »Holzbaron vom Hennesee«. Inka war mit etwas wackeligen Beinen ausgestiegen, denn die rustikalen Fahrkünste des Streifenpolizisten hatten ihre Spuren hinterlassen. In einer Gegend, in der schon jeder zivile Verkehrsteilnehmer mit »HSK«-Kennzeichen Verkehrsregeln eher als Empfehlung denn als Vorschrift auslegte, kam Inka die Fahrt unter Blaulicht vor wie ein Hubschrauberflug durch den Raiffeisenmarkt. Immer nur Zentimeter vorbei an Kiefernholz oder Metall. Aber noch mehr als die Fahrt machte sich in Inka etwas anderes bemerkbar. Lampenfieber. Ihr erster »eigener« Fall seit langer Zeit wartete auf sie. Inka betrat die Arena. Und konnte sich über eine mangelnde Dramatik nicht beklagen.
Als sie die Villa des Holzbarons auf einem Kiesweg umrundet hatte, sah sie auf eine sanft in Richtung Seeufer abfallende, parkähnliche Grünfläche. Gesäumt und immer wieder unterbrochen von unzähligen gepflegten Sträuchern und Bäumen. Darauf verteilt standen zu Inkas Überraschung mehrere weiße Pavillons, verschieden große Zelte, ein Bierwagen, Stromaggregate und Dutzende Klappboxen mit technischem Material. Alles aus dem Bestand eines örtlichen Cateringservices und eingerahmt von feierlicher Beleuchtung. Die Vorbereitungen für eine imposante Gartenparty, kurz vor ihrer Vollendung jäh unterbrochen. Was immer würdig genug war, hier so groß gefeiert zu werden, die Szenerie am Seeufer hatte es zu einer unwichtigen Fußnote der Geschichte werden lassen.
Inka ging den Rasenhang hinunter, hockte sich an das schlammige Seeufer am Fuße des Gartens. Sie gratulierte sich zum Einhalten der Sauerland-Regel Nummer eins: Gummistiefel sollten nie weiter als einen kurzen Sprint entfernt sein. Im grellen Licht von vier Scheinwerfern und unter den kritischen Blicken der umstehenden Kollegen studierte sie die Leiche, die blass und leicht aufgedunsen rücklings vor ihr lag.
»Weiblich, etwa eins fünfundsechzig groß, mittelbraunes, langes Haar. Bis auf den fehlenden linken Schuh vollständig bekleidet. Außer den …« Die Stimme stockte angesichts des verstörenden Anblicks. »Außer den Nähten im Gesicht und zwei Löchern in der Schulter keine äußerlichen Spuren von Gewalteinwirkung.«
Die Beschreibung war ebenso lustlos wie überflüssig. Inka sah auf ein Paar gedrungene Beine in zu engen Cordhosen und Gummistiefeln neben sich. Kriminalkommissar Georg Pfeil klappte seinen Notizblock zu, zog seinen Gürtel über den stattlichen Bauch und musterte Inka von oben herab mit dem Gesichtsausdruck eines chronisch Magenleidenden. Er gab sich keine Mühe, die Aversion gegen die neue Kollegin zu verbergen. Warum auch? Er war Sauerländer, sie Zugereiste. Sein Heimspiel.
An der Leiche fiel Inka eher das auf, was Pfeil bei seiner Beschreibung – außer »tot« – ausgelassen hatte. Entweder weil er es nicht bemerkt hatte, oder weil er es für unwichtig hielt. Für Inka beides keine Bewerbung zum »Ermittler des Monats«.
Es war eine attraktive Frau Anfang dreißig, die da vor ihr lag. Zumindest ließ das die wasserdurchtränkte, enganliegende Kleidung vermuten. Reste einer offenbar frisch geschnittenen Frisur, gepflegte, manikürte Fingernägel, modische Schminke, inklusive – ironischerweise – wasserfestem Mascara. Doch alles an ihr wirkte ein wenig zu dick aufgetragen, um unter echten Stadtpflanzen noch als chic durchzugehen. Inka tippte auf eine wie sich. Auch eine Zugezogene. Bereit, sich den ländlichen Gesetzmäßigkeiten anzupassen, aber ohne sich dabei völlig selbst aufzugeben. Jemand, der mit Sicherheit andere Träume gehabt hatte, als am Ufer des Hennesees zu enden. Noch dazu als ein in der Tat verstörender Anblick. Augen, Ohren und Mund der Frau waren angelegt, beziehungsweise geschlossen und anschließend mit groben Stichen und dickem, dunklem Garn zugenäht worden.
»Wir haben keine persönlichen Gegenstände bei ihr gefunden. Also keine Handtasche, kein Portemonnaie, kein Schminkzeug oder so. Nur einen Schlüsselbund in ihrer rechten vorderen Hosentasche.«
Ohne Inka anzusehen, hielt Pfeil einen transparenten Plastikbeutel an seinem ausgestreckten Arm. Inka nahm ihn und betrachtete den Inhalt. Ein etwa zehn Zentimeter großes, metallenes »N« mit unbehandelten Außenseiten. In der Mitte waren die Balken des Buchstabens pink beschichtet, an den seitlichen Rändern der Oberfläche glitzerten Dutzende winziger Strasssteinchen. Modeschmuck. Der ziemlich schwer zu tragen hatte. Denn an einem ebenfalls metallenen Ring an der Unterseite des Buchstabens zählte Inka nicht weniger als dreizehn Schlüssel. Einen Autoschlüssel konnte sie dank der Marke identifizieren, den Zweck von sechs größeren und weiteren sechs kleineren Schlüsseln zumindest vage erahnen. Inka hatte genug eigene Fahrradschlösser, Geldkassetten und Vorhängeschlösser für Kellerräume besessen, um zu wissen, womit man sie klassischerweise sicherte. Die fünf verbliebenen Schlüssel machten allerdings den Eindruck, als gehörten sie mindestens in die Kategorie Wohnungsschlüssel. Inka wog den Beutel in der Hand. Ganz schön schwer. Andererseits hatte Inka genug Freundinnen, die ebenfalls zum Horten von Schlüsseln neigten. Ungewöhnlich fand Inka daher eher den Fundort des Bundes. Welche Frau bewahrte schon ein Kilo klobiges Metall in der Hosentasche auf?
»Ist das alles?« Inka gab Pfeil die Tüte zurück und erntete ein Nicken.
»Wenn sie eine Handtasche hatte, kann die überall sein.« Er deutete vage auf den See. »Nur im Kirchturm wird sie wohl nicht hängen«, grinste er.
Inka fragte sich einen Moment, was Pfeil mit der Anspielung meinte. Dann erinnerte sie sich undeutlich an grobkörnige Schwarzweißfotos aus einer Tageszeitung, die Inkas Mutter ihr in ihrer Kindheit einmal gezeigt hatte. Bilder, die sie als sehr verstörend empfunden hatte. Der Hennesee war genau genommen eine Talsperre. Wo heute zig Millionen Kubikmeter Wasser zum Baden oder Segeln einluden und sogar Strom erzeugten, standen vor dem Bau der Staumauer vier Dörfer ganz oder teilweise in einer Talsenke. Weil den Behörden der Ausbau des Sees aber wichtiger war als die Interessen der Bewohner von Hellern, Mielinghausen, Enkhausen und Immenhausen, wurden sie, soweit betroffen, umgesiedelt und entschädigt. Die Gebäude ließ man stehen und wartete, bis die Henne, ihre Nebenflüsse und der sauerländische Regen sie nach und nach in der Tiefe des neu entstehenden Sees verschwinden ließen. Nur in Zeiten extremer Trockenperioden und entsprechendem Niedrigwasser, wie damals 1976, kam es vor, dass der See in seinen Randbereichen eine alte Brücke des Dorfes Hellern und Teile der alten Bundesstraße 55 freigab. Kirchtürme gab es dort unten nicht, aber für die kleine Inka waren schon die Bilder der Straße und der Brücke genug, um Horrorvisionen von Untoten aufsteigen zu lassen, die stumme Anklage für ihren qualvollen Tod erhoben, bevor sie sich wieder in ihr feuchtes Grab zurückzogen.
»Und bevor Sie fragen, keine Ahnung, wie lange sie da schon liegt.« Pfeil holte Inka in eine ebenso unangenehme Gegenwart zurück. Er musterte sie von oben.
Inka stand auf. Und genoss besonders die letzten Momente vor Erreichen ihrer vollen Eins achtundsiebzig. Denn diese Momente waren die Zentimeter, die sie ihren neuen Kollegen an Größe überragte. Immerhin gute sechs Zentimeter. Und für Pfeil offenbar ausreichend für einen überraschten Schritt nach hinten. Inka unterdrückte ein zufriedenes Lächeln. Daran musste Pfeil sich wohl erst noch gewöhnen. Genau wie an Inkas entschlossenen Ton.
»Die Liegezeit am Ufer interessiert mich weniger. Ich will wissen, wer sie ist, wie lange sie tot ist, wie lange sie im Wasser war und wie sie da reingekommen ist.«
Pfeil machte sich zwar Notizen, seine hochgezogenen Augenbrauen zeugten jedoch nicht gerade von übertriebenem Arbeitseifer.
»Sonst noch was?«
»Ja, zum Beispiel, warum sie so heftig nach Alkohol riecht und nach welchem. Wann hat sie den zu sich genommen und wie?« Sie setzte ein aufmunternd gemeintes Lächeln auf und rieb sich die auskühlenden Hände. »Also, fangen wir an zu ermitteln, oder stellen wir Vermutungen an, bis wir Wurzeln schlagen?«
Inka wandte sich in Richtung des Gartens und machte sich an den Anstieg zur Terrasse. Hinter sich konnte sie förmlich hören, wie Pfeil verärgert die Augen verdrehte.
»Die Spusi hat gerade erst angefangen … Keine Ahnung, wie schnell die bei euch in Dortmund arbeiten, hier wird sorgfältig gearbeitet, nicht gehext.«
Pfeil sah sich um, nur um zu kontrollieren, ob das gesamte Einsatzteam seinen Auftritt auch mit dem ihm zustehenden Respekt zu würdigen wusste. Wusste es. Die Blicke aller Anwesenden wanderten von Pfeil zu Inka. Irgendwie schien man den kleinen Disput der beiden zu genießen. Inka wusste aus Erfahrung, wenn ein Tatort zum Nebenschauplatz wurde, war das keine gute Grundlage für saubere Ermittlungsarbeit. Höchste Zeit, dem Geplänkel ein Ende zu machen. Auch wenn alle Umstehenden es live mitbekamen. So konnte die Gerüchteküche später wenigstens keine allzu exotischen Blüten treiben. Inka blieb stehen, zog ihren rechten Einweghandschuh aus und streckte Pfeil die Hand entgegen.
»Inka Luhmann. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir uns unter anderen Bedingungen kennenlernen.« Sie deutete mit dem Kopf Richtung Leiche. »Aber offenbar hat irgendjemand etwas dagegen.«
Statt ihre Hand zu ergreifen, betrachtete Pfeil sie nur mit unverhohlener Skepsis. Ein seltsames fünfgliedriges Insekt, dem er scheinbar zutraute, dass es entweder biss oder vielleicht ansteckende Krankheiten übertrug.
Inka sah auf ihre ausgestreckte Hand. Keine Reaktion von Pfeil. Sie fragte sich gerade, ob sie eine Scheibe Schinken drauflegen sollte, um sein Interesse zu wecken, als Pfeil die Begrüßung endlich erwiderte. Kurz, reserviert, fast schüchtern. Ein krasser Gegensatz zum sonstigen Auftritt des Sauerland-Napoleons.
»Pfeil, Georg Pfeil, Hauptkommissar.«
Das kam jetzt schon ein bisschen entschlossener rüber. Fast trotzig. Pfeil hatte sich gefangen. Und Inka nutzte die Gelegenheit, ihn ein winziges Stück zu sich heranzuziehen. Auch um das, was folgte, nicht zu einer allzu öffentlichen Demütigung zu machen.
»Herr Pfeil, ich kann nichts dafür, dass man mich an Ihrer Stelle zur Dezernatsleiterin ernannt hat. Aber ich kann etwas dafür, wenn ich Ihnen in den Hintern trete, sollte Ihre Arbeit unter irgendwelchen Machoallüren leiden«, sagte sie ebenso dezent wie bestimmt.
Pfeil schluckte und zog seine Hand zurück wie ein fetter, fauler Kater, dem ein dicker Regentropfen auf die Pfote geklatscht war. Inka wusste, dass er unverheiratet war. Und sie kannte das Gerücht in den weiblichen Kreisen des Präsidiums: Körperkontakt mit Frauen war Pfeil angeblich nur zu bestimmten Gelegenheiten angenehm. Ob das stimmte, wusste Inka nicht. Wohl aber, dass es sie nicht sonderlich interessierte. Auch wenn es wie die Faust aufs Auge passen würde. Denn ein anderes, diesmal bestätigtes Gerücht waren Pfeils Urlaubsvorlieben. Einmal im Jahr gönnte er sich eine Auszeit von seiner Schüchternheit. In einem kleinen Urlaubsresort in der Nähe von Marrakesch, wo Männer wie er nicht nach ihren Ehefrauen gefragt werden, sondern nur nach dem Inhalt ihres Portemonnaies.
»Keine Sorge, Frau Hauptkommissarin. Ich habe meine Arbeit hier schon korrekt gemacht, da hatten Sie noch DO auf dem Kennzeichen«, sagte er unterkühlt.
Inka biss sich auf die Zunge. Kein guter Zeitpunkt abzuschweifen.
»Dann auf gute Zusammenarbeit.«
Es war vielleicht nicht der Beginn einer wunderbaren Ermittlerfreundschaft, aber nötig. Inka war lange genug bei der Polizei, um zu wissen, dass ein bestimmter Typ Kollege nur eine bestimmte Form Ansprache verstand. Gerade wenn man sich als Frau frisch in eine leitende Tätigkeit einarbeitete, waren feste Regeln und Grenzen das Wichtigste. Je deutlicher, desto besser. Auch wenn Inka sicher war, sich mit dieser Einstellung nicht unbedingt viele Freunde zu machen. Im Gegenteil. Wahrscheinlich landete sie sogar mit dickem Zickenstempel in der Klischee-Ecke der hochnäsigen Zugereisten. Wichtiger aber war der Respekt, den sie sich erst einmal erarbeitet hatte. Und damit die Grundlage für funktionierende Polizeiarbeit.
Pfeils Gesichtausdruck nach zu urteilen hatte das erst einmal geklappt. Er lächelte unecht. Und hatte in Inkas Friedensangebot scheinbar mehr Ironie interpretiert, als sie reingelegt hatte. Kleine Männer, dachte sie. Irgendwie unberechenbar. Wieder einmal war sie froh, in Henne ein »ausgewachsenes« Exemplar zu Hause sitzen zu haben.
Stakkatoartiges Blitzen und das Klicken von professionellen Kameras kündigte den nächsten Punkt der Tatortroutine an. Die Presse war da. Zwei Männer mittleren Alters drängten sich hinter einem Zaun zum Nachbargrundstück und fotografierten, was das Zeug hielt. Inka ging auf sie zu.
»Ich kann sie nicht daran hindern, Frau Kommissarin. Sie sind hinter der Absperrung«, entschuldigte sich ein Streifenpolizist.
Inka winkte ab.
»Lassen Sie mal, ich mache das schon.«
Im Gegensatz zu vielen anderen ihrer Kollegen, vor allem in Dortmund, hatte Inka grundsätzlich nichts gegen die Presse. Gerade im ländlichen Bereich konnte die Zusammenarbeit mit den Journalisten gewisse Vorteile mit sich bringen. Inka erinnerte sich an einen ihrer letzten Fälle in Dortmund. Ein Vergewaltiger hatte sich bei seiner Opfersuche auf die Endstationen von Buslinien »spezialisiert«, die alle in ländlichen Vorstadtgebieten lagen. Inka hatte im Laufe ihrer Ermittlungen einen Eindruck davon erhalten, was Sturheit in Verbindung mit Misstrauen und übertriebener Feindseligkeit anrichten konnte. Auch wenn es offensichtlich war, dass es Zeugen für die einzelnen Taten gab, niemand war zu einer Aussage bereit gewesen. Bis Inka die umstrittene Idee hatte, einem Lokaljournalisten einen Deal anzubieten. Exklusive Insiderinformationen der Behörden gegen exklusive Insiderinformationen eines »Einheimischen«. Die Rechnung war aufgegangen. Inka konnte aufgrund einer Zeugenaussage einen ehemaligen Disponenten der Busbetriebe festnehmen, der in der Gegend gewohnt hatte. Offenbar hatte der Journalist den entscheidenden Zugang zu den Bürgern gehabt.
Das brachte seinen sauerländischen Kollegen jetzt einen Vertrauensvorschuss ein. Inka griff nach ihren neuen Visitenkarten in ihrer Jacke und reichte sie den Journalisten. Erst jetzt fiel ihr auf, dass die Männer fast identisch aussahen. Beide in Jeans, beide mit schwarzem Lederblouson, beide mit Bärten. Allerdings in unterschiedlichen Graustufen. Anscheinend eine Art Dresscode der örtlichen Presse.
»Inka Luhmann. Ich bin die leitende Kommissarin.«
Die beiden wollten sie gerade mit den üblichen Protestphrasen überschütten, als Inka schon lächelnd die Hände hob.
»Wenn Sie sich an eine einfache Regel halten, werden wir rekordverdächtig gut miteinander auskommen.«
»Und die wäre?«, fragte einer der verblüfften Journalisten.
»Sie lassen mich leben, ich lasse Sie leben. Und wenn Sie irgendwelche Informationen für mich haben, rufen Sie mich direkt nach Ihrer Redaktion an. Sie haben drei Minuten für Ihre Fotos.«
Das ungläubige Staunen währte nur eine Sekunde, dann kletterten die Journalisten über den Zaun, stiefelten bis zur nächsten Absperrung und machten aus noch immer sicherer Entfernung ihre Arbeit. Inka erinnerte sich an die Worte ihres ehemaligen Chefs, als sie ihn mit ihrer Journalistenidee konfrontiert hatte. »Inka, du kannst ein Kamel zum Wasser führen, aber du weißt, dass es dir reinpisst.« Sie fragte sich, ob das gerade wirklich der richtige Schritt gewesen war, entschied aber, der damalige Erfolg gab ihr recht.
»Frau Luhmann?« Die nervöse Stimme eines jungen Mannes ließ Inka sich umdrehen. Ein Tatort-Techniker in einem weißen Overall streckte ihr die Hand hin.
»Klaus Porbeck.«
Inka erinnerte sich.
»Der Forensiker, richtig?« Ein kurzes, freudiges Lächeln bestätigte ihr, dass sie richtiglag. Porbeck war, genau wie sie, noch neu. Gerade einmal zwei Wochen bei der Truppe. Und entsprechend stolz, dass man ihn erkannt hatte. Inka deutete mit dem Kopf den Garten hinauf in Richtung der Wohnhausterrasse.
»Begleiten Sie mich ein Stück. Was haben Sie?«
Spätestens jetzt wäre jedem erfahrenen Kollegen aufgefallen, wie neu Porbeck war. Inka kannte genug Großstadtforensiker und ihre Arbeitsweise. Fachchinesisch im Verborgenen, stets begleitet von mürrischer Laune und einer professionellen Bereitschaft, auf keinen Fall mehr zu reden als unbedingt nötig. Gegen Forensiker waren Mönche mit Schweigegelübde kommunikative Gesellen. Porbeck war das Gegenteil, offen und gesprächig. Er zückte sogar etwas, was Inka noch bei keinem seiner Kollegen im Ruhrgebiet gesehen hatte.
»Mein Tablet-PC. Praktischer geht es nicht. Mit dem kann ich nicht nur Notizen und Sprachaufzeichnungen machen, sondern auch noch eigene Fotos und Videos der Umgebung. Und er spart jede Menge Papier.«
Inka war beeindruckt.
»Dann legen Sie mal los«.
Porbeck ließ sich nicht zweimal bitten und tippte mit den Fingerkuppen auf sein Touchpad. Ein verstörend scharfes Bild der Toten öffnete sich. Eine Ganzkörperaufnahme.
»Das Offensichtliche wie Geschlecht, Größe und Kleidung lasse ich mal weg. Das Opfer ist …« Er korrigierte sich. »Entschuldigung, war zwischen 28 und 35 Jahre alt, Todeszeitpunkt vor ca. zwölf Stunden. Da kann ich mich aber noch nicht festlegen. Genaueres gibt es erst nach der pathologischen Untersuchung.«
Inka nickte. Für Porbeck das Signal fortzufahren. Er tippte auf einen Pfeil am Rande des Fotos. Ein weiteres schob sich darüber. Diesmal eine Großaufnahme des Gesichts mit den immer noch surreal wirkenden Nähten.
»Die Nähte beschränken sich auf Augen, Ohren und Mund. Weitere habe ich zumindest nach erster oberflächlicher Untersuchung nicht gefunden«, sagte Porbeck.
Inka sah ihn an.
»Irgendwas Auffälliges daran? Ich meine, außer dass man sich fragt, was das soll?«
»Im Moment wissen wir nur, dass sie dem Opfer post mortem zugefügt wurden. Es gibt keine spezifischen Einblutungen um die Einstiche herum.«
»Und das Seewasser könnte sie nicht einfach weggewaschen haben?«
»Doch, aber nicht überall. Reste finden sich immer. Außerdem hätten wir auch noch Blutspuren auf anderen Körperstellen oder der Kleidung finden müssen. Die Gefäße im Gesichtsbereich sind sehr empfindlich und sehr stark durchblutet. Überlegen Sie mal, was Sie anrichten, wenn Sie sich nur auf die Lippen beißen.«
Das klang plausibel. Aber Porbeck war noch nicht fertig.
»Und was die Technik oder die Ausrüstung angeht, mit der die Nähte angefertigt wurden, kann ich zumindest schon mal ausschließen, dass das Fleischerwerkzeug war.«
Inka war einen Moment irritiert. Dann fiel ihr Porbecks beruflicher Werdegang ein. Er war Metzgergeselle gewesen, hatte aber nach dem Tod seines Vaters nicht die geringste Lust, den elterlichen Laden in Bödefeld zu übernehmen. Er hatte sein Abi nachgemacht, ein beachtliches Studium hingelegt und war jetzt der vielleicht schrägste Seiteneinsteiger im Team.
Inka lächelte.
»Der Metzger in Ihnen …«
Porbeck erwiderte das Lächeln geschmeichelt und sah zu Boden, während Inka das Bild noch einmal eingehender betrachtete. Sie deutete auf zwei kleine dunkle Stellen jeweils in der Mitte von Ober- und Unterlippe.
»Und diese halbrunden Einblutungen … Haben Sie dafür schon eine Erklärung?
»Darauf wollte ich jetzt kommen.« Porbeck blieb stehen und öffnete eine Großaufnahme der unteren Gesichtshälfte der Toten. »Das sind Druckmale. Ich vermute stumpfe Gewalteinwirkung vor Eintritt des Todes«, fuhr er fort. »Als hätte jemand versucht, dem Opfer irgendwas an die Lippe zu drücken.«
»Zu drücken?« Inka erinnerte sich an den Alkoholgeruch. »Könnte das so was wie eine Flasche gewesen sein?«
Porbeck vergrößerte sein Foto, indem er Daumen und Zeigefinger auf dem Display auseinanderspreizte. Nun konnte man die leichte Rundung der Verletzung noch deutlicher erkennen.
»Vom Radius der Rötung würde ich sagen, so was in der Richtung. Aber nageln Sie mich erst drauf fest, wenn ich sie in der Pathologie hatte. Und da ist noch etwas.«
Die beiden gingen weiter, während Porbeck auf ein weiteres Foto tippte. Jetzt eine Detailaufnahme der nackten Haut des Opfers. Inka konnte unmöglich sagen, welchen Körperteils.
»Was ist das?«
»Zwei Stichverletzungen in der rechten Schulter. Eine kleinere mit einem Einriss nach oben. Eine größere, aber nicht so tiefreichende. Ebenfalls post mortem zugefügt.«
»Sie meinen, jemand hat in den toten Körper gestochen und dann daran gezogen?«
Porbeck zuckte mit den Schultern. Inka betrachtete skeptisch das Foto.
»Vielleicht doch Fleischerhaken oder so?«
Porbeck lächelte, während die beiden die Terrasse der herrschaftlichen Villa erreichten.
»Sicher nicht. Aber etwas Ähnliches.« Er wandte sich in Richtung des Sees. »Angesichts des Fundortes und dem, was hier so an Fisch aus dem See geholt wird, würde ich mal auf einen Angelhaken und ein Gaff tippen. Ist aber auch nur ’ne Theorie. Brauchen Sie mich noch?«
Inka schüttelte den Kopf und blickte über das Panorama des Hennesees.
»Nein. Danke, gute Arbeit, Herr Porbeck.«
Sie überlegte kurz und deutete auf seinen Tablet-Computer.
»Das heißt … würden Sie mir Ihr Wundergerät mal für eine Minute leihen?«
4
Samstag, 10:50 Uhr
»O! Mein! Gott!« Günther Nagel starrte entsetzt auf das Leichenfoto auf Porbecks Tablet-PC und legte einen doppelten Collier-Griff hin, der einer Operndiva würdig war. »Das … das ist die Leiche? Und die liegt auf unserem Grundstück?!«
Inka nickte. Sie saß neben Porbeck auf einem thronartigen Stuhl an einem monströsen Vollholztisch und sah in das gepflegte Gesicht eines 36-jährigen Mannes mit vollem dunklem Kurzhaar, durchtrainiertem Körper und tadelloser Kleidung. Unauffällig, aber modisch. Gezupfte Augenbrauen wirkten auf Inka bei fast allen Männern lächerlich, zu Nagel passten sie. Genau wie der sorgsam gestutzte Dreitagebart, die manikürten Fingernägel und die blendend weißen Zähne. George Michael in jung. Und auch wenn Inka nicht von sich behaupten konnte, ein ausgeprägtes Schwulenradar zu besitzen: Sollte Nagel je eine Frau aus anderen als rein platonischen Gründen berührt haben, sie hätte ihre Gummistiefel gefressen.
Der Beweis kam umgehend. Von hinten legte sich eine Bärenpranke mit erstaunlicher Zärtlichkeit auf Nagels Schulter. Wolfgang Hesterkamp, der Holztycoon, reichte Nagel ein Glas Wasser und setzte sich neben ihn. Inka bemerkte ein leichtes Zittern seiner Hände. Offenbar belastete auch ihn die Situation mehr, als er seinem Partner gegenüber zeigen wollte.
»Hier, Schatz, das beruhigt erst mal«, sagte er.
Nagel neigte dankbar den Kopf an Hesterkamps Arm und atmete durch.
»Du bist ein Engel«, seufzte er.
Ob es am Wasser lag oder mehr an Hesterkamps Stimme, Nagel beruhigte sich augenblicklich, und Inka war für einen winzigen Moment unabsichtlich Zeugin einer so innig intimen Vertrautheit, wie nur zwei Menschen sie teilen konnten, die füreinander geschaffen waren. Ein echtes Traumpaar. Was das Sauerland alles zu bieten hatte. Obwohl die beiden gegensätzlicher nicht sein konnten. Hesterkamp war mindestens zehn Jahre älter als Nagel und bei etwa gleicher Größe mindestens zwanzig Kilo schwerer. Inka fiel auf, dass er im Gegensatz zu seinem Lebensgefährten nicht nur deutlich maskuliner wirkte. Er verkörperte auch das urmännliche Klischeebild eines Holzbarons. Sein gesamter Habitus ließ keinerlei Rückschluss auf seine tatsächliche sexuelle Ausrichtung zu.
Aber Inka war Bulle genug, die Situation nicht unnötig angenehm werden zu lassen. Wenn sie der Frau am See schon nicht helfen konnte, konnte sie wenigstens für Gerechtigkeit sorgen.
»Sie haben die Frau also beide noch nie gesehen?«
Schon war es wieder vorbei mit Nagels Entspannung. Er schüttelte den Kopf und fuchtelte wild mit dem Zeigefinger über das Bild.
»Ich kann mir ja nicht mal vorstellen, wie sie ohne diese, diese … Dinger da ausgesehen hat.«
Inka musste zugeben, dass die Tote darauf kaum zu identifizieren war. »Es tut mir leid, aber ein angenehmeres Bild haben wir zur Zeit nicht.« Inka nahm den Tablet-PC wieder an sich. »Darf ich?« Sie reichte den Computer weiter an Porbeck.
»Danke für’s Leihen. Das war’s erst mal«, sagte sie zu dem Forensiker. Porbeck nickte, stand auf und verabschiedete sich.
»Ich melde mich, sobald ich was habe.«
Er ging zu einer riesigen gläsernen Panoramaverandatür, ließ sie zur Seite gleiten und trat in den Garten. Eine Windbö fegte an seiner Stelle in den Raum, in dem sich augenblicklich ein feuchtkühler Duft nach Tannen und Wasser verbreitete. Ein Vorbote des nahenden Herbstes. Inka wandte sich wieder an Nagel.
»Wie genau haben Sie sie gefunden?«
Inka zückte ihren Notizblock und fühlte sich ohne Porbecks High-Tech-Ausrüstung plötzlich wie ein Relikt aus prähistorischen Ermittlerzeiten. Nagel seufzte ein wenig übertrieben.
»Aber das habe ich den Streifenbeamten doch schon alles erzählt.«
»Wir hören die Dinge gerne mehr als einmal. Nur um sicherzugehen. Reine Routine.«
Hesterkamp nickte Nagel aufmunternd zu. Der trank einen Schluck Wasser und ergab sich seinem Schicksal.
»Es war so gegen halb zehn. Nach dem Aufstehen mache ich mir immer einen Mate-Tee. Mit dem setze ich mich dann in meinen Sessel am Fenster und schaue auf den See. Das ist so ein Morgenritual bei mir. Nur ich, mein Tee, das sanft wogende Wasser …«
Er lächelte gedankenverloren, als suchte sein Verstand verzweifelt den Notausgang aus einem Horrorkabinett. Eine Sekunde später war er wieder in der Realität angekommen.
»Na ja, und als ich mich gerade gesetzt hatte, fiel mir zwischen den ganzen Pavillons etwas Helles, Längliches am Ufer auf.« Er atmete schwer ein. »O Gott, ich konnte doch nicht wissen, dass das …«
Er deutete unbestimmt nach draußen. Inka schwieg. Es war fast immer besser, einen Zeugen reden zu lassen. Wer nicht unterbrochen wurde, gab meist mehr als nötig preis, nur um die unangenehme Stille zu vermeiden. Inka sah Nagel an. Er war definitiv so ein Kandidat. Sie behielt recht.
»Na ja, ich dachte erst, die Arbeiter hätten beim Aufbau für die Party irgendetwas nicht richtig befestigt, was der Wind dann Richtung See geblasen hat. Also hab ich mir meinen Morgenmantel angezogen und die Gummistiefel und bin nachsehen gegangen. Ja, und da lag sie dann.«
»Haben Sie irgendetwas berührt oder aufgenommen?«
Nagel schüttelte entschieden den Kopf.
»Ich bin ja nicht mal ganz rangegangen. Weil ich schon auf, ich weiß nicht, zehn Meter Entfernung gesehen habe, dass das ein … ein Mensch ist.«
Er brach wieder in Tränen aus und schmiegte sich in Hesterkamps Arm. Der übernahm.
»Und dann hat er mich geweckt, und ich habe die Polizei gerufen.«
Inka sah von Nagel zu Hesterkamp.
»Sie schliefen zu dem Zeitpunkt noch?« Sie sah auf ihren Notizblock und zitierte Nagels Aussage. »So gegen halb zehn.«
Hesterkamp nickte.
»Tue ich immer. Meistens wird es in der Firma abends doch recht spät, und dann genieße ich es, wenn ich dafür am nächsten Tag später anfange.«
»Mit ›Firma‹ meinen Sie Ihren Holzhandel?«
Hesterkamp lächelte.
»Wenn Sie mit ›Holzhandel‹ ein weltweit operierendes mittelständisches Unternehmen mit zweihundertvierzig Mitarbeitern, drei Niederlassungen und einem Umsatz von fast fünfzig Millionen Euro meinen.«
Inka musterte Hesterkamp und war wieder überrascht. Bei einem Mann seines Kalibers hätte sie deutlich mehr Arroganz als Antwort auf ihre kleine Provokation erwartet. Aber in Hesterkamps Blick lag nur eine etwas dünne, aber fast jungenhafte Freundlichkeit, gepaart mit einem Hauch Stolz. Sauerländer Understatement.
»Sie kaufen und verkaufen Holz?«
»So kann man es sagen. Ich will Ihnen ja nicht das letzte bisschen Sauerlandromantik nehmen. Aber nüchtern betrachtet ist das, was neunzig Prozent aller Touristen als letztes Refugium intakter Natur sehen, nichts anderes als eine gigantische Monokultur, die man Wald nennt. Und der wird bewirtschaftet. Man holzt ab, forstet auf, und ich bin derjenige, der das Holz erst ankauft und dann vertreibt.«
»Kann man sagen, Sie haben so was wie ein Monopol?«
Wieder das jungenhafte Lächeln. Auch wenn es wieder papierhaft dünn wirkte, als läge eine tiefe Sorge darunter.
»Nein, ich habe kein Monopol«, sagte Hesterkamp. »Aber vielleicht ein bisschen mehr Geschick als meine Mitbewerber.«
Inka sah sich um. Selbst wenn man nicht gewusst hätte, womit Wolfgang Hesterkamp offenbar die ein oder andere Million gemacht hatte, die Inneneinrichtung des Hauses ließ keinen Zweifel daran. Holz, wohin man auch sah. Die Fußböden selbstverständlich Parkett. Die Wände zum Teil vertäfelt, die Decke offene Balken. Die Möbel massiv. Das alles aber so hell und harmonisch aufeinander abgestimmt, dass es den Charme eines großzügigen Chalets ausstrahlte. Mindestens einer der beiden Herren hatte, neben Geld, offenbar auch ein Händchen für Inneneinrichtung. Inka klappte ihren Notizblock zu.
»Danke, das wäre dann erst einmal alles.«
Ihr Blick fiel in den Garten.
»Das heißt, bis auf eines. Ihre Party. Sieht ganz schön feierlich aus. Was planen Sie da? Ihre Hochzeitsfeier?«
Hesterkamp lächelte. Wieder bescheiden, intelligent und mit einem liebevollen Blick auf Nagel. Inka wurde langsam klar, was Nagel an ihm fand.
»So etwas Ähnliches.«
»Einen Ball«, verbesserte Nagel. »Genauer gesagt, einen Abschiedsball.«
Inka zog fragend die Augenbrauen hoch.
»Kommen Sie aus dem Sauerland, Frau Luhmann?«, fragte Hesterkamp.
»Aus Dortmund.«
»Immerhin Ruhrgebiet. Dann muss ich mit dem Thema ›Vereinsmeierei‹ ja nicht beim Urknall anfangen. Und ich muss Ihnen wohl auch nicht sagen, dass, egal wie klischeebelastet sie sind, Vereine so was wie ein Abbild der jeweiligen Gesellschaft sind. Tja, und was in Köln die Karnevalsvereine und in Dortmund vielleicht die Fußballvereine sind, das sind im Sauerland die Schützenvereine.«
»Danke, ich wohne schon ein paar Wochen hier.«
Hesterkamp sah sie an.
»Sind Sie selbst auch Mitglied?«
Inka schüttelte den Kopf und deutete auf ihre Polizeimarke.
»Ein Verein mit Schießeisen reicht mir.«
»Aber Sie kennen das Krönungsritual?«, fragte Hesterkamp.
Inka nickte. »Man veranstaltet ein Schützenfest, hängt einen Holzvogel auf und wer den Vogel abschießt, ist für ein Jahr der König.«
»Genau«, sagte Hesterkamp. »Bei uns in Meschede darf er dann kurz vor dem nächsten Schützenfest einen Abschiedsball ausrichten, bei dem er offiziell die Krone für den noch unbekannten nächsten König zurückgibt.«
»Dann sind Sie amtierender Schützenkönig?«, fragte Inka überrascht.
Hesterkamp schüttelte den Kopf und sah Nagel an, der den Blick senkte. »Ich war es. Vor ein paar Jahren. Aber wir konnten damals aus Krankheitsgründen keinen Abschiedsball geben. Deshalb wollten wir ihn dieses Jahr nachholen.«
»Und für den amtierenden König ist das in Ordnung? Wer ist das eigentlich?«
»Herr Löwe, unser Vorsitzender. Und es ist alles abgesprochen und abgesegnet«, sagte Hesterkamp. »Wir teilen uns die Kosten.«
Inka nickte nachdenklich.
»Stimmt es eigentlich, dass die Königsvergabe ein abgekartetes Spiel ist? Ich meine, steht nicht lange vor dem ersten Schuss fest, wer es wird?«
Hesterkamp setzte eine nachdenkliche Miene auf. »Ich glaube, das ist von Verein zu Verein verschieden.«
»Hat mit Sport dann aber auch nicht mehr allzu viel zu tun, oder?«
»Na ja, mit dem Sport alleine ist es ja auch nicht getan. König werden kann jeder, der sein Gewehr halbwegs gerade halten kann. König sein aber nur jemand, der auch das Bankkonto dazu hat. Billig ist es nämlich nicht gerade. Ab der Minute, wo man Sie mit dem rauchenden Gewehr auf den Schultern zur Bierbude schleppt, sind Sie für ein Jahr so was wie der Zahlmeister Ihres Vereins. Stammtische, Jubiläen, Feiertage … Überall sind alle mit dabei. Und der Deckel geht an Sie. Wer sich das nicht leisten kann, schießt lieber mal daneben. So viel zum Thema Sport.«
»Aber das Geld dürfte in einem Verein wie Meschede doch kein Problem sein. Ich meine, wenn auch Ihr Verein ein Abbild der Gesellschaft ist, wie Sie sagen, dürfte es da von mittelständischen Wohlhabenden ja nur so wimmeln.«
»Eben. Aber das macht es nicht unbedingt einfacher. Wenn es sich nämlich jeder leisten kann, König zu werden, will es irgendwann auch mal jeder sein. Ich zum Beispiel bin seit Menschengedenken Mitglied im Schützenverein von Meschede.«
»Und wie oft waren Sie König?«
»Nur das eine Mal. Und jetzt raten Sie mal, warum das eine Sensation war?« Nagel hatte sich fast trotzig eingemischt. Hesterkamp legte demonstrativ wieder den Arm um ihn.
»Weil Sie schwul sind«, bemerkte Inka und erntete ein zufriedenes Lächeln von beiden Männern.
»Und zwar bekennend. Können Sie sich vorstellen, was das in einer 525-jährigen konservativen, erzkatholischen Bruderschaft bedeutet?«
Inka konnte es sich ausmalen.
»Auf jeden Fall machte es Wolfgang auf den Schützenfesten traditionell nicht gerade zum Top-Favoriten.« Offenbar ein Reizthema für Nagel. »Man hat ihm zigmal zu verstehen gegeben, dass man ihn als König nicht will.«
Inka ahnte, was kam, fragte aber trotzdem: »Aber irgendwie müssen Sie es doch geworden sein?«
Nagel lächelte stolz. »Weil Wolfgang den Vogel einfach so abgeschossen hat. Gegen die Absprache.«
Inka zog die Augenbrauen hoch. Hesterkamp nickte nur.
»In jeder Wald- und Wiesenbruderschaft in der Umgebung hätten sie mich wahrscheinlich geteert und gefedert.«
»Und hier in Meschede?«
»Ist zu viel Politik im Spiel, als dass sich irgendjemand offiziell die Hände schmutzig macht. Nein, hier dürfte die Botschaft wohl deutlicher und subtiler ausfallen.«
Inka sah von ihren Notizen auf.
»Zum Beispiel eine Leiche an Ihrem Seeufer.«
5
Samstag, 11:47 Uhr
»Wer tut so was?« Polizeirat Klaus Halverscheid wandte sich mit besorgter Miene von den Tatortfotos auf seinem Schreibtisch ab. Froh, sich für einen Augenblick der Entspannung in seinem neuen, rückenfreundlichen Drehsessel zurücklehnen zu können. »Dreißig Jahre bin ich bei der Polizei.« Halverscheid rieb sich die Schläfen. »Seit fünf Jahren Polizeirat. Ich habe alles gesehen. Zumindest für Sauerländer Verhältnisse. Familientragödien in Bestwig, Erbstreitigkeiten in Arnsberg, Entführungen, Erpressungen, Schlägereien. Aber das? Muss ich denn zwei Jahre vor meiner Pensionierung noch so eine …« Er machte eine unbestimmte Geste in Richtung der Fotos und suchte nach dem richtigen Ausdruck. »So eine Sauerei haben?«
Inka saß in einem ebenfalls neuen Besucherstuhl vor dem Schreibtisch ihres Chefs und schwieg. Auf rhetorische Fragen zu antworten hatte sie sich abgewöhnt. Es war verschenkte Zeit. Sie folgte Halverscheids Blick aus der großzügigen Fensterfront im ersten Stock der Briloner Polizeidienststelle über den Marktplatz auf die hübsch renovierten Fassaden der Bahnhofstraße. Samstag war Einkaufstag. Und auch wenn Brilon, trotz der noch relativ neuen Arkaden, wahrscheinlich nie ein Shoppingparadies werden würde, füllten sich die Straßen an diesem späten Vormittag mit Familien, Rentnern und kleineren Gruppen Jugendlicher. Henne war bestimmt auch mit Mia, Tom und Böse unterwegs. Einer der Vorteile, wenn man nicht in einem Job steckte, der weder Dienstpläne noch Privatleben kannte.
Eine tiefe Sorgenfalte lag auf Halverscheids Stirn. In seinem korrekten, konservativen Anzug, mit dem vollen, grauen Haar und dem Bauchansatz kam er Inka vor wie ein buddhistischer Wächter, der keine Ahnung hat, wie er dem puren Bösen entgegentreten sollte, das gerade in sein letztes Refugium von Recht und Ordnung vordrang.
»Aber für diese Sauerei habe ich ja jetzt Sie, Frau Luhmann«, sagte er ein wenig gefasster und wandte sich an Inka.
Inka nickte. Das mit »keine Ahnung« stimmte jedenfalls schon mal nicht. Und Halverscheid hatte recht. Dafür hatte er sie hergeholt. Es waren Fälle wie dieser, von denen die Frau und Mutter in ihr gehofft hatte, sie würden nie eintreten. Die Polizistin in ihr musste nun dafür sorgen, dass sie nie wieder eintreten würden.
Inka setzte sich auf. »Immerhin wissen wir inzwischen, wer das Opfer ist«, sagte sie und klang optimistischer, als der Stand der Dinge es erlaubte. Sie zog einen DIN-A4-Ausdruck unter den Fotos hervor und drehte ihn Halverscheid zu. »Nathalie Brückner, 29 Jahre alt, Servicekraft in der Gastronomie, freiberuflich, ledig, keine Kinder …«
»Freiberuflich?« Halverscheid war irritiert. »Als Kellnerin?«
Inka sah auf ihren Computerausdruck.
»So steht es zumindest in der Vermisstenmeldung, die ihr momentaner Arbeitgeber aufgegeben hat. Ein gewisser Heiner Ried.«
»Der vom Partyservice Ried?«, fragte Halverscheid.
»Offenbar. Jedenfalls stimmen ihre Daten überein. Wir überprüfen das gerade, aber es sieht aus, als hätte Frau Brückner nicht regelmäßig gearbeitet, sondern immer nur dann, wenn sie gerade Geld brauchte. Oder sich eine Gelegenheit ergab.«
Halverscheid nickte. »Wie in fast allen Touristenhochburgen.«
Die örtlichen Gastronomen stellten ihre Saisonarbeitskräfte nach dem »Hire-and-Fire-Prinzip« ein. Kellner, Hilfsköche und Zimmermädchen bekamen meist eine Festanstellung für die Haupt- und Nebensaison, und wenn es gerade keinen Schnee gab oder kein Hochsommer war, meldete man sich arbeitslos.
»Und für diese Nähte, gibt es da schon irgendwelche Anhaltspunkte?« Halverscheid fuhr mit dem Finger über die Fotos, als könnte er die Struktur der Nähte dadurch fühlen.
Inka schüttelte den Kopf und berichtete von Porbecks ersten Erkenntnissen und den Ergebnissen ihrer Befragung von Nagel und Hesterkamp.
»Dann gehen wir also von einem Racheakt im Schützenverein aus?«, fasste Halverkamp zusammen.
»Hauptkommissar Pfeil scheint das jedenfalls nicht ausschließen zu wollen.«
Halverscheid sah Inka an. »Und Sie?«
»Mir fällt es zumindest schwer zu glauben, dass jemand in den besseren Kreisen von Meschede eine Servicekraft so bestialisch zurichtet, nur um einem Vereinskollegen eine Lektion zu erteilen. Und vor allem, dass er so lange damit wartet.«
Halverscheid schien nicht ganz überzeugt. »Ich erinnere mich an den Fall. Das war damals eine Sensation. Einen homosexuellen Schützenkönig hat es hier noch nicht gegeben. Damit hat Hesterkamp sich sicher keine Freunde gemacht. Schon gar nicht im Verein. Und denken Sie dran, das ist das Sauerland. Egal, wie viele Maßanzüge einer im Schrank hängen hat, hier ist keiner weiter als zwei Generationen von Bauern, Viehtreibern oder Holzfällern entfernt. Auch die sogenannten besseren Kreise nicht. Und wenn doch, machen sie’s wahrscheinlich mit Inzucht wieder wett. Ach so, wie kommen Sie überhaupt mit Pfeil klar?«
Inka zuckte mit den Schultern. »Ich glaube nicht, dass wir heiraten werden, aber es ist okay.«
»Gut, denn so wie es aussieht, werden Sie noch einige Zeit zusammenarbeiten müssen.« Er legte die Fotos säuberlich zu einem Stapel zusammen, richtete ihn mit einem Schlag auf den Schreibtisch aus und stand auf. Sein Blick wurde wieder ernster.
»Ihnen ist wohl klar, was das hier bedeutet?«
Das war es in der Tat. Als eine der eher kleineren Dienststellen der Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen gab es in Brilon keine festinstallierten Abteilungen, die sich ausschließlich mit Straftaten in ihrem jeweiligen Schwerpunktbereich beschäftigten. Waren in Dortmund, Essen oder Bochum vorwiegend Spezialisten für Gewalt-, Betrugs-, Drogen- oder wirtschaftskriminalistische Delikte auf ihrem jeweiligen Fachgebiet tätig, musste man in Brilon, schon aufgrund der deutlich dünneren Personaldecke, wesentlich breiter interessiert und ausgebildet sein. Hier waren Kapitalverbrechen noch selten genug, dass man für jedes einzelne eine eigene Sonderkommission bildete. Und das hatte aus Inkas Sicht einen unschlagbaren Vorteil. Es gab keine eingefahrenen Hierarchien, in deren Schutz die größten Fachidioten die Weisheit jeweils für sich pachten konnten. Nur ein solides Maß an kollektivem Grundwissen, gepaart mit gesundem Ermittlerverstand und Erfahrung. Und den Umstand, dass jeder Beamte gezwungen war, über seinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Henne hatte das einmal auf eine einfache Formel gebracht: »Fachidioten sind vielleicht fachlich gut. Aber sie bleiben Idioten.« Nicht so in Brilon. Gerade weil man hier auf sich allein gestellt war, musste man selbständig und verantwortungsvoll arbeiten. Ein weiterer Grund, warum Inka Halverscheids Jobangebot angenommen hatte.
Inka deutete auf den Aktenstapel zum Fall Nathalie Brückner, den ihr Chef sich mittlerweile unter den Arm geklemmt hatte. »Das bedeutet, wir richten eine Sonderkommission ein«, fasste sie zusammen.
Halverscheid begleitete sie zur Tür seines Büros. »Überlegen Sie sich mal einen Namen, und sagen Sie allen Kollegen, die Sie drinhaben wollen, Bescheid. Wir treffen uns im Besprechungsraum. In zehn Minuten.«
6
Samstag, 12:09 Uhr
Acht Minuten später betrat Inka den gläsernen Verbindungsgang, der den Altbau der Dienststelle mit dem Neubau verband. Sie sprach in ihr Handy. »Natürlich hat die Mama den Papa noch lieb, Tom. Und wenn er schon neben dir steht und mithört, kannst du ihn mir auch gleich geben.«
»Okay. Bis nachher, Mama.« Kinderfüße rannten weg. Dann raschelte es am Ende der Leitung, und Henne gab sich alle Mühe unverdächtig zu klingen.
»Luhmann?«
»Was für ein elender Feigling schickt denn seinen Sohn vor, um herauszufinden, ob ich noch sauer bin?«, fragte Inka lächelnd.
»Wer wohl? Dein treusorgender Ehemann.«
Fragte sich nur, womit Inka diesen ungewohnten Großmut verdient hatte. Schließlich hatte sie Böse animiert, den Innenraum des Autos zu entweihen, und eher damit gerechnet, dass Henne bis Weihnachten nicht mehr mit ihr redete.
»Und das Auto? Solltest du nicht sauer auf mich sein?«
»Ach, schon vergessen und ausgesaugt. Du hattest ja recht. Ich habe mich auch aufgeführt wie ein Idiot. Aber ich will es wieder gutmachen.«
Inka fielen auf Anhieb mindestens zwanzig Dinge ein, mit denen er das locker geschafft hätte. Fünfzehn davon waren alles andere als jugendfrei.
»Und um mir das zu sagen, lässt du Tom anrufen?«
»Deswegen, und um dich zu fragen, wann du nach Hause kommst.«
»Du, hier brennt der Baum. Ein Mordfall. Ich weiß noch nicht.«
»Mord?«, kam es erstaunt aus dem Hörer. »Wann? Wo?« Trotz neuer Rollenverteilung ließ sich der Bulle in Henne nicht von heute auf morgen abstellen. Zumal bei einem Mordfall. Wenn Inka sich richtig erinnerte, lag der letzte in Brilon und Umgebung Jahre zurück.
»Erzähle ich dir später, okay? Wir haben gleich ein Meeting.«
»Klar, sorry. Ich wollte nur … was für dich kochen«, kam es aus dem Hörer.
Inka blieb stehen. Selbst ohne Bulleninstinkt wäre ihr klar gewesen, dass jetzt der Zeitpunkt für gesundes Misstrauen gekommen war. Henne kochte nie. Und wenn doch, dann schmeckte man, dass er nie kochte.
»Henne, gibt es irgendwas, was ich wissen sollte?«
»Äh, nö. Nur, dass ich dich liebe. Und dass ich auflegen muss. Böse will raus. Ciao.«
»Henne …«
Weiter kam sie nicht. Ein Klicken beendete das Gespräch. Doch die Lösung des Rätsels ließ nicht lange auf sich warten. Eine Beamtin der Bereitschaftspolizei, deren Namen Inka sich einfach nicht merken konnte, kam mit einem Foto auf sie zu.
»Frau Luhmann, ich wusste gar nicht, dass Sie ein neues Auto haben.«
»Doch, seit heute Morgen«, sagte Inka irritiert.
»Dann haben Sie hoffentlich auch die passende Vollkasko.« Die Kollegin grinste breit und reichte Inka das Foto. »Die Jungs von der Bereitschaft sind gerade wieder reingekommen. Ein Typ, der Henne … der Ihrem Mann verdammt ähnlich sieht, hat beim Einparken am Marktplatz einen Hydranten geknutscht.« Sie verschwand in Richtung Altbau.
Inka starrte auf das Foto. Eine Großaufnahme der rechten Seite ihres neuen Autos. Hatten Inka und Böse wenigstens nur Polster, Scheiben und Armaturen versaut, war Henne gründlicher gewesen. Mitten auf dem rechten Kotflügel prangte eine unübersehbare Beule. Etwa zwanzig Zentimeter im Durchmesser, perfekt rund, mit dem tiefsten Punkt genau in der Mitte. Für eine Beule fast ein Kunstwerk. Inka musste grinsen und steckte das Foto ein. Deshalb der Anruf, deshalb das Essen. Gut, eine Lackreparatur war zwar kein Schnäppchen, aber vielleicht ein angemessener Preis für einen wiederhergestellten Familienfrieden. Inka und Henne waren quitt.
SIE
Samstag, 12:16 Uhr
Zunächst war sie enttäuscht: Das Foto der Leiche hatte es noch nicht einmal auf die Titelseite der Zeitung gebracht. Verflucht, was sollte das? Das war nicht gerecht. Was musste denn noch passieren, damit etwas wichtig genug ist, um prominent auf der ersten Seite präsentiert zu werden? Sie versuchte sich zu beruhigen. Sie war noch vor dem Frühstück rausgegangen, um eine Zeitung zu kaufen. Geschlafen hatte sie kaum. Wie auch? Die Vorfreude hatte sie fast überwältigt. Und jetzt das.
Der Kiosk war nicht weit, er hatte gerade erst geöffnet, als sie ihn betrat. Der Zigarettenqualm einer Ewigkeit hing im Raum. Die Zeitung würde danach riechen. Es war ihr egal, obwohl sie es sonst hasste, wenn Menschen mit ihren Süchten keine Rücksicht auf andere nahmen. Rücksicht war ihr wichtig, immer schon. Es war ihr gleich aufgefallen, die großen Zeitungen berichteten nicht darüber. Das war in Ordnung, aber die lokale Presse hätte damit aufmachen müssen. Ihr Atem ging schneller, ihre Hände zitterten. Nur einen kurzen Moment, bis sie den Blick des Kioskbesitzers spürte, der mit seinen nikotinverfärbten Fingern den verschnürten Stapel Frauenzeitschriften öffnete, ohne sich dabei zu bemühen, ihr weniger aufdringlich auf die Brüste unter ihrem Pulli zu schauen. Es ärgerte sie. Sie wollte allein sein mit ihrer Wut und ihrer Enttäuschung über die Missachtung ihrer Tat. Was musste man denn noch tun, um der Aufmerksamkeit notgeiler Kerle zu entgehen? Der Kioskbesitzer wandte sich einer älteren Kundin zu, die Rätselhefte suchte. Sein Glück. Er wusste nicht, auf was für ein gefährliches Spiel er sich eingelassen hatte. Wie auch, er hatte sie nie zuvor gesehen, und er war nicht der erste Mann, der ein einfaches Lächeln womöglich komplett falsch interpretierte. Als er das Geld der Rätselkundin kassiert hatte, war sie verschwunden. 80 Cent lagen passend auf dem Stapel mit den Lokalzeitungen. Sie sah nicht aus wie eine Betrügerin, wenigstens das hatte der Kioskbesitzer von Anfang an richtig eingeschätzt.
Als sie wieder auf ihrem Zimmer war, ging es ihr besser. Allein.