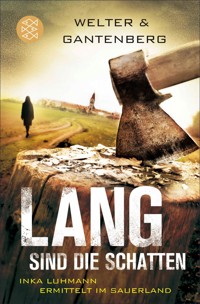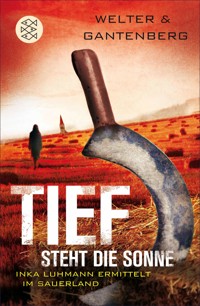
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inka Luhmann ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Campen kann tödlich sein - der dritte Fall für Kommissarin Luhmann im Sauerland. Mitten auf dem Campingplatz am Biggesee liegt die Leiche, einen Holzpflock tief ins Herz gerammt. Haufenweise Verdächtige im Wohnwagenidyll und Spuren von Magic Mushrooms machen Kommissarin Inka Luhmann das Leben schwer – zumal sie Camping-Hasserin ist. Während ihr Mann Henne wieder seiner einstigen Flamme Bianca begegnet, stößt Inka auf ein altes Verbrechen und eine neue Drogenspur. Und auf einmal ist ihre eigene Familie in tödlicher Gefahr…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Sammlungen
Ähnliche
Oliver Welter | Michael Gantenberg
TIEFSTEHT DIE SONNE
Inka Luhmann ermittelt im Sauerland
FISCHER E-Books
Inhalt
1
Samstag, 23:54 Uhr
Kein Laut war der beste Laut. Vor allem, wenn man nicht erwischt werden wollte. Heute Nacht wäre das die übelste aller Möglichkeiten.
Julia Zimmermann hielt den Atem an, ließ hinter sich lautlos die leichte Kunststofftür des Wohnwagens ins Schloss klicken und trat vorsichtig von einem Plastikpodest, das als Einstiegsstufe diente, in das stickige Vorzelt. Sie wandte sich nach links und sah zu dem Fenster, hinter dem ihre Eltern schliefen. Gleichmäßiges, gedämpftes Schnarchen. Alles blieb dunkel. Gut so. Teil eins ihres nächtlichen Ausflugs war geschafft. Erleichtert atmete Julia durch. Und rümpfte sofort die Nase.
Für ihre Eltern und den ganzen Platz schien der gummigeschwängerte Geruchsmix aus Zeltbahnausdünstungen, Kunststoffmöbeln, trocknender Badekleidung, kalten Grillresten, Spülmittel und feuchtem Rasen der Inbegriff von Freiheit und Erholung zu sein. Für Julia war es der Mief des permanenten Provisoriums. Campingurlaube liebte oder hasste man. Julia gehörte eindeutig in die zweite Kategorie. Aber was sollte sie machen? Mit vierzehn war sie zu jung, um mit ihren Freundinnen an den Goldstrand oder nach Mallorca zu düsen. Zumindest meinten das ihre Eltern und hatten sie zur jährlichen Höchststrafe verurteilt: drei Wochen mit dem Wohnwagen an den Biggesee. Drei Wochen Familienhorror. Nur gut, dass Julia in diesem Jahr Mathijn kennengelernt hatte.
Sie konnte es kaum erwarten, wieder in die kühle Frische der Sauerländer Nachtluft zu entkommen. Sie musste nur noch ihren Erzfeind der letzten Tage und Nächte überwinden. Im trüben Licht der platzeigenen Wegebeleuchtung vor der Parzelle schlich Julia zum Ausgang des Vorzeltes und stand vor ihm: dem breiten Reißverschluss, der in einem großen Rundbogen eine dicke Zeltplane mit einem halbblinden Folienfenster umspannte. Julia hasste den verdammten Verschluss. Tagsüber machte das Scheißding schon einen Heidenlärm, wenn jemand ihn auf- oder zuzog. In der Stille der Nacht könnte sie sich den Weg nach draußen genauso gut mit einer kreischenden Kettensäge bahnen.
Geduld war gefragt. Sie griff nach dem metallenen Schieber. Eine Spalte von einem halben Meter würde erfahrungsgemäß ausreichen, um ihre sportlichen 1,68 in die Freiheit zu entlassen. Aber sie durfte nicht ungeduldig werden. Millimeter für Millimeter zog sie den Reißverschluss auf, immer wieder mit bangem Blick zum Fenster ihrer Eltern. Zeit genug, sich auszumalen, was passieren würde, wenn ihre Mutter auch dieses Mal hinter ihren unerlaubten nächtlichen Ausflug kam. Beim ersten Mal hatte sie es bei einer Ermahnung belassen. Beim zweiten Mal hatte sie Julias Vater hinzugezogen, der prompt Julias ehemals eigenes Zelt neben dem Wohnwagen abgebaut und sie zum Schlafen im elterlichen Wohnwagen verdonnert hatte. Beim dritten Mal hatte dann der übliche Ausdruck mütterlicher Überforderung gegriffen: kein Geschrei, keine peinliche Szene oder gar Prügel. Julias Mutter hatte ihr eigenes Foltermittel. In Fällen von nachhaltiger Unbelehrbarkeit ihrer Tochter redete sie einfach nicht mehr mit ihr. Zum Teil tagelang. Stattdessen ließ sie keine Gelegenheit aus, Julia mit anklagender, vorwurfsvoller Miene klarzumachen, dass sie sich des größten aller Kapitalverbrechen schuldig gemacht hatte: Ungehorsam. Immerhin würde Julia morgen früh schnell merken, wo der Hase langlief. Das »Wecken« wäre ein unverhältnismäßig frühes und übertrieben lautes Herumpoltern im Wohnwagen, der Frühstücksklapptisch wäre für alle außer Julia gedeckt, und an wem der anschließende Abwasch hängenbleiben würde, wäre ohnehin klar. Beim bloßen Gedanken an die triefend selbstmitleidige, ohnmächtige passive Aggressivität ihrer Mutter schüttelte es Julia innerlich. Aber für Mathijn nahm sie das gerne in Kauf.
Schließlich hatte sie auch Ferien. Und nur weil ihre Eltern darunter verstanden, dass man täglich ab 11 Uhr 30 mit einer Horde gleichgesinnter Nachbarcamper vor einem Grill sinnlos Bier in sich und über viel zu fettes Grillgut kippte, musste Julia das ja nicht auch »total entspannend« finden. Sie wollte was erleben. War das denn so schlimm?
Ein Schwall kühler Nachtluft verdrängte ihre düsteren Gedanken. Geschafft! Julia sah sich ein letztes Mal um und schlüpfte lautlos durch den entstandenen Spalt im Vorzelteingang in die Stille der Nacht.
Die Türplane verschloss sie nur provisorisch. Sie verhakte routiniert drei breite Klettverschlüsse, die der Hersteller netterweise angebracht hatte. Schließlich musste sie ja später wieder unbemerkt zurück in den Wohnwagen. Ein weiterer Blick zum Fenster ihrer Eltern. Alles ruhig. Sie hatte auch Teil zwei geschafft.
Julia stand vor ihrer Parzelle mit der Nummer 149 und sah auf den spärlich beleuchteten Weg, der den Campingplatz ziemlich genau in der Mitte durchschnitt und wie alle Wege irgendwann zum Einfahrtsbereich führte. Nur von dort konnte man zum Strand und zu den Bootsanlegeplätzen gelangen. Julia hielt den Atem an. Stille umgab sie, nur unterbrochen vom gelegentlichen leisen Rauschen einer sommerlichen Brise und entfernten Feiergeräuschen vom Seeufer. Gut so. Doch an Entspannung war noch lange nicht zu denken, denn die nächste Gefahr für Julias Vorhaben war auch die größte. »Groscheks Bernd«, wie man ihn hier in bester Sauerländer Tradition, »Nachname vor Vorname«, nannte, war nicht nur offizieller Ordnungshüter des Campingplatzes, sondern auch Allround-Handwerker, Angelcoach, Kiosk-Notdienst, Wetterfee, Witwentröster, Maskottchen und Nachrichtenmann in Personalunion. Seine vielfältigen Aufgaben nahm der Mann ernst. Alle. Nachdem er vor einigen Jahren mal einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und filmreif in Angelschnur gefesselt an die Polizei übergeben hatte, hatte ihm ein Gast einen echten Sheriffstern aus den USA mitgebracht und an eine von gefühlt drei Dutzend Brusttaschen von Bernds Lieblingsklamotte geheftet: seine obligatorische Anglerweste. Seitdem war das protzige Blechschild nicht nur sein Markenzeichen geworden, es war auch jedem Betrachter klar, dass er es nicht zum Spaß trug. Was Groscheks Bernd mit einem weiblichen Teenie auf nächtlichem Knutschausflug machen würde, wollte Julia sich gar nicht erst ausmalen. Zumal sie sicher war, dass Groschek der Grund war, warum ihre letzten drei Ausflüge mit Mathijn aufgeflogen waren. Aber sie wusste auch, dass heute Samstag war. Der Tag, an dem der Sheriff sich traditionell auf seiner großen Platzrunde von jedem auf ein Bier einladen ließ, der ihn ansprach.
Julia spähte aufgeregt in die Nacht. Zu beiden Seiten des Weges führte eine verlassene, düstere Phalanx aus Zelten, Wohnwagen und Autos in dahinterliegendes undurchdringliches Schwarz der allgegenwärtigen Bäume. Der Weg war zu riskant für ihr Vorhaben. Julia bevorzugte eine unauffälligere Route. Sie überquerte den Weg und lief vorsichtig zwischen den beiden Wohnwagen der gegenüberliegenden Parzellen auf den dahinterliegenden, dichtbewachsenen Grünstreifen und von dort weiter in östliche Richtung zum Einfahrtsbereich des Platzes. Immer auf der Hut, nicht über Groschek, irgendwelche Spannseile oder die Reste einer Grillparty zu stolpern. Mathijn wartete bereits am See auf sie. Julia spürte, wie die Vorfreude eine kribbelnde Welle puren Adrenalins durch ihren Körper schickte.
Wenige Minuten später brauchte sie auf verräterische Geräusche nicht mehr zu achten. Sie hatte sich am verlassenen Rezeptionsgebäude vorbeigeschlichen und war unbemerkt die Treppe zum dahinter liegenden Verwaltungsgebäude hinuntergestiegen. Dort hatte sie sich rechts gehalten und war vorbei am verwaisten Imbiss und dem Campingshop hinunter zum See geeilt.
Am Wasser angekommen war die Luft erfüllt von einer verheißungsvollen Mischung aus sommerlicher Wärme und schilfigem Seegeruch. Das gelegentliche Rauschen eines einsamen Autos auf der nahen Sonderner Talbrücke mischte sich mit gedämpften Musikfetzen und einzelnen Lachsalven feiernder Campergrüppchen. Julias Vorfreude stieg. Eigentlich war’s hier doch gar nicht so schlecht, dachte Julia. Wenn man nicht an seine Eltern gebunden war. Und wenn Groschek einen nicht erwischte.
Sie schlich vorsichtig zu einem hölzernen Bootssteg und horchte angespannt in die Dunkelheit. Etwas abseits des Stegs stand eine kleine Holzhütte, Wasser schwappte träge gegen Holz und Bootsrümpfe.
»Mathijn?!«, fragte sie leise. Doch statt einer Antwort legte sich plötzlich eine Hand über ihren Mund! Kräftige Arme zogen Julia vom Steg herunter in Richtung der Hütte. Scheiße, dachte sie. Groschek! Zu Tode erschrocken fuhr Julia herum und stieß sich von ihrem Angreifer ab. Aber sie sah nicht in das graue vierschrötige Gesicht des Sheriffs, sondern in ein breites jugendliches Grinsen: Mathijn!
»Mann!«, stieß Julia leise hervor und schlug ihm spielerisch auf die Brust. »Bescheuert?!«
»Nur ein bisschen verrückt. Nach dir«, kam es in breitem niederländischem Tonfall zurück. Und bevor Julia noch etwas erwidern konnte, drückte ihr Mathijn seine Lippen auf den Mund. Der nächste Adrenalinschub durchfuhr Julia. Ihr wurde schwindelig. Küssen konnte der Typ jedenfalls. Und das war es schließlich, worauf sie den ganzen Tag gewartet hatte. Julia vergaß ihren Schreck und gab sich dem Moment hin. Sie erwiderte den Kuss und schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, fand sie sich inmitten eines Gewirrs aus Werkzeug, Seilen, Bootsgerätschaften und dem Geruch nach rohem Holz und Farbe wieder. Julia hatte gar nicht bemerkt, dass Mathijn sie in den kleinen Schuppen bugsiert hatte. Er schloss eine schmale Holztür hinter sich und kam zu ihr. Wieder gaben sich die beiden ihren Küssen hin. Jetzt fordernder. Sie keuchten. Julia spürte Mathijns Hände unter ihrem T-Shirt und ihre eigenen an der Knopfleiste seines Shirts, während er ihre Hüften anhob und sie auf eine schmale Werkbank setzte. Ohne die Lippen von seinen zu nehmen, stützte sie sich blind nach hinten ab. Und griff in eine zähe warm-feuchte Masse! Angeekelt fuhr sie zurück.
»Iih! Was ist das denn?!«
Mathijn schaltete sein Handy in den Taschenlampenmodus und hob Julias Hand in das brutal helle Licht. Eine bräunliche, zäh-klebrige Flüssigkeit hatte sich über zwei von Julias Fingerkuppen verteilt. Entsetzt sah sie auf.
»Ist das … Blut?«, fragte sie.
Doch Mathijns Anspannung wich sofort wieder seinem Grinsen. »Nee«, meinte er. »Dichtmasse.« Er suchte nach Worten. »Zum Abdichten von Booten.«
Julia atmete erleichtert durch und wollte ihren Kopf gerade an seine Schulter legen, als sie erneut aufschrak. Hinter Mathijn hatte für den Bruchteil einer Sekunde etwas Metallisches aufgeblitzt. Etwas, das Julia bekannt vorkam. Ihre Augen weiteten sich vor Schreck.
»Was ist jetzt wieder?«, fragte Mathijn, nun etwas ungeduldiger.
Statt einer Antwort richtete Julia den Lichtschein von Mathijns Handy wie in Trance auf die Stelle hinter der Tür. Der metallische Gegenstand war ein Sheriffstern. Nur glänzte er nicht mehr silbern, sondern rot. Blutrot. Aus einer tiefen Wunde im Brustkorb von Bernd Groschek hatte sich ein großer tiefschwarzer Fleck auf der Vorderseite seiner zerfetzten Anglerweste, seiner Hose und dem Boden ausgebreitet. Seine weit aufgerissenen Augen schienen Julia und Mathijn noch im Tod vorwurfsvoll anzustarren.
2
Sonntag, 08:22 Uhr
»Wann sind wir da-ha?«
Inka verdrehte müde die Augen und wandte sich nach rechts zum Beifahrersitz, von dem Henne sie grinsend ansah.
»Nicht dein Ernst, oder?«, fragte sie.
Henne zuckte die Achseln.
»Wenn die Kinder nicht fragen. Einer muss ja quengeln«, meinte er.
Inka musterte ihn einen Moment länger, als während einer Autobahnfahrt ratsam war. Dann fiel ihr auf, warum. Sein Lächeln. So entspannt hatte Henne in den letzten beiden Wochen nicht ein einziges Mal ausgesehen. Und das war immerhin ihr gemeinsamer Familienurlaub gewesen. Oder das, was man als Urlaub bezeichnete. Inka seufzte in sich hinein, wandte ihren Blick wieder der Fahrbahn zu und verringerte die Geschwindigkeit. Vor ihr wurde die A 33 zur B 480. Die eben noch flache westfälische Landschaft warf mehr und mehr Hügel auf. Doch Sauerländer Heimatgefühle wollten sich bei Inka nicht recht einstellen. Stattdessen fragte sie sich, woher die allgemeine Auffassung kam, Urlaub habe etwas mit Erholung zu tun. Glaubte man den Medien, der Werbeindustrie oder den Berichten von Freunden oder Bekannten, saß ganz Deutschland pünktlich zu Ferienbeginn entspannt mit Zahnpastalächeln und Cocktails in den Händen auf bequemen Liegestühlen und bewunderte prächtige Bergpanoramen, spektakuläre Sonnenuntergänge oder wildromantische Lagerfeuer neben hochglänzenden Fahrrädern. Und egal wen man Wochen später fragte, überall hörte man nur einen Urlaubs-Kommentar: »Super! Wir haben uns so was von erholt!« Nach den letzten beiden Wochen Dänemark konnte Inka darüber nur den Kopf schütteln.
Zwar war ihr kleines, gemietetes Ferienhaus an der Ostseeküste erstklassig gewesen, das Wetter perfekt und der nahe Strand ein Paradies für Tom, Mia und Böse, aber damit hatten sich die Klischees auch schon erledigt. Von wegen Ausspannen, mal zwei Wochen nur das tun, was einem gefällt, oder einfach mal ein gutes Buch lesen. Mit zwei Kindern, einem Hund und einem Ehemann, der im Urlaub auch Urlaub von seinen Hausmannspflichten machte, hatte sich die Welt um alles gedreht, nur nicht um Inkas eigene Bedürfnisse. So hatte ihr Ferienhaus zwar die Annehmlichkeit von drei Schlafzimmern und einem urigen Alkoven gehabt, allerdings hatte sich jedes der Betten als zu schmal für zwei Erwachsene erwiesen. Woraufhin Henne zu Inkas Entsetzen seltsam freiwillig vorgeschlagen hatte, getrennte Schlafzimmer zu beziehen. Gegenseitige »Besuche« waren allerdings unmöglich gewesen, weil Tom und Mia, trotz eigener Betten, natürlich regelmäßig und in wechselnden Kombinationen Kuschelasyl bei ihren Elternteilen eingefordert hatten. Nur um pünktlich bei Sonnenaufgang hellwach zu sein. Und der war in Dänemark eine gute halbe Stunde früher als in Brilon.
Als nicht weniger herausfordernd hatten sich die Tagesunternehmungen entpuppt. Abgesehen von Supermarktpreisen, die normalverdienenden Selbstversorgern die Tränen in die Augen trieb, hatten sich gemeinsame Unternehmungen, außer den Mahlzeiten, als unmöglich erwiesen. Immer hatte irgendjemand irgendetwas auszusetzen, weshalb man sich – um des lieben Friedens Willen – meist auf getrennte Wege einigte. Und hatten tatsächlich mal alle vier Luhmanns ein gemeinsames Ziel gefunden, waren sie spätestens an dessen Eingang von einem freundlich lächelnden Dänen auf ein Schild mit einem dicken roten Balken über einem stilisierten schwarzen Riesenschnauzer hingewiesen worden. Hunde verboten. Das Resultat: Inka war nicht nur übermüdet, sexuell unausgelastet und erholungsbedürftiger als zwei Wochen zuvor, sie ertappte sich sogar bei dem Gedanken, sich nach ihrem deutlich kalkulierbareren Berufsalltag zu sehnen. Das entsprechend schlechte Mutter-Gewissen natürlich inklusive.
»Wenn Mama weiter so schleicht, schaffen wir’s nicht vor heute Mittag.« Mia hatte sich von der Rückbank zwischen die Vordersitze gebeugt und sah vorwurfsvoll auf die Tachonadel. Ihr Bruder Tom schien neben ihr die Rückkehr zu verschlafen. Genau wie Böse, dessen gleichmäßiges Schnarchen aus dem Heckbereich selbst gegen das Fahrbahnrauschen gewann.
Inka trat wieder aufs Gas.
»Immerhin sind wir wieder im Sendebereich von Radio Sauerland«, meinte Henne entspannt, sortierte die Radiosender von Norddeutsch und Skandinavisch wieder auf Heimat und lieferte sich prompt mit Mia ein Duett zu irgendeinem aktuellen Urlaubshit. Inkas Skepsis schien er zu bemerken.
»Man wird sich doch wohl auf zu Hause freuen dürfen«, meinte er unschuldig.
Inka atmete durch und enthielt sich eines Kommentars, zumal ein Piepton mal wieder eine eingehende Nachricht auf Hennes Handy ankündigte. Neben der unglücklichen Gesamtsituation Inkas zweiter großer Urlaubskiller. Normalerweise war sie es, die, dienstlich bedingt, ihr Mobiltelefon nicht aus der Hand legen konnte. Wofür Henne, als Ex-Bulle in verlängerter Elternzeit, natürlich Verständnis hatte. Doch vor der Abfahrt in den Urlaub hatte er Inka einen Deal vorgeschlagen: Einmal am Tag Nachrichten checken. Mehr nicht. Beide hatten sich daran gehalten. Allerdings mit dem Unterschied, dass Inka ihr Telefon einmal abends für fünf Minuten eingeschaltet hatte, während Hennes Gerät zwölf Stunden am Stück Nachrichten empfing. Inkas zunehmend genervte Fragen nach den Absendern hatte er ebenso profan wie selbstverständlich beantwortet: seine Kumpels aus dem Altstadt-Treff. Warum deren Anliegen aber plötzlich wichtiger waren als Inkas Dienstangelegenheiten, hatte er verschwiegen. Dafür hatte Henne das Ferienhaus von der ersten Minute an fasziniert. Er hatte sogar mehrere Stunden mit dem freundlichen Vermieter über Bauart, Bauvorschriften und Immobilienpreise diskutiert, nur um Inka irgendwann in der zweiten Woche zwischen Abwasch und Spieleabend zu fragen, ob sie in ihrer Wohnung in Brilon eigentlich zufrieden wäre. Nein, dieser Urlaub war alles gewesen, nur nicht entspannend. Inka wollte endlich ankommen, auspacken und sich darauf verlassen, dass der Alltag möglichst schnell wieder für normale Familienverhältnisse sorgen würde.
Als sie wenig später unter dem lauten Jubel von Henne, Mia und Tom und einem lauten Gähnen von Böse in die Einfahrt ihres Zweifamilienhauses am Rand des Briloner Ortskerns einbog, kam es Inka vor, als wären die letzten 14 Tage schon zu einer uralten Erinnerung verblasst. Da passte es nur zu gut, dass pünktlich mit dem Öffnen der Fahrertür Inkas Handy klingelte. Nur meldete ihr Display nicht die erwartete Nummer ihrer Dienststelle in Brilon, sondern eine unbekannte mobile. Inka nahm das Gespräch an.
»Luhmann?«
»Birkholtz«, kam es aus dem Telefon.
Inka brauchte einen Moment, um sich den Namen ins Gedächtnis zu rufen. Andreas Birkholtz war ein ehemaliger Kollege aus Inkas früheren Dortmunder Zeiten.
»Noch da?«, fragte er in die entstandene Stille. Inka fing sich.
»Klar. Was gibt’s?«, fragte sie zurück.
»Immer noch die alte Smalltalk-Maschine, was?!«, lachte Birkholtz aus dem Telefon. »Aber weil du so nett fragst. Jau, uns geht’s gut hier. Deine Nummer und deine Urlaubsplanung hab’ ich übrigens von deiner Dienststelle.«
Inka schmunzelte.
»Klar, dass die nicht dichthalten. Aber du rufst sicher nicht an, weil ihr keine Postkarte gekriegt habt.«
Wieder das Lachen.
»Nee, sind wir gewohnt.« Dann konnte Inka förmlich hören, wie Birkholtz ernster wurde.
»Du weißt noch, was morgen ist?«, fragte er.
Inka überlegte. Hatte sie irgendetwas vergessen? Einen Gerichtstermin, ein Dienstjubiläum, die Pensionierung eines alten Kollegen? Wohl kaum. Sie hatte das Kapitel Dortmund abgeschlossen, als sie vor drei Jahren Hennes alten Job als Dienststellenleiterin der Abteilung Kapitalverbrechen hier in Brilon übernommen hatte. Sie sah, wie Henne und die Kinder anfingen, das Gepäck zur Haustür zu tragen, und wurde ungeduldig.
»Du, können wir das abkürzen? Wir sind gerade erst rein, haben ’ne Menge auszupacken und …«
»Sven Wittmann«, unterbrach Birkholtz sie. »Und nur, falls du dich noch an unser Versprechen gebunden fühlst.«
Inka fiel es sofort ein.
»Wann?«, fragte sie.
»Morgen um neun.«
»Alles klar«, sagte Inka und legte auf.
Henne kam von der Haustür zurück und wuchtete einen weiteren Koffer aus der Dachbox.
»Drei Minuten, und du hast ’nen neuen Fall?«
»Nee, einen alten«, meinte Inka nachdenklich. Doch bevor Henne weitere Fragen stellen konnte, öffnete sich die Haustür und Inkas und Hennes Nachbarin Frau Lugner umarmte Mia, Tom und Böse. Die rüstige alte Dame lebte seit jeher in der Wohnung unter den Luhmanns und hatte sich im Laufe der Jahre zu einer verlässlichen Freundin, liebevollen Teilzeitoma, Babysitterin und Hausverwalterin entwickelt. Entsprechend herzlich war der Empfang.
»Da seid ihr ja!«, rief sie freudig, wehrte eine Schleckattacke von Böse ab und wandte sich strahlend an Inka und Henne.
»Na, wie war der Urlaub?!«
Inka steckte ihr Handy ein, dachte kurz nach und setzte ein bemühtes Lächeln auf.
»Super. Wir haben uns so was von erholt.«
3
Montag, 08:55 Uhr
»Sieht fast idyllisch aus.«
Inka deutete mit dem Kinn auf den Eingangsbereich der Justizvollzugsanstalt Werl, der in der milden Morgensonne vor ihr lag. Sie lehnte neben Andreas Birkholtz an der noch warmen Motorhaube seines Wagens. Ihr war aufgefallen, dass es kein Fahrzeug seiner Dienststelle, sondern ein Privatwagen war, mit dem Birkholtz gekommen war. Also betrachtete er den Termin wohl zumindest zum Teil auch als privat. Verständlich angesichts des Hintergrundes.
Inka blickte auf die Straße, die vor ihnen lag. Beiderseits von weißen Mauern gesäumt führte sie, von dichtem grünem Laub überdacht, zu einem zweistöckigen, ebenfalls weißen Gebäude.
»Klar ist das idyllisch«, meinte Birkholtz. »Der Teufel versteckt sich halt immer im Sonntagsanzug.«
Inka wusste, was er meinte.
Das weiße Gebäude markierte das Ende aller vordergründigen Bildromantik. Mit seinen vergitterten Fenstern, einer grauen Tür und einem monströsen, geschätzt vier Meter hohen und breiten eisernen Tor in grauer Rostschutzfarbe bildete es nicht nur den Eingang zu einer der größten Justizvollzugsanstalten Deutschlands, sondern auch zu einer anderen Welt. Die der JVA Werl. Hinter dem Eingangsgebäude ragte die Kopfseite eines großen, weiß-roten kreuzförmigen Klinkerbaus auf. Das Inhaftierungsgebäude. 1908 recht übersichtlich als »Königlich-Preußisches-Centralgefängnis« in Betrieb genommen, hatten zahlreiche Erweiterungen, Modernisierungen und Anbauten das alte Gemäuer in mehr als hundert Jahren in eine Festung verwandelt, die sich heute über ein Areal von mehr als 13 Hektar Fläche im Werler Norden erstreckte. Über 400 Mitarbeiter waren für mehr als 850 Insassen zuständig. Alle sogenannte »Langstrafige«, wie Inka wusste. Mörder, Räuber, Vergewaltiger, Kinderschänder. Intensivtäter, die ausnahmslos lange Haftstrafen verbüßten. Nicht gerade die angenehmste Kundschaft.
Inka nahm einen Schluck aus dem Papp-Kaffeebecher einer nahen Bäckerei und sah von ihrer Armbanduhr zum eisernen Tor des Eingangsgebäudes. Was Birkholtz zu bemerken schien.
»Keine Sorge«, meinte er. »Die sind ziemlich pünktlich. In nicht mal ’ner Stunde bist du zurück in Brilon.« Inka winkte ab. Kurz vor ihrer Abfahrt nach Werl hatte sie ihre Kollegin Marlies Röggen in Brilon angerufen, um ihr mitzuteilen, dass sie ihren Dienst erst nach ihrem Ausflug nach Werl antreten würde. Auch wenn Röggen nicht nach dem Grund gefragt hatte, hatte Inka sie eingeweiht.
Birkholtz nahm ebenfalls einen Schluck Kaffee und hielt einen zweiten Becher hoch.
»Danke übrigens«, meinte er.
»Kein Thema«, erwiderte Inka. »Wer vergisst schon, dass du eher auf Zucker mit Kaffee stehst als auf Kaffee mit Zucker.« Die beiden lachten, stießen die Becher zusammen und gönnten sich noch einen Schluck. Dann wurde Birkholtz wieder ernster.
»Nicht nur für den Kaffee. Auch, dass du Wort gehalten hast, mein’ ich.«
Inka schwieg. Stattdessen griff sie hinter sich und nahm die alte Fallakte von der Motorhaube, die Birkholtz ihr nicht nur aus nostalgischen Gründen mitgebracht hatte. Sie schlug sie auf und reiste gedanklich fast acht Jahre zurück in die Vergangenheit.
Am 25. November 2009 waren sie und Birkholtz per stillem Alarm zu einem Banküberfall in Dortmund-Aplerbeck gerufen worden. Sie waren zufällig in der Nähe gewesen, als zwei Räuber es auf die Filiale einer Genossenschaftsbank abgesehen hatten. Ein »Klassiker« der Polizeiarbeit, wie Birkholtz damals meinte. Er hatte Banküberfälle, für Inka unverständlich, immer als eine der am wenigsten riskanten Kapitalverbrechen eingeschätzt. Zum einen, weil die Statistik belegte, dass Personenschäden dabei die Ausnahme waren, und zum anderen, so Birkholtz’ Theorie, weil die Situation für alle Beteiligten relativ berechenbar war. Im Grunde wusste jeder, was passieren würde. Die Täter wollten nur ihre Beute und möglichst schnell wieder raus. Und die Bankmitarbeiter waren genau für diesen Fall geschult. Sie waren angehalten, die Situation zu deeskalieren, diskret den stillen Alarm auszulösen und den Forderungen der Räuber ohne Hektik nachzugeben. Außerdem war beiden Seiten klar, dass technische Vorkehrungen wie Zeitschaltungen für Tresore oder geringe Bargeldbestände den Mitarbeitern der Bank wenig Spielraum ließen. Alles zusammen führte meist dazu, dass der Spuk relativ schnell wieder vorbei war. In der Regel bevor die Polizei am Tatort eintraf. Der Rest war Routine. Zumindest für Birkholtz.
Nicht jedoch am 25. November 2009. Am Tag des Überfalls hatte die Bank wegen des erhöhten vorweihnachtlichen Zahlungsverkehrs einen recht hohen Bargeldbestand in der Filiale und zum anderen einen neuen Filialleiter. Ein Umstand, der genau den Kritikpunkt ins Spiel brachte, mit dem Inka Birkholtz’ Theorie immer entkräftet hatte: der menschliche Faktor. Trotz aller Theorie, der bestmöglichen Schulungen oder der präzisesten Dienstanweisungen konnte niemand ahnen, wie er selbst, oder jemand anderes, unter dem Stress einer realen Ausnahmesituation reagierte.
Inka vermutete, es war übertriebener Ehrgeiz, der den Filialleiter zu einer folgenschweren Reaktion veranlasst hatte. Er war neu gewesen und die von den Tätern erbeutete Summe hoch, also entschloss er sich, die Täter zu ihrem Fluchtfahrzeug zu verfolgen. Die gerieten in Panik und nahmen den Mann als Geisel. Als Inka und Birkholtz wenig später am Tatort eintrafen und die Verfolgung aufnahmen, geriet die Situation außer Kontrolle. Die nun panischen Täter flohen mit dem Filialleiter in Richtung Sauerland. Nahe Menden stellte die Polizei das Fahrzeug, verhaftete den Fahrer, befreite den Filialleiter, konnte aber nicht verhindern, dass dem zweiten, unbekannten Täter mit der Beute die Flucht gelang. Alles, was blieb, waren auffällige Stiefelspuren, die sich irgendwo in einem Waldstück verloren. Trotz sofortiger Großfahndung und Auswertung aller möglichen Spuren blieb der Mann unerkannt und unauffindbar. Der festgenommene Fahrer des Fluchtfahrzeugs schwieg zu allen Vorwürfen. Es war Sven Wittmann, der wegen schwerer räuberischer Erpressung und Geiselnahme zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Nur achteinhalb Jahre, wie Birkholtz beklagte, aber Wittmanns Anwalt hatte glaubhaft machen können, dass zwar der Überfall, nicht aber die Geiselnahme geplant war. So viel zur Berechenbarkeit von Überfällen und Birkholtz’ Theorie, dachte Inka.
Als Resultat war an Inka und vor allem an Birkholtz damals der Makel eines versauten, ungelösten Falles hängengeblieben. Weshalb die beiden sich geschworen hatten, Wittmann nicht aus den Augen zu lassen, sobald dieser irgendwann entlassen würde. Dank dessen guter Führung, seiner günstigen Sozialprognose und vor allem dank eines positiven psychologischen Gutachtens war das genau heute der Fall. Inka las den Namen der zuständigen Psychotherapeutin: Dr. Angelika Pott. Ein Name, der ihr nichts sagte.
Inka schloss die Akte und sah auf.
»Der Mann hat seine Strafe verbüßt, ich bin offiziell Dienststellenleiterin in Brilon. Dir ist klar, dass ich nicht mehr tun kann, als ein bisschen auf den Busch zu klopfen, oder?«
Birkholtz sah sie an.
»Ich bin dir schon dafür mehr als dankbar, Frau Kriminalhauptkommissarin. Geht nur darum, Wittmann zu zeigen, dass wir ihn nicht vergessen haben. Den Rest übernehme ich. Äh, was war noch mal Freizeit«, scherzte er. Inka lächelte, bemerkte aber, dass er sich im selben Moment anspannte.
»Showtime«, meinte Birkholtz, nahm den letzten Schluck Kaffee und warf den Becher weg. Inka ließ die Akte sinken und folgte Birkholtz’ Blick zum Eingangsgebäude der JVA. Die kleine Tür neben dem Ausgangstor hatte sich geöffnet, und ein Justizbeamter gab einem unscheinbar wirkenden Mann mit einem Rucksack den Weg frei. Unsicher und ein wenig verloren trat Sven Wittmann in die wiedergewonnene Freiheit. Auf Inka wirkte er grauer, aber drahtiger als bei seiner Verhaftung. Vermutlich hatte er im Knast trainiert. Seine Kleidung, die er wohl schon bei seiner Einlieferung getragen hatte, hing deutlich zu weit an ihm herunter und war modisch überholt. Wittmann sah sich um, bemerkte sein Empfangskomitee und schritt langsam, aber entschlossen auf Inka und Birkholtz zu. Die beiden verschränkten die Arme und ließen Wittmann auf sich zukommen. Es dauerte eine geschlagene Minute, bis der Mann ihnen gegenüberstand.
»Wow, der ganz große Bahnhof? Wusste gar nicht, dass mir ’ne Eskorte in die Stadt zusteht«, meinte er.
Inka und Birkholtz verzogen keine Miene.
»Machen wir’s kurz, Wittmann«, raunte Birkholtz. »Wir wissen, was Sie wissen. Also vergessen Sie alles, was mit Geldbeschaffung, Bambushütten am Strand und kleinen thailändischen Mädchen zu tun hat.«
»Wenn Ihr Kumpel von damals das Programm nicht längst allein durchgezogen hat«, ergänzte Inka.
Birkholtz übernahm wieder. »Will sagen, wir haben ein Auge auf Sie, Wittmann.«
Wenn Wittmann das aus der Ruhe brachte, ließ er es sich nicht anmerken. Er schüttelte den Kopf, als könne er nicht glauben, was ihm da vorgeworfen wurde.
»Thailand? Ich bin auf Bewährung, Mann. Und ich hab’ andere Pläne.«
Als Inka und Birkholtz nichts erwiderten, fuhr er fort.
»Sittiche«, sagte er. »Brieftauben sind was für Spießer. Mein Zellenkollege hatte zwei Nymphen. Super Tiere. Hab’ mir alles über Zucht und Haltung und so angelesen und bau mir ’ne Voliere. Im Ernst, Leute. Ich bin sauber, und ich bleib’ sauber.«
Birkholtz lächelte humorlos und sah Inka an.
»Den unschuldigen Klischee-Knacki hat er jedenfalls super drauf.«
Inka übernahm wieder.
»Herr Wittmann, Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Sollten Sie aber auf irgendeine Art und Weise versuchen, sich Ihren Anteil an der Beute von damals zu verschaffen oder auch nur Ihren Komplizen zu kontaktieren, werden wir das herausfinden.«
»Und Sie legen schneller den Rückwärtsgang ein, als Sie »Scheiße« sagen können«, ergänzte Birkholtz und deutete zur JVA.
Wittmann sah Inka an.
»Schon klar. Aber alles nicht nötig. Ich hab’ nämlich ’ne Freundin. Echt. Seit ’n paar Monaten. Wohnt hier ganz in der Nähe und meint, ich kann bei ihr einziehen. Nicht schlecht, oder?«
Birkholtz und Inka musterten ihn ernst. Was auch Wittmann wieder ernst werden ließ. Er deutete mit dem Daumen in Richtung Eingangsgebäude, als wäre die JVA schon jetzt eine Episode seines Lebens, die Jahre hinter ihm lag.
»Außerdem hab’ ich da drin ’ne Bäckerlehre gemacht«, meinte Wittmann. Er zuckte mit den Schultern und sah sich um. »Ich züchte ’n paar Vögel, kümmer’ mich um meine Süße und such’ mir ’nen Job an ’nem warmen Ofen.« Er deutet grinsend auf Inkas Bäckerei-Kaffeebecher. »Und wenn Sie echt Glück haben, geb’ ich Ihnen mal einen aus.«
Im selben Moment heulte ein Dieselmotor auf, und ein Taxi hielt neben Wittmann.
»Mann, ich könnt’ den ganzen Tag plaudern, aber ich hab’ noch ’n bisschen was nachzuholen.« Er lächelte linkisch, warf seinen Rucksack auf die Rückbank des Taxis und setzte sich auf den Beifahrersitz.
»Man sieht sich. Aber hoffentlich nicht so schnell.«
Birkholtz und Inka schwiegen. Doch Birkholtz ließ es sich nicht nehmen, dem Bankräuber mit gespreiztem Zeige- und Mittelfinger, die er von seinen Augen auf die des Bankräubers richtete, noch einmal klarzumachen, dass er ab jetzt unter Beobachtung stand. Wittmann verdrehte die Augen und zog die Tür mit sattem Knall zu. Das Taxi fuhr davon. Inka und Birkholtz sahen ihm nach. Als der Wagen hinter einer Straßenbiegung verschwunden war, wandte Inka sich zu Birkholtz und sah in grimmig entschlossene Augen.
»Hab’ ich schon gesagt, dass ich nicht eher in Pension gehe, bevor ich diesen Fall geknackt hab’?«, fragte Birkholtz tonlos. Seine gewohnte Ironie war verflogen. Inka atmete durch. Auch ihr war der Fall keineswegs gleichgültig, aber sie hatte in Brilon eine neue Aufgabe übernommen, die sogar noch anspruchsvoller war.
»Der Stachel sitzt echt tief, oder?«, fragte sie.
Birkholtz’ Augen verfinsterten sich zu schmalen Schlitzen.
»Es ist weniger Wittmann persönlich. Der ist dämlich genug, wegen irgend ’ner anderen Sache wieder einzufahren. Was mir echt Sorgen macht, ist unser zweiter Mann.« Birkholtz’ Blick schweifte über die Häuser von Werl, als könne er durch sie hindurch die Weite der Landschaft dahinter erkennen.
»Irgendwo da draußen lebt seit über acht Jahren völlig unbehelligt ein Typ, der entweder verdammt gut ein Geheimnis für sich behalten kann oder einen noch besseren Plan hatte, was er mit der Beute von damals anstellt.«
Inka verstand, worauf er hinauswollte.
»Beides keine angenehme Vorstellung«, sagte sie beklommen.
Birkholtz nickte und sah Inka entschlossen an.
»Wittmann ist unser Schlüssel zu Mister X. Der hat nicht umsonst seine Strafe abgesessen. Der will seinen Lohn für sein Schweigen. Ich bleib’ dran, Inka.«
Sie trank ihren Kaffee aus und drückte Birkholtz den leeren Becher in die Hand.
»Und wie?«, fragte Inka. »Der weiß doch auch, dass du ihn nicht rund um die Uhr observieren lassen kannst.«
»Meine Frau sagt, ich hab’ sowieso zu wenig Hobbys.« Immerhin war Birkholtz’ Ironie wieder da, dachte Inka. Sie lächelte und klopfte ihm kumpelhaft auf die breite Schulter.
»Was muss der Typ sich auch ausgerechnet mit Dortmunds letztem echten Bullen anlegen?« Dann wurde ihr Blick nachdenklicher. »Wenn ich irgendwas für dich tun kann … Ich meine trotz Exil in Brilon, sag Bescheid, okay?«
Birkholtz nickte dankbar, als Inkas Handy klingelte. Sie sah auf das Display. Diesmal war es ihre Dienststelle in Brilon. Inka nahm das Gespräch an.
»Marlies, was gibt’s?«
Inka horchte. Ihr Blick verfinsterte sich. Ohne zu antworten legte sie auf, steckte ihr Handy ein und stieß sich von der Motorhaube ab.
»Sorry, ich muss. Halt mich auf dem Laufenden.«
Inka gab Birkholtz die alte Akte zurück und eilte zu ihrem Dienstwagen.
4
Montag, 10:41 Uhr
»Scheiße.«
Inka machte sich keine Mühe, ihr Entsetzen beim Anblick der Leiche zu verbergen. Trotz ihrer mittlerweile beachtlichen Diensterfahrung würde ein gewaltsamer Tod nie Normalität für sie werden. Schon gar nicht einer wie dieser.
Die ungewöhnlich warme Vormittagssonne hatte den Leichenfundort, einen winzigen hölzernen Bootsschuppen am Ufer des Biggesees, ohnehin schon beachtlich aufgeheizt. Doch jetzt bereiteten die Hitze der gleißend hellen Tatortbeleuchtung in Verbindung mit der Feuchte des nahen Sees und dem Surren Tausender Fliegen selbst einem Profi wie Inka ein nur schwer erträgliches Arbeitsumfeld. Nicht einmal ihr weißer Einwegoverall, der umgeschnallte Mundschutz und ihre bewährte Tatortatmung, nur noch durch den Mund, konnten verhindern, dass eine übelkeitserregende Welle aus fauligem Verwesungsgestank, metallischem Blutgeruch und dem allgegenwärtigen Moder durch jede Pore ihres Körpers drang.
Sie stand neben Klaus Porbeck, dem jungen Forensiker ihres Teams, und sah unter ihrer Kapuze auf einen leblosen Körper.
Angelehnt an eine rohe Holzwand saß vor den beiden die Leiche eines etwa fünfzigjährigen Mannes inmitten einer bräunlich verkrusteten Pfütze aus getrocknetem Blut. Weit aufgerissene Augen starrten leer in die Ferne. Gliedmaßen hingen leblos herab, als hätte jemand einer grotesken Marionette die Seile durchtrennt.
Im Brustkorb des Mannes klaffte eine tiefe, etwa zehn Zentimeter große, kreisrunde Wunde. Der Grund für den enormen Blutverlust des Opfers.
Inka sah sich unwohl um. Die staubige Enge des Schuppens machte die Szenerie noch unerträglicher. Auf etwa zehn Quadratmetern hatte man anscheinend alles untergebracht, was zum Betrieb und Unterhalt des nahen Bootssteges vor dem Schuppen nötig war. In den Schatten hinter der Tatortbeleuchtung hingen und standen allerlei maritime Gegenstände ohne erkennbare Ordnung. Inka erkannte Rettungsringe, Bootsfender, ausgeblichene Schwimmwesten, Angelruten und Kescher. Dazu Seile in allen erdenklichen Materialien, Längen und Farben. Wandte sie sich auch nur einen halben Meter um, stieß sie zwangsläufig an eine betagte staubige Werkbank, die augenscheinlich schon spurensicherungstechnisch behandelt worden war und ein Sammelsurium unterschiedlicher Holz- und Plastikkisten beherbergte. Inka erkannte Schrauben, Nägel und andere Befestigungsmaterialien. Daneben stapelten sich Kartons, Becher und Eimer mit Farben, Lacken und Holzlasuren. Werkzeug konnte Inka nicht entdecken, dafür unzählige weitere Gegenstände im Halbdunkel. Inkas Blick wanderte sehnsüchtig zu einem winzigen verdreckten Fenster über der Werkbank, das sich jedoch anscheinend nicht öffnen ließ. Sie merkte, wie ihr schwindelig wurde und war froh, dass Porbeck endlich zur Sache kam.
»Wie Sie sehen: männliche Leiche«, sagte der Forensiker etwas gedämpft durch seinen Mundschutz und wedelte einen wütenden Schwarm blauschillernder Fliegen beiseite. »Kein Ausweis, keine persönlichen Gegenstände, aber identifiziert als Bernd Groschek. Zweiundfünfzig Jahre alt.«
»Sagt wer?«
»Der Mann, der ihn heute Morgen gefunden hat. Ein Angler. Kemperdick und Röggen haben ihn befragt.«
Inka nickte. Sie hatte sich schon gefragt, wo sich die restlichen beiden Mitglieder ihres Teams befanden. Offenbar bei der Zeugenbefragung irgendwo auf dem Campingplatz.
»Hat dieser Angler hier irgendwas angefasst?«, fragte Inka und sah in der Hoffnung zur Tür, wenigstens von dort einen Hauch frischer Luft atmen zu können. Porbeck schüttelte den Kopf.
»Ich hab ihn schon befragt. Er war nicht mal hier drin. Er sagt, er sei so was wie ein Stammkunde und habe seine Angelrute hier untergestellt. Als er sie heute Morgen aus dem Schuppen holen wollte, hat er erst die Fliegen bemerkt, dann den Toten durch den Spalt zwischen Tür und Rahmen entdeckt und die Rezeption des Campingplatzes angerufen, die wiederum uns benachrichtigt hat.«
»Kannte er den Mann?« Diesmal nickte Porbeck und deutete auf ein blutverkrustetes metallenes Emblem in der Nähe der Wunde des Opfers. Ein Sheriffstern.
»Groschek war der ›Sheriff‹ auf dem Campingplatz«, meinte Porbeck und machte behandschuhte Anführungszeichen mit Zeige- und Mittelfingern in der Luft. »Eine etwas testosteronlastige Umschreibung für Hausmeister oder Mädchen für alles.«
Inka sah noch einmal zur Tür. Diesmal auf deren Schloss. Ein einfacher Metallriegel mit Verriegelungs-, aber ohne Schließmechanismus.
»Ist der Schuppen denn normalerweise abgeschlossen?«, fragte sie.
Wieder ein Kopfschütteln von Porbeck.
»Hier kann jeder jederzeit rein. Der Angler meint, hier kennt man sich.« Porbecks Schulterzucken führte dazu, dass erneut ein Schwarm Fliegen mit empörtem Summen aufstob. Inka zog ihre Kapuze etwas tiefer ins Gesicht, konnte aber nicht verhindern, dass etliche der Insekten summend an ihre Wangen stießen. Zusätzlich zum Schwindel kämpfte sie gegen eine aufkommende Welle der Übelkeit. Sie war froh, dass ihr Frühstück nur aus einem Becher Kaffee bestanden hatte. Porbeck hockte sich nun neben die Leiche.
»Einen Unfall können wir jedenfalls ausschließen«, meinte er und deutete auf die Wunde im Brustkorb des Mannes. Deren Umrandung hatte, wie die Blutlache auf dem Boden des Schuppens, einen dunklen Braunton angenommen.
»Definitiv«, ergänzte er und gab Inka einen großen transparenten Beweisbeutel, in dem sie einen etwa dreißig Zentimeter langen Holzpflock erkannte. Etwa zehn Zentimeter im Durchmesser schien er in Form und Größe zur Wunde des Opfers zu passen. Sein angespitztes unteres Ende wies Blutspuren und Gewebe- und Kleidungsreste des Opfers auf, wie Inka vermutete.
»Die Tatwaffe«, bestätigte Porbeck prompt. »Lag direkt neben dem Opfer und passt genau zur Eintrittswunde. Keine Fingerabdrücke. DNA überprüfe ich noch.«
»Sie kommen mir jetzt aber nicht mit ’ner Ritualnummer, oder?«, fragte Inka besorgt und gab ihm die Tüte zurück. »Von wegen Werwolfjagd mit Holzpflock ins Herz und so?«
Um Porbecks Augen bildeten sich kleine Fältchen, was wohl hieß, dass er unter seinem Mundschutz lächelte.
»Wenn, dann eher Vampirjagd. Tötet man Werwölfe nicht mit ’ner Silberkugel oder durch Enthauptung?« Porbeck war ein Mann der Fakten, nicht der Mythen. Die Fältchen verschwanden, und sein Ton wurde wieder ernst.
»Nach dem Wundkanal sieht es jedenfalls nach einer einzigen Stichbewegung aus. Rechtshänder. Verlauf von oben nach unten. Direkt ins Herz. Aber wie gesagt, alles vorläufig.«
Inka nickte nachdenklich, wog den Pflock in ihrer Hand und maß die Leiche Bernd Groscheks visuell ab.
»Jemand, der mindestens gleich groß war«, sinnierte sie. »Und ziemlich Kraft hatte.«
»Oder wusste, wo man treffen muss«, schränkte Porbeck ein. »Jedenfalls ging der Stich offenbar sauber zwischen zwei Rippen durch. Kann aber auch Zufall gewesen sein.«
»Wissen wir, wo die Waffe herkommt?«, fragte Inka.
Anstelle einer Antwort richtete Porbeck sich auf und drehte sich vorsichtig zu der schmalen Werkbank hinter Inka und deutete auf einen Vorrat an weiteren Pflöcken im Halbdunkel an der Wand.
»Da liegt noch ein ganzer Stapel. Alle identisch mit der Tatwaffe. Kesseldruckimprägnierte Industrieware aus Kiefer. Für kleine Zäune oder Palisaden.«
Inka drehte sich ebenfalls um und nahm sich einen der von Porbeck angesprochenen Pflöcke, um ihn mit der Tatwaffe im Beutel zu vergleichen. Beide hatten dieselbe Größe, dieselben grünlichen Imprägnierungsverfärbungen und dieselben Alterungsspuren.
»Notwehr können wir ausschließen?«, fragte sie mit einem Blick in Richtung ihres Forensikers.
»Ist aufgrund der mangelnden Kampfspuren jedenfalls sehr unwahrscheinlich. Allerdings ist die Spurenlage etwas … «, er suchte nach dem richtigen Wort. »Vielschichtig«, meinte er. Er wandte sich zur Tür und stellte den möglichen Tatverlauf nach. »Ich nehme an, Täter und Opfer kommen zusammen rein. Der Täter dreht sich zur Werkbank, schnappt sich einen der Pflöcke und sticht zu.«
»Sie meinen, Groschek wurde überrascht«, meinte Inka nachdenklich. Porbeck nickte.
»Es gibt keine Abwehrspuren. Groschek hat nichts geahnt. Und ist sofort tot hinter der Tür zusammengebrochen.«
Inka sah sich noch einmal um. »Also hat er der Person vertraut?«, überlegte sie laut.
»Vermutlich.«
Inka atmete durch und sah sich in ihrer ersten Annahme bestätigt.
»Dann reden wir über Mord«, meinte sie und sah Porbeck an. »Fundort gleich Tatort?«
Wieder nickte Porbeck.
»Den Todeszeitpunkt kann ich aber erst mal nur grob schätzen. Definitiv länger als 24 Stunden. Ich sage mal ›Arbeitstitel Samstag‹. Leider ist es hier so heiß, dass die Temperaturmethode nicht funktioniert. Ich sehe mir in Brilon mal den Mageninhalt an und wenn das nicht weiterführt …« Er ließ den Satz unvollendet und scheuchte stattdessen einen neuen Schwarm Fliegen auf. »Die Calliphoridae hier waren auch nicht ganz faul.«
Inka wusste, was er meinte. Schmeißfliegen waren meist die ersten Lebewesen, die den noch kaum wahrnehmbaren Verwesungsgeruch einer Leiche erkannten. Als Aasinsekten witterten sie nicht nur eine lukrative Nahrungsquelle für sich selbst, sondern erst recht für ihren Nachwuchs. Porbeck hatte Inka einmal von einem Fall erzählt, in dem nicht einmal 60 Minuten nach dem Tod eines Unfallopfers bereits erste Eiablagen auf dem Körper nachgewiesen werden konnten. Diesen natürlichen Umstand machte sich die forensische Entomologie zunutze, um den Todeszeitpunkt eines Opfers besser bestimmen zu können. Je nach Witterung am Tat- oder Fundort und dem Entwicklungszustand der Insektenlarven konnte man unter Berücksichtigung weiterer Faktoren, wie Körpergewicht des Opfers und dessen Zugänglichkeit für die Insekten Rückschlüsse auf den Zeitpunkt der Eiablage und damit zum ungefähren Eintritt des Todes ziehen.
»Aber um noch mal auf die Vielschichtigkeit der Spuren zurückzukommen …«, meinte Porbeck und scheuchte abermals einen Schwarm Fliegen auf, von denen nun einige in Inkas Kapuze landeten und sich mit wütendem Surren in ihrem Haar verfingen. Ekel mischte sich unter ihre Übelkeit, eine Gänsehaut kroch über ihren Rücken.
»Gerne«, sagte Inka mühsam beherrscht. »Aber bitte draußen.«
Inka wandte sich zur Schuppentür. Sie konnte es kaum erwarten, durch den surrenden Schwarm Calliphoridae ins Freie zu treten.
Draußen angekommen riss sie den Mundschutz hoch, klappte ihre Kapuze herunter und fuhr sich wild schüttelnd durchs Haar. Gierig sog sie frische Sauerländer Luft in die Lungen. Sie merkte augenblicklich, wie die Übelkeit verflog. Und dass ihre kurze Unbeherrschtheit ein Fehler gewesen war. Ein undefinierbares Stimmengewirr brandete leise auf. Inka hörte das künstlich animierte Klicken zahlreicher Fotokameras und blickte in eine Phalanx aus Handys und den neugierigen Gesichtern Dutzender wohlgebräunter Menschen in zu bunter Freizeitkleidung.
»Verdammt«, murmelte sie unhörbar. Hatten sich bei ihrem Eintreffen erst ein paar irritierte Camper, Angler und Spaziergänger hinter dem rot-weißen Absperrband der Bereitschaftspolizei eingefunden, waren nun geschätzte achtzig Schaulustige rings um den Schuppen am Steg versammelt. Vier uniformierte Beamte der örtlichen Polizei hatten ihre liebe Mühe, sie am Betreten des Tatortes zu hindern. Woran sie sie nicht hindern konnten, war das Fotografieren. Inka wurde klar, dass sie mit ihrem Verhalten indirekt das bestätigt hatte, was jeder einzelne der Gaffer sich erhofft hatte: In dem Schuppen befand sich eine morbide Sensation mit Gruselfaktor. Inka stöhnte innerlich auf. Wenn nur die Hälfte der Handyknipser einen Account bei irgendeinem sozialen Netzwerk hatte, konnte sie sich ausmalen, was in den nächsten Stunden daraus werden würde. Anscheinend legten auch andere Arten von Schmeißfliegen ihre Eier am liebsten auf frischem Aas ab.
Eine wohltuend sachliche Stimme rief Inka in die Realität zurück.
»Kann ich den Tatort dann freigeben?« Inka drehte sich um. Porbeck war neben sie getreten. Wenn er Inkas düstere Gedanken ahnte, ließ er es sich nicht anmerken. Stattdessen deutete er mit dem Kopf auf zwei diskret dreinschauende Männer, die graue Kittel über schwarzen Anzügen trugen. Anscheinend die Mitarbeiter eines Beerdigungsinstitutes, die geduldig darauf warteten, ihrer Arbeit nachgehen zu können. Inka nickte mit mahnendem Blick.
»Aber erst, wenn Sie wirklich nichts übersehen haben.«
Porbeck nickte wissend.
»Pfeil, oder?«, fragte er und traf damit voll ins Schwarze.
Weil Inka geschlagene eineinhalb Stunden gebraucht hatte, um sich von Werl einmal quer durchs Sauerland nach Olpe zu kämpfen, hatte sie Porbeck angewiesen, den Tatort nicht vor ihrem Eintreffen freizugeben. Sie wollte ihn unbedingt persönlich in Augenschein nehmen. Nicht, weil sie Porbecks Spurensicherung nicht traute. Im Gegenteil. Der junge Mann war die Personifizierung seriöser Polizeiarbeit. Er hatte vor etwa zwei Jahren fast zeitgleich mit Inka in Brilon seinen Dienst angetreten und war von einem anfangs schüchternen Nachwuchspathologen zu einem veritablen Allround-Forensiker gereift, der sich mittlerweile sogar als hervorragender Ermittler entpuppte. Inkas Bedenken hatten sich eher gegen ihren neuen Vorgesetzten gerichtet. Georg Pfeil. Inkas ehemaliger Kollege und im Dienstrang Untergebener, war zum Polizeirat befördert worden und seit einigen Wochen Inkas direkter Vorgesetzter. Da ihr Verhältnis schon seit Inkas Dienstantritt nicht gerade auf Herzlichkeit und gegenseitiger Wertschätzung beruhte, wusste Inka nicht, was sie erwartete, falls sie nicht streng nach Vorschrift arbeitete.
»Keine Sorge. Alles hier drin«, meinte Porbeck und kramte umständlich seinen obligatorischen Tablet-PC aus den Tiefen seines Overalls. Inka zog Porbeck etwas abseits des Schuppens auf den Bootssteg.
»Und was meinten Sie eben mit Vielschichtigkeit der Spuren?«, fragte sie ihn.
»Sie haben sich doch sicher schon gefragt, warum wir nicht mehr Spuren gefunden haben, die direkt mit dem Mord zusammenhängen.«
Das hatte Inka in der Tat. Der Schuppen hätte aufgrund seines vernachlässigten Zustands und der dicken Staubschichten eigentlich ein Eldorado für jede Spurensicherung sein müssen. Es sei denn, er wäre gereinigt worden, aber den Eindruck hatte er nun wirklich nicht gemacht.
»Es gab noch mehr Spuren. Aber die wurden durch andere Spuren überdeckt und unbrauchbar gemacht.« Inka sah ihn mit großen Augen an.
»Aber Sie sagten doch, der Angler hätte den Schuppen nicht betreten.«
»Der nicht. Aber jemand anderes. Genauer zwei Personen.«
Zur Bestätigung öffnete Porbeck eine Reihe von Fotos auf seinem Tablet, die die Abdrücke von Schuhsohlen auf dem staubigen Betonboden des Schuppens zeigten.
»Zwei verschiedene Paar Sportschuhe oder Sneakers«, sagte er. »Größen vermutlich etwa 37 und 44. Könnte also ein Pärchen gewesen sein.«
»Als die Leiche schon im Schuppen lag?!«, fragte Inka noch immer fassungslos.
»Ja.« Bestätigte Porbeck und kam Inkas nächster Frage zuvor. »Und die Leiche müssen sie bemerkt haben.«
Er schloss die Datei mit den Schuhabdruckfotos und öffnete eine weitere. Inka sah nun die Oberfläche der Werkbank, vor der sie noch vor wenigen Augenblicken gestanden hatte. Auf ihrer staubigen Arbeitsfläche befand sich ein weiterer Abdruck, den Inka im Schatten der hellen Tatortleuchten zunächst nicht erkannt hatte. Ein Bild, das einem Fotonegativ ähnelte und Nähte, Nieten und Falten zeigte, die Inka aus ihrem heimischen Wäschekorb bekannt vorkamen.
»Ist das … ein Hintern?«, fragte sie irritiert.
»Genauer gesagt, der Abdruck eines vermutlich weiblichen Gesäßes in einer Jeans«, präzisierte Porbeck. »Gehen wir von meiner Pärchentheorie aus, dann hat die Frau auf der Werkbank gesessen. Mit Blickrichtung direkt auf die Leiche.«
»Und es gibt sicher keine Meldung von den beiden?«
Porbeck verneinte und überließ Inka die Schlussfolgerung.
»Dann sind die beiden entweder in Panik geraten. Oder sie hatten einen Grund, warum sie sich nicht gemeldet haben.« Inka sah vom Foto zu Porbeck. »Außer Fuß- und Arschabdruck irgendwas, womit wir sie identifizieren können? Körperflüssigkeiten oder so?«
»Nein, aber fast so gut«, lächelte Porbeck nicht unzufrieden und förderte auf seinem Tablet eine Reihe weiterer Fotos zutage. Wieder die Werkbank, allerdings diesmal die Detailaufnahme eines Bechers auf der Arbeitsfläche, den Inka bei ihrer Tatortbesichtigung allerdings nicht bemerkt hatte.
»Einer der beiden, vermutlich die Frau, hatte die Finger in einem Behälter mit einer Spezialdichtmasse für Boote.«
Inka sah auf das Bild eines weißen Plastiktopfes mit dem Werbeaufdruck eines englischsprachigen Herstellers, dessen Deckel jemand offen gelassen hatte. Darin befand sich eine offenbar halb ausgehärtete flexible Masse, die Inka farblich an Erdnussbutter erinnerte. Inmitten der ansonsten nahezu glatten Oberfläche prangten deutlich erkennbar die Einstiche zweier Finger, vermutlich einer rechten Hand.
»Den Becher habe ich in die Kühlung gebracht, bevor ich die Scheinwerfer im Schuppen aufgebaut habe«, erklärte Porbeck. »Es war ohnehin schon warm genug. In der Scheinwerferhitze wäre die Masse womöglich flüssig geworden, und wir hätten die Spuren verloren.«
»Reicht das denn für einen Abdruck?«, fragte Inka.
»Eigentlich ist es fast schon einer.« Porbeck lächelte zufrieden und schloss seine Fotodateien. »Das wär’s erst mal von meiner Seite. Wenn Sie mich nicht mehr brauchen, fahre ich nach Brilon zurück und kümmere mich um alles Weitere.«
Er deutete mit dem Daumen zum Schuppen, aus dem die beiden Bestatter gerade einen schweren Körper in einem weißen Leichensack trugen, um ihn in den bereitstehenden Transportsarg zu legen. Bernd Groscheck trat seine vorletzte Reise an.
Das Klicken der Gafferhandys erinnerte Inka daran, dass ihre Reise dagegen gerade erst begonnen hatte. Sie atmete durch und zückte ihr Handy.
»Danke, Herr Porbeck. Gute Arbeit. Wo sind eigentlich die Kollegen Kemperdick und Röggen?«
5
Montag, 11:43 Uhr
»296 Stellplätze?!«
Inka dehnte die Zahl ungläubig und sah von dem vor ihr liegenden Lageplan des Campingplatzes »Vier Jahreszeiten« in die Gesichter von Kemperdick und Röggen. Schon bei ihrer Ankunft war ihr klar gewesen, dass es sich um eine größere Anlage handelte. Wie groß, das hatten die über das weitläufige Gelände verteilten, dichtbelaubten Bäume, die kaum einsehbaren Reihen aus Wohnwagen, Campingmobilen und Zelten und die zum Biggesee abfallenden Hänge des Platzes allerdings sorgsam kaschiert. Der Plan zeigte nun die ungeschönte Wahrheit über das Ausmaß an Laufarbeit, das Inka und ihren Kollegen bevorstand.
Sie wandte sich wieder dem Plan zu. Die Lage des Campingplatzes erinnerte Inka an einen auf dem Kopf stehenden, flachen, windgepeitschten Baum, wie man sie häufig an der Küste fand. Vom breiten Zufahrtsbereich mit dunkelrot markierten Verwaltungs- und Service- und Freizeitgebäuden verästelten sich grau eingezeichnete Wege auf grünem Untergrund vom oberen rechten Rand des Planes in verschieden langen, bogenförmig angelegten Wegen nach links unten. Unterschiedlich große gelbe, nummerierte Kästchen reihten sich rechts und links davon auf. Die Stellplätze. Am auffälligsten waren vier kreisrunde Stellplatzbereiche, die sogenannten Rondelle, die wie exotische Blüten aus dem Astgewirr hervorstachen. Abgerundet wurde der Plan mit der exakten Lage von Sanitärgebäuden, Koch- und Waschküchen, Wertstoffhöfen und Spielplätzen. Ein großes »N« mit einem Pfeil verortete die Nordrichtung nach links oben. Neben dem Pfeil deuteten weitere beschriftete Flächen eine Rollschuhbahn, den Sportplatz eines örtlichen Fußballvereins, den campingplatzeigenen Bolzplatz sowie eine Grillhütte und eine Tauchschule an. Inka hob beeindruckt die Brauen, als sie neben dem Rezeptionsbereich mit Servicebüro und Shop auch noch einen Wellnessbereich mit Sauna und Solarium fand. Dazu der See mit seinen Wassersportmöglichkeiten … Verzichten musste man hier auf keine Annehmlichkeit. Henne würde bei diesem Anblick nicht ganz zu Unrecht fragen, warum man sechshundert Kilometer nach Dänemark fahren musste, wenn die Erholung doch so nah war. Inkas Antwort würde lauten, dass sie wenigstens einmal im Jahr für zwei Wochen rausmusste. Raus aus dem Alltag, raus aus dem Sauerland. Und sie würde sagen, dass sie Camping hasste.
»296 Stellplätze ist noch nicht mal die schlechte Nachricht«, meinte eine männliche Stimme. Bastian Kemperdick hatte sich auf die Ellenbogen gestützt, betonte seine muskulösen Oberarme unter seinem sportlich-engen karierten Hemd und machte eine fächerartige Bewegung mit der rechten Hand.
»Die schlechte Nachricht lautet: Der Platz ist fast komplett ausgebucht. 290 belegte Plätze.«
Die drei Ermittler standen im Halbkreis um einen verwaisten Schreibtisch im Servicebüro des Campingplatzes. Die kleine, normalerweise gut frequentierte Rezeption war im Alltagsbetrieb das pulsierende Herz der gesamten Anlage. Hier wurden An- und Abreiseformalitäten erledigt, Informationen über den Platz und die Umgebung ausgetauscht, Aktivitäten gebucht, Telefonkarten und Briefmarken verkauft – falls im Internetzeitalter noch nachgefragt –, Gasflaschen getauscht und sogar Bücher aus einer kleinen Bibliothek verliehen. Ein großer hölzerner Tresen trennte den hellen, freundlich gestalteten Raum in einen Gäste- und einen Mitarbeiterteil. Die holzvertäfelten Wände waren mit Landkarten, Werbeplakaten und Informationsmaterial bestückt. Handgezeichnete Bilder mit kindlichen Urlaubsmotiven offenbar zufriedener kleiner Gäste verliehen dem Raum eine familiäre Atmosphäre. Allerdings nicht heute, denn bis auf Inka, Kemperdick und Röggen war das Servicebüro menschenleer. Angesichts der Ereignisse unten am Bootssteg hatte die Platzleitung in Absprache mit der Polizei entschieden, die Rezeption bis auf weiteres zu schließen. Die Jalousien der großen Fenster waren heruntergelassen, die ansonsten einladend offenstehende Tür verschlossen, das Herz des Campingplatzes schlug auf Notbetrieb.
»Gut, zumindest waren am Wochenende 290 Plätze belegt«, präzisierte Marlies Röggen, »unserem relevanten Zeitpunkt, wenn wir von Porbecks Vermutung ausgehen, dass der Todeszeitpunkt irgendwann am Samstag lag.«
Inkas Kollegin setzte elegant ihre Kaffeetasse ab und verzog den Mund. Irgendetwas an dem Gebräu schien nicht zu stimmen. Trotzdem kam Inka nicht umhin, wieder einmal festzustellen, dass Marlies wie üblich makellos aussah. Sie war zwar einige Jahre älter, aber eine waschechte Teflon-Schönheit, wie Inka sie insgeheim getauft hatte. Jede Art äußerer Einflüsse schienen an ihr abzuperlen wie Regentropfen an einem Lotusblatt. Ihr Make-up war dezent, ihre Frisur frisch und topmodisch und ihre Kleidung perfekt darauf abgestimmt. Sogar die Tatortgummistiefel, die Inka selbst nach eigener Einschätzung endgültig zum Bauerntrampel degradierten, wirkten an Marlies wie elegante Reiterstiefel einer Dame der gehobenen Gesellschaft. Inka merkte, dass sie gedanklich abschweifte. Vielleicht lag es auch daran, dass sie seit der Tatortbesichtigung reif für eine Dusche war und die provisorische Campingplatzatmosphäre ihr den Rest gab. Was man von Kemperdick und Röggen offenbar nicht sagen konnte.
Die beiden waren konzentriert bei der Sache und neben Porbeck die letzten verbliebenen Mitglieder ihres Ermittlungsteams, nachdem Georg Pfeil von Inkas Assistenten zu ihrem Chef aufgestiegen war. Und sie hatten eine Affäre. Sie gaben sich zwar nach außen alle Mühe, es zu verbergen, aber Brilon war einfach zu klein, als dass nicht die kleinste verräterische Geste sofort zum Überkochen der Gerüchteküche geführt hätte. Wovon Kemperdick und Röggen jedoch unbeeindruckt blieben. Entweder sie wussten nicht, dass ganz Brilon es wusste, oder sie wollten sich nicht angreifbar machen. Inka war das egal, solange ihre Arbeit nicht darunter litt. Und das tat sie definitiv nicht.
»Das Problem ist, dass Samstag und Sonntag hier die Hauptan- und -abreisetage sind«, erklärte Kemperdick. »Das heißt, einige der möglichen Zeugen von Samstag sind schon wieder zu Hause. Ferienende in NRW und so.«
Inka nickte. Das kam ihr irgendwie bekannt vor.
»Haben wir eine Übersicht über die Gäste?«, fragte sie und bekam von Röggen einen mehrseitigen Computerausdruck zugeschoben. Darauf erkannte sie unter dem Logo des Campingplatzes eine Tabelle, auf der neben jeder einzelnen Stellplatznummer Namen, Adressen, Telefonnummern sowie Kalenderdaten verzeichnet waren. Inka blickte auf die Kopfleiste der Tabelle und sah ihre Vermutung bestätigt, dass es die Stellplatzmieter mit ihren persönlichen Daten sowie den Zeitpunkten ihrer An- und Abreise waren. Hinter einigen der Spalten waren handschriftliche Kreuze vermerkt.
»Sehr gut. Habt ihr mit der Befragung schon angefangen?«
Röggen nickte.
»Bisher aber nur bei dem Angler, der Groscheks Leiche gefunden hat«, sagte sie und zog ein elegantes ledergebundenes Notizbuch hervor, aus dem sie zitierte. »Karl Schleiden. Vierundsiebzig. Pensionierter Busfahrer. Hat seit Jahren ein kleines Boot am Steg und kommt regelmäßig mit seinem Fahrrad zum Angeln. Er sagt, er hat seine Angel in dem Schuppen gelagert, damit er sie nicht immer mit nach Hause nehmen muss, und wollte sie heute Morgen gegen sieben rausholen, als er Groschek gefunden hat.«
Inka sah irritiert auf. »Und wieso hat es dann so lange gedauert, bis wir benachrichtigt wurden?«
»Überforderung. Er ist nicht mehr der Jüngste, hat kein Handy und war allein am Seeufer mit einem Toten, den er kannte. Er meinte, es hat etwas gedauert, bis er es hierher ins Servicebüro geschafft hatte. Dort hat er Frau Adams, die Geschäftsführerin, alarmiert. Die ist aber erst wieder mit ihm zum Schuppen gegangen, um nachzusehen, ob Schleiden keine Gespenster gesehen hat, und hat dann von dort die Polizei per Handy alarmiert.«
Inka atmete durch. »Ist Frau Adams noch da?«
Kemperdick deutete mit dem Daumen auf eine Türöffnung in einer der holzvertäfelten Wände. Offensichtlich war dort ein separates Büro von der Rezeption abgetrennt.
»Sie wartet im Büro. Und ist ziemlich fertig.«
»Was habt ihr sonst noch?« Röggen blätterte einige Seiten weiter in ihrem Notizbuch.
»Das Ergebnis unserer Personenabfrage aus Brilon. Unser Opfer Bernd Groschek ist polizeilich bisher nicht aktenkundig geworden. Allerdings haben wir auch keine Adresse oder sonstige Identifizierungsmöglichkeit.« Inka nickte.
»Wenn er hier gearbeitet hat, weiß Frau Adams sicher mehr.«
Kemperdick war wieder an der Reihe.
»Den Rest der Zeit haben wir damit verbracht, mit Frau Adams abzugleichen, welche Gäste von Samstag noch immer hier sind und welche wir gegebenenfalls zu Hause anrufen müssen.«
Marlies Röggen deutete auf die Kreuze auf Inkas Liste.
»Die mit den Kreuzen sind die Abgereisten. Genau 112. Macht also noch mindestens 178 mögliche Zeugen unter den Campern hier, dazu deren Familien, weitere Mitarbeiter des Platzes, Passanten und alles was sonst noch hier herumläuft.«
»Sauber«, stöhnte Inka und sah ihre beiden Kollegen an. »Hört sich nach ordentlich Laufarbeit an. Habt ihr Verstärkung angefordert?«
Röggen nickte.
»Die Kollegen aus Olpe stellen uns einen Großteil der Beamten ab, die unten am See schon die Tatortsicherung übernommen haben.«
»Sehr gut«, lobte Inka. »Und Pfeil? Wisst ihr, ob der sich in meinem Urlaub um einen Nachfolger für sich selbst gekümmert hat?«
Inka entging nicht, dass Kemperdick und Röggen einen Blick wechselten, bevor Röggen antwortete.
»Du, Chefsache«, meinte sie und klappte ihr Notizbuch zu. »Da fragst du ihn am besten selbst.«
Inka sah auf ihr Handy. Wie zur Bestätigung teilte ihr eine signalrote Festnetznummer im Display mit, dass sie drei Anrufe ihrer Dienststelle in Brilon verpasst hatte. Offenbar hatte Pfeil bereits Gesprächsbedarf. Und das bedeutete, er wollte einen ausführlichen Lagebericht. Inka überlegte kurz, ob sie ihn zurückrufen sollte. Dazu hatte sie allerdings noch zu wenige Informationen.
»Okay«, sagte sie nach einigen Sekunden. »Teilen wir uns auf. Das Wichtigste ist erst mal, Zeugen zu finden und zu befragen. Kümmert ihr euch mit den Kollegen aus Olpe bitte darum?«
»Klar.« Sagte Marlies und stand auf. Kemperdick nahm den Lageplan des Platzes an sich.
»Und Sie?«, fragte er.
Ein dumpfes Poltern, gefolgt von einem unterdrückten Fluch, unterbrach die Ermittler. Sie wandten sich zu dem Büro hinter der Rezeption. Röggen sah Inka an, wie um ihre Einschätzung des nervlichen Zustands der Campingplatzleiterin zu bestätigen.
»Ich kümmer’ mich erst mal um Frau Adams. Und dann um Pfeil«, meinte Inka. »Vielleicht können wir ja später zusammen mittagessen.«
6
Montag, 11:54 Uhr
»Ist das wirklich nötig?«
Nicole Adams stand aufgebracht mit einer leeren Kaffeetasse in der einen und einer bräunlich feuchten Untertasse in der anderen Hand vor ihrem Bürofenster und sah besorgt auf die Szenerie davor. Ein buntes Trockentuch verdeckte eine dunkle Kaffeepfütze auf dem Teppich neben ihrem Schreibtisch. Der Grund für das Poltern, das Inka gehört hatte.
»Das da meine ich«, sagte Nicole Adams.
Inka folgte ihrem Blick auf den Einfahrtsbereich des Campingplatzes. Auf dem Zufahrtsweg glichen zwei uniformierte Polizeibeamte die Ausweise eines älteren Paares in einem silbernen Mittelklassekombi mit einer Liste ab. Bei dem Paar schien die Kontrolle auf Unverständnis zu stoßen. Der Mann pochte ununterbrochen auf seinen Campingplatzausweis und deutete in Richtung der Rezeption. Nicole Adams stellte Tasse und Untertasse auf einen Nebentisch und wandte sich zu Inka, die auf nun auf einen Besucherstuhl vor Adams Schreibtisch zusteuerte.
»Verstehen Sie mich nicht falsch … Ein Mord … Bei uns … Mein Gott, ich habe alles Verständnis der Welt für Ihre Arbeit, aber wissen Sie, Camper sind ein besonderer Schlag Menschen.« Sie machte eine Pause, um durchzuatmen. »Tschuldigung«, fügte sie hinzu. »Setzen Sie sich doch.«
Inka nickte und folgte der Einladung.
»Ich weiß, was Sie meinen«, sagte Inka beruhigend. »Individualität und Unabhängigkeit. Aber wir betreiben keine Schikane, sondern Ermittlungsarbeit. Und dazu müssen wir sicherstellen, dass nur Leute auf den Campingplatz kommen, die auch hierhergehören.« Nicole Adams setzte sich auf ihren Schreibtischstuhl und legte nervös die Fingerspitzen zusammen. Sie war eine attraktive Frau Anfang vierzig. Allerdings alles andere als zierlich, was aber nicht an einer unvorteilhaften Figur lag, sondern an ihrer imposanten Größe von 1,85 m. Ihre leicht burschikosen Bewegungen unterstützten Inkas Eindruck, es mit einer Frau zu tun zu haben, die lieber anpackte als zu reden. Eine Macherin. Sie trug Teamkleidung. Ein einfaches schwarzes Poloshirt mit dem Logo des Campingplatzes und eine modische Jeans. Dazu passte ihre pflegeleicht-praktische blonde Kurzhaarfrisur und die Bräune im Gesicht und auf den Armen. Inka vermutete, ein nicht geringer Teil ihres Jobs als Geschäftsführerin des Campingplatzes bestand aus Arbeit an der frischen Luft.
»Können Sie mir wenigstens sagen, wann ich das Servicebüro wieder öffnen kann?«, fragte sie Inka.
»Leider nicht. Nur, was passieren würde, wenn Sie es heute noch täten. In nicht einmal zehn Minuten hätten wir einen Massenauflauf. Die eine Hälfte der Gäste würde vermutlich abreisen wollen und die andere Hälfte hätte am liebsten eine Liveübertragung vom Bootssteg. Mit anderen Worten: Chaos. Und das ist genau das, was wir jetzt erst einmal verhindern müssen.«
Nicole Adams atmete wieder vernehmlich durch.
»Aber Sie müssen die Leute verstehen, die kommen zur Erholung her. Denen geht’s nicht nur um Sensationsgier. Die wollen wissen, ›was passiert mit meinem sauer verdienten Urlaub?‹ und ›bin ich hier überhaupt noch sicher?‹. Irgendwas müssen wir denen sagen, Frau Luhmann. Sonst macht die Gerüchteküche auch ohne Servicebüro innerhalb von einer Stunde aus einem Mord einen wahnsinnigen Serienkiller, der es auf friedliche Camper abgesehen hat!«