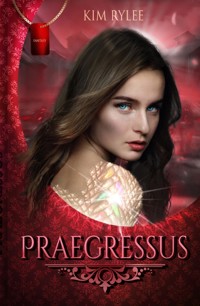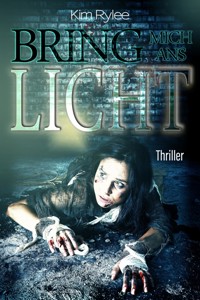4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
San Francisco. Um den Kerl ausfindig zu machen, der seine geliebte Viktoria Stern auf dem Gewissen hat, geht der gefürchtete Gangsterboss André Murony neue Wege. Er sucht Unterstützung bei der bekannten Lokalreporterin Shannon Strange. Die wittert die Story ihres Lebens. Ihre Recherchen führen sie auf die Spur von Muronys Ex-Geliebter.
Je tiefer Shannon in Andrés Vergangenheit wühlt, desto enger zieht sich die Schlinge um den Boss zu. Und der spürt nicht mal, wie nah er am Abgrund steht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kalte Gefühle - Gegenspieler
Thriller
Von Kim Rylee
An der Berner Au 45 b
22159 Hamburg
Kalte Gefühle - Gegenspieler
Thriller
Von Kim Rylee
An der Berner Au 45 b
22159 Hamburg
1 Täter oder Opfer?
Hatte er gezögert?
Es dauerte nur ein Wimpernschlag, bis das Gehirn den Befehl weiterleitete. Sein Finger gehorchte dem Impuls. Er spürte den Druck. Kurz darauf folgte das leichte Nachgeben. Der kalte Stahl des Abzugshahns presste sich in die Fingerkuppe.
Dann ... dieses Gefühl ... als würde sein Zeigefinger einen Krampf bekommen, verunsicherte ihn kurz.
Das alles spielte sich so schnell ab, dass er nicht wusste, ob es der Wirklichkeit entsprach. Trotz eines minimalen Widerstands, der sich zwischen Impulsgeber und Zeigefinger abspielte, gewann der Verstand. Die Stromwellen des Cerebrums hatten sich längst ihren Weg gebahnt. Er drückte ab.
Der Schuss erfüllte den Raum, klang wie das Brüllen eines verletzten Löwen. Oder war er derjenige, der gebrüllt hat? Er wusste es schlichtweg nicht. Alles ging so schnell.
Kaum war der Hall verklungen, umschlang ihn eine unsichtbare Hülle. Das Herz in seiner Brust zog sich schmerzhaft zusammen. Kein klarer Gedanke wollte sich formen, keine Gefühlsregung kam zum Vorschein.
Nur Kälte.
Die Art von Kälte, die einen Menschen umfing, wenn er spürte, wie das Blut langsam aus dem Kopf in Richtung Boden sackte. Ungnädige Kälte, die sich in schwarze Ohnmacht verwandelte, wenn er nichts dagegen unternahm. Doch konnte er dem Abgrund entkommen, der sich unmittelbar vor ihm auftat und ihn verschlingen wollte?
Zum ersten Mal in seinem Leben kamen Zweifel auf.
Schlagartig wurde ihm bewusst: Er hatte gezögert.
»André?«
In weiter Ferne vernahm er eine bekannte Stimme.
Sie klang gedämpft, als müssten die Worte sich durch eine bleierne Mauer kämpfen.
Kein Laut wollte seinen Mund verlassen, der fassungslos offen stand. Eine Leere begann, sich in seinem Kopf breitzumachen. Sie fühlte sich wie ein Vakuum an, wie er es noch nie zuvor gespürt hatte. Etwas schien seine Gedanken, seine Gefühle, sogar sein gesamtes Leben förmlich aus ihm herausgesaugt zu haben wie ein riesiger Industriestaubsauger auf maximaler Stufe, dem nicht das kleinste Staubkorn entkommen konnte.
Er schloss die Augen, doch die Dunkelheit hatte ihn bereits eingeholt, sodass er keinen Unterschied mehr bemerkte.
»Es ist vorbei, André.«
2 Bargeflüster
Die Luft war stickig und abgestanden, während der Geruch von Schweiß sich mit dem vom alten Bratfett vermischte. Die guten Zeiten hatte das Mobiliar lange hinter sich gelassen. Das schummrige Licht trug nicht dazu bei, dass die Gesichter der Anwesenden freundlicher wirkten. Knarzend öffnete sich die Tür, dennoch wurde es in der Bar nicht wirklich heller. Drei Männer in ölverschmierten Latzhosen und durchgeschwitzten Muskel-Shirts traten ein, bogen nach rechts und setzten sich an einen der zwei freien runden Tische. Einer von ihnen hob die Hand und signalisierte dem Barkeeper mit seinen Fingern, ihm drei Bier zu bringen. Der Barkeeper nickte, dann machte er die Bestellung fertig.
Ins ›Last Chance‹, einer Kneipe mit billigen Drinks in Hunters Point kamen nur Männer, die wussten, dass sich hier eine Gaststätte befand. Weder ein Schild noch ein aufgemalter Name an der gelben Fassade luden Besucher ein. Der rechteckige Kasten wirkte wie ein zu großer Mauerstein mit winzigen Wohnungen, die man einfach in einer Reihe auf das Flachdach gesetzt hatte. Er passte nicht in diese Straße, in dessen Nachbarschaft sonst heruntergekommene Familienhäuser standen, die einem kleineren Sturm nichts entgegenzusetzen hatten. Den brüchigen Straßenbelag durchzogen tiefe Risse. Als Zugabe machten Schlaglöcher von der Größe einer Kinderbadewanne das Autofahren zu einer Herausforderung.
Die Kundschaft bestand hauptsächlich aus Hafen- und Bauarbeitern, die hier mittags eine schnelle Mahlzeit einnahmen und später ihr Abendbier tranken, bevor sie sich auf den Weg zurück zu ihren Familien machten. Viele von ihnen sträubten sich, nach Hause zu gehen, wo sie eine mürrische Ehefrau und kreischende Kinder erwarteten. Es war an der Tagesordnung, dass der eine oder andere hier einen über den Durst kippte.
Joe Driscoll und sein zwei Jahre älterer Bruder Hank saßen am Tresen. Ihnen schräg gegenüber ein alter Fernseher, der knapp unter der niedrigen Decke verankert war.
»Schau mal, Hank! Diese Shannon sieht ganz schnuckelig aus. Findest du nicht auch?« Joe nahm sein halb leeres Glas mit Bier und führte es zum Mund.
»Die würde dich noch nicht mal mit ihren Allerwertesten ansehen, Joe«, konterte Hank, während er an seinem Glas nippte. Das Bier war in der Zwischenzeit warm und schal geworden, sodass er das Glas abstellte und wegschob.
»Ach, Blödsinn«, herrschte er Hank an. »Der Kleinen würde ich zu gern den Hintern versohlen. Und glaube mir, es würde ihr gefallen.« Joe grinste anzüglich. »Das sehe ich ihr an.«
»Das zarte Persönchen?« Hank schüttelte nur den Kopf. »Du spinnst doch.« Er hatte jetzt nicht die Muße, mit Joe über Sex zu reden. Die Spielchen seines Bruders hinterließen oftmals Spuren bei den Mädchen, sofern sich eine von ihnen auf das Wagnis einließ. Hank stand eher auf die Missionarsstellung. Alles andere fand er nur widerwärtig.
»Glaub mir, wenn ich dir sage, dass gerade diese Frauen auf feurige Hengste wie mich stehen.« Der Jüngere prahlte mal wieder. Er zog eine Miene, während er das Glas leerte.
Hank schnaubte nur und starrte weiter vor sich her, als unvermittelt ein Schlag gegen den Oberarm seine Aufmerksamkeit verlangte.
»Was ist, Joe?« Er rollte mit den Augen und ignorierte den Hieb, als hätte Joe ihn nur sanft berührt.
Joe starrte auf den Fernseher, während seine langen, schmalgliedrigen Finger noch immer versuchten, Hanks Oberarm zu umfassen.
»Hey, Luke! Mach mal die Kiste etwas lauter!«, rief er dem schlaksig wirkenden Barkeeper mit den wachen Augen zu. Im selben Moment löste er die Hand. Sein Finger zeigte in Richtung des Fernsehers. Hanks Blick folgte dem Finger, während sich sein massiger Oberkörper mit einem Ruck gerade aufsetzte.
Luke stellte ein halb voll gezapftes Glas neben sich auf die Anrichte. »Habt ihr das etwa noch nicht mitbekommen? Ist doch seit einigen Tagen in den Nachrichten.«
»Mach endlich lauter«, fiel ihm Hank ins Wort. »Wir haben keine Glotze zu Hause.«
Der Barkeeper trocknete sich die Hände an einem zerrissenen Geschirrtuch ab, während er zum Gerät ging und die Lautstärke ein wenig erhöhte. Gerade noch rechtzeitig bekam auch Joe mit, welche Frage die Reporterin dem Verletzten stellte, bevor sie von der Polizei weggeschickt wurde.
Joe stieß einen Pfiff aus. »Für mich sieht es aus, als ob auf André Murony ein Attentat verübt wurde. Eigentlich hätten die Zeitungen voll davon sein müssen.« Leichte Falten legten sich auf seine Stirn, die sich mit Schweiß füllten. »Meinst du, unser Goldfisch hatte damit etwas zu tun?« Mit dem Handrücken wischte er sich die Stirn trocken.
»Unser Goldfisch im Haifischbecken?« Hank straffte den Schultergürtel. »Ich dachte, sie hätte was mit ihm? Außerdem ist sie zu schlau dafür. Warum sollte sie ihm ...« Weiter kam er nicht, da Joe ihn unterbrach.
»Eben. Sie ist schlau. Und was siehst du in der Glotze, Hank?«
Hank verstand nicht, worauf sein Bruder hinauswollte.
Joe seufzte. »Na, sieh dir diesen Murony an. Wie er gekleidet ist. Bestimmt wollte er unseren Goldfisch ausführen. Aber wo ist sie?« Ein verschwörerischer Blick schlich über Joes Miene. »Ich kann sie nirgends entdecken.«
Hank schüttelte den Kopf. »Wenn sie das getan hat ...« Seine Augen begannen zu leuchten. Ein Geistesblitz. »Wer hätte denn einen Killer auf Murony ansetzen wollen? Unser Goldfisch handelt nur nach Auftrag. Kennst du überhaupt jemanden, der den Mut dazu gehabt hätte, ein Attentat auf André Murony zu verüben?«
Joe wollte gerade einen kräftigen Schluck aus seinem Glas nehmen, als er sich daran erinnerte, dass er es zuvor ausgetrunken hatte. »Vermutlich hast du recht.« In seiner Hand drehte er das leere Glas. »Ich wüsste auch niemanden, der ...«
»Siehste«, fiel Hank ihm pampig ins Wort.
»Doch ich weiß …« Joe widerstrebte es, zuzugeben, dass er sich im Unrecht befand. »… dass sich jemand an seinen Lieferungen zu schaffen gemacht hat. Vielleicht ist gerade eine neue Gang dabei, ihm das Territorium streitig zu machen.«
Hank schüttelte leicht den Kopf. »Einen von den Typen haben sie erwischt. Ich denke nicht, dass der sich noch traut, geschweige denn lebt. Und das da ...« Hank nahm das Glas und richtete es auf den Fernseher, als würde er den Darstellern zuprosten. »Das war eine Explosion. Wohl eine defekte Gasleitung. Soll ja vorkommen.«
Mit dem Finger deutete Joe in das leere Glas.
Luke sah es, nickte und holte eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank unter der Theke hervor.
»Aber wo ist dann der Goldfisch?« Joe bohrte weiter. »Der Hai ist dafür bekannt, dass er seine Mädels nicht von der Angel lässt.«
»Hm«, brummte Hank. Darauf wusste er keine Antwort und zuckte nur mit den Achseln. »Unser Goldfisch scheut ja eher die Öffentlichkeit. Außerdem lässt sie sich nur schwer einfangen. Selbst ein Murony wird Schwierigkeiten haben, sie im Zaum zu halten.«
Luke hatte gerade die Flasche geöffnet; Hank nahm sie ihm ab und füllte das Glas selbst.
»Kannst du dich noch an die letzte Freundin von Murony erinnern?« Joe sah seinen Kumpel an.
»Die Mädchen davor? Das waren doch alles keine richtigen Weiber«, entgegnete der Koloss.
Nun verstand Joe gar nichts mehr, was sich in seinem Gesicht widerspiegelte.
»Na, das waren doch alles nur Betthäschen. Goldfisch ist der Tancho Koi unter den Frauen. Sie hat Klasse«, schwärmte Hank. Er wartete, doch Joe öffnete nur leicht den Mund und starrte ihn weiterhin an.
Noch so’n dämlicher Vergleich, und ich ersaufe dich persönlich in deinem Fischtümpel, dachte der jüngere Bruder. Joe teilte Hanks Liebe zu den teuren Karpfen nicht.
Mit einem Knall sprang die vergitterte Eingangstür auf. Das Gemurmel in der Bar verstummte. Die Köpfe der Gäste schnellten in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Wie üblich gab es keinen Luftaustausch. Die Ausdünstungen schienen so dick und schwer zu sein, dass dünne, frischere Luft keine Chance hatte, in die dunkle Bar einzusickern.
Die Silhouetten von vier Männern in den Zwanzigern erschienen im Türrahmen. Sie hatten bereits einiges getrunken. Lautstark traten sie in den mit dunklem Holz ausgestatteten Raum.
Gemurmel setzte ein und die Anwesenden widmeten sich wieder ihren eigenen Angelegenheiten, ohne die Neuankömmlinge noch eines Blickes zu würdigen.
»Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde«, dachte Hank laut, während ihm kurz ein Anflug von Mitleid überfiel, als sein Blick für ein paar Sekunden auf einem der jungen Männer haften blieb. Schließlich wandte er sich wieder seinem Bier zu.
Es war offensichtlich, dass einer von ihnen kurz davor stand, in den Hafen der Ehe zu segeln. Der Junggesellenabschied wurde nach amerikanischer Sitte angegangen. Die vier Männer, die augenscheinlich allesamt gut befreundet waren, hatten den Bachelor in ein plüschiges Elefantenkostüm gesteckt. Mit seinem Leibesumfang füllte er das Kostüm komplett aus, an einigen Stellen spannte es sogar. Die rosa Kapuze hatte er zurückgestreift, sodass der Plüschrüssel unanständig an seinem breiten Hintern herunterhing. Er sah lächerlich aus. Zudem schwitzte er stark. In seinem hochroten Gesicht klebten die halb langen Haare klitschnass an der Stirn. Keiner seiner Freunde erbarmte sich, ihn aus dem Kostüm zu befreien.
Die Gruppe fand einen leeren Tisch und setzte sich grölend daran.
»Tequila! Und stell gleich die ganze Flasche auf den Tisch«, lallte der Kleinste aus der Männergruppe. Er war so unscheinbar wie eine Grille im Gras. Man hörte ihn, sah ihn aber nicht.
Luke nickte und kümmerte sich umgehend um die neuen Gäste.
Nach einer Pause nahm Hank das Thema wieder auf. »Goldfisch springt nicht, wenn man ihr befiehlt, zu springen. Kapierst du?« Obwohl Hank keine große Leuchte war, hatte er das Gefühl, zu einem kleinen Kind zu reden.
»Kann sein. Doch auch ein André Murony lässt sich nicht die Fäden aus der Hand nehmen.«
»Dann gibt es zwischen den beiden wohl eine Pattsituation.« Hank grinste.
»Wo hast du denn dieses schlaue Wort her?«, neckte Joe seinen Bruder, der verzog beleidigt den Mund. »Schon gut, Hank. War nicht so gemeint.« Joes Entschuldigung klang aufrichtig.
»Auf jeden Fall zahlt unser Goldfisch immer anständig«, nuschelte Hank. »Und ihre Aufträge sind nie von schlechten Eltern.« Trotz des schummrigen Lichts fiel ihm an Joe eine Veränderung auf. »Was ist los?«
Hank entdeckte den Ausdruck des plötzlichen Allwissens in Joes Miene.
Der Bruder klatschte sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Der Schlüssel!«
»Welcher Schlüssel?« Hank konnte dem plötzlichen Sinneswandel nicht folgen.
»Der, den ich für unseren Goldfisch angefertigt hatte. Hank. Ich glaube, ich weiß, wofür der ist.«
»Ach ja?« Hank führte das Glas an seinen Mund. »Wofür?«
»Das Apartmenthaus, das gerade renoviert wird. Dort wurden die Schlösser ausgetauscht, wegen der Zwischenfälle. Ein Kumpel, der den Auftrag erteilt bekam, hatte mir davon erzählt.«
»Und nun glaubst du, Goldfisch will sich dort ein Apartment zulegen?« Er hob überrascht die Augenbrauen.
»Red keinen Blödsinn! Aber vom Dach aus kann man einige Ziele gut anvisieren.« Er schaute verschwörerisch. »Verstehst du?«
»Und wer soll das Opfer sein?«
Joe zuckte mit den Schultern. »Hm. Mal überlegen …« Sein Blick wanderte wieder zum Fernseher. Er sah, dass die Linse der Kamera noch immer André Murony einfing.
Der Kameramann zoomte heran, sodass der Restaurantbesitzer gut zu erkennen war. Er zog gerade sein Handy aus der Tasche. Nachdem er das Gespräch entgegengenommen hatte, entglitten André Murony alle Gesichtszüge und seine freie Hand ballte sich zu einer Faust.
Joe und Hank tauschten einen kurzen Blick aus.
Langsam drehten sie die Köpfe und starrten zum Fernseher.
3 Zeit der Wehmut
Ruckartig schoss er hoch.
Die Hand griff zur schweißnassen Brust. Sein Atem ging heftig.
»Licht!«, rief André in das schwarze Nichts.
Sofort umgab ihn eine warme Atmosphäre. André schob die leichte Bettdecke zur Seite, während er die Beine über die Bettkante hob. So verharrte er einige Minuten. Dabei versuchten die Zehen, die Fasern des weichen Teppichs zu greifen. Ein Ritual, das er in den letzten Wochen des Öfteren praktizierte. Es hatte eine beruhigende Wirkung auf ihn. Hoffte er.
»Ausatmen. Einatmen. Ausatmen.«
Nachdem sein Puls wieder den Normalzustand erreicht hatte, schlüpfte er in den teuren Bademantel und ging ins Wohnzimmer. Sein Blick fiel auf die Uhr an der Wand.
»Zwanzig nach neun.«
Durch das riesige Fenster schien die Sonne. Alles deutete darauf hin, dass heute ein schöner Tag werden würde.
Auf dem Glastisch standen die angebrochene Flasche und ein Glas vom Vorabend. Gerade schenkte er sich einen Drink ein, als sich die Tür öffnete.
»Ein wenig früh für einen Whiskey. Meinst du nicht auch?«
»Was spricht dagegen?« André wandte sich langsam um, »wenn ich die Lebensgeister zum Frühstück erwachen lasse?«, entgegnete der Boss verbissen.
Da war sie wieder. Diese Zerrissenheit in Andrés Miene. Lorenzo schloss die Tür hinter sich. Wieder mal sorgte er sich um den Freund.
»Wieder ein Albtraum?«
Mit einer Geste bot André dem Freund ebenfalls ein Glas an.
»Bedauerlicherweise löst es nicht das Problem«, schlug der Leibwächter die Einladung aus. »Aber Reden. Erzähl mir von deinen Albträumen.«
»Es ist nur ein Traum.« André holte tief Luft. »Doch der verfolgt mich seit ...« Kurz überlegte der Boss. Dann nahm er noch einen Schluck, starrte das leere Glas an, und entschied, diesmal nicht nachzuschenken. Stattdessen stellte er das Glas auf dem Tisch ab, während er ins Sofa sank. Dessen Leder knarzte, als er sich vorbeugte, um die Unterarme auf den nackten Oberschenkeln aufzustützen, und die Hände faltete.
Während Lorenzo es sich auf dem Sessel bequem machte, begann André leise zu erzählen.
»Ich starre auf den leblosen Körper, der vor mir auf dem Boden liegt. Seine Körperhaltung gleicht der einer toten, steif gewordenen Schlange. Ein roter Heiligenschein umrahmt den Kopf.« Kurz presste er die Lippen aufeinander, dann fuhr er fort. »Es übt fast schon eine perfide Faszination auf mich aus.«
Aufmerksam beobachtete Lorenzo seinen Boss, der zugleich sein bester Freund ist. Er kannte ihn nur zu gut. In diesem Moment wäre André zu allem fähig gewesen. Er hatte etwas Unglaubliches getan. Er hatte getötet. Zwar nicht zum ersten Mal, denn André Murony scheute sich nicht, die Drecksarbeit selbst zu erledigen.
Schon in jungen Jahren, als er noch bei seiner Familie in Italien lebte, genoss er einen gewissen Ruf. Er hatte bereits Dutzende Male seinen Widersachern die Lebenslichter ausgeblasen. Doch das hier war etwas anderes. Ein Zustand, den der Leibwächter nur schwer einschätzen konnte.
Lorenzo verstand nicht, weshalb sein bester Freund tiefste Zuneigung gegenüber dieser Frau empfunden hatte, die seinen besten Freund nur benutzte. Ihn ungeniert ausspionierte, und geduldig auf die Gelegenheit wartete, ihren Auftrag auszuführen. Fast wäre es ihr gelungen.
»Mein Stern«, hauchte André, während Lorenzo Zweifel in sich aufsteigen spürte. Die Art und Weise, wie André sich gerade verhielt, war untypisch für den mächtigsten Drogendealer der Westküste.
»Was dagegen, wenn ich mir nun doch einen Drink genehmige?«
»Bedien dich!« Seine Stimme klang hohl. Fast schon leblos.
Für André war diese Frau etwas Besonderes. Mit ihr war er nie so hart umgesprungen wie mit den anderen Mädchen, die er einfach wegwarf, sobald er die Lust an ihnen verlor. Im wahrsten Sinne des Wortes. Viktoria Stern war mehr. Sehr viel mehr als nur ein kurzes Intermezzo. Sie hatte ihn daran erinnert, was es bedeutet, ein Mann zu sein, der seine Eroberung feiern und genießen konnte.
»Es sind bereits zehn Wochen«, begann Lorenzo, während er zur Wand ging, um an der Vorrichtung nach dem Diener zu rufen.
Wenig später betrat der Diener das Wohnzimmer.
»Ein Tonic Water, Silvio.«
Der stumme Diener verschwand.
»Für mich ist es, als wäre es erst gestern gewesen. Dieser Traum katapultiert mich immer wieder zurück zu diesem Moment.«
Silvio kehrte mit einem Tablett zurück. Auf ihm eine kleine Flasche Tonic Water, ein Glas mit Eiswürfeln und ein Flaschenöffner. Er stellte das Tablett auf dem Glastisch ab und verschwand.
Ein Zischen ertönte, als Lorenzo den Kronkorken mit dem Öffner entfernte.
Kaum merklich schüttelte André den Kopf.
»Viktoria war etwas ganz Besonderes. Eine Herausforderung. Ein Mysterium, das es zu lösen galt.«
»Wohl eher ein unlösbares Rätsel«, bemerkte der Leibwächter fast nebenbei. Doch der Boss hatte es mitbekommen.
»Was meinst du damit?«
»Ihre äußerlich unterkühlt wirkende Art stand in keinem Einklang zu ihrer Sinnlichkeit, wie du mir immer wieder versucht hast, weiszumachen.«
»Mein guter Freund. Ich weiß, dass du keine große Meinung von ihr hattest. Viktoria ließ sich nichts vorschreiben. Doch ich versichere dir, dieser Vamp appellierte an den Jagdinstinkt im Mann. Nicht nur bei mir. Sie gab sich allen Männern gegenüber immer reserviert. Kontrolliert. Genau damit reizte sie mich. Nur mit größter Mühe konnte ich mich in ihrer Gegenwart beherrschen.«
André wahrte keine Geheimnisse vor seinem Leibwächter. Der Mafiaboss vertraute Lorenzo alles an. Das Vergnügen, im Bett mit ihr um die Herrschaft zu ringen. Meistens gewann er. Zumindest gab Viktoria ihm das Gefühl, als Sieger hervorzugehen.
»Ich hatte sehr gehofft, dieses Wunder eines Tages zu besitzen.« Seine Faust landete lautstark auf dem Tisch und verharrte dort. Die leere Flasche hüpfte, fiel um und zersprang. »Jemand hat mich dieser Chance beraubt!« Erneut schlug die Hand auf die Glasplatte. André bemerkte nicht, dass eine Scherbe in seiner Hand steckte.
»Viktoria komplett für mich zu gewinnen, ihre Schale zu knacken, damit ich ihrer Einzigartigkeit auf den Grund gehen kann.« Die Faust geballt, sodass seine Fingerknöchel unter der gebräunten Haut weiß zu leuchten begannen, schoss André hoch. Blut tropfte auf den weißen Teppich. Mit geschlossenen Augen stand er einfach nur da. Schwer atmend, als würde ein Zentner Blei auf seiner Brust liegen.
Erneut öffnete sich die Tür. Silvio trat ein. Als der Diener das Blut an der Hand entdeckte, verschwand er zügig.
»Wir werden ihren Auftraggeber suchen«, bemerkte Lorenzo gelassen. »Und wenn wir ihn gefunden haben ...«
»... dann gnade ihm Gott!«, beendete der Boss den Satz.
André wusste, entgegen seinen Prinzipien hatte er vorschnell gehandelt. Selbst mit nur wenigen Zahlen einer Telefonnummer wäre sein Team in der Lage gewesen, seinen Widersacher ausfindig zu machen. Es war dumm, sie umzubringen. Viktoria kannte ihren Auftraggeber. Doch er wusste, dass sie ihm nichts verraten hätte. Es stand in ihren Augen geschrieben. Viktoria zu foltern, war keine Option. Sie war ein Profi, und das respektierte er. Dennoch durchbohrte ihn die Enttäuschung wie ein Dolch. Außerdem war der Boss wütend darüber, dass ihn jemand benutzt hatte. Und er hatte es nicht bemerkt. Viktoria war verdammt gut in ihrem Job gewesen. Hat ihn immer in Sicherheit gewogen. Nie gab es einen Hinweis, dass sie etwas im Schilde führte, ja, dass sie sogar seinen Tod beabsichtigte.
Der Drogenboss seufzte. Viktoria an seiner Seite … das käme einem Sechser im Lotto samt Zusatzzahl gleich. Dabei machte es keinen Unterschied, ob als Geliebte oder auch als Geschäftspartnerin. Gemeinsam hätten sie seine Macht festigen und ausweiten können. Wenn er nur zuvor von der Intrige gewusst hätte. Er war überzeugt davon, dass er sie auf seine Seite hätte ziehen können. Seine Gedanken reisten zurück, während er zum riesigen Fenster ging.
Er verharrte an der Stelle, an der Viktoria stand, als er sie zum ersten Mal zu sich mit nach Hause genommen hatte. Ein Luftzug im Nacken ließ ihn erschaudern. Kurz hoffte er, dass Viktoria hinter ihm stehen würde. Er hatte das Bild ganz klar vor Augen. Wie sich ihr schlanker Körper im Fenster spiegelte, während sie fasziniert auf das sich unter ihr ergießende Lichtermeer schaute. Jetzt hatte alles Licht seinen Glanz verloren. Trotz der Helligkeit umspülte Dunkelheit sein Herz.
Das Leder gab sein typisches Geräusch von sich, als Lorenzo sich zurücklehnte.
Silvio trat ein und reichte André ein feuchtes Handtuch.
Der Drogenbaron nahm es und wischte sich das Blut von den Händen. Danach verband Silvio die Wunde. Mit dem blutverschmierten Tuch verschwand der Diener wieder.
»Was machen wir, Lorenzo?« Seine heisere Stimme durchbrach endlich das Schweigen.
»Du willst ihren Auftraggeber …« Lorenzo sprach Andrés Gedanken aus.
André nickte, während seine Miene sich zusehends verfinsterte. Wie Atome im Teilchenbeschleuniger rasten die Gedanken in seinem Kopf.
»Glaub mir, Lorenzo, wir hätten Viktoria zerlegen können. Sie hätte nie ihren Auftraggeber verraten.« Andächtig schaute der Drogenbaron aus dem Fenster. »Und ich hätte es nicht geduldet, dass jemand anderes sie ...«, flüsterte er, ohne den Gedanken auszusprechen.
»In Ordnung«, warf der Leibwächter ein. Er wollte den Freund nicht weiterhin unnötig in Griesgram versinken lassen. »Uns fehlen noch die vier Jahre. Wenn wir wissen, was Viktoria in der Zeit gemacht hatte« ... Lorenzo überlegte laut. »... vor allem, wo sie sich aufgehalten hatte, dann wären wir ein ganzes Stück weiter«.
»Und wo sollen wir ansetzen?«
Der Leibwächter nippte an seinem Glas, bevor er antwortete.
»Sie hat auf dich geschossen. Das Kaliber und die Waffe ...« Er überlegte kurz. »Ich kenne nicht viele Händler, die diese Munition führen. Mal sehen, was wir herausfinden können.«
»Du weißt, wo du suchen musst?«
Lorenzo lächelte schmal. »Mir ist nur eine Person bekannt, die dieses Kaliber problemlos auftreiben kann«, entgegnete er selbstsicher, als hätte er gerade einen Trumpf ausgespielt.
»An wen denkst du? François?«
Lorenzo schüttelte den Kopf. »Nur eine Vermutung. Viktoria und du ... nun ... ihr wart nicht lange zusammen. Viel Zeit hatte sie nicht. Anfangs dachte ich zwar an François ... doch der ist schon vor einem Jahr nach Frankreich zurückgegangen. Mir kommt da jemand in den Sinn, der viel näher ist.«
»Du hast meine volle Unterstützung. Egal, was dir vorschwebt.« Andrés Entschlossenheit kehrte zurück.
Zufrieden beobachtete Lorenzo seinen Freund, der wieder zur gewohnten Form auflief.
4 Helfe ich dir, hilfst du mir
Sie hatte Schwierigkeiten sich zu artikulieren, verschluckte beim Sprechen einige Silben, doch Doktor Darka verstand sie.
In den vielen Jahren hatte er gelernt, die Sprache der Schluchzer und dicken Tränen zu decodieren. Er hatte ihren Code geknackt, war ein Experte in deren Übersetzung geworden. Es waren fast immer dieselben Laute, die aus den Mündern gespült wurden.
»Samantha. Ich bitte Sie inständig, gehen Sie zur Polizei.« Doktor Darka bemühte sich, die Patientin nicht zu sehr zu drängen. »Dieser Kerl darf nicht seiner gerechten Strafe entgehen.«
Die dürre Frau saß zusammengefaltet auf dem Sofa. Ihr nach vorn gebeugter Oberkörper zitterte, während sie das Gesicht in den Handflächen vergrub. Dabei brachen unentwegt Schluchzer aus ihr heraus.
»Sie ... wollen ... mich ... nicht ... verstehen«, stammelte sie in ihre Handflächen, ohne dabei den Kopf zu heben.
Doktor Darka wurde das Herz schwer.
Sam trug ein Top mit Spaghetti-Trägern. Sie litt nicht nur unter psychischen Narben. Auch physisch litt Sam. Ihr Körper erzählte Geschichten. Einige der Narben zwischen den Schulterblättern waren älter, andere wiesen noch eine leicht rötliche Färbung auf.
Langsam erhob er sich aus seinem Sessel und schob die Box mit den Papiertüchern zu ihr herüber. Sie bemerkte es nicht einmal. Zu sehr war sie in ihrer Welt gefangen. Eine Welt voller Tränen, Verzweiflung und Angst. Angst davor, dass André sie finden und umbringen würde.
In ihrem jungen Leben hatte Sam bereits Schlimmes gesehen und erdulden müssen.
Mit dreizehn brach sie die Schule ab. Sie bereute es nicht, dass sie von Geschäften nichts verstand. Männer waren dazu auserkoren, den Chefsessel zu besetzen. Es hieß nicht umsonst Chef-Etage statt Chefin-Etage. Während ihrer Kindheit wurde es ihr immer wieder eingebläut. Oftmals unter schmerzhaften Lektionen, wenn ihr Vater sie mal wieder windelweich schlug, sobald der billige Schnaps zur Neige ging. Ihre Mutter arbeitete als Putze in Doppelschichten, sodass ihr keine Zeit blieb, sich um Sam und ihre jüngere Schwester Doreen zu kümmern. Irgendwann reichte es. Heimlich packte Samantha ihre paar Habseligkeiten in einen Stoffbeutel und verschwand.
An der Westküste hoffte sie auf ein besseres Leben. Doch Happy Ends gab es nur in Hollywoodfilmen. Das Leben abseits der Filmkulissen gestaltete sich gänzlich anders. Für Verliererinnen wie Samantha existierte kein Plan B.
Bereits beim ersten Treffen mit André Murony bewunderte sie seine Stärke. Bei ihm fühlte sie sich geborgen. Sicher. Nichts ahnend, wer der charismatische Vierziger wirklich war. Und welchen Geschäften er nachging.
Es machte ihr nichts aus, wenn ihm mal die Hand ausrutschte. Nicht anders verhielt es sich in ihrem Job. Starke Männer schlugen nun einmal Frauen. Schließlich hatten sie allen Grund dazu. Samantha kannte es nicht anders.
Nicht selten kam André erst spät nach Hause. Er war ein vielbeschäftigter Mann. Hatte immer mehrere Deals parallel laufen, wie er ihr erzählte. Nach dem Abendessen hatten sie Sex. Samantha kannte die Vorlieben der Männer zur Genüge, auch wenn es ihr nur wenig Spaß bereitete. Mitunter verpasste er ihr eine Ohrfeige, wenn sie es ihm nicht richtig besorgte. Sam wusste, die Ursache seiner üblen Laune lag begründet in den Geschäften. Er arbeitete hart, um sich diesen Lebensstil zu ermöglichen. Zumindest bildete sie es sich ein. Sie wähnte sich als Glückspilz, dass ein Mann wie André Murony, gebildet, reich und gut aussehend, sie als seine Freundin ausgesucht hatte. Davon hätte sie nie zu träumen gewagt.
Der Abend, an dem sie André in seinem Büro überraschen wollte, änderte alles.
André hatte tagsüber wieder einmal viel zu tun. Wichtige Dinge, die keinen Aufschub duldeten, wie er ihr beim Frühstück erklärte, ohne ins Detail zu gehen.
An diesem besonderen Abend – sie waren auf den Tag genau zwei Monate zusammen - wollte sie André überraschen. Nur für ihn hübschte sie sich auf, hatte eine Kosmetikerin aufgesucht, die sie schminkte, betrat ein Dessous-Geschäft, um dort ein verführerisches Negligé zu kaufen, das sie extra für diesen besonderen Abend anzog. Sie schlüpfte in die Rolle der ›frivolen Geliebten‹. Rollenspiele lagen ihr zwar weniger, doch Sam wollte André damit eine Freude bereiten.
An jenem Abend kam er viel später als erwartet nach Hause. Sam übte sich in Geduld. In seinem ›Heiligtum‹, wie André sein Büro nannte, schaute sie sich um, ohne jedoch etwas anzufassen. Sie wartete bereits zwei Stunden, dann betrat André das Zimmer. Im Schlepptau wie gewohnt: Lorenzo.
Die beiden Männer verbrachten so viel Zeit miteinander, dass man sie für Zwillinge halten konnte.
Mit Andrés Reaktion hatte sie nicht gerechnet. »Du blöde Schlampe!«, schrie er sie mit hochrotem Kopf an. »Was hast du daran nicht kapiert? In diesem Raum sind Weiber nicht geduldet!« Er packte ihre Haare und zerrte sie vom Schreibtisch herunter. Sam schrie auf. Eher vor Angst als vor Schmerz.
»Das hatte ich dir beim Einzug klargemacht! Was muss ich noch machen, damit das endlich in dein unterbelichtetes Hirn geht?«
Während dieser Standpauke schlug er unkontrolliert auf sie ein, bis sie nur noch auf dem Boden lag, die Oberschenkel fest gegen den Bauch gepresst und versuchte, mit den Händen ihren Kopf zu schützen. Doch André kannte kein Erbarmen. Mit wutverzerrter Miene zog er den Gürtel aus seiner Anzughose. Das Leder schnalzte, als es auf ihrem Körper traf, während Sam nur noch dalag: winselnd wie ein verhungernder Köter, der bestraft wurde, nur weil er um ein Stück vom Knochen gebettelt hatte.
Einzig Lorenzo konnte André davon abhalten, sie zu Tode zu prügeln. Ohne Umschweife brachte er Sam ins Krankenhaus und bläute ihr ein, wenn sie auspacken sollte, wäre es das Letzte, was sie in ihrem jämmerlichen Leben machen würde.
Samantha interpretierte diesen Satz so, dass es das Ende ihrer Beziehung zu André bedeutete. Sie liebte André, diesen erfolgreichen Mann, der wusste, was er wollte und es bekam. Ausnahmslos. Und vor allem liebte sie den Reichtum. Sam wollte nichts von dieser scheinbar schönen Welt verlieren, die ihr in den vergangenen Wochen viel mehr bot als ihr gesamtes vorheriges Leben.
Im Krankenhaus schwieg sie. Erst am frühen Morgen kehrte sie zum Anwesen zurück. Danach war nichts mehr wie zuvor.
Fast täglich fragte André sie, ob sie gefunden hätte, wonach sie im Büro gesucht hatte.
Unter Tränen der Verzweiflung versicherte sie ihm jedes Mal, dass sie ihm nur eine Freude bereiten wollte. Sie hatte nichts weiter gemacht, als sich auf den Schreibtisch zu setzen, um dort auf seine Rückkehr zu warten.