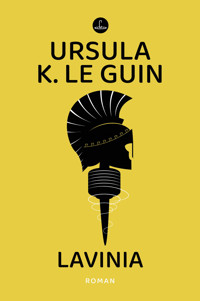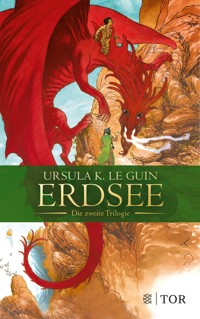Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Golkonda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Grande Dame der modernen Literatur philosophiert in Gedankensplittern über das Alter, Kunst, Kultur und Katzen – Ursula K. Le Guins letzten Gedanken. Im Januar 2018 verstarb Ursula K. Le Guin (1929 – 2018), eine der renommiertesten Autorinnen der angloamerikanischen Science Fiction, Verfechterin der Phantastik und starke Feministin. Über Jahrzehnte hat sie ihre Leser in phantastische Welten entführt. In ihren Essays erkundet sie hingegen recht realistische Aspekte des Lebens, die sie vor allem in den letzten Jahren immer wieder beschäftigen: das Altwerden, die Wahrnehmung der Literatur und der Rolle der Phantastik darin, ihr einzigartiger Kater Pard. Ihre scharfzüngige, kluge und besonnene Art über Alltägliches und Außergewöhnliches zu schreiben, öffnet einem selbst neue Perspektiven. Ein wunderbarer Rückblick auf das, was Ursula K. Le Guin in den letzten Jahren ihres Lebens tief bewegt hat. Mit einem Vorwort von Karen Nölle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
No Time to Spare: Thinking about What Matters
im Oktober 2017 bei Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, New York, USA.
© 2017 by Ursula K. Le Guin
Copyright für die deutsche Erstausgabe
© 2018 by Golkonda Verlags GmbH & Co. KG, München • Berlin
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.
Lektorat: Hannes Riffel
Korrektorat: Catherine Beck, Robert Schekulin
Gestaltung: s.BENeš [www.benswerk.wordpress.com]
Illustration (S. 191): Ursula K. Le Guin
E-Book-Erstellung: Hardy Kettlitz
ISBN 978-3-946503-50-7 (Buch)
ISBN 978-3-946503-51-4 (E-Book)
www.golkonda-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für Produktsicherheit
Europa Verlage GmbH
Monika Roleff
Johannisplatz 15
81667 München
+49 89 18 94 733-0
INHALT
Impressum
Inhalt
Karen Nölle:ALT UND WEISE, WEIBLICH UND BÖSE – EIN VORWORT
Karen Joy Fowler:EINFÜHRUNG
Ursula K. Le Guin:EINE VORBEMERKUNG
TEIL 1: DIE ACHTZIG ÜBERSCHREITEN
IN IHRER FREIZEIT
DAS WEICHEI SCHLÄGT ZURÜCK
WAS FÄNGT MAN MIT DEM REST NUN AN?
AUFHOLEN, HA HA
DIE ANNALEN VON PARD 1
EINE KATZE AUSSUCHEN
VON EINER KATZE AUSGESUCHT
TEIL 2: DER LITERATURBETRIEB
HÖRT IHR BITTE VERDAMMT NOCH MAL AUF
LESERFRAGEN
BRIEFE VON KINDERN
ÜBER KUCHEN
PAPA H
EIN AUSGESPROCHEN NOTWENDIGER LITERATURPREIS
DER GROSSE AMERIKANISCHE ROMAN
NOCH MAL DER GROSSE AMERIKANISCHE ROMAN
NARRATIVE BEGABUNG ALS MORALISCHES DILEMMA
ES MUSS NICHT SO SEIN, WIE ES IST
UTOPIYIN, UTOPIYANG
DIE ANNALEN VON PARD 2
ZOFF MIT DEM KATER
PARD UND DIE ZEITMASCHINE
TEIL 3: VERSUCHE, ES ZU VERSTEHEN
EIN BUND VON BRÜDERN, EIN STROM VON SCHWESTERN
EXORZISTEN
UNIFORMEN
VERZWEIFELT AN EINER METAPHER FESTHALTEND
ALLES WEGLÜGEN
DAS INNERE KIND UND DER NACKTE POLITIKER
EIN BESCHEIDENER VORSCHLAG: VEGEMPATHIE
DER GLAUBE ANS GLAUBEN
ÜBER WUT
DIE ANNALEN VON PARD 3
NICHT AUSGELERNT
KNITTELVERSE FÜR MEINEN KATER
NICHT AUSGELERNT, DIE ZWEITE
TEIL 4: BELOHNUNGEN
DIE KREISENDEN STERNE, DAS UMFANGENDE MEER: PHILIP GLASS UND JOHN LUTHER ADAMS
THEATERPROBE
JEMAND NAMENS DELORES
OHNE EI
NÔTRE-DAME DE LA FAIM
DER BAUM
HOCH ZU DEN PFERDCHEN
ERSTKONTAKT
DER LUCHS
NOTIZEN AUS EINER WOCHE, DIE WIR AUF EINER RANCH IN DER HOCHWÜSTE VON OREGON VERBRACHTEN
Phantastik im Golkonda Verlag
Karen Nölle:ALT UND WEISE, WEIBLICH UND BÖSE – EIN VORWORT
Dieses Buch, das Sie in Händen halten, ist Ursula K. Le Guins letztes, noch gerade zu Lebzeiten herausgegeben. Es war erst kürzlich erschienen, als sie im Januar 2018 starb, 88 Jahre alt und noch stets bereit, Besuch zu empfangen und an Texten zu feilen, auch wenn sie schon seit Längerem sorgfältig mit ihren Kräften haushalten musste.
Keine Zeit verlieren war für sie ein ungewöhnliches Projekt, denn was sie bis dahin geschrieben hatte, waren Romane, Erzählungen, Essays und Gedichte, ausgeklügelt, tief empfunden und vielfach preisgekrönt, ein großes, an die fünfzig Bände umfassendes Werk. Nach der Veröffentlichung von Lavinia, ihrem letzten, 2008 erschienen Roman, entschied sie, sich nur noch kürzeren Formen zu widmen, und erklärte in Interviews, für große Entwürfe würden ihre Kraft und Ausdauer nicht mehr reichen. Ihr Kampfgeist und ihr schräger Sinn für Humor blieben jedoch lebendig bis zuletzt. Und das Schreiben gehörte einfach immer zum Leben. Sie brachte weiterhin regelmäßig Gedichte, Essaysammlungen, Geschichten heraus, und 2010 enthielt ein wunderschönes Buch über eine besonders geliebte Landschaft, das sie zusammen mit dem Fotografen Roger Dorband herausbrachte, sogar Skizzen von ihr.
Einer der großen Einflüsse in ihrem Leben war der Taoismus, dessen Lehren auch ihr Werk durchziehen. Das Tao Te King des legendären chinesischen Philosophen Laotse hat sie sich Wort für Wort erarbeitet, die vielen Übersetzungen ins Englische verglichen und 1997 in eigener Übersetzung herausgebracht. Über die Drachen in ihren Erdsee-Büchern hat sie einmal gesagt, sie seien selbstverständlich von den europäischen und den chinesischen Drachen mit ihren unterschiedlichen Eigenarten inspiriert, aber es seien amerikanische Drachen oder genauer Drachen der Westküste, geprägt von ihrer Zeit, ihren Erfahrungen und ihrem eigenen Wesen. Ähnlich verhält es sich mit dem Taoismus, sie hat ihn sich anverwandelt, und er nimmt in jedem Werk passend zu dem Stoff eine eigene Prägung an.
2010, mit 81, ging sie unter die Blogger. José Saramagos Blogs machten ihr Lust auf die Freiheit der spontanen Form und nahmen ihr die Vorstellung, dass sie, wenn sie sich im Internet äußerte, ständig mit ihren Leserinnen und Lesern in Dialog treten müsste. Dazu sei sie zu zurückhaltend, schrieb sie in der Notiz, die sie dem Blog vorausschickte und die nun am Beginn dieses Buches steht. Es versammelt ein knappes Drittel ihrer Einträge. Die übrigen, oft mehr durch politisches und anderes aktuelles Geschehen veranlasst, sind auf der Website der Autorin zu finden. Sie behandeln ganz unterschiedliche Themen, oft geht es um ihre eigenen Texte und die Werke anderer, oft auch um die Zustände in den USA und den Ländern des Nahen Ostens. Die politische Situation machte ihr Kummer. 2017 wurden die Einträge spärlicher.
Am 25. September des Jahres stellte sie ein Gedicht von 1991 ein, mit dem Titel »When the Soviet Union Was Disintegrating«. Es ist ihr letzter Eintrag, ein sehr persönliches Gedicht aus zwei Teilen. Im ersten geht es um den Versuch, sich etwas zu erschreiben, das Seele heißen könnte. Ihre Themen sind Mut, Güte, das Meer bei Abendlicht, das Lob der Schönheit und eine Ahnung davon, was von ihr bleiben könnte, wenn sie nicht mehr ist. Im zweiten Teil wendet sie sich der Tagespolitik zu, und Bitterkeit darüber, was sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Russland vollzieht, lässt sie deutlich werden, »… alt und weise, weiblich und böse«: Die Männer, die im Namen einer Sache siebzig Jahre lang Männer, Frauen und Kinder umgebracht, gefoltert, Lager errichtet, gelogen und Gewinne kassiert haben, nehmen sich neue Ziele vor, und wieder mit denselben Methoden. Siebzig Jahre umsonst. Weggeworfen der Traum von Gerechtigkeit, der dem Verrat vorausging. Das Einzige, was zählt, ist, wer das Sagen hat.
Die letzte Strophe bringt beide Teile zusammen. Sie, die einst »Freiheit, Freiheit« gesungen habe, schön wie eine Nachtigall, habe Realpolitik gelernt: In dieser Welt der Sagenhaber, wo es keine Freiheit gibt und die Sagenhaber nur von Stille umgeben sind, darf man nicht müde werden, in diese Stille hineinzuhorchen. »Und so werde ich Frauen, unseren Kindern und machtlosen Männern lauschen, meinen Leuten. Und ehren nur die Meinen, die Leute ohne Macht.«
Was 1991 auf die Zeit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs gemünzt war, passt 2017 auf die Vorgänge in den USA. Und die Art, wie in dem Gedicht das Persönliche und Politische mit essenziellen Gedanken über das Menschsein verknüpft werden, zeigt noch ein letztes Mal, wofür Le Guin mit ihrem Schreiben steht.
Alt und Weiblich. Seit einigen Jahrzehnten sind die Themen Alter und Weiblichkeit ein fester Bestandteil von Ursula K. Le Guins Werken. Das gilt auch für das vorliegende Buch. Dass sie so wichtig wurden, ist in ihrer Art zu denken begründet.
Wurde Ursula K. Le Guin gefragt, wann ihr klar geworden sei, dass sie Schriftstellerin werden wollte, antwortete sie stets, darüber habe sie nie nachgedacht, sie habe schlicht immer geschrieben. Die Berufsbezeichnung, der Status bedeuteten ihr nichts, es gehe ihr um die Sache. Als sie mit Anfang zwanzig begann, ans Veröffentlichen zu denken, gelang es ihr nur gelegentlich, kleinere Texte unterzubringen. Ihre Romane wurden abgelehnt. Zu eigen, hieß es, zu abseitig. Über den ersten bemerkte der Verleger Alfred Knopf in seinem Ablehnungsbrief, es sei ein seltsames Buch, aber was sie da mache, sei interessant. Vor zehn Jahren hätte er das verrückte Ding verlegt, aber jetzt (1953) könne er es nicht wagen. Le Guin fühlte sich dadurch ermuntert und produzierte mit Geduld und Leidenschaft – für die Schublade. Anfang der 1960er-Jahre riet ihr eine Freundin, sich in der Science Fiction umzuschauen. Dort fand sie Gedankenexperimente, denen sie sich verwandt fühlte, und sie beschloss, sich an dem Genre zu versuchen. Nun gelang der Durchbruch, und es folgte eine intensive Schaffensperiode. Von 1966 bis 1976 erschienen zehn Romane, zwei Erzählbände und zwei Gedichtbände, Ursula K. Le Guin erhielt für ihre Bücher dreizehn große Auszeichnungen und war plötzlich überall gefragt. Weltweit berühmt wurden vor allem die beiden Science-Fiction-Romane, Die linke Hand der Dunkelheit und Freie Geister, und die drei ersten Bücher ihrer Fantasyserie für junge Leser, Ein Magier von Erdsee, Die Gräber von Atuan und Das fernste Ufer.
Wer diese Werke liest, wird schwerlich darauf kommen, dass ihrem Gefühl für das, was Menschen ausmacht – denn darum geht es im Kern in allen ihren Werken – noch etwas fehlt. Sie umspielen die ganze Bandbreite menschlicher Möglichkeiten: Herz, Mut, Freude, Trauer, Achtung vor den Welten, in denen die Figuren leben, mit allen Tieren, Pflanzen, Meeren, Landschaften – die vielen Möglichkeiten des Missbrauchs von Macht und Herrschaft, das Zusammenspiel von Innenleben und Außenwelt. Die Abenteuer, in die man gerät, indem man ihren Figuren folgt, vereinen Verstand und Gefühl. Und ihre Helden müssen einiges aushalten. Bewaffnete Konflikte jedoch gibt es kaum. Die interessieren sie als Problemlösung nicht.
In Freie Geister schickt sie einen von Gleichheit und Gerechtigkeit überzeugten Anarchisten mutterseelenallein in eine kapitalistisch regierte Welt und erkundet den Reiz von Besitzlosigkeit. In Die linke Hand der Dunkelheit bereist ein Emissär einen Planeten, auf dem die Bewohner ihr Geschlecht wechseln können und bei der Fortpflanzung mal die männliche, mal die weibliche Rolle übernehmen. In Erdsee muss im ersten Band ein junger Zauberer seinem Schatten begegnen und ihn als Teil von sich annehmen, ehe er sich fortentwickeln kann. Im zweiten befreit sich eine junge Priesterin mit Hilfe eines Zauberers vom Diktat ihres Kults. Und im dritten machen sich ein alter Zauberer und ein junger Prinz auf, die Ursache dafür zu finden, warum in Erdsee die alten Lieder und Handwerkskünste vergessen werden und die Kultur verfällt: Ein dunkler Magier hat den Leuten ewiges Leben versprochen und die Grenze zum Tod verwischt.
Fällt Ihnen etwas auf? Wenn nicht, geht es Ihnen wie Ursula K. Le Guin, bevor sie in den frühen 1970ern die zweite Frauenbewegung für sich entdeckte. Erst als sie zum vierten Erdseeband ansetzte, in dem wie im zweiten eine weibliche Hauptfigur im Mittelpunkt stehen sollte, wurde ihr klar, dass die Handlungsträger in ihren Büchern stets männlich gewesen waren, Helden, wie es die Tradition vorsah. Das trifft auch auf Die Gräber von Atuan zu: Ohne Anstoß durch den Magier hätte die junge Priesterin keinen Weg aus ihrer Situation gefunden.
In Die Linke Hand der Dunkelheit hatte sie wie selbstverständlich das generische Maskulinum für alle verwendet, obwohl ihre Figuren geschlechtlich nicht festgelegt waren. Was immer sie an Subversion betrieben hatte, es war nicht weit genug gegangen. Das Schreiben des vierten Bandes wollte nicht gelingen, bis sie wusste, was eine Heldin ausmachen könnte. In ihrem »Rückblick auf Erdsee« bemerkt sie dazu: »Ich konnte meine Heldengeschichte nicht fortsetzen, ehe ich als Frau und Künstlerin mit den Engeln weiblichen Bewusstseins gerungen hatte. Es dauerte lange, bis ich ihren Segen erhielt. Ich wusste schon 1972, dass es einen vierten Band [von Erdsee] geben sollte, aber es hat sechzehn Jahre gedauert, bis ich ihn schreiben konnte.« Tehanu erschien 1990.
Hinter die Entwicklung dieser sechzehn Jahre ist sie nie wieder zurückgegangen. Sie hat ihr Schreiben verwandelt, den Stil vornehmlich in den Essays, wo sie häufig ein generisches Femininum verwendet, vor allem aber die Wahl der Themen und den Blickwinkel auf jegliches Geschehen. Die Frauen sind nicht mehr aus ihrem Werk wegzudenken. Und in alles, worüber sie nachdenkt, sind Reflexionen über die männliche Dominanz im Literaturbetrieb, in den Traditionen, in Politik und Gesellschaft integriert. Ihre Analysen sind scharf, die Differenzierungen hinreißend, ihr Witz dabei köstlich, die Richtung stets konstruktiv. Darin ist sie wirklich einmalig. Es gibt einen wunderbaren kleinen Text, den sie mit sechzig schrieb und über Jahre für verschiedene Auftritte immer wieder leicht veränderte. »Darf ich mich vorstellen?« zeigt gebündelt, wie sie vorgeht. Die ersten Worte lauten: »Ich bin ein Mann«, und anschließend wird erläutert, inwiefern das zutrifft, weshalb sie aber natürlich immer nur ein zweitklassiger Mann sein kann, ob als Autor oder sonst im Leben:
Als Er verhalte ich mich zu einem echten Mann wie ein Fischstäbchen aus der Mikrowelle zu einem Königslachs vom Grill … Der Haken an der Sache ist, glaube ich, dass mir zu einem Mann etwas fehlt. Zu einem Mann wie Ernest Hemingway. Mit dem Bart und den Waffen und den Ehefrauen und den kurzen, knappen Sätzen. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ich habe dieses bartartige Zeug am Kinn, das mir immer wieder wachsen will, so neun oder zehn Haare, manchmal auch mehr. Doch was mache ich mit den Haaren? Ich zupfe sie aus. Würde ein Mann das tun? Männer zupfen nicht. Männer rasieren sich. Jedenfalls rasieren sich weiße Männer … Ich zupfe. Aber das heißt nichts, weil ich nicht wirklich einen Bart habe, der als solcher zählen kann. Außerdem habe ich keine Waffe und keine einzige Ehefrau, und meine Sätze haben den Hang, immer weiter und weiter und weiter zu gehen und voller Syntax zu sein. Hemingway wäre lieber gestorben, als sich mit Syntax abzugeben … Und noch etwas. Ernest Hemingway wäre lieber gestorben als alt zu werden. Er ist lieber gestorben. Er hat sich erschossen.
Das fügt dem Thema Weiblichkeit ein weiteres hinzu. Sie schreibt: »Ich habe mir gestattet, alt zu werden, und habe nicht das Geringste dagegen getan, mit einer Waffe oder sonst was.« Das ist in einer Gesellschaft, die der Jugend huldigt, ein Problem. Ihre Lösung dafür lautet: »Wenn ich nicht überzeugend so tun kann, als wäre ich ein Mann, und nicht überzeugend jung sein kann, dann kann ich auch gleich so tun, als wäre ich eine alte Frau. Ich bin mir nicht sicher, ob schon jemand alte Frauen erfunden hat; aber vielleicht ist es einen Versuch wert.« Dieser Versuch gehört seit den 90er-Jahren zu ihren Projekten, die Texte zum Thema Alter in diesem Band sind späte Früchte dieser Tradition.
Böse und weise. Ursula K. Le Guin war nicht darauf aus, sich oder irgendwelche Minderheiten in den Mainstream integriert zu wissen. Vom Mainstream hielt sie gar nichts, weder in der Verlagswelt noch in der Politik. Und sie verstand es als ihre Aufgabe, bei öffentlichen Äußerungen deutlich zu sagen, welche Absurditäten der Ausbeutungskapitalismus mit seiner Idee vom ewigen Wachstum uns und dem Planeten aufbürdet. Resignation lag ihr fern, aber die Trauer um das, was ist, schwingt in allen Texten mit. Sie hat schon viel gesehen, und es tut weh. Aber das nimmt ihr weder die Scharfsicht noch den Mut, sich weiter einzumischen und unnachgiebig für das Leben auf der Erde, die Achtung vor der Vielfalt der Natur, die Machtlosen und unermüdlich für Freiheit zu streiten. Ihr Credo blieb: Es muss nicht sein, wie es ist. Dafür lohnt es sich, die ganze Kraft eines Lebens einzusetzen, erfinderisch zu werden, alles immer wieder neu zu denken, Schlupflöcher in eine Zukunft zu suchen, in der wir Menschen mehr Verantwortung zeigen. Ihr zu folgen, wenn sie Dinge ausdifferenziert, »Macht zu« von »Macht über«, »Freiheit zu« von »Freiheit von« unterscheidet oder, wie in einem der Einträge in diesem Buch, Überlegungen zum Nutzen und Missbrauch von Wut anstellt.
Ihre Fans erfreut dabei vor allem, wie sie Unübliches zusammendenkt, wie Verstand und Gefühl, Traumlogik und Taglogik ineinanderfließen und wie tief der Humor ist, der ihre Texte durchströmt. Sie hat sich die Freiheit erarbeitet, noch im Schlimmsten Anlass zum Lachen zu finden. Es lockert das Denkvermögen und erweitert Perspektiven – auf die Tier- und Pflanzenwelt und die Sprache der »unbelebten« Natur, auf Wahrheit und Lüge, Geschlechter- oder andere Gerechtigkeit.
Als DIE ZEIT im Kontext der aktuellen Diskussion um gendergerechte Sprache jüngst eine Reihe deutscher Autorinnen und Autoren fragte: »Wie halten Sie es mit dem Gender?«, antwortete Clemens J. Setz: »Man sollte sich in solchen Belangen immer fragen: »What would Ursula K. Le Guin do?« Die würde sich nicht damit begnügen, bloß genderneutral zu schreiben, sondern darüber hinaus in ihren Sätzen alle möglichen Dinge explodieren lassen, die als mürrisches, starres Kulturgut um uns herumliegen.«
Welch ein guter Nutzen für Sprengstoff! Die vorliegenden Blogbeiträge bieten eine Fülle von Beispielen dafür, wie sie es macht. Genießen Sie das Vergnügen, sich von einer über Achtzigjährigen Herz und Hirn durchpusten zu lassen.
Karen Nölle, im Juni 2018
Quellen:
Darf ich mich vorstellenhttps://www.tor-online.de/feature/buch/2018/02/darf-ich-mich-vorstellen-ursula-k-le-guin/
Blogs: http://www.ursulakleguin.com/Blog-Index.html
Clemens J. Setz in DIE ZEIT Nr. 24 vom 7. Juni 2018. S. 39 zum Thema: Wie halten Sie es mit dem Gender?
Karen Joy Fowler:EINFÜHRUNG
Ich kann mich noch gut an einen Cartoon erinnern, den ich vor vielen Jahren im New Yorker gesehen habe. Zwei Männer, einer ein Sinnsuchender, der andere ein Weiser, sitzen auf einem Felsvorsprung vor einer Berghöhle, umgeben von Katzen. »Der Sinn des Lebens sind Katzen«, sagt der Weise zum Suchenden. Dank der Magie des Internets kann ich als Jahr der Veröffentlichung 1966 ermitteln und als Zeichner Sam Gross.
Der Cartoon kam mir beim Lesen der vorliegenden Sammlung wieder in den Sinn. Ich dachte, wenn ich den Berg erklimme und zur Höhle der weisen Ursula K. Le Guin komme und die vorhersehbare Frage stelle, erhalte ich womöglich genau diese Antwort. Oder auch nicht – Le Guin ist nicht vorhersehbar. Sie könnte stattdessen sagen: »Das Alter ist etwas für alle, die es erreichen.« Oder »Angst ist selten vernünftig und niemals freundlich.« Oder vielleicht würde sie mir sagen: »Bei den Toten gibt es kein Ei.«
Für den Suchenden ist die Antwort weniger wichtig als das, was er daraus macht. Was für den Weisen wichtig ist, weiß ich nicht. Folgt man Le Guin, könnte es einfach das Frühstück sein.
Heute ist der Weg zur Le-Guin-Höhle weniger schweißtreibend, aber nicht weniger gefährlich als der archetypische Weg zum Gipfel. Man muss die Wikipediasümpfe durchqueren und auf Zehenspitzen an sämtlichen Kommentarspalten vorbeischleichen, um die Trolle nicht aufzuwecken. Denkt dran: Wenn ihr sie seht, können sie euch auch sehen! Hütet euch vor dem Monster YouTube, dem großen Zeitfresser. Nutzt stattdessen das Wurmloch namens Google und gleitet hindurch. Landet auf Ursula K. Le Guins Website und geht direkt zu ihrem Blog, um die neuesten Einträge zu lesen.
Aber zuerst lest dieses Buch.
Hier findet man ein Archiv von Betrachtungen zu vielerlei Themen: dem Altern, exorzistischen Riten, der Notwendigkeit von Ritualen – vor allem, wenn sie ohne besonderen Glauben durchgeführt werden –, dass ein Fehler im Internet nie mehr korrigiert werden kann, Musik sowie lesenden und schreibenden Kindern, Homer, Sartre und dem Weihnachtsmann. Le Guin gehört nicht zu jenen Weisen, die Zustimmung und Gehorsam verlangen. Jeder, der ihre Bücher gelesen hat, weiß das. Die hier zusammengestellten Betrachtungen zeigen einfach, worüber sie selbst nachgedacht hat.
Aber sie sind allesamt ein wunderbares Sprungbrett für eigene Überlegungen. Manchmal hängt an der Höhle ein Schild, auf dem steht, dass die Weise nicht zu Hause ist. Dann wird das Thema des Tages stattdessen von der Katze vorgegeben. »Denk über Wanzen nach«, schlägt die Katze vor, und ich tue es. Wanzen erweisen sich als überraschend ertragreiches Thema, besonders, wenn der Ratschlag von dem guten Kater mit den bösen Pfoten kommt. Ich denke über Katzen nach und über ihre bezaubernde, mordlüsterne Art. Ich mache mir Gedanken über das problematische Verhältnis des Menschen zur Natur. Wir hegen alle, denke ich, irgendwo tief in uns den Wunschtraum, Mogli zu sein – den Wunsch, dass die anderen Tiere uns als einen der ihren betrachten und akzeptieren. Und dann verraten wir diesen Traum, wenn die falschen Tiere ihn von uns einfordern. Wir wollen zu den wilden Tieren im Dschungel gehören, tolerieren aber nicht die wilden Tiere in unserer Küche. Wir denken, dass es zu viele Ameisen gibt, und greifen nach der Spraydose, wo es doch genauso zutrifft, dass es zu viele Menschen gibt.
In einem anderen Essay in einem anderen Buch hat Le Guin geschrieben, dass der sogenannte Realismus den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Nur phantastische Literatur betrachtet das Nicht-Menschliche als gleichermaßen interessant und relevant. Damit (und aus vielen anderen Gründen) ist Fantasy die subversivere, umfassendere, reizvollere Literatur. Wenn man diese beiden Punkte kombiniert – unsere Unfähigkeit, mit unserer eigenen Vielzahl zurechtzukommen, und unser Beharren darauf, dass wir an erster Stelle stehen –, könnte das unser Ende sein. Und mit diesen Gedanken erreiche ich das Weltende, wo ich schließlich genug davon habe, über Wanzen nachzudenken, und komme wieder zurück zu Le Guin.
Le Guin hat sich in ihrem langen Leben als Schriftstellerin immer für die Phantasie starkgemacht und für die Geschichten, die aus ihr entstehen. Ich habe mein gesamtes Erwachsenenleben den Weg den Berg hinauf gesucht, um von ihr Antworten auf Fragen zu erhalten, von denen ich nicht einmal wusste, dass ich sie mir stelle. Da ich nun auf die siebzig zusteuere, ist das ein langer Zeitraum. Zu den größten Geschenken der Welt an mich gehört, dass ich Le Guin persönlich kenne, dass ich viele Stunden in ihrer Gesellschaft verbracht habe. Aber wenn ich nur (nur – ha!) die Bücher gehabt hätte, wäre das Geschenk für mich immer noch von unschätzbarem Wert.
Ich denke, sie erlebt aktuell einen Moment der Anerkennung und der Wertschätzung. Bei diesem besonderen Moment (sie hatte auch schon andere solcher Momente) geht es zum Teil um ihren prägenden Einfluss auf eine Generation von Autoren wie mich. Am Anfang dieser Sammlung schreibt sie darüber, wie sie José Saramagos Blog entdeckt hat und dachte: Ach, jetzt verstehe ich! Kann ich das auch? Und genauso hat ihr eigenes Werk auf viele von uns gewirkt – als Beispiel, als eine Befreiung von Konventionen und Erwartungen, als eine Einladung in eine Welt, die größer ist als die, die wir sehen.
Aber aus meiner Sicht entsprechen all diese Momente von Le Guin, die Anerkennung und Bewunderung, nicht im Entferntesten dem, was sie tatsächlich erreicht hat. Mir fällt kein anderer Autor und keine andere Autorin ein, der oder die so viele Welten erschaffen hat wie sie, geschweige denn Welten von einer solchen Komplexität und Vielschichtigkeit. Wo andere Autoren ihr Vermächtnis mit einem einzigen Buch sichern, hat sie ein Dutzend Bücher geschrieben, die dafür geeignet wären. Und ihr letzter Roman, Lavinia, gehört gewiss zu ihren großen Werken. Le Guin ist sowohl produktiv als auch wirkmächtig. Sie ist sowohl spielerisch als auch kraftvoll. In ihrem Leben und bei ihrer Arbeit hat sie sich immer für das Gute eingesetzt, war immer präzise in ihrer Gesellschaftskritik, die jetzt, da wir sehen, welch schlimmen Weg die Welt gerade einschlägt, nötiger ist denn je. Wir, die wir als Leser und Autoren ihr Schaffen verfolgt haben, können uns glücklich schätzen. Wir lieben sie nicht nur; wir brauchen sie.
In diesem Band begegnet man einer ungezwungeneren Le Guin, der Privatperson. Manche Fragen, die sie während ihrer langen Zeit als Schriftstellerin nicht losgelassen haben – das fatale kapitalistische Wachstumsmodell; Schwesternschaft und wie diese sich von der männlichen Bruderschaft unterscheidet; die Abwertung von Genreliteratur, Wissenschaft und Glauben sowie damit verbundene Fehlauffassungen werden auch hier wieder zum Thema, aber sie wurden auf ihre absolute Essenz herunterdestilliert. Besondere Freude bereitet es, Le Guins lebhaften Geist beim Denken zu beobachten, oder auch, wie beispielsweise ein Post, der zunächst recht fröhlich erscheint, zutiefst bedeutsam wird.
Le Guin ist der Natur immer mit Staunen begegnet. Sie gehört zu den aufmerksamsten Menschen, denen ich in meinem Leben begegnet bin, achtet auf den Vogelgesang im Hintergrund, das Blatt am Baum. Ihr hier abgedruckter Essay über die Klapperschlange und auch der über den Luchs wirken auf mich wie Lyrik und lösen intensive Gefühle aus, die ich nicht ganz einordnen kann und für die mir die Worte fehlen.
Ich sollte mir die Worte dafür ausdenken. Le Guin würde das tun. (Googelt einmal »Fibble, Game of«.) Wenn ich Le Guins Texte über Vögel oder andere Tiere lese, über bestimmte Tiere mit einer eigenen Geschichte und Persönlichkeit und mit außergewöhnlichen Verhaltensweisen, oder wenn ich lese, wie Le Guin über Bäume und Flüsse und die ganze vergängliche Schönheit der Welt schreibt, dann sollte ich wohl sagen, ich fühle ich mich trans-platziert, anders-fürchtig, zungen-starr.
Eure zungen-starre
Karen Joy Fowler
Ursula K. Le Guin:EINE VORBEMERKUNG
Oktober 2010
Die außergewöhnlichen Blogs von José Saramago, die er als Fünfundachtzig- und Sechsundachtzigjähriger geführt hat, haben meine Begeisterung geweckt. Dieses Jahr wurden sie auf Englisch unter dem Titel The Notebook veröffentlicht. Ich habe sie mit Erstaunen und großer Freude gelesen.
Bis dahin hatte ich nie vorgehabt zu bloggen. Mir hat das Wort Blog nie gefallen – vermutlich soll es für bio-log oder so etwas stehen, aber es könnte auch ein Hindernis im Nasengang bezeichnen (o, sie spricht so merkwürdig, weil sie so schreckliche Blogs in der Nase hat). Mich schreckte auch die Vorstellung ab, dass ein Blog »interaktiv« sein soll, dass vom Blogger erwartet wird, die Kommentare der Leute zu lesen, um dann auf sie zu antworten und eine endlose Konversation mit Fremden zu führen. Ich bin viel zu introvertiert, um so etwas zu wollen. Ich komme mit Fremden am besten klar, wenn ich eine Geschichte oder ein Gedicht schreiben und mich dahinter vor ihnen verstecken kann, den Text für mich sprechen lasse.
Obwohl ich ein paar Beiträge zum Book View Café beigesteuert habe, die an Blogartikel erinnern, haben sie mir nie gefallen. Letztendlich waren sie, trotz der neuen Bezeichnung, einfach nur Stellungnahmen oder Essays, und Essays zu schreiben war für mich immer harte Arbeit und nur gelegentlich bereichernd.
Doch als ich sah, was Saramago mit dieser Textform machte, war das eine Offenbarung.
Oh! Ich verstehe! Ich begreife! Kann ich das auch mal versuchen?
Meine Versuche/Proben (das bedeutet der Begriff Essay) sind bisher politisch und moralisch viel weniger gewichtig ausgefallen als die von Saramago, und sie sind von eher trivialer Art und auch persönlicher. Vielleicht wird sich das ändern, wenn ich mich in dieser Form übe, vielleicht auch nicht. Vielleicht gelange ich bald zu der Ansicht, dass sie doch nichts für mich ist, und höre wieder auf. Das wird sich zeigen. Was mir im Moment gefällt, ist der Aspekt der Freiheit. Saramago hat (mit einer Ausnahme) nicht direkt mit seinen Lesern interagiert. Diese Freiheit habe ich mir ebenfalls von ihm abgeschaut.
TEIL 1: DIE ACHTZIG ÜBERSCHREITEN
IN IHRER FREIZEIT
Oktober 2010
Ich habe einen Fragebogen zugeschickt bekommen, aus Harvard, im Vorfeld des Jahrgangstreffens zum sechzigsten Jubiläum unseres Studienabschlusses von 1951. Natürlich war ich am Radcliffe-College gewesen, das damals angegliedert war, aber wegen seines Status als Frauencollege nicht wirklich als Teil Harvards betrachtet wurde; doch in den luftigen Höhen von Harvard, von wo aus alles Mögliche nicht weiter beachtenswert ist, werden solche Details gern übersehen. Der Fragebogen ist ohnehin anonym, deshalb spielt das Geschlecht bei den Fragen wahrscheinlich auch keine Rolle, und er ist interessant.
Die Leute, an die er sich richtet, sind – oder wären – heute fast allesamt achtzig oder älter, und in sechzig Jahren kann einem einst munteren jungen Absolventen jede Menge widerfahren. Daher enthält der Bogen eine höfliche Bitte an Witwen oder Witwer, die Fragen stellvertretend für den Verstorbenen zu beantworten. Und bei Punkt 1c), »Sofern geschieden«, findet sich eine interessante Reihe kleiner Kästchen zum Ankreuzen: »Einmal«, »Zweimal«, »Dreimal«, »Viermal oder öfter«, »Zurzeit wieder verheiratet«, »Zurzeit in einer Partnerschaft«, »Sonstiges«. Die letzte Option ist verwirrend. Ich versuche mir vorzustellen, wie man geschieden sein kann, ohne dass einer der vor »Sonstiges« genannten Unterpunkte zutrifft. Jedenfalls wäre 1951 wohl keines dieser Kästchen auf einem Fragebogen zum Jahrgangstreffen aufgetaucht. You’ve come a long way, baby!, wie es in der Zigarettenreklame mit dem flotten Püppchen so schön heißt.
Frage 12: »Wie haben sich Ihre Enkel – in Bezug auf Ihre Erwartungen – ganz allgemein im Leben gemacht?« Das jüngste meiner Enkelkinder ist gerade vier Jahre alt geworden. Wie hat sich mein Enkel bisher im Leben gemacht? Gut, insgesamt sehr gut. Ich frage mich, welche Erwartungen man wohl an einen Vierjährigen haben soll. Dass er weiterhin ein lieber kleiner Junge ist und bald Lesen und Schreiben lernt, das ist das Einzige, was mir einfällt. Wahrscheinlich erwartet man von mir, dass ich erwarte, dass er nach Harvard geht, oder wenigstens auf die Columbia wie sein Vater und sein Urgroßvater. Aber dass er lieb ist und Lesen und Schreiben lernt, scheint mir für den Moment erst mal genug.
Eigentlich habe ich gar keine Erwartungen. Ich hege Hoffnungen und habe Ängste. Mittlerweile überwiegen die Ängste. Als meine Kinder klein waren, konnte ich noch hoffen, dass wir ihnen die Erde nicht völlig ruiniert hinterlassen. Aber jetzt, wo wir genau das getan und uns mehr denn je an einen profitorientierten Industrialismus verkauft haben, dessen Horizont gerade mal ein paar Monate in die Zukunft reicht, ist meine Hoffnung, dass die kommenden Generationen gut und in Frieden werden leben können, doch sehr gedämpft worden, und sie wird sich gegen die Finsternis behaupten müssen.
Frage 13: »Was wird die Lebensqualität für die kommenden Generationen Ihrer Familie verbessern?« Es folgen Kästchen, bei denen man die Relevanz jedes Punktes von 1 bis 10 bewerten kann. Der erste Punkt ist »Bessere Bildungschancen« – na gut, Harvard gehört schließlich zum Bildungsbereich. Ich habe 10 angekreuzt. Der zweite Punkt ist »Wachstum und Stabilität der US-Wirtschaft«. Das brachte mich komplett raus. Was für ein herrliches Beispiel für kapitalistisches Denken, oder vielmehr Nicht-Denken: anzunehmen, dass Wachstum und Stabilität zusammengehören! Schließlich machte ich kein Kreuzchen, sondern schrieb an den Rand: »Das eine schließt das andere aus.«
Die weiteren Faktoren waren: »Abbau der Staatsverschuldung«, »Weniger Abhängigkeit von Energieimporten«, »Qualitativ bessere und günstigere Gesundheitsversorgung«, »Erfolgreiche Bekämpfung des Terrorismus«, »Effektive Einwanderungspolitik«, »Mehr Überparteilichkeit in der US-Politik«, »Export der Demokratie«.
Da wir doch angehalten sind, uns Gedanken über das Leben der zukünftigen Generationen zu machen, scheint mir das eine merkwürdige Zusammenstellung. Sie beschränkt sich auf eher gegenwärtige Fragen und ist von aktuellen Lieblingsthemen der Rechten gefärbt, wie etwa »Terrorismus«, »effektiver« Einwanderungspolitik und »Export« von »Demokratie« (ich nehme an, das ist ein Euphemismus für unsere Politik, in Länder, die wir nicht mögen, einzumarschieren und zu versuchen, ihre gesellschaftlichen Strukturen, ihre Kultur und Religion zu zerstören). Neun Wahlmöglichkeiten, aber kein Wort zum Klimawandel, nichts zur internationalen Politik, nichts zu Bevölkerungswachstum und Umweltverschmutzung durch die Industrie, nichts zur Einflussnahme von Konzernen auf die Regierung, nichts zu Menschenrechten oder sozialer Ungerechtigkeit oder Armut …
Frage 14: »Leben Sie Ihre geheimen Wünsche aus?« Wieder war ich sprachlos. Schließlich kreuzte ich weder »Ja«, »Zum Teil« noch »Nein« an, sondern schrieb zwischen die Zeilen: »Ich habe keine, meine Wünsche kann jeder wissen.«
Aber richtig deprimierend fand ich Frage 18. »Womit verbringen Sie Ihre Freizeit? (Bitte alle zutreffenden Punkte ankreuzen.)« Und die Auflistung beginnt mit: »Golf …«
An siebter Stelle in der Liste von siebenundzwanzig Aktivitäten, nach »Schlägersportarten«, aber vor »Einkaufen«, »Fernsehen« und »Bridge«, steht »Kreative Beschäftigungen (Malen, Schreiben, Fotografieren etc.)«.
An diesem Punkt hörte ich auf zu lesen und dachte ziemlich lange nach.
Das Schlüsselwort ist Freizeit. Was meinen die Ersteller des Fragebogens damit?
Für jemanden, der arbeitet – für einen Kassierer im Supermarkt, eine Anwältin, einen Autobahnbauer, eine Hausfrau, für eine Cellistin, einen Computerfachmann, einen Lehrer, eine Kellnerin –, ist freie Zeit die Zeit, die man nicht am Arbeitsplatz verbringt oder damit, das restliche Leben zu meistern, zu kochen, zu putzen, das Auto in die Werkstatt zu bringen und die Kinder zur Schule. Für Leute mittleren Alters ist Freizeit freie Zeit und wird als solche geschätzt.
Aber für jemanden, der achtzig ist? Was sonst haben Menschen im Ruhestand als »freie« Zeit?
Ich bin nicht im eigentlichen Sinne im Ruhestand, weil ich nie eine Arbeit hatte, nach der man in den Ruhestand hätte gehen können. Ich arbeite immer noch, wenn auch nicht so viel wie früher. Ich war und bin immer noch stolz darauf, eine Frau zu sein, die arbeitet. Aber für die Fragebogenersteller in Harvard war mein Lebenswerk eine »kreative Beschäftigung«, ein Hobby, etwas, womit man seine Freizeit ausfüllt. Hätten sie gewusst, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene, hätten sie es womöglich in einer respektableren Kategorie aufgeführt, aber auch daran habe ich meine Zweifel.
Bleibt die Frage: Wenn alle Zeit, die man hat, Freizeit ist, nicht weiter verplant, was macht man dann damit?
Und was mag der Unterschied zwischen dieser Freizeit und jener sein, die man hatte, als man fünfzig oder dreißig oder fünfzehn war?
Kinder hatten früher eine Menge freie Zeit, Kinder aus der Mittelschicht jedenfalls. Wenn sie keinen Sport trieben, hatten sie, abgesehen vom Schulbesuch, den Großteil ihrer Zeit zur freien Verfügung, und sie überlegten sich mehr oder weniger gut, was sie damit anfangen sollten. Als ich ein Teenager war, hatte ich ganze Sommer lang nichts zu tun. Drei Monate frei. Keinerlei Verpflichtungen. Und nach der Schule hatte ich auch viel Freizeit. Ich las, ich schrieb, ich traf mich mit Jean und Shirley und Joyce, ich streifte umher und hing Gedanken nach und hatte Gefühle, o ja, das waren tiefe Gedanken und tiefe Gefühle … Ich hoffe, dass manche Kinder immer noch solche Momente erleben. Die Kinder, die ich kenne, scheinen in der Tretmühle ihres verplanten Tages zu stecken, hetzen ohne Pause von Termin zu Termin, zum Fußballtraining, zu Verabredungen mit Freunden, zu was auch immer. Ich hoffe, sie finden noch Freiräume und ziehen sich dorthin zurück. Manchmal kann ich beobachten, wie ein Teenager in unserer Familie zwar körperlich anwesend ist – sie lächelt, ist höflich und scheint aufmerksam –, aber geistig ist sie abwesend. Ich denke, ja ich hoffe, dass sie Freiraum gefunden, sich freie Zeit geschaffen hat, diese Zeit genießt und dort allein ist, weit zurückgezogen, und denkt und fühlt.
Das Gegenteil von Freizeit ist wohl Zeit, in der man beschäftigt ist. Ich selbst weiß bis heute nicht, was Freizeit ist, denn ich bin die ganze Zeit über beschäftigt. So war es schon immer, und so ist es auch jetzt. Ich bin damit beschäftigt zu leben.
In meinem Alter besteht das Leben zunehmend daraus, den eigenen Körper zu pflegen und fit zu halten, was beschwerlich ist. Aber in meinem ganzen Leben gab es keine Zeit oder Phase, in der ich nicht beschäftigt war. Ich bin ein freier Mensch, aber freie Zeit habe ich nicht. Meine Zeit ist komplett ausgefüllt mit Schlafen, Tagträumen, Arbeit und E-Mail-Korrespondenz mit Freunden und Familie, mit Lektüre, mit dem Verfassen von Lyrik, dem Verfassen von Prosa, mit Nachdenken und mit Vergessen, mit Stickarbeiten, mit Kochen und Essen und dem Aufräumen der Küche, mit Vergil-Interpretation, Treffen mit Freunden, Gesprächen mit meinem Mann, mit Einkaufen, mit Spaziergängen, wenn ich spazieren gehen kann, und Reisen, wenn wir mal verreisen, manchmal mit Vipassana-Sitzmeditation, gelegentlich mit einem Film, mit den Acht Brokaten aus dem Chi Gong, wenn ich dazu komme; damit, mich am Nachmittag mit einem Krazy-Kat-Band hinzulegen, während meine eigene, ebenfalls etwas verrückte Katze sich auf meinen Beinen niederlässt und dort sofort tief und fest einschlummert. Nichts davon ist freie Zeit. Ich habe keine freie Zeit. Was stellen sich die Leute in Harvard vor? Nächste Woche werde ich einundachtzig. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit.
DAS WEICHEI SCHLÄGT ZURÜCK
November 2010
Seitdem ich selbst alt bin, halte ich nichts mehr von dem Sprichwort »Man ist so jung, wie man sich fühlt«.
Es hat einen noblen Hintergrund. Es speist sich aus der Vorstellung von der Macht des positiven Denkens, die in Amerika weit verbreitet ist, weil sie so gut zur Macht der Werbeindustrie und der Macht des Wunschdenkens passt, auch bekannt unter dem Namen »Amerikanischer Traum«. Das ist die schöne Seite des Puritanismus: Du verdienst, was du bekommst. (Auf die Schattenseite des Puritanismus sei an dieser Stelle nicht näher eingegangen.) Guten Menschen widerfahren gute Dinge, und die Jugend währt ewig für den, der jung im Herzen ist.
Jepp.