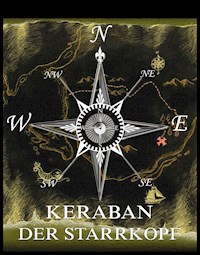
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die illustrierte Version dieses Klassikers. Nach einem Ehestreit flieht der niederländische Tabakhändler Mijnheer Jan Van Mitten mit seinem Diener Bruno von Rotterdam nach Istanbul, wo er seinen Freund und Geschäftspartner Keraban aufsucht. Kerabans Geschäftsräume liegen in dem in Europa gelegenen Teil Istanbuls. Dort treffen ihn Van Mitten und Bruno an ..... (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Keraban der Starrkopf
Jules Verne
Inhalt:
Jules Verne – Biografie und Bibliografie
Keraban der Starrkopf
Erster Theil.
Erstes Capitel. In dem Van Mitten und sein Diener Bruno sich umsehend und plaudernd lustwandeln, ohne zu begreifen, was um sie vorgeht.
Zweites Capitel. Wo der Intendant Scarpante und der Capitän Yarhud sich von Projecten unterhalten, deren Kenntniß für den Leser von Wichtigkeit ist.
Drittes Capitel. In welchem Seigneur Keraban höchst erstaunt ist, mit seinem Freunde Van Mitten zusammenzutreffen.
Viertes Capitel. In welchem Seigneur Keraban, noch starrköpfiger als sonst, sogar den Beamten der Hohen Pforte entgegentritt.
Fünftes Capitel. Worin Seigneur Keraban in seiner Weise darüber spricht, was er unter Reisen versteht, und Constantinopel verläßt.
Sechstes Capitel. In welchem die Reisenden, vorzüglich im Donau-Delta, auf einige Schwierigkeiten stoßen.
Siebentes Capitel. In welchem die Pferde aus Angst zustande bringen, was sie unter der Peitsche des Postillons nicht auszuführen vermochten.
Achtes Capitel. Worin der Leser gern die Bekanntschaft der jungen Amasia und ihres Verlobten Ahmet machen wird.
Neuntes Capitel. Worin dem Gelingen des Planes des Cäpitan Yarhud nur sehr wenig fehlte.
Zehntes Capitel. In welchem Ahmet einen energischen, übrigens durch die Umstände gebotenen Entschluß faßt.
Elftes Capitel. In welchem sich dieser phanatischen Fahrt etwas dramatische Würze beimischt.
Zwölftes Capitel. In welchem Van Mitten eine Tulpengeschichte erzählt, die den Leser vielleicht interssieren dürfte.
Dreizehntes Capitel. Quer durch das alte Tauris.
Vierzehntes Capitel. Worin der Seigneur Keraban sich in der Geographie mehr bewandert zeigt, als sein Neffe Ahmet geglaubt hätte.
Fünfzehntes Capitel. In welchem der Seigneur Keraban, Ahmet, Van Mitten und deren Diener die Rolle von Salamandern spielen.
Sechsechzehntes Capitel. Worin es sich um die ausgezeichneten des Tabaks von Persien und von Kleinasien handelt.
Siebzehntes Capitel. In dem es zu einem sehr ernsthaften Abenteuer kommt, welches den ersten Theil dieser Erzählung abschließt.
Zweiter Theil.
Erstes Capitel. In dem man den Seigneur Keraban, aber wüthend, mit einer Eisenbahn gefahren zu sein, wiederfindet.
Zweites Capitel. In welchem Van Mitten sich entschließt, dem Drängen Brunos nachzugeben, und was daraus entsteht.
Drittes Capitel. In welchem Bruno seinem Kameraden Nizib einen Streich spielt, den ihm der Leser freundlich verzeihen möge.
Viertes Capitel. In welchem Alles unter blendenden Blitzen und krachenden Donnerschlägen vor sich geht.
Fünftes Capitel. Wovon man auf dem Wege von Atina nach Trapezunt spricht und was man dabei sieht.
Sechstes Capitel. Worin von neuen Persönlichkeiten die Rede ist, welchen der Seigneur Keraban in der Karawanserei von Rissar begegnet.
Siebentes Capitel. In welchem der Richter von Trapezunt in sehr erfinderischer Weise zu seiner Untersuchung vorschreitet.
Achtes Capitel. Welches vorzüglich für Freund Van Mitten in sehr unerwarteter Weise endigt.
Neuntes Capitel. In welchem Van Mitten durch Verlobung mit der Sarabul die Ehre widerfährt, der Schwager des Seigneur Yanar zu werden.
Zehntes Capitel. In welchem die Helden dieser Erzählung weder einen Tag, noch eine Stunde verlieren.
Elftes Capitel. In welchem der Seigneur Keraban sich ein wenig gegen die Ansicht seines Neffen Ahmet einem Rathschläge des Führers fügt.
Zwölftes Capitel. Worin ein Gespräch zwischen der edlen Sarabul und ihrem Verlobten mitgetheilt wird.
Dreizehntes Capitel. In welchem der Seigneur Keraban, nachdem er seinem Esel gegenüber den eignen Kopf behauptet, auch seinem Todfeind gegenübertritt.
Vierzehntes Capitel. In welchem Van Mitten sich bemüht, die edle Sarabul über die wirkliche Sachlage aufzuklären.
Fünfzehntes Capitel. In welchem man den Seigneur Karaban noch starrköpfiger als je sehen wird.
Sechzehntes Capitel. Worin es sich zeigt, daß der Zufall immer der geschickteste Helfer ist, um eine verfahrene Sache wieder in's Geleise zu bringen.
Keraban der Starrkopf, Jules Verne
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
Jules Verne – Biografie und Bibliografie
Franz. Schriftsteller, geb. 8. Febr. 1828 in Nantes, gest. 24. März 1905 in Amiens, studierte in Paris die Rechte, muß sich aber schon früh auch den Naturwissenschaften zugewandt haben, denn gleich sein erster Roman, der die Reihe jener originellen, eine völlig neue Gattung begründenden Produkte Vernes eröffnete: »Cinq semainesen ballon« (1863), zeugt von jenem Studium. Der Erfolg, dessen sich diese Schöpfung erfreute, bestimmte ihn, die dramatische Laufbahn, mit der er sich bereits durch mehrere »Comédies« und Operntexte vertraut gemacht hatte, zu verlassen und sich ausschließlich dem phantastisch-naturwissenschaftlichen Roman zu widmen. V. führt seine Leser auf den abenteuerlichsten, stets aber physikalisch motivierten Fahrten nach dem Monde, um den Mond, nach dem Mittelpunkte der Erde, »20,000 Meilen« unter das Meer, auf das Eis des Nordens, auf den Schnee des Montblanc, durch die Sonnenwelt etc., und man kann nicht leugnen, daß er es verstand, die ernste Lehre, wenigstens die große Fülle seiner realen Kenntnisse, mit dem Faden der poetischen Fiktion geschickt zu verweben und dem unkundigen Leser eine gewisse Anschauung von naturwissenschaftlichen Dingen und Fragen spielend beizubringen. Wir nennen hier seine »Aventures du capitaine Hatteras« (1867), »Les enfants du capitaine Grant«, »La découverte de la terre« (1870), »Voyage autour du monde en 80 jours« (1872), »Le docteur Ox« (1874), »Un hivernage dans le glâces«, »Michel Strogoff (Moscou, Ireoutsk)«, »Un capitaine de 15 aus«, »Les Indes noires« (1875), »La maison à vapeur«, »Mathias Sandorf« (1887), »Claudius Bombarnai«, »Le Château des Carpathes« (1892), alle bereits in vielen Ausgaben erschienen und von der Lesewelt verschlungen, auch meist ins Deutsche übersetzt und in Form von Ausstattungsstücken mit nicht geringem Erfolg auf die Bühne gebracht (vgl. »Les voyages an théâtre« von V. und A.Dennery). Die »Œuvres complètes«
Vernes erschienen 1878 in 34 Bänden (illustrierte Ausg. 15 Bde.).
Romane:
Fünf Wochen im Ballon. 1875
Reise zum Mittelpunkt der Erde. 1873
Von der Erde zum Mond. 1873
Abenteuer des Kapitän Hatteras. 1875
Die Kinder des Kapitän Grant. 1875
Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer. 1874
Reise um den Mond. 1873
Eine schwimmende Stadt. 1875
Abenteuer von drei Russen und drei Engländern in Südafrika. 1875
Das Land der Pelze. 1875
Reise um die Erde in 80 Tagen. 1873
Die geheimnisvolle Insel. 1875 und 1876
Der Chancellor. 1875
Der Kurier des Zaren. 1876
Reise durch die Sonnenwelt. 1878
Die Stadt unter der Erde. 1878
Ein Kapitän von 15 Jahren. 1879
Die 500 Millionen der Begum. 1880
Die Leiden eines Chinesen in China. 1880
Das Dampfhaus. 1881
Die „Jangada“. 1882
Die Schule der Robinsons. 1885
Der grüne Strahl. 1885
Keraban der Starrkopf. 1885
Der Südstern oder Das Land der Diamanten. 1886
Der Archipel in Flammen. 1886
Mathias Sandorf. 1887
Ein Lotterie-Los. 1887
Robur der Sieger. 1887
Nord gegen Süd. 1888
Zwei Jahre Ferien. 1889
Die Familie ohne Namen. 1891
Kein Durcheinander. 1891
Cäsar Cascabel. 1891
Mistress Branican. 1891
Das Karpatenschloss. 1893
Claudius Bombarnac. 1893
Der Findling. 1894
Meister Antifers wunderbare Abenteuer. 1894
Die Propellerinsel. 1895
Vor der Flagge des Vaterlandes. 1896
Clovis Dardentor. 1896
Die Eissphinx. 1897
Der stolze Orinoco. 1898
Das Testament eines Exzentrischen. 1899
Das zweite Vaterland. 1901
Das Dorf in den Lüften.1901
Keraban der Starrkopf
Erster Theil.
Erstes Capitel. In dem Van Mitten und sein Diener Bruno sich umsehend und plaudernd lustwandeln, ohne zu begreifen, was um sie vorgeht.
Am Tage des Beginns unserer Erzählung, dem 16. August, war der, sonst von dem Hin- und Herwogen und dem Getöse der Menge so belebte Top-Hane-Platz in Constantinopel auffallend still, düster und fast menschenleer.
Betrachtete man ihn von der Höhe der Terrassentreppe, welche nach dem Bosporus hinabführte, so bot derselbe immer noch ein reizendes Bild, dem es nur an allem Leben fehlte. Kaum einige Stadtfremde eilten über den Platz nach den engen schmutzigen, oft mit üblem Geruch erfüllten und von herrenlosen gelbhaarigen Hunden belagerten Straßen, durch die man von hier aus nach der Vorstadt Pera gelangt. Letztere bildet bekanntlich das eigentliche Quartier der Europäer, deren steinerne Häuser sich weiß von dem dunkelgrünen Hintergrunde mit Cypressen besetzter Hügel abheben.
Malerisch aber bleibt jener Platz immer, selbst ohne das schillernde Farbenspiel von Costümen, welches ihn sonst gewöhnlich schmückt, malerisch und augengefällig durch seine Moschee Mahmud's mit den schlanken Minarets, durch seinen hübschen Springbrunnen in arabischem Style, von dem das frühere chinesische Dach entfernt worden ist, durch seine vielen Läden, in denen hier Sorbet und tausenderlei Zuckerbackwaren verkauft werden, dort ungeheure Mengen von Kürbissen, Melonen aus Smyrna, Weintrauben aus Scutari aufgehäuft sind, während dazwischen noch Specereihandlungen liegen und Händler mit Rosenkränzen umherziehen, endlich auch durch seine Ufertreppe, an der Hunderte von buntgemalten Kajiks anlegen, deren Doppelruder unter den gekreuzten Händen der Kajiktschi (d. s. Schiffer) die blauen Wellen des Goldenen Horns und des Bosporus mehr liebkosen als durchschneiden.
Wo waren jetzt aber die gewöhnlichen Flaneurs des Top-Hane-Platzes; jene Perser mit der coquetten Astrachan-Mütze; jene Griechen, die sich in ihrer Fustanella mit tausend Falten und Fältchen nicht ohne Eleganz hin- und herwiegen; jene Circassier mit fast ausnahmslos militärischer Haltung; jene Georgier, die bezüglich des Costüms auch jenseits ihrer Grenze noch Russen geblieben sind; jene Arnauten, deren vom Sonnenbrande geröstete Haut durch den rundlichen Ausschnitt ihrer gestickten Westen hervorsieht, und jene Türken endlich, jene Türken oder Osmanlis, die Söhne des alten Byzanz, des alten Istambul – ja, wo waren sie Alle?
Keinesfalls hätte man eine solche Frage an zwei Fremdlinge richten dürfen, zwei Occidentalen, welche eben jetzt neugierigen Blickes, mit hoch erhobener Nase und unsicheren Schrittes fast allein auf dem genannten Platze lustwandelten; sie hätten darauf keine Antwort geben können. Aber noch mehr. Selbst in der eigentlichen Stadt, jenseits des Hafens, hätte ein Tourist dasselbe Schweigen, dieselbe Oede angetroffen. Auf der anderen Seite des Goldenen Horns – dieses tiefen Einschnittes zwischen dem alten Serail und den Landungsplätzen des Top-Haue – dessen linkes Ufer mit dem rechten durch drei Schiffbrücken in Verbindung gesetzt wird, schien das ganze Amphitheater von Constantinopel in Schlummer versunken zu sein. Wachte jetzt wirklich kein Mensch im Palaste von Serai-Burnu? Gab es keine Gläubigen, keine Hadjis mehr, welche nach den Moscheen Ahmed's, von Bayezidieh, der heiligen Sophie Suleïmanieh pilgerten? Hielt auch er Siesta, der sorglose Thurmwächter des Seraskierats, ebenso vielleicht, wie sein College auf dem Thurme von Galata, welche auf den Ausbruch der gerade in dieser Stadt so überaus häufigen Schadenfeuer ein wachsames Auge haben sollen? In der That, hier war nichts zu bemerken, als höchstens das nie ganz aussetzende Leben im Hafen, welches jedoch ebenfalls etwas gedämpft erschien, trotz der Flottille österreichischer, französischer und englischer Dampfer, der Zollkutter, Kajiks und Dampfschaluppen, welche sich längs der Brücken und der Häuserzeilen hindrängen, deren Grund die Wässer des Goldenen Horns umspülen.
War das jenes hochgepriesene Constantinopel, der durch den Machtwillen Constantins und Mahomeds II. verwirklichte Traum des Morgenlandes? – Diese Frage stellten sich die beiden auf dem Platze vereinzelt dahinschreitenden Fremdlinge, und wenn sie dieselbe nicht beantworteten, lag das keineswegs an ihrer Unkenntniß der Landessprache. Im Gegentheil, sie waren des Türkischen ziemlich mächtig; der Eine, weil er dasselbe in seinem geschäftlichen Briefwechsel seit zwanzig Jahren anwendete; der Andere, weil er seinem Herrn oft als Schreibgehilfe beigetreten war, obgleich er bei diesem eigentlich nur als Diener in Lohn und Brot stand.
Die beiden Fremden waren Holländer, gebürtig aus Rotterdam, Herr Jan Van Mitten und dessen Leibdiener Bruno, welche eigenthümliche Umstände bis zu dieser äußersten Ostmark Europas verschlagen hatten.
Van Mitten – in der Heimat eine allbekannte Persönlichkeit – war ein Mann von fünf- bis sechsundvierzig Jahren, mit blondem Haar und himmelblauen Augen, gelblichem Backen- und Kinn-, aber mangelndem Schnurrbart, einer für die sonstige Entwicklungsstufe des Gesichts etwas zu kurz gerathenen Nase, mit ziemlich kräftigem Kopfe und breiten Schultern bei übermittlerem Wuchs, mit mäßigem Embonpoint und Beinen, welche mehr auf sicheren Stand als auf Eleganz berechnet schienen – mit einem Wort, er machte den Eindruck eines achtbaren, seinem Vaterlande zur Ehre gereichenden Staatsbürgers.
Von Charakter schien Van Mitten freilich etwas weich zu sein. Er gehörte unbestreitbar zur Kategorie der Leute von sanfter geselliger Gemüthsverfassung, welche Wortgefechte nicht lieben, in allen Punkten gern nachgeben und weniger zum Befehlen als zum Gehorchen geschaffen sind –
zu jenen ruhigen, schwer erregbaren Persönlichkeiten, von denen man allgemein sagt, daß sie keinen eigenen Willen haben, selbst wenn sie sich einmal einbilden, einen solchen zu besitzen. Schlechter sind sie deshalb ja keineswegs. Einmal, aber nur ein einziges Mal in seinem Leben, hatte sich Van Mitten, zum Aeußersten getrieben, in einen
Wortwechsel eingelassen, der für ihn von ernstester Folge werden sollte. An dem betreffenden Tage war er sozusagen aus seinem Charakter ganz herausgegangen, seitdem in denselben aber wieder zurückgekehrt, wie der Mensch ja zuweilen auf's Neue bei sich selbst Einkehr hält. Er hätte wohl auch damals besser gethan nachzugeben, und würde das zu thun gar nicht gezögert haben, wenn er ahnen konnte, was ihm die Zukunft vorbehielt. Doch es scheint unpassend, hier den Ereignissen vorzugreifen, welche sich im Verlaufe dieser Erzählung abspielen.
»Nun, Mynheer? begann Bruno, als Beide auf den Top-Hane-Platz kamen.
– Nun, Bruno?
– Da wären wir also in Constantinopel.
– Jawohl, Bruno, in Constantinopel, das heißt, viele Hundert Meilen von Rotterdam.
– Glauben Sie endlich, fragte Bruno, daß wir uns nun weit genug von Holland befinden?
– Ich kann davon niemals weit genug weg sein!« antwortete Van Mitten nur halblaut, als wäre Holland so nahe gewesen, um ihn hören zu können.
Van Mitten besaß in Bruno einen unter allen Verhältnissen treu ergebenen Diener. Aeußerlich ähnelte der brave Mann einigermaßen seinem Herrn – wenigstens so weit das die, jenem gebührende Ehrerbietung gestattete – eine Folge langjährigen Beisammenseins. Während voller zwanzig Jahre hatten sie sich wohl kaum einen einzigen Tag getrennt. War Bruno im Hause auch weniger als ein Freund, so galt er doch bestimmt mehr als ein bloßer Diener. Er erfüllte seine Pflichten mit Verstand und Methode und versagte sich keineswegs, gelegentlich guten Rath zu geben, aus dem Van Mitten hätte Nutzen ziehen können, oder selbst diesem gelinde Vorwürfe zu machen, welche sein Dienstherr ohne aufzubrausen entgegennahm. Vorzüglich wurmte es ihn, daß der Letztere für die Befehle aller Welt da zu sein schien, daß er den Wünschen Anderer niemals entgegentreten konnte, kurz, daß es ihm an Charakter fast gänzlich fehlte.
»Das wird noch Ihr Unglück sein, wiederholte er öfters, und meines natürlich mit!«
Wir müssen hier einfügen, daß der nun vierzigjährige Bruno etwas seßhafter Natur war und Ortsveränderungen nicht leiden konnte. Strengt man sich in dieser Weise an, so setzt man damit das ruhige Gleichgewicht des Organismus in Gefahr, man nützt sich ab, wird magerer, und Bruno, der sich jede Woche einmal wiegen zu lassen pflegte, hielt darauf, von seiner stattlichen Erscheinung nichts einzubüßen. Beim Eintritt in die Dienste des Herrn Van Mitten erreichte sein Gewicht nur hundert Pfund; er war also damals von einer, für ihn als Holländer demüthigenden Magerkeit. Dank der vorzüglichen Lebensweise hatte er nach kaum einem Jahre um dreißig Pfund zugenommen und konnte sich nun ohne Erröthen überall sehen lassen. Seinem Brotherrn verdankte er endlich die jetzige hübsche Abrundung, die hundertsechzig Pfund Körpergewicht – was ihm unter seinen Mitbürgern etwa eine mittlere Stellung anwies. Man muß übrigens bescheiden sein, und so hatte er sich auch erst für seine alten Tage vorgenommen, zweihundert Pfund zu erreichen.
Bei der innigen Anhänglichkeit an sein Haus, an seine Vaterstadt und sein Heimatland – jenes der Nordsee abgerungene Niederland – würde sich Bruno ohne höchst zwingende Gründe niemals entschlossen haben, die behagliche Wohnung am Nieuve-Haven, die gute Stadt Rotterdam, in seinen Augen überhaupt die erste Stadt Hollands, oder gar letzteres selbst zu verlassen, das ihm gewiß als das schönste Königreich der Erde galt.
Ja, gewiß nicht; und dennoch ist es ebenso wahr, daß sich Bruno an jenem Tage in Constantinopel, dem alten Byzanz, dem Istambul der Türken, in der Hauptstadt des ottomanischen Reiches befand.
Was war denn übrigens Van Mitten? – Nichts anderes als ein reicher Kaufmann in Rotterdam, ein Tabakshändler und Importeur der feinsten Erzeugnisse der Habana, wie der von Maryland, Virginia, von Varinas und Porto-Rico, insbesondere auch der von Macedonien, Syrien und Kleinasien überhaupt.
Seit zwanzig Jahren schon machte Van Mitten umfängliche Geschäfte dieser Art mit dem Hause Keraban in Constantinopel, welches seine renommirten und garantirten Tabake nach allen fünf Erdtheilen versendete. Durch den vielfachen Schriftenwechsel mit dem bedeutenden Comptoir hatte sich der holländische Kaufmann eine gründliche Kenntniß der türkischen Sprache, das heißt des Osmanli, angeeignet, welches durch das ganze Reich in Gebrauch ist, so daß er dasselbe wie ein leibhaftiger Unterthan des Padischah oder ein Minister des »Emir-el-Mumenin«, des Oberherrn der Gläubigen, handhabte. Aus reiner Sympathie sprach es auch Bruno, der seines Herrn Geschäftsthätigkeit, wie oben gesagt, von jeher nahe stand, ebenso geläufig wie dieser.
Die beiden originellen Leutchen waren sogar dahin übereingekommen, sich der türkischen Sprache nach ihrer Ankunft in der Türkei auch in der persönlichen Unterhaltung bedienen zu wollen. Und wirklich hätte man sie, abgesehen von ihrer Tracht, recht gut für zwei Osmanlis alten Schlages halten können. Uebrigens machte das nur Van Mitten Spaß, während es Bruno eigentlich mißfiel.
Dennoch unterließ es der gehorsame Diener nicht, jeden Morgen zu seinem Herrn zu sagen:
»Efendum, emriniz nè dir?«
Das bedeutet: »Mein Herr, was befehlen Sie?– Und der also Angeredete antwortete in gutem Türkisch:
»Sitrimi, pantalounymi fourtcha.«
Das bedeutet: »Bürste meinen Rock und meine Hose aus.«
Aus Obigem wird man die Ueberzeugung gewinnen, daß Van Mitten und Bruno sich in der so ausgedehnten Stadt Constantinopel, ohne in Verlegenheit zu kommen, überall bewegen konnten, erstens, weil sie sich in der Landessprache geläufig auszudrücken verstanden, und dann auch, weil sie eines freundschaftlichen Empfanges im Hause Keraban sicher waren, dessen Chef schon einmal eine Reise nach Holland gemacht und sich – eine häufige Wirkung greller Gegensätze – mit seinem Geschäftsfreunde in Rotterdam auf vertrautesten Fuß gestellt hatte. Das war eigentlich der Hauptgrund gewesen, um des willen Van Mitten, als er dem Vaterlande den Rücken kehrte, der Gedanke gekommen war, einmal in Constantinopel Aufenthalt zu nehmen, und um des willen auch Bruno, freilich zu seinem Leidwesen, sich hatte bestimmen lassen, ihn zu begleiten; und die Veranlassung endlich, daß jetzt beide auf dem Top-Hane-Platze umhergingen.
»Noch eine Stunde, sagte da ein Türke, dann wird die Sonne in den Fluthen des Bosporus erloschen sein, und dann...
– Dann können wir, fuhr ein Anderer fort, nach Herzenslust essen, trinken und, vor Allem, rauchen!
– Sie wird etwas langweilig, diese Ramadan-Fastenzeit.
– Wie jedes religiöse Fasten!«
Andererseits wechselten wieder zwei, vor einem Kaffeehause auf- und abgehende Fremde die Worte:
»Es sind doch wunderliche Leute, diese Türken! Wahrlich, wenn ein Fremder gerade während dieser langen Abstinenzzeit Constantinopel zum ersten Male sähe, er müßte eine traurige Vorstellung von der Hauptstadt Mohammed's gewinnen!
– Bah! meinte der Andere, London ist Sonntags auch nicht lustiger! Wenn die Türken tagsüber fasten, so entschädigen sie sich in der Nacht, und mit dem Kanonenschusse, der den Untergang der Sonne meldet, werden die Straßen mit dem Geruche gebratenen Fleisches, dem Dufte der Getränke und dem Rauche der Tschibuks und Cigaretten schon wieder das gewohnte Gesicht annehmen.«
Die Fremdlinge mußten wohl Recht haben, denn eben rief der Wirth des Kaffeehauses einem dienstbaren Geiste zu:
»Sorgt, daß Alles bereit ist! Nach einer Stunde werden die Fastenhalter herzuströmen, und dann weiß Einer nicht, wo er zuerst hinhören soll.«
Da nahmen die beiden Fremden ihr Gespräch wieder auf:
»Ich weiß es nicht, aber mir will's scheinen, als ob Constantinopel gerade zur Zeit des Ramadan am merkwürdigsten zu sehen wäre. Wenn die Tage da traurig, widerlich und kläglich sind, wie ein Aschermittwoch, so geht's während der Nächte desto lustiger, lauter und ausgelassener zu, wie an einem Faschings-Dienstage.
– Ja, es ist wirklich ein greller Unterschied.«
Und während diese Beiden ihre Gedanken austauschten, sandten ihnen wieder einige Türken ziemlich neidische Blicke zu.
»Was sie glücklich sind, diese Fremden! meinte der Eine. Sie können trinken, essen und rauchen, wie es ihnen gefällt!
– Gewiß, entgegnete der Andere; zur Stunde würden sie freilich weder ein Kebab von Lammfleisch, ein Pilaw von Huhn mit Reis, noch einen Baklavakuchen austreiben können – nicht einmal eine Schnitte Wassermelone oder Kürbis...
– Weil sie die richtigen Stellen nicht kennen! Mit einigen Piastern findet man stets bereitwillige Händler, welche von Mohammed II. Dispense besitzen.
– Bei Allah! sagte da einer der Türken, mir verdorren die Cigaretten in der Tasche, und es soll gar nicht beschworen sein, ob ich's nicht gern auf ein paar Paras von Latakieh ankommen lasse.«
Und auf die Gefahr hin, in Strafe genommen zu werden, holte dieser durch seine Glaubenssätze wenig genirte Gläubige eine Cigarette hervor, zündete sie an und that zwei oder drei herzhafte Züge.
»Nimm Dich in Acht! ermahnte sein Begleiter. Wenn ein etwas orthodoxer Ulema hier vorbeikäme, so...
– So würde ich den Rauch einfach verschlucken, und da sähe er nichts davon!« erwiderte lachend der Freidenker.
Beide setzten ihren Spaziergang fort, schlenderten über den Platz und dann nach einer der Nachbarstraßen, welche bis nach den Vorstädten Galata und Pera hinaufführen.
»Na, Mynheer, rief da Bruno, sich nach rechts und links umsehend, entschieden ist das eine sonderbare Stadt. Seit wir unser Hôtel verlassen, hab' ich nur Schatten von Einwohnern, nur Phantome von waschechten Constantinopolitanern entdeckt. Alles schläft auf den Straßen, den Quais und den Plätzen, selbst die gelben, spindeldürren Hunde, die nicht einmal aufstehen, um Einen in die Waden zu beißen. Nein, gehen Sie! Was die Reisenden Einem auch vorschwatzen mögen, seh' ich doch mehr und mehr, daß bei der Sache nichts herauskommt. Da lob' ich mir unsere gute Stadt Rotterdam und den grauen Himmel unseres alten Holland!
– Geduld, Bruno, Geduld! antwortete Van Mitten. Wir sind seit einigen Stunden hier angelangt. Ich gestehe indeß, daß das auch nicht das Constantinopel ist, welches ich mir vorgestellt hatte. Man bildet sich ein, in's richtige Morgenland zu kommen, einen Traum aus Tausendundeine Nacht verwirklicht zu finden, und sieht sich dafür tief eingepfercht in...
– In ein ungeheures Kloster, fuhr Bruno fort, versetzt unter Leute, welche ebenso griesgrämig aussehen, wie einsame Mönche in ihrer Zelle.
– Mein Freund Keraban wird uns schon erklären, was das Alles zu bedeuten hat, antwortete Van Mitten.
– Aber wo sind wir jetzt? fragte Bruno. Was für ein Platz und welcher Quai ist das?
– Wenn ich nicht irre, belehrte ihn Van Mitten, befinden wir uns auf dem Top-Hane-Platze, am äußersten Ende des Goldenen Horns. Hier ist der Bosporus, der die Küste Asiens bespült, und auf der anderen Seite des Hafens kannst Du die Serailspitze sehen und die eigentliche türkische Stadt, welche sich über derselben aufbaut.
– Das Serail! rief Bruno. Wie, der Palast des Sultans, in dem er mit seinen achtzigtausend Odalisken wohnt?
– Achtzigtausend! Das ist viel Bruno; ich glaube, es ist zu viel – selbst für einen Türken. In Holland hat man nur eine einzige Frau, und es ist da manchmal schwierig genug, in seinen vier Pfählen auszuhalten.
– Ja, ja, Mynheer, sprechen wir davon nicht mehr – lieber so wenig als möglich!«
Dann wendete sich Bruno dem noch immer leeren Kaffeehause zu.
»Ah, das scheint mir doch ein Café zu sein, sagte er. Wir haben uns mit dem Herabsteigen aus der Vorstadt Pera ganz abgemattet. Die Sonne der Türkei heizt Einem ein, wie die Mündung eines Gießofens, und ich würde nicht darüber staunen, von Mynheer zu vernehmen, daß Sie sich nach einer Erfrischung sehnten.
– Auch eine Art, auszudrücken, daß Du Durst hast, antwortete Van Mitten. – Meinetwegen, wir wollen in jenes Café gehen.«
Beide nahmen vor der Front des Etablissements an einem leeren Tischehen Platz.
»Cawadji!« rief Bruno, auf Europäerart klopfend.
Niemand erschien.
Bruno rief mit lauterer Stimme.
Der Inhaber des Cafés zeigte sich im Hintergrunde seines Locals, beeilte sich aber keineswegs, herauszukommen.
»Ein paar Fremde! murmelte er, die beiden am Tische sitzenden Männer erblickend. Sollten sie wirklich glauben, daß...«
Endlich kam er näher.
»Cawadji, bringen Sie uns eine Karaffe Kirschwasser, aber hübsch frisch! bestellte Van Mitten.
– Mit dem Kanonenschusse, antwortete der Cafétier.
– Was? Kirschwasser mit einem Kanonenschusse? rief Bruno. Nein, dann geben Sie uns lieber Pfefferminzwasser.
– Oder, wenn Sie Kirschwasser nicht hätten, sagte Van Mitten, so serviren Sie uns ein Glas rosa Rahtlokum. Das scheint, meinem Reisehandbuche nach, etwas Vorzügliches zu sein.
– Mit dem Kanonenschusse, wiederholte der Wirth, mit den Achseln zuckend.
– Aber was hat er nur mit seinem ewigen Kanonenschusse? fragte jetzt Bruno seinen Herrn in holländischer Sprache.
– Das werden wir ja sehen, antwortete dieser gemächlich. Nun, wenn Sie auch keinen Rahtlokum führen, so lassen Sie uns wenigstens eine Tasse Mokka zukommen – ein Glas Sorbet – was Sie wollen, guter Freund.
– Mit dem Kanonenschusse!
– Mit dem Kanonenschusse? wiederholte Van Mitten.
– Nicht eher!« antwortete der Cafétier.
Ohne weitere Umstände zog er sich wieder in die inneren Räumlichkeiten zurück.
»Ich bitte Sie, Mynheer, sagte da Bruno, wir wollen fortgehen; hier ist doch nichts zu machen. Sie haben ja den Spitzbuben von Türken gesehen, der Ihnen immer nur einen Kanonenschuß auf Ihre Fragen zur Antwort giebt.
– Komm, Bruno, antwortete Van Mitten, wir werden schon ein anderes Kaffeehaus finden, wo sich's mit dem Wirthe vernünftiger reden läßt.«
Beide kehrten nach dem Platze zurück.
»Entschieden, Mynheer, begann Bruno, ist es nicht mehr zu frühzeitig, daß wir Ihren Freund, den Seigneur Keraban, entdecken. Hätten wir ihn in seinem Comptoir angetroffen, so wüßten wir doch wenigstens, woran wir hier eigentlich sind.
– Ja wohl, Bruno, nur ein wenig Geduld. Man hat uns doch versichert, daß wir ihn auf diesem Platze treffen würden...
– Nicht vor sieben Uhr, Mynheer. Hier an der Ufertreppe von Top-Hane soll sein Kajik anlegen, um ihn nach der andern Seite des Bosporus, nach Scutari überzusetzen.
– Nun, Bruno, dieser hochachtbare Handelsherr wird uns schon über Alles, was hier vorgeht, aufklären. O, das ist ein richtiger Osmanli, ein getreuer Anhänger der alttürkischen Partei, welche sich weder in den Vorstellungen noch den Gebräuchen mit den thatsächlichen Verhältnissen zu befreunden vermag, gegen alle neuzeitlichen Erfindungen Einspruch erhebt; der Leute, die einen rumpelnden Postwagen jeder Eisenbahn, eine gebrechliche Tartane jedem Dampfschiffe vorziehen. Seit unserer, nun schon über zwanzig Jahre bestehenden Geschäftsverbindung habe ich noch nie bemerkt, daß die Anschauungen meines Freundes Keraban sich nur im geringsten geändert hätten. Als er vor drei Jahren in Rotterdam eintraf, um mich zu besuchen, kam er in einem Postwagen an und, statt einer Woche höchstens, hat er einen vollen Monat zur Fahrt hierher gebraucht. Siehst Du, Bruno, ich sah wohl in meinem Leben so manchen Trotzkopf, aber einen solchen Starrsinn wie den seinigen niemals!
– Er wird schön erstaunt sein, Sie hier in Constantinopel zu treffen, bemerkte Bruno.
– Ich glaub' es auch, antwortete Van Mitten, doch es machte mir eben Vergnügen, ihn zu überraschen. In seiner Gesellschaft aber werden wir uns erst wirklich in der Türkei befinden. O, mein Freund Keraban wird sich niemals bestimmen lassen, die Tracht des Nizam anzulegen, den einreihigen blauen Rock und das rothe Fez der Jungtürken zu tragen.
– Wenn sie ihr Fez abnehmen, meinte Bruno, sehen sie aus wie eine Flasche, die sich selbst entkorkt.
– O, dieser werthe, stets unwandelbare Keraban! fuhr Van Mitten fort; er wird noch ganz ebenso gekleidet sein, wie damals, als er mich am anderen Ende Europas aufsuchte, im weitbauchigen Turban, narzißgelben oder zimmetrothen Kaftan...
– Ein richtiger Dattelhändler, das! rief Bruno dazwischen.
– Ja, aber ein Dattelhändler, der goldene Datteln verkaufen und auch ebensolche bei jeder Mahlzeit verzehren könnte. Er hat sich wohlweislich den Handelszweig erwählt, der für sein Land am passendsten ist, den eines Tabakshändlers. Wie sollte Einer dabei nicht Schätze sammeln in einer Stadt, in der alle Welt vom Morgen bis zum Abend, nein, selbst noch vom Abend bis zum Morgen raucht!
– Was, hier würde so stark geraucht? fragte Bruno ungläubig. So zeigen Sie mir doch Leute, welche rauchen, Mynheer! Im Gegentheil, hier raucht ja keine Seele! Und ich – ich erwartete schon ganze Gruppen von Türken vor ihren Thüren gelagert und in die langen Schläuche ihrer Narghiles eingewickelt oder mit dem großen Weichselrohre in der Hand und an dem Bernsteinmundstücke saugend zu finden! Aber nein – keine Cigarre, nicht einmal eine Cigarette!
– Das ist freilich kaum zu begreifen, Bruno, gab Van Mitten zu; in der That sind die Straßen Rotterdams mehr von Tabaksrauch erfüllt, als die Constantinopels.
– Ja, sapperment, Mynheer, sagte Bruno, sind Sie sich denn auch gewiß, daß wir uns nicht im Wege geirrt haben? Ist das wirklich die Hauptstadt der Türkei? Können wir darauf wetten, nicht nach der entgegengesetzten Seite gefahren zu sein, und darauf, daß das hier das Goldene Horn und nicht vielleicht die Themse mit ihren Tausenden von Dampfern ist? Bedenken Sie, die Moschee da unten ist gar nicht die der heiligen Sophie, sondern höchst wahrscheinlich die Paulskirche. Das soll Constantinopel sein? – Nimmermehr! Das ist ja London!
– Halt' ein, Bruno, mahnte Van Mitten. Für ein Kind Hollands scheinst Du mir etwas zu nervöser Natur zu sein. Bleibe ruhig, geduldig, phlegmatisch wie Dein Herr, und erstaune über nichts zu sehr. Wir verließen Rotterdam infolge... nun, Du weißt's ja selbst.
– Ja... ja!... bestätigte Bruno den Kopf schüttelnd.
– Wir gingen über Paris, den Sanct Gotthardt, durch Italien nach Brindisi und über das Mittelmeer, und Du hast gar keinen Grund zu glauben, daß das Packetboot der Messageries uns nach achttägiger Ueberfahrt an der London-Bridge, und nicht an der Brücke von Galata abgesetzt hätte.
– Indeß... wendete Bruno ein.
– Ich empfehle Dir übrigens dringend, in Gegenwart meines Freundes Keraban von solchen Scherzen abzusehen. Er könnte sie sehr übel aufnehmen, sich weiter einlassen, seinen Starrkopf aufsetzen...
– Werde mir's merken, Mynheer! versprach Bruno; doch da man hier keine andere Herzstärkung haben kann, ist es doch, vermuthe ich, wenigstens gestattet, eine Pfeife Tabak zu rauchen. Sie erkennen darin doch keinen Verstoß?
– Nein, Bruno, mir als Tabakshändler ist nichts angenehmer, als die Leute rauchen zu sehen. Ich bedauere sogar, daß wir von der Natur nur mit einem einzigen Munde ausgestattet wurden. Freilich haben wir noch die Nase, Tabak zu schnupfen...
– Und die Zähne, um solchen zu kauen!« setzte Bruno hinzu.
Unter diesen Worten stopfte er schon seinen mächtigen buntbemalten Porzellankopf, zündete die Pfeife an und that mit sichtlicher Befriedigung daraus einige kräftige Züge.
Da erschienen eben wieder die beiden Türken, welche so energisch gegen die durch den Ramadan auferlegten Entbehrungen geeifert hatten, auf dem Platze. Gerade Der, der sich nicht genirte, seine Cigarette zu rauchen, bemerkte Bruno, als dieser mit der Pfeife im Munde dahinging.
»Bei Allah! rief er seinem Begleiter zu, da ist wieder einer jener verdammten Fremdlinge, der dem Gebote des Korans zu trotzen wagt. Ich werd' ihn eines Besseren belehren...
– Lösche wenigstens Deine eigene Cigarette, bemerkte ihm der Andere.
– Ja!«
Und die Cigarette wegschleudernd, ging er stracks auf den würdigen Holländer zu, der es sich nicht versah, wieder mit den Worten angeredet zu werden:
»Mit dem Kanonenschusse!« polterte der Türke heraus.
Gleichzeitig entriß er ihm hastig die Pfeife.
»He! Meine Pfeife! rief Bruno, den sein Herr vergeblich zu besänftigen suchte.
– Mit dem Kanonenschusse, Christenhund!
– Selbst Türkenhund!
– Ruhig, Bruno, sagte Van Mitten.
– Er soll mir wenigstens meine Pfeife wiedergeben! versetzte Bruno.
– Mit dem Kanonenschusse! wiederholte zum letzten Male der Türke, der die Pfeife in einer Falte seines Kaftans verschwinden ließ.
– Komm', Bruno, redete Van Mitten diesem zu, man darf die Sitten eines Landes, das man besucht, nicht verletzen.
– Die Sitten von Straßenräubern!
– Komm, sag' ich Dir. Mein Freund Keraban wird vor sieben Uhr nicht auf diesem Platze sein. Wir wollen unseren Spaziergang fortsetzen und ihn zu finden suchen, wenn es dazu Zeit ist.«
Van Mitten zog Bruno mit sich fort, der sehr ärgerlich war, so mir nichts dir nichts einer Pfeife beraubt worden zu sein, die er als Raucher besonders schätzte.
Und während sie weggingen, sagten die beiden Türken zu einander:
»Wahrlich, diese Fremden glauben sich Alles gestatten zu dürfen!...
– Aber auch vor Sonnenuntergang zu rauchen!
– Willst Du Feuer? fragte der Eine, eine neue Cigarette anzündend.
– Ja, gern!« antwortete der Andere.
Zweites Capitel. Wo der Intendant Scarpante und der Capitän Yarhud sich von Projecten unterhalten, deren Kenntniß für den Leser von Wichtigkeit ist.
Als Van Mitten und Bruno so am Quai von Top-Hane hinschlenderten und sich eben an der ersten Schiffsbrücke der Sultanin Valide befanden, welche Galata quer über das Goldene Horn mit dem alten Stambul in Verbindung setzt, kam ein Türke um die Ecke der Moschee Mahmud's und blieb dann auf dem Platze stehen.
Es war jetzt um sechs Uhr. Zum vierten Male im Laufe des Tages hatten die Muezzins die Gallerie jener Minarete erstiegen, deren jede von einem Kaiser gestiftete Moschee wenigstens vier hat. Feierlich erklang über der Stadt ihre Stimme, während sie die Gläubigen zum Gebete riefen und in's Freie ertönen ließen: »La Ilah il Allah ve Mohammed reconl Allah« (Es giebt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet!)
Der Türke sah sich vorsichtig um, faßte die wenigen Leute auf dem Platze scharf in's Auge und ging dann in der Achse einer der verschiedenen, hier mündenden Straßen weiter; offenbar bemühte er sich, unter deutlichen Zeichen von Ungeduld, zu sehen, ob nicht eine von ihm erwartete Person käme.
»Dieser Yarhud stellt sich auch niemals rechtzeitig ein, murmelte er, und weiß doch, daß er zur bestimmten Zeit hier sein soll!«
Noch mehrmals ging der Türke um den Platz herum, entfernte sich sogar bis zur nördlichen Ecke der Kaserne von Top-Hane, blickte in der Richtung der Kanonengießerei hinaus, stampfte mit dem Fuße, wie einer der ungern wartet, und kam endlich zurück bis nach dem Café, wo Van Mitten und sein Diener vergeblich eine Erfrischung zu erhalten versucht hatten.
Hier nahm der Türke ungenirt an einem der Tische Platz, ohne nach dem Cavadji zu verlangen; als gewissenhafter Beobachter der Fasten des Ramadan wußte er, daß die Stunde, von welcher ab die so verschiedenen Getränke der ottomanischen Destillation verabreicht werden, noch nicht gekommen war.
Dieser Türke war kein Anderer, als Scarpante, der Intendant des reichen Herrn Saffar, eines Ottomanen, der in Trapezunt, d. h. in dem Theil der asiatischen Türkei wohnte, welcher das südliche Ufer des Schwarzen Meeres bildet.
Eben jetzt bereiste Herr Saffar die südlichen Provinzen Rußlands; nach einem Besuche der Kaukasusländer gedachte er dann nach Trapezunt zurückzukehren, in der sicheren Erwartung, daß sein Intendant eine ihm aufgetragene Unternehmung inzwischen mit günstigem Erfolge werde ausgeführt haben. In seinem Palaste, der in der ganzen Pracht orientalischen Luxus' glänzte, in jener Stadt, wo man seine Equipagen allgemein bewunderte, sollte Scarpante nach Durchführung seiner Mission ihn wieder treffen. Herr Saffar hätte nie zugestanden, daß ein Mann, dem er befohlen, etwas zu thun, dabei einen Mißerfolg haben könne. Er liebte es, die Allmacht, welche ihm sein Reichthum verlieh, auf die schwierigsten Proben zu stellen, und verfuhr gewöhnlich mit jener Ostentation, welche den Nabobs Kleinasiens gleich im Blute zu liegen scheint.
Jener Intendant, ein waghalsiger Mann und als solcher zu jedem Handstreich bereit und vor keinem Hinderniß zurückschreckend, war stets entschlossen, per fas et nefas, auch die kleinsten Wünsche seines Herrn zu befriedigen. Aus ähnlicher Absicht traf er auch heute in Constantinopel ein und erwartete er an verabredeter Stelle einen gewissen, maltesischen Capitän, der seiner nach allen Seiten würdig war.
Dieser Capitän, Namens Yarhud, befehligte die Tartane »Guidare«, mit der er meist das Schwarze Meer befuhr.
Seinen Handel mit Contrebande verband er noch mit einem anderen, der das Licht eigentlich noch mehr zu scheuen hatte, nämlich einem solchen mit Sclaven aus dem Sudan, aus Aethiopien oder Aegypten, mit Circassierinnen oder Georgierinnen, welche vorzüglich in dem Stadttheile Top-Hane verkauft werden – übrigens ein Handel, dem gegenüber die Behörde gar zu gern ein Auge zudrückte.
Scarpante wartete noch immer, Yarhud aber kam nicht.
Obwohl der Intendant äußerlich ganz gelassen blieb und nichts seine Gedanken verrieth, brachte doch der innerliche Grimm sein Blut mehr und mehr in Wallung.
»Wo steckt er denn, der Hund? murmelte er. Sollte ihm ein Unfall zugestoßen sein? Vorgestern hat er aus Odessa abreisen wollen! Er mußte hier auf diesem Platz, in diesem Café und in der Minute hier sein, in der ich ihn zu treffen bestimmt hatte«...
In diesem Augenblicke erschien ein maltesischer Seemann an der Ecke des Quais. Das war Yarhud. Er blickte nach rechts und nach links und gewahrte jetzt Scarpante. Dieser erhob sich sogleich, verließ das Kaffeehaus und gesellte sich zu dem Capitän der »Guidare«, während einige Passanten – jetzt zwar in etwas größerer Anzahl, aber alle schweigend – sich hier und dorthin über den Platz bewegten.
»Ich bin nicht gewohnt, daß man mich warten läßt, Yarhud, sagte Scarpante in einem Tone, über den der Malteser nicht im Unklaren bleiben konnte.
– Möge Scarpante mir verzeihen, antwortete Yarhud, aber ich habe gewiß das Möglichste gethan, um rechtzeitig hier einzutreffen.
– So bist Du eben erst angekommen?
– Erst diesen Augenblick mit der Eisenbahn von Janboli nach Adrianopel, und ohne jede Zugsverspätung...
– Wann bist Du aus Odessa abgefahren?
– Vorgestern.
– Und Dein Schiff?
– Erwartet mich im Hafen von Odessa.
– Kannst Du Deinen Leuten trauen?
– Vollkommen! Es sind Malteser gleich mir, welche dem treu dienen, der freigebig bezahlt.
– Und sie werden Dir gehorchen?...
– Hierin, wie in Allem.
– Gut! Welche Nachrichten bringst Du, Yarhud?
– Ja, gleichzeitig gute und schlechte, erwiderte der Capitän achselzuckend.
– Wie lauten zunächst die schlechten? fragte Scarpante.
– Die schlechten... nun, dahin, daß die junge Amasia, die Tochter des Banquiers Selim zu Odessa, sich bald verheiraten soll. Ihre Entführung wird also mehr Schwierigkeiten bieten und verlangt jetzt größere Eile, als wenn ihre Vermählung noch nicht so bald bevorstände.
– Aus dieser Vermählung wird eben nichts werden, Yarhud! rief Scarpante etwas lauter, als es zweckdienlich schien. Nein, bei Mohammed, es darf nichts daraus werden.
– Ich habe nicht gesagt, daß dieselbe vor sich gehen werde, Scarpante, versetzte Yarhud, sondern nur, daß sie stattfinden sollte.
– Nun ja doch, erwiderte der Intendant, Herr Saffar erwartet jedoch, daß jenes junge Mädchen vor Ablauf von drei Tagen nach Trapezunt eingeschifft ist, und wenn Du das für unmöglich hieltest...
– Ich habe nicht gesagt, daß es unmöglich sei, Scarpante. Mit Muth und Geduld ist nichts unmöglich. Ich habe nur gesagt, daß es schwieriger sein werde, nichts weiter.
– Schwierig! antwortete Scarpante. Das wird auch nicht zum ersten Male sein, daß eine junge Türkin oder Russin aus Odessa verschwunden und nicht in das väterliche Haus zurückgekehrt wäre.
– Und es wird hier nicht zum letzten Male der Fall sein, erklärte Yarhud, oder der Capitän der »Guidare« müßte sein Geschäft nicht verstehen.
– Was für ein Mann ist es, den die junge Amasia heiraten soll? fragte Scarpante.
– Ein junger Türke, von dem nämlichen Stamme wie sie.
– Ein Türke aus Odessa?
– Nein, aus Constantinopel.
– Und er heißt?...
– Ahmet.
– Was ist dieser Ahmet?
– Der Neffe und einzige Erbe eines reichen Kaufmanns von Galata, des Seigneur Keraban.
– Was treibt dieser Keraban?
– Tabakhandel, bei dem er ein großes Vermögen erworben hat; in Odessa ist sein Correspondent der Banquier Selim. Sie machen miteinander sehr ausgedehnte Geschäfte und statten sich öfters Besuche ab. Bei einer solchen Gelegenheit hat Ahmet die junge Amasia kennen gelernt, und so ist die Verbindung zwischen dem Vater des jungen Mädchens und dem Onkel des jungen Mannes ausgemacht worden.
– Wo soll die Trauung vor sich gehen? fragte Scarpante. Hier in Constantinopel?
– Nein, in Odessa.
– Zu welcher Zeit?
– Das weiß ich zwar nicht, fürchte aber, daß sie auf Betreiben der jungen Ahmet jeden Tag stattfinden könne.
– Es ist also kein Augenblick zu verlieren.
– Kein einziger!
– Wo befindet sich Ahmet jetzt?
– In Odessa.
– Und jener Keraban?
– In Constantinopel.
– Hast Du während der Zeit zwischen Deiner letzten Ankunft in Odessa und Deiner Abreise von da den jungen Mann gesehen, Yarhud?
– Ich hatte ja ein Interesse daran, ihn zu kennen, Scarpante... Ich hab' ihn gesehen und kenne ihn.
– Wie ist er?
– O, ein junger Mann, der geschaffen ist zu gefallen und der der Tochter des Banquiers Selim auch gefällt.
– Ist er zu fürchten?
– Man nennt ihn muthvoll, entschlossen, und bei unserem Vorhaben, mein' ich, werden wir ihn nicht außer Rechnung lassen dürfen.
– Ist er unabhängig bezüglich seiner Stellung, seines Vermögens? fragte Scarpante, der alles diesen jungen Ahmet Betreffende, der ihm doch einige Unruhe einflößte, kennen zu lernen wünschte.
– Nein, Scarpante, antwortete Yarhud. Ahmet hängt von seinem Onkel und Vormund, dem Seigneur Keraban ab, der ihn wie einen Sohn liebt und sich aller Wahrscheinlichkeit nach sehr bald nach Odessa begeben wird, um die Verbindung zum Abschluß zu bringen.
– Ließe sich die Abreise dieses Keraban nicht verzögern?
– Ja, das wäre freilich das Beste und gewährte uns mehr Zeit zum Handeln. Doch wie sollten wir es anfangen?
– Es ist Deine Sache, das auszuklügeln, Yarhud, erklärte Scarpante; jedenfalls muß geschehen, was Seigneur Saffar wünscht, das heißt, die junge Amasia muß nach Trapezunt geschafft werden. Es ist ja nicht zum ersten Male, daß die Tartane »Guidare« für seine Rechnung das Schwarze Meer befährt, und Du weißt, wie er die ihm geleisteten Dienste belohnt....
– Gewiß, Scarpante.
– Seigneur Saffar hatte jenes junge Mädchen nur einen Augenblick in ihrer Wohnung zu Odessa gesehen; ihre Schönheit hatte ihn berückt, und sie wird sich nicht zu beklagen haben, das Haus des Banquiers Selim mit seinem Palast in Trapezunt vertauscht zu haben. Amasia wird also entführt, und wenn es nicht durch Dich geschieht, nun, so wird es ein Anderer übernehmen.
– Ich werd's ausführen, verlassen Sie sich auf mich, antwortete einfach der Maltesercapitän. Die schlimmen Neuigkeiten wissen Sie nun; jetzt hören Sie die bessern.
– Rede, erwiderte Scarpante, der, nachdem er einige Schritte hin und her gegangen war, wieder an Yarhud herantrat.
– Wenn die bevorstehende Vermählung es etwas erschwert, das junge Mädchen zu entfernen, fuhr der Malteser fort, da Ahmet kaum von ihrer Seite weicht, so bietet sie mir andererseits Gelegenheit, in das Haus des Banquiers Selim zu gelangen. Ich bin ja nicht allein Schiffsführer, sondern auch Händler. Die »Guidare« birgt eine reiche Ladung Seidenstoffe aus Brussa, Marder- und Zobelpelzwerk, glänzende Brocate, Schnüre und Besatz von den geschicktesten Goldspinnerinnen Kleinasiens und hundert andere Waaren, welche die Begehrlichkeit einer jungen Verlobten zu reizen vermögen. Gerade, wenn sie sich vermählen soll, wird die Versuchung sie leichter besiegen. Ich werde sie also an Bord locken, einen günstigen Wind benützen können, ehe Jemand von der Entführung etwas ahnt.
– Das scheint mir gut erdacht, Yarhud, antwortete Scarpante, und ich zweifle nicht, daß Du damit Erfolg hast. Aber sorge dafür, daß Alles in größter Heimlichkeit geschieht.
– Seien Sie ohne Sorge, versicherte Yarhud.
– An Geld fehlt es Dir nicht?
– Nein, daran wird mir's nie fehlen mit einem Auftraggeber wie Ihr Herr.
– Verliere keine Zeit! Nach vollzogener Trauung ist Amasia die Gattin Ahmets, erwiderte Scarpante, und Ahmets Frau erwartet Seigneur Saffar nicht in Trapezunt!
– Ich verstehe!
– Du wirst also, sobald die Tochter des Banquiers Selim bei Dir an Bord ist, auslaufen?...
– Gewiß, Scarpante, denn ich werde nicht eher vorgehen, als bis eine gute westliche Brise weht.
– Und wieviel Zeit brauchst Du, Yarhud, um von Odessa direct nach Trapezunt zu segeln?
– Unter Berücksichtigung der möglichen Verzögerungen, der im Sommer nicht seltenen Windstille und der häufiger wechselnden Winde auf dem Schwarzen Meere dürfte die Ueberfahrt wohl auf drei Wochen zu veranschlagen sein.
– Gut, erwiderte Scarpante; eben zu derselben Zeit werd' ich in Trapezunt zurück sein, und mein Herr wird auch nicht auf sich warten lassen.
– Ich hoffe noch vor Ihnen dort einzutreffen.
– Seigneur Saffar hat, das bemerke ich Dir, noch ausdrücklich vorgeschrieben, daß das junge Mädchen mit aller erdenklichen Rücksicht behandelt werden soll. Keine Rohheit, keine Gewalt, wenn sie erst bei Dir an Bord ist!...
– Sie wird respectirt werden, ganz wie es Seigneur Saffar wünscht, und ganz so, als wenn es ihm selbst gälte.
– Ich rechne auf Deinen Eifer, Yarhud.
– Er gehört ganz Ihnen, Scarpante.
– Und auf Deine Gewandtheit!
– Sicherer würde ich meiner Sache freilich sein, wenn diese Heirat etwas verzögert würde, und das könnte erreicht werden, wenn irgend ein Zwischenfall die unmittelbare Abreise des Seigneur Keraban verhinderte.
– Kennst Du ihn, diesen Händler?
– Seine Feinde, oder die, welche es werden wollen, muß man immer kennen, entgegnete der Malteser. So ist es auch nach der Ankunft hier meine erste Sorge gewesen, mich unter dem Vorwande von Geschäften nach seinem Comptoir in Galata zu begeben.
– Und da hast Du ihn gesehen?
– Nur einen Augenblick, doch das genügte, und...«
Da unterbrach sich Yarhud und trat eiligst näher zu Scarpante heran, dem er leise zuflüsterte:
»Ei, Scarpante, ein merkwürdiger Zufall und vielleicht ein glückliches Zusammentreffen!
– Was willst Du?
– Jener starke Mann, der dort in Begleitung seines Dieners die Straße von Pera herunterkommt...
– Das wäre er?
– Ja freilich, Scarpante, antwortete der Capitän. Halten wir uns bei Seite und verlieren wir ihn nicht aus den Augen. Ich weiß, daß er jeden Abend nach seiner Wohnung in Scutari zurückkehrt, und um zu erfahren, ob er demnächst abzureisen gedenkt, würde ich ihm, wenn nöthig, selbst auf die andere Seite des Bosporus folgen!«
Der Seigneur Keraban war, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, ein »Mann von großer Oberfläche« – körperlich wie geistig – zählte seinem Gesicht nach vierzig, seiner Corpulenz nach fünfzig und in Wahrheit fünfundvierzig Jahre; bei seiner imponirenden Gestalt zeichnete er sich durch ein höchst intelligentes Gesicht aus. Sein schon etwas grau schimmernder Bart mit zwei Spitzen, die er mehr kurz als lang hielt, die schwarzen, seinen, scharfen Augen mit lebhaftem Blick, welche selbst für die flüchtigsten Eindrücke ebenso empfänglich waren, wie die Schale einer Präcisionswage für den Unterschied eines Zehntel-Karat, ein mächtiges Kinn, seine, wenn auch nicht übermäßig ausgesprochene Adlernase, welche zu den Augen vortrefflich paßte, der Mund mit festgeschlossenen Lippen, die sich nur öffneten, um eine volle Reihe schöner weißer Zähne zu zeigen; die hohe gut gewölbte Stirn mit lothrechter Falte, einer richtigen Trotzkopf-Falte zwischen den beiden rabenschwarzen Augenbrauen – alles das zusammen verlieh ihm das eigenthümliche Aussehen eines originellen selbstbewußten Mannes, den man nicht leicht wieder vergessen konnte, wenn er auch nur einmal die Aufmerksamkeit eines Anderen erregt hatte.
Die Kleidung des Seigneur Keraban war die der alten Türken, welche noch der früheren Tracht aus der Janitscharenzeit treugeblieben sind: ein breiter, vorstehender Turban, weite, flatternde Beinkleider, die nach den »Pabüdj« zu herabfielen, eine ärmellose Weste verziert mit großen facettirten Knöpfen und mit seidenem Ausputz, der Gürtelshawl, der seinen wohlbeleibten Rumpf umschloß, und endlich der Kaftan, der in majestätischen Falten herabwallte. In dieser antiken Tracht fand sich also keine Spur europäischer Mode, und sie unterschied sich auf den ersten Augenblick von der Kleidung der Orientalen der neuen Epoche. Eben diese Tracht gilt als Abweisung der neuen Ideen, als Protest zu Gunsten der localen Färbung, welche mehr und mehr zu verschwinden droht, und als offener Widerspruch gegen die Erlässe des Sultans Mahmud, dessen allmächtiger Wille das moderne Costüm der Osmanlis vorgeschrieben hat.
Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß der Diener des Seigneur Keraban, ein Bursche von fünfundzwanzig Jahren, Namens Nizib, der so mager war, daß der Holländer Bruno sich darüber fast entsetzte, ebenfalls das alttürkische Costüm trug. Da er seinem Herrn, einen der starrsinnigsten Menschen, in keiner Weise entgegentrat, konnte er doch hierin nicht von ihm abweichen. Er war ein treuer Diener, dem es nur an eigenen Gedanken völlig fehlte. Meist sagte er schon im Voraus zu Allem ja und wiederholte unbewußt, wie ein Echo, das Ende der Phrasen des mächtigen Kaufherrn. Das war das beste Mittel, mit ihm stets einer Ansicht zu sein und sich gelegentlich harte Zurechtweisungen zu ersparen, welche Seigneur Keraban ziemlich verschwenderisch auszutheilen liebte.
Beide kamen also durch eine der engen schlauchartigen Gassen, die von den Vorstadt Pera herabführen, nach dem Platze von Top-Hane. Seiner Gewohnheit gemäß sprach Seigneur Keraban mit lauter Stimme, ohne sich darum zu kümmern, ob ihn Jemand hörte oder nicht.
»Zum Teufel, nein! sagte er. Mög' Allah mit uns sein, aber seit der Zeit der Janitscharen hatte Jedermann das Recht, wenn der Abend gekommen war, zu thun, was ihm beliebte. Nein, ich füge mich ihren neuen Polizeiordnungen nicht! Ich werde auf der Straße gehen ohne Laterne in der Hand, wenn mir das beliebt, und wenn ich in das erste beste Schlammloch stürzen oder mich von einem herrenlosen Hunde sollte in die Beine beißen lassen.
– Beine beißen lassen!... wiederholte Nizib.
– Du hast gar nicht nöthig, mir die Ohren mit Deinen dummen Warnungen zu belästigen, oder bei Mohammed, ich verlängere die Deinigen, daß Dich jeder Esel sammt seinem Großvater darum beneiden soll!
– Darum beneiden soll!... antwortete Nizib, dem es übrigens kaum in den Sinn gekommen war, sich mit einer Warnung aufzudrängen.
– Und wenn der Polizeipräfect mich in Strafe nimmt, fuhr der trotzige Mann fort, so werd' ich eben die Strafe bezahlen. Verurtheilt er mich zu Gefängniß – gut, so gehe ich in's Gefängniß; aber es fällt mir, in diesem Punkte wie in jedem andern, gewiß nicht ein, nachzugeben!«
Nizib machte ein Zeichen der Zustimmung. Er war bereit, seinen Herrn in's Gefängniß zu begleiten, wenn es so weit kam.
»Ah, diese Herren Jungtürken! rief Seigneur Keraban, als er eben ein paar Constantinopolitaner in schwarzem Rocke und mit dem rothen Fez auf dem Kopfe vorübergehen sah. Ah, Ihr wollt uns Gesetze geben, wollt mit den alten Gewohnheiten brechen! – Nun wohlan, und wenn ich allein übrig bleiben sollte, ich erhebe Einspruch!... Nizib, hast Du meinem Kajiktschi gesagt, sich um sieben Uhr an der Terrasse von Top-Hane einzufinden?
– Um sieben Uhr!
– Warum ist er noch nicht da?
– Ja, warum wird er noch nicht da sein?
– Aha, weil es eben noch nicht sieben Uhr ist.
– Nein, es ist noch nicht sieben Uhr.
– Woher weißt Du das?
– Ich weiß es, weil Sie es sagen, Herr!
– Und wenn ich sagte, es wäre fünf Uhr?
– Dann würde es auch um fünf Uhr sein, antwortete Nizib.
– Nein, es giebt doch keinen dümmeren Menschen!
– Keinen dümmeren Menschen.
– Dieser Kerl, murmelte Keraban, wird mich noch wüthend machen damit, daß er nie eine andere Meinung hat!«
Eben erschienen Van Mitten und Bruno wieder auf dem Platze, und Bruno sagte mit dem Tone schwerer Enttäuschung:
»Nein, ziehen wir unseres Wegs, Herr; lassen Sie uns fortgehen und mit dem ersten Zuge reisen! Das soll Constantinopel sein, die Hauptstadt des Oberherrn der Gläubigen? – Nimmermehr!
– Nur ruhig, Bruno, ruhig!« antwortete Van Mitten.
Es wurde jetzt allmählich Abend. Die hinter den Anhöhen des alten Stambul verborgene Sonne ließ den Platz von Top-Hane schon in einer Art Helldunkel. Van Mitten erkannte deshalb den Seigneur Keraban nicht gleich, als dieser sich mit ihm auf dem Wege nach dem Quai von Galata kreuzte. Der Zufall wollte es auch, daß die beiden Männer, da sie gerade in verschiedener Richtung gingen, an einander stießen, indem sie gleichzeitig nach
rechts und wieder nach links ausweichen wollten. Diese Hin- und Herbewegung, welche eine halbe Minute dauerte, hatte einen fast lächerlichen Anstrich.
»Nun, mein Herr, rief Keraban, der nicht dazu angethan war, nachzugeben, Sie werden mich durchlassen.
– Ja, aber... erwiderte Van Mitten, der höflich zur Seite wich, um Platz zu machen, aber aus dem eben angegebenen Grunde nicht dazu kam.
– Ich werde doch vorwärts gehen...
– Ja wohl, aber«...
Plötzlich rief er, den, mit dem er zu thun hatte, erkennend:
»Ah mein Freund Keraban!
– Sie... Sie, Van Mitten, erwiderte Keraban höchst erstaunt, Sie hier in Constantinopel?
– Wie Sie sehen.
– Seit wann?
– Seit diesem Morgen.
– Und Sie haben nicht zuerst mir, mir einen Besuch abgestattet?
– Im Gegentheil, ich bin bei Ihnen gewesen, erklärte der Holländer. Ich begab mich sofort nach Ihrem Comptoir, traf Sie daselbst aber nicht an und hörte nur, daß Sie um sieben Uhr Abends nach diesem Platze kommen würden...
– Womit meine Leute ganz Recht hatten, Van Mitten, rief Keraban, indem er mit einer Heftigkeit, die schon mehr an Gewalt grenzte, die Hand seines Correspondenten aus Rotterdam drückte. Ah, mein lieber Van Mitten, nie, nein, niemals hätte ich erwartete Sie in Constantinopel zu sehen!... Warum haben Sie mir nicht geschrieben?
– Ich bin aus Holland sehr plötzlich abgereist
– Eine Geschäftsreise?
– Nein... eine Tour... zum Vergnügen! Bisher kannte ich ja weder Constantinopel, noch die Türkei überhaupt, und ich beabsichtigte gleichzeitig, Ihnen für Ihren Besuch, den Sie mir in Rotterdam gemacht, einen Gegenbesuch abzustatten.
– Das ist schön von Ihnen!... Aber es scheint mir, ich sehe Frau Van Mitten nicht mit Ihnen?
– Freilich... ich habe sie nicht mitgebracht, gestand der Holländer nicht ohne einiges Zögern. Meine Frau geht nur ungern von zu Hause fort; so bin ich mit meinem Diener Bruno allein gekommen!
– Aha, mit diesem Burschen, sagte Seigneur Keraban, eine leichte Handbewegung gegen Bruno machend, der sich nach türkischer Sitte verneigen zu müssen glaubte und seine beiden Arme wie die Henkel einer Vase nach dem Hute ausstreckte.
– Jawohl, antwortete Van Mitten, dieser wackere junge Mann, der mich schon verlassen und zurückreisen wollte...
– Zurückreisen? rief Keraban. Zurückreisen, ohne von mir dazu Erlaubniß zu haben?
– Ja, Freund Keraban. Er findet diese Hauptstadt des ottomanischen Kaiserreichs weder sehr unterhaltend, noch sehr belebt.
– Das richtige Mausoleum! ließ sich Bruno vernehmen. Kein Mensch in den Läden!... Kein Wagen auf Straßen und Plätzen!... Nur Schattengestalten, welche durch die Straßen eilen und Einem auch noch die Pfeife rauben.
– Ja, so ist's wohl während des Ramadan, Van Mitten, antwortete Seigneur Keraban, und wir sind jetzt mitten im Ramadan.
– Ah so, das nennt man Ramadan? fiel Bruno ein. Nun erklärt sich ja Alles! – Doch bitte, was ist denn das, dieser Ramadan?
– Eine Zeit des Fastens und der Enthaltsamkeit, belehrte ihn Keraban. Während der Dauer desselben ist es zwischen Auf- und Untergang der Sonne verboten zu rauchen, zu trinken und zu essen. Nach Verlauf einer halben Stunde aber, sobald der Kanonenschuß das Ende des Tages verkündet...
– Aha, da haben wir ja, was sie mit ihrem Kanonenschuß meinten, rief Bruno.
– Dann wird sich Alles die ganze Nacht hindurch für die Entbehrung des Tages schadlos halten.
– Also haben Sie, wandte Bruno sich an Nizib, weil jetzt Ramadan ist, seit diesen Morgen noch keinen Bissen genossen?
– Noch keinen Bissen genossen, bestätigte Nizib.
– Sapperment, da würd' ich bald gehörig abmagern! Das kostete mir jeden Tag ein Pfund Leibesgewicht – mindestens ein Pfund.
– Mindestens, stimmte Nizib zu.
– Nun sollen Sie aber sehen, wenn die Sonne untergegangen ist, Van Mitten, nahm Keraban das Wort, da werden Sie große Augen machen! Dann ändert sich Alles wie mit einem Zauberschlage, der aus einer todten Stadt eine lebende macht. Ah, Ihr Herren Jungtürken, diese guten alten Sitten habt Ihr mit Euren albernen Neuerungen doch nicht beseitigen können! Der Koran hält schon solchen Dummheiten die Stange! Möge Mohammed Euch erdrosseln!
– O, Freund Keraban, meinte Van Mitten, ich sehe, daß Sie den alten Gewohnheiten noch vollkommen treu geblieben sind.
– Das ist mehr als Treue, Van Mitten, das grenzt schon an Trotz! – Doch, sagen Sie mir, werther Freund, Sie werden doch einige Tage in Constantinopel verweilen, nicht wahr?
– Ja... das heißt...
– Schon gut, Sie gehören mir! Ich lege Beschlag auf Ihre Person! Sie werden mich nicht mehr verlassen.
– Gut, ich gehöre Ihnen.
– Und Du, Nizib, wirst für den Burschen da Sorge tragen, setzte Keraban mit einem Hinweis auf Bruno hinzu. Ich beauftrage Dich vor Allem, seine Vorstellungen über unsere wundervolle Hauptstadt zu ändern.«
Nizib gab ein Zeichen der Zustimmung und zog Bruno mitten in die Menschenmenge, welche immer dichter wurde.
»Halt, da fällt mir etwas ein, rief plötzlich Seigneur Keraban, Sie kommen gerade zur rechten Zeit, Van Mitten. Sechs Wochen später hätten Sie mich nicht mehr in Constantinopel getroffen.
– Sie, Keraban?
– Ja, mich; ich wäre dann nach Odessa abgereist.
– Nach Odessa?
– Nun, wenn Sie dann noch hier sind, reisen wir natürlich zusammen. Ja, wahrlich, ich sehe gar nicht ein, warum Sie mich nicht begleiten sollten.
– Das heißt... stotterte Van Mitten.
– Sie werden mich eben begleiten, sage ich Ihnen!
– Ich dachte allerdings, von der etwas schnell zurückgelegten Reise mich hier zu erholen...
– Ganz recht! Sie ruhen hier aus!... Nachher ruhen Sie wieder in Odessa aus, drei volle Wochen lang.
– Freund Keraban...
– Alles abgemacht, Van Mitten. Ich denke doch, daß Sie nicht die Absicht haben, mir schon am ersten Tage Ihres Hierseins zu widersprechen? Sie wissen ja, wenn ich Recht habe, gebe ich nicht so leicht nach.
– Ja... das weiß ich!... erwiderte Van Mitten.
– Uebrigens, fuhr Keraban fort, kennen Sie meinen Neffen Ahmet noch gar nicht, und dessen Bekanntschaft müssen Sie doch nothwendig machen.
– Sie haben mir zwar von Ihrem Neffen gesprochen...
– Besser, von meinem Sohne, Van Mitten, da ich ja keine Kinder habe. Sie wissen, die Geschäfte... O, die Geschäfte!... Ich habe keine fünf Minuten Zeit gefunden, mich zu verheiraten.
– Dazu genügt schon eine Minute, bemerkte Van Mitten sehr ernst, und zuweilen ist schon eine Minute zu viel!
– Sie werden Ahmet in Odessa treffen, sagte Keraban. Ein prächtiger Junge!... Vom Geschäft will er zwar nicht viel wissen, ist so ein Stückchen Künstler und ein Stückchen Dichter... Aber ein prächtiges Kerlchen! Seinem Onkel gleicht er nicht im Geringsten und tritt ihm niemals entgegen.
– Freund Keraban...
– Schon gut! Schon gut! Zur Feier seiner Hochzeit gehen wir eben nach Odessa.
– Seiner Hochzeit?
– Ja, freilich. Ahmet heiratet ein hübsches Mädchen... die junge Amasia... die Tochter meines Banquiers Selim, eines reichen Türken, wie ich. Da wird es schöne Feste geben. Das muß herrlich werden! Sie sind natürlich dabei!
– Aber... ich hätte vorgezogen... stammelte Van Mitten, der noch einen letzten Einwurf machen wollte.
– Ist schon Alles abgemacht! erklärte Keraban. Es wird Ihnen doch nicht in den Sinn kommen, sich wider mich auflehnen zu wollen?
– Ich möchte nur... antwortete Van Mitten.
– Ach was, Sie werden's aber nicht können!«
In diesem Augenblicke näherten sich Scarpante und der Maltesercapitän, welche weiter in der Mitte des Platzes gestanden hatten.
Seigneur Keraban sagte eben zu seinem Gastfreunde:
»Abgemacht! Binnen höchstens sechs Wochen reisen wir Beide nach Odessa!
– Und die Hochzeit findet statt...? fragte Van Mitten.
– Sobald wir daselbst angelangt sind,« antwortete Keraban.
Yarhud hatte sich nach Scarpante's Ohr geneigt.
»Sechs Wochen, da haben wir ja hinlänglich Zeit!
– Ja, aber je eher Alles abgemacht ist, desto besser, antwortete Scarpante. Vergiß nicht, Yarhud, daß Seigneur Saffar vor Ablauf von sechs Wochen in Trapezunt zurück sein wird.«
Beide gingen dann wieder mit lauerndem Auge und gespanntem Ohre auf und ab.
Inzwischen plauderte Seigneur Keraban mit Van Mitten weiter und sagte:
»Mein Freund Selim, der's immer eilig hat, und mein Neffe Ahmet, der vielleicht noch ungeduldiger ist, wollten die Hochzeit unverzüglich feiern. Ich muß wohl zugeben, daß sie dafür einen gewissen Grund haben. Selim's Tochter muß nämlich vor vollendetem siebzehnten Lebensjahre vermählt sein, oder sie verliert die Kleinigkeit von hunderttausend türkischen Pfunden (– 1,800.000 Mark^ welche eine alte verrückte Tante ihr nur unter jener Bedingung testamentarisch ausgesetzt hat. Siebzehn Jahre alt wird sie aber erst nach sechs Wochen. Ich habe den Leutchen auch den Kopf zurecht gesetzt und gesagt: »Ob's Euch nun recht ist oder nicht, die Hochzeit wird vor Ende des kommenden Monats doch nicht stattfinden.«
– Und Ihr Freund Selim hat sich gefügt? fragte Van Mitten.
– Das versteht sich.
– Und der junge Ahmet?
– Der nicht so leicht, antwortete Keraban. Er betet die hübsche Amasia an; ich habe nichts dagegen; er hat ja Zeit genug dazu. Geschäftlich ist er nicht in Anspruch genommen. Nun, Sie müssen so etwas ja begreifen, Freund Van Mitten, Sie haben ja einmal die schöne Frau...
– Ja, ja, Freund Keraban, unterbrach ihn der Holländer. Das ist aber schon lange her... so lange, daß es kaum der Mühe lohnt, mich daran zu erinnern.





























