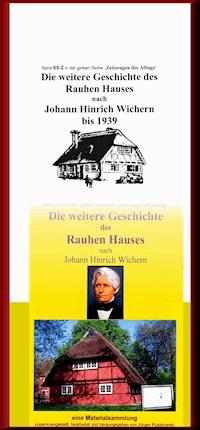Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Nach dem verlorenen 2. Weltkrieg und dem Zusammenbruch der verbrecherischen Hitler-Diktatur, nach dem Verlust der Heimat, von Hab und Gut suchten die Menschen in dem schrecklichen Chaos nach Halt und Sinn. Viele sahen in dem gerade Erlebten ein Gottesgericht. Man besann sich auf tiefere Werte, die Kirchen füllten sich. Hier fand man Trost und Hoffnung. Aber das gefiel den neuen Herren von Stalins Gnaden nicht. Laut Karl Marx war ja Religion Opium fürs Volk. Als Jugendlicher fand auch der Herausgeber dieser Anthologie im Nachkriegs-Mecklenburg seinen Weg zur Kirche und erlebte – wie auch die anderen Autoren – den Kampf der atheistischen Staatspartei unter Ulbricht und der Honnecker-FDJ gegen die junge Gemeinde der Kirche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Ruszkowski
Kirche im Nachkriegs-Mecklenburg um 1950-60
Berichte zur Zeitgeschichte - Anthologie - Band 72 in der gelben Reihe "Zeitzeugen des Alltags"
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Landesjugendpastor Friedrich Franz Wellingerhof – Schwerin
Arvid Schnauer: Junge Gemeinde in Schwerin
Jürgen Ruszkowski: Mein Weg zur Kirche
Propst Otto Münster berichtet über Grevesmühlen ab 1945
Wilhelm Gasse: Dank an Mecklenburg
Jochen Stopperam: Junge Gemeinde in Schwerin um 1953
Weitere Informationen
Maritime gelbe Buchreihe „Zeitzeugen des Alltags“
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Zu den von mir bevorzugt gelesenen Büchern gehören Dokumentationen zur Zeitgeschichte und Biographien.
Menschen und ihre Geschichte sind immer interessant.
Seit etwa zwei Jahrzehnten sammle ich Zeitzeugenberichte, zunächst von Seeleuten, mit denen ich über Jahrzehnte in meinem Beruf als Diakon und Dipl.-Sozialpädagoge in einem Seemannsheim täglichen Kontakt hatte. So kam es, dass ich in etlichen Bänden Lebensläufe und Erlebnisberichte von Fahrensmännern aufzeichnete und zusammenstellte.
Menschenschicksale sind immer interessant und aufschlussreich, und wir können viel aus dem Erleben unserer Mitmenschen lernen.
Nach dem verlorenen 2. Weltkrieg und dem Zusammenbruch der verbrecherischen Hitler-Diktatur, nach dem Verlust der Heimat, von Hab und Gut suchten die Menschen in dem schrecklichen Chaos nach Halt und Sinn. Viele sahen in dem gerade Erlebten ein Gottesgericht. Man besann sich auf tiefere Werte, Die Kirchen füllten sich. Hier fand man Trost und Hoffnung. Aber das gefiel den neuen Herren von Stalins Gnaden nicht. Laut Karl Marx war ja Religion Opium fürs Volk.
Als Jugendlicher fand auch ich im Nachkriegs-Mecklenburg meinen Weg zur Kirche und erlebte den Kampf der atheistischen Staatspartei unter Ulbricht und den Honneckers gegen die junge Gemeinde der Kirche.
Neben meinen eigenen Erinnerungen kommen in diesem Band die aufschlussreichen Berichte einiger Zeitzeugen der 1950er Jahre zu Wort. Den Autoren sei Dank für Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung.
Hamburg, im Mai 2014, Jürgen Ruszkowski
Landesjugendpastor Friedrich Franz Wellingerhof – Schwerin
Zeitzeugen-Bericht von Elisabeth Wellingerhof
Schweriner Dom
Die Monatsrüste war zuende. Wir hatten wie an jedem 1. Tag des Monats mit über 300 Jugendlichen im Halbkreis um den Altar des Schweriner Doms gestanden, uns die Hände gereicht und gesungen „Herr, wir stehen Hand in Hand“, als unsere Jugendleiterin O.A. uns 17-jährige Mädchen zusammenholte und uns erzählte: „Pastor Wellingerhof, unser Landesjugendpastor, hat zum 1. Mal ein Sommerlager für 15-17jährige Jungen geplant, er hat 65 Anmeldungen und die sowjetische Militärkommandantur hat es verboten. Ich bitte Euch, betet für diese Freizeit, denn P.W. hält sie für so wichtig, dass er sie auf alle Fälle durchziehen will.“
Und wir haben gebetet – vielleicht tat ich es mehr als die anderen – ich wusste noch nicht, dass ich ein gutes Jahr später die Frau des Landesjugendpastors sein würde – und die Sache ging gut.
Als ich meinen späteren Mann dann fragte, ob er keine Angst gehabt hätte, schließlich gab es noch Verbannung nach Sibirien oder andere schlimme Strafen, meinte er, das sei sicher der Fall gewesen, aber das half nichts. Freizeiten wären für ihn unverzichtbar für kirchliche Jugendarbeit, da ging es ums Ganze.
Pastor Wellingerhof
Aber, ich denke, ich erzähle der Reihe nach, so, wie ich es erlebt habe oder wie mein Mann es mir erzählt hat.
Mein Mann war vorher 6 Jahre Soldat gewesen, davon 4 Jahre Sanitäter in Russland. Er erzählte von endlosen Märschen bei sommerlicher Hitze und bei minus 40 Grad Kälte. Er hatte viele Nächte in Gräben und Bunkern, die unter Beschuss standen, verbracht, war verwundet und in Todesgefahr gewesen. Er hatte es nicht fassen können, dass er sich 1945 tatsächlich gesund in Hannover wiederfand und schrieb seine Bewahrung der betenden Mutter zu.
Als der mecklenburgische Landesbischof ihm 1946 schrieb und ihn bat, die Jugendarbeit im Lande zu übernehmen, war dies für ihn der Ruf Gottes. Er selbst war als Junge im Rostocker Schülerbibelkreis (B.K.) gewesen, hatte während des Theologiestudiums einen Jugendkreis dort geleitet, hatte nach dem Krieg ein Jahr lang die Schülerarbeit in Hannover aufgebaut und wusste, wie wichtig die kirchliche Arbeit mit und an der Jugend ist.
So kam er heimlich über die Grenze in die damalige „Ostzone“, die noch geprägt war von dem Zusammenbruch und von Hunger und von plötzlichen Verhaftungen durch die sowjetische Militärbehörde. Der kirchlichen Jugendarbeit begegnete man mit großem Misstrauen. Ein Kommandant sagte einmal sehr böse: „Du sollst mit Jungen beten, nicht baden“, als es um eine Freizeit ging. Trotzdem wollte mein Mann wirken „solange es geht“.
Die erste Unterkunft, die Schwerin ihm bieten konnte, war ein Lagerraum der Bibelgesellschaft. Dort wurde eine Matratze auf einige Bücher gelegt und etwas frei geräumt, der Raum aber war nicht heizbar.
Später wurde ihm ein möbliertes Zimmer von einem Sekretär angeboten, der im Gericht arbeitete und auf Anfrage sogar bereit war, nach Feierabend einige Schreibarbeiten für meinen Mann zu machen.
Es konnte keiner ahnen, wieviel Schwierigkeiten dies mit sich bringen sollte. Denn als Herr I. zwei Monate später, am 24.12. vormittags zum Dienst ging, schloss man plötzlich hinter ihm ab. Man bedrohte ihn und nötigte ihn, er solle den Landesjugenpastor bespitzeln, täte er das nicht, könne er das Weihnachtsfest im Zuchthaus verbringen. Ihm schien kein anderer Ausweg, als zu unterschreiben. Zitternd erzählte er dies, trotz scharfen Verbots, einige Tage später meinem Mann und fragte, was er tun solle.
Beide fanden einen Kompromiss: Mein Mann diktierte ihm wöchentlich harmlose Briefe an irgendwelche Leute oder Gemeinden. Herr B. nahm diese Texte auf neuen Blaubogen mit zum Dienst. Er wurde dafür sehr gelobt und bekam monatlich einen Zentner Briketts dafür, damals ein Vermögen, das sich beide teilten.
Mein Mann hat mir diese Geschichte erst viele, viele Jahre später erzählt und sagte dann: „Eigentlich konnte mir ja nichts besseres passieren, als meinen Spitzel zu kennen.“ Trotzdem musste er regelmäßig beim sowjetischen Militärkommandanten erscheinen, um über seine Arbeit zu berichten. Am liebsten wollte der ihm alle Veranstaltungen verbieten, die nicht gottesdienstliche Formen hatten. Mein Mann konnte dann an die Nazizeit erinnern und noch Gestapovorladungen aus der Zeit der Bekennenden Kirche in Rostock vorzeigen und ihn damit verunsichern. Wenn er nicht zu diesen „Vorladungen“ einen Lutherrock angezogen hätte, um auf diese Weise an einen Popen zu erinnern, wäre er wohl als Mann der Kirche gar nicht ernst genommen worden. Trotzdem machte er völlig gelassen und fröhlich weiter: „Wirken, solange noch Zeit ist.“
Zunächst war der Schwerpunkt seiner Arbeit, zumindest an den Wochentagen, Schwerin. Er bat die Pastoren dort, in den Konfirmandenstunden zum Jugendkreis einladen zu dürfen und hatte bald mehrere Gruppen der 12-14jährigen, machte offene Abende für ältere Jugendliche, Kreise für konfirmierte Jungen (Mädchen wurden in fast jeder Gemeinde von Gemeindehelferinnen des Burckhardthauses gesammelt), er übte Laienspiele ein und fasste alle Schweriner Jugendarbeit zusammen in der Monatsrüste, die an jedem 1. des Monats 19:00 Uhr stattfand.
Sonnabends und Sonntags fuhr er mit dem Zug in Städte und Dörfer des Landes; dort hielt er Jugendsonntage und machte durch Kinder-, Jugend- und Gemeindeveranstaltungen Mut zur regelmäßigen Arbeit mit der Jugend.
Ich muss mich fast wundern, dass er bei aller Beanspruchung einen Termin für unsere Hochzeit fand, die unter großer Beteiligung der Jugend in der Schelfkirche stattfand.
Zehn Tage danach fuhr ich als Köchin zu einer Freizeit mit. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie man und wieviel man für 40 Jungen kocht, aber ich fand gute Beratung und vor allem Kartoffeln und Gemüse im Pfarrhaus. Die Jungen halfen beim Schälen und Putzen, es machte Spaß. Dies war eine besondere Rüstzeit. Es waren hierzu konfirmierte Jungen aus ganz Mecklenburg eingeladen, die sich mit dem Gedanken trugen, in den kirchlichen Dienst zu treten. Sie kamen zweimal im Jahr meist in Dobbertin zusammen und waren später unter dem Namen „Dobbertiner Bruderschaft“ bekannt. Aus diesem Kreis ging fast eine ganze Pastorengeneration in Mecklenburg hervor.
Die zweite Freizeit, die ich kennenlernte und die mich sehr beeindruckte, war ein Zeltlager der 12-14 jährigen Jungen im Ostseebad Graal-Müritz. „Die Kreuzfahrer“, so hieß diese Elitegruppe, hatten mich für einen Tag dorthin eingeladen. Ich fand die 35 Jungen mit meinem Mann 5 km vom Ort entfernt in den Dünen, am Rande des Moores. Die Zelte waren einfach in den Sand gebaut, da sparte man Luftmatratzen und Gummiboden (beides gab es noch nicht). Kartoffeln kochten sie mit dem Salzwasser der Ostsee, Kaffee mit Moorwasser, das durch ein Tuch gegossen wurde.
Bibelarbeit, der wichtigste Teil jeder Freizeit, fand hier im Dünensand statt. Nachmittags spielten wir und machten Olympiade am und im Wasser.
Die Jungs hatten sich mir vorgestellt als „Mose“ (er hatte keine Schuhe zum Gottesdienst angezogen und sich dabei auf Mose berufen), „Kluten“, er mochte die Kluten so gern in der morgendlichen Trockenmilchsuppe, „Obadja“, er sagte gern das Wetter voraus, da es nur selten stimmte, war er nur einer der kleinen Propheten. Einer wurde gerade ausgelacht, er hatte den Einladezettel zur Freizeit gut gelesen und Schuhputzzeug mitgebracht, war aber barfuß angereist.
Abends, als durch die Nähe des Moores die Mücken unerträglich wurden, räucherten sie die Zelte kurz aus mit schwelenden Grassoden. Es war eine tolle Stimmung hier. Ich wäre gern geblieben, aber ich hatte andere Verpflichtungen und die Jungen brauchten keine Köchin. Sie bereiteten ihr Mittag auf einem selbstgebauten Herd (vier Ziegelsteine), den sie mit Kiefernzapfen, die man im Moor reichlich fand, heizten.
Gern erinnere ich mich an eine Abiturientenrüste. Hier schliefen 15 Jungen und 14 Mädchen in je einem Raum, in dem Stroh auf den Boden geschüttet und gleichmäßig verteilt war. In der Mitte blieb ein Gang. Die Morgenandachten gestalteten sie selber, bei der Bibelarbeit waren rege Diskussionen. Als ein damals bekannter Künstler, den mein Mann für einen Tag eingeladen hatte, Mut zu eigenen Versuchen auf verschiedenen Gebieten der Kunst gemacht hatte, entstanden durch einige Schüler supermoderne Kunstwerke, die sehr witzig und geistreich auf der „Gemäldeausstellung“ vorgeführt wurden. Andere dachten sich Sketche aus, von denen mir einer sehr im Gedächtnis blieb: Ein Schüler stellte einen völlig unbeholfenen Vikar dar, andere waren würdige Oberkirchenräte, die nach der theologischen Prüfung völlig verzweifelt waren: was sollen wir mit dem nur machen, den kann man doch keiner Gemeinde zumuten. Bis einer der hohen Herren eine Idee hat: „Wir machen ihn zum Landesjugendpastor, dafür reicht’s immer noch.“
Kurz vor der Hochzeit hatten wir eine Wohnung zugewiesen bekommen: Zwei Mansardenzimmer mit Küchenbenutzung parterre. Wir waren glücklich. Es machte uns nichts aus, dass unser kleines Schlafzimmer, bestehend aus zwei Couchen, einem Schrank und einer Kommode, von 8:00 bis 12:00 Uhr auch der Sekretärin als Büro diente. Da wurde die Waschschüssel auf den Schrank gestellt und mit der Schreibmaschine vertauscht. So einfach war das.
Als 1950 unser Sohn geboren wurde, mein Mann war natürlich gerade auf einer Freizeit, bekamen wir eine tolle Dreizimmerwohnung mit eigener Küche und eigenem Bad. Die eigene Küche war besonders wichtig, denn die Hauptmieterin der vorigen hatte mir das Windelkochen verboten. Hier hatten wir eine wunderschöne Zeit. Die Angst um die Weiterführung der Jugendarbeit ließ uns zwar nie ganz los, aber es war schön, dass zwei Jugenddiakone aus Neinstedt und die Leiterin der Mädchenarbeit, Elisabeth Frahm, im gleichen Haus wohnten. Wir hatten morgens gemeinsame Andacht, die Reisen ins Land konnten abgestimmt und ausgewertet werden.
Alle waren viel unterwegs, machten Jugendtreffen, Gemeinde- und Elternabende und natürlich Freizeiten.
Mein Mann legte dabei besonderen Wert auf die 12 - 14jährigen. „In diesem Alter werden die Weichen für's Leben gestellt“, sagte er. Als in Schwerin die Jungscharkreise zu groß wurden, hielt er wöchentlich einen Vorbereitungskreis mit 16 - 18jährigen Jungen, die dann zu zweit einen Jungscharkreis leiteten.
Um auch im Lande das Interesse für diese Arbeit mit dieser Altersgruppe zu wecken, nahm er bei einem Schweriner Wochenendtreffen Dias auf, Bilder von lustigen Szenen, Bibelarbeit und Singen. Er gewann einen jungen Mann, der mit dem Fahrrad diese Diaserie auf den Dörfern und in Städten den Konfirmanden und Jugendlichen zeigte und dabei zu Freizeiten einlud. Im Jahr darauf konnten wir uns nicht retten vor Anmeldungen. So mussten Mitarbeiter gewonnen und geschult werden (wie oft lese ich im Tagebuch von damals: „Herr, bitte schicke uns Mitarbeiter.“) und Pastoren, die ihre Konfirmandensäle für Jugendfreizeiten oder Wochenenden zur Verfügung stellten.
Die Heime, die nach und nach entstanden, (die Beschaffung der Bauplätze, der Materialien und des Geldes dazu wäre ein eigenes langes Kapitel) waren mehr „Barackstil“ als Barock, aber es war Leben da, tägliche Beschäftigung mit der Bibel und ausgelassene Freude.
Uns alle verband das Zeichen der Jungen Gemeinde, das Kreuz auf der Weltkugel, das allen Jugendlichen, die ein Jahr zur „Jungen Gemeinde“ gehörten, verliehen wurde. Uns verbanden die Lieder, die durch alle Kreise gingen, wie: „Es geht ein Wind zur Heide ... Gott weiß, was uns im Leide so stark und freudig macht.“ Oder das Lied von R. A. Schröder „Es mag sein, dass alles fällt ... halte Du den Glauben fest, dass Dich Gott nicht fallen lässt ...“
Unvergesslich sind wohl für uns alle die Landesjugendtage mit mehreren tausend Jugendlichen in Güstrow, die Mitarbeiterrüsten, die Laienspiele, die sehr wichtig waren, weil es noch kein Fernsehen gab, und die lustigen Lieder und Stücke und die Verkleidungen dazu, die z. T. noch heute ihre Runde im Lande machen.
Schlimm wurde es im Sommer 1952. Viele Freizeiten wurden verboten, andere trotz Angst vor Verhaftungen durchgezogen. Ich erinnere mich noch sehr an eine Schülerinnenrüste, die mein Mann und ich gemeinsam leiteten. Plötzlich erschien da eine Delegation, sah sich in der Scheune, in der wir unser Nachtlager aufgeschlagen hatten, um und löste kurzerhand die Freizeit wegen hygienischer Mängel auf. Während mein Mann noch mit den Leuten verhandelte, versuchte ich den Mädchen etwas vorzulesen. Haben sie gemerkt, wie sehr mir die Hände zitterten? Wir haben dann alles Gepäck auf ein Gefährt geladen und sind zu Fuß in ein anderes Dorf, das in einem anderen Bezirk lag, gezogen und haben dort noch wunderschöne Tage gehabt. Natürlich war dies ein glücklicher Umstand und nicht immer möglich.
Viel schlimmer wurde es, wenn Jugendliche nach der Freizeit aus der Schulklasse geholt wurden und Rechenschaft geben sollten, was sie auf einer staatsfeindlichen Veranstaltung zu suchen hätten. Dies waren bisher nicht gehörte Töne, kam aber immer häufiger vor, besonders im Jahr 1953.
Das Jahr begann, wie schon seit mehreren Jahren, mit der großen Mitarbeitertagung in Schwerin. Wir hatten über 300 Anmeldungen, es waren genug Privatquartiere durch die Schweriner angeboten worden. Alle freuten sich auf die gemeinsamen Tage. Schon am Bahnhof aber begann die massive Behinderung. An jedem Ausgang stand ein Volkspolizist mit Maschinenpistole; wenn sie ein Zeichen der Jungen Gemeinde am Rockaufschlag eines Reisenden sahen, bedrohten sie denjenigen, nahmen ihm den Ausweis ab und schickten ihn nach Hause. Wenn nicht einige dabei gewesen wären, die als kirchliche Mitarbeiter nicht erkannt waren, und gleich auf die Bahnsteige liefen und den anderen rieten, die Zeichen abzunehmen, hätten wir wohl kaum Leute zur Tagung gehabt. So aber waren es noch fast 300 Leute.
Pastor Johannes Busch aus Essen sagte bei der Begrüßung: „Haben wir nicht einen mächtigen Herrn? Seine Gegner haben solche Angst vor ihm, dass sie meinen, sie müssen mit Waffen gegen ihn vorgehen.“ Zunächst aber durfte er gar nicht sprechen. Die Tagung war verboten worden.
Was nun? Sollten 300 Leute umsonst aus ganz Mecklenburg und woanders her nach Schwerin gekommen sein? Ein Gottesdienst konnte nicht verhindert werden. So verlegte mein Mann die Begrüßungsveranstaltung in die Schelfkirche. Pastor Busch zog einen Talar an und hielt seine Rede wie vorgesehen als Predigt. Inzwischen verhandelten mein Mann und zwei Mitarbeiter mit den staatlichen Stellen. Sie setzten es nach schwierigen Verhandlungen durch, dass die Tagung stattfinden durfte, aber es waren die ganze Zeit hindurch Mitarbeiter der Stasi dabei, die sich mit Gewalt Eintritt verschafft hatten. Als ein Jugenddiakon einem dieser Typen, der sich als Theologiestudent ausgab, den Eintritt verweigerte, musste er einige Tage später zur Polizei und sollte Spitzeldienste leisten. Er ist die Nacht drauf über die Grenze nach Westdeutschland gegangen mit Frau und kleinen Kindern. Einige andere Mitarbeiter sind nach dieser Tagung verhaftet und z. T. zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt.
Von nun an wurde es gefährlich, zur „Jungen Gemeinde“ zu gehören. Täglich standen Artikel in den Zeitungen, besonders in der FDJ-Zeitung „Junge Welt“, die über angebliche Spionagedienste von Gliedern der Jungen Gemeinde berichteten. Es wurde immer wieder behauptet, „Junge Gemeinde“ hätte mit Kirche gar nichts zu tun, es wäre eine gefährliche Spionageorganisation, vom Westen gesteuert und unterstützt. Es wurde plötzlich gefährlich, das Zeichen des Kugelkreuzes zu tragen, in der Schule wurde es offiziell verboten. Anfang April wurden alle Oberschüler der Stadt ohne Angabe eines Grundes nachmittags auf den Schweriner Markt bestellt. Dort hielt der Direktor der Schule eine Rede, beschuldigte alle Glieder der „Jungen Gemeinde“ der Spionage und forderte alle Schüler auf, die „Machenschaften dieser Organisation“ zu verurteilen, indem sie die Hand gegen sie erheben. Ein Junge der 12. Klasse hatte das Zeichen angesteckt und hob natürlich nicht die Hand, da wollten Mitschüler es ihm abnehmen. Er aber hielt es mit aller Gewalt fest, bis ihn die Leute zur Polizei schleppten. Es hat viele Kämpfe gekostet, ihn wieder frei zu kriegen.
Einige Tage darauf waren die Teilnehmer des Laienspielkreises in der Paulskirche versammelt, um ein eingeübtes Passionsspiel der Gemeinde vorzutragen, als ein Teil der Oberschüler, der, der nachmittags Unterricht hatte (das wechselte jede Woche), kurz vor Beginn des Spiels ihren Mitspielern mitteilten, dass sie ganz plötzlich aus der Schule geflogen seien. Grund: Spionageorganisation „Junge Gemeinde“.
Das war ein Schlag! Manche hatten gerade das schriftliche Abitur fertig. Und nun – wer wird morgen früh dran sein und die Schule verlassen müssen? – Doch die Jungen spielten trotzdem. Es hat wohl selten ein Laienspiel die Gemeinde so berührt wie dies, waren die Jungen dem leidenden Herrn doch so nahe.
Aber was sollte werden? Wir merkten bald, dass dies nicht nur in Schwerin passierte, sondern die Agentenbeschuldigung der Jungen Gemeinde war DDR-weit. Konnten wir unsere Arbeit weitermachen – Freizeiten – Jugendkreise – Jugendtage? War es nicht zu gefährlich? Oft waren wir ratlos.
Und dann – wer konnte es fassen – kam der 10. Juni 1953; ich weiß es noch wie heute: Ich saß mit Freunden zusammen, wir hatten seit Tagen kein Radio gehört, als mein Mann in die Tür kam, die Zeitung aufschlug und vorlas: „Allen Jugendlichen der „Jungen Gemeinde“ ist Unrecht geschehen, sie sind sofort wieder in den Schulen aufzunehmen, die Abiturienten sind nachzuprüfen.“ Konnte das möglich sein? Es war nicht zu fassen. Ein Wunder war geschehen, ein großes Aufatmen begann.
Es war dann eine wunderbare Sache, dass der ganze Laienspielkreis, der noch als solcher regelmäßig zusammenkam, zum Hamburger Kirchentag eingeladen wurde. Die Jungen haben dort eine Sprechmotette dargeboten und den Kirchentagsbesuchern gesagt: „Gott erhört Gebet, wir haben es erlebt. Er gibt uns Kraft um des Glaubens willen Anfechtung und Druck zu ertragen und doch getrost zu bleiben.“
Für uns folgten noch drei Jahre in der mecklenburgischen Jugendarbeit. Äußerlich wurde vieles einfacher: Wir konnten ein Büro im Keller ausbauen, mein Mann bekam ein Auto, die Heime wurden mit Betten ausgestattet, die Zelte mit Luftmatratzen, aber die erste Zeit bleibt unvergessen.
Eines aber möchte ich noch erzählen: Im Jahre 1985, also dreißig Jahre später, kurz vor seinem plötzlichem Tod, hat mein Mann noch Mädchen und Jungen der 5. Klasse, die keine Christenlehre hatten, eingeladen zu „biblischer Geschichte und spannender Spielrunde“. Er hat die Stunde nicht mehr halten können, aber es macht deutlich, ihm war bis zuletzt das wichtigste Anliegen, die biblische Botschaft jungen Menschen weiterzusagen.
Inzwischen war mein Mann zehn Jahre Landesjugendpastor gewesen und meinte, da müsse jetzt ein Jüngerer ran. Er teilte dies dem Oberkirchenrat mit und auf seine Anfrage, wo für ihn eine Gemeinde frei sei, wurden ihm Sülze, Dargun und Gnoien genannt. Wir waren zunächst nicht gerade begeistert, denn alle drei Kleinstädte waren ziemlich weit weg von unsrem geliebten Schwerin. Nachdem wir dann aber die Gemeinden abgefahren waren, entschieden wir uns sehr schnell für Gnoien. Die Stadt gefiel uns, klein, aber ein Zentrum für viele umliegende Dörfer. Die Kirche stand wie eine Glucke inmitten der Häuser. Die Leute würden also keine weiten Wege zur Kirche haben. Mit entscheidend war auch, dass der Vorgänger fünfzig Jahre in dieser Gemeinde gewesen war und vieles eingeschlafen schien. Es reizte uns, in der Gemeinde altes zu beleben und neues zu versuchen. So sagten wir zu und entschieden uns für Gnoien. Im Herbst sollte es losgehen. Wir alle waren schon sehr gespannt.
Es war ein freundlicher Empfang, den die Gnoiener uns bereiteten. Gnoien war eine sogenannte Ackerbürgerstadt von 5.000 Seelen, Zentrum für viele umliegende Dörfer. Es gab hier noch keine Kanalisation, d.h. die Abwässer der Wohnungen und er Stallungen flossen am Rande der Bürgersteige auf der Straße ab. Das war besonders schwierig, wenn Frostwetter war oder wenn geschlachtet wurde und auch Blut und Schlachtabwässer auf die Straße flossen. Man kann sich kaum vorstellen, wie die Straßen dann aussahen, vom Geruch ganz zu schweigen. Aber schon am Sonntag beim Einführungsgottesdienst in der vollen Kirche waren wir versöhnt, wir merkten, hier waren wir willkommen.
Zuerst lud mein Mann die 12 bis 14jährigen Jungen ein und begeisterte sie mit Spiel und mit biblischer Geschichte, erst dann fing er mit der Konfirmandenstunde für Jungen und Mächen an und hatte bald große Scharen. Schon nach kurzer Zeit meldeten sich auch die größeren Jugendlichen und meinten, in Gnoien sei nichts los, ob sie nicht auch kommen könnten.
Es war klar, dass es den Stadtvätern nach einiger Zeit nicht verborgen blieb, dass im Gnoiener Pfarrhaus und in der Kirche immer etwas los war. Es war auch klar, dass ihnen das nicht gefiel, denn wir hatten ja den atheistischen sozialistischen Staat, der nach der Devise von Karl Marx herrschte: „Religion ist Opium fürs Volk“. Die Verfassung der DDR sollte zwar Religionsfreiheit garantieren, aber überall im Lande versuchte man, diese zu umgehen. So gab es dann bald Schwierigkeiten und Schikanen mit der Christenlehre. Christlichen Schüler wurden behindert und bedroht. Schlimm war auch die Zeit, als die Werbung für die Jugendweihe mit den bekannten Nötigungen begann.
Alle diese Auseinandersetzungen gingen nicht spurlos an meinem Mann vorüber. Die ersten gesundheitlichen Probleme hatte er schon zwei Jahre nach unserer Übersiedlung nach Gnoien. Es wurde ein kleiner Herzfehler festgestellt. Sein Hauptproblem sei der Stress, er nähme sich zu viel vor.
Eines Tages erreichte uns ein Brief von dem uns bekannten Pastor Runge aus Schwerin. Er teilte uns mit, dass er in den Ruhestand gehen wolle und sich keinen anderen Nachfolger für die Paulskirche vorstellen könne, als PW. „Bitte, bitte, kommen Sie“, war der Schluss des Briefes. Wir haben lange überlegt und alles Für und Wider abgewogen, und wir kamen zu dem Schluss: Ja, wir machen es, wir sagen zu. Wir waren sehr gerne in Gnoien, aber es gab mehrere Gründe für einen Wechsel nach Schwerin. Ende Februar 1963 verließen wir Gnoien schweren Herzens. Unsere neue Heimat sollte jetzt der Packhof und die Paulsgemeinde in Schwerin werden.
Anschließend war Friedrich Franz Wellingerhof 10 Jahre lang als Pastor an St. Paul in Schwerin, zuletzt 10 Jahre lang als Landessuperintendent des Kirchenkreises Schwerin (Nachfolger von Friedrich Wilhelm Gasse).
Am 7.09.1985 verstarb er plötzlich und unerwartet im Alter von 68 Jahren an einem Herzinfarkt in Schwerin.
Arvid Schnauer: Junge Gemeinde in Schwerin
Zeitzeugenbericht von Arvid Schnauer (Jahrgang 1937)
Ich gehörte schon eine Zeitlang zu einer Jungensgruppe, die sich im Kohlenkeller des Gemeindehauses in der Bäckerstraße wöchentlich traf. Dort wurde zur Gitarre gesungen und gespielt, sicher auch biblische Geschichten erzählt, aber neben anderen, sehr spannenden, die mir sehr eindrücklich waren – und auch die Leiter, zuerst wohl Herr Mayer, dann der Diakon Brösel, machten einen tiefen Eindruck auf mich.
Eines Tages kam ein Pastor und wollte uns zu einer „Rüstzeit“ einladen. Ich wußte nicht, was das war, aber was dieser Pastor (eben Pastor Wellingerhof
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: