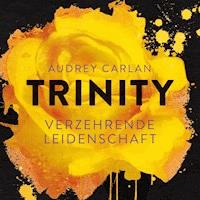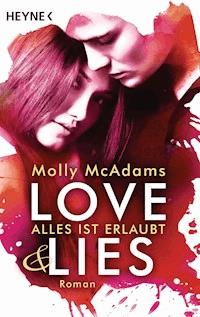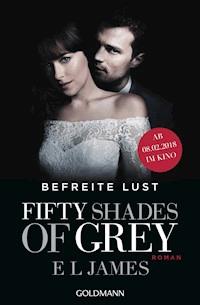Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Passion Publishing
- Kategorie: Erotik
- Serie: Klassiker der Erotik
- Sprache: Deutsch
Schon sehr früh lernt Saturnin alle Spielarten der Liebe kennen. Als er dann ins Kloster kommt, ist er sehr darüber verwundert, dass es dort nicht anders zugeht als in der Welt draußen. Aber er ist kein Kostverächter, und er nimmt jede Gelegenheit, die sich ihm bietet, mit Freuden wahr. Das Leben hinter Klostermauern ist sogar so anziehend und voll von sexuellen Abenteuern, dass es ihm bei den Karthäusern immer besser gefällt. Und schließlich kommt er sogar zu der Erkenntnis, dass es sich hier in jeder Hinsicht am allerbesten leben und lieben lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
J. CH. G. DE LATOUCHE
Der Karthäuser-Pförtner
I.
Ah, welche süße Genugtuung ist es für ein Herz, sich freigemacht zu haben von schalen Vergnügungen, von frivolem Amüsement und von gefährlichen Liebschaften, die es an die Welt banden. Nach einer langen Reihe von Verirrungen ist es endlich sich selbst wiedergegeben! In der Ruhe, die ihm die Befriedigung seiner früheren Genüsse bereitet, fühlt es noch jene Erschütterung der Seele, die die Erinnerung an entgangene Gefahren im Geist zurückläßt. Aber es fühlt sie nur, um sich selbst zu beglückwünschen wegen der Sicherheit, in der es sich befindet. Diese Gemütsbewegungen werden ihm teuere Gefühle, weil sie den Reiz der ihm gewährten Ruhe besser auskosten lassen.
Dies ist, liebe Leser, meine Lage. Welchen Dank schulde ich dem Allmächtigen, dessen Mitleid mich aus dem Sumpf der Liederlichkeit herausgezogen hat, in den ich versunken war, und der mir die Kraft gibt, heute meine Verirrungen niederzuschreiben, zur Warnung und Erbauung meiner Brüder.
Ich bin die Frucht der Unkeuschheit der heiligen Zölestiner der Stadt R. Ich sage der heiligen Zölestiner, weil sich alle rühmten, an meiner Entstehung mitgewirkt zu haben. Doch, welche Gedanken halten mich da plötzlich auf! Mein Herz ist bewegt; ist das die Furcht vor dem Vorwurf, ich entschleiere die Geheimnisse der Kirche? Ach, überwinden wir diese Schwäche, diesen Gedanken! Weiß man nicht, daß jeder Mann ein Mann ist, und ein Mönch ganz besonders? Sie haben also die Fähigkeit, an der Verbreitung des Menschengeschlechts mitzuarbeiten. Warum untersagt man es ihnen dann? Da sie sich ihrer Aufgabe so gut entledigen?
Vielleicht erwartest du, lieber Leser, daß ich dir eine genaue Schilderung meiner Geburt gebe. Ich bin selbst ärgerlich darüber, dich mit diesem Bericht so bald nicht befriedigen zu können und mich dir als Pflegesohn eines guten Bauern zeigen zu müssen, den ich lange für meinen Vater gehalten habe.
Ambroise, dies ist der Name des guten Mannes, war der Gärtner eines Landhauses, das die Zölestiner in einem kleinen Dorf, einige Meilen vor der Stadt, besaßen. Seine Frau Toinette wurde zu meiner Amme erwählt; ein Sohn, den sie zur Welt gebracht hatte, der aber im Augenblick meiner Geburt starb, half das Geheimnis meiner Entstehung zu verschleiern. Man scharrte heimlich den Sohn des Gärtners ein, und der der Mönche trat an seine Stelle; Geld erreicht alles.
Ich wuchs heran, immer, auch in meinen eigenen Augen, als der Sohn des Gärtners. Man möge mir diesen kleinen Zug der Eitelkeit verzeihen, aber ich wage trotzdem zu sagen: Meine Neigungen straften diese Abstammung Lügen. Ich weiß nicht, welcher göttliche Segen über den Werken der Mönche schwebt; es scheint, als ob die Tugend der Kutte an allem hängenbleibe, das sie berührt: Toinette war ein Beispiel dafür. Sie war sicher das munterste Weibchen, das ich jemals gesehen habe – und ich habe ihrer genug gesehen. Sie war dick, doch appetitlich, mit kleinen schwarzen Augen, einem Stumpfnäschen, lebhaft, verliebt, sorgfältiger gekleidet, als es Bäuerinnen gewöhnlich sind. Das wäre ein prächtiger Notbehelf für einen ehrbaren Menschen gewesen.
Wenn die vulkanische Dralle in ihrer Sonntagsbluse erschien, die einen Busen einzwängte, den der Sonnenbrand immer respektiert hatte, und der zwei herrliche Brüste sehen ließ, die frech und angriffslustig ans Tageslicht drängten, da fühlte ich wohl, daß ich nicht ihr Sohn sei, aber daß ich mich gern dafür halten ließ! Ihre dicken Hinterbacken erinnerten mich immer an eine Stute.
Ich hatte Anlagen ganz wie ein Mönch. Lediglich durch den Instinkt geführt, konnte ich kein Mädchen sehen, ohne es zu küssen, ohne daß ich ihm nicht mit der Hand überall hingefahren wäre, wo sie es nur zuließ, und wenn ich auch nichts Bestimmtes wußte, so sagte mir doch mein Herz, daß ich noch mehr getan hätte, wenn mir nicht Einhalt geboten worden wäre.
Eines Tages, da man mich in der Schule vermutete, war ich in einem kleinen Zimmer geblieben, in dem ich schlief. Eine einfache Wand trennte es von dem Zimmer Ambroisens, dessen Bett an der Wand stand, an der ich schlief. Ich schlief; es war entsetzlich heiß, nämlich Hochsommer. Plötzlich wurde ich durch heftige Stöße geweckt, die ich an die Wand schlagen hörte. Ich konnte mir das Geräusch nicht erklären; es wiederholte sich. Ich legte das Ohr an die Wand und hörte erregte und zitternde Laute, Worte ohne Sinn und halb ausgesprochen. »Ah, langsam, meine liebe Toinette, mach nicht so schnell!«
»Ah, du Schelm, du tötest mich vor Lust! Schnell! Ah, schnell! Ah, ich sterbe!«
Überrascht, solche Ausrufe zu hören, deren Erregtheit ich spürte, setzte ich mich auf. Kaum wagte ich zu atmen. Wenn man mich da bemerkt hätte, mußte ich alles befürchten; ich wußte nicht, was ich denken sollte; ich war sehr erregt. Meine Unruhe machte bald der Neugierde Platz. Ich hörte von neuem das nämliche Geräusch, und ich glaubte unterscheiden zu können, daß ein Mann und Toinette abwechselnd die Worte ausstießen, die ich schon gehört hatte. Die Begierde, zu erfahren, was in jenem Zimmer vor sich gehe, wurde schließlich so lebhaft, daß sie alle meine Furcht erstickte. Ich entschloß mich, in Erfahrung zu bringen, was da vor sich ging. Ich glaube, ich wäre deshalb gern in das Zimmer von Ambroise eingetreten, was auch immer hätte passieren können. Ich wurde dieser Mühe enthoben; sorgsam an der Wand tastend, ob ich nicht irgendein Loch in ihr fände, fühlte ich eins, das klein und durch ein großes Bild verdeckt war. Ich machte es frei und mir Licht. Welches Schauspiel! Toinette, nackt wie ihre Hand, lag ausgestreckt auf dem Bett, und der Pater Polycarpe, Vorsteher des Klosters, der erst seit einiger Zeit da war, nackt wie Toinette, machten – was? Das, was unsere Ureltern taten, als ihnen der liebe Gott befahl, die Erde zu bevölkern. Die aber taten das unter weniger schlüpfrigen Umständen.
Dieser Anblick rief bei mir eine Überraschung hervor, die mit Freude vermischt war und mit einem lebhaften und prickelnden Gefühl, das ich nicht beschreiben könnte. Ich fühlte, daß ich mein Leben dafür gegeben hätte, an der Stelle des Mönches zu sein, daß ich ihn beneidete! Daß mir sein Glück ungeheuerlich erschien. Ein ungeahntes Feuer jagte durch meine Adern, mein Gesicht war gerötet, mein Herz klopfte zum Zerspringen; ich hielt meinen Atem an und den Speer der Venus, der von einer Kraft und Steifheit war, daß ich die Wand damit hätte zusammenschlagen können, wenn ich nackt ein wenig fest dagegen gestoßen hätte.
Der fromme Pater beendigte seinen Ritt, zog sich von Toinette zurück und ließ sie so ganz meinen verzehrenden Blicken ausgesetzt. Sie hatte Augen wie eine Sterbende; ihr Gesicht war vom tiefsten Rot bedeckt; der Atem war ihr ausgegangen; die Arme hingen ihr schlaff herab; ihre Brust hob und senkte sich mit erstaunlicher Schnelligkeit; sie zuckte von Zeit zu Zeit mit dem Hintern, indem sie sich streckte und tiefe Seufzer dabei ausstieß. Mit unbegreiflicher Schnelligkeit überflogen meine Augen alle Teile ihres Körpers; es blieb auch nicht einer übrig, auf den ich im Geiste nicht tausend brennende Küsse geheftet hätte. Ich preßte meine Lippen auf ihre Brüste, auf ihren Leib und auf den köstlichsten Ort, von dem sich meine Augen nicht mehr losreißen konnten. Plötzlich riß ich die Augen auf ... Das war – Ihr versteht mich. Was hatte diese Schelmin für Reize für mich! Ah, diese liebliche Färbung! Obwohl mit einem leichten weißen Schaum bedeckt, verlor es für mich nichts von der Lebhaftigkeit seiner Farben. An dem Vergnügen, das ich bei seinem Anblick empfand, erkannte ich in ihm das Zentrum der Wollust. Es war von einem dichten, schwarzen und gekräuselten Haarbüschel beschattet. Toinette hatte die Beine gespreizt. Es schien, als ob ihre Unsittlichkeit mit meiner Neugierde verbunden wäre, um meinen Blicken keinen Wunsch zu versagen.
Der Mönch hatte seine Kraft zurückgewonnen und kam, um sich von neuem zum Kampf zu stellen. Er schwang sich mit frischem Eifer auf Toinette, aber seine Kräfte straften seinen Mut Lügen. Müde, sein Roß unnützerweise anzutreiben, sah ich, wie er sein Instrument aus der Muschel Toinettes bleich und mit niedergeschlagenen Augen herauszog. Toinette war aufgebracht über seinen Rückzug, faßte das Glied und begann es zu schütteln. Der Mönch erschauerte wie verrückt und schien das Vergnügen, das er empfand, nicht länger ertragen zu können.
Ich beobachtete alle ihre Bewegungen, ohne anderen Führer als die Natur, ohne jede andere Belehrung als das Beispiel. Neugierig darauf, zu erfahren, was diese krampfhaften Bewegungen des Paters hervorrief, suchte ich bei mir selbst deren Ursache. Ich war überrascht, ein unbekanntes Vergnügen zu fühlen, das sich unbemerkt vergrößerte, bis ich erschöpft auf mein Bett fiel. Die Natur machte unglaubliche Anstrengungen, und alle Teile meines Körpers schienen zu dem Vergnügen des Gliedes beizutragen, das ich streichelte. Endlich kam jener weiße Saft, von dem ich einen so gründlichen Niederschlag bei Toinette gesehen hatte. Ich kam aus meiner Ekstase heraus und machte mich wieder an das Loch in der Wand; es war zu spät, der letzte Schuß war gefallen, der Kampf war beendigt. Toinette kleidete sich wieder an, der fromme Pater war schon in seinen Kleidern.
Ich blieb einige Zeit liegen, Kopf und Herz voll des Abenteuers, das ich mit angesehen hatte. Ich empfand eine Betäubung, wie sie ein Mensch erleidet, wenn er von einem plötzlichen Lichtstrahl getroffen wird. Eine Überraschung löste die andere ab. Die Kenntnisse, die die Natur in mein Herz gesenkt hatte, fingen an sich zu entwickeln, die Wolken, mit denen sie bedeckt waren, sich zu zerstreuen. Ich begriff die Ursache der verschiedenen Gefühle, die mich alle Tage bei dem Anblick von Frauen heimsuchten. Dieser unmerkliche Übergang von der Ruhe zur lebhaftesten Erregtheit, von der Gleichgültigkeit zur Begierde waren keine Rätsel mehr für mich. »Ah!« rief ich aus. »Wie waren sie glücklich! Die Freude durchbebte sie beide. Das Vergnügen, das sie empfanden, muß groß gewesen sein! Ah, wie waren sie glücklich, wie waren sie glücklich!«
Der Gedanke an dieses Glück nahm mich vollständig gefangen, er nahm mir für einen Augenblick jede Fähigkeit, darüber nachzudenken. Ein tiefes Stillschweigen folgte meinem Ausrufe. Bald aber fing ich wieder an: »Werde ich niemals groß werden, um ebenso mit einer Frau zu sein? Ich würde vor Vergnügen auf ihr sterben, da ich schon jetzt bei dem Zusehen so viel Lust empfand. Das ist sicher nur ein schwaches Bild von dem, was meine Mutter mit dem Pater Polycarpe fühlte. Aber«, setzte ich mein Selbstgespräch fort, »ist es unbedingt nötig, groß zu sein, um dieses Vergnügen zu empfinden? Ich bin doch recht dumm! Wahrhaftig! Ich glaube, das Vergnügen wird nicht nach der Größe gemessen, wenn nur eines auf dem anderen liegt, muß schon alles ganz von selbst gehen.« Wie ein Feuer zuckte mir’s durch meine Empfindungsnerven, mein Herz schlug wild, die Leidenschaft wütete mir durch alle Gefühle.
Sofort fiel mir ein, ich solle meiner Schwester Suzon von meinen neuen Entdeckungen Mitteilung machen. Sie war einige Jahre älter als ich, eine kleine, sehr schöne Blondine, mit jener offenen Physiognomie, die man für dumm halten kann, weil sie gleichgültig dreinschaut. Sie hatte schöne, blaue, sanftmütige Augen, die ohne Absicht auf einem zu ruhen scheinen, deren Wirkung aber nicht geringer ist als die der brennenden pikanten braunen, die einem leidenschaftliche zu werfen. Warum das? Ich weiß es nicht, denn ich habe mich einfach immer mit dem Gefühl an sich begnügt, ohne zu versuchen, seine Ursache zu ergründen. Ist es nicht vielleicht deshalb, weil eine schöne Blondine mit ihren schmachtenden Blicken einen zu bitten scheint, ihr sein Herz zu schenken, während dich die Braune mit Gewalt unterwerfen will? Die Blonde verlangt nur ein wenig Mitgefühl für ihre Schwäche, und diese Art zu bitten ist sehr verführerisch. Du glaubst, nur ein wenig Mitgefühl darzubieten, und gibst deine Liebe. Die Braune dagegen will, daß du schwach seiest, ohne dir zu versprechen, daß sie es auch sein wird. Das Herz wappnet sich gegen diese. Ist es nicht so?
Ich gestehe es zu meiner Schande, daß es mir noch nie in den Sinn gekommen war, auf Suzon einen Blick der Begehrlichkeit zu werfen; seltene Sache bei mir, der ich alle Frauen, die ich sah, begehrte. Es ist zwar wahr, daß ich sie nicht oft sah, weil sie das Patenkind der Herrin des Dorfes war, die sie gern hatte und bei sich auf ziehen ließ. Sie war sogar seit einem Jahr im Kloster und erst vor acht Tagen dort weggegangen, da ihre Patin einige Zeit auf dem Land verbringen wollte und ihr erlaubt hatte, Ambroise zu besuchen. Ich fühlte mich sofort von dem Gedanken begeistert, meine liebe Schwester zu belehren und mit ihr die Wonnen durchzukosten, die ich soeben Polycarpe mit Toinette hatte schlürfen sehen. Ich war nicht mehr der gleiche wie früher ihr gegenüber. Meine Augen sahen tausend Reize, die ich sonst nicht an ihr bemerkt hatte. Ich fand bei ihr eine zarte, sich entwickelnde Brust, weißer als die Lilie, fest, voll. Im Geist saugte ich mit einem unbeschreiblichen Entzücken an diesen beiden kleinen Erdbeeren, die ich auf dem Gipfel ihrer Brüste sah. Aber vor allem vergaß ich bei dem Ausmalen ihrer Reize nicht dieses Zentrum, dieses Hochgebirge des Vergnügens, von dem ich mir ein berauschendes Bild entwarf.
Belebt durch das lebhafte, brennende Feuer, das diese Ideen durch meinen ganzen Körper jagte, verließ ich das Haus und lief umher, um Suzon zu suchen. Die Sonne war schon schlafen gegangen, der Nebel stieg. Ich redete mir ein, daß ich unter dem Mantel der nächtlichen Finsternis bald auf dem Gipfel meiner Wünsche sein müßte, wenn ich sie fände. Von weitem sah ich jemand Blumen pflücken. Suzon! Sie dachte in diesem Augenblick nicht daran, daß ich darüber nachsann, wie ich die kostbarste Blume ihres Buketts pflücken könnte. Ich flog auf sie zu, als ich sie bei dieser unschuldigen Beschäftigung sah. Ich schwelgte in Gedanken an den Moment, da ich ihr meinen Plan enthüllt haben würde. Doch mit jedem Schritt, der mich ihr näher brachte, verlangsamte ich meinen Lauf. Ein plötzliches Zittern schien mir meine Absicht vorzuwerfen. Ich glaubte, ihre Unschuld respektieren zu müssen; ich wurde durch die Ungewißheit des Erfolges zurückgehalten. Ich war bei ihr angekommen, redete sie an, aber mit einem Stottern, das mich keine zwei Worte Vorbringen ließ, ohne von neuem Atem zu schöpfen.
»Was machst du denn da, Suzon?« sagte ich zu ihr, indem ich mich näherte und sie küssen wollte.
Sie entwich mir lachend und antwortete: »Siehst du denn nicht, daß ich Blumen pflücke?«
»Ah, ah«, erwiderte ich, »du sammelst Blumen?«
»He, ja, wirklich«, antwortete sie mir, »weißt du denn nicht, daß morgen der Namenstag meiner Pflegemutter ist?«
Dieser Name ließ mich erzittern, als müßte ich fürchten, daß mir Suzon entwiche. Mein Herz hatte schon gesprochen
wenn ich mich dieses Ausdruckes bedienen darf –, und ich betrachtete sie schon meiner Gewohnheit gemäß als sichere Beute. Der Gedanke an ihre Entfernung schien mich mit dem Verlust eines Vergnügens zu bedrohen, das ich schon als sicher betrachtete, obwohl ich es noch nicht gekostet hatte.
»Ich sehe dich also dann nicht mehr, Suzon?« fragte ich sie mit trauriger Miene.
»Aber weshalb denn nicht?« antwortete sie. »Komme ich denn nicht immer hierher? Doch los!« setzte sie mit einer entzückenden Miene fort, »hilf mir mein Bukett machen!«
Ich antwortete ihr, indem ich ihr einige Blumen ins Gesicht warf. Sie warf wieder.
»Gib acht, Suzon«, sagte ich ihr, »wenn du mich noch einmal bewirfst, so werde ich dich ... du wirst es mir bezahlen.« Um zu zeigen, wie meine Drohungen auf sie wirkten, zeigte sie mir die Faust.
In diesem Augenblick verließ mich meine Furchtsamkeit; ich fühlte keine Angst mehr, gesehen zu werden; der Nebel, der verhinderte, daß man über eine gewisse Entfernung überhaupt etwas sah, begünstigte meine Kühnheit. Ich warf mich auf Suzon; sie stieß mich zurück, ich küßte sie, sie gab mir eine Ohrfeige. Ich warf sie auf den Rasen, sie versuchte aufzuspringen, ich hinderte sie daran. Fest preßte ich sie in meine Arme, küßte sie auf den Hals, sie verteidigte sich, ich versuchte ihr die Hand unter den Rock zu schieben, sie schrie wie ein kleiner Teufel. Sie setzte sich so stark zur Wehr, daß ich fürchtete, überhaupt nicht zum Ziele zu kommen und daß sich überhaupt nichts ereignete. Ich erhob mich lachend und glaubte, daß sie mir mein Vorhaben, mit dem sie offenbar nicht einverstanden war, nicht nachtragen würde. Wie täuschte ich mich!
»Na, komm, Suzon«, sagte ich, »damit du siehst, daß ich dir nicht weh tun wollte, will ich dir helfen.«
»Ja, ja«, antwortete sie, mindestens so erregt wie ich, »da kommt meine Mutter, und ich .. .«
»Ah, Suzon«, erwiderte ich lebhaft, indem ich sie hinderte, mehr zu sagen, »liebe Suzon, sage nichts, ich gebe dir ... siehe, alles was du willst.« Ein neuer Kuß war das Pfand meiner Worte. Sie lachte darüber, Toinette kam an; ich fürchtete, Suzon würde plaudern, aber sie sagte kein Wort; so gingen wir alle zusammen zurück zum Abendessen.
Seit seiner Ankunft hatte Pater Polycarpe neue Beweise der Zuneigung des Klosters für den angeblichen Sohn Ambroisens gegeben; ich war von Kopf bis zu Fuß neu gekleidet worden. In Wahrheit hatte Se. Reverenz weniger die klösterliche Wohltätigkeitskasse gefragt, die ziemlich begrenzt war, als die väterliche Zärtlichkeit, die es meistens nicht ist. Der gute Pater setzte durch eine neue derartige Freigebigkeit die Legitimität meiner Geburt argen Verdächtigungen aus. Aber meine Bauern waren gute Leute, die davon nicht mehr merkten, als sie sollten. Wer hätte übrigens auch wagen sollen, die Großmütigkeit der frommen Patres mit kritischem und scheelem Auge zu betrachten. Das waren so ehrenhafte, so brave Leute; man betete sie in dem Dorf an; sie taten den Männern nur Gutes und achteten die Ehre der Frauen; alle Welt war zufrieden. Aber kommen wir zu meiner Person zurück. Ich hatte ein glänzendes Abenteuer.
Mein Gesicht: Ich hatte ein schelmisches Aussehen, das nicht gegen mich einnahm. Ich hatte regelmäßige Gesichtszüge und schlaue Augen, lange schwarze Locken fielen mir auf die Schultern und hoben die lebhaften Farben meines Gesichtes prächtig hervor, das zwar ein wenig braun war, aber etwas darstellte. Das ist ein authentisches Zeugnis, das ich dem Urteil sehr ehrenwerter und sehr tugendhafter Leute verdanke, denen ich meine Ehrfurcht bewies.
Suzon hatte, wie schon gesagt, ein Bukett für Madame Dinville gemacht. Das war der Name ihrer Pflegemutter, der Frau eines Rates der benachbarten Stadt, die auf das Land kam, Milch zu trinken, um so ihre durch zuviel Champagner und etliche andere Sachen geschwächte Brust auszukurieren.
Suzon war in ihren besten Staat gesteckt worden, der sie in meinen Augen noch liebenswerter machte; ich sollte sie begleiten. Wir gingen zu dem Landhaus. Wir trafen die Dame in einem Sommergemach, in dem sie frische Luft schöpfte. Denkt euch eine Frau von mittlerer Größe, mit braunem Haar und weißer Haut, umrahmt von einem bäuerlichen Rot, aber mit Augen wie ein Reh und mit riesigen Brüsten, so groß, wie sie eine Frau auf der Welt nur haben kann. Das war damals die erste gute Eigenschaft, die ich an ihr bemerkte. Diese beiden Hügel waren immer meine Schwäche. Es ist auch etwas Erhabenes, wenn ihr solche Dinger in der Hand haltet, wenn ihr ... nun, jedem das Seine ...
Sobald uns die Dame bemerkte, warf sie uns einen gutmütigen Blick zu, ohne aufzustehen. Sie lag auf einem Kanapee, ein Bein heraufgezogen, das andere auf dem Fußboden. Sie hatte nur einen einfachen weißen Rock an, kurz genug, um ein Knie sehen zu lassen, das seinerseits wieder nicht genug bedeckt war, um es allzu schwierig zu machen, den Rest zu sehen. Ein kleines Korsett von der gleichen Farbe, eine rosarote Morgenjacke von Taffet mit leichter Einfassung und die Hand – unter dem Rock. Ratet, wozu! Meine Phantasie war in diesem Moment schon fertig mit ihrer Tätigkeit; mein Herz folgte ihr ganz in die Nähe. Von jetzt ab war es mein Schicksal, mich in alle Frauen zu verlieben, die mir vor die Augen kamen. Die Enthüllungen des vorhergehenden Tages hatten diese löblichen Eigenschaften zur Entwicklung gebracht.
»Ah, guten Tag, mein liebes Kind«, sagte Madame Dinville zu Suzon, »sieh da, du kommst also zurück zu mir? Oh, du bringst mir ein Bukett, wirklich, ich bin dir sehr dankbar dafür, mein gutes Töchterchen, gib mir einen Kuß.« Küsserei von Seite Suzons. Dann warf sie einen Blick auf mich und fuhr fort: »Aber wer ist denn dieser dicke schöne Junge da? Wie, mein kleines Fräulein, du läßt dich von einem jungen Mann begleiten? Das ist ja niedlich.«
Ich senkte den Blick, Suzon sagte, ich sei ihr Bruder. Verbeugung von meiner Seite.
»Dein Bruder«, ergriff Madame Dinville wieder das Wort und redete mich dann an: »Küsse mich, mein Sohn, wir wollen Bekanntschaft miteinander schließen.«
Sie gibt mir einen Kuß auf den Mund; ich fühle, wie sich eine schmale Zunge zwischen meine Lippen schiebt und eine Hand mit meinen Locken spielt. Ich kannte diese Art des Küssens noch nicht; sie versetzte mich in eine seltsame Erregung. Ich warf der Dame einen furchtsamen Blick zu, der ihren leuchtenden, feurigen Blicken begegnete, die mit ihren Gluten meine befeuerten und mich zwangen, meine niederzuschlagen. Ein neuer Kuß der gleichen Sorte, nach dem es mir freistand, mich zurückzuziehen. Ich war wohl in der Verfassung, daß sie mich weiter hätte küssen wollen. Aber ich war ihr nicht böse darüber; ich glaubte, das gehöre zur Zeremonie der Bekanntschaft, die sie mit mir schließen wollte. Ich war ihr für die mir gewährte Freiheit nur dankbar, wenn ich auch den schlechten Eindruck derartig lebhafter, ungemäßigter Zärtlichkeiten beim ersten Besuch nicht verwinden konnte. Doch diese Gedanken waren nicht von langer Dauer; sie begann wieder ein Gespräch mit Suzon, und das Ende jedes Satzes war: »Suzon, küsse mich.« Zuerst hielt mich der Respekt zurück. »Na du«, wandte sie sich von neuem an mich, »du großer Junge, willst du mich nicht auch küssen?« Ich machte einige Schritte vor und küßte sie auf die Wange; ich wagte mich noch nicht an den Mund heran. Der Kuß war etwas feuriger als der erste. Übrigens war ich ihr gegenüber nicht leidenschaftlicher als sie gegen mich. So teilte sie ihre Zärtlichkeiten zwischen mir und meiner Schwester, um mich über den Grund ihrer Liebenswürdigkeit auf eine falsche Spur zu lenken. Ihre Politik gab mir Selbstbewußtsein, ich war geschickter, als mein Gesicht hätte vermuten lassen. Unmerklich paßte ich mich dieser kleinen Hausarbeit so gut an, daß ich den Refrain gar nicht erst abwartete, um meinen Teil hinwegzunehmen. Nach und nach fand sich meine Schwester des ihrigen beraubt. Ich machte mich in dem ausschließlichen Privileg breit, die Gunstbezeigungen der Dame allein zu genießen, Suzon hatte nur noch das Wort.
Wir saßen auf dem Kanapee und plauderten, denn Madame Dinville war eine große Schwatzbase. Suzon befand sich an ihrer rechten, ich war an ihrer linken Seite. Suzon sah in den Garten. Madame Dinville hatte ihre Blicke auf mich geheftet. Sie amüsierte sich damit, meine Frisur in Ordnung zu bringen, mich in die Wange zu kneifen, mir zarte Ohrfeigen zu geben, und ich vergnügte mich damit, ihr meine Hand um den Hals zu legen, zuerst mit Zittern. Ihre behäbigen Manieren gaben mir leichtes Spiel; ich war erstaunt, sie sagte kein Wort, betrachtete mich, lachte und ließ mich gewähren. Meine Hand war im Anfang furchtsam, wurde aber kühner durch die Möglichkeit, die sich fand, mich zu befriedigen. Sie stieg langsam vom Hals zum Busen und ließ sich mit Entzücken auf ihm nieder, wo ihn seine Elastizität in Schwingungen versetzte. Mein Herz schwamm in Freude; schon hielt ich die einer Schüssel ähnlichen Formen, die sich stolz und sicher an meinen Fingern rieben. Ich war gerade im Begriff, meinen Mund darauf zu drücken – durch Vorrücken kommt man zum Ziel. Ich hätte, glaube ich, mein Glück bis zum Ende ausgekostet, als sich ein verwünschter Störenfried im Vorzimmer hören ließ, der Amtmann des Dorfes, ein alter Affe, den mir der Teufel, eifersüchtig über mein Glück, daherschickte.
Madame Dinville kam durch das Geräusch, das dieses Original bei seiner Ankunft machte, zu sich und sagte mir: »Was machen Sie da, kleiner Strolch!« Bestürzt zog ich meine Hand zurück. Ich wurde rot, ich hielt mich für verloren. Madame Dinville sah meine Verlegenheit und ließ mich durch einen leisen Seufzer und ein entzückendes Lächeln merken, daß ihr Zorn nur gespielt war, und ihre Blicke sagten mir, daß ihr meine Kühnheit weniger mißfiel als die Ankunft dieses dummen Amtmanns.
Er trat ein, der langweilige Kerl. Nachdem er gehustet, gespuckt, geniest und sich geschneuzt hatte, begann er seine Ansprache, die noch langweiliger war als sein Gesicht. Wenn wir davon befreit gewesen wären, so wäre das Unglück nur halb so groß gewesen, aber es schien, als hätte das Unheil allen Unglücksraben des Dorfes das Wort erteilt, die nach und nach an die Reihe kamen, ihren Bückling zu machen. Ich geriet in Wut. Nachdem Madame Dinville alle die dummen Glückwünsche beantwortet hatte, drehte sie sich zu uns herum und sagte: »Oh, dies Leid, meine lieben Kinder! Ihr kommt morgen zum Essen zu mir, da werden wir allein sein.« Es schien mir, als würfe sie bei diesen Worten einen liebevollen Blick auf mich. Mein Herz fand seine Rechnung in dieser Versicherung, und ohne mir nahe treten zu wollen, fand sich meine kleine Eigenliebe geschmeichelt. »Ihr kommt also, hörst du, Suzon?« fuhr Madame Dinville fort. »Und du bringst Saturnin mit. Adieu, Saturnin«, sagte sie und gab mir einen Kuß. Damit waren wir einander nichts mehr schuldig. Suzon und ich gingen.
Ich fühlte mich in einer Verfassung, in der ich sicher Ehre bei Madame Dinville eingelegt hätte, wenn nicht die langweiligen Gratulanten dazwischengekommen wären. Aber was ich für sie fühlte, war keine Liebe, es war nur ein heftiges Verlangen, mit einer Frau das gleiche zu machen, was Pater Polycarpe mit Toinette getan hatte. Die Frist von einem Tag, die mir Madame Dinville gesetzt hatte, schien mir eine Ewigkeit. Ich versuchte unterwegs, Suzon auf die Sache zu bringen, indem ich sie an das Abenteuer vom Abend vorher erinnerte. »Wie einfältig du bist, Suzon«, sagte ich ihr. »Glaubst du denn, daß ich dir weh tun wollte?«
»Was wolltest du mir denn machen? Vielleicht ein Vergnügen, was?« antwortete sie überrascht. »Wie du mir mit der Hand unter den Rock fuhrst, hast du mir etwa was Angenehmes tun wollen?«
»Wenn du willst, daß ich dir das beweise«, sagte ich, »so komme mit mir, irgendwohin, wo wir ungestört sind.« Ich betrachtete sie unruhig, ich suchte in ihrem Gesicht zu lesen, welche Wirkungen meine Worte hervorbrachten; ich sah keine größere Lebhaftigkeit darin als sonst. »Willst du, meine liebe Suzon?« fuhr ich unter Liebkosungen fort.
»Aber, noch einmal«, erwiderte sie, sich mit meinem Vorschlag einverstanden zu erklären, »was ist das für ein Vergnügen, von dem du so viel Aufhebens machst?«
Ich antwortete ihr: »Das ist die Vereinigung eines Mannes mit einer Frau, die einander küssen, die sich aneinanderdrücken und die in diesem engen Verschlungensein ineinander ergießen.« Die Augen fortwährend fest auf das Gesicht meiner Schwester gerichtet, ließ ich keine ihrer Gemütsbewegungen meinen Blicken entgehen; ich sah das fast unmerkliche Anwachsen ihrer Begierden; ihre Brust hob sich.
»Aber«, sagte sie mit einer sonderbaren Naivität, die mir von guter Vorbedeutung schien, »mein Vater hat mich einige Male so gehalten, wie du sagst, und ich habe keinerlei Vergnügungen gespürt.«
»Das kommt daher«, erwiderte ich, »daß er dir nicht das machte, was ich dir wohl machen möchte.«
Mit zitternder Stimme fragte sie: »Oh, was möchtest du denn machen?«
»Ich würde dir«, antwortete ich keck, »etwas zwischen die Schenkel stecken, was er nicht wagte.« Sie wurde rot und ließ mich in ihrer Verwirrung fortfahren: »Siehst du, Suzon, du hast da ein kleines Loch« – damit zeigte ich an die Stelle, wo ich bei Toinette die Spalte gesehen hatte.
»Na, wer hat dir das gesagt?« fragte sie mich, ohne mich dabei anzusehen.
»Wer es mir gesagt hat?« erwiderte ich. »Das ist, weil ... weil alle Frauen eines da haben.«
»Und die Männer?« fuhr sie fort.
»Die Männer«, erwiderte ich, »haben einen Stecken da, wo du einen Wuschelbart hast. Diesen Stecken schiebt man in die Ritze, und das macht das Vergnügen, das ein Weib am Mann hat. Willst du meinen sehen? Aber nur unter der Bedingung, daß ich dein Löchelchen berühren darf. Wir werden einander kitzeln und uns sehr wohl fühlen.«
Suzon war wie mit Purpur übergossen; meine Reden schienen sie zu überraschen. Es schien, als ob sie Mühe hätte, meinen Worten Glauben zu schenken. Sie wollte nicht, daß ich meine Hand unter ihren Rock stecke, weil sie, wie sie sagte, fürchtete, daß ich sie täuschen wollte und nicht alles gesagt hätte. Ich versicherte ihr, daß mir nichts auf der Welt jemals ein Geständnis entreißen könnte. Um sie von dem Unterschied zwischen uns zu überzeugen, von dem ich gesprochen hatte, versuchte ich, ihre Hand zu ergreifen. Sie zog sie weg und wir setzten unsere Unterhaltung bis zum Hause fort.
Ich sah wohl, daß das kleine Luder Gefallen an meinem Unterricht fand, und es kam mir nicht schwierig vor, sie am Schreien zu hindern, wenn ich sie noch einmal beim Blumenpflücken finden sollte. Ich brannte vor Begierde, die letzte Hand an meinen Unterricht zu legen und die Praxis damit zu verbinden.
Kaum waren wir in das Haus getreten, als wir Pater Polycarpe ankommen sahen. Ich erriet den Grund seines Besuches und zweifelte schon gar nicht mehr daran, als Se. Reverenz behäbig erklärte, er wolle zusammen mit der Familie essen. Man hielt Ambroise für weit entfernt. Man muß zwar eingestehen, daß er sie kaum genierte, aber man fühlt sich doch stets behaglicher, von der Gegenwart eines Ehemannes befreit zu sein, so bequem er auch sein mag.
Ich zweifelte nicht daran, daß ich diesen Nachmittag das gleiche Schauspiel haben würde wie am Tage vorher, und faßte sofort den Entschluß, dies Suzon mitzuteilen. Ich dachte mit Recht, daß ein derartiger Anblick ein vortreffliches Mittel sei, meine Absichten der Verwirklichung näher zu bringen. Ich sprach nicht mit ihr darüber und verschob dieses Kampfmittel auf den Nachmittag, fest entschlossen, es nur im Notfalle anzuwenden.
Der Mönch und Toinette genierten sich sehr wenig in unserer Gegenwart; sie hielten uns für wenig gefährliche Zeugen. Ich sah die linke Hand des Paters geheimnisvoll unter dem Tisch verschwinden und an den Röcken Toinettes herumarbeiten, die ihm zulächelte und, wie mir schien, ihre Beine öffnete, um dem wollüstigen Finger des Mönches den Weg freizumachen.
Toinettes ihrerseits hatte eine Hand auf dem Tisch, eine darunter und machte offenbar dem frommen Pater das, was er ihr machte; ich war auf dem laufenden. Die kleinsten Begebenheiten bemerkt ein aufgeklärter Geist. Der ehrenwerte Pater zechte in flinken Zügen. Seine Wünsche gelangten bald so weit, daß er sich durch unsere Gegenwart gestört fühlte, was er uns zu verstehen gab, indem er meiner Schwester und mir riet, einen Spaziergang durch den Garten zu machen. Ich verstand, was das heißen sollte. Wir standen sofort auf und gaben ihnen durch unser Verschwinden die Möglichkeit, etwas anderes zu tun, als die Hände unter den Tisch zu stecken. Neidisch auf das Glück, das sie infolge unseres Weggangs auskosten konnten, versuchte ich nochmals, bei Suzon zum Ziel zu kommen, ohne die Hilfe des Bildes, das ich ihren Blicken darbieten wollte. Ich führte sie zu einer Baumallee, deren dichtes Blätterwerk eine solche Dunkelheit verbreitete, daß sie meinem Vorhaben durchaus günstig schien. Sie durchschaute meinen Plan und wollte mir nicht folgen. »Schau, Saturnin«, sagte sie unschuldig, »ich merke, daß du wieder davon reden willst. Meinetwegen, sprechen wir darüber.«
»Es macht dir also Spaß«, erwiderte ich, »wenn ich davon plaudere?« Sie gestand mir das ein. Ich sagte zu ihr: »Urteile nach dem Vergnügen, das dir meine Worte gewähren, über das, was du haben würdest, wenn ...« Ich sagte nichts weiter, sondern sah sie nur an und preßte ihre Hand gegen mein Herz.
»Aber, Saturnin«, meinte sie, »wenn ... wenn das nun weh tut?«
»Welchen Schmerz kann es bereiten?« erwiderte ich, entzückt zu sehen, daß nur noch ein schwacher Widerstand zu überwinden war.
»Gar keinen?« antwortete sie rot werdend und die Augen senkend. »Und wenn ich dick würde?«
Dieser Einwurf überraschte mich ganz sonderbar. Ich hatte Suzon nicht für so wissend gehalten und muß gestehen, daß ich ihr keine befriedigende Antwort zu geben wußte.
»Wieso denn dick?« sagte ich ihr. »Werden die Frauen auf diese Weise schwanger?«
»Zweifellos«, antwortete sie mit einem Ton der Sicherheit, der mich erschreckte.
»Und woher weißt du das?« fragte ich sie, denn ich fühlte wohl, daß sie jetzt an der Reihe war, mir Unterricht zu geben. Sie entgegnete mir, daß sie es mir wohl sagen wolle, daß ich aber nie in meinem Leben davon sprechen dürfte.
»Ich halte dich für verschwiegen, Saturnin«, fügte sie hinzu, »und wenn du jemals den Mund öffnen solltest, um über das zu reden, was ich dir jetzt anvertraue, würde ich dich bis zum Tode hassen.«
Ich schwor ihr, daß ich niemals darüber reden würde.
»Setzen wir uns hierher«, fuhr sie fort, indem sie auf einen Rasenfleck zeigte, auf dem man am besten plaudern konnte, ohne gehört zu werden. Ich hätte lieber die Allee gehabt, wo wir den Ohren und den Augen anderer verborgen gewesen wären; ich schlug diese von neuem vor, aber Suzon wollte nicht.
Wir ließen uns auf dem Rasen nieder: zu meinem großen Leid. Um das Unglück vollständig zu machen, sah ich von ferne Ambroise herankommen.
Da ich für diesmal keine Hoffnung mehr hatte, fügte ich mich. Die Neugierde, zu erfahren, was mir Suzon mitzuteilen hatte, zerstreute meinen Kummer,
Bevor sie zu sprechen anfing, verlangte Suzon neue Gelübde des Schweigens von mir; ich schwor. Sie zögerte doch noch und wagte immer noch nicht zu sprechen. Ich drängte sie so stark, daß sie endlich nachgab.
»Also, was geschehen ist«, sagte sie mir, »ich will dir glauben, Saturnin. Höre! Du wirst erstaunt sein über das, was ich alles weiß, das sage ich dir im voraus. Du glaubtest mich so viel lehren zu können. Ich weiß davon mehr als du. Du wirst es gleich sehen. Aber glaube deshalb nicht, daß ich aus diesem Grund weniger Vergnügen an dem gehabt hätte, was du mir erzählt hast. Man spricht immer gern von dem, was gefällt.«
»Wie das? Du sprichst wie ein Orakel. Man merkt wohl, daß du im Kloster warst! Wie das ein junges Mädchen bildet!«
»Ja, wirklich«, antwortete sie mir, »wenn ich nicht da gewesen wäre, wüßte ich manches nicht, was ich weiß.«
»So sage es mir doch«, entgegnete ich lebhaft, »ich sterbe vor Ungeduld, es zu hören.«