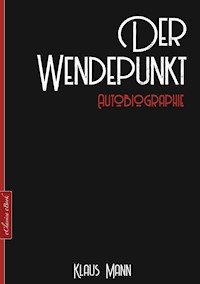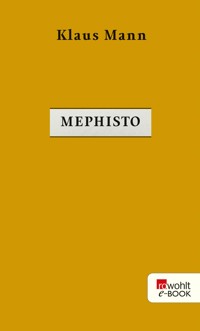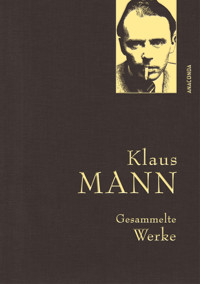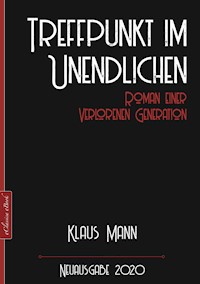
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EClassica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Klaus Mann: Treffpunkt im Unendlichen - Roman einer verlorenen Generation | Neu editierte Ausgabe 2020 || Die Zwanziger Jahre, Berlin und Paris: Sonja, die Schauspielerin, und Sebastian, der Nachwuchs-Schriftsteller, sind Teil jener Lost Generation, die während und nach dem Ersten Weltkrieg, dem Sündenfall und Trauma aller Intellektuellen, aufwuchs. Alte Werte sind im Kanonendonner zerstoben, neue noch nicht vorhanden. Man experimentiert mit Drogen, Kunst, freier Liebe und Homosexualität; man lässt sich treiben - kein Ziel vor Augen. Nur wenige ahnen: Eine Entscheidung steht bevor. Triumphieren wird eine Ideologie, die auf dem Marktplatz der Möglichkeiten zu dieser Zeit nur eine unter vielen ist: der Nationalsozialismus, die Unkultur in Reinform, das pure Gegenteil der Bohème, der sich die jungen Leute zugehörig fühlen. Ein großartiger Roman, der das Lebensgefühl der "Wilden Zwanziger" wie kaum ein anderer trifft. © Redaktion eClassica, 2020
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
— INHALT —
Innentitel
Über das Buch
Über den Autor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Impressum
Über das Buch
Die Zwanziger Jahre, Berlin und Paris: Sonja, die Schauspielerin und Sebastian, der Nachwuchs-Schriftsteller, sind Teil jener Lost Generation, die während und nach dem Ersten Weltkrieg, dem Sündenfall und Trauma aller Intellektuellen, aufwuchs. Alte Werte sind im Kanonendonner zerstoben, neue noch nicht vorhanden. Man experimentiert mit Drogen, Kunst, freier Liebe und Homosexualität; man lässt sich treiben – kein Ziel vor Augen. Nur wenige ahnen: Eine Entscheidung steht bevor. Triumphieren wird eine Ideologie, die auf dem Marktplatz der Möglichkeiten nur eine unter vielen ist: der Nationalsozialismus, die Unkultur in Reinform, das pure Gegenteil der Bohème, der sich die jungen Leute zugehörig fühlen. In diesem Milieu, den ›Wilden Zwanzigern‹, treiben Sonja und Sebastian aufeinander zu wie parallele Linien, die sich erst im Unendlichen treffen. – Ein großartiger Roman, der das Lebensgefühl der damaligen Zeit wie kaum ein anderer trifft.
Über den Autor
Klaus Mann war der älteste Sohn des Schriftstellers Thomas Mann, geboren als dessen zweites Kind nach Schwester Erika, am 18. November 1906 in München. Von einem leichtfertigen, selbstbezogenen und bohéme-artigen Nachwuchsschriftsteller, der im Schatten seines berühmten Vaters stand, entwickelt er sich im Lauf der Jahre zu einem der wichtigsten Kritiker der Nazi-Diktatur im Exil. Er arbeitet für im Ausland publizierte Widerstandsblätter und geht in den USA auf Vortragsreisen, um das Bild eines ›anderen‹, humanen Deutschland zu vermitteln. Drogensucht, oft unglücklich gelebte Homosexualität und ein schwieriges Verhältnis zum ›Übervater‹ Thomas Mann ließen ihn häufig am Leben zweifeln und mit Selbstmordgedanken spielen. Am 21. Mai 1949 starb er in Cannes nach einer Überdosis Schlaftabletten.
1
Berlin, den 6. Oktober 193... Am Bahnhof Zoo.
Viele Taxis fahren vor; dazwischen, seltener, ein eleganter Privatwagen. Aus einem Auto steigt ein Mann, aus einem anderen eine Frau; aus diesem dritten ein Paar mit Kindern, aus dem vierten ein Paar, kinderlos. Auf dem Dach dieses fünften liegt ein großer Koffer. Er wird heruntergehoben. Es steigen aus: eine sehr große Dame mit einem blassen jungen Gesicht; ein kleiner Herr mit hängendem schwarzen Schnurrbart; ein junger brünetter Mann, ohne Hut, mit offenem Trenchcoat.
Sie wollen zum Pariser Morgenzug.
Do bezahlte das Taxi. Sie wusste, dass es Sebastian gerne hatte, wenn man Kleinigkeiten für ihn auslegte. Sebastian sagte nervös zum Träger, der sich den großen Koffer auflud: »Glauben Sie, dass er noch mitkommt? Wäre idiotisch, wenn ich die Sachen heute nacht nicht hätte …« Er sprach so gehetzt, dass der Mann ihn misstrauisch ansah. Doktor Massis sagte mit zartem Lächeln: »Tiens – unser Freund hat Reisefieber.«
Während Do sich um die Gepäckaufgabe bekümmerte, kaufte Sebastian Zeitungen und Zigaretten. Gegen seine Gewohnheit war er streitsüchtig und ungeduldig mit den Leuten, die ihn bedienten. »Nein, ich wollte doch ohne Mundstück«, machte er enerviert. »Ach, ich muss mir ja auch noch französisches Geld einwechseln.« Obwohl er viel reiste, erregte es ihn jedes Mal wieder. – Inzwischen kam Do mit dem Schein für den aufgegebenen Koffer.
Sie ging, ohne ihn zu beachten, an Doktor Massis vorbei, der nervös an den Enden seines Schnurrbartes kaute. Sie winkte mit dem Kofferschein wie mit einer Blume. Der Gang war schön und beschwingt, mit dem sie durch die Bahnhofshalle auf Sebastian zukam. Sie wiegte sich leicht in den Hüften und lachte. Sie lachte mit großem und geschwungenem Mund, wobei ihre Augen freilich ernst blieben. Als sie Sebastian gegenüberstand, überragte sie ihn um einen halben Kopf. Sie war sehr schlank im hellgrau karierten, knapp gegürteten Mantel.
»Wie viel hast du für mich ausgelegt?« fragte Sebastian. Sie lachte: »Das soll meine letzte milde Gabe für dich sein.« – »Sei nur nicht so sicher, dass es die letzte ist.« Er lachte auch, während er das Papier einsteckte.
Inzwischen war das Auto angekommen, in dem Frau Grete mit zwei jungen Leuten zum Bahnhof Zoo gefahren war. Frau Grete nahte sich eilig, ihr Busen wogte, sie kam bunt und stattlich daher, Blumen im Arm, die schönen, dunklen Augen kurzsichtig zusammengezogen und erregt mit den Nüstern schnuppernd. Sie rief laut: »Sebastian – Engel!« und hielt ihm die Blumen hin. Dann sagte sie gleich: »Da ist ja auch mein Herr Chef!« – denn sie arbeitete als Sekretärin bei Doktor Massis. Der suchte nach etwas Ironischem, was er antworten könnte, fand aber nichts und lächelte nur fein. Frau Grete küsste erst Sebastian, dann Do. Währenddessen waren auch die jungen Leute herangeschlendert.
Richard Darmstädter drückte dem Sebastian innig die Hand. Die Art seines Blickens war vertraulich und intensiv. Auf seinem langen, rassigen Gesicht standen Schweißperlen. Er brachte dieses erregte und sentimentale Antlitz, in dem die schwarzen Brauen an der Nasenwurzel temperamentvoll zusammenwuchsen, in bedenkliche Nähe von Sebastian. Dabei schwieg er bedeutungsvoll und ergriffen.
Der andere junge Mensch verhielt sich zurückhaltender und konventioneller. Er war ein eleganter und schöner junger Engländer, der einen braun-seidigen Tschau-Hund an der Leine führte. Der Tschau-Hund hieß Leu und schien empfindlich, ja äußerst scheu von Charakter, obwohl er mit seiner Mähne, seinen kleinen goldenen Augen etwas von einem Miniaturraubtier hatte, von einer Zwergmischung aus Bär und Löwe. Mitten auf seiner Stirne, zwischen den Augen, bildete ein schmales Stück schwarzen Fells eine Art dunkler Falte, was seinem Blick, seinem ganzen Ausdrucke etwas Ängstliches und Besorgtes verlieh.
Do nahm die Perronkarten für alle. Sie gingen die Treppe hinauf, die zum Bahnsteig führte. »Noch acht Minuten, Sebastian«, sagte feierlich Richard Darmstädter. Jemand fragte: »Wo ist Gregor Gregori?« Sebastian, der vorne neben Frau Grete ging, wandte sich um: »Von dem habe ich mich schon verabschiedet.« Der junge Engländer bemerkte mit etwas schwerer Zunge – oder klang sein Deutsch nur behindert durch den englischen Akzent?: »Natürlich – wenn die alten Freunde arrivieren, machen sie sich rar.« Diese Bemerkung ward als taktlos empfunden, es entstand eine kleine Pause. Schließlich bemerkte Frau Grete, die stets auf dem laufenden war: »Er konnte ja gar nicht kommen, denn heute früh trifft seine Freundin aus München ein; diese Sonja. Kennst du sie eigentlich?« wandte sie sich an Sebastian. – »Nein, Gregor hat mir nur dauernd von ihr erzählt.« Sebastian antwortete mit einem merkwürdigen Anflug von Ungeduld in der Stimme, als habe man ihn nach einem Gegenstand gefragt, über den er so viel habe hören müssen, dass er ihn nachgerade unerträglich langweilte.
Der junge Engländer, der übrigens Freddy hieß, hatte wegen seines schüchternen braunen Tieres Streit mit einer älteren Dame bekommen, wobei er sich sehr reizbar und hochfahrend zeigte. Sein helles und breites Gesicht flammte rot; er stampfte. Als die Dame ihn schließlich kurzerhand »Sie Lausejunge!« nannte, schrie er mit funkelnden Augen: »I am a British boy!« – wozu Doktor Massis gedämpft bemerkte: »Dabei ist unser guter Freddy zu drei Vierteln Amerikaner.«
Derart abgelenkt, wandten sie alle dem Zuge, der unerwartet einfuhr, den Rücken. Der Schaffner schrie schon sein: »Einsteigen! Einsteigen!« und Sebastian, wieder von Nervosität gepackt, lief einige Schritte sinnlos umher, um seinen Träger zu finden. Der war aber schon dabei, die Handkoffer im Zweite-Klasse-Raucherabteil zu verstauen. Sebastian hatte erst vor, allen seinen Freunden auf dem Bahnsteig die Hand zu schütteln, überlegte es aber anders, sprang die Stufen hinauf in den Wagen, lief den Gang hinunter, bezahlte im Coupé erst den Träger und versuchte dann die Scheibe herunterzulassen, um denen draußen adieu zu sagen. Es gelang ihm nicht gleich, er stellte sich ungeschickt an. Hastig zerrte er am Riemen, indessen klopfte Richard Darmstädter von außen mahnend an die Scheibe. Endlich war der Trick gefunden, die Scheibe sank – da setzte sich der Zug auch schon in Bewegung.
Die fünf Personen, denen Sebastian winkte, standen auf dem Pflaster nebeneinander, plötzlich ein dickes und kompaktes Häufchen Menschen, das zusammengehörte. Er, über ihnen, schon ganz isoliert, schon ganz fern, losgelöst und entschwindend. ›Welcher Schriftsteller‹, dachte Sebastian, ›hat gesagt, bei jeder Abreise verwandelt sich der, welcher am Coupéfenster steht, in einen Pfeil, der gefiedert ins Ferne zielt; der aber, der am Bahnsteig zurückbleibt, in ein Ei, aus dem die Bewegung noch nicht geboren ist. Stolz des Scheidens, des Bald-nicht-mehr-da-seins; Stolz des Sterbens.‹
Sebastians Gesicht, das sich langsam davon bewegte, sehr allmählich weggezogen wurde, stand hochmütig über den Gesichtern seiner Freunde. Wie aus Mitleid beugte er sich noch einmal zu ihnen. Er berührte einen Augenblick Frau Gretes runden, kleinen schwarzen Hut und nahm dann die Hand, welche Do nach ihm streckte. Do hob ihre Hand, damit er sie noch einmal anfassen sollte. Er legte sie, als wenn er sie in aller Eile wärmen wollte, zwischen seine beiden Hände, und er fand noch einmal, wie schön Dos Hand war, mit den langen, schlanken, spitz zulaufenden Fingern; etwas abgemagerte und doch so unschuldige Hand. Do musste nun schon ein wenig laufen, um neben Sebastian zu bleiben. Die anderen liefen mit, nur Doktor Massis blieb stehen. Er rief plötzlich ganz konventionell: »Gute Reise!«, aber mit so geheimnisvoll gesenkter Stimme, dass es Sebastian nicht mehr hören konnte. Auch was Frau Grete ihm noch mitteilen wollte, verstand er nicht mehr, er sah nur noch ihr aufgerissenes, nacktes und buntes Gesicht, in dem plötzlich etwas wie Angst stand – eine ganz wilde, unerklärliche Angst. ›Wovor fürchtet sie sich nur?‹ dachte flüchtig Sebastian. Und dann: ›Wie schwammig und schlapp die Partie um den Mund bei ihr wird. Arme Frau Grete …‹
Er musste Dos Hand loslassen und empfing ihren letzten Blick, der tränenvoll war über dem lachenden Mund. Freddy und Richard waren zurückgeblieben; endlich gaben auch die beiden Frauen den Wettlauf mit der Lokomotive auf. Freddy rief plötzlich – es war viel zu spät – mit einer tiefen, brummenden Stimme: »Wiederkommen! Wiederkommen!« – während Massis seinen schwarzen Schlapphut im weiten Halbkreis schwang und sich ironisch tief verneigte. Ehe der Zug in die Kurve bog, erkannte Sebastian noch einmal Dos Gesicht. Nun glaubte er auch in ihren Augen Angst zu finden. ›Wovor fürchtet sie sich?‹ dachte Sebastian, während er sich vom Fenster zurückzog. Er dachte es so gründlich und besorgt, dass er mehrere Sekunden vergaß, sich hinzusetzen oder überhaupt seine Stellung zu ändern.
· · · · ·
Sonja, im schwarzen Pelzmantel mit grauem Kragen, winkte aus dem Coupéfenster: »Hallo, Gregor! Hallo! Hallo!« Gregor sagte aus Verlegenheit, noch ehe er Sonja begrüßte: »Da ist ja auch Froschele.« Froschele verkroch sich listig in sich selbst, sie schien winzig klein und verhutzelt zu werden, während sie hinter Sonja aus dem Schlafwagen stieg. »Kalt«, sagte sie zur Begrüßung.
Sonja und Gregor lachten; Sonja tief, herzlich und laut, Gregor etwas angespannt und verzerrt. In seinem fahlen Gesicht ist sein Mund entzündet, fleischig weich und dunkelrot. Er nimmt den hellgrauen leichten Hut ab, sein blondes, schütteres Haar weicht weit von den Schläfen zurück und ist auf der Scheitelhöhe künstlich über eine runde Glatze frisiert. Immer noch lächelnd – nun etwas schmerzlich, fast klagend – küsst er beiden Damen die Hand – Sonja und ihrer Gesellschafterin. Er lässt das schöne, fahle Gesicht über Sonjas Hand einige Sekunden lang, er streift sogar ihren Wildlederhandschuh zurück, um mit den Lippen ihr Fleisch zu finden. Sie, über ihm, fragt mit ihrer tiefen, aufgeräumten Stimme: »Und wie stehen die Geschäfte?« Er erwidert, auf eine larmoyant kokette Art die Silben ziehend und miauend: »Eigentlich glänzend.« Froschele bemerkt boshaft: »Unsere Gepäck ist futsch.« Sie lachen wieder und gehen dem Ausgang zu. Froschele trägt einen mausgrauen Paletot und ein mausgraues Käppchen, ein Zwergenhütchen, das ihr den Kopf merkwürdig vermummt; Gregor Gregori: einen offenen, braunen, etwas abgeschabten Ledermantel und den hellen Hut, dazu offene gelbe Spangenschuhe, eine Art Sandalen, die seinem federnden, schlenkernden und wiegenden Gang etwas exzentrisch Beschwingtes geben; etwas Schwereloses, als wollte er gleich auf und davon fliegen. Er lacht immer noch, während er singend und gezogen sagt: »Wunderbar, dass du da bist.« Wie er aber mit dem Träger verhandelt, hat er plötzlich eine knappe, militärisch zusammengenommene Ausdrucksweise und ein hochgehaltenes, fest und herrschsüchtig umrissenes Kinn …
Gregor Gregori ist erster Tänzer und Ballettmeister an einem der Berliner Opernhäuser; Sonja, die in München engagiert gewesen ist, soll in Berlin in einem Gesellschaftsstück und in einer klassischen Rolle gastieren. Froschele lebt seit einigen Jahren bei Sonja, als ihre Freundin eher denn als ihre Angestellte. Sie ist in Landshut geboren und das erste Mal in Berlin.
· · · · ·
Sebastian, in seinem Coupé Berlin—Paris, legte den Kopf an das Polster, das ihn gleichmäßig bebend und rüttelnd empfing. Er dachte: ›Nach tausend Leuten, die ihren Kopf hier angelehnt haben, nun also auch ich. Ekelt mich das? Nein, eher tut es mir wohl. Man gehört immer in einen Zusammenhang; bleibt immer Glied einer Reihe und ist niemals allein. Kahle Köpfe der Geschäftsreisenden, rote Frisuren der Damen, die nach Paris zu den Abenteuern und zu den Moden fahren. Nun also Sebastian, fünfundzwanzig Jahre alt, Journalist, Schriftsteller, könnte man wohl sagen; befreundet mit einigen Menschen; der Freund eines Mädchens namens Do; sonst allein.
Das war doch ganz deutlich Angst gewesen, vorhin in Frau Gretes und Dos Gesicht. Merkwürdig: Wovor fürchten sie sich? Weil ich abreise? Abreise …‹
Sein übermüdeter Kopf wiederholte diese Vokabel; die Räder des Zuges wiederholten sie mit. ›Abreisen, abreisen, abreisen. Ich reise ab, es reist mich ab, es reißt ab. – Wenn man so ein Wort sehr lange denkt, verliert es seinen Sinn, oder es bekommt einen anderen. – Die Angst in ihren Gesichtern. Der Pfeil und das Ei. Abreisen. Gestern nachmittag in der Rankestraße ist mir ein Geschäft aufgefallen – komisch, das hatte ich doch bis jetzt übersehen. Nein, nicht »Blütenschön – Blumen – Rosen auf Eis«, das kenne ich doch schon länger, und das liegt überhaupt in der Motzstraße. Vielmehr: ein Sarggeschäft. In einem Schaufenster, wo normalerweise Zigaretten, Strümpfe, Bücher oder Kuchen liegen: – Särge. Metallene Särge. Särge aus Eichenholz, Fichtenholz, schwarzem Stein. »Alle Beerdigungsangelegenheiten für In- und Ausland erledigt promptest …« Mitten in der Geschäftsstraße der Tod. Komisch. Der Tod – als Teil der Geschäftsstraße. Der Tod als Geschäft. Komisch, komisch.‹
Sebastian, die Augen zu, Kopf am speckig samtenen Polster, an dem Tausende vor ihm geruht haben, denkt: ›Sehr, sehr spassig und bemerkenswert. – Wir werden abgeholt. Abreise. Ich reise soeben ab. Ich werde abreisen. – Bitte exakt und prompt zu antworten, prompteste Erledigung der Frage: aus welcher Kraft erträgt man diesen spukhaft provisorischen Aufenthalt – Leben? Wir werden abgeholt. – Angst.‹
Er war schläfrig. Aus einer merkwürdigen Angst, wirklich einzuschlafen, tastete er nach dem Polster, auf dem er saß. Es war gerippt, in den Vertiefungen des Stoffes nisteten Ruß und Staub. Grüner Samt, Ruß und Staub – das sind schließlich Dinge, die zum Leben gehören. Sebastian tastete und schnupperte gierig.
Das ist also zweifelsohne noch Leben: Staub, Samt, Ruß. Rhythmus der Räder. Draußen, der graue Vormittag. Telegrafendrähte, steigend und sinkend, Wiesen, Zäune und Häuser. – Das ist zweifelsohne noch Gegenwart.
Wenn man mit allen Kräften an den Tod gedacht hat, lernt man schließlich eine neue Art, das Leben zu fassen. (Das ist also noch Leben, das habe ich noch.) Was man erfährt, ist eine merkwürdige Übersteigerung des Besitz- und Sammelinstinktes; dieses Licht spüre ich noch, diesen Ton fange ich auf – das macht mich gewiss für den Tod etwas reifer, das wird mein Leben wieder um ein weniges kompletter machen.
Sebastian kannte diese Lebenshabgier. Sie kam zuweilen, ebenso oft wie das andere, das ihr vorangehen musste. Jeden Blick, jeden Schritt, jeden Atemzug, den man auf diese Weise dem Besitz des Gelebten zuführte, um den Tod noch darum zu betrügen, sammelte man recht eigentlich für ihn – für den Tod – der eines Tages seine dunkle Hand auf diesen hastig zusammengerafften Besitz der winzigen Erinnerungen legen würde.
Fiebrig, um nur nichts zu versäumen, sah Sebastian sich im Abteil um: Lampe, Aschenbecher, Notbremse. Zuletzt bemerkte er das junge Mädchen, das ihm gegenübersaß.
· · · · ·
Doktor Massis, Do, Frau Grete und Richard Darmstädter hatten beschlossen, dass sie unbedingt erstes Frühstück zusammen haben müssten. Sie behaupteten alle, noch nüchtern zu sein, und bestellten in der Mampe-Stube am Kurfürstendamm sehr viel Kaffee, Brötchen, Käsestangen, Honig und Orangenmarmelade. Trotz einer gewissen Wehmut, die über ihnen lag, schienen sie doch bei gutem Appetit. Nur Do rührte nichts an.
»Kleine Do sieht wie eine Witwe aus«, sagte Doktor Massis und beschaute sie mit zärtlich schiefgehaltenem Kopf.
»Ich bin auch eine!« Do lächelte zu tränenfeuchten Augen.
Doktor Massis lächelte mit ihr, er stützte sein schlaues und nervöses Gesicht in die kleinen, zarten, schwarzbehaarten Hände. Es war das Antlitz eines feinen und sarkastischen Franzosen, pikant und überraschend gemacht durch einen slawischen, ja hunnischen Einschlag, der nicht nur durch den schwarzen, glänzenden Schnurrbart, sondern auch durch die zwar fein modellierten, aber entschieden zu hohen Wangenknochen entstand. Über ihnen spannte die Haut sich mattgelb, angegriffen und rau. Hinter den dicken, scharf geschliffenen Brillengläsern erkannte man die Augen fast nicht, man wusste nie, wohin ihr Blick ging. Nur zuweilen gab es ein überraschend dunkles und gefährliches Aufblitzen hinter den Gläsern.
»Wie lange will Sebastian eigentlich in Paris bleiben?« fragte der junge Engländer mit der schweren Zunge – er gehörte nicht ganz intim in diesen Freundeskreis, sondern trieb sich in verschiedenen Milieus herum und war nur zufällig auch in dieses geraten.
»Er sagt – vielleicht immer«, erklärte Do mit ihrer kummervollen kleinen Stimme.
»Dabei hat er nicht einmal einen festen Auftrag von einer Gazette …« bemerkte Doktor Massis auf eine sanft lispelnde und doch scharfe Art. Er hatte einen deutlich gallischen Akzent, obwohl seine Vorfahren seit verschiedenen Generationen Deutsche waren.
»Ja, nun wird unser netter kleiner Kreis ganz auseinanderfallen«, bemerkte Frau Grete betrübt – worüber Massis spöttisch lächelte. Do aber musste aufschluchzen.
»Er war doch das Zentrum«, sagte sie und schnupfte die Tränen; Frau Grete und Richard nickten. Beide überlegten einen Augenblick, was oder wie viel sie eigentlich von Sebastian gehabt hatten, genau berechnet. Es war nicht sehr viel, sie hielten ihn, bei all seiner Liebenswürdigkeit und Weichheit, eher für eine kühle Natur. Trotzdem hatte er, so passiv und nachlässig er war, die geheime Kraft, Menschen zusammenzuhalten. Sie fühlten alle, dass nun, da er fort war, Dinge geschehen könnten, die seine Gegenwart nicht geduldet hätte. Er würde ihnen vielleicht nicht so sehr fehlen – ersetzlich ist jeder, um jede Lücke schließt sich das alltägliche Leben – aber es würde einfach Schaden anrichten, dass es ihn zunächst nicht mehr gab.
»Mon pauvre enfant«, sagte Doktor Massis zu Do. »Sie schluchzt wirklich.« Er tupfte mit einem rotseidenen Taschentuch nach ihrem Gesicht, das sie aber zurückzog. »Tiens, tiens« – machte er gütig.
Auf ihren betrübten Wangen hatten die Tränen Spuren in den Puder gegraben, kleine Rinnen, Betten für weitere Tränen, die nun melancholisch-drollig in den vorgeschriebenen Bahnen dahinkullerten. Die Farbe ihres Gesichtes war nicht gut, auch die Beschaffenheit des Fleisches besorgniserregend. Ihr Fleisch schien grau und zu locker von Masse; nicht schwammig gerade, aber zu leicht, zu porös. – Der Blick, mit dem sie auf Doktor Massis’ scherzhafte Tröstungen reagierte, war nicht vertrauensvoll, sondern ziemlich böse und traurig. »Lassen Sie doch!« sagte sie. »Sie können sich immer nur über Gefühle lustig machen, zu denen Sie selber zu verdorben sind.« Doktor Massis versuchte die Miene eines gescholtenen Schuljungen aufzusetzen, was nicht sehr angenehm wirkte.
Plötzlich erhob Frau Grete die Stimme, um ihren Brotgeber anzufahren: »Do hat vollkommen recht, und jetzt machen Sie uns gefälligst kein so saublödes Gesicht, verstanden?! Sie sind und bleiben ein gefühlloses, altes Schwein!« Ihre kernigen Worte unterstrich sie, indem sie mit der Faust auf den Tisch schlug. Massis duckte den Kopf, aber unter der gesenkten Stirne konnte man erkennen, wie er pfiffig und genüsslich lächelte. Er hatte es zuweilen gerne, wenn Frau Grete ihn auf diese Art behandelte.
Alle lachten, am lautesten Richard Darmstädter, der sich zur Zeit um Frau Grete bemühte. Wenn Darmstädter lachte, bildete sein Mund eine beinahe viereckige Form – schwarzes Loch, schmerzlich aufgerissen. Seine Augen wurden dann wie aus schwarzem Glas, funkelnd und hart – während sie, wenn er ernst blieb, feucht und gefühlvoll blickten. Schwarzes und trockenes Haar wuchs ihm tief in eine niedrige, erhitzte Stirne. Auch seine lange, gebogene Nase war erhitzt, und seine Hände neigten zum Schwitzen.
Frau Grete dankte ihm für sein ehrenvolles Gelächter mit einem verlockenden Blick aus den dunklen, kurzsichtigen Augen. Sie spitzte die Lippen und legte ihre Hand eine Sekunde auf seine, die glühte. Er lachte weiter, von ihrer Berührung wie von elektrischer Strömung erregt. Nun schüttelte er sich sogar ein wenig beim Lachen. »Du bist ja wieder ganz groß …!« brachte er hervor. Der Engländer, der sein braunes Tier mit Käsestangen fütterte, fügte mit Bassstimme hinzu: »She’s always grand …« und warf Frau Grete einen lustigen und siegesgewissen Blick aus den eisgrauen Augen zu. Er war reizend, wenn man ihn bei guter Laune hielt. Leider war er von Natur aus misstrauisch und reizbar, ständig auf der Hut, gesellschaftlich nicht voll genommen zu werden.
Das allgemeine Gelächter hatte eine Situation entspannt, die gedrückt und befangen gewesen war. Plötzlich redete alles durcheinander, man fand, dass dieses Lokal eigentlich urgemütlich war – goldbraun getäfelt – man sprach von anderen Lokalen, mittendrin sah Do auf die Uhr und erklärte, dass sie eine Verabredung habe. Sie verlangte die Rechnung, der Oberkellner präsentierte sie, da kein anderer Miene machte, sich zu beteiligen, zahlte Do sie allein. Es machte acht Mark und fünfzig.
Draußen kam es noch zu einem kleinen Krach zwischen Massis und Frau Grete, die sich weigerte, sofort mit zum Diktat zu kommen. »Ich habe auch mal was Dringliches vor«, sagte sie, kampfbereit. Darauf er: »Das ist Nonsens. Wofür zahl’ ich dich?« – was sie wiederum sehr zänkisch und giftig machte. Er schrie sie mit einer plötzlich ganz hohen, scharfen und klirrenden Stimme an; sie antwortete keifend, die Arme in die Hüften gestemmt. Mit einem Schlage wurde sie ganz zur alten Kokotte, die sich in der Friedrichstraße mit ihrem Kavalier um den Preis zankt. In diesem Schimpfgefecht musste Massis auf die Dauer der Unterlegene bleiben. Schließlich wandte er wütend den Rücken und eilte mit trippelnden Schritten davon, wobei er die Schultern hochzog und nervös vor sich hin pfiff.
Do, die wieder ihr schmollendes Kindergesicht machte, ließ sich von Freddy mit braunem Hund nach Hause fahren. Sie wohnte nicht weit – in der Meineckestraße – aber sie behauptete zu müde zu sein, um nur einen Schritt zu Fuß zu gehen.
· · · · ·
Sebastian versuchte in einer der Zeitschriften zu lesen, die er vor sich auf dem Klapptischchen sortiert hatte, aber die Augen taten ihm weh. Als er sich eine Zigarette anzündete, schmeckte sie ihm nicht. Sein Mund war ausgetrocknet, der Rauch biss ihn am Gaumen und in der Kehle. Er überlegte, ob er eine von den Orangen essen sollte, die er oben im Netz in einer Tüte wusste. Aber er stellte sich das Schälen mühsam vor. ›Man holt sich klebrige Finger‹, dachte er und aß etwas Schokolade, was ihn noch durstiger machte.
Gleichsam zur Rache, weil er keinen Genuss von ihr gehabt hatte, bot er auch dem jungen Mädchen an, das ihm gegenübersaß. Das junge Mädchen war von einer gewissen dürftigen Lieblichkeit, mit einem kleinen, blonden, aufgestülpten Gesicht. Über der Stupsnase hatte sie runde und helle Augen, die Sebastian fast ununterbrochen leer und zärtlich musterten. Als er nun zu ihr hinsah und ihr sogar die Schokoladenschachtel reichte, wurde sie rot und lächelte verzagt. Sebastian beschloss, dass sie Kunstgewerblerin sein müsse. Sie trug auf einer braunseidenen Bluse eine anspruchsvoll schlichte, runde Silberbrosche. Sebastian erkannte, dass die Figuren auf der Brosche einen antiken Mythos darstellten, vielleicht Leda mit dem Schwan oder die beiden Wölfe, an deren Funktion er sich nicht genau erinnerte. – Er sagte: »Mögen Sie so was?« – womit er die Schokolade meinte. Das Mädchen wurde rot bis unter die Haarwurzeln und über den ganzen Hals. Sie nahm sich ein Bonbon mit spitzen Fingern, sagte so leise »danke«, dass man es nur als hingehauchten Laut vernahm, und senkte, während sie an der zähen Nougat-Süßigkeit kaute, wie beschämt ihre hellen Augen. Sebastian bemerkte noch, um ihr Mut zu machen: »Furchtbar langweilige Reise.« Worauf sie aber nur wieder lächelte und die Augen auf seine breite, hellbraune Stirne richtete. Sebastian wurde die Situation etwas peinlich, er stand auf und verließ das Coupé. Auf dem Korridor zündete er sich eine Zigarette an, obwohl sie ihm den Mund austrocknen würde. Er legte die Stirne gegen die Fensterscheibe, empfand mit Dankbarkeit, dass sie kühl war, und schloss die Augen.
›Warum bin ich eigentlich so verstimmt?‹ dachte er. ›Ist es wirklich, weil Gregori nicht am Zug gewesen ist? Ja, es ist wohl hauptsächlich deswegen. Er hätte es schon einrichten können, obwohl seine Freundin ankam – gerade weil wir in den letzten Monaten nicht ungespannt standen. Nein, gar nicht ungespannt, keineswegs. – Jetzt haben wir uns überhaupt nicht verabschiedet‹, konstatierte er mit einer bitteren Genugtuung.
›Es ist sehr gut, dass ich nun viele Stunden Zeit habe, das alles einmal gründlich mit mir durchzusprechen. Ich muss das wirklich mit mir in Ordnung bringen. Hoffentlich stört mich die junge Weibsperson dort drinnen nicht.‹
Er ging ins Coupé zurück, mit einer gewissen Pedanterie dazu entschlossen, endlich einmal mit seinem alten Freund Gregor Gregori innerlich reinen Tisch zu machen. Das junge Mädchen empfing ihn durch ein verstecktes und doch schamloses Aufblitzen ihrer runden, graugrünen Augen. Ihre Wimpern waren fast weiß, das gab ihren Augen etwas Entzündetes und Nacktes. – Sebastian legte sein Gesicht wieder ans Polster, aus dem ihm vorhin der Geruch der tausend Unbekannten gestiegen war, und stellte sich, als wollte er schlafen. Diese List wandte er an, um ungestört seine innere Besprechung abhalten zu können.
Das junge Mädchen hieß Annemarie und sollte in Paris als Modezeichnerin ausgebildet werden. Die Tante, bei der sie erzogen war, hatte sie loswerden wollen – ihre Eltern waren in Südamerika verschollen – und hatte ihr deshalb einen Wechsel von hundertfünfzig Mark monatlich genehmigt. Es war das erste Mal, dass sie reiste – und nun gar allein! – Mehr als den Berliner Westen und Heringsdorf kannte sie noch nicht von der Welt. Lüstern und unerfahren, wie sie war, verliebte sie sich in den jungen Mann, der ihr gegenübersaß, sofort dermaßen, dass ihr das Herz auf eine süße Art wehe tat und sie die Knie öffnete, um ihn zu empfangen.
Sie dachte: ›Dieser reizende junge Mann hat dunkles Haar, ganz offen gesagt, ist es ein bisschen zu fett und neigt deshalb dazu, in glatten, breiten Strähnen auseinanderzufallen. Er hat bräunliche Haut und trotzdem einen lichten Sattel von Sommersprossen über der Nase, was doch sonst häufiger bei Blonden ist. Er hat einen sehr, sehr angenehmen Mund, und von seiner breiten, hellen Stirn kommen meine Augen gar nicht mehr los. Zwischen den Augenbrauen hat er so einen empfindlichen Zug, immer wie etwas überanstrengt. Er hält sich zwar schlecht, aber ist doch elastisch. Ich möchte in Paris ein kleines Appartement mit ihm nehmen, ja, wie die Künstler es dort wohl haben. Sicher macht er Gedichte und interessante Romane. Jede Nacht bei ihm liegen. Seine Zähne sind auch recht schön. Sieht er nicht aus, als wenn er gerade von sehr anstrengenden Dingen träumte? – Träumt er von mir?‹
Sebastian, ihr gegenüber, dachte: ›Wer von uns beiden hat angefangen, ich oder Gregor? Habe ich damit begonnen, ihn nicht mehr völlig ernst zu nehmen, oder habe ich das erst getan, als ich merkte, dass er mich ein wenig verachtete? Darüber muss ich mir unbedingt klar werden, das ist natürlich sehr wichtig. Zur Zeit verachtet er mich etwas, das steht einmal fest. Er findet mich kompromissbereit, frivol und träge. Er fängt auch schon damit an, mich geringzuschätzen, weil ich weniger Geld mache als er. Das würde er nicht zugeben, es ist aber so. Gregor wird ohne Frage bald enorm viel Geld verdienen, er verdient jetzt schon mehr, als ich für einen Tänzer schicklich finde. Ich hingegen verdiene entschieden weniger, als für irgend jemand schicklich ist …
In letzter Zeit ist er auf eine schrecklich ungesunde Art aktiv geworden. Ja, ja, diese hysterischen Willensmenschen. Er bekommt auch schon so einen lächerlich markanten Zug ums Kinn. Dabei ist gerade sein Kinn von Natur weich. Alles Schwindel. – Es könnte doch sein, dass ich damit anfing, ihn zu verachten, als ich den markanten Zug das erste Mal an ihm bemerkte. – Wenn er diesen Unfug mit der Politik wenigstens lassen wollte, interessiert ihn im Grunde doch gar nicht, er hat keine Ahnung. Aber das braucht er; das braucht er, zum Beispiel, um behaupten zu können, ich lebte in Kompromissen. Als wenn ich mir nicht auch so blendende Scheinlösungen ausdenken könnte – zu dämlich, zu dämlich. Kompromisslerisch ist man also gleich, wenn man nicht so schnoddrig und gewalttätig ist, sondern ein bisschen gewissenhaft …? Aber, Gregor! – Und du warst doch so nett. Du warst doch wirklich von einer ganz begnadeten Nettigkeit, damals – damals …‹
Die List, die er dem Mädchen Annemarie gegenüber angewandt hatte, begann sich an ihm zu rächen: er war wirklich drauf und dran, einzuschlafen, die Gedanken verwirrten sich ihm.
Das Mädchen dachte: ›Jetzt löst sich die Spannung zwischen seinen Augenbrauen. Jetzt muss er ganz tief schlafen. Er hat den Mund halb offen und atmet gleichmäßig.‹
Sebastian, an der Grenze des Traumes, besann sich: ein Gebiet in Gregors Leben, von dem ich so gut wie nichts weiß, ist diese Sonja. Ich hätte eigentlich noch einen Tag in Berlin bleiben können, um sie endlich kennenzulernen. Ich stelle sie mir ziemlich streng vor, und dann doch wieder. – Nein, ich stelle sie mir ganz anders vor – ziemlich lustig …
Während er einschlief, dachte er nicht mehr an Gregor Gregori, sondern nur noch an die unbekannte Sonja.
· · · · ·
In ihrem Hotelzimmer fand Sonja einen großen Strauß weißer Rosen, dazu eine Karte, auf der stand: »Guten Tag, in Berlin, vom alten W. B.« – »Die sind vom alten Geheimrat Bayer!« sagte Sonja zu Froschele, die mit verkniffenem und misstrauischem Mienenspiel die Einrichtung des Zimmers musterte. »Er hätte statt dessen lieber Geld schicken sollen!« meinte Sonja fröhlich und trat vor den Spiegelschrank. Sie gefiel sich nicht und murrte. »Ich sehe wieder scheußlich verreist aus. Lauter schwärzliches Zeug im Gesicht. Fürchterlich, diese Eisenbahnen. Wär’ ich doch in meiner kleinen Kutsche gekommen!«
Froschele, die von einer Entdeckungsfahrt ins Badezimmer und in ihre eigene Stube zurückkam, behauptete, während sie sich neben Sonja vor den Spiegel stellte: »Ich bin entschieden noch mieser.«
Ihr Gesicht war nicht reizlos, trotz des eingekniffenen Mundes. Dieser Mund hatte ganz die Form, als ob er zahnlos wäre; auch die kleine, braune, zweimal gebuckelte, von Fältchen durchzogene Stirn und die dunklen, lebhaften kleinen Hände hatten etwas affenartig-zwergenhaft Vergreistes. Anderseits gab ihr die scheue und boshafte Haltung Ähnlichkeit mit einem halbentwickelten Schulmädchen, das, aggressiv vor Schüchternheit, hinter den Männern her kichert, die ihr gefallen. Ihr Körper, zugleich eckig und zart, schien wirklich der einer Vierzehnjährigen. Das hatten schon manche bezaubernd gefunden; auch Sonja, die Froschele von der Seite prüfte, ob sie wirklich so mies sei, war diesem Charme keineswegs unzugängig. – Abschließend stellte sie fest: »Du bist ganz komisch so, wie du bist.« Froschele kroch mit ihrem Kopf zwischen die spitzen Schultern. – »Der Gregori ist eigentlich recht ekelhaft«, sagte sie plötzlich mit einer flachen Münchener Schulmädchenstimme. Sonja lachte, während sie ihr Gesicht mit einem Stück Watte abrieb, das in Toilettemilch getränkt war. »Wie viel Dreck abgeht!« konstatierte sie und betrachtete, angewidert und interessiert, das Wattebäuschchen, das sich schwarz gefärbt hatte. – »Ach, weißt du, der Gregor …« sagte sie nachdenklich, als habe sie Froscheles Bemerkung erst jetzt gehört.
Gregor hatte sich vor dem Hotel von ihnen verabschiedet. »Ich muss auf die Probe ins Opernhaus, sei mir nicht böse, Sonja«, hatte er mit angespanntester Höflichkeit gesagt und war beflügelten Schrittes auf ein Taxi zugesprungen. Noch einmal winkend, hatte er sich mit flatterndem Ledermantel hineingeschwungen und dem Chauffeur herrschsüchtig über die Schulter zugerufen, wohin’s gehen sollte. Sonja erinnerte sich an jede seiner Gesten und Laute, wobei sie die Brauen zusammenzog, als müsse sie scharf kombinieren und aus alldem wichtige Schlüsse ziehen.
Unvermittelt spürte sie das Bedürfnis, etwas zu tun, Tätigkeit zu entwickeln. »Wir sind in Berlin, wir müssen telefonieren«, rief sie und eilte durchs Zimmer. »Außerdem haben wir noch gar nicht ausgepackt.« Sie öffnete einen Koffer, nahm mit großen Bewegungen einen Morgenrock, eine Kostümjacke heraus. Dann beschloss sie, doch erst zu telefonieren. »Ich muss das Theater anrufen wegen der Probe. Und dann diesen Sportlehrer Müller, ab morgen früh wird trainiert. Und dann den alten W. B., mich für die Röslein bedanken …« Sie verlangte das Amt.
Froschele sah ihr zu. Sie machte den Mund auf, so schön fand sie Sonja.
Sonjas dunkles Haar hatte einen rötlichen Schimmer. Sie trug es kurz geschnitten und locker, auf der linken Seite gescheitelt. Auch in ihren weiten dunklen Augen konnte man rötliche Lichter erkennen, die zuweilen ins Goldene spielten.
Froschele setzte sich hin, um ihr besser zusehen zu können, wie sie telefonierte.
· · · · ·
Frau Grete fuhr mit der Untergrundbahn bis zum Nollendorfplatz. Sie rührte sich nicht während der Fahrt, vielmehr saß sie, zugleich gestrafft und ein wenig frierend in sich zusammengezogen, das Kinn in den Kragen ihres schwarzen Pelzmantels gesteckt, die Hände im Schoße gefaltet, die Füße akkurat nebeneinander vor sich hingestellt, so wie man Schuhe vor die Zimmertüre zum Geputztwerden postiert. Sie starrte auf den schmutzigen Boden, wo Zigarettenstummel und zerrissene gelbe Fahrscheine lagen. Mit den oberen Zähnen nagte sie an der geschminkten Unterlippe, so dass die Zähne einen roten Rand bekamen, als habe sie in etwas Blutiges gebissen.
Haltestelle Nollendorfplatz stand sie schnell auf, durchschritt in einer Haltung, die plötzlich wieder auf ihre Umgebung konzentriert schien, wiegend und energisch den Wagen; eilte, am Schalterbeamten vorbei, die Stufen hinunter; überquerte den Nollendorfplatz, ohne den Kinopalästen, von denen grelle Plakate sie anschrieen, einen Blick zu schenken; bog in die Nollendorfstraße ein, ging fünf bis sechs Minuten raschen Schrittes die rechte Straßenseite hinunter. Das Haus, vor dem sie stehenblieb, war hässlich und grau wie irgendeines; unten gab es eine kleine Bierwirtschaft. Sie öffnete die schwere angelehnte Haustüre und stieg die halbdunkle Treppe hinauf. Alle paar Stufen musste sie stehenbleiben, um zu verschnaufen. Im vierten Stock klingelte sie, nickte der alten Frau, die öffnete, zu, ging über den finsteren Korridor, öffnete eine Zimmertür, ohne zu klopfen. Drinnen war die Luft trübe und ungelüftet. Im Bett lag ein junger Mensch, der ein blaukariertes Nachthemd anhatte. Er musste neunzehn oder zwanzig Jahre alt sein, als erstes fiel seine breite, ruhige und glatte Stirn auf, die Stirn eines schönen Tieres, eines Rindes. Auch sein Mund war breit, und wenn er sprach, bekam er etwas Malmendes, Käuendes. Seine Hände lagen schwer wie Gewichte nebeneinander auf der Bettdecke. Der Junge sagte: »Tag, Mutter.« Frau Grete öffnete erst das Fenster, setzte sich dann neben das Fenster auf einen roten Plüschsessel und sagte: »Erst muss ich mich mal verpusten.«
Nach einer Pause fragte sie ihn, ob er Fieber habe. Er sagte: »’n bisschen« und reckte sich im Bett. »Uff, ich mag nicht mehr liegenbleiben.« – »Untersteh dich!« Sie erhob sich aus ihrem Plüschsessel, um zu ihm ans Bett zu treten. »Du siehst noch grün aus, wie Ausgekotztes«, stellte sie angewidert fest und prüfte ihn aus zusammengekniffenen Augen. – »Na, bist ooch nicht gerade rosig, mein Schatz«, sagte er, wozu er kurz lachte. »Außerdem hast du wieder mal rote Zähne.« Sie lief zum Spiegel, um sich zu begutachten. »Na hör mal, Drecksjunge, ich finde mich toll in Form.« – »Kein Mensch würde glauben, dass ich dein Sohn bin«, sagte der Junge mit einer tiefen Stimme vom Bett her. Sie machte scharf: »Hoffentlich …« und nahm sich ihr kleines, schwarzes, etwas eingestaubtes Hütchen vom Kopf.
Im fleckigen Spiegelglas prüfte sie aus nächster Nähe ihr ramponiertes Gesicht. Sie fand es glänzend erhalten – »für das, was ich hinter mir habe«, sagte sie. Nur das nervöse Schnüffeln der Nase war eklig – ›das kommt vom Koks‹, dachte sie zornig und beschloss, sich wirklich mehr zu beherrschen, wenn sie unter Leuten war. Solange nur Walter es hörte, schadete es nichts. – »Ich seh’ immer noch nach mehr aus als zwanzig dumme Jöhren zusammen«, schloss sie grimmig ihre Selbstbetrachtung, wobei sie das Hütchen wieder aufsetzte.
Sie rückte den Plüschsessel, der im Zimmer die einzige Sitzgelegenheit war, neben das Bett und konstatierte: »Also der Herr hat Grippe.« Der Junge gähnte. »Kommt dein Mädel nicht mehr?« fragte die Mutter und schnüffelte misstrauisch. – »Nee; seit vorgestern ist das Stück nicht mehr hier gewesen.« Darauf die Mutter: »Also auch mit Pinkepinke Schluss?« Er nickte so gleichgültig, dass sie ihn anfuhr: »Du scheinst dir wohl nicht viel ernste Gedanken zu machen – wie?!« Er sah sie träge und verständnislos an. »So wie du möchte ich sein!« sagte neidisch Frau Grete. – Wie konnte man lächeln, wenn man nicht wusste, wovon den nächsten Tag leben? Von ihrem unruhvollen Ehrgeiz hatte der da nichts geerbt. War sein Vater denn wie er gewesen?
Um nicht an seinen Vater denken zu müssen, sagte sie unvermittelt: »Was zu fressen hab’ ich dir mitgebracht, oller Zuhälter«, und langte das Paketchen aus der Manteltasche. »Das is’n ganzes halbes Hühnchen, bei Borchardt gekauft.« Er nahm das Huhn in beide Hände, ohne sich zu bedanken. »Geld brauch’ ich auch«, sagte er nur.
Da fuhr sie denn doch in die Höhe. »Du bist wohl irre!« schrie sie, ehrlich erschrocken. »Schließlich finde ich’s ja auch nicht auf der Straße. Meinst du, ’s is’n Spass, für den meschuggenen Doktor zu arbeiten?!« Dabei kramte sie aber schon in ihrem Täschchen. »Weil du’s bist!« schloss sie plötzlich milde und reichte ihm den Zehnmarkschein mit halb weggewandtem Gesicht, als schäme sie sich der mütterlichen Weichheit. Er knüllte den Schein zusammen und schob ihn unter sein Kopfkissen; sie beobachtete ihn zärtlich. »Hast du’s wieder geschafft«, sagte sie. »Eine muss doch immer herhalten.«
Schon aufgestanden, ermahnte sie ihn noch, jetzt wieder mit scharfer Stimme: »Übrigens – dass du dich nicht noch Mal unterstehst, bei Massis anzurufen. Hat schon ganz wissbegierig gefragt, wer denn das wieder war. Der Mann is dir so enorm neugierig, is dir ja der Mann. Und die denken doch alle, ich bin dreißig Jahre. Is wirklich nich nötig, dass du mir die Tour vermasselst.« – »Ick weeß ja, ick weeß ja«, beruhigte er sie mit der tiefen, versoffenen Stimme eines Berliner Kutschers. – »Mit ’nem Jungen wie du als Sohn vor die Öffentlichkeit treten«, schimpfte sie, »könnte mir gerade passen …« – »Na, aufs nächste Mal, Mutter!« sagte der Junge. Sie brummte, noch erregt atmend: »Na, is doch wahr!« Und dann, während sie ihm schnell noch mal übers Haar fuhr: »Adieu, Walter!«
· · · · ·
Gregor Gregori zahlte das Taxi vorm Opernhaus, gab dem Chauffeur ein zu hohes Trinkgeld, wobei er, nervös summend, an ihm vorbeisah, und dachte, während er, das Kinn hochgestemmt, an der Portiersloge vorbeieilte: ›Ich muss hier bald mit meinem eigenen Wagen vorfahren, das geht so nicht weiter. Aber unter einem starken Amerikaner tu’ ich’s nicht. Mit Opel wird nicht erst angefangen …‹
Er traf auf dem Korridor einen hohen Verwaltungsdirektor, mit dem er sich fünf Minuten lang unterhielt. Er brillierte und funkelte, zierte sich mit hochgezogenen Schultern, schielte verführerisch mit blaugrün schillernden Augen. Mit den neuesten Scherzen und Skandalhistörchen wusste er in aller Eile aufzuwarten, wobei er das Kinn senkte, ein wenig an den Hals drückte, so dass einige Falten entstanden, und vertraulich von unten blickte. Der Direktor, derlei Tändeleien sonst unzugängig, fühlte sich bezaubert und schüttelte am Schluss Gregori warm, fast heftig die Hand, immer noch herzlich über all die kleinen Pointen lachend.
Gregor eilte hochgemut in seine Garderobe, um sich für die Probe umzuziehen. Er spürte auf der ganzen Haut ein Prickeln – Schauer der Genugtuung über den eben errungenen Sieg. ›Aus solchen Siegen baut sich eine Karriere‹, dachte er, während er das schwarze Trikot überstreifte. Er probierte seine Positionen vorm Spiegel: neuer Triumph, jeder Muskel straffte sich, wie er’s wollte! – Der Wille schafft’s, der Wille schafft’s – trällerte er, während er über den Korridor zur Bühne flog, trunken von Energien.
Das Orchester übte, die Tänzer lungerten, faul wartend, herum. Gregor Gregori klatschte von der Türe her in die Hände: »Herrschaften! Wir fangen an!« In die unfrische Luft der morgendlichen Szene fuhr seine Stimme, spannungsvibrierend. Er sprang vors Orchester. Wie er die Arme reckte und mit einem Blick die missgestimmten Mädchen und jungen Leute, die gerade noch in amorphen Knäueln herumgestanden hatten, zur Gruppe ordnete, war es, als ob sein ganzer gestraffter Leib zitterte, eine angespannte Bogensehne. Sein Gesicht schien vor Konzentration beinahe traurig zu werden, ein vor Spannung leidender Zug trat um die Augenbrauen und ums Kinn hervor. Sein fahles Antlitz, herrschsüchtig und melancholisch dieser Menschengruppe entgegengehalten, die der Befehle harrte, die er aussprechen würde, glänzte in einer so zusammengenommenen, strengen und pathetischen Schönheit, dass keiner gewagt hätte, in seiner anspruchsvollen Gegenwart laut zu reden.
Nur der kleine hässliche Tänzer, der die dämonische Charakterrolle innehatte, flüsterte seiner Partnerin zu: »Sieh da – der tänzerische Herrenmensch …«
· · · · ·
Sonja sagte am Telefon: »Sind Sie es wirklich, alter W. B.?« Sie hörte seine fette, tiefe und starke Stimme: »Sonja, wie schön, dass Sie da sind.«
Sie sah sein Gesicht, mit dem mächtig breiten Kinn, dem schwarzen, gestutzten Schnurrbart, den zugleich weichen und majestätischen Augen, das Gesicht eines jüdischen Cäsars. »Ich habe Sie als ersten angerufen – nach dem Theater und dem Trainer natürlich«, sagte Sonja und lachte. – »Wollen wir umgehend zusammen Mittag essen?« fragte auf der anderen Seite Geheimrat Bayer. Und Sonja: »Wenn es sein muss, sofort.«
2
Doktor Massis war Privatgelehrter. Das gestattete ihm seine finanzielle Lage. Sein Vermögen, das ein tüchtiger Vetter ihm über die Inflation gerettet hatte, war nicht groß, aber doch eben groß genug, dass er von den Zinsen behaglich leben konnte.
Er hatte eine Dreizimmerwohnung in der Dörnbergstraße, Nähe Lützowufer. Schlafzimmer und Esszimmer waren unauffällig, fast spießig möbliert, aber sein Arbeitsraum hatte skurrilen Charakter. Er war schwarz tapeziert und überfüllt mit bizarren Gegenständen. Wo keine Bücher standen oder in Stapeln lagen, hingen chinesische Masken, indianische Fratzengottheiten oder gespenstische Blätter moderner Meister (zum Beispiel ein ungemein verwunschener Kubin). Oben auf den Bücherschränken standen große Modelle von Segelschiffen, dazwischen ein menschlicher Embryo, im Spiritus grässlich gekrümmt.
Freunde nannten diese düstere Stube das Kabinett des Doktor Caligari, und Massis selbst pflegte über seine Dämonie zu scherzen. »Das sind so altmodische kleine Späße, die man sich gönnt.«
Sein Ehrgeiz war, vieldeutig zu erscheinen, was ihm bei seiner talmudistischen Verschlagenheit nicht übel gelang. Wozu er sich auch bekannte, immer ließ er noch geheime Hintergründe ahnen, niemals war im letzten festzustellen, wo sein Standort war. Was er preisgegeben hatte, nahm er durch ein ironisches Wort wieder zurück, und hatte er sich zu weit hervorgewagt, verhüllte er sich nachher um so gründlicher. Dabei wollte er nicht unzuverlässig oder unredlich scheinen, aber hinter jeder definitiven Erkenntnis, die er aussagte, hatte er stets eine noch definitivere in petto. Dieses Spiel hatte denselben Reiz wie der Blick in den Spiegel, dem ein anderer Spiegel gegenübersteht: die Verführung der unendlichen Perspektive, die foppende Kulissenwirkung einer falschen Ewigkeit. Freilich war jene Unterhaltung so trügerisch wie diese, beide entließen einen ungetröstet und unbelehrt.
Sehr gefährlich waren, zum Beispiel, politische Unterhaltungen mit dem Doktor Massis. Er begann meistens damit, dass er mit ironischem Lächeln jeden verschüchterte, der einen anderen Standpunkt hatte als den konsequent marxistischen. »Tiens, tiens, diese Voraussetzungen fehlen also«, machte er liebenswürdig-spöttisch. »Nie von einem gewissen Karl Marx gehört? Der historische Materialismus Ihnen unbekannt? Tiens, tiens. Aber, hören Sie, das sind Dinge, die sich einfach lernen lassen. Dialektisch denken kann jeder, der nicht gänzlich auf den Kopf gefallen ist. Sie müssen sich nur erst abgewöhnen, die Scheinwahrheiten einer bourgeoisen Terminologie ernst zu nehmen …« So beängstigend ging es weiter. Der Doktor zitierte Lenin, bemerkte so nebenbei: »Aber ich bitte Sie – ›Freiheit‹, das sind doch kapitalistische Vorurteile, ich habe Sie doch vor diesen idealistischen Flausen eigens gewarnt. Aber was heißt denn ›Wert des Individuums‹? Sie fangen an, mich nervös zu machen. Mann ist Mann, sagt der einzige lebende große Dichter. – Da wir also in spätestens fünfzehn Jahren – wenn Russland den Fünfzehnjahresplan durchgeführt haben wird – den neuen Weltkrieg und, daran anschließend, den Kommunismus haben werden …« begann er triumphierend eine große Satzperiode.
Man glaubte etwas zu haben, worauf man ihn festlegen könnte: den Marxismus, daran konnte man sich halten. Aber, siehe da, schon deutete er mit geheimnisvollem Augenzwinkern an, dass er so einfach nicht zu fassen sei. Hinter dem politischen Standpunkt eröffnete sich der, den er den theologischen nannte. Alles, was er gerade als definitiv geäußert hatte, wurde mit einemmal vorläufig, unwesentlich, nur Vordergrundswahrheit. Plötzlich warf er Gott in die Diskussion, er fiel hinein, ein ungeheures Gewicht, und zerstörte alle Gewebe, die der Doktor selbst gesponnen. Wo erst von Fünfjahresplan, der Überproduktion und der Planwirtschaft die Rede gewesen war, standen unvermutet Erzengel auf. Der Erlösungsgedanke, der gerade noch ein recht erdenschweres Antlitz gezeigt hatte, wurde metaphysisch stilisiert, und statt Lenin hieß es nun der Messias. Dem, der zuhörte, ward verwirrt zumute. War dieser vertrackte Massis treuer Sohn der katholischen Kirche? Warum sprach er dann plötzlich von der Kabbala? Und nun von vorderasiatischen Mysterien, zu denen er in schauerlich intimen Beziehungen zu stehen schien? Und nun sah er plötzlich ganz chinesisch aus. Er schlüpfte immer weiter nach Osten. Mit dem Mann war ein anständiges weltanschauliches Gespräch gar nicht möglich.
Denn nun gab er plötzlich – letzter und gefährlichster Trick – jeden Standort preis und gaukelte zynisch im Leeren. Er verkleidete sich als Ästhet, der nichts sucht als Reize und dem alles Wissen, alle Erkenntnis nur dazu dienen, immer neuere, sublimere und ausgefallenere zu finden. Über die Zukunft der Menschheit scherzte er verächtlich – »was geht der Pöbel mich an?« – indessen schwärmte er gelehrt und lüstern von orientalischen, spätrömischen und pariserisch-dekadenten Verfeinerungen. Der erst nur dem volkspädagogischen Lehrstück und der proletarischen »Gebrauchslyrik« Daseinsberechtigung zuerkannt hatte, las nun mit genießerisch perfekter Aussprache Strophen aus »Fleurs du mal« vor oder besonders raffinierte, laszive und schwierige Proben aus Huysmans. Er redete in spitzen und geistreichen Worten das Lob der extremen Individualisten, der einsamen Lüstlinge, der narzisstisch in sich selbst versunkenen; er feierte die Opiumesser, die Kinderverführer, Gilles du Rey, den Marquis Sade, alle rauschsüchtigen Gesellschaftsfeinde, die Diener des l’art pour l’art, die in jeder Künstlichkeit den Tod wittern und deren krankhaftem Reizbedürfnis erst der Ruch der Verwesung genügt. »Meine geliebten Freunde«, rief Doktor Massis, selbst benommen von seiner makabren Rhetorik, »wer behauptet, Kunst sei Gemeinschaftsdienst oder könne es auch nur sein?! Der Künstler, meine geliebten Freunde, ist ein Monomane des Egoismus, jeder Künstler ein vollendeter Narziss, jeder ganz allein sich selbst und seine Lüste anbetend, jeder ein Onanist, und wenn er drei Frauen liebte pro Tag. Das ist die Wahrheit. Ich weiß sie, denn, bei Gott, ich bin Künstler.«
Von solchem Gipfel anarchistischer Ekstase sprang er plötzlich mit unerhört kühnem Satz ins Gegenextrem, mit phantastischem Salto Mortale landete er dort, wo er ganz zu Anfang gewesen war. Dem Lauschenden blieb der Mund offen stehen vor Verblüfftheit, denn plötzlich hörte er ihn wieder von wirtschaftlichen Gegebenheiten, von der Einzelseele als Schwindel und von der Geburt der kollektiven Menschen reden. »Soziologie ist die einzige Betätigung, die eines geistigen Menschen heute würdig ist, solange er sich noch nicht für den Kampf um die Weltrevolution mit seinem Fleisch und Blut einsetzen kann«, behauptete er – und jedem wurde taumlig bei diesem Wirbel. – »Die Kunst hat wieder den wenig prominenten Platz einzunehmen, der ihr zukommt: sie ist eine keineswegs unentbehrliche Unterabteilung der Pädagogik und zuweilen für Werbezwecke nicht unbrauchbar. Als Erholungsmittel kommt sie nicht ernsthaft in Frage; zu diesem Zwecke ist Sport vorzuziehen …«
Als geübter Menschenfänger und Geheimniskrämer betrieb er sein Verwirrung stiftendes Handwerk seit zehn Jahren mindestens. Schon auf ziemlich viele Menschen hatte er Einfluss gehabt, vor allem auf Frauen, aber auch zuweilen auf junge Leute.