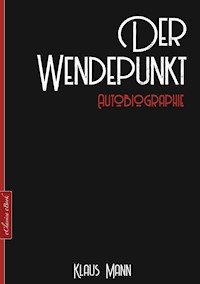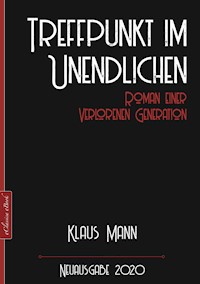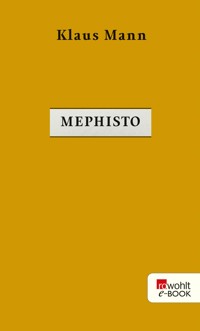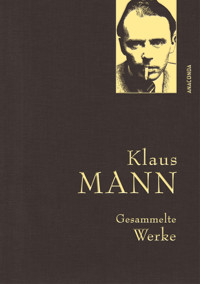4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Band ist die erste vollständige Sammlung von Klaus Manns Erzählungen aus dem Exil, von denen viele bisher unveröffentlicht waren. Die Geschichten, entstanden zwischen 1933 und 1943, handeln von Außenseitern und Ausgestoßenen, von Einsamen und Selbstmördern. Sie spiegeln das Elend des Lebens in der Emigration. In der Titel-Erzählung "Speed" werden Erfahrungen mit den künstlichen Paradiesen der Rauschgifte beschrieben. Der Band enthält auch Klaus Manns berühmte Novelle um den Tod des Bayern-Königs Ludwig II., "Vergittertes Fenster".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Klaus Mann
Speed
Die Erzählungen aus dem Exil
Über dieses Buch
Dieser Band ist die erste vollständige Sammlung von Klaus Manns Erzählungen aus dem Exil, von denen viele bisher ungedruckt waren. Die Geschichten, entstanden zwischen 1933 und 1943, handeln von Außenseitern und Ausgestoßenen, von Einsamen und Selbstmördern. Sie spiegeln das Elend des Lebens in der Emigration. In der Titel-Erzählung «Speed» werden Erfahrungen mit den künstlichen Paradiesen der Rauschgifte beschrieben. Der Band enthält auch Klaus Manns berühmte Novelle um den Tod des Bayern-Königs Ludwig II., «Vergittertes Fenster».
Vita
Klaus Mann, geboren 1906 in München als ältester Sohn von Katia und Thomas Mann, begann seine literarische Laufbahn als Enfant terrible in den Jahren der Weimarer Republik. Nach 1933 wurde er ein wichtiger Repräsentant der von den Nazis ins Exil getriebenen deutschen Literatur. Seine bedeutendsten Romane schrieb er in der Emigration: «Symphonie Pathétique» (1935), «Mephisto» (1936) und «Der Vulkan» (1939). Im Mai 1949 starb Klaus Mann in Cannes an den Folgen einer Überdosis Schlaftabletten.
Impressum
Die Erzählungen «Speed», «Le Dernier Cri», «Hennessy mit drei Sternen», «Ermittlung», «Afrikanische Romanze» und «Der Mönch» wurden für diesen Band ins Deutsche übertragen von Heribert Hoven und Monika Gripenberg.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2019
Copyright © 1990 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildung Bergmann/neuebildanstalt
ISBN 978-3-644-00438-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Wert der Ehre
April, nutzlos vertan
Une Belle Journée
Letztes Gespräch
Der Bauchredner
In der Fremde
Vergittertes Fenster
Triumph und Elend der Miss Miracula
Speed
Le Dernier Cri
Hennessy mit drei Sternen
Ermittlung
Afrikanische Romanze
Der Mönch
Nachwort
Editorische Bemerkungen
Wert der Ehre
Keß waren sie beide, doch sie immer noch kesser als er. Es geschah oft, daß er ihren allzu radikalen Zynismus tadelte. «Meine Liebste», mahnte er mit zärtlicher Strenge, «die Ideale, über die du dich lustig machst, haben mehr inneren Wert, als du annimmst; übrigens auch mehr äußeren», fügte er hinzu. Worauf sie enerviert und verächtlich die Achseln zuckte.
«Ehrgefühl ist bürgerlicher Quatsch», sagte sie anschließend. Darüber gerieten sie in ihrem Pariser Hotelzimmer ernsthaft in Streit.
Beide hatten fast immer Geld, beinahe zufälligerweise, woher es kam, wußte niemand genau. Er wie sie behaupteten stets, irgendwo komplizierte Geschäfte schwelen zu haben. In Frankfurt oder in Argentinien.
So war es nicht nötig, daß sie hochstapelten und die Hoteliers um das Ihrige brachten. Aber Jenny erklärte, mit Überzeugung: «Ich bin ehrlich, nur weil sich mir niemals ein reizvoller Anlaß zum Betrügen geboten hat. Prinzipiell bin ich täglich bereit, gegen jedes Gesetz zu verstoßen. Für meine bürgerliche Ehre gibt mir kein Mensch einen Heller.»
Ralf, der sich besser auskannte, lächelte verschmitzt.
Der junge Gentleman, der das anspruchsvolle Juwelengeschäft der Champs-Élysées vormittags um halb elf Uhr siegesgewiß betrat, machte, mit kariertem Anzug, Monokel, weißen Gamaschen, den Eindruck dessen, der zu reisen gewohnt ist, Geld reichlich hat und es noch reichlicher ausgibt, eine Wohnung in London und Paris besitzt, Freundinnen aber auch in anderen Städten.
Die Kleinodien, die man ihm vorlegte, prüfte er mit der Miene des gewiegten Kenners; er entschied sich für ein Perlenkollier, das eine halbe Million Francs kostete. Er unterschrieb einen Scheck, bat nachlässig darum, den Schmuck sofort ins Claridge hinüberzuschicken.
Derselbe junge Mann betrat um halb zwölf Uhr den benachbarten Laden, diesmal war seine Haltung nervöser. Er bat hastig, den Besitzer sprechen zu dürfen, und erklärte dem Herrn, der höflich, wenn auch etwas mißtrauisch lauschte, kurz und bündig, daß er Geld brauche. «Ich bin in Not», sagte er einfach. «Dieser Schmuck gehörte meiner seligen Frau.» Er wischte sich die Augen, man bemerkte, daß sie trocken waren. Es schien klar, daß er log.
Das war verdächtig, um so verdächtiger, als die Perlen keineswegs seiner seligen Frau gehört hatten, vielmehr noch diesen Morgen dem Geschäft nebenan, was der mißtrauische Besitzer, der die Auslagen der Konkurrenz kannte, auf den ersten Blick feststellte. Hier stimmte nicht alles. Es wurde noch klarer, als der junge Mann, nach dem Preis gefragt, den er forderte, fünfzigtausend Francs wollte. Nebenan, das wußte der Geschäftsmann, hatte das Stück noch diesen Morgen das Zehnfache gekostet. Die Echtheit der Perlen unterlag keinem Zweifel. Der junge Gentleman schien ein Betrüger; freilich hätte er, der Geschäftsmann, davon den Vorteil gehabt, es war die Konkurrenz, die hereingelegt wurde.
Der Händler kämpfte einen kurzen, aber heftigen Kampf. Sollte er einen Betrüger entlarven, der ihm selbst zu verdienen gab, die Konkurrenz aber schädigte? Schließlich siegte das Solidaritätsgefühl mit dem andern Kapitalisten, gegenüber einem Abenteurer, der der Gesellschaft gefährlich war; zudem konnte es vorteilhaft sein, sich den Nachbar durch Edelmut zu verpflichten.
Er schickte ein Fräulein hinüber, das sich erkundigen sollte, wie die Sache mit dem Perlenkauf stand. Den karierten jungen Mann, der sich bleich auf die Lippen biß, bat er, nicht ohne Strenge, zu warten.
Die Antwort von nebenan fiel nicht anders aus, als zu vermuten gewesen war: die Perlen waren mit einem Scheck bezahlt worden. Wenn einer als Bezahlung für ein Kollier um halb elf Uhr einen Scheck über eine halbe Million Francs unterschrieb und ebendasselbe Schmuckstück eine Stunde später für fünfzigtausend Francs verkaufen wollte, lag der Sachverhalt klar: der Scheck mußte ungedeckt sein.
Der Geschäftsmann, der um ein Haar betrogen worden war, eilte herbei, um dem anderen, der ihn gebeten hatte, gerührt die Hand zu schütteln; so kameradschaftlich waren die beiden Herren noch nie miteinander gewesen. Den Karierten, der verzweifelt zur Erde starrte, streiften sie mit einem eisigen Seitenblick.
Er wurde gebeten, noch ein wenig Geduld zu haben. Indessen sandte man einen Angestellten zur Bank, auf deren Namen der Scheck lautete.
Er kam zu spät, es war Samstag und zwölf Uhr zehn. So mußte man das Einholen der Erkundigungen verschieben. Die befreundeten Juweliere besprachen sich erregt, doch konzentriert. Es war alles klar, der Verdacht zu dringend man hatte die moralische Verpflichtung, den Hochstapler vorläufig in Gewahrsam zu nehmen. – Übrigens schien der Jüngling sich selber als überführt, seine Lage als hoffnungslos anzusehen: er widersprach nicht, knirschte nicht mit den Zähnen, als die Polizeibeamten ihn aufforderten, sie zu begleiten.
Die Zeit von Samstag vormittags bis Montag früh verbrachte Ralf im Gefängnis ; seine Freundin vermutete ihn auf einer Geschäftsreise in London.
Montag früh stellte sich heraus der Scheck war gedeckt, das Bankguthaben des Herrn Ralf betrug sechshundertfünfzigtausend Francs.
Nach französischem Gesetz bekam der unter falschem Verdacht ins Gefängnis Gesetzte vom Staate einen moralischen Schadensersatz von hunderttausend Francs bei der Haftentlassung ausbezahlt. «Freilich kann dieses Geld die Schmach nicht gutmachen, die wir Ihnen unter falschen Voraussetzungen zugefügt haben», sagte der Beamte gefühlvoll. «Ehre ist unbezahlbar.» – Auch die Juweliere entschuldigten sich.
«So viel ist Ehre wert», sagte Ralf als Abschluß seiner hochdramatischen Geschichte zu Jenny, die erschüttert nickte. «Mit Schurkerei so schnell Geld zu verdienen ist nicht leicht. Ehre ist der höchstbezahlte Artikel.»
Übrigens schenkte er ihr die Perlen.
April, nutzlos vertan
Max Perzel, ein junger Mann aus dem Mittelstande, war bis jetzt immer sehr achtlos mit seiner Zeit umgegangen. Neunzehn war er alt geworden, ohne daß sich in seinem Leben etwas Ungewöhnliches zugetragen hätte. Er hatte das Gymnasium in der mitteldeutschen Kleinstadt absolviert, in der sein Vater pensionierter Beamter war, weder in der Schule noch im Familienkreise war er je im guten oder schlechten Sinne aufgefallen. In der Klasse gehörte er stets zur schlechteren Hälfte der Schüler, vermied es aber durch einen dauerhaften und ehrhaften Fleiß, jemals zu den wirklich Gefährdeten, den eigentlichen Sorgenkindern hinabzusinken. So wurde er, von Schuljahr zu Schuljahr, mit einem eben noch knapp mittelguten Zeugnis versetzt. Bei den Spielen, in der Pause oder nachmittags auf der Wiese, war er niemals, keine halbe Stunde lang, unter den Tonangebenden, Regierenden; von zu gewagten, tollkühnen Unternehmungen hielt er sich völlig zurück. Da er bei anderen, harmloseren Gelegenheiten von einer maßvollen und soliden Forschheit sein konnte, blieb es ihm trotzdem erspart, in den Ruf des Feiglings, Duckmäusers oder Musterknäbleins zu kommen. – Brüder hatte er nicht, nur eine Schwester, die aber schon ins Büro ging. Sie war für ihn eine fremde, etwas schnippische junge Dame. – Als Max achtzehn Jahre alt war und nicht mehr so viele Pickel im Gesicht hatte, meinten einige wohlwollende Leute, daß er eigentlich ein ganz hübscher Junge wäre. Er war ziemlich groß ; leider mußte er eine Brille tragen, wegen leichter Kurzsichtigkeit. Sein Haar – dunkelblond – wäre angenehm von Farbe und Qualität gewesen, wenn er es nicht zu stark pomadisiert hätte. Auch das Abitur ging vorüber, und seine Eltern waren zufrieden, als er es mit der Durchschnittsnote Drei bestanden hatte. Es war beschlossen, daß er die Rechte studieren sollte, und zwar zunächst ein Semester in Heidelberg. Er packte seinen Koffer, bekam von seinem Vater das Eisenbahnbillett dritter Klasse, von der Mutter ein Körbchen mit Wurstbroten, einem halben Sandkuchen, zwei harten Eiern, drei Äpfeln und drei Orangen ausgehändigt, und er fuhr los. In Heidelberg suchte er die alte Pension auf, deren Adresse sein Vater ihm gegeben hatte. Von seinem Fenster hatte er einen schönen Blick über den Neckar. Das Semester hatte noch nicht begonnen. Der Tag gehörte ganz ihm.
Es gab einige Formalitäten auf der Universität zu erledigen. Es war selbstverständlich, daß er die freie Zeit, die ihm blieb, zur vernünftigen Arbeit verwendete. Er legte sich Bücher und Zeitschriften auf dem Schreibtisch zurecht. Als er aber das Fenster öffnete, um sein Zimmer zu lüften, bemerkte er, daß über den Bäumen und Gebüschen ein sehr zartes Grün lag, wie er es noch nie gesehen zu haben glaubte. Er dachte, daß es Knospen seien, die so schimmerten. Das Wort «Knospen» bestürzte ihn, als dächte er es zum erstenmal. Er sah zum Himmel hinauf und war noch einmal bestürzt – über seine empfindliche und reine Bläue, in der, reizend geformt, leichte weiße Wolken wie Vögel schwammen. Ich könnte Spazierengehen – dachte Max Perzel. Der Student darf sich ein wenig Freiheit gönnen, dachte er konventionell.
Als er das Haus verließ, ging eben eine alte Dame vorüber, die von einem jungen Mädchen geführt wurde; Max konnte den beiden einen vollen Augenblick in die so verschiedenen Gesichter sehen. Die Alte hing schwer am Arme des jungen Mädchens; sie hatte einen merkwürdig stampfenden, grimmigen, ja wütenden Gang. Auch der Ausdruck ihres Gesichtes war zornig –: ein großes weißes Gesicht, konstatierte Max Perzel, steinern verhärtet, von unzähligen Fältchen durchzogen. Die weit aufgerissenen, stahlblauen Augen wirkten kahl ohne Brauen und Wimpern – kahle Eisaugen unter einer hohen, eigensinnigen, gottverlassenen Stirn. Die alte Frau war groß und breitschultrig, von einer angsterweckenden Rüstigkeit. Sie trug ein schwarzes Pelzkleid – es war kein Mantel, sondern ein Kleid, knapp gearbeitet; es muß aus Seehundfell sein, dachte Max Perzel. Das Antlitz der Alten war so bedeutend und derart erschreckend, daß es den Blick von dem süßen Gesicht des jungen Mädchens auf eine herrische Art ablenkte. Nur eine halbe Sekunde lang durften die Augen des jungen Menschen dieses Gesicht berühren, das sich ihm wie flehend entgegenhielt. Das empfindliche Halbprofil, das ihn, über die majestätische Schulter der Alten hinweg, mit seinem angstvollen Lächeln beschenkte, schien ihm zartgetönt, mit mattgelben Lichtern, wie altes Elfenbein. Die dunklen Augen hatten malaiischen Schnitt. Der weiche, dunkle und schöne Mund schien auf eine pathetische Art zu schmollen. – Die Alte riß an dem Mädchen, auf das sie sich stützte. Während sie weiterstampfte, hörte Max Perzel sie deutlich sagen: «Marsch – los, April!» Er überlegte eine Sekunde lang, ob das schöne Mädchen April heißen möge; ob er die Alte mißverstanden habe oder ob diese einfach geisteskrank sei. Gleichzeitig dachte er: Und dabei ist der April fast zu Ende. – – Als er wieder zu den beiden hinschauen wollte, waren sie um eine Ecke verschwunden. Er eilte ihnen nach, entdeckte aber keine Spur mehr von ihnen. – Man schrieb den 30. April. Es war mittags zwölf Uhr.
Student Perzel blieb mitten auf der Straße stehen, wie einer, dem etwas Ungeheuerliches zugestoßen. In welche Tragödie hatte er hier einen so flüchtigen und bewegenden Einblick bekommen? Was geschah diesem Mädchen, dieser Holdheit, diesem exotischen Kinde? – Welche Welt von finsteren und romantischen Zusammenhängen! Wie konnte man eingreifen, wie helfen? Wie das Mädchen wenigstens wiedersehen? – Eine wahrhaft panische Angst, nur ja nichts zu versäumen, bemächtigte sich des trägen jungen Mannes. Er fühlte sich physisch verändert, eine Unruhe ergriff ihn, die sein Körper niemals gekannt hatte. Was hatte er bis jetzt mit seiner Zeit getan? Wie schlapp, wie tatenlos hatte er sie dahingehen lassen. Mit einem Schlag war die Zeit kostbar, geheiligt –: das war die große Veränderung. Ohne Frage war die Welt immer und überall voll von so erregenden, unerklärbaren und wilden Abenteuern – er hatte nur bis jetzt die Augen nicht offen gehabt hinter seinen dummen Brillengläsern. Aber dieser April war noch nicht vorüber. Nutze die Stunde! Wirf dich in die Minute! Halte zäh und zärtlich die Sekunde fest!
Er eilte dahin, niemals war eine solche Ungeduld in seinem Gang gewesen. Zum Fluß hinunter – und noch niemals hatte er Wasser mit Bewußtsein zwischen seinen Fingern hindurchrinnen lassen –; über Wiesen; wieder zurück in die Stadt. Nirgends das Mädchen, aber überall eine veränderte Welt. Andere Farben, Gerüche, Gesichter; alles gesteigert, anspruchsvoll, heftig geworden, und zwischen allen Geräuschen –: die Stimme des Mädchens, die er so deutlich zu hören glaubte. Sie verlangte nach ihm, von ihrer schrecklichen Herrin gepeinigt; man gab ihr Gift zu trinken, man schlug sie. – – Wie anders war dieser Tag als alle vorhergegangenen, endlos viel länger und dabei abgekürzt auf eine stürmische Weise. Die Frucht, die er anfaßte, als er schließlich Hunger bekam, schien ihm elektrisch geladen. Zwischen ihm und dem Kellner im Restaurant ereignete sich ein bedeutungsvolles und stummes Gespräch der Blicke, als hätten sie etwas Entscheidendes untereinander auszutragen. – Während er eilte oder ermüdet saß, arbeitete es in seinem Kopf ununterbrochen. Wie habe ich die ganze Zeit bis jetzt gelebt? Neun unverzeihliche Jahre habe ich den Stumpfsinn des Gymnasiums mitgemacht. Und nun – Jura studieren, wo die Welt doch voll ganz anderer Mysterien ist. Ich werde nicht Rechtsanwalt, im Gegenteil, ich mache Gedichte. Ich werde Schauspieler, gleich hier, und jetzt springe ich auf die Gartenbank und rezitiere etwas Beispielloses. Ich lerne Geigenspielen und wunderbar Flöteblasen. Ich gehe auf Wanderschaft. Das Mädchen finde ich doch, und trotz allem. Ich erwürge die Alte – mit diesen meinen Händen erwürge ich sie –, ich werde hingerichtet, aber erst gründe ich eine geheime Gesellschaft; ich sprenge die Universität in die Luft – o Gott, mein Gott, was habe ich nur bis jetzt mit meiner Zeit getan! Läßt es sich nachholen, so viel Versäumtes? Sei noch nicht vorüber, April, verweile noch, verweile noch, nie wieder werde ich deiner teilhaftig sein. Vergängliche Minute, mach eine Ausnahme, verzögere dich, es ist ja schon abends, Viertel nach elf, der gesegnete Monat ist gleich vorüber, und wenn kein Wunder geschieht, habe ich ihn nutzlos vertan.
Es ist gut, daß keiner seiner Kameraden ihn sieht, denn er hat seine Brille verloren, sich beim Laufen in den Gebüschen ein klaffendes Dreieck ins Hemd gerissen; seine Krawatte hat sich auch gelöst. Man müßte ihn für sehr heruntergekommen halten. Wir aber folgen gerührt seinem taumeligen Gang am Rande des Flusses, in dessen treibender Dunkelheit, zu seinem fassungslosen Glück, Lichter schwimmen. Noch sehen wir ihn zusammenschauern, da die Uhr Mitternacht schlägt. Und dann überlassen wir dies Herz, das so gleichmütig geschlagen hatte, seiner stürmischen Wonne über die gegenwärtige, seiner Verzweiflung über die entrinnende Minute.
Une Belle Journée
Madame Leroux, die Wirtin des Hotels de la Plage, unterhielt sich mit den beiden alten Herrschaften, die im schattigen Vorgärtchen des Hotels beim Mittagessen saßen. «Es ist heute ein friedlicher Tag», meinte Madame Leroux. «Ein Sonntag, so recht, wie er sein soll.» Mit blanken Augen sah sie der alten Dame zu, die sich ein gewaltiges Stück Schinken auf ein noch umfangreicheres Stück Weißbrot legte. Die alte Dame aß stark; sie hatte eine fast grimmige Würde in Gesicht und Haltung, wenn sie sich enorme Portionen auf den Teller tat und verzehrte. Der schlohweiße, etwas fahle und müde Herr ihr gegenüber war mäkliger: er vermied schwere Speisen, ließ manches liegen. Die beiden wirkten wie ein altes Ehepaar, er etwas matter, kränklicher als sie. In Wahrheit war sie die Mutter des Herrn, der neunundsechzig Jahre alt war; sie selber war einundneunzig.
Nicht ohne Beunruhigung beobachtete Madame Leroux, mit welch trotziger Geschwindigkeit die Greisin Sardinen, Radieschen, rohen Schinken durcheinander verzehrte. «Ja, es ist ein herrlicher Tag», wiederholte die Wirtin und blinzelte von der schmausenden Alten fort, zum palmenbestandenen Platz hinüber, wo eine faule Menge flanierte.
Das Meer ruhte in seiner satten, unendlichen Bläue. Die braunen Segel einiger Fischerboote schwankten träge in seinem mittäglich atmenden Frieden. Madame Leroux war mit ihrem Ausblick so zufrieden, daß sie lächeln mußte. Sie war vierzig Jahre alt, üppig und fest. Ihr rosig gepudertes Gesicht schaute energisch, liebenswürdig, intelligent. Sie war Varieté-Künstlerin, dann Besitzerin einer großen Music-Hall in Tunis gewesen, ehe sie sich hier, in der Nähe von Toulon, niedergelassen hatte. Ihr Hotel ging gut.
Madame Leroux hob mit einer wollüstig ausladenden, dabei trägen Gebärde den Arm, um ihre Frisur zu ordnen. Sie lächelte immer noch. Aus einem offenen Fenster kam plötzlich Musik; ein Grammophon spielte. Vor dem Hotelgärtchen, wo noch ein schmales Stück Straße war, ehe es, einen Meter tief, zum blauen Wasser hinunterging, stieg ein junger Mann pfeifend in einen halbgeschlossenen Wagen. Man hörte, wie er den Motor anließ. Aus dem Fenster sang es, süß und bewegt: «Dann sag’ ich dir auf Wiedersehen …» Der junge Mann begann in einem ziemlich flotten Tempo nach rückwärts zu fahren: er wollte auf dem schmalen Stück Straße seinen Wagen wenden.
Es krachte, plantschte, Wasser spritzte hoch auf. Der Wagen war ins Wasser gestürzt. Die Greisin, ein Weinglas in der Hand, schrie mit einem rauhen Kehlkopflaut; Madame Leroux silberhell.
Innerhalb ganz weniger Sekunden war die Menschenmenge zusammengeströmt. Der Platz, die Promenade lagen plötzlich vereinsamt, friedlich in der Sonne. Alles Leben hatte sich mit grausamer Neugierde um die Unglücksstelle versammelt. Man redete, schrie durcheinander, aber niemand griff ein. Eine schreckliche Sache, eine tolle Bescherung, so was war ja lange nicht vorgekommen.
Was für ein beklagenswerter Anblick! Die vier Räder des gestürzten Wagens schauten gerade noch aus dem Wasser, das sich schmutzig gefärbt hatte – der schlammige Grund war aufgewirbelt; sonst war nichts mehr zu sehen. Wo aber war der Mann, der den Wagen geführt hatte? War er ertrunken? Aus der Volksmenge kam die Frage als Schrei. – Da stieg der Mann, triefend, mit einer Schramme über der Stirn und mit verzerrtem Gesicht, aus den Fluten. Der Schwung des Sturzes hatte ihn, aus dem Wagen hinaus, weiter ins Wasser geschleudert. Es war ihm gar nichts geschehen. Wie durch ein Wunder war der Mann gerettet.
Er war höchstens fünfundzwanzig Jahre alt, mager und lang. Das Hemd mit den kurzen Ärmeln, die grauen Hosen klebten durchnäßt am Körper. Das verwirrte Haar hing ihm in die blutige Stirn. Er starrte einige Sekunden lang mit einem völlig verwirrten Blick, der schwarz vor Entsetzen war und nichts sah, in die Menge, die ihn und sein Unglück umstand. Dann wandte er sich mit einem jähen Ruck, richtete den Blick auf die vier Räder, die so melancholisch aus dem Wasser ragten, und hob beide Hände mit der Geste jäher Verzweiflung zu den Schläfen empor; die Arme mit den spitzen Ellenbogen ragten als zwei groteske und pathetische Flügel. «O Gott!» schrie er –und jetzt funkelten seine Augen unter der blutenden Stirn; «o Gott, mein Gott – welch ein Unglück!» Er war Südfranzose, sprach den Dialekt der Gegend, was allgemein sympathisch berührte. Eine Dame aus der Menge rief: «Er lebt!» – als hätte sie es jetzt erst bemerkt. Man lachte einerseits über die Dame, andererseits aus Erleichterung darüber, daß der junge Mann gerettet war.
«Der Kerl hat Glück gehabt!» riefen einige der Herren. Man begann sich zu erzählen, wie das Unglück zustande gekommen war. «Beim Umdrehen», sagten wichtig die jungen Fischer, die in der Nähe gewesen waren. «Es ist beim Wenden passiert.» «Da heißt es eben, vorsichtig sein!» Ein alter Herr lachte herzlich. «Er hätte unter das Auto kommen können, und er wäre ertrunken!» konstatierte angeregt eine reife Dame; man merkte, wie die Gänsehaut, wollüstig gruslig, ihr über den Rücken lief, da sie sich den ganzen Schrecken, der hätte passieren können, so recht ausmalte.
Inzwischen spielte der junge Mann seine große Szene: es war primitives, schönes Theater, dabei von Herzen erlebt. Er rollte die Augen, immer die Hände an die Schläfen gepreßt oder in die Haare gewühlt; eilte mit großen Schritten umher. Er wehklagte, brüllte – wirklich, es flössen Tränen über sein weißes, verstörtes Gesicht, sie vermischten sich mit dem Blut, das von der Stirne rann. «Das ist fürchterlich!» schrie er, wobei er den Kreis seiner ergriffenen Zuschauer mit großer Gebärde teilte, taumelnden Schrittes bis zum Hotelgärtchen und wieder zurück, zum Kai, rannte, wo sich die Menge seines Publikums gleich wieder um ihn schloß. «Das ist entsetzlich, wie konnte mir das passieren! Unser schönes Automobil! O wehe, wehe!» Er raufte sich das Haar, krallte sich die Nägel in die Wangen, stampfte mit beiden Füßen.
Junge Leute klopften ihm gutmütig-tröstend die Schulter; alte Herren suchten ihn mit überlegenem Lächeln zu beruhigen. «Seien Sie doch froh, daß Sie mit dem Leben davongekommen sind!» sagte man ihm. Er aber entwand sich allen, die ihn halten wollten, um nur weiter zu rasen und zu brüllen «Wie konnte das nur passieren! Unser schönes Automobil!»
Die gefräßige Greisin stand in der ersten Reihe der Zuschauer – man hatte sie respektvoll vorgelassen – und verschlang gierigen Blickes das sensationelle Schauspiel. Ihr alter Sohn bot dem Tobenden, als dieser gerade einmal an ihm vorüberrannte, eine Zigarre aus seinem Etui an. Der junge Mann nahm sie mit großen, ziemlich abgearbeiteten Händen. Einen Augenblick hielt er inne in seinem Verzweiflungslauf, während man ihm das Feuer reichte; dabei murmelte er, zur Greisin gewandt, flüchtig und konventionell: «O Madame, wie ich unglücklich bin, oh, ich Unglücklicher!» Dann eilte er weiter, nun gierig rauchend beim Laufen und Lamentieren. Madame Leroux erschien tatkräftig mit einem Kognak. Sie sah den Verzweifelten, der das Glas hastig leerte, aufmunternd aus blanken und erfahrenen Augen an.
Einige aus der Menge behaupteten, den ständig Tobenden zu kennen. Er sei aus Toulon – wurde behauptet –, habe in den Tropen gearbeitet. Die Hitze dort habe ihm zugesetzt, er habe was weg, man verstehe doch, einen Stich, einen kleinen Koller … Andere hatten ihn hier, in einem kleinen Restaurant am Hafen, frühstücken sehen. Er habe zuviel getrunken, mehrere Apéritifs und reichlich Rotwein, auf solche Weise geschehen dann solche Unglücksfälle.
Aus den wild hervorgestoßenen, von Jammerlauten zerrissenen Andeutungen des jungen Mannes ergab sich langsam der Grund seiner besonderen Verzweiflung, die Geschichte seines nie wiedergutzumachenden Pechs. Der verunglückte Wagen gehörte nicht ihm, vielmehr seinem Schwager, von dem er ihn sich über den Sonntag ausgeliehen hatte. Dieser Schwager schien ein gefährlicher Mensch zu sein, der sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf das gräßlichste rächen würde – soviel war aus den unartikulierten Lauten des Triefenden zu erraten. «Wie konnte mir das nur passieren! Ach, ich hatte ja nichts vor, als mir einen guten Tag zu machen – einen guten Tag in der Woche! Der Wagen ist hin – oh, ich Unglücklicher!»
Ein Kran war zur Stelle. Arbeiter begannen damit, die Räder des versunkenen Fahrzeuges an Ketten zu befestigen und den Wagen in die Höhe zu ziehen. Sie stapften in ihren blauen Hosen durchs Wasser, das ihnen bis zum Bauch reichte. Der junge Mann sprang zu ihnen, wild gestikulierend stand er zwischen ihnen im Wasser, die nasse Zigarre in den rauhen Fingern. «Der Wagen ist hin!» schrie er ein über das andere Mal aus den Fluten, drohend um sich schauend. «Fester zupacken!» verlangte er von den Arbeitern. «Mein Schwager bringt mich um! Ein schöner Tag in der Woche! Oh, ich Unglücklicher!»
Die Menschenmenge am Kai war immer dichter geworden. Man ermunterte die Männer durch Witze oder sachverständige Zurufe. Ein Arbeiter bückte sich, um den Wagen, der sich langsam, Zentimeter für Zentimeter, hob, von unten zu stützen.
Plötzlich richtete der Gebückte sich auf, sein Gesicht war weiß, tödlich erschrocken. Er schaute eine Sekunde lang zu dem Gestikulierenden hin, der unter wilden Reden die Zigarre schwang. Der Arbeiter bückte sich wieder und zog langsam unter dem sich hebenden Wagen etwas Helles, Weiches hervor an die Oberfläche des Wassers. Es war ein menschlicher Körper – der Körper eines jungen Mädchens. Nun lag er, von den Armen des Mannes gehalten, wie schwimmend auf der blauen Wasserfläche.
Es herrschte ein Schweigen, als hätte ein eisiger Wind alle angeweht. Eine ewige Sekunde lang rührte sich niemand. Der junge Mann, versteinert mitten in einer theatralischen Geste, die Zigarre immer noch zwischen den Fingern, starrte in das gedunsene Gesicht seiner ertrunkenen Geliebten.
Der Arbeiter, plötzlich zitternd, ließ den Körper los, der lautlos ins Wasser zurücksank, wie in seine Heimat. Ein Schrei löste sich aus der Menge. Der junge Mann, immer noch ohne sich zu bewegen, sagte ganz leise:
«Ich habe Louise vergessen …»
Letztes Gespräch
Karl bog vom Boulevard Saint Germain in die Rue Saint Benoist ein; ging die Rue Saint Benoist rasch hinunter bis zur nächsten Straßenkreuzung; schwenkte dann nach links ab. Er ging schnell, die Hände in den Taschen seines schmutzigen, alten Trench-Coats, das junge Gesicht geneigt vor einem grimmigen Wind, der an Nase und Ohren weh tat. Schneien sollte es, dachte Karl. Es war sehr kalt. Beinah wäre er an seinem Hotel vorbeigelaufen, weil er die Stirn nicht gegen diese Kälte heben wollte. Dicht vor der Haustür merkte er, daß er am Ziel war; er lachte leise in sich hinein – es war eine angenehme kleine Überraschung –, stieß die Türe auf, ging durch das Vestibül – im Salon wurde Klavier gespielt, Chopin –, vorbei an der staubigen Palme im grünen Kübel, am Brett mit den Schlüsseln unter den Zimmernummern; am Glasverschlag, hinter dem die Patronne – sie war taub – im schwarzen Kostüm saß und ihn mißtrauisch musterte (er nickte ihr zu, aber sie erwiderte seinen Gruß nicht, er hatte seit vierzehn Tagen nichts bezahlt); rannte die Treppe hinauf (schmutzig-roter Läufer, vollgesogen von Staub; aus diesem Hause müßte man den Staub tonnenweise ziehen können, dachte er laufend, etwas atemlos); erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock; schnaufend hielt er vor Zimmer achtzehn; riß die Türe auf; stand lachend im Zimmer.
«Ich habe Geld!» rief er lachend und fügte hinzu – als gelte es, eine übertrieben freudige Reaktion, einen Aufschrei etwa, der aber aus dem Zimmer gar nicht erfolgt war, zu dämpfen –: «Oh, nicht sehr viel! Aber es langt doch, um die Rechnung hier zu bezahlen. Wir können raus aus dem Loch hier, Annette!»
Statt des begeisterten Schreis, den er sich unterwegs, auf der kalten Straße, vorgestellt hatte, antwortete ihm aus dem halbdunklen Zimmer nur gedämpfte Musik. Das Grammophon spielte, eine schleppende und süße Melodie erfüllte den dämmrigen, kleinen Raum, mit dem Zigarettenrauch, wie eine zäh ziehende Wolke. – Karl konnte im ersten Augenblick gar nicht feststellen, wo Annette saß, so dunkel war es. Dann erkannte er sie, in der Ecke des breiten Betts, regungslos kauernd. «Mach doch die Türe zu, Liebling!» sagte sie mit einer hohen, piepsenden Stimme.
«Ich bin zu Bruno gegangen», redete er auf sie ein. «Wie idiotisch, daß ich es nicht längst getan habe! Er war prachtvoll wie immer. Noch ein paar Genossen sind dagewesen, es war wirklich fein, sie wiederzusehen. Was ich da alles gehört habe! Es wird ja viel, viel mehr getan und geplant, viel intensiver unterirdisch gearbeitet, als wir ahnen, Annette. Ja, und das Geld hat Bruno mir also geliehen. Es genügt, um in diesem verdammten Puff hier die Rechnung zu bezahlen – dafür genügt es. Wir haben ja verdammt fest hier gesessen. Jetzt können wir raus!» – Er warf den Trench-Coat über eine Stuhllehne, die Baskenmütze flog hinterdrein. Er reckte sich, lachend. Man hatte eine schwere und schlimme Zeit hinter sich. Aber nun fühlte er sich wieder wundervoll.
Annette sah vom Bett her seinen Bewegungen zu, die schön und beinah wild vor Freudigkeit waren. Sie sagte, ohne die Augen von ihm zu wenden und ohne ihre Stellung zu verändern: «Komm her! Gib mir einen Kuß.» Er stutzte; aber dann lachte er wieder. Lachend trat er zu ihr. Um sie zu erreichen, mußte er sich aufs Bett knien und dann immer noch die Arme nach ihr ausstrecken. Er zog sie näher an sich, ohne sie zu umarmen. Er legte nur sein Gesicht gegen ihres (sein Gesicht, frisch von der Kälte, mit roten Ohren, jung im Lachen wie das eines Achtzehnjährigen). Mit seinen Lippen berührte er leicht, sehr zärtlich ihre Stirn – kleine, runde Kinderstirn, dachte er, ergriffen von einer plötzlichen Besorgtheit. Diese Besorgtheit wuchs, da er seinen Blick weiter über ihr Antlitz gehen ließ, das sie ihm stumm hinhielt –: Antlitz eines Kindes, das zuviel erlebt hat, oder zuwenig; schon mitgenommen, schon ramponiert. Wie grau und locker das Fleisch ihrer Wangen. Armes Ding! dachte er. Sie sieht richtig krank aus. Sein fast ängstlich prüfendes Schauen erwiderte sie mit dem unschuldsvoll feuchten Blick ihrer runden, dunklen Augen, die in tiefen, bräunlichen Schatten lagen.
«Freust du dich, daß wir wegkommen von hier?» fragte er, so nahe bei ihr. «Das hier war nicht gut – auch für dich nicht.» Er machte eine angeekelte Handbewegung über das Zimmer. «Wir werden mit Bruno und den Genossen zusammenwohnen. Sie haben ein Atelier, es liegt ziemlich weit draußen, aber mit Metro-Verbindung. Zunächst brauchen wir gar nichts zu zahlen. Wir werden arbeiten – auch du wirst arbeiten, Annette. Hier waren wir ja so elend isoliert, so weg von den andern, so abgeschnitten. Freust du dich?» fragte er sie noch einmal. Sie sagte nichts. Ihr Lächeln, das er nicht beachtete – denn er suchte mit seinen Augen in ihren nach einer Antwort, die er nicht finden konnte –, wurde sehr traurig. Der große, dunkelgefärbte Mund in ihrem blassen Gesicht – ein Gesicht, das einmal rund gewesen war, pausbäckig (nur wer es so gekannt hatte, konnte diese vergangene Schönheit noch an ihm erraten) –, ihr großer, schöner Mund zitterte etwas im Lächeln. Sie hätte lieber geweint.
Sie stand plötzlich auf und ging rasch durchs Zimmer. Ihr Gang war elastisch, eitler und kraftvoller, als ihr verwundetes und müdes Lächeln es hätte vermuten lassen. Man konnte wieder ein wenig mehr Hoffnung für sie haben, da man sie gehen sah. Sie war sehr groß; das enge, schwarze Pyjama betonte ihre Magerkeit. Auf dem Schwarz des kurzen, seidnen Jäckchens trug sie eine blutrote schmale Kette; Karl hatte sie ihr vor Jahren geschenkt. – Sie beugte sich über das Grammophon, das leer lief, um es abzustellen. Noch über den Apparat geneigt, sagte sie leise: «Ich will nicht fort von hier, Karl. Ich bleibe.»
Hatte er nicht schon auf diese Worte von ihr gewartet? Nun stellte er sich, als täte sie ihm eine arge Überraschung an. «Was heißt das?» fuhr er auf – sie ging langsam an ihm vorbei, um sich wieder aufs Bett zu setzen. «Gefällt es dir hier so gut?» Er machte wieder dieselbe angeekelte Handbewegung – nur fiel sie diesmal heftiger aus – durch die dämmrige Stube, mit all ihrem Plüsch, gerafften Vorhängen, Schlafröcken und Hemden über Stuhllehnen. Annette zündete sich eine Zigarette an. Das Gesicht still über dem Streichholz, welches sie zu Ende glimmen ließ, fragte sie, sanft erstaunt: «Ob es mir hier gefällt? Wieso denn?» Das weiche, hellbraune Haar fiel ihr in die Stirne, sie warf es zurück, indem sie den Kopf hob und Karl beinah bittend anlächelte. «Aber ich will nicht mehr fort», sagte sie. «Ich will auch gar nicht zu Bruno, und von illegaler Arbeit will ich auch nichts wissen. Ich bin müde.»
Er betrachtete sie mit einem Blick, der unter zusammengezogenen Brauen immer finsterer "wurde. Von ihr weg schaute er über das Zimmer. Mit einer grimmigen Genauigkeit prüfte er – als sähe er das alles zum ersten Mal – die billigen und makabren Requisiten ihrer Einsamkeit, die er, seit sie von Deutschland fort waren, mit ihr geteilt hatte. Über den Hocker, auf dem das Grammophon stand, hatte sie einen dunkelroten, türkischen Schal gebreitet; Karl empfand plötzlich die gelben Blumen, mit denen der Schal bestickt war, als ungemein häßlich. Die Nachttischlampe war mit einem weichen Lumpen ähnlicher Art verhüllt. Auf dem Nachttisch lagen zwei zerlesene, gelb broschierte Bücher, ein zerknülltes, schwarzseidenes Tüchlein und eine lange, schwarze Zigarettenspitze neben einer leeren Parfümflasche und einer Kollektion von medizinischen Packungen: Schlafmittel, Beruhigendes, Schmerzstillendes; Tabletten, Tropfen, Zäpfchen und Tinkturen. – Als Aschenbecher benutzte sie die Seifenschale vom Waschtisch.
Was für ein billiger kleiner Aufwand! dachte Karl entsetzt. Er spürte plötzlich Haß gegen Annette, wegen der Seidenlümpchen und der leeren Flacons. Sie will eine Stimmung um sich herstellen, die ihr sozial nicht mehr zukommt. Das ist es – natürlich, da haben wir den Grund, warum dies alles so abstoßend wirkt. Unsereiner kann sich solchen Zauber nicht mehr leisten; dazu gehört ein Apparat, der kostspielig ist. Décadence, die noble Pathologie; Einsamkeit mit Drogen und Huysmans «À Rebours» in kostbarem Einband –: ich weiß schon, was ihr da vorschwebt, dem Kindskopf. Diese Launen kamen einer Bourgeoisie zu, deren Geschäfte gut gingen. Die konnte sich den Horizont mit Orchideen verstellen und müde vom Nichterlebten dem Tode zulächeln, während andre sich für sie plagten. Aber Orchideen sind teuer. Mit diesen abgeschmackten Seidenfetzen wirkt das Ganze nur blöd.
Laut sagte er: «Wie willst du überhaupt die Rechnung hier weiter bezahlen? Was ich habe, langt grade für das, was wir jetzt schon schuldig sind.» Sie erwiderte, ohne sich zu bewegen und ohne die Augen von ihrer Zigarette zu heben «Vielleicht schickt Mama doch noch mal ’n bißchen was.»
Er wußte, daß sie es nicht glaubte – ja daß sie von der völligen Unmöglichkeit ihrer Hoffnung überzeugt "war –, und er erschrak gleich über den zugleich klaren und toten Klang ihrer Stimme. Um das sehr unangenehme Gefühl dieses Schreckens zu überwinden, redete er wieder eifrig und laut: «Was das wieder für Dummheiten sind! Du hast Launen, gut, dafür bist du eine Frau! Aber jetzt denk doch mal nach, nun nimm dich doch mal zusammen! Soll es denn ewig so weitergehen, mit dieser Schlappheit und mit dieser Faulheit und mit diesen traurigen Spielereien? Wieviel schöne Zeit wir schon verloren haben! Das ist doch unersetzliche Zeit. Wir hätten sie nutzen sollen – zur Arbeit. Auf wen soll die Bewegung denn rechnen, wenn wir so verkommen, und wir sind jung? In Deutschland herrscht das Grauen und die Barbarei, in andren Ländern steht es vor der Tür; wir sollen kämpfen – kämpfen, verstehst du, Annette? –, auf uns kommt es an! Und du liegst hier mit deinen Seidentüchlein.»
Es war fraglich, ob sie zugehört hatte. Ihr Gesicht – beinah friedlich bei aller Traurigkeit – zeigte keine Bewegung. Zu der Zigarette hinunter, die sie langsam zwischen den Fingern drehte, sagte sie mit derselben klaren und toten Stimme wie vorher: «Laß mich liegen. Ich mag nicht mehr.»
Ihre schreckliche Haltung ängstigte und erregte ihn derart, daß er schrie. «Unsinn!» schrie er, und: «Du weißt ja nicht, was du sprichst. Sitz doch nicht so da, ich beschwöre dich! Du lebst doch gern, du hast doch immer gerne gelebt. Nun – dann mußt du auch etwas dafür tun, dann mußt du dich mit uns plagen, daß aus dem Leben hier etwas Vernünftiges wird, etwas Lebenswertes –»
Er rannte im Zimmer auf und ab, gestikulierend und keuchend. Sie sagte, während sie die Zigarette in der Seifenschale ausdrückte «Ja – es war hübsch mit dir –» Wahrscheinlich hatte er es gar nicht gehört, denn er schrie noch immer, wobei er nun vor ihr stehen blieb und sie sogar an den Schultern rüttelte – er spürte die Magerkeit ihrer Schultern –: «Steh auf! Komm mit mir! Die Welt will anders werden, und du bleibst hocken auf deinem Bett!»
Sie erwiderte langsam und ruhig – und entzog sich dabei seinem Zugriff –: «Die Welt will anders werden. Gut. Mehr als gut – ja, ich weiß schon, Karli: ganz ausgezeichnet. Es muß famos sein, da mitzuarbeiten.» Er wollte schon wieder auffahren, aber sie winkte seiner Entrüstung mit ihrer schönen, blassen Hand ab – es war die rechte Hand, die sie hob, er sah die vom Nikotin gelbgefärbten Spitzen von Daumen und Zeigefinger, es war aber nicht häßlich, nur rührend, Elfenbein, mußte er denken, Elfenbein, edel verfärbt, ach, wie unendlich hatte er diese Hände geliebt, lange Finger, schmale Gelenke und der schöne Schnitt der ovalen Nägel –: «Laß mich doch sprechen, Tolpatsch», sagte sie und lächelte ernst (sie ist älter geworden). «Du mußt mir doch zugeben: die Welt nimmt sich reichlich Zeit zu ihrem Anderswerden. Der Übergang dauert recht lange. Liebling – es muß ja nicht jeder dabeisein. Nicht jeder fühlt sich stark genug, da mitzumachen. Und ihr sagt ja selber, daß es auf den einzelnen nicht mehr ankommt.»
Hier konnte er sie unterbrechen, das gab Anlaß zur Diskussion. «Nein», konnte er heftig rufen – das Gesicht hitzig und angespannt, wie wenn er in Versammlungen sprach –, «nicht so, doch nicht in diesem Sinne, Annette. Da mißverstehst du wieder etwas, ja, da weißt du eben einfach nicht genug. Natürlich ist der einzelne unentbehrlich, jeder ist unentbehrlich für den sozialistischen Aufbau und für den Kampf um seine Vorbereitung – aber eben nur, wenn er sich unterordnet, nur als Teil des Ganzen –»
Einen Moment kam Langeweile in ihr Gesicht, aber sie wich gleich wieder einem freundlichen, wenn auch müden Ernst. «Sicher», sagte sie nachgiebig, «du hast recht, Liebling. Aber sicher ist der einzelne doch nur dann zu verwenden, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind; vor allem die, daß ihn die ganze Pastete – ich meine: das Schicksal der Menschheit – überhaupt so sehr interessiert. Die Menschheit – denk doch nur, Karli –: was für eine Bande. Gut, gut – soll sie doch sehen, wie sie mit sich zurechtkommt, soll sie doch recht grausam und störrisch sein – sie muß ja selbst alles büßen –, soll sie endlich ihre große Schreckenssache auffahren, ihre effektvolle Apokalypse, diesen Gaskrieg – jetzt schwatzt man so lange davon –; sie wird auch darüber wegkommen, sie ist ja zäh; und soll sie sich dann noch eine Diktatur einrichten, damit alles möglichst grausig bleibt. Aber – ohne mich, Liebling! Bitte bitte, Liebling –: ohne mich!» Ihre Bitte war ernst, sie hob flehend die Hände, Tränen standen in ihren kindlichen Augen.
Vor dem naiven Zynismus dieser Melancholie erschrak er wie vor einem Abgrund, der plötzlich aufsprang. Das war seine Geliebte, das seine Freundin seit so vielen Jahren! Mit ihr war er aus Deutschland geflohen, damit sie seine Genossin im Kampfe sei. Er nannte diesen Kampf «heilig», den sie abtat mit so trostlosen Worten. Annette! – «Aber Annette!» konnte er grade noch flüstern. Sie sprach schon weiter – jetzt hatte sie die schwarze Zigarettenspitze als ein Spielzeug zwischen ihren Fingern –: «Wir haben nichts mehr zu erwarten, was sich für jemanden lohnt, der das Kämpfen nicht mag. Seien wir doch mal ehrlich, mein Häschen: nur immer noch ekelhafter kann es werden. Wir haben zehn relativ vernünftige Jahre hinter uns. Jetzt fängt ein Zwischenspiel von Grauen an – ein etwas ausführliches Zwischenspiel, für meinen Geschmack. Was dann kommt, ist schon für die nächste Generation, bestenfalls; sicher nicht mehr für uns. Wozu da noch groß Kraftanstrengung machen?» In seiner Hilflosigkeit rief er: «Annette! Du bist siebenundzwanzig Jahre alt!» Sie beugte sich tiefer über die Zigarettenspitze, auf das armselige Spielzeug fiel ihr Lächeln wie Tränen. «Ja», sagte sie. «Ich war sechzehn, als ich dich kennenlernte. Das macht elf Jahre.» Sie berührte mit ihren Fingern seine Hand, die sich geballt hatte, aber sich löste, öffnete bei ihrer Berührung.
Kühle Berührung ihrer Hände – ewig geliebte Berührung –: was stürzte da auf ihn ein? Ach, die Ewigkeit ihrer Liebe. Diese ersten Jahre, gemeinsam, in der Freien Schulgemeinde. Spaziergänge, endlos, und das endlose Gespräch. Die Vertrautheit ihrer Körper, innig, wie die Vertrautheit ihrer unreif schweifenden Gedanken. Reisen; dann das Leben in verschiedenen Städten. Und um wie vieles schöner das Leben wurde, da es anfing, ernster und verpflichtender zu werden. Er begann, sich um Politik zu kümmern, dann politisch tätig zu sein. Sie blieb ihm nahe, bei aller etwas spöttischen Skepsis, die sie dieser Sphäre gegenüber wahrte. Sie war immer sein Leben gewesen, oder doch sein gehebtester Teil. Er glaubte, daß er niemals ohne sie auskommen könnte.
Auch sie spürte Erinnerungen, während sie seine Hand streichelte; aber ein Schleier hängte sich davor. Im Innersten war sie doch schon bereit, dies alles, was ihr einst über alle Maßen kostbar gewesen war, gegen das große Dunkle einzutauschen, dem sie nun allein die tröstliche Macht zuerkannte. Ihr freigiebig und schrecklich frei gewordnes Herz verschenkte schon das Irdische, um das gnadenreichere Labsal dafür anzunehmen. Ihr Herz war lüstern und gierig nach diesem Tausch. Es hatte noch nichts vergessen und sich alle Zärtlichkeit bewahrt. Aber schon war diese Zärtlichkeit getränkt von dem unwiderstehlichen Gefühl ihrer Todessehnsucht, ganz durchdrungen von ihm und dadurch dunkel verändert. Die hingerissene Liebe zum Tod, die ihr Gesicht nicht bitter machte, sondern freundlich verklärte, schloß ihre treue Liebe zum Gatten und Freunde in sich ein. Sie vergaß ihn nicht, ihren Freund – wie hätte sie’s können? –, aber was sie ihm noch an unvergänglichem Gefühl bewahrte, war doch schon nur ein Teil ihrer neuen Brautschaft.
Mit einem merkwürdig friedlichen Ausdruck im Gesicht konstatierte sie: «In Deutschland ist die Schweinerei zunächst unabsetzbar, und was nachher kommt, wird auch nicht viel besser sein. Ein feines Vaterland haben wir. Der einzige Trost bleibt, daß mit der übrigen Welt auch nicht mehr los ist.»
Das ernüchterte ihn. Alle seine Instinkte und all seine Grundsätze wehrten sich gegen diese schaurige Resignation. Ihre asoziale, hoffnungslos lächelnde Friedsamkeit empörte ihn. Er sagte mit Schärfe: «Wenn alle so dächten wie du, könnte die Menschheit Selbstmord begehen.» Worauf sie mit dem sanftesten Lächeln zu entgegnen hatte: «Erstens wäre das nur ein Gewinn, und zweitens denken ja leider nur die allerwenigsten wie ich, oder trauen sich doch nicht, es sich einzugestehen.» Statt ihr auf diese Bemerkung, die er als geradezu unverschämt empfand, zu erwidern, dachte er nach, die Stirne trotzig gesenkt, in großen, harten Zusammenhängen.
Merke ich das jetzt erst? Wir gehören nicht mehr zusammen. Ich habe eine Aufgabe, sie hat keine. Ich glaube an etwas, sie nicht. Wir dürfen uns nichts mehr vormachen. Das wußten wir ja, als wir damals loszogen aus Deutschland: diese Situation muß alles auf die Spitze treiben, auch das Private. Es wird Entscheidung verlangt. – Nein, sie wird sich doch nichts antun, das doch nicht! Er dachte diesen Gedanken zum ersten Mal oder doch zum ersten Mal mit solcher Klarheit. Mit einer Unaufrichtigkeit vor sich selber, die nicht ganz unbewußt sein konnte, wies er ihn gleich wieder von sich. Solche Unaufrichtigkeit gestattete er sich um der Sache willen. Wer so wie sie mit dem Tod kokettiert, läßt sich nicht im Ernst mit ihm ein, zwang er sich zu denken. Hat sie denn einen Grund zum Selbstmord? Ich «verlasse» sie nicht. Was sind das überhaupt für bürgerliche Vokabeln. Es liegt nur so, daß wir einander im Augenblick durchaus nichts nützen können. Ich darf mich jetzt mit ihr nicht belasten, so sicher bin ich selber noch nicht. Ein Glück, daß ich mich nicht schon mehr an ihr angesteckt habe. Diese Begegnung mit Bruno war meine Rettung. Vielleicht findet sie später doch noch zu uns, wahrscheinlich, es muß ja so kommen, im Grunde ist sie ein prachtvoller Mensch, und wir gehören zusammen. Es wird meine Aufgabe sein, ihr zu helfen, sie zu erziehen. Ich habe da gewiß viel falsch gemacht. Aber ich verkomme selbst, und sie mit mir, wenn ich hier in dieser Atmosphäre weiterlebe.
Vor ihrem Bett stehend fragte er sie noch einmal mit einer künstlichen Ruhe, sehr streng: «Du willst also nicht mit mir zu den Genossen gehen?» Sie schüttelte den Kopf.
«Ich habe es aber den Genossen versprochen, daß ich zu ihnen komme», sprach er weiter. «Ich habe es Bruno versprochen. Ich brauche Bruno und die andern, ich brauche sie jetzt.»
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: