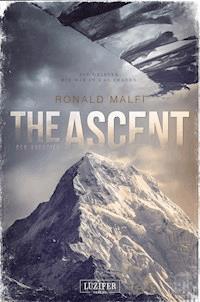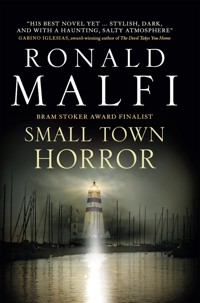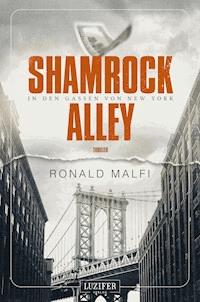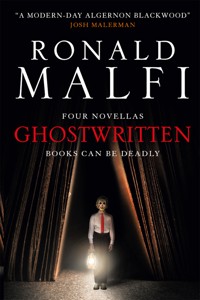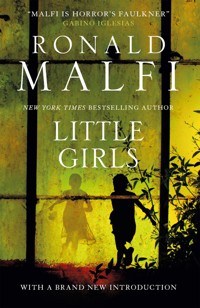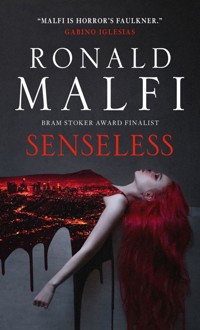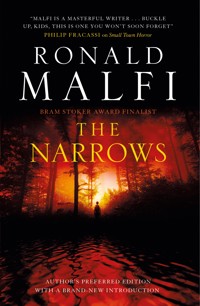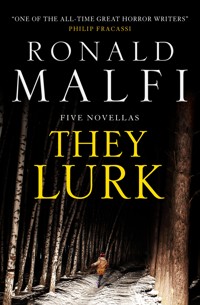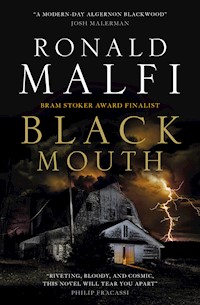Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine Welt aus gefrorener Dunkelheit. Das Geräusch von Knochen, die aneinander reiben … Paul Gallo sah die Berichte in den Nachrichten: Ein Massenmörder führte die Polizei zu den Gräbern seiner Opfer, irgendwo in der Wildnis Alaskas. Die gleiche Wildnis, in der Pauls Zwillingsbruder vor Jahren verschwand. Als man die Opfer exhumiert, begibt sich auch Paul nach Alaska, um endlich Gewissheit zu erlangen und seinen Frieden zu finden. Doch damit fängt das Rätsel erst an. Auf seinen Nachforschungen stößt Paul auf abergläubische Einheimische, die den Teufel fürchten, und eine Reihe von Holzkreuzen, die etwas Böses daran hindern sollen, den Wald zu verlassen. Und je tiefer er nach Antworten gräbt, umso mehr scheint er selbst Teil des Mysteriums zu werden … "Eine unheimliche Welt, mit einer Fülle an Ideen und Details, die Erinnerungen an frühe Werke von Stephen King wecken." – RT Book Reviews "Ein unheimliches Buch … blutig und voller grausiger Geheimnisse." – Publishers Weekly "Malfis bildhafte Sprache und sein knapper Schreibstil fesseln den Leser von der ersten Zeile an." – Rue Morgue "Malfi ist ein unglaublich talentierter Schriftsteller." – Horror World
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Knochenbleich
Ronald Malfi
Copyright © 2017 by Ronald Malfi
This Work was negotiated through Literary Agency Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Für Darin und Jon – meine Brüder
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: BONE WHITE Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Nicole Lischewski Lektorat: Manfred Enderle
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-579-8
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Die Hölle ist leer, alle Teufel sind hier.
DU SOLLTEST NICHT HIER SEIN
ERSTER TEIL
Kapitel 1
Der Mann, der Tabby Whites Café an diesem bewölkten Dienstagmorgen gegen sieben Uhr betrat, wurde nur von ein paar vereinzelten Gästen erkannt, obwohl er schon seit mehr als dreißig Jahren im Ort lebte. Er wurde von einem kalten Windstoß hereingeschubst; eine verschrumpelte Hülle von einem Mann in einem schweren, wollgefütterten Ledermantel. Fetzen von Blättern und Dreck hingen in seinem schwarzen graumelierten Bart, und seine gerötete Nasenspitze und die schweren Tränensäcke unter seinen Augen wirkten wie von Kälte geschwollen. Das Thermohemd, das er unter dem Mantel anhatte, sah aus, als wäre es steif von getrocknetem Blut.
Bill Hopewell, dessen Familie schon seit drei Generationen im Ort lebte, war der Erste, der den Mann erkannte – und selbst das erst, nachdem er ihn mehrere Minuten lang genau gemustert hatte. Als er den Mann schließlich als den alten Joe Mallory von der Durham Road identifiziert hatte, saß Mallory bereits am Frühstückstresen und wärmte sich die Hände an einer dampfenden Tasse von Tabbys heißer Schokolade.
»Bist du das, Joe?«, sagte Bill Hopewell. Tabbys Café war klein und obwohl es Frühstückszeit war, hatten sich nur etwa ein halbes Dutzend Gäste eingefunden. Ein paar von ihnen sahen von ihrem Essen auf und zu Bill Hopewell hinüber, der allein an einem der wackeligen Tische vor einer dampfenden Schüssel Haferbrei und einer Tasse starken Kaffees saß. Danach ließen dieselben paar Gäste ihren Blick zu dem vogelscheuchendünnen Mann im Ledermantel schweifen, der wie ein Fragezeichen in sich zusammengesunken an Tabbys Frühstückstresen hockte.
Der Mann am Tresen – Joe Mallory, falls er es denn war – drehte sich nicht um. Soweit Bill Hopewell sehen konnte, hatte er ihn nicht mal gehört.
Es war Tabby Whites Gesichtsausdruck, der Bill schließlich veranlasste, sich aus seinem Stuhl zu stemmen und an den Tresen zu schlendern. Tabby White war eine äußerst herzliche Frau, die man nur selten ohne ihr Lächeln sah. Aber jetzt lächelte sie nicht: Pflichtbewusst hatte sie dem Mann die von ihm bestellte heiße Schokolade serviert und beobachtete ihn jetzt so weit in die Ecke gedrückt, wie sie konnte, vom anderen Ende des Frühstückstresens aus. Direkt über ihr in der als Katze geformten Wanduhr tickten die Augen wie der Stab eines Metronoms hin und her. Tabby machte eine besorgte Miene.
»He, Joe«, sagte Bill Hopewell, trat neben den Mann und lehnte sich mit einem Ellbogen auf den Tresen. Als der Mann den Kopf wandte, um ihn anzusehen, stellte Bill seine Annahme, dass es sich hier tatsächlich um Joseph Mallory von der Durham Road handelte, einen Moment lang infrage. Mallory war Mitte fünfzig, und dieser Mann sah um die zehn Jahre älter aus – wenn nicht noch mehr. Und auch wenn Joe Mallory noch nie viel Wert auf Körperpflege gelegt hatte, roch dieser Typ, als hätte er sich gut einen Monat lang nicht mehr gewaschen.
Der Mann drehte sich zu Bill Hopewell um und grinste. Die zwischen den drahtigen Barthaaren aufblitzenden Lippen waren von der Kälte verschorft und gesprungen. In seinem einen Mundwinkel war die Haut schwarz und erfroren, rau wie Baumrinde. Die wenigen Zähne, die Mallory noch besaß, sahen wie kleine Holzstümpfe aus.
»Wo hast du dich denn rumgetrieben, Joe?«, fragte Bill. »Dich hat ja schon seit Ewigkeiten keiner mehr gesehen.«
»Seit Jahren nicht«, sagte Galen Provost, der von seinem Tisch beim Fenster zu den beiden hinübersah. »Stimmt doch, oder, Joe?«
Joseph Mallory drehte sich auf seinem Hocker wieder um. Mit beiden Händen brachte er die Tasse heiße Schokolade an seine Lippen und schlürfte. Ein Rinnsal aus Kakao rann seinen Bart hinunter und tropfte braun auf die Resopaloberfläche des Tresens.
Bill Hopewell und Galen Provost tauschten beunruhigte Blicke aus. Dann sah Bill zu Tabby hinüber, die immer noch mit dem Rücken in die Ecke gedrückt unter der Katzenuhr mit den tickenden Augen stand und heftig an ihrem Daumennagel kaute.
»Das ist ein leckerer Kakao, Tabs«, sagte Mallory. Die Worte kamen gedehnt heraus, rau wie Schmirgelpapier. »Sehr lecker.«
Als ihr Name fiel, zuckte Tabby zusammen und stieß gegen ein Regal. Eine Flasche Ketchup fiel zu Boden.
»Was hast du denn da überall auf deinen Klamotten?«, fragte Galen Provost vom anderen Ende des Raums. Inzwischen sahen alle zu.
»Ist das Blut auf deiner Kleidung, Joe?«, fragte Bill Hopewell in weniger vorwurfsvollem Ton als Galen, trotz der Direktheit seiner Worte. Bill dachte sich, dass Galen vielleicht weniger vorlaut sein würde, wenn er derjenige wäre, der neben Mallory stand und den Schmutz in den Falten von Mallorys Gesicht sah, die weißen Nissen in seinen Haaren und dem Bart und das Zeug unter den Fingernägeln des Mannes, das wie altes Blut aussah. Wenn er sehen könnte, wie unnormal Mallory aussah. Bill räusperte sich. »Bist wohl im Wald gewesen, Joe?«
Das war der Moment, in dem Joseph Mallory zu lachen begann. Oder vielleicht fing er auch zu weinen an; Bill Hopewell war sich in diesem Augenblick nicht ganz sicher und würde es auch lange, nachdem Mallorys Gesicht überall in den Fernsehnachrichten zu sehen war, nicht sein. Er wusste nur, dass das Geräusch, das aus der Kehle des alten Joe Mallory herausvibrierte, wie ein widerspenstiger Vergaser klang und dass dem Mann plötzlich Tränen in den Augen standen.
Bill Hopewell stieß sich mit dem Ellbogen vom Tresen ab und wich zwei Schritte zurück.
Das Lachen – oder was es auch war – dauerte nur ein paar Sekunden lang an. Als er damit fertig war, wischte Mallory sich mit seiner großen, schwieligen Hand die Tränen aus den Augen. Dann nestelte er ein paar feuchte Dollarscheine aus der Innentasche seines Mantels heraus und legte sie nebeneinander auf den Tresen. Er nickte in Tabby Whites Richtung.
Tabby White starrte ihn nur an.
Mallorys Hocker quietschte, als er sich zu Bill Hopewell umdrehte. Ungelenk stieg er vom Hocker. Er bewegte sich mühsam und steif, so als wären seine Muskeln verknotet und seine Knochen spröde Zweige. Die dunklen Streifen vorn an Mallorys Hemd überzogen auch seinen Mantel und die Hosen, erkannte Bill plötzlich.
»Na, die sind also alle da draußen«, sagte Mallory. Seine Stimme war ein kaum hörbares Krächzen. Später musste Bill für Galen Provost und den Rest von Tabby Whites Kundschaft, der außer Hörweite saß, wiederholen, was er gehört hatte. »Sie sind alle tot und ich hab sie umgebracht. Aber damit bin ich jetzt fertig. Das war’s also.« Er wandte sich von Bill Hopewell ab und sah Tabby an. »Ist Val Drammell noch der Hilfssheriff?«
Tabby antwortete ihm nicht. Sie sah aus, als sei es ihr unmöglich.
»Ist er«, antwortete Bill Hopewell für sie.
»Also gut dann«, sagte Mallory, der sich wieder Bill zugewandt hatte. Er nickte, als sei er höchst zufrieden. »Würde einer von euch hier so nett sein, ihn anzurufen? Sagt ihm, dass ich draußen vor der Kirche sitzen werde und warte, bis die State Trooper kommen und mich holen.«
»Ja, okay«, sagte Bill, der zu schockiert war, um irgendetwas anderes zu tun, als dem Mann beizustimmen.
»Vielen Dank«, sagte Mallory. Und dann drehte er sich um und schlurfte in den kalten, grauen Morgen hinaus.
»Tabby«, sagte Bill, ohne sie anzusehen – er starrte der ausgemergelten Gestalt von Joe Mallory, die in Richtung der alten Kirche die Straße hochging, durchs Fenster hinterher. »Ruf am besten Val Drammell an, wie er gesagt hat.«
Es dauerte einige Sekunden, bis Tabby White begriff, dass mit ihr geredet wurde. Sie ging zum schnurlosen Telefon neben den Kaffeeurnen hinüber – einer ihrer weißen Turnschuhe verschmierte einen Streifen Ketchup auf dem Linoleum, aber sie merkte es nicht – und fummelte am Apparat herum, bis sie ihn schließlich an ihr Ohr brachte.
»Val«, sagte sie ins Telefon. Ihre dünne Stimme ging pfeifend hoch, war fast ein Jammern. »Hier ist Tabby vom Café.« Eine Pause entstand. Dann sagte sie: »Ich glaube, ich reiche Sie an Bill Hopewell weiter.«
Sie gab Bill das Telefon und Bill drückte es an sein Ohr. Er beobachtete immer noch Joe Mallory, der die Straße zur Kirche hochschlenderte. Der Himmel am Horizont sah ausgeblichen aus, farblos. Es versprach ein kalter Winter zu werden. »Hier ist was, das Sie sich besser ansehen sollten, denke ich«, sagte er und erklärte dann, was vorgefallen war.
Kapitel 2
Es war Viertel nach acht Uhr morgens, als das Telefon auf Jill Ryersons Schreibtisch klingelte.
»Kapitalverbrechen«, sagte sie. »Ryerson am Apparat.«
»Ms. Ryerson, hier ist Valerie Drammell, ich bin der Hilfssheriff oben in der Hand. Ich habe Ihre Visitenkarte hier und dachte mir, ich gebe Ihnen wegen der Umstände bei uns vor Ort Bescheid.« Eine Männerstimme mit einem Frauennamen, erkannte sie. Er sprach hastig und atemlos, so abgehackt, dass es zuerst schwierig war, ihn zu verstehen.
»Was sagten Sie, von wo Sie anrufen, Mr. Drammell?«
»Aus der Hand, Ma’am.« Dann räusperte der Mann sich. »Aus Dread’s Hand, um genau zu sein, Ma’am.«
Der Ortsname war ihr geläufig – er war zu ungewöhnlich, als dass man ihn vergessen konnte –, aber im Moment entging ihr, woher oder wieso sie ihn kannte. Aber irgendetwas war dort kürzlich passiert, vielleicht innerhalb der letzten zwölf Monate, und irgendwie hatte sie etwas damit zu tun gehabt.
»Was für Umstände haben Sie da oben, Drammell?«
»Hören Sie, ich habe hier einen Mann, der hier lebt, namens Joe Mallory«, erklärte Drammell. »Er sagt, dass er einige Leute umgebracht hat und die Leichen hier in der Gegend im Wald begraben hat. Er hat … na ja, es sieht so aus, als hätte er Blut auf der Kleidung, getrocknetes Blut. Frisch sieht es nicht aus. Er wirkt … er sieht ungut aus, Ms. Ryerson – äh, Detective. Ich habe doch die richtige Nummer, ja? Ist das die richtige Nummer?«
Sie versicherte Drammell, dass er die korrekte Nummer gewählt hatte, und sagte, dass sie so schnell wie möglich kommen würde. Nachdem sie aufgelegt hatte, verließ sie ihr Büro und spähte in die Zentrale, wo Mike McHale hinter dem Schreibtisch saß.
»Dread’s Hand«, sagte sie. »Wo ist das?«
Mike McHale zuckte nur mit den Schultern. Er war kein auffallend beleibter Mann, bewegte sich aber, als wäre er es. Auf der Anrichte hinter McHales Schreibtisch lag ein Straßenatlas. Er lehnte sich hinüber, grunzte dabei, und nahm ihn sich. Er schlug den Atlas auf seinem Tisch auf und sah sich eine der Karten genauer an.
»Eben hat der Hilfssheriff von da angerufen. Er sagt, er hätte einen Ortsansässigen, der behauptet, mehrere Menschen ermordet zu haben.«
Stirnrunzelnd sah McHale von der Landkarte auf. »Oh ja?«, sagte er.
Ryerson zuckte die Achseln.
»Hier ist das«, sagte McHale und tippte mit dem Finger auf eine vergrößerte Karte von Alaskas Landesinnerem. »Ganz da draußen in den Bergen. Schätze, wir brauchen um die anderthalb Stunden bis dahin«, sagte McHale.
Ryerson verzog eine Seite ihres Mundes zu einem halben Lächeln. »Wir?«
»Was für ein Mann wäre ich denn, wenn ich dich mutterseelenallein losziehen und Mordverdächtige jagen ließe?«
»Dann darfst du fahren«, sagte sie.
Sie fanden Drammell auf einer Bank vor der Dorfkirche. Er saß neben einer ausgemergelten Vogelscheuche von einem Mann, dem sein krauser Bart bis unters Schlüsselbein hing. Ryerson und McHale stiegen aus ihrem Streifenwagen aus und näherten sich den Männern entspannt. Es dauerte keinen Sekundenbruchteil, bis Ryerson die kupferbraunen Streifen aus getrocknetem Blut vorn auf Mallorys Thermohemd und an seinen Hosenaufschlägen auffielen. Nicht, dass sie das sofort überbewertete – schließlich konnte dieser Mann die letzten beiden Tage im Wald auch Wild ausgeweidet haben –, aber als er sie das erste Mal ansah, flößte ihr irgendetwas in Mallorys grauen Augen ein Gefühl von Kälte ein.
»Ich bin hier, weil ich damit ins Reine kommen will«, sagte Mallory, bevor Ryerson und McHale auch nur den Mund aufmachen konnten.
»Womit?«, fragte Ryerson.
»Kommen Sie mit und ich zeig’s Ihnen«, erklärte Mallory. Er nahm Val Drammells Schulter zur Hilfe, um sich von der Kirchenbank hochzustemmen. Drammells Miene vermittelte den Eindruck, dass die Berührung des Mannes ihn anwiderte, auch wenn er keinerlei Versuche unternahm, die Hand von seiner Schulter zu stoßen. Als sein Blick zu Ryerson schweifte, wirkte er äußerst erleichtert, dass sie hier war und dass er sein Problem an sie und ihren Kollegen abgeben konnte.
»Einen Moment«, sagte Ryerson. »Mr. Drammell hier hat uns angerufen und gesagt, dass Sie hier in der Gegend mehrere Menschen getötet haben. Stimmt das?«
»Ja, Ma’am«, sagte Mallory.
»Haben Sie das erst kürzlich getan?«
»Oh nein, Ma’am. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht.«
»Wo sind sie?«
»Das wollte ich Ihnen zeigen, Ma’am«, sagte Mallory. Er zeigte auf die Bäume, die das Vorgebirge der White Mountains umkränzten.
»Da befinden die sich? Da oben?«
»Alle«, sagte Mallory.
»Menschen«, schob Val Drammell ein. »Er sagt, er hat da oben mehrere Menschen begraben. Nur, damit das allen klar ist.«
»Ich verstehe«, sagte sie zu Drammell. Dann sah sie wieder Mallory an. »Das ist es, was Sie uns hier sagen, oder? Dass Sie mehrere Menschen getötet und sie da oben begraben haben. Stimmt das?«
»Stimmt«, sagte Mallory.
Sie sah einen Augenblick lang zur Waldgrenze hinauf, bevor sie ihren Blick wieder auf Mallory fallen ließ. Diese Wälder waren immens und das Vorgebirge schwieriges Terrain. Außerdem sah Mallory unterernährt aus und stand ungefähr so sicher auf den Beinen wie ein neugeborenes Fohlen. »Wie weit ist es bis dahin?«
»Das schaffen wir auf jeden Fall zu Fuß«, antwortete Mallory, obwohl Jill Ryerson angesichts seines Äußeren und der Art, wie er Drammells Schulter gerade eben als Krücke zum Aufstehen von der Bank benutzt hatte, stark daran zweifelte.
»Ich glaube, Sie brauchen vorher vielleicht erst mal ärztliche Hilfe«, sagte sie zu ihm.
»Dafür ist später noch genug Zeit«, sagte Mallory. »Ich werde da draußen schon nicht gleich mein Leben aushauchen, Ma’am. Zuerst zeige ich Ihnen, wo die liegen. Es ist wichtig, dass ich Ihnen zeige, wo sie liegen. Das hier ist alles sehr wichtig.«
Sie warf einen Blick auf McHale, der aussah, als sei ihm kalt und als wäre er sich unsicher. Er zuckte die Schultern.
»Also gut«, sagte Ryerson. Aus irgendeinem Grund glaubte sie ihm – dass es wichtig war, von ihm jetzt und sofort gezeigt zu bekommen, wo sie lagen. Als würde es später keine Gelegenheit mehr dazu geben. Sie holte eine Extra-Jacke aus dem Kofferraum des Streifenwagens und half Mallory, sie überzuziehen. Amüsiert verzog Mallory sein verwittertes Gesicht und spähte auf das aufgestickte Polizeiabzeichen hinunter.
»Na, schau mal einer guck«, murmelte er und befingerte das Rangabzeichen.
Mallory führte sie in den Wald, auf einen Marsch, der fast eine Stunde währte, und über eine Distanz, die Ryerson im Kopf auf knapp über eine Meile berechnete. Wäre sie zurückgegangen, um das Auto zu holen, hätte sie etwas weniger als die Hälfte der Strecke auf der ehemaligen Bergbaustraße zurücklegen können: Nachdem sie ungefähr eine Viertelstunde lang gegangen waren, verschmälerte die Straße sich auf vielleicht einen Meter Breite, und ab und zu mussten sie über umgestürzte Bäume klettern oder massive Felsbrocken umgehen, um weiterzukommen. Und dann verschwand die Straße vollends, ergab sich einem spärlichen Bewuchs aus Kiefern und Sitka-Fichten und großen, mit weichem, grünem Moos bepelzten Felsbrocken.
»Falls sich jemand das hier als Streich ausgedacht hat«, sagte McHale zu niemandem Bestimmten auf der Hälfte der Strecke, »knalle ich dem meine Taschenlampe auf den Kopf.«
Ryerson überließ Mallory die Führung. Sie hatte ihm keine Handschellen angelegt – es wäre zu schwierig für ihn, mit hinter dem Rücken gefesselten Händen durch den Wald zu klettern –, aber sie hatte ihn unauffällig abgetastet, als sie ihm in den Parka geholfen hatte, und keine Waffen gefühlt. Außerdem war sie immer noch nicht überzeugt, dass es sich bei diesem Typen nicht um einen Irren handelte. Es gab weiß Gott genügend davon. Trotzdem ließ sie ihn während ihres Marsches nicht aus den Augen.
»Woher hatten Sie meinen Namen und meine Telefonnummer?«, fragte Ryerson Drammell, als sie sich auf den Scheitelpunkt der waldigen Hügel zuarbeiteten. »Der Name Ihres Orts kommt mir bekannt vor, aber hier gewesen bin ich noch nie.«
»Vor vielleicht einem Jahr kamen zwei Trooper her, die jemanden suchten«, sagte Drammell. »Soviel ich weiß, haben sie den Mann nie gefunden. Als sie wieder fuhren, haben sie mir Ihre Visitenkarte dagelassen. Falls der Mann hier auftauchen sollte, hätte ich Sie anrufen sollen.« Drammell runzelte die Stirn und fügte hinzu: »Ist er nie.«
Ja, jetzt erinnerte sie sich. Sie hatte vor ungefähr einem Jahr einen Anruf von dem Bruder eines Mannes erhalten, der in dieser Gegend verschwunden war. Der Mann hatte herausgefunden, dass sein Bruder zuletzt in Dread’s Hand gesehen worden war. Ryerson hatte den Anruf entgegengenommen und die entsprechenden Formulare ausgefüllt, aber selbst hergekommen war sie nicht. Stattdessen hatte sie zwei Kollegen nach Dread’s Hand geschickt, um Nachforschungen anzustellen. Ganz sicher war sie sich im Moment nicht, meinte aber, dass es ihnen gelungen war, den Mietwagen des Mannes zu finden.
»Haben Sie diesen Mann je gefunden?«, fragte Drammell.
»Nein«, sagte Ryerson.
Überraschenderweise schien Mallory das Gehen trotz seiner schlechten körperlichen Verfassung keine Schwierigkeiten zu bereiten. McHale und Drammell dagegen waren beide außer Atem, als sie eine große Lichtung erreichten. Genau hier, erklärte Joseph Mallory, hatte er die Leichen der acht Opfer begraben, die er über einen Zeitrahmen von fünf Jahren hinweg ermordet hatte. Über die Anzahl der Opfer schien er sich sicher zu sein, weniger sicher darüber, wie lange er gemordet hatte. »Hier draußen«, versuchte er zu erklären, »ist es komisch mit der Zeit.«
Ryerson und McHale sahen sich an.
»Sie begreifen, was Sie uns sagen, oder nicht?«, sagte McHale.
»Natürlich.« Plötzlich war Mallory aufgebracht und starrte McHale wütend an. »Ich bin doch nicht blöd, Junge.«
»Nein, Sir«, sagte McHale. Ryerson fiel mehr als nur ein Hauch von Sarkasmus in seiner Stimme auf.
»Das ist eine große Fläche«, sagte Ryerson. »Ist es möglich, dass Sie es auf einen genaueren Platz eingrenzen?«
»Es sind viele Plätze«, informierte Mallory sie. »Na, dann kommen Sie mal.«
Er zeigte, wo ungefähr jedes einzelne nicht erkennbare Grab lag; Ryersons Schätzung zufolge handelte es sich um eine Fläche von ungefähr fünf Hektar Wald. Und obwohl Ryerson direkt neben ihm gestanden und den düsteren Ausdruck von Joseph Mallorys verwittertem Gesicht studiert hatte, als er murmelte »Hier liegt eine tote Seele, ein ganzes Stück weiter dahinten noch eine«, glaubte sie immer noch, dass hier keine einzige Leiche verscharrt war. Und dass Joseph Mallory nur ein weiterer verrückter Hinterwäldler mit getrocknetem Hirschblut auf den Klamotten war, der bei der Staatspolizei aus Fairbanks nach seiner Viertelstunde Ruhm suchte. Schließlich war unübersehbar, dass der alte Mann eine Kirsche zu wenig auf der Torte hatte, wie Jill Ryersons Vater immer gern gesagt hatte.
»Das war’s«, sagte Mallory, als er damit fertig war, Ryerson, McHale und Drammell kreuz und quer über Gottes grüne Erde zu führen (obwohl dieser Wald in Alaska Mitte September keinerlei Grün zu bieten hatte – der Boden war so kalt und grau wie die Stämme der Sitka-Fichten). Die ganze Exkursion hatte über zwei Stunden gedauert – Mallory war sich an mehreren Stellen unsicher gewesen, und dann hatte er sich einige Male ausruhen müssen – und sie hatten immer noch den Rückweg aus dem Wald vor sich. Ryerson hatte sich überanstrengt und war in ihrer Uniform und dem Parka trotz der Kälte schweißgebadet. Sie wies Mike McHale an, jede Stelle, die Mallory ihnen zeigte, zu markieren, und McHale rammte Stöcke in die Erde und knotete an jedem ein Papiertaschentuch fest, damit sie einen schnellen Überblick bekamen.
»Du glaubst doch nicht wirklich, dass hier Leichen begraben sind, oder?«, fragte McHale sie irgendwann leise. Sein heißer, nach Kaffee riechender Atem strich ihr über den Hals.
»Nein, glaube ich nicht«, sagte sie. »Er scheint verwirrt zu sein. Aber lass uns das machen, wie es sich gehört, nur für den Fall, dass wir falsch liegen. Okay?«`
»Verstanden«, sagte McHale.
»Ich werde Ihnen jetzt Handschellen anlegen und Sie mit nach Fairbanks nehmen«, sagte Ryerson zu Mallory, als er ihnen alle der acht nicht erkennbaren Gräber gezeigt hatte. »Und mir wäre wohler, wenn ich Sie von einem Arzt untersuchen lassen könnte.«
»Jetzt geht’s mir gut«, sagte Mallory, der mitten auf der Lichtung stand. Er schloss die Augen und hielt sein gerötetes, verwittertes Gesicht zum Himmel hoch. Wunde Stellen überzogen seine Wangenknochen und wässerten an seinen Lippen. Es sah aus, als hätte er mehrere Erfrierungen. »Aber wir haben hier draußen zu viel Zeit zugebracht. Ich hab sie mir schon einmal abgeschrubbt. Lassen Sie uns in den Ort zurückfahren, bevor sie wieder gierig wird.«
Hätte Valerie Drammell sich in diesem Moment nicht zu Wort gemeldet, hätte Ryerson vielleicht darum gebeten, diese Feststellung genauer erläutert zu bekommen. »Ja, wollen wir uns auf den Rückweg machen. Jetzt gleich.« Er sah sich verstohlen um, als erwartete er, dass jemand aus dem Wald heraustrat und sich zu ihnen gesellte – ein Gespenst vielleicht.
»Sie beide sollten die Lichtung absperren und Fotos machen«, empfahl Ryerson und sah von Drammell zu McHale hinüber. »Verfahren wir wie mit einem Tatort. Sobald ich beim Wagen bin, fordere ich Verstärkung an. Ich werde außerdem den Gerichtsmediziner in Anchorage informieren, nur für den Fall, dass … ähm … unser Freund hier weiß, wovon er redet.«
»Natürlich tue ich das«, brummte Mallory, dessen Blick sich plötzlich verfinstert hatte.
»Ich?«, hakte Val Drammell nach. »Ich auch hierbleiben?«
Ryerson fand, dass er sich peinlich ähnlich wie Tarzan anhörte. »Verpflichtet sind Sie dazu nicht, aber wir könnten die extra Hilfe gebrauchen, Mr. Drammell«, erklärte sie ihm.
Obwohl nicht zu übersehen war, dass Drammell nicht dableiben wollte, nickte er. Die von McHale mit den Stöcken und Taschentuchfahnen bepflanzte Lichtung bot einen beunruhigenden Anblick, und die anderthalb Stunden, die er neben Mallory auf der Kirchenbank gesessen hatte, waren dem armen Mann gehörig unter die Haut gegangen. Er steckte sich eine Zigarette in den Mund.
»Bitte rauchen Sie hier nicht«, sagte Ryerson. »Es ist der Schauplatz eines Verbrechens.«
Drammell starrte sie zwei Herzschläge lang an – lange genug, dass Jill Ryerson dachte: Na gut, dann muss ich wohl den starken Mann markieren –, doch dann nahm er sich die Zigarette aus dem Mund und steckte sie sich hinters linke Ohr.
»Willst du keine Hilfe dabei, ihn zum Wagen zurückzubringen?«, fragte McHale, als Ryerson Mallory die Hände hinter den Rücken zog und die Handschellen zuschnappen ließ.
»Ich komme schon klar«, sagte sie. »Sehen wir zu, dass hier alles abgesichert ist. Und dass keiner von den Anliegern herkommt.«
»Niemand aus der Gegend würde hierherkommen«, sagte Drammell, ohne es weiter zu erklären.
Als sie unten im Ort in den Streifenwagen einstiegen, setzte Ryerson Mallory über seine Rechte in Kenntnis.
»Rechte brauche ich nicht«, sagte Mallory im Drahtkäfig hinten im Wagen. »Und einen Anwalt auch nicht. Ich hab alle meine Sünden gebeichtet. Damit wären wir so gut wie fertig, oder?«
»Ich sage Ihnen nur, was gesetzlich Pflicht ist, Mr. Mallory«, erwiderte sie, ließ das Auto an und drehte die Heizung voll auf. Auf der anderen Straßenseite stand eine kleine Gruppe Schaulustiger, die die neuesten Entwicklungen beobachtete. Aus ihren offenen Mündern stiegen Dunstwolken auf. Ryerson fand, dass sie wie Flüchtlinge aussahen, die man an den Ufern eines fremden Landes ausgesetzt hatte.
Sie fuhr die Hauptstraße, die zum Teil aus gefrorenen Matschrillen, zum Teil aus Schotter bestand, langsam hinunter, während die Gaffer alle gleichzeitig die Köpfe verdrehten, um ihnen hinterherzuschauen.
»Haben Sie Lust, mir das Motiv zu verraten, aus dem Sie all diese Leute umgebracht haben?«, fragte sie.
»Nein«, sagte Mallory ausdruckslos.
»Sie hatten kein Motiv?«
»Hab keine Lust, es zu verraten«, stellte er klar.
»Wieso nicht?«
Diesmal antwortete Mallory nicht.
»Wie wär’s mit den Namen?«, fragte Ryerson. »Möchten Sie mir sagen, wer diese Menschen waren? Kamen sie aus der Gegend hier?«
»Mir ist nicht danach, ihre Namen laut auszusprechen, Ma’am, wobei ich nicht erwarte, dass Sie das verstehen«, sagte Mallory. »Im Moment erinnere ich mich nicht so recht an die Namen, um ganz ehrlich zu sein. Das war was, auf das es nie ankam.«
»Tatsächlich?«, sagte sie.
»Ich nehme allerdings an, dass Sie die mit der Zeit herausfinden werden. Und das ist okay.«
»Falls das hier ein Spielchen ist, das Sie mit uns treiben, Mr. Mallory, sagen Sie es mir am besten jetzt, damit wir uns eine Menge unnötiger Arbeit ersparen können.«
»Spielchen?«, fragte er.
»Falls Sie versuchen, uns einen Streich zu spielen, um es anders auszudrücken«, sagte sie. »Falls es da oben keine Leichen gibt, meine ich.«
»Oh«, sagte er. »Die liegen da schon, Ma’am. Bei Gott, die liegen da.«
Jill Ryerson hatte ihre Zweifel.
Neunzig Minuten später setzte Ryerson Mallory im Fairbanks Memorial Hospital ab und übergab ihn zwei jungen Polizeibeamten. McHale und Drammell hatten inzwischen die Lichtung im Wald abgesperrt und warteten auf die Verstärkung, zu der Spürhunde und ein in der Verwendung von Bodenradar ausgebildeter Techniker gehörten. Ryerson verschwendete kaum mehr einen Gedanken daran, bis sie etwas später einen Anruf von McHale erhielt, der immer noch am Tatort war.
»Du kommst besser wieder her, Jill«, sagte McHale. Obwohl er sehr versuchte, sich zu beherrschen, fiel ihr der Unterton ungestümer Aufregung in seiner Stimme auf. »Wir haben eine Leiche gefunden.«
Kapitel 3
Paul Gallo erfuhr von dem Monster, als er gerade bei einem Glas Johnnie Walker im Telluride saß und Essays über Conrads Herz der Finsternis korrigierte.
Die Bar Telluride stach mit ihrer Après-Ski-Aufmachung unter den rustikalen, maritim angehauchten Kneipen von Annapolis’ Innenstadt vollkommen deplatziert heraus. Ein Paar gekreuzte Skis hingen über der Theke und eingerahmte Fotos von diversen Pisten in Colorado an den holzgetäfelten Wänden. An einem Ende der Bar befand sich ein einladender Kamin aus Naturstein mit einer abgenutzten Couch im Navajo-Muster davor. Lackierte Holzschilder stellten ausgestopfte Antilopenköpfe zur Schau, deren tote Augen grau mit Staub bepelzt waren.
Der Wirt war ein ehemaliger Kriminalkommissar namens Luther Parnell. Luther war noch nie im Leben Ski gefahren und hatte Paul gegenüber mehr als einmal zugegeben, dass er eine Skipiste nicht von einer Rodelbahn unterscheiden konnte. Er hatte das Lokal gekauft, als er in den Ruhestand gegangen war, und da das Telluride sich reger Kundschaft erfreute und keinerlei Renovierungen bedurfte, hatte er es unverändert gelassen. Selbst den Namen.
Paul mochte die Atmosphäre der Kneipe im Allgemeinen und Lou im Besonderen, aber er kam hauptsächlich her, weil sie vom College Campus zu Fuß zu erreichen war. Seine Dienstags- und Donnerstagsseminare fanden spätnachmittags statt, was bedeutete, dass er um die Abendessenszeit herum fertig war. Da ihn Mikrowellendinner vor dem Fernseher nicht zurück in sein Haus in der Conduit Street lockten, hatte er sich im Laufe der Zeit unvermeidlich angewöhnt, an diesen Tagen im Telluride zu essen, wo er nebenbei Essays korrigierte und sich mit Lou unterhielt.
An diesem Abend hatte Paul seinen Burger schon aufgegessen und arbeitete an seinem zweiten Glas Scotch, als Luther Parnell hinter der Theke vorbeiging und beiläufig die Worte »Dread’s Hand« fallen ließ.
Paul sah von der Abhandlung auf, an der er gerade saß, und starrte Lou an. »Was hast du gesagt?«
Luther zeigte auf den Fernsehschirm, der über der Theke hing. Eine Luftaufnahme von einer trostlosen, mit spärlichen Schösslingen bewachsenen Lichtung war zu sehen, die von großen, grauen Bäumen umringt war. Zwischen zwei Bäumen stand ein diagonal geparkter einsamer Streifenwagen, und mehrere Menschen gingen hin und her. Ein gelber Bagger, der blaue Abgaswolken ausstieß, schaufelte einen Graben. Der Text unten auf dem Bildschirm wies den Ort der Aufnahmen als Dread’s Hand, Alaska aus.
»Das ist mal ein origineller Name für eine Stadt, was?«, sagte Luther. »Hand des Schreckens?«
Aber Paul hörte ihm jetzt kaum noch zu. »Worum geht’s? Kann man das nicht lauter stellen?«
Luther zuckte die Achseln und gab ein Geräusch von sich, das fast wie ein Grunzen klang. Er wandte seine Aufmerksamkeit einem Mann mittleren Alters mit werdender Halbglatze und Krawatte am anderen Ende des Tresens zu. Der Mann mittleren Alters sagte irgendetwas und Luther Parnell lachte sein lautes, tiefes Lachen.
»Lou«, rief Paul ihm zu. »Kannst du das lauter machen? Kannst du den Ton aufdrehen?«
In diesem Moment wurde unten auf dem Bildschirm ein Stück Text eingeblendet: UNBEKANNTER TOTER AUS FLACHEM GRAB GEBORGEN.
Paul stand von seinem Barhocker auf. Der rote Stift, mit dem er die Essays der Studenten korrigierte, rollte vom Tresen und fiel klappernd zu Boden. Daraufhin drehten sich ein paar Köpfe in seine Richtung, doch er bemerkte es kaum. Er konnte sich auf nichts anderes als den Fernsehschirm konzentrieren.
Luther drückte sich hinter die Theke und fing an, nach der Fernbedienung zu suchen.
»Na komm, mach schon«, sagte Paul und wedelte mit der Hand.
»Herrje, Junge, krieg dich wieder ein«, sagte Lou, der immer noch hinter der Theke nach der Fernbedienung fahndete.
Auf dem Bildschirm wurde der Text von einem neuen Abschnitt ersetzt, dessen Anblick Paul wie ein eiskalter Finger über das Rückgrat strich: EINWOHNER VON ABGELEGENEM DORF IN ALASKA BEKENNT, IN DER GEGEND EINE UNBEKANNTE ANZAHL VON OPFERN ERMORDET ZU HABEN.
Paul Gallos Ohren füllten sich mit hämmernden Herzschlägen.
»Lou«, sagte er.
»Ja doch, eine Sekunde noch.« Endlich fand Lou die Fernbedienung und zeigte damit auf den Bildschirm.
Aus den Lautsprechern gellte die Stimme einer Reporterin, die mitten im Satz war: »… als ein Mann am Dienstagnachmittag ein örtliches Café betrat und gestand, eine unbekannte Anzahl von Opfern ermordet zu haben, sagt die Polizei. Quellen zufolge behauptet der Tatverdächtige, diese Opfer in einer bewaldeten Gegend ein paar Meilen außerhalb des abgelegenen alaskanischen Dorfs Dread’s Hand, einer früheren Bergbaustadt um die hundert Meilen nordwestlich von Fairbanks, begraben zu haben. Wie unser SkyCrew-Video zeigt, ist die Polizei vor Ort und seit achtundvierzig Stunden rund um die Uhr im Einsatz. Die Polizei hat die Identität des Mannes noch nicht bekanntgegeben. Bisher gibt es nur wenige Informationen, außer, dass er sich momentan unter ärztlicher Aufsicht in Untersuchungshaft befindet. Ein Zeuge gibt an, dass der Mann ein Einwohner des Orts ist oder war, aber die zuständige Kriminalabteilung von Alaskas Bureau of Investigation hat noch keine offizielle Erklärung abgegeben.«
»Eine wirklich beunruhigende Situation, Sandra«, sagte ein anderer Reporter, während das Fernsehbild ins Studio überwechselte, in dem zwei Journalisten hinter einem hohen Tresen saßen und angemessen betroffene, aber gleichzeitig muntere Gesichter machten. »Um es noch einmal zusammenzufassen: Eine noch nicht identifizierte Leiche ist an ungefähr der Stelle geborgen worden, die ein Tatverdächtiger der Polizei gezeigt hat. Er behauptet, in diesem entlegenen Dorf in Alaska mehrere Menschen ermordet zu haben.«
Paul schien ewig lange dazustehen und den Fernseher anzustarren, bis die Nachrichten schließlich von Werbung unterbrochen wurden. Sein Herz trommelte gegen seinen Brustkorb und seine Hände zitterten. Schließlich merkte er, dass Lou ihm etwas zurief.
»He, alles okay, Paul?«
Paul sah sich um und merkte, dass einige andere Gäste von ihren Tischen zu ihm hinübersahen. Sie wandten sich ab, als sein Blick sie traf.
»Mann, was ist denn los mit dir?«, fragte Lou. Er zeigte mit dem Kinn auf Pauls Barhocker und schlug ihm vor, sich hinzusetzen, ehe er zu Boden fiel.
Paul setzte sich und starrte seinen Drink an. Dann kippte er ihn sich die Kehle hinunter.
Lou stellte den Fernseher stumm und legte die Fernbedienung unter den Tresen. Er lehnte sich über die Bar zu Paul hinüber. Der Diamantohrstecker in seinem linken Ohrläppchen funkelte. »Was zum Teufel ist mit dir los, Mann?«
Paul räusperte sich. »Dread’s Hand ist, wo Danny verschwunden ist.«
»Danny«, sagte Lou. Er sprach den Namen aus, als sei er ihm nicht geläufig. Doch dann dämmerte es ihm anscheinend – Paul sah, wie Luther Parnells Gesicht eine vollkommene Veränderung durchlief –, und der Mordkommissar im Ruhestand sagte mit mehr Mitgefühl: »Danny. Dein Bruder. Scheiße, Paul. Bist du dir sicher?«
»Ganz sicher«, sagte er und dachte, wer würde einen Ortsnamen wie Dread’s Hand jemals wieder vergessen?
Lou warf einen Blick auf den Fernseher, in dem jetzt Werbung für Hypotheken lief. Luther Parnell kannte die Geschichte von Pauls Bruder. Als Danny vorübergehend bei Paul gewohnt hatte, war er sogar ein paarmal mit Paul ins Lokal gekommen. Als Danny spurlos verschwand, war es Lou gewesen, der Paul mit einem seiner alten Kollegen in Verbindung gesetzt hatte, einem Ermittler namens Richard Ridgley in Baltimore City. Ridgley hatte einige von Dannys persönlichen Konten einsehen können – Kreditkartenauszüge und Handydaten – und hatte Paul schließlich an Jill Ryerson weitergeleitet, einer Kriminalkommissarin von Alaskas Bureau of Investigations – Abteilung für Kapitalverbrechen in Fairbanks. Es waren Ryersons Kollegen gewesen, die schließlich den an irgendeiner namenlosen Schotterstraße außerhalb von Dread’s Hand stehengelassenen Mietwagen von Danny gefunden hatten.
»Das ist verrückt«, sagte Paul. In seinem Kopf drehte sich alles.
»Beruhig dich«, sagte Lou. »Bleib hier ein paar Minuten still sitzen und beruhige dich, Paul, okay?«
»Mir geht’s gut«, sagte er – was nicht ganz stimmte, das wusste er, denn ihm war innerhalb von dreißig Sekunden erst eiskalt und dann unangenehm heiß geworden. Er lockerte seine Krawatte und knöpfte die beiden obersten Knöpfe seines Hemds auf.
»Möchtest du, dass ich Ridge anrufe?«
Paul schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, was das jetzt bringen sollte«, sagte er. Er sah zum Bildschirm hoch, aber es lief immer noch irgendwelche Werbung. »Wie funktioniert das bei so was, Lou? Diese Leiche wurde gefunden … und was kommt nun?«
Lou zog die Augenbrauen hoch und verschränkte seine Arme. Das auf seinen Bizeps tätowierte Hula-Hula-Mädchen dehnte sich. Zuerst nahm Paul an, dass Lou selbst nachdenken musste, doch als Lou zu sprechen begann, wurde Paul klar, dass der ehemalige Mordkommissar lediglich nach den einfühlsamsten Worten gesucht hatte, mit denen er die Frage beantworten konnte.
»Ich schätze, es kommt alles auf … na ja, den Zustand der Leiche an«, sagte Lou. »Wenn die Verwesung noch nicht allzu weit fortgeschritten ist, können sie Fingerabdrücke nehmen und sie durch den Computer jagen. Man kann auch nach dem Zahnschema suchen, aber das wird meist erst gemacht, wenn man eine Vermutung hat, um wen es sich handelt, und das bestätigen will. Es gibt … außerdem weitere Anzeichen am Körper …« Lous Stimme verlor sich. Er runzelte die Stirn. »Diese ganze Scheiße willst du wirklich nicht hören.«
»Ich will nur wissen, wie es jetzt weitergeht«, sagte Paul.
»Es geht damit weiter, dass du jetzt nicht sofort voreilige Schlüsse ziehst«, sagte Lou. »Sagtest du nicht, dass du eine Kontaktperson in Alaska hast? Jemanden, mit dem Ridge dich in Verbindung gesetzt hatte?«
»Ryerson. Sie ist Kommissarin der Mordkommission.«
»Ruf sie an.«
»Wie spät ist es denn jetzt in Alaska?«
»Keine Ahnung.« Lou griff unter den Tresen und zog die Flasche Johnnie Walker heraus. Er füllte Pauls Glas zum dritten Mal an diesem Abend. »Den gebe ich dir aus. Trink.«
Paul wollte trinken, wagte es aber plötzlich nicht, das Glas anzuheben. Seine Hände zitterten zu sehr.
»Halb fünf«, sagte der Mann mit der Krawatte am anderen Ende des Tresens.
Paul drehte sich zu ihm um. »Was?«
»In Alaska ist es jetzt sechzehn Uhr dreißig«, sagte der Mann. Er erhob sich von seinem Hocker und kam mit seinem großen Glas pissefarbenem Bier herüber und setzte sich neben ihn. Er tippte sich auf seine teuer aussehende Uhr und sagte dann: »Sechzehn Uhr achtunddreißig, um ganz genau zu sein. Da ist es vier Stunden früher. Ich hab mal in Anchorage gewohnt.«
»Danke«, sagte Paul.
»Entschuldigung, dass ich mitgehört habe.«
»Schon gut.«
Der Mann lächelte, was Paul annehmen ließ, dass er vielleicht den Großteil des Gesprächs doch nicht mitbekommen hatte. Er war zu gut gelaunt. Entweder das oder er war betrunken.
»Dieses Dorf Dread’s Hand«, sagte Paul und schwenkte die Hand in Richtung Bildschirm. »Kennen Sie das?«
»Nein, kenne ich nicht. Aber in der Gegend gibt es viele ehemalige Bergbaudörfer, manche davon so winzig, dass man sie kaum zur Zivilisation dazuzählen kann. Und manche sind völlig unzivilisiert.«
Betrunken, entschied Paul.
Der Mann lächelte und nippte dann fast geziert an seinem Bier. »Ich kann Ihnen sagen, das ist eine völlig andere Welt da oben«, fuhr er fort, nachdem er sein Bier wieder auf einen Papieruntersatz gestellt hatte.
»Glaub ich gern«, sagte Paul. In diesem Moment musste er an den Karton auf dem Regalbrett in seinem Schlafzimmerschrank denken.
»Auf Yahoo!News steht ein Artikel von der Associated Press«, sagte Lou, der auf sein iPhone starrte. »Ist gerade vor fünf Minuten aktualisiert worden, aber viel mehr Einzelheiten, als das, was du gerade gehört hast, sind nicht dabei.«
»Wissen Sie, die haben einen an der Pfanne da oben«, sagte der Mann mit der Krawatte.
»Wer?«
»Alle«, sagte der Mann. »Jeder Einzelne. Selbst in den Großstädten. Und je weiter man in die Wildnis fährt, desto verrückter sind sie. Vollkommen durchgedreht. Hohe Selbstmordraten, viel Alkoholismus. Häusliche Gewalt. Und jede Menge Vergewaltigungen gibt’s da oben, wissen Sie, wobei man davon nie in den Nachrichten hört. Jedenfalls nicht hier unten in den Lower 48s.« Der Mann nickte in Richtung Bildschirm, der ein weiches, bläuliches Licht auf seine große Halbglatze warf. »Von dem, was da oben vor sich geht, hört man nichts, bis dann so was wie das hier passiert. Dann kümmert sich die amerikanische Presse darum, zumindest eine Weile lang.«
Die Reporter waren jetzt wieder auf dem Bildschirm zu sehen, berichteten inzwischen jedoch über etwas anderes. Angesichts der aktuellen Zustände mit wöchentlichen Amokläufen in den USA und ständig neuen Terroristenangriffen auf der ganzen Welt – wie viel Aufmerksamkeit konnten die Medien da ein paar Leichen in Alaska schenken?
»Wissen Sie, ich hab da oben Mitte der 80er gearbeitet«, sagte der Mann. »Bin zwischen Anchorage und Fairbanks hin und her gependelt und hab Schadensersatzanträge für eine Versicherung bearbeitet, die auf die Öl- und Erdgasindustrie spezialisiert war. Meistens hatte ich in großen Unternehmen in einer von den beiden Großstädten zu tun und habe in Anchorage gewohnt, aber ab und zu, wenn ein uraltes Maschinenteil kaputtging oder sich auf irgendeiner Eisstraße ein Tanklaster überschlagen hatte, haben sie mich in abgelegene Dörfer geschickt, wo man sonst nie hinkommt. So was passiert da öfter, als man denkt.«
»Ich hab die Fernsehsendung gesehen«, kommentierte Lou. »Die mit den Lkw-Fahrern, die auf dem gefrorenen Meer unterwegs sind.«
»Viele der Straßen durch die Berge sind nicht asphaltiert und gefährlich. Manchmal stürzen Bäume auf die Straße und auf Autofahrer, wenn die’s nicht sehen, bevor es zu spät ist.«
Lou nickte.
»Damals war ich Anfang zwanzig, von daher war das für mich ein bisschen Abenteuer«, fuhr der Mann fort. »83 oder 84 war es, dass sie mich nach Manley Hot Springs schickten, was um die hundertfünfzig Meilen westlich von Fairbanks am Tanana River liegt. Außer diesen gottverlassenen Bergbaudörfern ist da nichts, wie ich ja schon sagte. Ich glaube, damals haben in Manley vielleicht siebzig Leute gewohnt, und davon waren vermutlich viele nur vorübergehend dort.
Es gibt eine Straße, den Elliott Highway, die von Fairbanks nach Manley Hot Springs führt. Außerhalb von Fairbanks ist die ganz normal geteert, aber die letzten achtzig Meilen oder so nach Manley ist es nur noch eine Schotterpiste. Kurz vor Manley war ein Tanklaster von der Straße abgekommen und sie hatten mich hingeschickt, um Fotos zu machen und einen Unfallbericht auszufüllen. Dieser Highway war berüchtigt für Unfälle, besonders im Winter, aber dieser Unfall war im Mai passiert und es war schönes Wetter.
Na ja, ich war jedenfalls damit zugange, Fotos zu machen und meine Formulare auszufüllen und hab mich um nichts anderes gekümmert, bis ich hinter mir einen alten, klapperigen Wagen an den Straßenrand fahren hörte. Den ganzen Morgen über waren nur ein paar vereinzelte Autos vorbeigefahren, deshalb fand ich es komisch, wissen Sie? Ich dreh mich um und sehe diesen großen braun-weißen Dodge Monaco mit einem großen Aluminiumkanu auf dem Dach. Steht mit laufendem Motor da, nur ein, zwei Meter hinter meinem Wagen. Ich sehe weiter hin und warte, dass der Fahrer aussteigt, denn mal ehrlich, es gibt keinen Grund, an dem Teil der Strecke anzuhalten, besonders nicht hinter einem anderen Auto. Es sei denn, man braucht Hilfe oder so, verstehen Sie? Vielleicht hatte er einen Platten oder vielleicht … ich weiß nicht … einen Herzinfarkt oder so. Hätte alles Mögliche sein können.«
»Wie lange ist er da so stehen geblieben?«, fragte Lou.
»Vielleicht fünfzehn, zwanzig Minuten. Ach ja, ich weiß nicht, ob Ihnen der Dodge Monaco was sagt, aber das war sozusagen der Cadillac der armen Leute und nicht gerade die Art von Auto, mit der man ein Kanu durch die Gegend fährt. Der Monaco steht weiter mit laufendem Motor da und ich kann hinter der Windschutzscheibe, an der die Sonne reflektiert, nur eine einzige Person sehen, die irgendwas macht. Aber dieser Typ steigt nicht aus. Hupt nicht, rollt nicht das Fenster runter oder winkt, um mir was zu sagen. Er macht nichts weiter, als da drinnen zu sitzen.
Ich mache meine Arbeit fertig und verstaue dann meine Kamera und meinen Unfallbericht wieder in meinem Auto. Und am liebsten wäre ich einfach losgefahren … aber dann sehe ich noch mal zu dem Wagen von diesem Typen rüber und denk mir, ach, komm, vielleicht braucht dieser Esel irgendwas von mir. Also gehe ich rüber, an die Fahrerseite. Der Fahrer rollt sein Fenster runter und dieses große, haarige Holzfällergesicht grinst mich an.
Brauchen Sie Hilfe?, frage ich ihn.
Nein, Sir, sagt er ganz höflich. Er scheint ungefähr in meinem Alter zu sein, wobei das wegen seines struppigen Barts schwer zu schätzen ist. Und er grinst mich an, irgendwie verkrampft, und ich weiß nicht, ob er sich über mich lustig macht oder einfach durchgeknallt ist.
Haben Sie sich verfahren?, frage ich ihn.
Nein, Sir. Ich hab mich nicht verirrt, sagt er und grinst immer noch wie eine Schnitzfigur. Im Gegenteil, man hat mich gefunden.
Genau das waren seine Worte – Man hat mich gefunden.
In dem Moment fällt mir auf, dass er ein Gewehr an den Beifahrersitz gelehnt hat, den Lauf an der Kopfstütze und nach oben zum Autodach hoch. Bei mir im Kopf schrillen die Alarmglocken los, und mir wird plötzlich klar, dass man meine Leiche vielleicht nie finden wird, wenn dieser Typ sein Gewehr nimmt und mich hier draußen erschießt. Und als ich ihn mir so betrachte, wird mir klar, dass dieser Typ vielleicht genau so einer ist, der das tun würde. Dieses komische Grinsen saß ihm immer noch im Gesicht und seine Augen sahen … ich weiß nicht … zu intensiv aus oder so. Als ob er sich zu sehr abmühte, fröhlich auszusehen und mich davon zu überzeugen, dass er, na ja, bloß ein ganz normaler Mann war. Und das fuhr mir nicht bloß durch den Kopf, weil ich das Gewehr sah – ich war schließlich in Alaska und ganz schön weit draußen in der Pampa und da hatte jeder Gewehre, wobei ich sagen muss, dass ich noch nie jemanden gesehen hatte, der mit dem Gewehr an den Beifahrersitz gelehnt herumfuhr. Also, mir begann diese ganze Situation Angst zu machen.
Und was machen Sie hier?, frage ich ihn.
Ich schaue nur, ob Sie bleich sind, sagt er zu mir.
Na, da hatte ich genug. Schönen Tag noch, wünsche ich ihm, steige in mein Auto und fahre weg.
Tja, und etwa eine Woche später sehe ich sein großes, haariges Holzfällergesicht wieder, aber diesmal in den Fernsehnachrichten. Der Typ hieß Michael Silka und hatte in und um Manley Hot Springs herum neun Menschen ermordet, darunter einen State Trooper und eine schwangere Frau und ihre Familie. Es kam zu einer Schießerei und die Polizei hat ihn nur ein paar Tage, nachdem ich ihm auf dem Elliott Highway begegnet war, erschossen.«
»Ach herrje«, sagte Paul.
Der Mann mit der Krawatte trank sein Bier aus und stellte das leere Glas auf den Papieruntersatz.
»Ich frag mich heute noch«, sagte der Mann, »ob Silka nur in dem Auto saß, um den Mut zu sammeln, mir mit dem Gewehr den Kopf von den Schultern zu schießen. Und vielleicht meine Leiche irgendwo verschwinden zu lassen und mein Auto zu stehlen. Aus mir sein zehntes Opfer zu machen, verstehen Sie? Eine schöne runde Zahl. Falls er das vorhatte – falls das der Grund war, dass er an dem Tag seinen klapperigen Wagen hinter meinem parkte und einfach fünfzehn, zwanzig Minuten dasaß und mich beobachtete –, dann weiß nur Gott, was ihn davon abgehalten hat, das zu tun.«
»Das ist das verdammt noch mal Unheimlichste, was ich je gehört habe«, sagte Lou. Er starrte den Mann mit fast lachhaft weit aufgerissenen Augen an. »Und ich hab im Laufe meines Lebens viele abgedrehte Sachen miterlebt.«
»Ab und zu denke ich noch daran«, sagte der Mann. Manche Menschen wären stolz darauf, eine solche Geschichte zu erzählen, dachte Paul, aber dieser Mann sah aus, als hätte ihm gerade jemand in den Magen geschlagen.
Der Mann zog einen 50-Dollar-Schein aus der Tasche und legte ihn sorgfältig neben sein leeres Bierglas auf die Theke. »Es war mir ein Vergnügen, Gentlemen. Einen angenehmen Abend noch. Und passen Sie auf sich auf.« Er hielt seinen Daumen und Zeigefinger wie eine Pistole und schoss auf Paul.
Paul sah ihm nach, wie er aus dem Lokal wankte.
»Das ist Tom Justice«, erklärte Lou. »Er wohnt nur ein paar Straßen weiter. Ab und zu kommt er her und besäuft sich und geht dann zu Fuß nach Hause.« Er sah Paul an. »Alles okay? Diese Gruselgeschichte hast du jetzt wahrscheinlich nicht gerade gebraucht.«
»Alles okay«, sagte er und wusste ganz genau, dass das nicht stimmte.
Es war Viertel nach zehn, als er sein Haus betrat, benommen von zu viel Scotch und verstört von dieser neuen, schrecklichen Möglichkeit. Um die fünftausend Meilen weit entfernt wurde eine Leiche aus der arktischen Tundra gegraben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um Danny handelte, war vermutlich äußerst gering, auch wenn er sich nicht überzeugen konnte, dass es eine Unmöglichkeit war. Er merkte auch, dass sich bis an diesem Abend und obwohl er seit Dannys Verschwinden vor über einem Jahr nichts mehr von ihm gehört hatte, ein Teil von ihm – ein immer schwächer werdender Kerzenschimmer – an die Hoffnung geklammert hatte, Danny könnte irgendwo immer noch am Leben sein. Dass Danny einfach ausgestiegen war und sich in die Wälder geschlagen hatte und sich da draußen wie der Mann in den Bergen von der Wildnis ernährte. Oder dass er vielleicht losgewandert war und ins Yukon Territory oder quer durch Kanada oder sonst wo hin marschiert war. Es war sogar möglich, dass Danny wieder Probleme mit der Polizei bekommen hatte und sein Verschwinden von Anfang an geplant hatte …
Es waren optimistische, wenn auch weit hergeholte Vorstellungen, aber ein Teil von Paul hatte daran immer wieder Halt finden können. Sie gaben ihm Hoffnung. Denn wäre es nicht typisch Danny, so was Verrücktes zu tun?
Doch die Abendnachrichten hatten das alles zu Fall gebracht. Er spürte seine Hoffnung dahinschwinden, und dieser Verlust höhlte ihn aus. Mit einem Mal fühlte er sich vor Trauer fast schwerelos.
Paul Gallo hatte weder Frau, Kinder, noch Haustiere und wurde nur vom dunklen Eingang seines Bungalows in der Conduit Street begrüßt, als er in die Tür trat. Er warf seine Aktentasche auf den Boden und ging ins Wohnzimmer, wo er zwischen zwei Sofakissen die Fernbedienung hervorkramte. Er stellte den Fernseher an und ging dann in die Küche, wo er sich eine Kanne starken Kaffees machte.
Als die Elf-Uhr-Nachrichten anfingen, saß er mit beiden Händen die Kaffeetasse umklammernd auf dem Sofa und wartete, während über nie versiegende Gewalttaten in Baltimore, korrupte Politiker in Washington und Sportveranstaltungen berichtet wurde, die ihm so gut wie nichts bedeuteten.
Der Beitrag über Dread’s Hand kam fast am Ende der Sendung.
»Des Weiteren führt die Polizei an diesem Abend in einem abgelegenen Dorf in Alaska immer noch eine Suche nach menschlichen Überresten durch«, berichtete der Nachrichtensprecher und betonte den Namen des Bundesstaats, als überraschte es ihn, dass es Alaska überhaupt gab. »Dienstagabend wurde in einem flachen Grab eine bisher nicht identifizierte Leiche entdeckt. Die Suche begann, nachdem ein örtlicher Einwohner angeblich gestanden hatte, eine ungewisse Anzahl von Personen in und um das Dorf Dread’s Hand herum ermordet zu haben. Er führte daraufhin die Polizei an die bewaldete Stelle, an der er behauptet, die Leichen vergraben zu haben.«
Auf dem Fernsehschirm wurde das Schwarzweißporträt eines Mannes um die Mitte fünfzig eingeblendet, dessen starres Gesicht nicht lächelte. Er trug eine karierte Jägerjacke und hatte einen perfekten Seitenscheitel, der ahnen ließ, dass er eine Halbglatze versteckte. Unter dem Foto stand der Name JOSEPH ALLEN MALLORY und der Text darunter erklärte: NAME VON MORDVERDÄCHTIGEM IN ALASKA BEKANNTGEGEBEN.
»Die Polizei hat den Tatverdächtigen heute Abend als Joseph Mallory identifiziert«, sagte der Sprecher, »der ein Einwohner von Dread’s Hand ist. Laut Polizeiaussagen wurde Mallory in ein Krankenhaus in Anchorage gebracht, wo er wegen Unterkühlung und Dehydrierung behandelt wird. Die Polizei hat keinerlei Angaben zur Anzahl der Opfer gemacht, und obwohl Mallory laut Aussagen des Polizeisprechers mit der Untersuchung kooperiert, hat er bislang kein Motiv für diese Verbrechen bekanntgegeben und nicht gesagt, um wen es sich bei seinen Opfern handelt.«
Das Schwarz-Weiß-Foto von Mallory verschwand und das unbewegte Gesicht des Reporters wurde wieder eingeblendet. »Und gerade eben wurde uns mitgeteilt, dass an derselben Stelle eine zweite Leiche gefunden wurde. Es wird davon ausgegangen, dass die Polizei ihre Suche die Nacht hindurch fortsetzt.«
Paul machte den Fernseher aus, stellte seinen Kaffee auf einen Beistelltisch und ging dann in sein Schlafzimmer hoch, wo er die Wandschranktür öffnete. Auf dem obersten Regalbrett standen Ringbücher mit Steuerunterlagen und Arbeitspapieren sowie ein paar Schuhkartons voller Kassenbons und Briefe. Zwischen den Schuhkartons und Aktenordnern stand ein flacher, etikettenloser Karton. Paul nahm den Karton aus dem Regal, setzte sich aufs Bett und öffnete die Schachtel auf seinem Schoß.
Die Kreditkartenauszüge und Telefondaten von Danny befanden sich darin, die Detective Richard Ridgely ihm geschickt hatte, sowie mehrere Postkarten, die Danny ihm zu Anfang seiner Alaska-Reise geschickt hatte, und der Ausdruck eines großen Hochglanzporträts von Danny, das Paul der Staatspolizei in Fairbanks gemailt hatte: Danny in seiner Skijacke, die Sonnenbrille in die dunklen Haare hochgeschoben. Danny lächelte in die Kamera und sah aus wie Zahncremewerbung. Außerdem waren die Ausdrucke der letzten zwei SMS dabei, die Danny ihm geschickt hatte, bevor er nichts mehr von sich hören ließ. Die erste war: KOMME GERADE NACH DREAD’S HAND – DIE HAND DES SCHRECKENS, WIE GRUSELIG! Die zweite war ein leicht verschwommenes Selfie von Dannys Gesicht vor dem Hintergrund eines verfallenen Blockhauses. Paul hatte beide Nachrichten an die Polizei weitergeleitet.
In dem Karton befanden sich außerdem Kopien der Vermisstenanzeige, die Paul beim Alaska Bureau of Investigation gestellt hatte. Oben an die Formulare war Investigator Jill Ryersons Visitenkarte geklammert, die sie ihm mit den Kopien per Post geschickt hatte.
Eine Handynummer stand nicht auf der Karte. Er musste die Büronummer wählen. Es klingelte mehrmals, bis eine Aufnahme von Ryersons kühler, professioneller Stimme ihn bat, eine Nachricht zu hinterlassen. Piep.
Paul saß mit dem Telefon am Ohr auf der Bettkante, außerstande, ein Wort herauszubringen. Sein Kopf war voller verwirrter Gedanken, unkontrolliert hindurchbrausender Gedankenzüge, aber er fühlte sich machtlos, auch nur ein einziges Wort ins Telefon zu sprechen.
Daran liegt es aber nicht allein, dachte er, während das Telefon an seinem Ohr immer wärmer wurde. Du bist immer noch so blöd, dich an Hoffnung zu klammern, Du willst es gar nicht wirklich wissen, oder? Das ist doch besser, oder?
Schließlich legte er auf, ohne eine Nachricht hinterlassen zu haben.
Kapitel 4
Als Kinder waren sie unzertrennlich gewesen. Sie hatten sich den Bauch ihrer Mutter geteilt, teilten dieselbe Abstammung: Paul Gallo wurde sieben Minuten vor seinem Zwillingsbruder Danny geboren. Paul kam schnell zur Welt, ein rosa, schreiendes Bündel mit zitternden Beinchen und Ärmchen, den zahnlosen Mund weit aufgerissen, die Augen wie ein Ferkel zusammengekniffen und verklebt. Er wurde sauber gewischt und schnell ans andere Ende des Kreißsaals gebracht, wo zwei Krankenschwestern seine Vitalwerte maßen. Alles schien in Ordnung zu sein. Aber während Dannys Geburt gab es Komplikationen.
»Dann wollen wir mal den zweiten holen«, sagte der Arzt, und Pauls Mutter presste. Dann sagte er: »Warten Sie, warten Sie. Moment mal.«
Eine andere Krankenschwester sah auf den Monitor. »Der Blutdruck des Babys ist gesunken«, sagte sie.
»Was bedeutet das?«, fragte Michael Gallo, Pauls Vater. »Was ist los?«
Die Nabelschnur hatte sich in der Gebärmutter um den Hals des Säuglings geschlungen, erklärte der Arzt. Jedes Mal, wenn die Mutter presste, zog sich die Schnur wie eine Schlaufe zusammen.
»Versuchen wir es mit einer anderen Position«, schlug der Arzt vor. Er wies die neben ihm stehende Krankenpflegerin an: »Holen Sie uns Hilfe.«
Sie halfen Melinda Gallo in eine andere Stellung, aber beim nächsten Pressen fiel Dannys Blutdruck erneut. Eine der Krankenpflegerinnen befahl Michael Gallo, Platz zu machen.
»Doktor!«, rief eine der Schwestern am anderen Ende des Zimmers. »Der Blutdruck fällt.«
»Wir kümmern uns darum«, versicherte der Arzt ihr.
»Nein«, rief sie. »Bei diesem Baby. Hier. Hier.«
Paul Gallos winziger Körper war auf der Waage unter den Wärmelampen schlaff geworden. Eine der Krankenschwestern hob seine Beine und schlug ihn fest auf seinen schmalen, roten Hintern. Das Baby weinte nicht.
»Doktor …«
»Holen Sie Hilfe«, wiederholte der Arzt. »Sofort.«
»Was ist denn?«, verlangte Michael Gallo zu wissen. Er ging zu der Waage hinüber, auf der der kleine Paul bewusstlos mit allen Vieren von sich gestreckt auf einer gestreiften Babydecke lag. Ein Auge stand offen und starrte ins Nichts. Und in dem Moment, als Michael seinen Sohn ansah, erschauderte Paul und begann wieder zu schreien.
»Gott sei Dank«, flüsterte die Pflegerin neben Michael Gallo.
Auf der anderen Seite des Zimmers stöhnte Melinda Gallo, schrie auf, presste erneut.
»Nein«, sagte der Arzt ruhig zu ihr.
Auf dem Monitor verlangsamte sich Dannys Herzschlag.
Auf der Waage wurde Pauls winziger Körper wieder schlaff.
Letztendlich machten sie einen Notkaiserschnitt und brachten Danny unverletzt zur Welt. Er schrie, als er einen Klaps auf den Hintern bekam, und sein etwas älterer Bruder fiel auf der anderen Seite des Zimmers in sein Geschrei ein. Der Arzt, ein Mann um die sechzig mit einem feuerroten Bart, sagte später mit einem verwunderten Lächeln auf den Lippen, wie seltsam das alles war, aber den jungen Eltern gegenüber erwähnte er es nicht mehr. Niemand sprach mehr davon.
Sie waren eineiige Zwillinge und sahen sich als Kinder auch tatsächlich sehr ähnlich – so sehr, dass Melinda Gallo sich einen Spaß daraus machte, ihre Ähnlichkeit zu betonen, und ihnen oft dieselbe Kleidung anzog, sodass ihre Nachbarn, Mitschüler und selbst Verwandte sie nicht auseinanderhalten konnten. Zu der Zeit hatten die Jungs denselben Haarschnitt, identisch von links nach rechts gescheitelt, und freuten sich, damit zur allgemeinen Verwirrung beizutragen. Damals, bevor die brüderlichen Bande unter dem Gewicht des nahenden Erwachsenwerdens zu schwächeln begannen, bestand eine geheime Magie zwischen ihnen. Seht ihr diese Jungs? Könnt ihr sie sehen? In den Sommern rannten sie barfuß und ohne T-Shirts an den schlammigen Ufern des Magothy entlang. An kühlen Sommerabenden schliefen sie draußen im Garten hinter dem Haus, sahen zum Himmel mit seinen glänzenden Sternen hoch, und ihre Zehen glitten durch das taufeuchte Gras, während sie sich zuflüsterten und kicherten und glücklich waren. Es war die Magie von Kindheit und Brüdern, und dies waren die stärksten Kräfte des Universums. Zumindest eine Weile lang.
Als Teenager begann Paul und Danny Gallos Ähnlichkeit dahinzuschwinden. Es war offensichtlich, dass sie Brüder waren, aber sie konnten anderen nicht mehr glaubhaft vortäuschen, dass einer der andere war. Und sie wollten es auch gar nicht mehr, sondern hatten es darauf abgesehen, sich jeder eine eigene Identität zu schaffen. Paul behielt die Haare kurz, während Danny seine in langen, widerspenstigen Strähnen über den Hemdkragen hängen ließ. Paul verbrachte seine gesamte High-School-Zeit glattrasiert und sauber geschrubbt, während Danny sich oft einen drahtigen schwarzen Ziegenbart und Koteletten stehen ließ, die buschig wie Fuchsschwänze waren. Sie waren beide durchschnittlich groß und hatten eine durchschnittliche Figur, aber Paul bewegte sich meistens schnell und zielgerichtet – wie ein Kolibri, sagte ihre Mutter manchmal –, während Danny sich mit der Zeit einen schlendernden Gang angewöhnte, der ihren Vater reizte und nach einem Grad von Frechheit aussah, dem Danny nur allzu gern gerecht wurde.
Und diese neu entdeckten Unterschiede beschränkten sich auch nicht auf ihr Äußeres. Ihre gesamte Schulzeit hindurch war Paul ein fleißiges, belesenes Kind. Er bekam gute Noten, und das mit Leichtigkeit. Auch im Sport war er nicht schlecht, wobei ihn niemand je für einen talentierten Athleten hielt. Danny dagegen tat sich im Unterricht schwer und war stets kurz davor, in irgendeinem Fach zu versagen. Er interessierte sich überhaupt nicht für Bücher. Im Gegensatz zu Paul war Danny allerdings ein athletisches Naturtalent, auch wenn er am Sportunterricht kein Interesse hatte und bei den Fußball- oder Baseballspielen der Nachbarschaftskinder selten mitmachte. Weil ihr Vater darauf bestand (der vielleicht glaubte, dass ein Sportstipendium Dannys beste Chance sei, an ein vernünftiges College zu kommen), versuchte Danny ins Ringkampfteam der Schule aufgenommen zu werden. Er nahm nur an zwei Kämpfen teil – die er beide gewann –, bis er aus der Mannschaft gestoßen wurde, weil er im Umkleideraum Zigaretten rauchte. Ihr Vater explodierte, aber Danny tat es gleichgültig ab. »Konnte diese bescheuerten Vereinsmeier eh nicht ausstehen«, sagte Danny später zu Paul, was ihr gesamter Austausch zu diesem Thema war.
Als sie in der neunten Klasse waren, stritt ihr Vater sich mit Danny darüber, dass er sich einen Sommerjob besorgen sollte. Dannys Vorstellungen von Sommerferien bestanden zu diesem Zeitpunkt aus Kiffen und Van Halen hören, aber er wusste, dass ihr Vater nicht nachgeben würde, und beschaffte sich daher einen Job an der Kasse von Caldor, einem Kaufhaus. Er verließ das Haus jeden Morgen um acht und kam nachmittags gegen fünf zurück, und ihr Vater ließ ihn in Ruhe. Aber irgendwann Anfang August entdeckte Paul, der auf Mittagspause von seinem Sommerjob im Baumarkt war, Danny auf dem Parkplatz von Taco Bell. Danny lag auf der Autokühlerhaube eines Freundes in Jeans-Shorts und T-Shirt auf dem Rücken, hatte eine verspiegelte Sonnenbrille auf und ein Leck-mich-am-Arsch-Grinsen im Gesicht, und rauchte eine Marlboro. Als Paul seinen Namen rief, setzte Danny sich abrupt auf, und seine nichtsnutzigen Freunde, die sich um ihn herum im Gras lümmelten oder wie Geier auf dem Kantstein hockten, setzten sich ebenfalls auf. Doch als Danny sah, dass es nur Paul war, sein älterer Bruder (wenn auch nur eine Handvoll Minuten älter), verbreiterte sich das Leck-mich-am-Arsch-Grinsen zu einem richtigen Lächeln. Er sagte Paul, dass er mit seinen Freunden für den Rest des Tages an den Strand fahren würde. Ob Paul mitkommen wollte? Paul erwiderte, dass er zurück auf die Arbeit musste und Danny doch auch, dachte er. Das Lächeln wurde lediglich noch breiter – was wie ein Ding der Unmöglichkeit schien –, und Danny musste nichts weiter erklären. Er hatte gar keinen Sommerjob gehabt und ihren Vater – und Paul – den ganzen Sommer lang angelogen.
Allerdings hatte