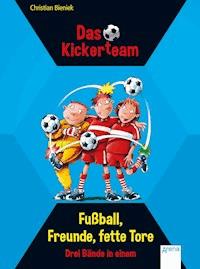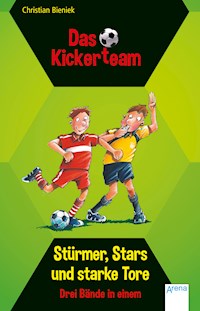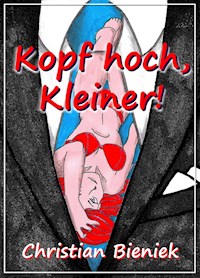
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Achim ist TV-Serienautor, leidet aber seit geraumer Zeit unter einer Schreibblockade. Dass seine Frau ausgerechnet mit einem albernen Hunderoman einen Bestseller landet, macht die Sache auch nicht besser. Ein Silberstreif am Horizont ist sein neuer Job als TV-Redakteur, doch Adams Freude ist nur von kurzer Dauer. Denn erstens hat er die Stelle seiner Ehefrau zu verdanken, und zweitens muss er - ziemlich leidvoll! - erfahren, dass die attraktive Frau in seinem Büro nicht seine Sekretärin, sondern seine Chefin ist...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Bieniek (1956-2005)
hat es mit seinem Werk geschafft, zu einem der bekanntesten und beliebtesten Kinder- und Jugendbuchautoren Deutschlands zu werden. Seine vielen Lesereisen, die begeistert aufgenommen wurden, machten aus ihm einen Autor zum Anfassen. So konnte er selbst Lesemuffel zum Lesen animieren. Christian Bieniek schrieb nicht nur für Kinder und Jugendliche.
Christian Bieniek
Unfair ist das Leben schon, wenn Mann seit Jahren schreibblockierter Hochliterat ist und plötzlich die Ehefrau mit einem Tierbuch den Bestseller landet. Wenn Mann vom Freund der Tochter analysiert und als hoffnungsloser Fall abgelegt wird. Einen Silberstreif am Horizont bietet der neue Job als TV-Redakteur, denn hier ist sich der Held sicher, dass er endlich gewürdigt wird. Bis er feststellen muss, dass die tolle Frau in seinem Büro nicht seine Sekretärin, sondern sein Boss ist und er den Job sowieso der eigenen Ehefrau verdankt. Mit schnoddrigem Witz und atemberaubendem Tempo zeigt Christian Bieniek, wie der moderne Adam im Leben mit lauter Klassefrauen besteht – manchmal halt nur auf kleiner Flamme. Turbulente Szenen, freche Sprüche und ein unwiderstehlicher Held garantieren echtes Lesevergnügen
© Text: Helga Bieniek – Sonja Tolstov © Covergestaltung: Eva Pissulla – Brigitte Pissulla Amazon Kindle Veröffentlichung 2017 Epubli-Veröffentlichung 2018
ERSTES KAPITEL
1
Ich fuhr hoch und schlug auf den uralten Wecker ein, bis er verstummte. Ellen stieß einen Seufzer aus, wälzte sich auf die andere Seite und schlief weiter. Dass sie vor mir aufstand, mir ein tolles Frühstück machte und am Bett servierte, war schon öfter vorgekommen - allerdings nur in meinen Träumen. Ich stieg aus dem Bett und schlüpfte in meine Hausschuhe. Sie waren ein Weihnachtsgeschenk von Vanessa und drei Nummern zu groß. Das Gehen darin wurde nie langweilig, da ich mich bei jedem Schritt anstrengen musste, sie nicht zu verlieren. Eigentlich ein Wunder, dass ich noch keine Krampfadern in den Waden hatte. Vanessa kannte meine Schuhgröße nicht. Sie wusste ebenso wenig, wie alt ich war, was ich studiert hatte und wie ich mit zweitem Vornamen hieß. Warum hätte sie das auch interessieren sollen? Ich war ja nur ihr Vater. Als ich an der Badezimmertür vorbei zur Toilette schlurfte, brummte ich: “Guten Morgen!“ “Morgen, Paps!“ rief Vanessa überraschend gutgelaunt zurück. Meistens war sie morgens genauso ungenießbar wie ich. Auf der Toilette hing eine Zeichnung von einem gewissen Gabriel Silewski. Sie stammte offenbar aus einer frühen Schaffensperiode des Meisters, und zwar aus seiner Zeit im Kindergarten. Ellens Begeisterung für moderne Kunst war so ziemlich das einzige, was ich nicht an ihr ausstehen konnte. Neuerdings schleppte sie sogar moderne Möbel an, zum Beispiel einen furchtbar schmalen Sessel mit einer schrägen Sitzfläche aus verrosteten Eisenstangen. Ich wagte mich kaum draufzusetzen, wenn nicht gerade ein Orthopäde im Zimmer war. Ich ging runter in die Küche, warf die Kaffeemaschine an und deckte den Tisch. Um mir nicht den Appetit aufs Frühstück zu verderben, vermied ich jeden Blick in Richtung Spüle. Dort stapelte sich nämlich mal wieder das schmutzige Geschirr der letzten vier Tage. Ellens Interesse an Hausarbeit war seltsamen Schwankungen unterworfen: Manchmal polierte sie stundenlang die Kacheln im Badezimmer, um dann eine Woche lang völlig zu vergessen, dass wir eine Waschmaschine, einen Staubsauger und eine Mülltonne hatten. Also mussten Vanessa und ich ran, wenn in unserer Küche Seuchengefahr drohte oder es im ganzen Haus kein sauberes T-Shirt mehr gab. Wir waren ein perfekt eingespieltes Team: Ich machte die ganze Arbeit - und Vanessa dachte sich Ausreden aus, um mir nicht dabei helfen zu müssen. Mit einem strahlenden Lächeln kam Vanessa herein, boxte mich leicht in den Bauch und rief fröhlich: “Na? Gut geschlafen?“ “Was ist los?“ fragte ich mit ernster Miene. “Hast du irgendwelche Drogen genommen?“ “Hä?“ “Du bist so gut drauf, und das vor dem Frühstück.“ Sie schnitt eine Grimasse. Dann setzte sie sich an den Tisch, schüttete Müsli in ihre kleine Schüssel, goss Milch darüber und begann zu essen. Ich ließ zwei Brotscheiben im Toaster verschwinden, setzte mich neben sie und schaute sie an. Abgesehen von dem einen oder andern kurzen Gastspiel, hatten Jungs bisher keine große Bedeutung für sie gehabt. Ich fragte mich manchmal, wie ich mich verhalten hätte, wenn ich als Fünfzehnjähriger so einem Mädchen über den Weg gelaufen wäre. Wahrscheinlich hätte ich schleunigst das Weite gesucht, und zwar mit gebrochenem Herzen. “Was glotzt du denn so blöd?“ knurrte Vanessa, lächelte dabei aber ihre Kakaotasse an. “Irgendwas stimmt nicht mit dir“, behauptete ich mit gespielter Besorgtheit und legte die Toastbrote auf meinen Teller. “Mit dir auch nicht“, konterte sie. “Warum gehst du eigentlich nicht mal zum Psychiater?“ Ich sah sie stirnrunzelnd an. “Dir fällt doch nichts mehr ein. So 'ne Therapie kann deine Phantasie vielleicht wieder in Schwung bringen.“ “Phantasie!“ schnaubte ich verächtlich. “Ich hab' noch nie Phantasie gehabt.“ “Ach nee! Und womit hast du früher deine Drehbücher geschrieben?“ “Mit der Schreibmaschine.“ Ich unterhielt mich nicht gern beim Frühstück über dieses Thema. Beim Mittagessen und Abendbrot auch nicht. Ehrlich gesagt hasste ich es, auch nur ein einziges Wort darüber zu hören oder zu reden, egal zu welcher Tageszeit. “Wieso willst du mit mir nicht darüber sprechen?“ fragte Vanessa gereizt. “Vielleicht hast du es noch nicht gemerkt: Ich bin nicht mehr zehn, sondern vierzehn.“ “Und du meinst, du hast dich in den letzten vier Jahren irgendwie verändert?“ Ich wollte sie wütend machen, um sie zum Schweigen zu bringen, was sie irrtümlicherweise für ihre stärkste Waffe hielt. Doch sie lachte nur über diesen plumpen Versuch. “Eins ist ja wohl klar: Auch Mutti ist dran Schuld, dass dir nichts mehr einfällt. Weil ihr Buch nämlich so erfolgreich ist.“ “Sehr scharfsinnig, Doktor Freud.“ “Hast du eigentlich schon mal was von Sigmund Freud gelesen?“ wollte sie wissen. “Von Büchern mit mehr als zwei Fremdwörtern pro Seite krieg ich Kopfschmerzen.“ “Ich lese gerade sein Buch über Träume. David hat gesagt, dass man durch Träume sehr viel mehr über sein Unterbewusstsein –“ Sie unterbrach sich abrupt. Ich biss in mein Toastbrot und sah sie an. Mir dämmerte, warum sie an diesem Morgen anders war als sonst. “Wer ist David?“ Sie wurde rot, schlug mir mit dem Handrücken auf den Oberschenkel und murmelte “Du bist blöd!“ Dann stopfte sie sich einen übervollen Löffel Müsli in den Mund und kaute ganz langsam darauf herum. Ich verstand sofort, dass sie mir damit ein Angebot machte: Kein Wort mehr über David, und dafür würde sie mein Schreibproblem nicht mehr erwähnen. Damit war ich natürlich einverstanden. Also plauderten wir über die Schule, bis sie mit ihrem Frühstück fertig war. Dann nahm sie eine Banane und einen Apfel aus der Obstschale und ging zur Tür. “Er kommt demnächst mal vorbei“, sagte sie mehr zur Türklinke als zu mir. “David?“ “Er wird euch gefallen.“ Ich nickte. Plötzlich kam sie zu mir und küsste mich auf die Backe. “Ich find‘s toll, dass du jeden Morgen meinetwegen so früh aufstehst“, erklärte sie mit einem leicht verlegenen Lächeln. “Deinetwegen? Wie kommst du denn darauf? Ich steh auf, weil ich schreiben will.“ Sie sah mich mitleidig an. “Du solltest mal mit David drüber reden. Vielleicht kann er dir helfen.“
2
Vielleicht lag es an diesem verdammten Computer, dass mir nichts mehr einfiel. Vor zwei Jahren hatte ich mir das Ding zugelegt und seitdem keinen Pfennig mehr verdient. Die drei oder vier Serienexposés, die ich auf dem Computer geschrieben hatte, waren völlig daneben. Ich bekam einen Ablehnungsbrief nach dem anderen. Alle waren so freundlich formuliert, dass ich zunächst gar nicht registrierte, wie sie mich zunehmend entmutigten. So tüftelte ich weiter an neuen Exposés herum, bis ich dann vor etwa einem halben Jahr entdeckte, dass ich keine Lust oder keine Kraft mehr zum Schreiben hatte. jeden Morgen versuchte ich es zwar aufs Neue, aber ich brachte einfach nichts zustande, was ich für Wert gehalten hätte, mir vom Computer ausdrucken zu lassen. Hatte sich meine Kreativität nur ein paar Monate Urlaub genommen? Oder war sie etwa endgültig in Rente gegangen? Das fragte ich mich auch jetzt, als ich - immer noch im Kimono - am Fenster meines Arbeitszimmers stand und in unsern Garten hinaussah. Vanessa hatte vor zehn Minuten das Haus verlassen, Ellen lag noch im Bett. Ich war allein mit dem Computer, den ich erst anmachen wollte, wenn etwas in meinem Gehirn auftauchte, was ich ohne jede Selbsttäuschung als Einfall bezeichnen konnte. Oder sollte ich auf den Speicher gehen und meine alte Schreibmaschine suchen? Ich beschloss, es erst einmal mit dem Tigergang zu versuchen. Also stieg ich aus den Hausschuhen, verschränkte die Hände hinter dem Rücken und ging zwischen dem Fenster und der Tür hin und her. Nach fünf Minuten hatte ich tatsächlich eine Idee: die Hausschuhe wieder anzuziehen, weil ich an den Füßen fror. Und jetzt? Keine Ahnung. Ich hatte in den letzten Monaten schon alles ausprobiert: Alkohol, Tabletten, Räucherstäbchen, Bach-Kantaten, Yoga und eine Überdosis Bananen. Ich hatte mich mit einer dicken Kladde auf dem Schoß in Parks, Cafés, Kneipen, Museen, Kirchen und Tiefgaragen gesetzt - ohne Erfolg. Was brauchte Ellen zum Schreiben? Den Küchentisch, einen Block und einen Kuli. Ich stellte den Schreibtischsessel ans Fenster, ließ mich reinfallen und legte die Füße auf die Heizung. Der Bernhardiner von Herrn Freese, der die andere Hälfte unseres Doppelhauses bewohnte, bellte im Garten nebenan. Ich bin kein Hundefreund, seit Timo hasse ich Hunde. Timo! Ich hatte mir doch geschworen, zumindest in meinem Arbeitszimmer keinen Gedanken mehr an ihn zu verschwenden. Vielleicht sollte ich einfach meine Koffer packen und mich für einige Wochen auf die Insel Baltrum zurückziehen. Dort schien das richtige Klima für gute Einfälle zu herrschen. im vorletzten Sommer hatte Ellen mit ihrer Freundin Hanna zwei Wochen auf Baltrum verbracht. Braungebrannt und mit einer seltsamen Idee im Kopf war sie wiedergekommen: Sie wollte ein Buch mit Geschichten über einen kleinen Hund schreiben. Ich bekam fast einen Lachkrampf, als sie mir davon erzählte, doch einen Monat später lachte ich schon etwas leiser, nachdem ich ihre ersten Hundestories gelesen hatte. Und dann kam Ende letzten Jahres der Tag, an dem ich das Lachen fast verlernte TIMO - EIN HUNDELEBEN tauchte an der Spitze der Bestsellerliste auf. Timo sah aus wie eine Kreuzung zwischen einem Terrier und einer zerquetschten Bierdose und philosophierte wie eine Mischung aus La Rochefoucauld und Peter Frankenfeld. Ellen gab in einer Woche mehr Interviews als ich in meinem ganzen Leben. Und fast jedes Mal wurde sie gefragt, was ihr Mann beruflich machen würde. Anscheinend konnte sich kein Mensch mehr daran erinnern, dass Achim Conrady der Autor von drei Fernsehserien war, die vor gar nicht allzu langer Zeit ganz passable Einschaltquoten erzielt hatten (und sogar zwei gute Kritiken). Der Witz an Ellens Erfolg war, dass sie vor ihrem Hundebuch noch nie etwas geschrieben hatte, abgesehen von den regelmäßigen Briefen an ihre Mutter. Wie konnte sie einfach so einen Bestseller schreiben? Und noch dazu, ohne mich ein einziges Mal um Rat gefragt zu haben? Sie hatte doch gar keine Ahnung vom Schreiben. Mit einundzwanzig hatte sie ihr Soziologiestudium abgebrochen, um nach Indien auszuwandern. Sie kam bis kurz vor Turin und blieb dort ein Jahr in einem Dorf hängen, wo sie mit einem jungen Bäcker zusammenlebte, der ihr jeden Tag einen Heiratsantrag machte. Aber sie kehrte ledig zurück, landete nach einigen Umwegen in unserer Münchner Wohngemeinschaft, heiratete mich und brachte Vanessa auf die Welt. Sie hatte als Kellnerin gejobbt, als Putzfrau und als Kassiererin. Wieso kam sie plötzlich auf die Idee, ein Buch schreiben zu können? Und warum konnte sie es tatsächlich? Natürlich gönnte ich ihr den Erfolg, zumal wir das Geld gut gebrauchen konnten. Die letzte Wiederholung einer meiner Serien lag tatsächlich schon etwas länger zurück. Und die Hoffnung, dass jemals wieder eins meiner alten Theaterstücke aus den Siebzigern aufgeführt werden könnte, hatte ich auch längst aufgegeben. Meine Stücke waren damals so aktuell gewesen, dass sie schon wenige Wochen nach der Uraufführung überholt waren. Oder möchte vielleicht noch irgendjemand eine dreistündige Tragikomödie über den Radikalenerlass sehen? Jedenfalls kam es zwischen Ellen und mir nicht zu Szenen, in denen ich ihr mit weinerlicher Stimme und einer halbleeren Whiskyflasche in der Hand vorwarf, mit ihrem Erfolg mein Talent kaputtgemacht zu haben. Solch dämliche Klischees gab es nur in meinen Serien. Auch ohne TIMO wäre ich wahrscheinlich in das kreative Loch gefallen, aus dem ich nun schon seit einem halben Jahr zu klettern versuchte. “Morgen, Schatz“, sagte eine müde Stimme hinter mir. Ich drehte mich um und sah die verschlafene Bestsellerautorin im Bademantel auf mich zukommen. “Schon wach?“ Ellen küsste mich flüchtig auf den Mund. Dann gähnte sie und fragte: “Und? Ist dir was eingefallen?“ “Nur drei Serien, eine Filmkomödie und zwei Theaterstücke.“ “Mehr nicht?“ Sie legte eine Hand auf meine Schulter. Mit dieser Hand würde sie gleich nach dem Frühstück an ihrem neuen Buch weiterschreiben, das den genialen Titel TIMO – EIN HUNDELEBEN II tragen würde. Der Verlag wartete schon ungeduldig auf das Manuskript. Ellen hatte nur ein einziges Schreibproblem: Wenn sie zehn Seiten hintereinander geschrieben hatte, tat ihr der rechte Unterarm weh. Ich erzählte ihr von David. “Du meinst, Vanessa hat jetzt einen richtigen Freund? Hoffentlich ist dieser David auch in Ordnung.“ “Glaub‘ ich kaum“, meinte ich kopfschüttelnd. “Der Junge hat ein ganz widerliches Hobby.“ “Rauschgift?“ “Nein, Sigmund Freud.“ Im Garten nebenan bellte Freeses Hund. Ellen machte plötzlich ein ernstes Gesicht und sagte leise: “Heute vor einem Jahr war der Unfall von Frau Freese.“ “Du hast dir das Datum gemerkt?“ Sie warf mir einen seltsamen Blick zu und schaute dann aus dem Fenster. “Sollen wir Freese nicht endlich mal einladen? Das haben wir schon seit der Beerdigung vor.“ “Ich seh‘ ihn doch jeden Tag“, meinte Ellen. “Ich nicht.“ “Wie würdest du eigentlich damit fertig werden, wenn ich plötzlich nicht mehr da wäre?“ “Ich würde durchdrehen, und zwar vor Freude. Vielleicht könnte ich dann nämlich wieder schreiben.“ Mit einem schwachen Lächeln ging Ellen zur Tür. “Ich hol‘ gleich meine alte Schreibmaschine vom Speicher“, verkündete ich und war gespannt, ob Ellen darauf mit einem spöttischen Grinsen reagierte. “Die hast du letztes Jahr weggeschmissen.“ Ich riss die Augen auf. “Was?“ “Warum schreibst du denn nicht mit der Hand? Das ist wirklich am besten.“ Sie ging hinaus und schloss die Tür. Meine alte Schreibmaschine! Meine alte Schreibmaschine mit dem abgesplitterten Lack und dem S, das dauernd klemmte - für immer verschwunden! Meine Hände begannen leicht zu zittern. Meine Kehle war völlig ausgetrocknet. Ich wollte schlucken, aber es ging nicht. Was war mit mir los? Zusammengesunken hing ich im Sessel und starrte meine Hausschuhe an. Ich konnte nur dasitzen und mir beim Atmen zuhören und immer wieder denken: Ich höre mich atmen. Es war soweit. “Ich hab‘ Depressionen!“ schrie ich so laut, dass ich selbst erschrocken zusammenzuckte. Ellen stürmte ins Zimmer. “Was ist passiert?“ fragte sie besorgt. Ich nahm meine ganze Kraft zusammen, erhob mich mühsam aus dem Sessel und schaute sie hilflos an. Sie war nackt. Sofort erwachten meine Augen zu neuem Leben und irrten auf Ellens Körper herum. “Ich wollte gerade unter die Dusche“, erklärte sie. “Was hast du denn?“ “Depressionen.“ “Das sehe ich.“ Sie zeigte auf eine Stelle meines Kimonos, wo sich eine deutliche Wölbung abzeichnete. Ich streckte die Arme nach ihr aus. “Du bist unmöglich!“ knurrte sie gereizt und ging hinaus.
3
Ich rannte davon, so wie jeden Vormittag. Für Ende März war es richtig warm. Ich hatte die Trainingsjacke zu Hause gelassen und lief im T-Shirt. Trotzdem begann ich schon an der ersten Straßenecke zu schwitzen. Ich liebte es zu schwitzen, es war ein Beweis dafür, dass ich etwas leistete. Wenn ich mir eine besonders lange Strecke vorgenommen hatte und unterwegs schlappzumachen drohte, brauchte ich nur den Geruch zu atmen, um meine Reserven zu mobilisieren. Komisch, dass der Geruch von Leistungsschweiß nicht auf der Dopingliste steht. Ende vergangenen Jahres hatte ich angefangen zu begreifen, dass das Nicht-Schreiben keine Beschäftigung war, die mich ausfüllte. Sicher, ich versuchte es Tag für Tag aufs Neue, gab meine Bemühungen aber immer rascher auf und musste mir schließlich etwas einfallen lassen, um die restliche Zeit totzuschlagen. Warum nicht joggen? Also zog ich an einem kalten Januarmorgen meine alten Turnschuhe an und rannte los. Nach zweihundert Metern blieb ich stehen, legte eine Hand auf mein Herz und riss entsetzt die Augen auf: Das war kein Herzklopfen, sondern ein Schlagzeugsolo. In Zeitlupe schlich ich zurück nach Hause, ließ mich aufs Sofa fallen und bat Ellen mit schwacher Stimme, den Notarzt anzurufen. Sie ging in die Küche und machte mir einen Kamillentee. Erst dann griff sie zum Telefon - um ihrer Freundin Hanna zu erzählen, was für einen Superathleten sie geheiratet hatte. Einige Tage später rannte ich wieder los. Diesmal schaffte ich es bis in den Schlosspark, und in den folgenden Wochen steigerte ich meine Laufzeiten immer weiter. O.K., es war nur Laufen, aber ich war glücklich über die Entdeckung, dass es irgendwas auf der Welt gab, bei dem selbst ein ausgebranntes Wrack wie ich Fortschritte machen konnte. Wenn ich völlig ausgepumpt und durchgeschwitzt nach Hause kam und dann in der Badewanne meine Waden und Oberschenkel durchknetete, war ich so stolz auf mich, als hätte ich gerade den Marathon-Weltrekord gebrochen. Ich bog in den Schlosspark ein und hielt Ausschau nach Toronto. Ich nannte ihn so, weil ich seinen richtigen Namen nicht kannte und auf der Rückseite seines Trainingsanzuges TORONTO stand. Schon vor Monaten waren wir uns täglich beim Laufen begegnet, aber erst einige Wochen später fingen wir an, uns dabei zuzunicken. Anfang März kamen wir zum ersten Mal ins Gespräch. Seitdem joggten wir zusammen, und mittlerweile vermisste ich ihn sogar, wenn er mal ausblieb und ich allein meine Runden durch den Park drehen musste. Ich hörte seine Schritte hinter mir. Kurz darauf holte er mich ein. “Na? Gut geschlafen? Oder haben Sie wieder die ganze Nacht an Ihrem Roman gearbeitet?“ “Nur bis um zwei“, behauptete ich. Beim Laufen konnte man ausgezeichnet lügen: Das Gesicht war sowieso rot, und weil man so schnell atmen musste, fielen gewisse Schwankungen in der Stimme nicht weiter auf. “Vorsicht!“ rief Toronto und zeigte auf einen Hundehaufen. Ich sprang drüber. “Der war garantiert von dieser Bulldogge mit dem roten Halsband. Womit kann man Hunde eigentlich am leichtesten vergiften?“ Toronto war ein leidenschaftlicher Hundefeind, aber das war nicht das einzige, was ihn mir sympathisch machte. Man konnte sehr gut mit ihm plaudern. Er redete zwar am liebsten über sich selbst, das aber meistens so amüsant, dass ich ihm gern zuhörte. Er war Besitzer einer großen Brauerei im Sauerland gewesen, die er ein Jahr zuvor für zehn Millionen verkauft hatte. Seitdem lebte er in einer Penthouse Wohnung in Düsseldorf und kümmerte sich nur noch um seine Geldanlagen und seine wechselnden Affären mit Kellnerinnen, Stewardessen und Models. Toronto war kein sonderlich diskreter Liebhaber. Die detaillierten Berichte über seine Liebesnächte ließen meine Erregung manchmal dermaßen anschwellen, dass ich kaum weiterlaufen konnte. Toronto war Ende Vierzig, also ein paar Jahre älter als ich, aber viel besser in Form. Joggen und Sex waren nur zwei der zig Sportarten, mit denen er sich fit hielt. Ich beneidete ihn um sein Geld, seine Frauen und seine Figur, doch am besten gefiel mir an ihm, dass er nichts von Ellen und Timo wusste. Mein Drang, ihm von den beiden zu erzählen, hielt sich sehr in Grenzen. Für den Rest der Welt war ich ein ehemaliger Fernsehautor, der vom Bestsellererfolg seiner Frau lebte. Für Toronto war ich ein ehemaliger Fernsehautor, der sich beim Joggen von der Arbeit an seinem ersten Roman erholte. Ich hatte keinerlei Gewissensbisse wegen dieser kleinen Schwindelei, im Gegenteil: Für den Fall, dass Toronto eines Tages meinen Namen wissen wollte, hatte ich mir schon einen ausgedacht. Doch sein Interesse an mir war nicht besonders groß. Wahrscheinlich ahnte er, dass mein Leben so aufregend war wie die Gebrauchsanweisung für eine Stehlampe. Allerdings erkundigte er sich regelmäßig danach, wie es mit meinem Roman weiterging. Dann musste ich ihm erzählen, wie sich die Geschichte weiterentwickelte. Die Story, die ich ihm auftischte, war absolut großartig. Am liebsten hätte ich sie wirklich zu einem Roman verarbeitet - wenn F. Scott Fitzgerald sie nicht schon vor sechzig Jahren in DER GROSSE GATSBY verwendet hätte. Wir liefen am Wassergraben hinter dem Benrather Schloss entlang. Toronto berichtete mir ausführlich von der vergangenen Nacht, die er mit einer jungen Spanierin verbracht hatte. Er hatte eine widerliche Art, über Frauen zu reden. Aber es war mindestens genauso widerlich, wie gierig ich ihm dabei zuhörte. Toronto kam schnell zum Höhepunkt seiner Geschichte. Und dann zum nächsten und zum übernächsten Höhepunkt. Und so ging es die ganze Nacht lang weiter, bis die Spanierin heiser war vom Stöhnen. Verglichen mit dem, was dieser Zuchtbulle mit seinen Gespielinnen veranstaltete, war mein Sexualleben mit Ellen so unschuldig wie die Sendung mit der Maus. Plötzlich sprang eine Dogge aus dem Gebüsch und stürmte mit wütendem Gebell auf uns zu. Toronto riss die kleine Spraydose aus der Tasche und sprühte dem Hund Tränengas in die Augen. Die Dogge jaulte auf und trollte sich. Ihr Besitzer schrie ein paar nette Worte hinter uns her. Wir drehten uns lachend um und zeigten ihm unsere ausgestreckten Mittelfinger.
ZWEITES KAPITEL 1
Als ich vier Tage später vom Joggen nach Hause kam, rief Paul Jansen an. Er war als Redakteur für meine letzte Fernsehserie verantwortlich gewesen und hatte mittlerweile die Fronten gewechselt, wie er sich ausdrückte. Seit zwei Monaten arbeitete er für eine Kölner TV-Produktionsfirma. Ich erwartete jeden Augenblick, dass Jansen mich bitten würde, Ellen ans Telefon zu holen, aber nein: Er schien tatsächlich mit mir sprechen zu wollen. Dann fragte er mich plötzlich doch nach Ellen. “Wie geht‘s denn Ihrer Frau?“ “Gut“, antwortete ich knapp. “Freut mich.“ Pause. War das etwa alles? “Wissen Sie denn nichts von ihrem Riesenerfolg mit dem Hundebuch?“ erkundigte ich mich sicherheitshalber. “Was für ein Hundebuch?“ “Kennen Sie nicht TIMO?“ “Muss man den kennen?“ Vor Freude hätte ich beinahe den Hörer geküsst. Wir plauderten über dies und jenes, so auch über den Niveauverfall der aktuellen Fernsehunterhaltung. Das gehörte seit mindestens fünfzehn Jahren zum Pflichtprogramm aller Gespräche zwischen Fernsehleuten. Wann würde er endlich fragen, ob ich ihm eine neue Serie anzubieten hätte? Und was würde ich darauf antworten? Aber er wollte etwas ganz anderes von mir, und als wir mit dem Smalltalk fertig waren, rückte er endlich damit raus. “Haben Sie keine Lust, für uns zu arbeiten?“ “Sie meinen schreiben?“ “Nein, als Redakteur. Also Manuskripte lesen, mit uns zusammen neue Konzepte erarbeiten, Kontakte zu Autoren und Sendern halten und so weiter. Wir haben hier ein sehr schönes Büro für Sie mit Blick auf den Rhein. Von Düsseldorf nach Köln ist es nur eine halbe Stunde mit der Bahn. Na? Was halten Sie davon?“ “Wissen Sie, warum ich Schriftsteller geworden bin? Weil ich nie in meinem Leben von acht bis vier in einem Büro sitzen wollte.“ Jansen lachte. “Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir arbeiten nämlich von neun bis fünf. Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Reden Sie erst mit Ihrer Frau und Ihrem Sohn darüber.“ “Tochter“, berichtigte ich ihn. “Und dann kommen Sie einfach mal vorbei und sehen sich unsern Laden an. Ich könnte Sie hier gut gebrauchen. Obwohl Sie eigentlich schon zehn Jahre zu alt sind für den Job“, fügte er hinzu. Ich war dreiundvierzig und Jansen Mitte Fünfzig. Der letzte Satz hatte sich trotzdem nicht scherzhaft angehört. Er gab mir seine Büro- und Privatnummer, und ich musste ihm versprechen, mich zu melden, sobald ich zu einem Entschluss gekommen war. Dann verabschiedeten wir uns. “War das Hanna wegen des Essens morgen?“ rief Ellen aus der Küche, wo sie an ihrem neuen Bestseller schrieb. “Nein, es war geschäftlich.“ “Warum hast du mich denn nicht gerufen?“ “Es war geschäftlich für mich.“ Ich konnte nicht verhindern, dass ein bisschen Stolz in meiner Stimme mitschwang. Aber wenn ich geglaubt hatte, dass Ellen sofort sterbend vor Neugier ins Wohnzimmer stürzen würde, war das ein Irrtum gewesen. Sie blieb in der Küche und arbeitete weiter. Erst beim Mittagessen sahen wir uns wieder. Es gab zwei Fertigmenüs aus der Tiefkühltruhe. Wenn ich mir vor dem Essen nicht die Zutatenliste durchgelesen hätte, dann hätte es mir vielleicht sogar geschmeckt. “Wo hast du das Zeug gekauft?“ fragte ich Ellen nach dem zweiten Bissen. “In einem Chemielabor?“ “Nun erzähl schon, wer vorhin angerufen hat. Wird etwas von dir wiederholt?“ Ich schüttelte den Kopf und kaute weiter. Ellen sah mich ungeduldig an. Ich fragte nach Vanessa und erfuhr, dass sie gerade eine Radtour mit David machte. Es war ihr erster Ferientag. David hatten wir bisher immer noch nicht zu Gesicht bekommen. Ellen fragte mich wieder nach dem Anruf, und ich fing an zu erzählen. Mein Bericht über das Gespräch mit Jansen entsprach nicht ganz der Wahrheit. Ich verriet Ellen nichts von der Hochstimmung, in die mich Jansens Angebot kurzzeitig versetzt hatte, und übertrieb ein wenig sein Interesse an mir. Was das Aufgabengebiet betraf, für das ich in der Produktionsfirma zuständig sein sollte, so grenzte ich es weniger eng ein als Jansen vorhin am Telefon. Es hörte sich für Ellen so an, als ob ohne mich künftig nichts mehr laufen würde in der deutschen Fernsehunterhaltung. Zudem deutete ich noch etwas an von einer eigenen Sekretärin und einem großen, luxuriösen Büro hoch über dem Rhein mit direktem Blick auf den Drachenfels. Ich hatte keine Skrupel, die Wahrheit auszuschmücken. Ellen kannte mich so gut, dass sie mir sowieso nie etwas richtig glaubte. Als ich ausgeredet hatte, fragte Ellen erstaunt: “Du nimmst Jansens Angebot also an?“ “Sonst noch was?“ Es war tatsächlich mein erster Impuls gewesen, nachdem ich den Hörer aufgelegt hatte. Doch dann hatte ich darüber nachgedacht und war zu dem Schluss gekommen, dass das eine Kapitulation gewesen wäre, eine Flucht vor meinem Computer, meinem Arbeitszimmer und meiner Ideenlosigkeit. Genauso pathetisch schilderte ich Ellen diese Überlegungen, und sie stimmte mir zu. “Aber vielleicht solltest du es trotzdem mal versuchen“, riet sie mir dann. “Du kämst hier raus, würdest neue Gesichter sehen und auf andere Gedanken kommen. Schreiben kannst du ja abends oder am Wochenende, wenn dir was einfällt.“ Ich verzog das Gesicht. Jansens Angebot hatte mir deutlich gemacht, wie ich einmal enden würde, wenn ich nicht so bald wie möglich wieder etwas Brauchbares zustande brachte. So wie bisher konnte es einfach nicht weitergehen. Und darum hatte ich auch kurz nach dem Anruf bereits am Computer gesessen und in Windeseile eine Ausgangssituation mit dem dazugehörigen Personal für eine Serie entworfen. Hinterher zwang ich mich dazu, die Qualität dieses Entwurfs nicht allzu gewissenhaft nachzuprüfen. Das war sicher mein Hauptfehler gewesen im letzten halben Jahr: Ich war zu kritisch mit meinen Ideen umgegangen. Waren die Serien, die ich bisher verkauft hatte, nicht alles in allem totaler Schrott gewesen? Genau an diesen Punkt musste ich wieder gelangen: Ich musste meine Ideen als schwachsinnig akzeptieren und dennoch versuchen, Fernsehserien daraus zu entwickeln. Ellen hörte mich kommentarlos an. lm Gegensatz zu mir liebte sie das Schreiben und konnte es nicht leiden, wenn ich so zynisch darüber redete. Und sie schien enttäuscht darüber zu sein, dass ich Jansens Angebot nicht annehmen wollte. Ob sie mir nicht mehr zutraute, jemals wieder an alte Erfolge anknüpfen zu können? Ich wäre ihr deswegen nicht böse gewesen, denn im Grunde traute ich es mir selbst nicht mehr zu. Ellen schlug mir vor, an einem der nächsten Tage nach Köln zu fahren und mir die Firma unverbindlich anzuschauen. Um ihr einen Gefallen zu tun, versprach ich es ihr.
2
Am Abend darauf gingen wir zu Knut und Hanna. “Wir haben die beiden doch erst letzte Woche gesehen“, maulte ich, als ich im Flur meinen Trenchcoat anzog. “Irrtum, es ist fast einen Monat her. Mach ja nicht den ganzen Abend so ein Gesicht. Hanna ist meine beste Freundin.“ “Aber Knut ist nicht mein bester Freund.“ Seit Ellens Bestsellererfolg wurde sie natürlich mit Einladungen überschüttet, aber zum Glück konnte ich mich meistens davor drücken, sie zu begleiten. Der Smalltalk der Werbeleute, Schönheitschirurgen, Anlageberater und Waschmittelhersteller, die sich für die feine Düsseldorfer Gesellschaft hielten, war für mich nicht ohne Walkman mit Heavy Metal zu ertragen. Ellen fand es ganz amüsant, ein wenig im Mittelpunkt zu stehen, und sie freute sich kindisch, wenn sie ein Bild von sich in den Gesellschaftsrubriken entdeckte. Wie sich das für einen treuen Hund gehört, wich TIMO auch dort seinem Frauchen nicht von der Seite: Hinter Ellens Name tauchte in Klammern und Anführungszeichen immer der von TIMO auf. “Bist du bald fertig?“ fragte ich Ellen, die vor dem Garderobenspiegel verschiedene Haarspangen ausprobierte.