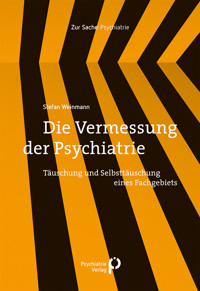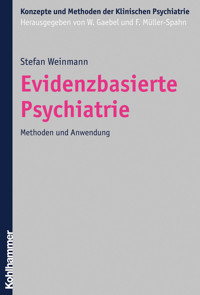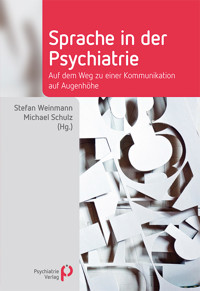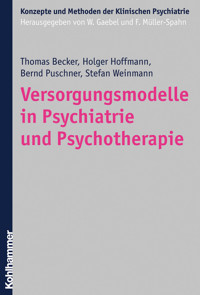Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Victor, ein junger Arzt, begibt sich auf die Reise, der von seinem Vater geschiedenen Mutter näherzukommen. Sie wurde während der Ehe psychisch krank, worauf der Vater ihn und seinen Bruder in eine neue Familie mitnahm und der Kontakt zu ihr abbrach. Das diffuse Bild seiner Mutter hatte sich nie aufgeklart. Durch die Nachkriegsjahrzehnte zieht sich ein Familientrauma, das wie Mehltau an ihr haftet. Aus einer von Victor rekonstruierten Entwicklung der Mutter in ihre Erkrankung hinein versucht er nun, seine eigene Entwicklung und sein Unbehagen zu rekonstruieren. Auch seine Reise auf einen anderen Kontinent macht ihm deutlich, was zerbrochen wird, wenn Menschen fallen gelassen werden. War sie an ihrem Schicksal schuld? War ihr Weg in die Krankheit unumgänglich? Alles bleibt im Unklaren. Aber auch die Sprache spiegelt das Verwirrende der Entwicklungen wider. Es gibt Entleihungen aus depressivem und paranoidem Denken, und greifbar ist kaum etwas. Verschiedene Schreibstile wechseln sich ab. Die Welt ist nicht kohärent. Auf der Suche nach Herkunft und Sinn lernt Victor ein wenig, wer er selbst ist. Das Eis zwischen Normalität und Wahn aber ist dünn, und auch sein Leben hätte ganz anders werden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Weinmann
Kreuzungen
Eine Spurensuche
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1 Gras - 1956-1958
2 Tage -1979
3 Weg - 1997
4 Arbeit – 1999-2002
Impressum neobooks
1 Gras - 1956-1958
Stefan Weinmann
Kreuzungen
Eine Spurensuche
Roman
Impressum
Stefan Weinmann
© 2016
I
In der Mulde stand sie, heilig, sanft. Man erkannte die Heiligkeit am goldenen Schein über der Stirn. Und dem Hellblau ihres Gewandes. Sie stand in der kleinen Nische, die der Urgroßvater in die wuchtige Steinwand gehauen hatte - genau über dem Haupteingang, jeden begrüßend und segnend, auch die Jungen aus Fellhausen, die klingelten und wegrannten, alle, die Gutes wollten und alle, die Böses im Schilde führten. Oben im Übergang zwischen Küche und Wohnzimmer, das auch das Esszimmer von Onkel und Tante war, auch hier berührte sie dich fast mit ihrem Zeige- und dem Mittelfinger. Und jedes Mal warst du ihr nah. Die Mutter Gottes war deine Freundin. Sie wusste alles. Und mit ihr teiltest du deine Geheimnisse, die sie in ihr großes Herz aufnahm. Ganz anders war es mit Jesus, der sich an den Kruzifixen quälte, und der wie ein unausgesprochener Vorwurf war, auch an dich. Du gingst ihm aus dem Weg. Auch bei Onkel und Tante gab es gekreuzigte Heilande, meistens aber kleine, und viel mehr Madonnen.
„Gebenedeit sei die Frucht Deines Leibes...“
Jeden Mittag am Wochenende versammelten sie sich in der Küche und dachten an den Tod und an die Frucht des Leibes. Und früher dachtest du, gebenedeit sei etwas Schlechtes, Peinliches und Unaussprechliches. Der Leib, ein eigenartiges, bedeutungsschweres altes Wort, und nur ein wenig heilig, mehr ein Bedürfnis; Körper war Bedürfnis, ein Wort, das man nur leise sagen durfte, weil das so Gemeinte einfach da war und nur schamvoll ausgehalten werden konnte, wie der dicke Bauch bei der Frau Gruber, die ihre Tochter immer aus dem Kindergarten holte, und die keinen Mann besaß. Denn manche Wörter waren nur für die Gedanken, nicht zum Sagen - und sie hielt sich dran, so wie sie sich an alles hielt, was die Erwachsenen in Schweigen hüllten. Und dennoch. Wenn Oma von den Unaussprechlichen sprach, die an der Leine wehten, war alles doch in Ordnung. Aus ihrem Mund war alles fast ein wenig heilig, sogar Wäsche. Manchmal auch bei Kindern, wie bei Falk. Der durfte pullern sagen. Falk kam aus dem Norden und war anders als all die Franks und Michaels und Wolfgangs. Theresas und Christines und Marias. Die Worte gaben die Erwachsenen vor - so wie die Namen ihrer Kinder bei Geburt - sie machten dir die Bilder in den Kopf. Und viele dieser Worte, welche andre zubereiteten, sie hinterließen dir Geschmack auf deiner Zunge, Geruch in deiner Nase. Wort und Ding, Vanille, Stuhl, gelb, Rauch, Schwamm, Holz, Ruß, Regen, Tabak, weiß, grün, Stern und heiße Suppe ließen sich nicht trennen. Eins waren auch die Räume mit allem, was geschah in ihnen. Kinderzimmer, Küche, Speiseraum, Esszimmer, Wohnzimmer, Küche – Bad. Der große Bastelraum im Kindergarten war dein Raum gewesen. Du warst so dankbar für den Kindergarten und auch für die Schule, auch wenn es dir zu viele Kinder waren, zu viel Bewegung, zu viel Chaos, zu viel des ineinander grell verschlungenen Lärms. Aber es waren deine Räume, denn nie kam Papa dich hier holen.
Er kam am Wochenende oft zu spät zum Essen und machte immer irgendwelche Sachen und Erledigungen, war lange im Verborgenen beschäftigt oder einfach weg, verschwunden. In Kellern, Schrebergärten, Werkstätten, Stammtischen, Höfen. Und dann nahm er am Esstisch schweigend Platz, und niemand fragte. Obwohl sie schon gebetet hatten. Dann aß er, ohne selbst zu beten. Vielleicht hatte er vorher gebetet…. Du aber warst stets pünktlich da, weil du es mochtest, bei Tante Lena in der Wohnung zu spielen, wenn sie kochte. Hier war alles leicht, die Zimmer waren heller als zuhause, man durfte überall hin. Vor allem gefiel dir die alte braune Nähmaschine mit dem großen Pedal. Hier war alles Gute aus der Vergangenheit herübergerettet worden und hatte den wertvollsten Platz im Haus bekommen. Tante Lena lebte gut mit der Vergangenheit zusammen und haderte nicht mit ihr wie Mama, Papa und die ewig Gestrigen im Dorf. Der Duft von Kohlrouladen, Klößen, Braten oder Rotkraut breitete sich langsam in den Zimmern aus, und Tante Lena war beim Kochen nicht verbannt in eine abgelegene Küche wie Mama zuhause. Man sah sie stets vergnügt durch die weit geöffnete Türe neben dem Speisezimmer die Geheimnisse ihrer Kochkunst feiern. Manchmal rief sie:
„Johanna, bist Du da? Sei so gut, hol mir den Nachtisch aus dem Keller ...“
Und auch der Keller war nicht dunkel, sondern voller kulinarischer Geheimnisse.
Alles war leicht. Und die einzige Schwere war das Gebenedeit-Gebet, das nie fehlte vor dem Essen, und niemand fehlte außer manchmal Papa.
„Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unsres Todes. Amen.“
Du wusstest, dass du Sünderin warst, aber du warst froh, dass du noch nie beten musstest, auch im Kindergarten durftest du nie aufsagen, obwohl du dies vielleicht sogar wolltest, man traute es dir einfach noch nicht zu, aufsagen durften nur die Jungen und die forschen Mädchen. Du warst kein lautes Mädchen.
Der Tod war jeden Tag anwesend im Gebet. Auch andere Familien im Dorf kanntest du, in denen der Tod mindestens einmal seine Macht ausgespielt hatte. Seine Macht ausspielen hieß nicht die Alten zu sich holen, die immer häufiger vom Tode sprachen, von Petrus und vom Sensenmann. Des Todes Macht ausspielen tat er an den Kindern und den Zwanzig- oder Dreißigjährigen. Wenn du so etwas hörtest, wie es einen mitten aus dem Leben riss, dann wanderte die Phantasie umher, je weniger davon gesprochen wurde, desto stärker. Und dann bekamst du doch nur häppchenweise Auskunft. Du fragtest kaum mehr. Dann landete die Phantasie auf einem klammen Bett zuhause oder in den riesigen Gewölben der Familiengräber, zu denen du mit Tante Lena manchmal durftest gießen helfen – im Alltag jener selbstverständlichen besuche auf dem Friedhof nach dem Marmeladekochen und dem Wohnungsputz. Und immer war auch Jesus da, wenn irgendwo gestorben wurde. Er war ein bisschen schuld, er war für uns gestorben, wie alle sagten, und hatte vielleicht für alle die zu früh Gestorbenen ein viel zu gutes Vorbild abgegeben. Zu früh gestorben war vor allem Falk, zwei Jahre, nachdem er hergezogen war, nach einem gemeinsamen Jahr im Kindergarten und einem in der Schule, Falk, der, dies hat man allen in der Klasse erzählt, von seinem Bruder auf dem Traktor überfahren worden war, mit diesen großen Reifen - nie konntest du verstehen, dass er nicht einfach laut genug gerufen, ja, geschrien hatte, du hattest immer wieder nachgedacht, sogar geträumt davon, wie denn ein Bruder seinen Bruder rückwärts mit dem Traktor überrollen konnte – ach, wäre es doch nur ein Bein gewesen, auf ein Bein konnte man verzichten, manchmal dachtest du, du hättest gerne auf ein Bein – vielleicht eher einen Arm, den linken – verzichtet, um Falk wieder lebendig zu machen. Dann hättet ihr beide eine Gliedmaße weniger und würdet euch dennoch freuen. So war der einzige vernünftige und ruhige Junge aus deiner Klasse, der kein Rabauke oder Hänsler war, von heute auf morgen verschwunden gewesen, und du wusstest noch nicht mal, ob es ihm weh getan hatte. Du wusstest nur, dass euer Lehrer, Herr Heinz, seitdem verändert war, gebeugt, ja fast gebrochen, vielleicht auch haderte er mit Jesus. Du wusstest auch, dass Falk bei seiner und bei deiner Mutter Gottes war, sie nahm ja in ihr großes Herz all die zu früh Gestorbenen auf und schenkte Trost…
Du warst kein lautes Mädchen, weil es dir nie in den Sinn kam, laut zu sein. Du bogst dich wie Schilfgras unter dem Wind, etwas anderes kanntest du nicht, und etwas anderes wurde von dir auch nicht erwartet. Für Wut, Trotz, Treppentrampeln und Türenschlagen war deine Schwester zuständig, und niemand machte ihr diese Auftritte streitig. Deine Rolle war es, gedämpft zu sein, geschmeidig und geräuschlos, du hattest eine nahezu Vollkommenheit entwickelt, Störungen vorauszuahnen und zu verhindern. Du warst für andre da.
II
Das neue Bad lag in einem separaten Anbau. Sie hatten es an mehreren Wochenenden hingeklebt, Stein für Stein. Die Männer, die den Zement gemischt und die Ziegelsteine herbeigeschleppt hatten, waren keine Maurer gewesen, und hatten besonders stark geschwitzt; sie waren Feldarbeit gewohnt, die Arbeitshosen grün, nicht blau, und lange Kaffeepausen mit belegten Broten. Das Bad war viel moderner als das Haus. Man musste durch die Eingangstüre und die Garderobe. Am Schuhregal vorbei. Vorbei am Ölbild eines bärtigen Opas, der Pfeife rauchend selbstgenügsam in den Vorraum blickte und die Welt an sich vorbeiziehen ließ. Vorbei an jenem Hutständer, dessen schwarze Arme, wenn sie unbeladen waren, gefährlich in den Eingangsraum hineinragten. Dann die zwei Treppenstufen, Stolpersteine, Grund für viele blaue Flecken. Der Fußabstreifer am Fuß der Türe, die ein milchig gelbes Glas einrahmte, das den Blick nicht frei gab, sondern nur zerstreute. Das Bad in blassen, gelben, grünen, braunen Tönen. Das Bad.
Sie waren den ganzen Tag draußen gewesen. Schule und Kindergarten waren geschlossen. Die Zeit war schon mit einer Woche Ferien angefüllt. Mama war beim Einkaufen, einer ihrer langen Touren über den Markt und die Höfe. Zuerst waren sie durch die Oleanderbüsche gelaufen, die über den Steinweg hingen, und die sie sachte vorbeischieben mussten, um sie nicht abzuknicken. Dann kam immer dieser süßlich leicht verwesende Geruch – nie wusste sie, woher er kam, von Pflanzen, von den Komposthäufen, den Schnecken, oder gar den Nachbarn, besonders wenn es vorher stark geregnet hatte. Sie sprangen über runde Trittsteine, aber diese waren im Abstand erwachsener Schritte gelegt worden, daher landeten sie oft in den Beeten, und an ihren Schuhen klebten große Brocken Erde, die erst mit der Zeit wieder abfielen. Johanna öffnete die hintere Gartentüre, und sie sprangen hindurch. Ihr Lieblingseck war die versteckte Laube, kaum einsehbar, mit dieser großen Schaukel, die die anderen „Hollywood“ nannten. Ihr Onkel und der dunkelhaarige Franz hatten sie herbeigeschafft, sie sah die beiden immer noch die Heerstraße entlang laufen, die große rote Schaukel mit dem riesigen überhängenden Dach, den Ketten, den gelben und türkisen Blumen schleppen wie ein Großtransport, die Leute blieben auf der Straße stehen, die Autos hielten, weil der Gehweg zu schmal gewesen war. Die Schaukel passte in die Ecke wie angegossen – nie sah sie ihren Vater schleppen, ihr Vater organisierte und kam wenn alle Arbeit getan war. Nie sah sie ihren Vater dort sitzen, auf der Schaukel saßen immer nur die Frauen und die Kinder, man saß dort, um zu stricken, um erdige Gelbe Rüben vom Grünzeug zu befreien, das den Stallhasen hingelegt wurde, um warmen Apfelkuchen zu essen, den die Tante im Korb mitbrachte für alle. Der Stoff war schon nach kurzer Zeit zunehmend angegrünt und glich sich diesem Garten an. Man spielte mit den Puppen auf der Schaukel, die nicht müde wurde, schwerfällig hin und her zu wippen und leise, nur ganz leise zu quietschen anfing seit dem letzten Sommer – erst später wurde es so laut, dass man das Schaukeln im Hause hören konnte.
Sie setzten sich beide und fuhren gleich wieder hoch, der Stoff war vollgesogen mit Regen von heute Nacht, und beide Kleidchen wurden nass am Po. Frieda sah auf ihre Uhr.
„Oh, vier Uhr schon. Ich müsste längst zuhause sein.“
Seitdem sie ihre Uhr bekommen hatte, war sie angespannter, und musste immer wieder darauf sehen, die Uhr hatte sie in eine Verantwortung katapultiert, jetzt musste sie um so und so zuhause sein, und dafür konnte sie gescholten werden, denn sie hatte ja eine Uhr, die ging. Johanna würde nie eine Uhr haben wollen, die so unbarmherzig Macht über ihren Tag hatte – und tatsächlich würde es lange dauern, bis man ihr eine kaufte, auch das traute man ihr noch nicht zu.
Frieda war aufgeregt.
„Papa kommt heute Abend schon nach Hause“, rief sie. „Wir müssen alle unsere Zimmer aufräumen und den Hof kehren. Bis morgen!“
Und lief durch das Gatter, verschwand hinter der alten Scheune. Johanna beschloss, die Hasen aus dem Stall zu holen und sie mit Löwenzahn zu füttern. Sie lief ins Haus, um den rostigen Schlüssel vom Stall in der Küche zu holen. Erschrak kurz, als sie Papa am Treppenaufgang sah mit dem Schraubenzieher und der Rohrzange in der Hand. Sie dachte, sie sei alleine zu Haus.
„Da bist Du ja.“
Papa sah sie nicht an. Der Hut auf seinem Kopf sah in der Wohnung seltsam aus, so fehl am Platz.
„Deine Mutter hat gesagt, Du sollst heute Nachmittag baden. Wir gehen heute Abend in die Kirche, nicht morgen. Ich lass das Wasser rein. Geh und hol ein frisches Kleid.“
Er ging zum Bad, nahm schwerfällig seinen Hut ab und setzte ihn auf den Hutständer. Sie zögerte nicht. Eine Antwort von ihr war nicht vorgesehen. Wie in Trance ging sie die Treppe zum Kinderzimmer (Marlene, wo war ihre Schwester Marlene?). Sie hatte nur zwei Kleider für die Kirche. Sie nahm das weiße, und weiße Unterwäsche.
Papa stand schon im Bad und ließ das Wasser in den Boiler laufen. Sein grünes Hemd zerknittert, die Knöpfe oben offen, der sorgsam gekämmte Scheitel über den Kotletten. Die braune Hose mit Farbspritzern. Er war Maler.
Er war zu sorgsam. Seife, Haarwaschmittel. Sogar das Handtuch hing schon auf der Stange. Dies war das Irritierendste. Das Bad ist für die Frauen.
Sie zog ihr nasses Kleid zögernd über den Kopf. Der Wasserkessel fing zu dampfen an, und Papa ließ das Wasser im Strahl in die gelbe Wanne. Sie suchte die kleinen Töpfchen, die sie immer nahm, um die Fontänen im Park zu imitieren, es waren fünf, und jedes hatte ein Tier auf der Seite, drei hatten ein Loch. Das Regal mit den Badespielsachen war leer, jemand hatte aufgeräumt, alles sah sauber aus, so dass sie auf der Seite suchte, die Töpfchen waren weg, sie suchte unterm Milchglasfenster und kreuzte seinen Blick, der auf sie gerichtet war wie ein Raubtier, gleich wollte sie wieder zur Seite sehen, da bemerkte sie, dass er nicht in ihre Augen blickte, sondern mit glasigem Blick ihren Körper betrachtete, wie ferngesteuert, sie hörte sein Atmen, die Luft, die schwer durch seine Nasenlöcher entwich. Sie zögerte, die Unterhose auszuziehen, bis sein Signal kam, das Wasser sei nun richtig. Er lief zur Türe und drehte den Schlüssel leise nach rechts, sie stieg in die Wanne und wusste, dass sein Blick ihr von hinten folgte, das Wasser war warm, ein wenig Schaum hatte sich auch gebildet, aber kein Spielzeug, nichts. Sie saß unbewegt, während er den Hocker holte, sich mechanisch neben die Wanne setzte und sie mit seiner rechten Hand, die fest, bestimmt und auch ein wenig zärtlich war, den Rücken, Bauch, die Beine einseifte, während sein Atem schneller ging, sie sah die ganze Zeit zum Milchglasfenster, sah die Fassung, die weiße Farbe, die schon anfing abzublättern, obwohl das Bad so neu war, und schemenhaft den Hut dahinter, den Papa zum Grüßen heute Abend in der Kirche abnehmen und den ganzen Gottesdienst in seiner Hand behalten würde. Seine große Hand fuhr fort, den Körper zu erkunden, und wieder fing sie an zu hoffen, dass er ihr weh tun möge, er tat es nicht, warum tat er es nicht?
Sie hörte, wie er den Reißverschluss seiner Hose mit der anderen Hand herunterzog, jetzt war ein unterdrücktes Stöhnen zu hören, nie würde sie dies sehen wollen, was sich auf dem Hocker neben ihr abspielte, nur im Augenwinkel war die Haltung ihres Vaters wie die der Bauern, wenn sie ihre Kühe molken. Sie dachte wieder daran, wie sie Hüte hasste, jeglicher Art. Ihre Gedanken wanderten zur Schaukel, sie beschuldigte die Uhr von Frieda, dass sie nicht dort saßen beide. Sie ging die Messe durch, die sie erleben würde später in der Kirche, sie wusste, dass sie Sünderin war, es war gut, dass es vor der Messe passierte, dann bat sie um Vergebung, dass sie sich zwischen ihre Eltern drängte, er hat doch Mama, aber wer ist er, sie wusste, dass es nicht der Vater war, der neben ihr keuchte, es konnte nicht derselbe sein, neben dem sie später die Kirchenbank teilen würde, den Hut auf dem Schoß, es war ein anderer, vollkommen anderer. Sie wusste nicht, dass dieser andere auch durch Gedanken irrte, Bilderfriedhöfe durchwatete, und beide litten, aber danach war es besser.
(Der Schock saß ihnen noch tief im Körper, die hinterlistigen Polacken hatten Knut am Arm getroffen, bevor sie alle eliminiert wurden. Knut war immer weißer geworden, sie hatten ihn im Lazarett diesseits zurücklassen müssen, weil sie rasch weiterzogen, um sich mit der Zweiten Einheit zu verbünden. Auch hier hatte er die Rolle des Technikers gespielt, hier, ohne Sanitäter, abbinden, desinfizieren, dann die Spritzen, sie hatten ihn alle machen lassen, so wortkarg er war, so effizient war sein überlegtes Handeln, während sonst Unruhe und sinnlose Bewegung aufkamen, wie auch sonst bei all den Hutmachern, Goldschmieden und Kontoristen, die sie in die Uniformen gesteckt hatten, er war der Besonnene und auf ihn konnte man sich verlassen, er konnte die Zelte so aufrichten, dass sie nicht wackelten, er kannte die Mechanik der Gewehre wie im Schlaf, er nähte Kleidung wie ein Schneider, war so geländekundig wie ein Gebirgsjäger, und er wusste wie man die Freischärler einkeilte und wie sie eliminiert werden konnten mit geringstem Verlust an Munition, diese slawischen Gesichter mit den abstehenden Ohren, warum wehrten sie sich alle und rotteten sich zusammen, er verstand es nicht, früher oder später war sie so oder so unser, die ganze Gegend, im Zweifelsfall Partisanen, sagt der Spieß - aber er selbst war nie dabei, wenn sie erschossen wurden, er plante die Gruben, berechnete den Sprengsatz für die Brücke, aber wenn es losging, war er schon weter. Niemand sah ihn um Knut trauern, überhaupt war es eher das Material, was ihn interessierte, er konnte sich stundenlang mit Eisen und Holz, Tuch und Blech, Nadel und Faden, und mit der Zündapp beschäftigen. Sie schafften es auf der Landesstrasse nach Janów, schlussendlich, und alles war so geordnet gelaufen, die Kameraden hatten gute Arbeit geleistet, die Stadt war besetzt und peinlich gut organisiert, sie wohnten wieder wie Menschen, aßen Fleisch und Kartoffeln, und nur ihn mussten sie überreden, ins Blaue Haus zu kommen, Junge, alles paletti, Schluss mir der Selbstzucht, genügend „Material“, mein Guter, kennst die Truppe doch, ausgesuchte Mädels, keine Jüdinnen, sauber, durchorganisiert und ohne Tripper, der Spieß lädt alle ein, durch die heilgebliebene Tür ins Blaue, Egon voran, der Helmut, der lange Ernst, dann Hans - du und nicht Ernst müsstest eigentlich „Ernst“ heißen, hatten sie mehrmals geflunkert - was guckste so bedebbert, haben wir doch verdient, vorbei an den zwinkernden Wachen, an der Dame des Hauses, auf die Polin zu, eine der Unsrigen, eilfertig und umsorgend auf sie zueilend, warm gestikulierend, die Alte mit dem roten Kopftuch und dem Blümchenkleid über den Schwimmringen, den ausgetretenen Stiefeln, „eingetreten, eingetreten, Freunde“, was für ein Geschäft läuft da ab, den Helmut komplimentiert sie zuerst hinauf, wo haben sie nur den roten Teppich aufgetrieben, der die Holztreppe rauf schleicht, das sieht er vom dunklen Gang aus, er darf im überdachten Innenhof Platz nehmen, sogar eine Pflanze hat sich hierher verirrt in einem mediterranen Kübel, links und rechts eine Mischung von eifrigen Verwaltungsgesichtern und wissenden (zufriedenen, wartenden?) Soldaten, man nickt sich wohlwollend zu, rechts der Weg zu den Örtlichkeiten, ein wenig schäbig und schuttig, das war wieder Polen, Staub und Polen, aber das Haus sonst tadellos, was verhandeln die da in gebrochenem Deutsch, er lässt die Blicke über die Stuckdecke schweifen, die kitschigen dorischen Säulen, sogar eine Büste in der Ecke, Schriftsteller, Feldherr?, die belebte, aber heimelige Atmosphäre missfällt ihm und zieht ihn gleichzeitig an, er würde gerne einen Tag hier verbringen, aber alleine, ohne dieses Wuseln, auch ohne Egon und Ernst, die zwar ausgelaugt und fahl, aber doch immer bereit waren, alles zu machen, und ihre Angst war nur abends in den Zelten drückend, wenn sie ihre Briefe lasen, und vor allem, wenn sie unter der Bettdecke keuchten, in gegenseitigem Wissen, und sich erleichterten, dann musste er sich abwenden in einer Mischung von Ekel und Verständnis -ja, alleine im Blauen Haus, ganz alleine, und jetzt?, jetzt zeigt man auf ihn, die Polin nähert sich mit ausgebreiteten Armen, „komm, komm, mein Frrreund, ich habe was ganz Besonderes für dich“, die Treppe hoch, eher geschubst als gestiegen, was soll er auch machen, ins grüne Zimmer bugsiert, dunkel, warum so dunkel, wo er auf einem Sessel Platz nimmt und wartet, minutenlang wartet, aber warten ist man gewohnt im Krieg, bis er das Rascheln in der Ecke vernimmt und die Kleine dort sitzen sieht mit dem Zopf, blond und dürr, das gestreifte Kleidchen mehr hängend als anliegend, ihm kaum zugewandt, nur im Profil die Wand vor sich fixierend, als sei diese Mauer ihre Welt, ihr Gebieter oder ihr Korsett, das sie aufrecht hält und vor dem Zerfließen bewahrt, neben dem verräterischen Bett mit dem schweren dunkelroten Leinen, dem Kissen und dem noch verräterischeren Handtuch am Fußende, er, erstaunt ob ihres Alters, dreizehn, höchstens vierzehn, und doch die Erregung fühlend, die sich seiner bemächtigt, er weiß, dass er nun die Macht über sie hat, er beobachtet sie, stumm, und mit jeder Sekunde steigt die Erregung, sie steht mechanisch auf, löst den kleinen Knopf am Rücken, streift das Kleidchen über den Kopf, ohne den Blick von der Wand zu nehmen, da steht sie hilflos, und er wundert sich, wie er sich an ihrer Hilflosigkeit weidet, wehrt sich und überlegt, was ist, wenn er dem Ganzen ein Ende bereitet, ihr bedeutet, das Kleid wieder anzuziehen, und sie eine halbe Stunde warten, aber sie spricht womöglich kein Deutsch, er zögert, aber seine Erregung steigt und überschwemmt seine Gedanken und wirft über Bord, was ihm anerzogen worden war, ihr Schulterblatt wie ein missglückter Flügel nicht in der Lage, seine Lust auf den Boden zu ziehen, er hört seinen Atem schwerer und schwerer gehen, als sie ihr Mieder öffnet und sie die Unterwäsche wie in Zeitlupe abstreift, auf der Bettkante völlig unbekleidet zu sitzen kommt, ihn erwartet, ohne ihn anzusehen, er langsam sich nähert, sein Hemd wie von Geisterhand öffnend, ohne ein Wort zu wechseln mit zitternden Händen über den scheuen Ansatz ihrer Brüste streicht, dann tiefer und tiefer bis zu ihren weißen Schenkeln, aussichtslos, sich der Erregung zu erwehren, nach all der Zeit ohne Frauenkörper, sie die Augen schließend, immer wieder der gleiche Gedanke, du bist in meiner Hand, in meiner Hand, auch sie ohne Zeichen des Widerstands, alles gewährend, so dass er denkt, wie gut, dass er es war und keiner der Kameraden, er wird sie schützen und nicht zum Äußersten gehen, er wird sie nur mit seinen entbehrungsvollen Händen streicheln und den Strom gewähren lassen, der ihn erfüllt, das Nein in seinem Hirn für ein paar Momente besiegend, diesen Kampf erleidend und gleichzeitig genießend, am Ende ihr Blick, fast dankbar, fragend, als er ihr in das Kleidchen hilft. Dann der Abscheu vor sich und das aufrichtige Nie Wieder seiner Gedanken, das der aufkeimenden Erregung nicht stand halten wird, und dann doch immer wieder bei ihr und später im Wehrmachtsbordell an der Grenze, diesmal ist er es, der die Jüngste aussucht, und auch später immer wieder die gleichen Gedanken an die weiße unschuldige Haut, Bilder, die nur ihm gehören, die er nie teilen würde, nie, so wie die Kämpfe, die er nie offenbaren würde, bis jetzt, und auch nie hatte ihn jemand danach gefragt. Danach war es immer besser. Auch wenn ein Gefühl von Schwere und Trauer zurückblieb.)
III
„Pass auf die Hauptstraße auf, ja? Und nicht aufs Eis“, hatte die Mutter gesagt. Sie warnte immer, sah immer irgendwo Gefahren, wo keine waren. Dieses besorgte Sich-Kümmern war ihre Rolle, wo immer sie auch waren, glitt sie in ihre Rolle der Vertreiberin böser Einflüsse auf die Mädchen, auch wenn es zum Selbstzweck geworden war. Man kannte sie nicht anders. Jedes Jahr ein Stirnfältchen mehr an karger peinsamer Beunruhigung, der die Mutter mit Beschwörung und mit Ordnung beizukommen wusste. Auf ihre Ängstlichkeit war Verlass, ihre Sorgen begleiteten Johanna überall hin, außer zu Tante Lena, diese war das Gegenteil ihrer ängstlichen Mutter, bei Tante Lena war alles leicht. Die Mutter strich Johannas Mantel glatt, zog ihr die Mütze fest ins Gesicht. Winter, herrlich klarer Winter. Sonne.
Ihr Herz hüpfte vor Freude, weil sie endlich, endlich Cäsar ausführen durfte, ganz alleine; Cäsar, den Cocker-Spaniel aus der Wirtsfamilie. Sie kannte ihn schon mehr als zwei Jahre, ihr Schulweg führte bei den Wirtsleuten vorbei, dann kam er immer ans Tor und wedelte unablässig mit dem Schwanz, wenn sie ihn streichelte, und wenn sie mal Essen gingen am Sonntag im Wirtshaus, selten genug, denn Papa aß ungern außer Haus mit allen, vielleicht, weil es zu teuer war, dann stahl sie sich nach dem Hauptgang in den Hof und tollte mit Cäsar herum, der schon, wenn sie kamen, um ihre Füße schwänzelte und nur den Moment abwartete, bis die Gedecke abgetragen wurden. Jetzt war es soweit gewesen, sie hatte ihrer Mutter lange in den Ohren gelegen, und die Wirtsfrau hatte es mehrmals gesagt und irgendwann ihre Mutter überzeugt, sie würde doch so gerne mit Cäsar raus, wie gewissenhaft Johanna doch war, sie könne es ja mit einem Besuch beim Kirchladen verbinden, da ginge sie ja auch schon alleine hin, und die Wirtsfrau hatte Johanna kaum merklich zugezwinkert, und das machte sie stolz, wenigstens eine, die ihr vertraute, neben Tante Lena.
Jetzt lief sie los, mit dem kleinen Korb ihrer Mutter ausgestattet und dem Einkaufszettel, sprang bis zur Straße und, nach dreimaligem Links- und Rechts-Schauen, kein Auto in Sicht, flugs über die Stelle, wo werktags die Traktoren und Landmaschinen in die Webergasse einbogen und sich zu den Feldern aufmachten, querte den Burgweg, der zu keiner Burg mehr führte, nur noch Ruinen, und eilte die lange kurvige Furt, vorbei am Friedhof, hinauf zum Wirtshaus Löwen.
Cäsar stand schon auf der Treppe, als ob er auf sie gewartet hätte, goldbraun, mit langen, fast bis zum Boden reichenden Ohren, der hechelnden hellrosa Zunge, tiefen nach unten hängenden Hautfalten am Auge, die dem kaum drei Jahre alten Spaniel etwas Welterfahrenes gaben, wie er so da stand und ihr Kommen verfolgte, gleich würde er losspringen, sein Kopf sah fast aus wie der ihrer Schwester, wenn deren sorgsam in stundenlangem Ritual gewaschene Haare langsam an der Luft trockneten und sich über ihren Schultern rollten – Cäsar, mein lieber Cäsar!
Sie schloss leise das Tor, und er wedelte ihr entgegen, sie kämmte mir ihren kleinen Fingern durch seine Mähne, nahm sein Ohren, kraulte den Hals, und er hielt still wie ein Buddha, und nur der unruhige Schwanz zeigte seine Freude. Jetzt sah sie die Wirtsfrau an der Haustüre, die den Handrücken gekonnt an der weiß-blauen Schürze abwischte und Johannas Treiben mit dem Hund wohlwollend verfolgte, innehaltend, aus offensichtlich schwerer Arbeit aufgetaucht.
„Johanna, mein Engel“, was das Bild von Gabriel in ihr hervorrief, der über dem lustig tollenden Hund daher flog im Flügelmantel und mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger die Geschicke des Spaniels leitete, dass ihm nichts Böses mög‘ geschehen in der Welt der tausend Gefahren.
„Johanna, mein Schatz, du bist ja pünktlich wie ein Maurer! Siehst du, wie Cäsar auf dich gewartet hat?“
Sie ließ sich den Weg erklären, bekam die Leine mit, ein wenig Geld für den Laden („nur für dich“), die warme Hand der Wirtsfrau an ihrer Wange, dann lief sie mit Cäsar los, stolz und bedächtig, denn alle sollten sehen, wie sie es richtig machte, hinaus an die Ulmen, den Feldweg entlang, durch den knirschenden Schnee und hinüber zum Weiher.
„Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Ist so kalt der Winter…“, ging es ihr durch den Kopf, als sie alles so machte wie mit Christine, die sie letzte Woche mit Cäsar begleiten durfte - alles genauso wie damals, der glasklare Himmel, einzelne Schneefetzen, die lange, einsame Allee entlang, sie nahm die gleiche Abkürzung über die Steinbrücke, warf die gleichen Hölzchen wie damals, beschwor die gleiche Weihnachtsstimmung herauf, und Cäsar sprang genauso voran und zurück, und das war so wunderbar, alles gleich und immer gleich zu machen, sie war eine Meisterin der Wiederholung, und das gab ihr das unveräußerliche Gefühl, an der richtigen Stelle in dieser Welt zu sein, so dass alles in Ordnung war, friedvoll und gut. Sie liebte die alten Weihnachtslieder und fing ganz langsam an, sie leise zu singen, soweit sie die Strophen konnte, und ihr Begleiter tollte bis in die weißgewordenen Äcker hinein und brachte ihr Stock für Stock zurück, wie damals.
Jetzt kam der Weiher, noch eine Steigung, dann sah sie die Weiden am zugefrorenen See in die Höhe ragen, den verlassenen Bootssteg mit nackten Beinen aus dem Eis ragend, einzelnes Gras im See verewigt, wie wenn der Winter zu schnell gekommen wäre. Aber dort, die dunklen Punkte unten am anderen Ende des Sees, die sich kreuzten und hin und her schwangen, was war das? Sie verfolgte die Bewegungen, bis sie sich sicher war, dass es Schlittschuhläufer sein mussten, sie kamen ihr entgegen, übermütig und kühn, jetzt hörte sie das Kratzen der Kufen, es waren die Jungs aus Fellhausen, allen voran der Günther mit weißer Pudelmütze, dann die zwei Freunde, und nun bemerkte sie, wie er ihr zuwinkte, Günther hob die Hand und winkte ihr auffordernd zu, sie freute sich, winkte zurück, dann fiel ihr Cäsar ein, den sie herbeirief und vorsichtshalber anleinte, erst wollte er nicht, spielte mit ihr, so dass sie ihn mehrmals rief, bis er kam, dann plötzlich klirrte es und ihr Herz blieb stehen, als sie nur zwei von den Jungs noch sah, die scharf zu bremsen versuchten, sich langsam zu dem Loch zurückwagten, plötzlich ganz linkisch auf dem See staksten. Dann hörte sie die Rufe, „Günther, Günther“, nein es durfte nicht sein, sie rannte zum Ufer, die Jungs hatten sich auf das Eis gelegt, schoben sich langsam nach vorn, es war zu weit im See, nichts von Günther zu sehen, sie kam noch näher, die warnenden Worte der Mutter im Ohr, nicht aufs Eis, nicht aus Eis, er hatte ihr doch gerade noch zugewinkt, was sollte sie machen, sie zog Cäsar zu sich, die Rufe auf dem See wurden schriller, erschütternder, das Loch blieb schwarz, aber nichts kam hervor, einer der Jungs schlitterte wie verrückt auf sie zu, „lauf schnell ins Dorf, hol‘ Hilfe, schnell, schnell“, aber sie blieb wie angewurzelt stehen, gleich würde sie losrennen, aber der Junge kippte schon ans Ufer und zog sich in Todeshast seine Schuhe aus, rannte den Feldweg hoch in Socken und rannte und rannte, Cäsar bellte auf den See hinaus, sie hielt ihn fest mit aller Kraft, der andere Junge rutschte von einem Fleck zum anderen, rief immer wieder mit heiser werdender Stimme Günthers Namen, sie stand wie erstarrt am Ufer, zog an Cäsars Leine, immer wieder der Name dessen, der ihr eben noch fröhlich zugewinkt hatte, weg, verschluckt vom tiefen See, die Wintersonne war noch die gleiche, das Bellen hallte ins Nichts, sie stand und stand, hilflos, und plötzlich fror sie, wie wenn sie selbst auf dem Grund des Sees stehen würde, er hatte sie doch gegrüßt, gewinkt, war es das Winken gewesen, da ihn straucheln ließ, war sie die Schuldige?, so stand sie und stand, und irgendwann kamen die Autos mit den langen Leitern, und alle riefen durcheinander, immer mehr kamen herbei, und sie bildeten Ketten, und irgendwann, sie hatten sie schon nach hinten geschubst, ihr bedeutet, wegzuschauen, nach Hause zu gehen, irgendwann sah sie, wie sie den schwarzen leblosen Körper übers Eis zogen, ohne Mütze, bis er im Tumult verschwand, und alle nur noch murmelten. Sie wusste nicht, wie sie nach Hause gekommen war, einer der Männer hatte sie fest am Arm gepackt, in das Forstauto gesetzt, Cäsar auf ihrem Schoß, schweigend die Feldwege entlang gefahren, armer Cäsar, sie würde ihn nie wieder alleine ausführen dürfen, nie wieder alleine mit ihm durch den glöckchenklingenden Wintertag laufen. Er hatte ihr doch gewunken.
IV
Die Mutter band sich immer eine grüne Schürze um, eine von zweien, die sie trug, wenn sie in der Küche arbeitete. Und das war jeden Tag. Und so war auch Johanna, wenn sie nicht bei Tante Lena war, fast jeden Tag in der Küche, mit den großen Töpfen, den Einmachgläsern, den Sirupflaschen, den Schüsseln..... denn die Küche war für die Frauen. Papa und Friedrich lugten höchstens durch die Türe, obwohl doch ihr Bruder gerne Leute um sich hatte, vor allem Johanna, und wenn Johanna mit der Mutter in der Küche arbeitete und niemand sonst da war, dann kam er an die Türe und fragte, was es gab und erzählte von der Schule, aber fast immer blieb er an der Schwelle stehen, und das war es, was Johanna Freude bereitete, mit beiden Händen im Semmelknödelteig zu stecken, die Mutter neben sich und ihr Bruder an der Türe sich am Entstehen seines Leibgerichts erfreuend und von den Begebenheiten des Unterrichts plaudernd, der Klasse, die dem alten Dorfschullehrer immer wieder Streiche spielte, auf die Johanna in ihrer kühnsten Phantasie nie gekommen wäre. Die Mutter tat fast immer, als sei sie entrüstet, aber mit der Zeit wusste Johanna, dass es nicht stimmte, sondern dass sie ihren Sohn, den einzigen, abgöttisch liebte und alles, was er tat, letztendlich guthieß.
Wenn dann Vater kam, zog sich Friedrich ins Wohnzimmer zurück, und dann war alles zu Ende, denn alleine mit der Mutter, an der sie neulich, als sie die selbst gemachte Marmelade kostete, entdeckte, dass sie einen kleinen Damenbart entwickelt hatte - alleine mit der Mutter ging es träge und stumm zu, man arbeitete vor sich hin… Und dann war es ein klammer, gedrückter Kampf gegen die Materialien, die Stimmung des gegen-Widerstände-Arbeitens, welche die Mutter verbreitete – die Anspannung, dass das Essen geriet, dass die Küche nicht zu schmutzig wurde, vielleicht auch spielten andere Gedanken hinein, vom Geld, das immer knapp war, vom großen Garten, dessen Pflege Zeit und Mühen kostete, von den Sorgen über die Entwicklung der Kinder…
Johanna hatte, bis das mit dem Bad begann, noch nie darüber nachgedacht, wie ihre Eltern zueinander standen, was hinter den Gesprächen steckte, wie sie sich ansahen, immer nur hatte es den Blick ihres Vaters und den Blick ihrer Mutter gegeben, aber nie ein Sich-Treffen ihrer Blicke, sie waren ihre Eltern, zweifellos, die Mutter mit den Ängsten und dem Damenbart, der arbeitende, mürrische mit seinem Dasein im Wohnzimmer Schwere verbreitende Vater – oder waren es auch seine Sorgen, die sich so offenbarten - es gab verschiedene Väter für sie, ja, dieser Mann war mehr als einer, und sie spürte, dass all diese Väter das Leben der Familie fest im Griff hatten.
Sie durfte in ihr Zimmer, das Ritual des Vorkochens für den Sonntag war beendet, die Küche dampfte noch. Sie wusste, dass ihr Vater im Wohnzimmer saß und Fußball schaute; doch was war mit Friedrich? Der Vater, der die ausgetretenen Hausschuhe abgestreift und seine Beine auf den weichen braunen Sessel abgelegt haben mochte, in unangenehm gezwungener Weise und ernst dem Verlauf des Spieles folgend, keine Kommentare außer derjenigen des Sprechers tolerierend, das war es wohl, was Friedrich aus dem Zimmer trieb. Sie dachte, wer von beiden war es wohl, der immer genau das Gegenteil vom anderen wollte und machte. Sie stießen sich ab wie zwei Magnete, und das war es, was in ihr haften blieb, Männer haben ihr Revier, sie vertragen sich, aber nur, weil sie sich zurückhalten, und nicht, weil es ihre Natur ist, dafür brauchen sie die Frauen, damit sie ohne Katastrophen zusammenwohnen können, weil sie nun einmal verwandt sind. Verwandtschaft ist kein Vorteil, nicht einmal ein Schutz. Was würde sie an Friedrichs Stelle machen? Und wo war er jetzt? Sie hatte das Knarren der Treppe nicht gehört, er war nicht in sein Zimmer gegangen.
„Friedrich“, hörte sie durch den Türspalt – sie war gehalten, die Türe des Zimmers, das sie mit ihrer Schwester teilte, immer offen zu lassen, wenn sie alleine dort war, „Friedrich, hilfst Du mir einkaufen, ich werd’ eine schwere Tasche haben?“
Ihre Mutter rettete ihn wieder aus der Gesellschaft des Vaters, und sie wusste, dass ihm selbst das Einkaufen lieber war als mit dem Vater Fußball zu schauen.
„Ich komme“, hörte sie seine ein wenig zu freudige, zu künstlich gut gelaunte Stimme, als habe er darauf gewartet. Dann Rascheln, Murmeln, Gerede, und dann fiel die Türe ins Schloss, und es war Ruhe, aber die Stille war klamm und schwerfällig.
Aus dem Wohnzimmer hörte sie gedämpft die Verlorenheit des Samstagnachmittags mit dem unermüdlichen Sportkommentator, immer wieder Pfiffe, noch schien kein Tor gefallen zu sein. Alles war unangenehm deutlich, und durch die Milchscheibe der Wohnzimmertüre schimmerte das bläuliche bewegte Licht des Fernsehers. Ihr Vater war nicht zu hören. Er würde wohl in dem großen braunen Ohrensessel sitzen, der nur ihm vorbehalten war, das Spiel halb gelangweilt, halb in Gedanken verfolgend, anderswo weilend. Er würde gelegentlich von dem nicht mehr so kalten Glas Bier eine Schaumkrone nehmen und kaum hörbar schlucken, und der Schaum würde in seinem Oberlippenbart hängen bleiben. Dann würde er den Fernseher leiser stellen, nicht ausmachen, nur drosseln, und langsam erst den rechten, dann den linken Fuß vom Sitzkissen nehmen und mit einer schweren Bewegung aufstehen und zur Türe laufen. Er würde die Türe langsam öffnen, mit gesenktem Kopf, nachdenklich in den Flur laufen und nach einem kurzen Blick in die leere, leergewordene Küche, ins Treppenhaus nach oben rufen, Johanna, ins Treppenhaus, durch das sie sich in die wunderbar einsame Langeweile des Samstagnachmittags hatte hinauf stehlen wollen - sein Herbeirufen, ohne irgendwelche Färbung der Stimme, ohne irgendetwas hineinzulegen, woran man ein Gefühl erkennen könnte, Johanna, Deine Mutter hat gesagt, Du sollst noch baden, komm jetzt herunter ins Bad, so dass sie kurz oder auch länger innehalten würde, den Atem anhalten, bis er erneut, lauter, aber immer noch gefühllos wieder ihren Namen rief, und dann ein drittes Mal, und sie wusste, dass er ihre Anwesenheit spürte, wie ein Hund, der Menschen roch unter Geröll oder unter einer Lawine. Dann würde sie wie ferngesteuert langsam die Treppe heruntertapsen, ohne ihn anzusehen, ohne ihn auch nur um eine Minute zu bitten für ein gedankenloses Sich-Verlieren im späten Nachmittag des verlassenen Kinderzimmers.