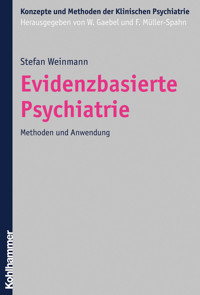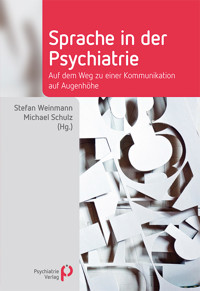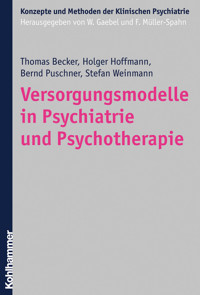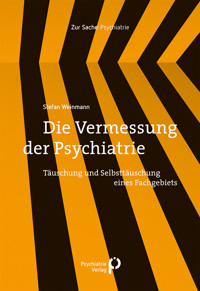
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychiatrie Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie sieht es aus mit der sogenannten »Evidenz« zu den Ursachen von Depression und Schizophrenie? Wie mit der Wirksamkeit von Medikamenten und Psychotherapien? Welche Bedeutungen haben Vorurteile, Verzerrungen und sich selbst erfüllende Voraussagen in der psychiatrischen Behandlung und Forschung? Und wieso helfen viele gut erforschte Ansätze so häufig nicht? Wenn man die gegenwärtige Psychiatrie verstehen will, muss man verstehen, was in den Köpfen von Psychiater*innen vor sich geht, sagt Weinmann und plädiert dafür, dass sich die Psychiatrie mehr den sozialen und auch den gesellschaftlichen Bedingungsfaktoren stellt. Mit diesem Buch liefert er einen kritischen und hochspannenden Beitrag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Weinmann
Die Vermessung der Psychiatrie
Täuschung und Selbsttäuschung eines Fachgebiets
Zur Sache: Psychiatrie
Stefan Weinmann ist Psychiater und Psychotherapeut mit Abschlüssen in den Gesundheits- und Wirtschaftswissenschaften. Er hat zur psychiatrischen Versorgung geforscht und mehrjährige Erfahrung in Gesundheitssystemen anderer Länder. Derzeit arbeitet er als Psychiater in Berlin.
Stefan Weinmann
Die Vermessung der Psychiatrie
Täuschung und Selbsttäuschung eines Fachgebiets
Zur Sache: Psychiatrie
1. Auflage 2019
ISBN Print 978-3-88414-931-7
ISBN PDF 978-3-88414-941-6
ISBN ePub 978-3-88414-949-2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Psychiatrie Verlag, Köln 2019
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne Zustimmung des Verlags vervielfältigt, digitalisiert oder verbreitet werden.
Umschlagkonzeption und -gestaltung: studio goe, Düsseldorf
Lektorat: Uwe Britten, Eisenach
Typografiekonzeption und Satz: Iga Bielejec, Nierstein
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
Cover
Titel
Über den Autor
Impressum
Denkmuster und Vor-Urteile – Einleitung
Vom therapeutischen Fach zur Selbstdiagnose
Methodik des Suchens
Erfolge in der Psychiatrie?
Moderne Psychiatrie?
Selbstkritik als Weg aus dem professionellen Dilemma
»Wir« und »sie«: Schemata in der Psychiatrie
Gehirnerkrankungen: Folgen des Biologismus in der Psychiatrie
Das gängige Paradigma
Neuroimaging?
Befunde der Bildgebung bei der Schizophrenie?
Das Bild vom Hirn – Fragen über Fragen
Die schöne Welt der akademischen Psychiatrie
Biologismus: die Schizophrenie als neuropsychiatrische Erkrankung
»Vor-Urteile« und darauf aufbauende Therapien
Psychoedukation
Zweifel am psychiatrischen Paradigma
Erkenntnismethoden in der Psychiatrie
Täuschung und Selbsttäuschung bei der medikamentösen Behandlung
Gute und schlechte Drogen
Die klinische Bedeutung von Psychopharmaka
Konditionierung zur Medikamentengabe
Die Dopaminhypothese der Schizophrenie
Zur »Wirksamkeit« von Antipsychotika
Eine weggetäuschte »Nebenwirkung«: Verringerung der Hirnmasse durch Antipsychotika
Antipsychotika: die Problematik der sich selbst erfüllenden Prophezeiung
Bipolare Störung und Antipsychotika – eine problematische Verbindung
Zur Erholung von Psychosen ohne Antipsychotika – erste vorsichtige Studien
Die Zunahme der Depression in der Moderne
Die Vermarktung der Depression
Wirkung von Antidepressiva
Konsequenzen aus der Antidepressiva-Ernüchterung
Warum ein Paradigmenwechsel in der Psychiatrie Medikamente miteinbeziehen muss
Ist Psychiatrie eine Wissenschaft?
Jump-to-Conclusions-Bias bei Patienten und Psychiatern
Geschichtliches zum Wunschdenken in Psychiatrie und Psychotherapie
Ist die Psychiatrie eine Wissenschaft?
Evidenzbasierte Psychiatrie – die Lösung?
Psychiatrie und Chronifizierung schwerer psychischer Störungen
Gemeindepsychiatrie – die Zielgruppe
Menschen mit »schweren« psychischen Störungen
Psychiatrische »Einrichtungen« in der »Gemeinde«
Rehabilitation
Fortschrittsparadigmen in der Gemeindepsychiatrie
Das Ideal der Gemeindepsychiatrie
»Erziehung« zum psychisch Kranken
Motivation
Verantwortung und Chronifizierung
Die Public-Health-Perspektive
Wege aus der Bevormundung
Zwang und Verantwortung in der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen
Die Home-Treatment-Revolution
Psychosoziale Determinanten psychischer Erkrankungen
Warum die Beschäftigung mit dem Sozialen?
Soziale Determinanten – was ist damit gemeint?
Soziale Determinanten – wie trifft uns Ungleichheit psychisch?
Das biopsychosoziale Erbe des Menschen
Warum auf soziale Determinanten achten?
Depression als psychosoziale Erkrankung
Psychose als psychosoziale Erkrankung
Psychologische und biologische Mechanismen der Psychose-Entwicklung
Ansätze und Argumente für die Verringerung von Ungleichheit
»Global Mental Health« – die Beglückung der Welt mit westlicher Psychiatrie
Was ist »Global Mental Health?«
Herausforderungen für Global Mental Health
Internationale Politik und Global Mental Health
Alternativen zum traditionellen medizinischen Modell
Die westliche Psychiatrie – ein Exportprodukt?
Gegen die Selbsttäuschungen des Fachgebiets
Schärfung des Blicks auf uns psychiatrisch Tätige
Überwindung dysfunktionaler Handlungsprinzipien Paradigmenwechsel –
Vorschläge zur Weiterentwicklung der Psychiatrie
Transformation der Psychiatrie durch Erfahrungsexperten
Die Psychiatrie vom Sozialen aus neu denken
Traumasensible Psychiatrie
Hinweis zum Buch
Danksagung
Literatur
Weitere Informationen
Denkmuster und Vor-Urteile – Einleitung
Ein Betrunkener kniet längere Zeit suchend auf dem Boden neben einer Straßenlaterne. Kommt ein Passant vorbei und fragt: »Suchen Sie etwas?« – »Ja, ich habe meinen Schlüssel verloren!« Der Passant hilft dem Betrunkenen suchen, doch sie finden den Schlüssel nicht. Nach einer Stunde fragt der Passant: »Sind Sie sich sicher, dass Sie den Schlüssel hier verloren haben?« Der Betrunkene antwortet ihm: »Nein, ich habe ihn wohl irgendwo dahinten verloren, aber hier gibt es einfach mehr Licht!«
Vom therapeutischen Fach zur Selbstdiagnose
Täuschung und Selbsttäuschung prägen die Menschheit seit Jahrtausenden. Beide regeln, erschweren aber auch unser Zusammenleben. Ganze Industrien leben heutzutage von (absichtlicher) Täuschung und (weniger bewusster) Selbsttäuschung. Nicht nur die immer bedeutsamer werdende Welt des Marketings, die uns dazu bewegen möchte, Geld auszugeben, indem Wünsche generiert werden, oder Teile der Politik, in der der Eindruck hervorgerufen wird, dass sich Menschen oder Parteien für unsere Belange einsetzen, aber im Grunde Macht anstreben – auch die Medizin, die Forschung und viele andere Bereiche sind voller Täuschungen. Ohne dass Menschen andere über ihre wahren Absichten täuschen, wären viele Leistungen heute oder zu früheren Zeiten nicht möglich. Ohne dass Menschen Illusionen pflegen und weitergeben, wären viele Lebenssituationen schwerer zu ertragen, würden viele von uns resignieren, oder gäbe es weniger Fortschritt im herkömmlichen Sinne.
Vielleicht gibt es aber doch etwas, was heutzutage anders ist als »früher«: Wir kennen die Mechanismen der Täuschung immer besser, da sie auch dem wissenschaftlichen Blick unterworfen wurden. Wir wissen mehr von den sozialen, psychologischen, biologischen und biochemischen Prozessen hinter der Täuschung. Dies bedeutet aber nicht, dass wir uns weniger täuschen lassen. Im Gegenteil: Mittlerweile ist eine Menge interessanter sozialpsychologischer und evolutionsbiologischer Befunde aus den Maschinenräumen der Täuschungs- und Selbsttäuschungsfabriken bei Menschen und Tieren publiziert worden. Täuschung ist in der Natur und unter uns Menschen allgegenwärtig und zuweilen sogar notwendig, weil sie mit einem Überlebensvorteil für uns (oder für einen Teil von uns) verbunden war (siehe Trivers 2011).
Technik und Wissenschaft erweitern aber nicht nur den Kenntnisstand, sondern auch die Täuschungsmöglichkeiten. Die Sprache als Mittel, Entferntes und Nicht-Gegenständliches, Symbolisches und Erdachtes sichtbar und kommunizierbar zu machen, hat unser Arsenal an Täuschungsmethoden im Vergleich zu unseren weniger sprachgewandten Vorfahren schon deutlich erweitert. Die kulturelle Entwicklung des Menschen, die Industrialisierung und zuletzt die digitale Revolution tun das Ihrige. Filme und Computerspiele sind so wirklichkeitsnah geworden, dass die Gefühle und die Gedanken ähnlich strömen wie in der konkreten sozialen Realität. Wie sehr wir von Bildern, Videos und Werbung gesteuert werden, kann kaum überschätzt werden. Formal demokratische Wahlen können damit gewonnen werden, dass Gerüchte in (sozialen) Medien verbreitet, Falschmeldungen clever platziert oder Werbung und Hinweise selektiv an Menschen gesendet werden, deren digitale Spuren auf bewusste oder unbewusste Einstellungen und Vorurteile hinweisen. Die basalen Mechanismen aber, und das, was der Mensch mit seinen vielfältigen Arten der Täuschung und Selbsttäuschung erreicht, sind dieselben wie in früheren Zeiten.
Während die Täuschung ihrer Sache nach entweder (1) als bewusster Betrug (Vorspiegelung falscher Tatsachen), als Desinformation und als Behauptung einer Lüge, die beim Getäuschten einen Irrtum auslöst, geläufig ist und damit intentional als Manipulation gilt, oder aber (2) als verzerrte Wahrnehmung unbeabsichtigt zu einem Irrtum führend gut nachvollzogen werden kann, ist die Selbsttäuschung schon schwerer zu fassen. Widersprüchlich ist die Selbsttäuschung, weil Täuschender und Getäuschter ein und dieselbe Person sind und weil eine Absicht, sich selbst vorsätzlich zu betrügen, schwer vorstellbar ist. Wenn ich lüge, kenne ich als Lügner die Wahrheit, die ich anderen verberge. Muss ich aber, wenn ich mich selbst belüge, wissen, was ich verberge?
Die Psychoanalyse hat schon länger Theorien entwickelt, wie Selbsttäuschung möglich ist, und bringt das Unterbewusste ins Spiel:
»Wir haben ernst zu nehmen, dass Selbsttäuschung durch unbewusste Wünsche und nicht-intendierte Verzerrungen unserer Meinungen bedingt sein kann. Selbsttäuschung kann einem wishful thinking entstammen und in einer honest lie resultieren (die sich von der bewussten Lüge unterscheidet und moralisch wie rechtlich anders beurteilt wird als diese). Selbst wenn jemand gegen seine proklamierten Überzeugungen und Präferenzen redet und handelt, agiert er nicht notwendig gegen seine wirklichen Überzeugungen und tragenden Handlungen« (ANGEHRN 2017, S. 37).
Die Selbsttäuschung wird daher in der Psychotherapie als Verdeckung unangenehmer Sachverhalte begriffen, die letztlich seelischen Schmerz vermeiden soll.
Die Evolutionsbiologie bringt eine differenzierte Perspektive ein: Täuschung verschafft uns in bestimmten Situationen einen Überlebensvorteil – ebenso die Selbsttäuschung. Beide sind dem Menschen inhärent und als psychologischer Mechanismus durch Überlebens- und Reproduktionserfordernisse erklärbar. Selbsttäuschung wird als besonders wirksame Form der Täuschung angesehen (TRIVERS 2011). Damit Täuschungen glaubwürdig sind, nicht zu Verunsicherungen beim Täuschenden selbst führen und damit rasch durchschaut würden, hat die Natur in der Evolution des Menschen eine besondere Strategie entwickelt: die Selbsttäuschung. Eine Selbsttäuschung ist demnach ein unbewusst ablaufender Prozess, der bewirkt, dass der Manipulator von dem, was er vermittelt oder verkündet, den Signalen, die er gibt, den Dingen, die er tut, um andere zu beeinflussen und zu manipulieren, selbst vollkommen überzeugt ist. Wer sich selbst täuscht, hält sich für rational, verhält sich jedoch irrational (DIETZ 2017, S. 224). Die selektive Wahrnehmung blendet die Unwahrheit des Täuschungsinhalts aus dem Bewusstsein des Täuschenden aus. Damit wird vermieden, dass der Täuschende wie bei einer bewussten Lüge oder Manipulation durch sein Auftreten, sein Verhalten und seine körperlichen Reaktionen die entscheidenden Hinweise gibt, die ihn als Lügner entlarven könnten: Nervosität, Aggressivität oder überkompensierte Beschwichtigung (LIBET 2004).
Das Gehirn arbeitet am effizientesten, wenn es sich seiner Widersprüche nicht bewusst ist. Am erfolgreichsten sind diejenigen Manipulatoren, die von ihrer Überlegenheit oder der Wahrheit ihrer Behauptung felsenfest überzeugt sind. Denn bei einer Täuschung sind im Gehirn zwei Wahrheiten gespeichert: die echte und die falsche (oder fantasierte bzw. erwünschte). Wie wir Gedanken und Erinnerungen (die »Evidenz«), die uns verunsichern könnten, ausblenden und ins Unterbewusste verschieben, um der falschen Wahrheit Raum und Wirkung zu geben, ist beim Menschen gut erforscht. Eine bewusste aktive Unterdrückung führt meist dazu, dass der Gedankeninhalt, der unterdrückt werden soll, umso deutlicher und unangenehmer wiederauftaucht (»Denken Sie nicht an rosa Elefanten!«). Daher ist die Verschiebung eines Gedankens in andere Bewusstseinsschichten viel wirksamer als die bewusste Unterdrückung, da sie viel weniger Energie und Aufwand erfordert.
In der Zusammenschau zeigen viele Forschungsergebnisse, dass Täuschung und Selbsttäuschung im Alltag ubiquitär und (bis zu einer bestimmten Grenze) normal und auch sinnvoll sind. Sie dienen dem Überleben und der Reproduktion, der Durchsetzung eigener Interessen, aber auch der Psychohygiene und der Abwehr einer Bedrohung der Integrität des Selbst. Wären die meisten Menschen auf dieser Erde nicht überzeugt davon, dass sie ihr Leben meistern können, würden sie manchmal resignieren angesichts der Herausforderungen, Risiken und Bedrohungen – nicht nur in Krisengebieten und unter schwierigsten materiellen Umständen, sondern auch im relativen Wohlstandsalltag. Würden viele Frauen nicht den Stress und die Schmerzen bei ihrer ersten Geburt vergessen, würden sie sich vermutlich seltener dazu bereit erklären, ein zweites oder drittes Kind zu bekommen. Würden viele Bergsteiger unaufhörlich daran denken, was im Gebirge passieren könnte, gäbe es weniger heroische Gipfelstürme. Sportliche Höchstleistungen wären seltener. Viele künstlerische und berufliche Leistungen sind das Ergebnis von Selbstüberschätzung, die Kreativität und ungeahnte Kräfte verleihen kann.
Außerdem bewahrt Selbsttäuschung vor Verzweiflung, denn wenn sich zu große Zweifel an den eigenen Fähigkeiten einstellen würden, bekäme das Selbstbild Risse und das Selbstwertgefühl würde leiden. Die Leistungsfähigkeit würde sinken. Eine fehlende Selbstverständlichkeit und Verlässlichkeit im Alltag und mangelnder Glaube an uns selbst und unsere Fähigkeiten würden uns zu oft blockieren und verunsichern und uns daran hindern, das zu tun, was gut für uns ist oder uns bzw. unsere Familie und Bezugsgruppe weiterbringt. Daher blenden wir manchmal die harte Realität aus und täuschen uns und andere um der Bewältigung von Problemen und der eigenen Stabilität willen. Aus Selbsttäuschung und Selbstüberschätzung erwächst manchmal die Kraft, Krisen zu meistern, die uns sonst zu Boden geworfen hätten.
Diese Erkenntnisse aus den psychoanalytischen oder sonstigen psychologischen Theorien, der Evolutionsbiologie und Soziologie wurden schon seit längerer Zeit mit intrapsychischen pathologischen Prozessen in Verbindung gebracht und auch auf Menschen mit psychischen Erkrankungen angewendet. Die Mechanismen der (Selbst-)Täuschung beim Wahn oder bei krankhaften und unkorrigierbaren Überzeugungen, die sich von denjenigen der Mehrheit der Menschen einer Region oder kulturellen Referenzgruppe unterscheiden und als unwahr, unlogisch und nicht stimmig angesehen werden, sind der psychologischen Literatur gut bekannt – ebenso wie diejenigen bei der Manie (mit ihrer teils krankhaften Selbstüberschätzung oder Verkennung). Man findet aber in der psychiatrischen Literatur wenig tiefer gehende anthropologisch und psychologisch fundierte Ausführungen hierzu. Sie bleibt in der Darstellung von Menschen mit wahnhaften Überzeugungen oft bei den Begriffen der »Sinnestäuschung« und des Wahns und einer groben, an Äußerlichkeiten orientierten Kategorisierung der Wahnsymptome hängen – natürlich gibt es viele interessante Ausnahmen, die aber oft sehr philosophisch und akademisch bleiben (siehe ANGEHRN & KÜCHENHOFF 2017).
Symptome mit Bezug zu Selbsttäuschung sollen vielmehr nach Ansicht vieler Psychiater vor allem Ausdruck einer angenommenen biologischen »Störung« sein, einer Neurotransmitter-Imbalance, und könnten daher nicht wirklich psychologisch nachvollzogen und verstanden werden.
Auch das Fehlen einer gesunden Selbsttäuschung kann zu Problemen führen, haben Wissenschaftler entdeckt, so zum Beispiel der britische Psychologe Richard BENTALL (2003, S. 233). Er behauptet, dass bei der Depression die Fähigkeit zur Selbsttäuschung ein wenig abhandengekommen sei und der Betroffene deshalb in eine Starre und Aussichtslosigkeit verfalle, weil er zu realistisch sei und darüber resigniere. Aber ob dies nur eine Begleiterscheinung der Depression ist oder gar eine ihrer Ursachen, ist schwer zu beantworten und zu erforschen.
Therapie in der Psychiatrie wiederum (vor allem aber in der Psychotherapie) kann immer auch als eine Arbeit an Verzerrungen in Wahrnehmung und Denken und deren emotionaler Bewertung sowie als Korrektur dysfunktionaler (Selbst-)Täuschungen begriffen werden.
Wie sieht es nun mit einer Anwendung der Erkenntnisse zur (Selbst-) Täuschung auf die Psychiatrie selbst aus – also auf eben dasjenige Fachgebiet, das die Behandlung und den Umgang mit psychischen Störungen zum Ziel hat? Nicht nur Individuen täuschen andere oder sich selbst, sondern auch Gruppen und ganze Professionen. Die Psychiatrie als Fachgebiet, das faszinierendste, ungeliebteste und stigmatisierteste aller medizinischen Disziplinen, das auch heute noch immer wieder seine Professionalität erkämpfen und seine Arbeit und Methoden rechtfertigen muss, basiert auf den Erkenntnissen, fachlichen (Vor-)Urteilen und auf von Menschen unterschiedlicher Interessenlage gemachten, mehr oder weniger gut durchdachten Studien. Die klinische Psychiatrie kämpft weiterhin um Anerkennung (und wird dies vermutlich immer tun, wenn sie sich als medizinisches Fachgebiet behaupten möchte). Sie meint sich dabei gegen eine »Übernahme« beispielsweise durch die Neurologie oder die Psychologie schützen zu müssen. Sie ringt um die Überwindung des Vorurteils von der geringen Behandelbarkeit schwerer psychiatrischer Störungen.
Der Stachel einer im Vergleich zu vielen körperlich begründbaren Krankheiten immer noch unzureichenden Aufklärung der Ursachen psychischer Störungen trotz jahrzehntelanger und teurer biologisch-psychiatrischer Forschung sitzt weiterhin tief im Fleisch des Fachgebietes. Gleichzeitig muss die klinische Psychiatrie handlungsfähig sein und überzeugen können, um ihre Aufgaben bewältigen und ihre Leistungen abrechnen zu können. Entsprechend intensiv sind die Bemühungen, das Fachgebiet als therapeutisch und erfolgreich darzustellen. Handlungsfähigkeit in der Psychiatrie wird – und dies ist ein Thema dieses Buches – nicht zuletzt mit den Mitteln der Selbsttäuschung erkauft.
Methodik des Suchens
Das Buch nimmt Bezug auf die schweren psychischen Erkrankungen (Psychosen, schwere Depressionen und manisch-depressive Erkrankungen, schwere Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen), nicht die sogenannten common mental disorders, die sich in der Breite der Bevölkerung finden lassen. Im Zentrum der Psychiatrie war eine große Zahl psychiatrischer Forscher (Wissenschaftler, welche die neurowissenschaftlichen, psychologischen oder sozialen Aspekte der Psychiatrie beforschen) sowie klinischer und gesellschaftlicher Meinungsführer, Vertreter von Psychotherapieschulen und Medikamentenhersteller erfolgreich darin, Studienergebnisse zu produzieren und zu veröffentlichen, die oft nur der Bestätigung halbwahrer oder falscher Hypothesen über die Natur und die Behandlung schwerer psychischer Erkrankungen dienten. Diese Studien versuchen, Licht in die Blackbox unserer Psyche zu bringen und angenommene »Störungen« im Gehirn, angeborene oder erlernte Denk-, emotionale und Verhaltensmuster zu erkennen und zu verändern. Sie bewegen sich jeweils in dem Referenzsystem, das dem Forschenden zur Verfügung steht.
Diese Studien werden als »Evidenz« gehandelt, auch wenn sie manchmal dem widersprechen, was wir als Therapeuten, Angehörige, Betroffene erleben: Viele Studien machen uns beispielsweise glauben, dass die rezidivierende Depression und die Schizophrenie schwere Gehirnerkrankungen auf einer biologischen Grundlage seien, die zu Rückfällen oder Wiedererkrankungen führen, wenn sie nicht über lange Zeit medikamentös (oder anderweitig »biologisch«) oder spezifisch psychotherapeutisch behandelt würden. Dabei sehen viele Laien psychische Störungen weiterhin als Folge äußerer Lebensumstände und Verletzungen.
Insbesondere die biologische Psychiatrie verlagert den »Defekt« ins Gehirn (und entlastet dadurch vermeintlich diejenigen, die zu den Kranken in Beziehung stehen oder standen). Sie relativiert die »Schläge des Lebens«, indem sie ihnen in der Tragödie der Krankheit lediglich die Nebenrollen von »Triggern« und »Auslösern« zubilligt. Viele Studien lassen uns glauben, dass wir das Leben von Menschen mit psychischen Krisen verbessern, wenn wir ihnen dreimal pro Woche Elektroschocks oder tief ins Gehirn eingreifende Substanzen geben und diese über lange Zeit verabreichen. Andere Studien legen uns nahe, dass die Bearbeitung eines Ödipus-Komplexes, eines dysfunktionalen Denkmusters, einer tiefen Kränkung oder einer »ich-strukturellen Störung« die Bewältigung des Alltags verbessert. Andere argumentieren, dass die Übernahme eines Krankheitsmodells im Rahmen psychoedukativer Sitzungen die Einnahmetreue für Medikamente steigert und damit den Langzeitverlauf von Psychosen günstig beeinflusst. Und wieder andere Untersuchungen weisen darauf hin, dass wir nur soziale Ungleichheit bekämpfen müssten, um der Epidemie psychischer Erkrankungen Herr zu werden bzw. sie zu verhindern. In vielen dieser Studien steckt vermutlich mal mehr, mal weniger Wahrheit; die meisten liefern allerdings falsche »Ergebnisse«, die später revidiert werden müssen.
Die Zahl und Vielfalt der wissenschaftlichen Befunde zu Gehirn und Geist von Menschen mit seelischen oder ohne seelische Krisen wächst. Die (biologische) Psychiatrie misst im Gehirn unendlich viele Details. Im Blut psychisch Kranker wird gemessen und gesucht – es wird aber wenig Verwertbares gefunden. Die Zahl der in Studien verwendeten klinischen, psychometrischen, neuropsychologischen und sonstigen Skalen (die meist »validiert«, also auf ihre Sinnhaftigkeit getestet sind) und der darauf basierenden Befunde ist groß und wächst kontinuierlich. Der biologische Blick auf den psychisch Kranken vermisst die Struktur und Funktion seines Gehirns, der psychologische analysiert und vermisst psychische Konstrukte. Befund an Befund wird aneinandergereiht, und je nach Methode kommen gänzlich unterschiedliche, sich teilweise widersprechende Ergebnisse zum Vorschein. Das Fachgebiet der Psychiatrie vereint sie in der Eigenwahrnehmung allesamt. Aber es ver-misst sich selbst, da es meist an den falschen Stellen misst und unzureichende, wenn nicht gar zweifelhafte Instrumente verwendet.
Die Psychiatrie ist ver-messen – nicht nur wie sie sucht oder neurowissenschaftlich oder psychologisch forscht, sondern vor allem, wenn sie die Halboder Unwahrheiten, die sie zutage fördert, für bare Münze nimmt, wenn sie die Ergebnisse als direkt anwendbare wissenschaftliche Erkenntnisse begreift sowie teilweise vermarktet, ohne die Grenzen ihrer Methodik in Rechnung zu stellen. Nicht die Forschung und die Publikationen, vielmehr der damit verbundene Anspruch und die damit einhergehende Anmaßung sind das Problem. Die Art der Vermessung des psychisch Kranken kann am sozialen Subjekt vollständig vorbeizielen und selbst zum schädlichen Agens werden, und zwar vor allem, wenn sie zu biologischen (in der Regel medikamentösen) Therapieversuchen führt, die wie Schrotflintenschüsse in das Gehirn zielen und den Blick auf die psychischen und sozialen Konflikte hinter den Symptomen verstellen.
Hinter dem tief gehenden Interesse vieler neurobiologisch denkender Forscher und Kliniker an den physiologischen und biochemischen Grundlagen der gestörten Hirnfunktion verbirgt sich sicher die aufrichtige Hoffnung, den »Geheimnissen« psychischer Erkrankungen auf die Spur zu kommen. Viele Forscher wollen einen Durchbruch in der Therapie erreichen, um den »Krankheitsträgern« nachhaltig zu helfen.
Ein wenig anders liegt es mit den Vertretern der analytischen, tiefenpsychologisch fundierten, systemischen, kognitiv-behavioralen oder sonstigen Psychotherapien, die durch eine der jeweiligen Schule entsprechende Herangehensweise eine Korrektur von fehlgeleiteten (dysfunktionalen) Denk-, Gefühls- oder Verhaltensmustern anstreben, die derart zur Entlastung und Auflösung von Knoten im Gehirn führt, dass Symptome nachlassen und Energien für die Bewältigung von Lebensaufgaben frei werden. Der therapeutische Impetus ist mal größer, mal geringer – aber die meisten Therapien haben zumindest den Anspruch, zu lindern oder zu heilen. Keine Therapie kann allerdings die Frage beantworten, wie wir leben sollen und wie ein authentisches und sinnerfülltes Leben erreicht werden kann (KLEINMAN 2006, S. 232 ff.). Aber darum geht es letztendlich in der Psychiatrie – auch bei schweren »psychischen Funktionsstörungen«.
Eine naheliegende Erklärung für die hohe Variabilität in den Krankheitsverläufen und die mäßige Wirksamkeit unserer Therapien bei Menschen mit schwereren psychischen Beeinträchtigungen wird oft verdrängt, nämlich:
1. dass es gar keine kategorial abgrenzbaren psychiatrischen Erkrankungen gibt (das »medizinische Modell« psychischer Erkrankungen oder die jeweiligen psychologischen Theorien also lediglich Konstrukte sind, die nur manchmal weiter-, im schlimmsten Fall aber in die Irre führen),
2. dass Menschen immer wieder »erkranken«, weil wir keine guten Therapien zur Verfügung haben oder die Therapien selbst krank machen,
3. weil Medikamente überhaupt zu hoch dosiert oder zu lange gegeben und Absetzphänomene fehlinterpretiert werden sowie individualpsychotherapeutische Gespräche nach einer der Psychotherapieschulen bei sozial schwer desintegrierten Menschen nicht den Durchbruch bringen können, wenn diese in ihrem gesamten Beziehungsgeflecht, auf das die Psychotherapien nur begrenzt Einfluss haben, aus der Bahn geworfen wurden.
Fragt man psychiatrische Meinungsführer in Deutschland, den USA, Großbritannien oder anderen Ländern mit Forschungstradition nach den gegenwärtigen Herausforderungen in der Psychiatrie, die den Fortschritt behindern, dann ist es immer wieder die fehlende bessere und ausgefeiltere Technologie, die genannt wird. Dass operationalisierte (standardisierte) Beschreibungen und Definitionen psychischer Krankheitseinheiten, bessere Scanner und versiertere molekularbiologische Methoden denjenigen Patientinnen und Patienten, die keine eindeutiges organische Ursache ihrer psychischen Störung aufweisen, jemals weiterbringen, ist mehr als zweifelhaft. Dass die Psychiatrie fünfzig oder gar hundert Jahre der Medizin hinterherhinkt, wie behauptet wird, ist keine psychiatrische Bescheidenheit, sondern eine Selbsttäuschung, impliziert diese Behauptung doch, dass wir mit naturwissenschaftlichen Methoden irgendwann »aufschließen« können und greifbare und therapierelevante somatische Korrelate psychischen Krankseins finden werden. Und diese Behauptung geht einher mit einer anderen, nämlich der, dass die medikamentöse Behandlung mit psychotropen Substanzen zwar schon segensreich sei, aber einfach noch besser werden müsse.
Erfolge in der Psychiatrie?
Epidemiologische Studien zu medikamentös und psychotherapeutisch unbehandelten Spontanverläufen, Langzeitstudien, die weniger verfälscht sind als die Studien der Hersteller, Erfinder und Verfechter der Therapien, historische Vergleiche und qualitative Interviews legen hingegen die begrenzte Wirkung unserer »modernen« Therapieverfahren nahe. So waren vor der Antidepressiva-Ära die Verläufe etwa bei der Depression durchaus weniger »rezidivierend« (POSTERNAK 2006).
Aufschlussreich ist eine WHO-Studie zu Psychosen. Die WHO identifizierte in einer großen epidemiologischen Untersuchung Menschen mit einer Schizophrenie und verfolgte sie über viele Jahre. In Ländern, in denen weniger Antipsychotika gegeben wurden, war der Anteil der Menschen mit nur einer psychotischen Episode viel größer als in stärker industrialisierten Ländern mit höheren Psychopharmaka-Behandlungsraten. Nach zwei Jahren lag der Anteil an Patienten mit nur einer psychotischen Episode (ohne Rezidiv) bei 75 Prozent der Fälle in Chandigarh (Indien), wohingegen er in Aarhus (Dänemark) nur 28,5 Prozent betrug. Eine einzelne psychotische Episode mit vollständiger Remission (Verschwinden der Symptome) hatten zwischen 54 Prozent der Patienten im ländlichen Chandigarh und lediglich 5,7 Prozent der Patienten im reichen Nagasaki (Japan). Einer der konsistentesten Befunde der Studie war der durchgehend bessere Verlauf von Psychosen in sogenannten Entwicklungsländern im Vergleich zu industrialisierten Ländern (JABLENSKY u. a. 1992).
Die WHO-Studie zeigte deutlich, dass in jenen Ländern, in denen die Patientinnen und Patienten einen günstigen Krankheitsverlauf hatten, nur zu einem sehr geringen Teil Antipsychotika verschrieben wurden. Zwischen 2,6 Prozent (Agra, Indien) und 16,5 Prozent (Chandigarh, Indien) der Patienten in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen erhielten während des gesamten oder zumindest zu drei Vierteln des Beobachtungszeitraums Antipsychotika. Im Unterschied dazu bekamen zwischen 34,5 Prozent (Honolulu) und 87,8 Prozent (Moskau) der Patienten in industrialisierten Ländern eine medikamentöse antipsychotische Therapie während fast der gesamten Beobachtungszeit. In industrialisierten Ländern war ein bedeutend größerer Teil der Betroffenen über längere Zeit hospitalisiert, während im ländlichen Chandigarh weniger als 9 Prozent der Patientinnen und Patienten in der gesamten Beobachtungszeit irgendwann in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt worden waren.
Diese Befunde waren für die Fachleute so verstörend, dass sie zunächst andere Erklärungen suchten – so beispielsweise, dass die Schizophrenien in Indien und Nigeria gar keine echten Schizophrenien seien, die Gesellschaft weniger »stressig« sei und die Familien und Gemeinschaften »inklusiver« lebten. Nachdem diese Erklärungen nicht hinreichend plausibel erschienen, verschwand der Befund einfach aus dem kollektiven Gedächtnis der Psychiater.
Die kognitive Dissonanz zum gängigen Paradigma einer pharmazeutischen und auf das psychiatrische Behandlungszentrum oder die Klinik bauenden Psychiatrie in Ländern mit »entwickelten« psychiatrischen Versorgungssystemen wurde verdrängt und aus dem Bewusstsein abgespalten. Und aufgrund der weiten Verbreitung von Antipsychotika, Antidepressiva und (mit Einschränkungen) auch Psychotherapien sowie aufgrund der immer früher beginnenden Behandlung in den westeuropäischen Ländern, den USA oder Australien sehen wir hier bei vielen Fällen von Psychosen oder manisch-depressiven Störungen häufig vor allem Medikations- und Absetzeffekte und kaum noch natürliche Verläufe. Dies wird als Erfolg einer modernen Psychiatrie gesehen: »Help is at hand.« Ein Weiter-so mit besseren Instrumenten wird dadurch ermöglicht, dass wir die fehlende Wirkung der Therapien meist auf die fehlende Therapietreue der Patienten zurückführen.
Mittlerweile häufen sich aber die Hinweise, wie sehr die Entwicklung von Psychosen mit belastenden Erfahrungen und Traumata in der Kindheit verbunden ist (siehe etwa AJNAKINA u. a. 2016). Das Aufwachsen in Familien mit problematischen Kommunikationsmustern oder schwierigen Rahmenbedingungen, Trennung der Eltern, Diskriminierungserfahrungen (aufgrund der Hautfarbe und anderer äußerer Aspekte oder der Religion oder aufgrund von Verhaltensweisen, die zur Viktimisierung führen), Stress und Missbrauch jeder Art sind derart stabile Risikofaktoren für Psychosen, dass eine davon unabhängige biologische Vulnerabilität deutlich relativiert wird (LONGDON & READ 2016). Die schädlichen Wirkungen von ungünstigen sozialen Faktoren werden von den Forschern immer früher verortet: vom jungen Erwachsenenalter hinein in die Pubertät, in das Schulkind- und Kleinkindalter. Benachteiligungen werden transgenerational »vererbt«, Copingmuster werden weitergegeben und lassen die Betroffenen oft in einer frustranen Spirale erfolgloser Versuche zurück, Anschluss an »die Gesellschaft« zu bekommen.
Von diesen Befunden kommt jedoch wenig in der klinischen Realität an – oder sie werden zur Kenntnis genommen, ohne dass sich die Behandlung ändert. Und: Wie soll sie sich auch verändern? Was sollen wir auch tun, wenn wir zwar wissen, dass der vor uns stehende junge Mensch mit einer Psychose eines oder mehrere Probleme in seiner Kindheit hatte, aber so psychotisch ist, dass er dies im Gespräch kaum benennen und reflektieren kann, wir seine Biografie nicht rückgängig machen können, die familiären Bande schon schwer belastet sind und das psychische Erleben schon festgefahren ist und zu massiven sozialen Beeinträchtigungen geführt hat? Die Bereitschaft von Psychotherapeuten (siehe etwa den Ausbau der Psychosenpsychotherapie), an der Stärkung der Ressourcen der Betroffenen anzusetzen und nicht beim Defizit, hat zwar erfreulicherweise zugenommen, die Koordinaten der psychiatrischen Akutbehandlung sind jedoch vielerorts die gleichen wie noch vor Dutzenden von Jahren.
In der klinischen Praxis, der »Versorgungspsychiatrie«, ist das Vertrauen in die Innovationsfähigkeit der Psychiatrie als Fachgebiet mittlerweile gesunken (siehe etwa KLEINMAN 2012). Unsere Arbeit geht hingegen weiter, weil Patientinnen und Patienten immer wieder in die Kliniken, Ambulanzen und Praxen kommen oder gebracht werden und nun mal behandelt werden müssen – und weil weiterhin viel Geld verdient wird in der psychiatrisch-therapeutischen Welt, auch wenn wir nicht immer viel bewirken. Medizinisch denkende und forschende Psychiater dominieren mit ihrem wenn auch nicht mehr ganz ungebrochenen Optimismus gegenwärtig noch die Grundrichtung der Psychiatrie und geben ein an der somatischen Medizin orientiertes Bild psychiatrischer Erkrankungen an Hunderte und Tausende junger Psychiater und andere Berufsgruppen weiter. Dieses medizinische Paradigma und die daraus folgende Herangehensweise sowie der Umgang mit den Erkrankungen haben allerdings nicht dazu geführt, dass es vielen, die stationär behandelt und dann entlassen werden oder die in psychosozialen Einrichtungen leben, langfristig gut geht. Die meisten Betroffenen selbst und ihre Angehörigen konnten bisher nicht von Krankheitsmodellen überzeugt werden, in denen die psychische Krankheit im Wesentlichen als primäre Störung einer biologischen Funktion des Gehirns begriffen wird. Weil sie nicht stimmen.
Nur wenige neurobiologische Forschungsergebnisse zu den nicht direkt organisch bedingten psychischen Erkrankungen haben Menschen mit einer schweren psychischen Störung genutzt – im besten Fall wurden schädliche Therapien (etwa hochdosierte Medikamente, die Lobotomie, die Insulinschocktherapie oder die Langzeithospitalisierung) aus dem therapeutischen Arsenal verbannt oder kamen seltener und behutsamer zur Anwendung. Ebenso sind krank machende Faktoren wie traumatische Erfahrungen, welche die Neurobiologie des Gehirns verändern können, Suchtmittel oder bestimmte Stressoren stärker ins Blickfeld geraten und darauf aufbauende psychosoziale Therapien entwickelt worden. Aber das resultierte nur zu einem geringen Teil aus neuen Forschungsergebnissen zur Gehirnfunktion, denn auch vorher schon war bekannt, dass es soziale Beziehungen sind, die sowohl in der Therapie als auch bei der Reintegration in die Gesellschaft eine wesentliche Rolle spielen. Aber die Psychiatrie ist im medizinischen Selbstverständnis weniger ein Vehikel zur Förderung sozialer Beziehungen, sondern muss therapeutischen Ansprüchen genügen und spezifische medizinische Interventionen anbieten. Wobei: Muss sie dies wirklich?
Das Problematische an unserer gegenwärtigen Situation in der Psychiatrie ist, dass schlechte Krankheitsverläufe häufig der Biologie und der »Erkrankung« selbst (oder der krankheitsbedingt unzureichenden Therapietreue) und weniger unserem Umgang damit oder gar unseren Therapien angelastet werden. Wer einmal die Definitionsmacht besitzt und es geschafft hat, Forschungstöpfe, Fachgesellschaften, Ausbildungsinhalte für Ärzte und andere psychiatrisch Tätige sowie die klinische Praxis in den Einrichtungen zu prägen, wird wenig grundsätzliche Kritik am eigenen Fachgebiet akzeptieren oder die den eigenen Forschungen und der eigenen klinischen Praxis zugrunde liegenden Annahmen infrage stellen. Auch diese kognitive Strategie ist aus der psychologischen Forschung bekannt: Man nennt sie »self-serving bias«. Wenn wir Positives bewirken und Erfolg haben, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir dies unserem Handeln zuschreiben. Wenn etwas nicht klappt, ist es für unser Selbstwertgefühl oder unsere Selbstdarstellung innerhalb unserer Bezugsgruppe oder nach außen besser, wenn andere schuld sind oder der Widerstand im Objekt (hier: im Patienten) liegt.
Dies ist der Grund, warum innovative psychiatrische Versorgung und echte Veränderung heutzutage immer seltener aus den Universitätskliniken kommt, denn sie würde konstitutive Paradigmen des eigenen Fachgebietes selbst infrage stellen müssen. Der Wandel wird eher von unten gestaltet, von der Basis, von Betroffenen und von jenen psychiatrisch Tätigen, die in direktem Kontakt mit den Patientinnen und Patienten stehen, auch ohne auf quantitative Studien zurückgreifen zu müssen. Er wird auch von klinisch arbeitenden Psychiatern und anderen Therapeuten gefördert, die nicht auf Forschungsmittel und die Anerkennung durch die universitäre akademische Psychiatrie angewiesen sind. Zwar gibt es auch in der Gemeindepsychiatrie viele Vor-Urteile gegenüber psychisch Kranken (siehe das Kapitel »›Erziehung‹ zum psychisch Kranken«) – aber deutlich weniger wissenschaftlichen »self-serving bias«.
Natürlich liegen den Denk- und Verhaltensmustern bei Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen biologische Phänomene zugrunde. Beim Stimmenhören passiert etwas im Gehirn, genauso wie wenn wir uns darüber ärgern, dass wir unseren Hausschlüssel vergessen haben oder wenn wir verliebt sind. Aber was ist das »Störungsmuster«, das Symptomkonstellationen wie der sogenannten Schizophrenie oder der schweren Depression oder der Manie zugrunde liegt – Krankheitskonstrukten, die unsere Vorfahren vor mehr als hundert Jahren zu psychiatrischen Diagnosen zusammengefasst und als »Gehirnerkrankungen« den Erkrankungen anderer Organe gleichgestellt haben? Wenn man die gegenwärtige Psychiatrie verstehen will, muss man verstehen, was in den Köpfen von Psychiatern vor sich geht – genauso wie man in die Gedankenwelt von Wirtschaftslenkern und -wissenschaftlern eindringen muss, wenn man Wirtschaft, wie wir sie im Zeitalter der Globalisierung betreiben, verstehen will. Deren ökonometrische Gleichungen erscheinen in sich stimmig – aber es steckt eine Vielzahl unbewiesener Annahmen über menschliches Verhalten dahinter, die manchmal erschreckend schlicht sind und zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden können. Manchmal funktionieren die Modelle, wenn sich Menschen erwartungskonform verhalten oder wenn viele ähnlich denken, manchmal gibt es aber auch Brüche und Katastrophen – dann wird die Künstlichkeit der Modelle besonders deutlich. Ein Beispiel ist die Finanzkrise nach 2007, deren Ursachen immer noch kontrovers diskutiert werden. Weder die Ökonomie noch die Psychiatrie sind objektive Wissenschaften.
Moderne Psychiatrie?
Auch die moderne Psychiatrie unterliegt manchmal ähnlichen Mechanismen der (Selbst-)Täuschung wie eine schamanische oder sonstige in irgendeiner der vielfältigen Kulturen der Welt verankerte »Psychiatrie«. Sogar Schamanen müssen ihre auf Suggestion beruhenden Heilungsansätze legitimieren, um etwas im Symptomträger zu bewirken. Wie bei der modernen Psychiatrie beruhen Heilungserfolge sehr stark auf dem Glauben an die Wirksamkeit der Maßnahme – diese ist an das Vertrauen und an die Integrität und Kompetenz der Person gebunden, welche die Behandlung vornimmt. Was zählt, ist vor allem die Bedeutungszuschreibung, nicht die Art und biologische Wirkung der durchgeführten (Be-)Handlung. Dies ist vielleicht einer der Gründe, warum manche Psychiater immer noch gerne einen weißen Arztkittel überziehen und sich mit den Insignien des Körpermediziners ausstatten. Die Heilungserfolge der Schamanen bei psychosozialen Problemen werden auch nicht dadurch geschmälert, dass sie auf Täuschung und Selbsttäuschung beruhen: Sie fördern wie idealerweise auch die moderne Psychiatrie Selbstheilungskräfte durch Suggestion und unspezifische (Placebo-)Effekte (siehe schon Warner 1980). Im ungünstigen Fall fördern sie Chronifizierung und verhindern die Nutzung wirksamerer Therapien.
Zwei wesentliche Unterschiede zwischen moderner und schamanischer Psychiatrie müssen allerdings genannt werden:
1. Dem Schamanen (und vielleicht auch manchem Psychotherapeuten) geht es nicht darum, zu bewerten, wer gesund ist oder nicht, sondern um das Gleichgewicht zwischen Mensch und Gesellschaft und zwischen Mensch und Kosmos überhaupt – dem Heiligen und dem Profanen. Die moderne Psychiatrie hingegen basiert auf diagnostischen Einteilungen und Bewertungen.
2. Die moderne Psychiatrie greift biologisch ins Gehirn ein. Der Ansatzpunkt ist das Individuum, dessen angenommene biologische Fehlfunktion »korrigiert« wird, während die schamanischen Geister als Kräfte von außen durch soziale und symbolische Handlungen wirken – wenn auch nicht selten unterstützt durch die Einnahme psychotroper Substanzen. Die moderne Psychiatrie versucht, die Verantwortung für die Störung in der Biologie anzusiedeln und die Schuld im biologisch »Anderen« des kranken Gehirns zu verorten, um die Person dadurch von Schuld zu entlasten. Letzteres kann aber nicht funktionieren, weil das Gehirn die Person ja ausmacht und nicht zu etwas objektiv »Anderem« gemacht werden kann. Dies ist ein bedeutender Teil der Selbsttäuschung in der modernen Psychiatrie.
Selbsttäuschung und Täuschung gehören zur kognitiven und sozialen Conditio humana – was wiederum bedeutet, dass es keinen Sinn hat, in einem Windmühlenkampf alle Täuschung und Selbsttäuschung ausmerzen zu wollen. Wenn wir aber anderen Menschen schaden, die wehrloser sind und weniger Deutungshoheit haben als wir, dann erscheint es sinnvoll, ein Bewusstsein für die Mechanismen der bewussten und unbewussten Manipulation zu schaffen. Auch dies legt uns unsere Humanität nahe. Diese Beschäftigung mit Täuschung und Selbsttäuschung in der Psychiatrie setzt:
1. die Klärung von »Gewissheit« (was stimmt eigentlich an den Studienergebnissen, warum verhält sich der Patient so oder so und was ist der Einfluss der Therapie?) sowie
2. die Fähigkeit zur Trennung von Täuschung und Selbsttäuschung voraus (RADEISKI 2014, S. 71).
Was wird bewusst und was wird unbewusst manipuliert? Hierfür benötigen wir ein Grundverständnis der Bedingungen von Selbsttäuschung, also eine Diagnose der Bedeutungszuschreibungen und der Prozesse in der Psychiatrie, wie wir sie kennen und beobachten. Solange wir nichts Genaues über psychische Krankheiten wissen, kann diese Diagnose auch nur bruchstückhaft sein. Es ist vor allem eine soziologische und eine (sozial-)psychologische Diagnose.
Selbstkritik als Weg aus dem professionellen Dilemma
Im vorliegenden Buch geht es nicht um das Ausspielen von »sozialen« gegenüber »biologischen« Theorien und Behandlungsansätzen psychischer Auffälligkeiten. Es geht vielmehr um die in kognitiven Mustern von Therapeuten, Forschern und anderen psychiatrisch Tätigen angesiedelten Gründe für einseitige Entwicklungen in der Psychiatrie und um die Mechanismen und (meist negative) Auswirkungen einer auf Vor-Urteilen basierenden »Behandlung« und »Versorgung«. Es geht um das Erlernen von Verteidigungsstrategien gegen Manipulationen in der Psychiatrie bzw. um die Vermeidung unerwünschter Nebenwirkungen von Täuschung und Selbsttäuschung. Und es geht um ein Konzept, wie Menschen mit schweren psychosozialen Beeinträchtigungen besser geholfen werden kann als mit einer Langzeitverschreibung von Medikamenten, flankiert von individualpsychotherapeutischen Behandlungsversuchen und einer langfristigen Eingliederung in ein Institutionensystem, das ihnen nicht selten Initiative, Perspektive und positiven Stress wegnimmt und sie im besten Fall auf niedrigstem Niveau »stabilisiert«.
Wenn wir keine Entbiologisierung, Entpsychologisierung und Entinstitutionalisierung in der Psychiatrie erreichen und das Fachgebiet weiterhin als Reparaturbetrieb psychischer Folgen von Verletzungen und Belastungen bei sensiblen Menschen und tief gehender sozialer Veränderungen und Konflikte pflegen und dabei unser Expertentum auf die Handhabung veralteter Werkzeugkästen reduzieren, wird die Zahl der Chronifizierten und vom Versorgungssystem Abhängigen eher größer als kleiner werden. Der Graben zwischen denen, die es geschafft haben und ihr Leben in die Hand nehmen, indem sie entweder nie in die Psychiatrie gekommen sind, eine behutsame psychiatrisch-psychotherapeutische Unterstützung nutzen oder die Psychiatrie hinter sich gelassen haben, und jenen, die es nicht geschafft haben und zum Spielball psychiatrischer Interessen oder zum Objekt von mehr oder weniger Behandlungsversuchen geworden sind, scheint tiefer zu werden. Dabei gibt es eine Reihe erfolgreicher Modelle, wie wir helfen können, Chronifizierung zu vermeiden und Anreize für positive Lebensgestaltung trotz Vorliegen von Symptomen zu setzen. Dies zu realisieren erfordert Mut und einen Bruch mit vermeintlichen Gewissheiten. Es erfordert die Akzeptanz des Betroffenen als des Verschiedenen, aber nicht grundsätzlich Anderen.
Dieses Buch handelt von einigen Täuschungen, denen wir als Professionelle und denen die Behandelten in der Psychiatrie ausgesetzt sind. Bewusste Täuschung gibt es sicher seitens der pharmazeutischen Industrie, deren Studiendaten teilweise manipuliert wurden, um Medikamente wirksamer erscheinen zu lassen. Der Mehrzahl der Herangehensweisen in der klassischen Psychiatrie und der neurobiologischen Forschung liegt sicherlich der Wunsch zugrunde, Menschen mit psychischen Problemen zu helfen. Wir haben einiges erreicht und können einige Betroffene in der Erreichung ihrer Ziele unterstützen, doch die Energie, die wir darauf verwenden, Patienten unsere mäßig wirksamen Therapien zu verkaufen, steht dann oft nicht mehr zur Verfügung, um kritisch zu prüfen, ob wir überhaupt etwas Gutes getan haben. Dies ist ein Teil unserer Selbsttäuschung. Dabei müssen wir uns nicht selbst täuschen, um helfen zu können, wenn wir die menschliche Beziehung in den Mittelpunkt unserer Hilfe stellen. Wir sollten eigentlich die Experten für Täuschung und Selbsttäuschung sein: Psychiater und Psychotherapeuten arbeiten daran, die Fehlwahrnehmungen und dysfunktionalen kognitiven und emotionalen Muster von aus der Bahn geworfenen Menschen bewusst zu machen, aufzubrechen oder zumindest Wege zu zeigen, damit umzugehen oder trotz Beschwerden an sinnstiftenden sozialen Beziehungen teilzuhaben.
In diesem Buch werden nur einige, aber meiner Ansicht nach zentrale Aspekte von Täuschung und Selbsttäuschung in der Psychiatrie als Schlaglichter aufgegriffen. Dies erfolgt nicht systematisch. Die Geschichte der Psychiatrie wird dabei nur hier und da bemüht, obwohl sie eine zentrale Bedeutung hat für die Missverständnisse, denen wir aufsitzen. Zunächst wird erörtert, wie zentrale Paradigmen wirken, etwa das der schweren psychischen Störungen als Gehirnerkrankungen, und warum viele Therapeuten daran festhalten. In einem eigenen Kapitel werden die Verfälschungen in der Wirksamkeitsbeurteilung und der Nutzung unserer zentralen Instrumente in der Psychiatrie dargestellt: den Psychopharmaka. Des Weiteren zeigt sich, dass die Psychiatrie nur begrenzt wissenschaftlich sein kann und dass eine evidenzbasierte Psychiatrie so, wie sie angewendet wird, ein fragwürdiges und oft in die Irre führendes Konzept ist. Im daran anschließenden Kapitel werden zentrale Mechanismen beschrieben, warum nicht nur Entwicklungen in der Geschichte, sondern auch in der heutigen Psychiatrie zur Chronifizierung von Verläufen beitragen können und wieso gut gemeinte Versorgungssysteme zwar Schutzraum und »Versorgung« bieten, aber die Entwicklung und Teilhabe von Menschen mit psychischen Problemen behindern können.
Im darauf folgenden Kapitel werden Befunde und das gegenwärtige Wissen bezüglich psychosozialer Einflussfaktoren auf schwere psychische Erkrankungen dargestellt, das in der Mainstream-Psychiatrie oft stiefmütterlich behandelt und verdrängt wurde. Die Entwicklung von »Global Mental Health« und das Bewusstsein für die Vernachlässigung psychischer Probleme und deren Behandlung in vielen wirtschaftlich armen Ländern werden begrüßt; über die Schattenseiten lassen wir uns aber gerne täuschen: Beglücken wir die Welt mit unseren eigenen Fehlern moderner Psychiatrie oder haben wir einen ausreichend breiten Blick auf vielfältige soziale und psychosoziale Zusammenhänge? Gegen Ende des Buches wird ein wesentliches Gegenmittel gegen Täuschung und Selbsttäuschung beleuchtet: die Betroffenenkontrolle, der Einbezug oder gar die Gestaltung der Hilfesysteme durch Psychiatrieerfahrene. Ob die Dynamik dieser Entwicklung »von unten« das verkrustete psychiatrische System aufbricht und zur Destigmatisierung beiträgt, hängt davon ab, ob wesentliche Entscheidungsträger der Psychiatrie dies zulassen, welche Rahmenbedingungen und Vergütungsspielräume die Psychiatrie bekommt und wie sich die Machtverhältnisse in dem und um das Fach herum entwickeln.
Aktuell entstehen immer neue »Interventionen« für die Patientinnen und Patienten. Diese sind, wie einige psychotherapeutische Techniken bei ausgewählten Störungen, beispielsweise Zwangs- und Angsterkrankungen, teilweise außergewöhnlich erfolgreich. In anderen Fällen, vor allem bei schweren psychischen Störungen, rufen sie zwar große Erwartungen hervor, führen aber oft zu Enttäuschungen. Dabei sind es auch die psychiatrisch Tätigen, die der »Interventionen« bedürfen. Wir müssen die Art und Weise verändern, wie wir Psychiatrie betreiben. Wir bedürfen einer Reflexionsstrategie gegen Täuschung und Selbsttäuschung. Dies sollte den Hauptteil der psychiatrischen Lehrbücher ausmachen, nicht die Aufzählung zweifelhafter Befunde und das Wiederkäuen diagnostischer Klassifikationen und therapeutischer Instrumente, mit denen sich manche einen Namen gemacht haben.
Den Einbezug von Menschen mit Erfahrungen aus psychischen Krisen in unser Hilfesystem, die Betroffenenkontrolle sowohl in der Behandlung als auch in der Forschung nutzen wir nicht, weil wir Machtverlust und Verunsicherung befürchten. Doch das ist wieder nur ein Trugschluss und eine Selbsttäuschung. Betroffene erinnern uns immer wieder daran, nicht allen vermeintlichen Wahrheiten klinisch oder akademisch tätiger Psychiater anzuhängen, die ihre Erkenntnisse und Erfahrungen direkt umsetzen wollen, sondern den Menschen vor uns möglichst vor-urteilslos zu sehen mit seiner Geschichte, seinem Leiden und seinen meist vielfältigen Versuchen, sich selbst zu helfen. Oft reicht es, diese Versuche zu unterstützen, manchmal müssen wir sie anstoßen.
»Wir« und »sie«: Schemata in der Psychiatrie
Die klinische Psychiatrie als medizinisches Fachgebiet mit ihren an der somatischen Medizin orientierten Aufgaben, Arbeitsweisen, Ritualen und diagnostischen Ordnungssystemen (die Internationale Klassifikation der Krankheiten ICD-11 und die mittlerweile fünfte Überarbeitung des US-amerikanischen psychiatrischen Systems DSM), mit ihren Paradigmen und den auf sie aufbauenden, als evidenzbasiert beworbenen Therapien hat zunächst einen recht klaren Auftrag, nämlich die Behandlung und Versorgung von Menschen mit psychischen Problemen. Schaut man aber genauer hin, wird dieser Auftrag von den jeweiligen psychiatrischen Institutionen sehr unterschiedlich wahrgenommen. Trotz des Versuchs, Leitlinien und Standards in der Psychiatrie zu etablieren, ist die Behandlungsvarianz erheblich. Das Schicksal von Menschen mit psychischen Problemen hängt entscheidend davon ab, wo sie behandelt, wohin sie gebracht werden und ob sie in der Lage sind, ihre psychischen Probleme mithilfe oder unabhängig von der Psychiatrie zu bewältigen. Viele Betroffene und Angehörige, die Veränderungen an sich selbst bzw. an den Betroffenen wahrnehmen, sind hilflos und wenden sich (oft im Unterschied zur Inanspruchnahme rein psychotherapeutischer Behandlung) nicht einfach an psychiatrische Institutionen, um Rat oder eine spezifische Therapie zu erhalten. Sie kommen, weil sie endgültig nicht mehr weiterwissen und weil alle bisherigen Lösungsversuche nicht funktioniert haben.
Die Vorgehensweise der Psychiatrie wiederum ist – zumindest was den Umgang mit Menschen mit schweren und schwersten psychischen Problemen angeht – Ausdruck und Versuch eines möglichst professionellen Umgangs mit kaum nachvollziehbarem Verhalten und Erleben, aber ebenso geprägt von Unsicherheiten und Wissenslücken. Die Standards und Regeln des Fachgebietes sind ein Versuch der Bewältigung von (beidseitiger) Hilflosigkeit. Im Großen und Ganzen ist die Gesellschaft froh, dass sich ein Fachgebiet entwickelt hat, das sich für Menschen mit solchen Auffälligkeiten, mit Anpassungsschwierigkeiten, mit teils umfassenden Problemen in der Beziehungsgestaltung und mit vielfältigen, nicht unmittelbar aus dem Zusammenhang erklärbaren Beeinträchtigungen interessiert und sich für diese Menschen als zuständig erklärt hat. Es entlastet die »normale« Gesellschaft, wenn sich Experten für solche Menschen verantwortlich fühlen und zumindest eine Beschreibung psychischer Störungen und Normabweichungen liefern. Die Psychiatrie ist für viele Menschen mit schweren Kommunikations- und Verhaltensproblemen die letzte Wiese. Angehörige dieser zu Psychiatriepatienten Gewordenen, ihre Arbeitskollegen, Lehrer, Nachbarn und Freunde werden von einer (Mit-)Verantwortung entbunden oder zumindest entlastet, sobald der Psychiater einen Menschen zum Kranken macht, indem er benennt, was mit ihm nicht stimmt, und eine Therapie dagegen bereithält. Die nach Hilfe und Erklärung suchende Gesellschaft hat für das, was sie anders nicht bewältigen kann oder will, eine professionelle Instanz zur Verfügung, an die sie einen Teil der Last delegieren kann. Die Hilflosigkeit nimmt ein wenig ab.
Aber ebenso wie bei vielen chronischen, nicht heilbaren somatischen Erkrankungen ist damit das Problem noch nicht gelöst. Denn die Psychiatrie hat oft gar keine schlüssige Erklärung für die Verhaltensauffälligkeiten. Zudem wirken die Behandlungsmethoden und insbesondere die Psychopharmaka nicht ursächlich und werden von den Betroffenen in höchst ambivalenter Weise oft lediglich toleriert: Sie sind keine Heilung, helfen nur manchmal und lassen langfristig oft im Dunkeln, ob sie mehr geschadet oder mehr geholfen haben.
Das psychiatrische Hilfesystem ist voller Widersprüchlichkeiten, auch wenn es mit dem ganzen Aufgebot an Forschungsmethoden, theoretischen Gebäuden, Hypothesen, Behauptungen, Befunden, Leitlinien und Therapien den Anschein von Handlungsfähigkeit und Kompetenz im Umgang mit schweren Symptomen aufrechtzuerhalten versucht. Viele Aspekte der klassischen Psychiatrie sind reaktiv und rückwärtsgewandt, selbst wenn viele fortschrittlich Denkende die Hoffnung haben, dass die Zeit der präventiven Psychiatrie und der behutsamen, früh ansetzenden und Chronifizierung verhindernden Therapien angebrochen sei. Die Psychiatrie bleibt ein eigentümlich verunsichertes Geschäft. Diese Hilflosigkeit wurde in den letzten hundert Jahren immer wieder kompensiert durch Medikalisierung und Biologisierung (das Gehirn sei krank), teilweise auch durch Gesellschaftskritik und Ideologisierung (die Gesellschaft sei krank und verrückt).
Medikalisierung bedeutet, dass wir die Folgen seelischen Leidens und des Leidausdrucks, wie er am Betroffenen als Symptom sichtbar wird, kategorisieren, mit den uns zur Verfügung stehenden Methoden vermessen und ihnen über die Konstruktion eines Zusammenhangs mit Rezeptorstörungen und strukturellen Auffälligkeiten eine professionell definierte Pseudogenauigkeit verpassen, um die Symptomträger den uns zur Verfügung stehenden Therapien zuzuführen. Diese Methode geht im Prinzip auf den deutschen Psychiater Emil Kraepelin zurück und hat sich seither kaum geändert. Wir leben immer noch in Zeiten einer vermessenden Psychiatrie: Uns reichen wenige Gewissheiten, um tief greifende Eingriffe in Gehirn und Psyche zu rechtfertigen und als »state-of-the-art« darzustellen. Die Klassifikation der Erscheinungsformen psychischer und Verhaltensauffälligkeiten und die künstliche Bildung von Gruppen und vermeintlichen Krankheits»einheiten« nennt man »Nosologie«. Heute, da wir wirksame Therapien zur Verfügung haben, suchen wir nach Symptomen und Symptomkonstellationen, die in dasjenige Raster passen, wofür die Therapien beworben werden.
Therapie und Diagnose gehören zusammen. Und Diagnostik war schon immer ein »weites Feld« in der Psychiatrie. Warum ist dies so? Die Äußerungen menschlichen Unwohlseins, innerer und äußerer Konflikte sowie das dazugehörige Verhalten müssen in eine Sprache übersetzt werden, die sowohl Kommunikation zwischen Experten ermöglicht als auch die Abweichungen zwar nicht verstehbar (im Sinne von Karl Jaspers), aber doch beschreibbar und einer Beurteilung zugänglich macht. Diese Übersetzung wurde aus der somatischen Medizin übernommen: Symptome zu Symptomkonstellationen, also zu Syndromen werden zu lassen und sie zu vermessen, um die zugrunde liegende strukturelle oder funktionelle Störung aufdecken und die Normabweichung mittels chirurgischer oder pharmakologischer Intervention beseitigen oder wenigstens erträglich machen zu können.
Diese ärztliche Übersetzungsleistung, die jede Sekunde im modernen Medizinbetrieb erfolgt, erscheint als Prinzip auch in der Psychiatrie unerlässlich. Die Übersetzung von Symptomen in Krankheitseinheiten (Störungen) erscheint notwendig, um die Illusion störungsspezifischer Therapien aufrechtzuerhalten und biologische oder psychotherapeutische Interventionen zu legitimieren. Damit gewinnt der Therapeut gegenüber den Betroffenen, den Angehörigen und der Öffentlichkeit Professionalität und Sicherheit. Er reduziert die Hilflosigkeit gegenüber dem vor ihm Sitzenden an sich selbst oder anderen (Mit-)Leidenden. Er schafft es dadurch, professionelle Distanz zu wahren und eine Rolle einzunehmen, die auf seinen Wissensvorsprung zurückgeht und dazu ermächtigt, angenommenes oder tatsächliches psychisches Leiden zu verringern.
Eine Verfeinerung bzw. Erweiterung dieser Beschreibung und Vermessung menschlichen Erlebens und Verhaltens zu therapeutischen Zwecken ist die Aufklärung der »Laien« und (potenziellen) Patienten und Angehörigen in dem Sinne, dass die in Symptomen sicht- und beschreibbaren Auffälligkeiten vom Symptomträger selbst oder von den Angehörigen bereits als psychische Störung wahrgenommen, entsprechend bewertet und im Kontakt mit dem Behandlungs- und Versorgungssystem präsentiert werden. Dies ist ein vor das Urteil des Psychiaters oder Psychotherapeuten geschalteter Mechanismus desjenigen, der seine Symptome schon in einer Weise interpretiert und vorträgt, dass sie zu den verfügbaren Krankheitskonzepten und Therapien passen. Jemand fühlt sich depressiv, weil er die Kategorien für die Erkrankung einer »Depression« über Therapeuten, Psychoedukation und verschiedene Medien in sein Denken eingebaut hat und seine niedergedrückte Stimmung, das Grübeln und die Schlafprobleme als Depression wahrnimmt. So wurde die Depression als Erkrankung in ihrer jetzigen Form erst mit der Verfügbarkeit der Antidepressiva »erfunden«, die (in ihrer älteren Version) vor allem Schlaf und Appetit verbessern, Antrieb steigern und Spannung verringern (HEALY 2002).
Vor zweihundert Jahren gab es keine Depression in heutiger Lesart. Die Melancholie hatte nicht immer und nicht überall Krankheitswert. Hinter der sozialen Phobie steckt unleugbar Leidensdruck, aber nicht immer wurden schüchterne, sozial zurückgezogene Personen als »krank« angesehen. Stimmenhören war nicht immer Ausdruck einer (psychotischen) Erkrankung. Stimmungsschwankungen waren nicht immer »bipolar«. Dies ist der Grund, warum so viel über den Verkauf von Psychopharmaka verdientes Geld in die »Aufklärung« der Bevölkerung investiert wird. Wenn ich einen Hammer besitze, sehe ich eine Welt voller Nägel.
Diese angebotsinduzierte Nachfrage gibt und gab es auch bei körperlich begründbaren Erkrankungen. Zwar existierten vor zweihundert Jahren auch noch keine »Herzinsuffizienz«, Leukämie oder Sklerodermie, aber heute kennen wir viele Mechanismen, wie sich diese körperlichen Erkrankungen entwickeln und was bei ihnen im Körper vor sich geht. Wir können also nur noch darüber diskutieren, wie viel Krankheitswert die körperliche Veränderung oder Normvariante hat. Organisch fassbare pathogenetische Mechanismen kennen wir aber nicht von der Depression oder der Schizophrenie, höchstens in Ansätzen bei der Demenz. Niemand weiß, was bei einer Depression oder einer Schizophrenie im Gehirn passiert. Aber wir behaupten, wir wüssten es zumindest zum Teil, und tun so, als handele es sich um Erkrankungen mit nicht nur einem biologischen Korrelat, sondern mit einer biologischen Verursachung – einer strukturellen oder funktionellen Störung im Gehirn. Dies hat weitreichende Folgen.
Ein wichtiger Schritt in der Psychiatrisierung von Normabweichungen des psychischen Erlebens und Verhaltens ist die Isolation des beobachteten Symptoms vom sozialen Kontext. Eine Niereninsuffizienz oder ein Oberschenkelhalsbruch sind in ihrer Pathologie immer gleich, ob ich sie in der Wohnung des Patienten oder in der Klinik untersuche, im Urwald oder in der Wüste – auch wenn die geäußerten Schmerzen durchaus davon abhängen, wer anwesend ist und wo und wie ich sie erfasse. Aber die relative Kontextunabhängigkeit medizinischer (Akut-)Erkrankungen trifft nicht für psychische Erkrankungen zu. Wenn ich die Krankheitsäußerungen eines Menschen mit psychischen Problemen kennenlernen und begreifen will, muss ich mich in seinen Kontext, in sein Lebensumfeld begeben, in dem die Abweichung entstanden ist oder sich manifestiert. Psychische Symptome existieren nicht ohne sozialen Kontext. Ein Fels, der in einer toten Steinwüste von einem anderen Felsen herunterfällt, produziert keinen Lärm, nur physikalische Phänomene. Es ist nämlich niemand da, dessen Trommelfell die Schallwellen in Töne übersetzt. »Lärm« als Begriff ist sozial konstruiert, genauso wie der Wahn oder die depressive Stimmung.
Paranoia, Beeinträchtigungserleben, Depressivität, Manie und Ängste existieren nur in Bezug auf andere Menschen. Alle Wahninhalte von Menschen mit Psychosen haben mit der Stellung des Wahnkranken in einem sozialen Kontext zu tun. Psychiater sind Übersetzer, die aber nicht uneigennützig, sondern mit vielen Vor-»Urteilen« Symptome in eine Sprache übersetzen, die sie selbst geschaffen haben. Damit bewerten sie die Symptome, ob sie wollen oder nicht. Wenn ich einen Menschen in eine dyadische Therapeut-Patient-Beziehung oder gar in einen hierarchischen Krankenhauskontext hineinversetze, bekommen seine Symptome, derentwegen die Angehörigen oder er selbst vorstellig wurden, sofort eine unterschiedliche Bedeutung (siehe immer noch: GOFFMAN 1961). Die Isolation des Symptoms aus dem sozialen Zusammenhang macht dessen eigentliche Bedeutung und »Funktionalität« zunichte. Das Symptom wird zur eigenen Wirklichkeit, an der Therapien ausprobiert werden, bis es verschwindet oder sozialverträglicher wird. Der Weg hin zum Symptom und dessen eigentliche Botschaft spielen keine Rolle mehr, weil das Symptom als derart dysfunktional wahrgenommen wird, dass sich eine inhaltliche Beschäftigung damit kaum lohnt. Das mit dem Symptom verbundene Risiko einer Fehlhandlung oder eines Schadens für den Betroffenen und für sein Umfeld ist so groß, dass die Symptomkontrolle im Vordergrund steht. Dies trifft nicht für leichtere psychische Beschwerden zu, die psychotherapeutisch behandelt werden, denn dort kann man sich den »Luxus« leisten, hinter das Symptom zu schauen, da die Risiken abwägbar sind. Für schwerste psychische Beeinträchtigungen allerdings wird Psychotherapie weiterhin oft nicht als wirksam erachtet.
Die Zuführung der Betroffenen zu einer psychiatrischen Therapie in entsprechenden Kliniken, Ambulanzen, Praxen oder Wohneinrichtungen birgt immer die Gefahr der Entwicklung von Paralleluniversen und Scheinwelten, in denen menschliches Handeln anders funktioniert als im normalen Alltag: hier der Patient, dessen Erleben und Verhalten eigentlich nur in seinem Lebensfeld begriffen werden könnte, und dort die (heutzutage auch nach »draußen« getragene) Klinik mit ihrem Bemühen, den Menschen einzuordnen, um ihn einer »objektiven«, einer »evidenzbasierten« Therapie zu unterziehen, die eine Veränderung von Denk- oder Verhaltensmustern nach sich zieht – oder einfach nur Symptome unterdrückt. Hier der Betroffene, dort die sich kümmernde, aus der Sozialversicherung oder Steuergeldern bezahlte und als Organisation sich selbst erhaltende Klinik oder sonstige Institution.
Daraus resultiert eine recht weit verbreitete Abneigung von Psychiatern, nach draußen ins soziale Umfeld des Patienten zu gehen: Die Furcht vor dem Verlust professioneller Distanz, die Sorge, das wohlvertraute Territorium der erlernten (Lehrbuch-) Psychiatrie mit ihren Hierarchien, Kategorien und Absicherungen zu verlassen und sich in die Sphäre des Patienten zu begeben, die sich sperriger und komplexer darstellt, als es die Schablonen von Diagnostik und Therapie abbilden können. Draußen ist der Sozialraum, der Erklärungsraum, das vermeintliche »Rauschen« neben den Symptomen viel präsenter und die Macht des Sozialen