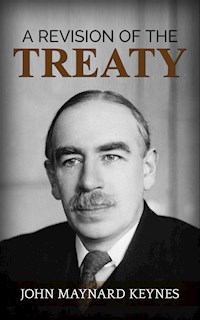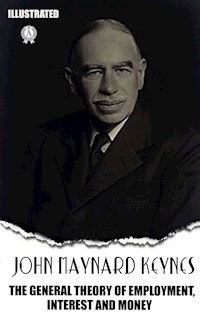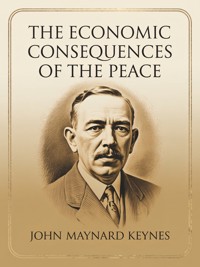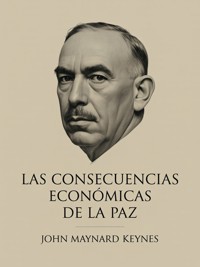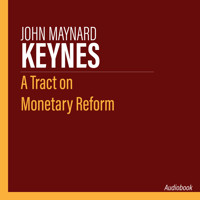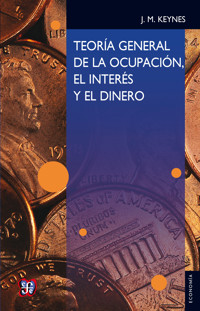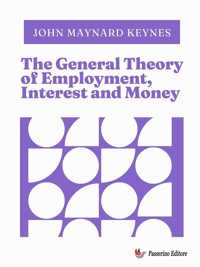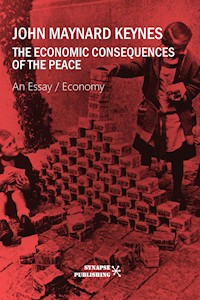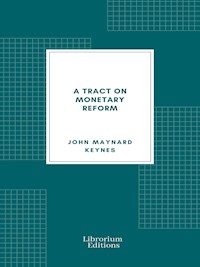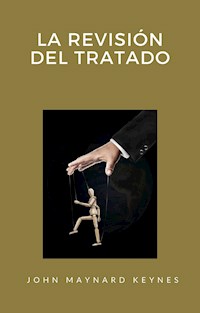Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit seinem Buch über die Folgen des Ersten Weltkriegs für Europa wurde John Maynard Keynes über Nacht ein berühmter Mann. Niemand hat prophetischer analysiert, warum der Vertrag von Versailles einen neuen Krieg und bis heute schwelende politische Konflikte auslösen konnte. Keynes' glänzend geschriebene Polemik, von Joachim Kalka neu übersetzt, enthält die Darstellung der nie wieder erlangten Höhe von Europas Reichtum vor 1914 und den Ausblick auf die wenig hoffnungsvolle Nachkriegszeit. Kein anderer hat so anschaulich und mit analytischem Spott beschrieben, wie 1919 der Frieden verspielt und Europa unabsehbarer Schaden zugefügt wurde. »Die sprichwörtliche Rede, wonach es leicht sei, einen Krieg zu beginnen, aber schwierig, einen gerechten Frieden zu stiften, bewahrheitet sich an wenigen Friedensschlüssen so wie am Versailler Friedensvertrag vom 28. Juni 1919. Seit fast hundert Jahren ist Keynes' Kommentar dazu von ungebrochener Aktualität.« Rudolf Walther, Süddeutsche Zeitung »Keynes ist nicht nur ein grandioser Ökonom und ein spannender Zeitzeuge gewesen, sondern auch ein großartiger Schriftsteller.« Caspar Dohmen, Deutschlandfunk
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrages am 28. Juni 1919. G. Clemenceau (Frankreich), Woodrow Wilson (USA) und D. Lloyd George (GB) verlassen das Schloss von Versailles nach der Vertragsunterzeichnung.
JOHN MAYNARD KEYNES
KRIEG UND FRIEDEN
Die wirtschaftlichen Folgen des Vertrags von Versailles
Aus dem Englischen von Joachim Kalka
Herausgegeben und mit einer Einleitung von Dorothea Hauser
BERENBERG
Dorothea Hauser
GELD UND MORAL
EDITORISCHE NOTIZ
VORBEMERKUNG DES ÜBERSETZERS
John Maynard Keynes
I. EINLEITENDES
II. EUROPA VOR DEM KRIEG
III. DIE KONFERENZ
IV. DER VERTRAG
V. DIE WIEDERGUTMACHUNG
VI. EUROPA NACH DEM VERTRAG
VII. HEILMITTEL
ANMERKUNGEN
ÜBER DEN AUTOR
Dorothea Hauser
GELD UND MORAL
Noch jeder Friedensschluss hat den Charakter des Krieges, der ihm vorausging, in sich getragen. Man kann daher den Friedensvertrag von Versailles, der auf die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, den Ersten Weltkrieg, folgte, auch als die Katastrophe nach der Katastrophe bezeichnen. Zu tief waren die Gräben, die der jahrelange Stellungskrieg auch in den Köpfen der Menschen hinterlassen hatte, zu groß auch die Versprechen, die alle Kriegsparteien für den Fall des Sieges vier Jahre lang ihren Bevölkerungen eingetrichtert hatten, als dass über den Gräbern von 10 Millionen Toten der 1914 begonnenen blutigen Selbstzerstörung Europas mit einem bloßen Federstrich hätte Einhalt geboten werden können. Vieles von dem, was die politische Instabilität jener beiden Jahrzehnte ausmachen sollte, die schon den Zeitgenossen oft düster als Zwischenkriegszeit erschienen, nicht zuletzt die finanzielle und wirtschaftliche Zerrüttung Europas, war weniger Folge des Friedensdebakels als vielmehr des Krieges selber.1 Wenn auch der Mythos vom »Schandvertrag« sich bis heute hält: Versailles allein lässt sich kein deutsches Fatum andichten.
Dass die Aufgabe, die sie sich vorgenommen hatten –nichts weniger als eine Neuordnung der Welt –, ihnen über den Kopf wachsen könnte, daran mochten die Staatsmänner, die 1919 in Paris ein halbes Jahr zusammensaßen, zunächst nicht denken. Und nicht nur sie: Als am 11. November 1918 endlich die Waffen schwiegen, hatte allenthalben große Zuversicht, ja sogar Begeisterung in der Luft gelegen. Denn von jenseits des Atlantiks erklang eine Heilsbotschaft, die dem traumatisierten alten Kontinent verhieß, dass das Massenopfer nicht umsonst gewesen sei: Man habe Krieg geführt, um in der Zukunft den Krieg zu verhindern und zugleich die Welt »safe for democracy«2 zu machen. Sie wurde ausgegeben von dem Staatsoberhaupt jenes Landes, ohne dessen erst finanzielle, ab 1917 dann auch militärische Unterstützung die Entente den Krieg wohl kaum gewonnen hätte. 1918 schlug die Stunde Amerikas, dessen Aufstieg zur Weltmacht das einzige bleibende Ergebnis des Ersten Weltkriegs sein sollte.
Die Vierzehn Punkte, die US-Präsident Wilson Anfang 1918 in Reaktion auf den bolschewistischen Umsturz in Russland verkündet hatte, waren seinerzeit nicht weniger revolutionär als die Parolen Lenins. Und die Bereitschaft der Menschen, an den Beginn einer neuen Ära der Weltgeschichte mit Frieden, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Völker zu glauben, war so umfassend wie die faktische Sinnlosigkeit des großen Schlachtens vorher. Nicht nur die Deutschen, die – durch den Schachzug ihrer Militärs, die unvermeidliche Niederlage in einem Moment anzuerkennen, in dem noch kein alliierter Soldat auf deutschem Boden stand – für Illusionen besonders empfänglich waren, wollten den Amerikaner beim Wort nehmen. Man kann die emotionale Verheißung, die die Menschen damals mit den Parolen des amerikanischen Präsidenten verbanden, gar nicht genug betonen: Als Wilson, der sich selber freilich eher als Missionar und moralischer Schiedsrichter verstand, im Dezember 1918 in Paris eintraf, war es, als ob der Messias käme. Der Jubel auf den Straßen wollte kein Ende nehmen und fand sein Echo in der weihevollen Hochgestimmtheit zahlreicher Friedensunterhändler.
»Wir wollten nicht nur den Frieden vorbereiten, sondern den ewigen Frieden. Uns umgab der Glorienschein eines göttlichen Auftrags«,3 fasste der Diplomat Harold Nicolson im Rückblick die anfängliche Gefühlslage vieler in der britischen Delegation zusammen. John Maynard Keynes, der ihr als Vertreter des britischen Schatzamts in prominenter Stellung angehörte, teilte derlei Zuversicht nicht. Nicht zuletzt geprägt durch seine Zugehörigkeit zum avantgardistischen Londoner Künstlerkreis von Bloomsbury, ließ ihn seine schon den ganzen Krieg über skeptische Haltung, was staatsmännische Vernunft und Kompromissbereitschaft angeht, von vornherein auch für danach wenig Gutes erwarten. Zwar entlarvte auch Keynes, wie er Mitte April 1919 an einen Bloomsbury-Freund schrieb, Wilson umstandslos als »den größten Betrüger auf Erden«.4 Doch im Vergleich zu dem Ton enttäuschter Hoffnung, den der gar nicht kleine Chor angloamerikanischer Versailles-Kritiker bald anstimmte, war Keynes’ bereits im Dezember 1919 veröffentlichte Philippika Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages in weit geringerem Maße ein Produkt überzogener Erwartungen an die Friedensmacher. Im Gegenteil: Seine Polemik war von der Überzeugung getragen, dass auf den Trümmern des Weltkriegs die Zukunft nicht im Treibsand politischer Ideen und Leidenschaften, sondern zuallererst in der grenzüberschreitenden Rationalität der ökonomischen Sphäre liege. Eben dieses letzte Residuum der Vernunft aber, so sah es Keynes, drohte mit den in Versailles festgelegten wirtschaftlichen Friedensbedingungen dem Irrsinn einer politischen Zivilisation in extremis anheimzufallen, die nach Deutschlands kalkulierter Aggression gegen das neutrale Belgien vom August 1914 einen Weltenbrand entfesselt und ein Goldenes Zeitalter des Wohlstands beendet hatte.
Hiermit formulierte Keynes, der seit seinen Cambridger Studientagen als Allroundgenie galt, nicht nur einen beispiellosen Überlegenheitsanspruch des Ökonomischen über die Politik. In seinen Augen drohten die finanziellen Klauseln des Versailler Vertrags durch eine wirtschaftliche Schwächung Deutschlands nicht allein die Verlierernation, sondern den ganzen Kontinent auch politisch zu ruinieren. Seine beißenden, nicht immer fairen Porträts der alliierten Friedenshäuptlinge gaben den Hintergrund für einen finsteren Ausblick: Keynes prophezeite nichts weniger als »einen langen Bürgerkrieg zwischen den Kräften der Reaktion und den verzweifelten Zuckungen der Revolution, vor dem die Schrecken des vergangenen Deutschen Krieges verblassen werden und der, gleichgültig wer Sieger ist, die Zivilisation und den Fortschritt unserer Generation zerstören wird«.5 Freilich beließ es der Ökonom nicht bei diesem abgründigen Szenario. Vielmehr lieferte er seine Rettungsvorschläge, die er 1922 in einem Folgeband unter dem Titel Revision des Friedensvertrages noch weiter ausarbeiten sollte, gleich mit. Obwohl, wie das ganze Traktat, brillant und mit Herzblut geschrieben, waren sie angesichts des Völkerhasses und der politischen Evangelien, die nach dem Ersten Weltkrieg im Schwange waren, mit ihrem Beharren auf einem Frieden der ökonomischen Vernunft von großer Nüchternheit. Tatsächlich waren sie zu nüchtern. Denn für die Qualen und die Ängste des Hauptleidtragenden des Krieges, nämlich Frankreich, dessen Nordteil die Deutschen systematisch verwüstet und demontiert hatten, zeigte Keynes bemerkenswert wenig Empathie. Mehr noch: Das von ihm geforderte und für Europas Erholung unentbehrliche finanzielle Engagement der USA, die als Wirtschafts- und Handelsmacht fortan weltweit unangefochten blieben, ließ sich vorerst kaum erzwingen. Schließlich hatten die Amerikaner, obgleich durch den Krieg reich geworden und durch den späten Kriegseintritt relativ unverschlissen, selbst ihren ausgezehrten Koalitionären jeglichen Schuldenerlass verweigert. Gleichwohl lag Keynes’ Entwurf zu Recht die Erkenntnis zugrunde, dass allein Europas wirtschaftliche Verschränkung, notwendig angetrieben von der Wirtschaftslokomotive Deutschland, der Schlüssel für den Wiederaufbau wie auch die politische Aussöhnung des kriegsversehrten Kontinents sei. Sein furioses Pamphlet ist, was allzu oft übersehen wird, gleichermaßen eine Kampfansage gegen Versailles wie eine frühe Werbeschrift für das Programm einer europäischen Integration. Man kann es mit Blick auf den weiteren Fortgang des 20. Jahrhunderts nicht ohne Erschütterung lesen.
So entwickelte Keynes mit seinem Vorschlag einer amerikanischen Anleihe für den europäischen Wiederaufbau nicht nur den blueprint für einen Marshallplan, wie er dann unter seinem wesentlichen Einfluss nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest dem westlichen Teil Europas zugutekommen sollte. Im Vorgriff auf das, was 1955 eine grundlegende Doktrin der Nato wurde, formulierte er zugleich das Postulat, dass Sicherheit vor Deutschland nur Sicherheit mit Deutschland sein könne. Vor allem aber plädierte er für die Gründung einer europäischen Freihandelsregion, der neben Deutschland und den anderen Staaten Zentral- und Osteuropas auch die Türkei angehören sollte. Tatsächlich erschien Keynes dieses Projekt derart dringlich, dass er in einer Passage, die den Artikel 23 des EWG-Vertrags von 1957 gleichsam vorwegnahm, für Deutschland sowie die 1919 neu geschaffenen Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns und des Osmanischen Reichs eigens eine zehnjährige Mitgliedspflicht unter Aufsicht des Völkerbunds vorsah. Für alle anderen Länder hingegen, Frankreich und Italien zumal, sollte der Beitritt zur europäischen Wirtschaftsunion freiwillig sein. Dabei hielt Keynes die Beteiligung Großbritanniens von Anfang an zwar für sinnvoll und wünschenswert. Doch er ging gleichzeitig davon aus, dass England, dessen Zwischenkriegsjahre heute als »Zeitalter der Illusionen«6 gelten, sich in einem »Übergangzustand«7 befinde und deshalb »immer noch außerhalb Europas«8 stehe. Keynes’ Lehre aus Versailles – »jedenfalls mußte ich als Engländer, der an der Pariser Konferenz […] teilnahm, […] zum Europäer werden«9 – blieb allerdings nicht nur in seinem Heimatland weitgehend ungehört. Stattdessen sollte mit der Verwirklichung seiner Ideen erst rund vierzig Jahre später, nach einem weiteren Weltkrieg, durch die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft begonnen werden. Und bis zur Teilhabe der 1919 neu entstandenen Staaten Osteuropas an einem gemeinsamen Wirtschaftsraum, von der Keynes in seinem Entwurf ganz selbstverständlich ausgegangen war, mussten gar noch einmal fast fünfzig Jahre vergehen. Das Drama Europas mag seit den Tagen Keynes’ nicht zuletzt darin bestehen, dass sein Zusammenhalt eben nicht am lodernden Feuer verheißungsvoller Utopien erdacht und beschlossen, sondern im Gegenteil gegen sie erkämpft werden musste, weil er – ganz ohne Fanfaren – schlicht eine zwingende Tatsache darstellt. Vernunft allein wärmt damals wie heute nicht jeden. Gerade Europas unentrinnbare Zweckmäßigkeit, mithin die Gefahr seiner Verunglimpfung als bloßer Zweckverband, wird seine Schwäche bleiben.
Was 1919 in Paris geschah, war ein Schauspiel, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte, und ein vergleichbares diplomatisches Massenspektakel hat es auch nie wieder gegeben. Paris, wo nicht nur die leeren Fensterhöhlen von Notre Dame, die schwarz gekleideten Frauen in den Straßen und die vielen Lazarette an den eben erst beendeten Krieg erinnerten, war damals sechs Monate lang nichts weniger als die Hauptstadt der Welt. In einer Zeit, in der der größte Teil des Globus keine eigene Staatlichkeit, sondern Kolonialstatus besaß, war außer dem revolutionären Russland quasi die gesamte Menschheit vertreten. Während die Kriegsverlierer – Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien und die Türkei – mehr oder minder nur am Katzentisch saßen, waren dreißig Länder aus allen fünf Kontinenten von den Siegermächten offiziell geladen. Und mit den Regierungschefs und ihren Ministern kamen nicht nur die Journalisten und Lobbyisten, sondern mehrere Tausend Staatsbeamte und Unterhändler, Sachverständige und Berater, die sich tagaus, tagein in Gremien und Stäben, Kommissionen und Unterkommissionen zusammenfanden. Im Gefolge des amerikanischen Präsidenten sollen sich allein 1300 Bürokräfte befunden haben, die eigens aus den USA herübergeschifft worden waren. Hinzu gesellten sich zahllose politische Bittsteller jeglicher Couleur sowie ernannte und selbst ernannte Fürsprecher all jener, die den Ruf Wilsons nach Freiheit und Selbstbestimmung für alle Völker persönlich nahmen. Die Kunde von den Vierzehn Punkten setzte noch in der entferntesten Erdengegend die Leute in Bewegung. Nicht alle kamen rechtzeitig: Die Vertreter der koreanischen Minderheit in Sibirien, die den weiten Weg nach Paris zu Fuß antraten, hatten zum Schluss der Hauptkonferenz Ende Juni 1919 nach monatelangen Märschen erst den Eismeerhafen Archangelsk erreicht. Andere wurden bitter enttäuscht. Ho Chi Minh etwa, der spätere Vietcong-Führer, der während der Konferenz als Küchengehilfe im Hotel Ritz arbeitete, stieß mit seinem Appell für das vietnamesische Volk auf ebenso taube Ohren wie der Schwarzenführer DuBois mit seiner Forderung nach der Unabhängigkeit Afrikas. Kein Gehör zu finden sollte 1919 nicht nur das Schicksal der Deutschen sein.
Versailles und die anderen Pariser Vorortverträge – Trianon, Saint-Germain, Sèvres und Neuilly – sind in vielerlei Hinsicht Dokumente des Übergangs. Denn mit dem Ersten Weltkrieg, dem Untergang des Zaren-, des Habsburger- und des Osmanischen Reiches sowie dem Eintritt der USA in die Weltpolitik war es nicht nur um das sogenannte Konzert der fünf europäischen Großmächte geschehen. Vorbei war es auch mit der aristokratischen Überschaubarkeit der diplomatischen Sphäre und somit der Institution des feierlichen Friedenskongresses, mit dem in Zeiten der klassischen »Großen Politik« die europäischen Kabinette das Mächtegleichgewicht nach jedem Waffengang neu austariert hatten. Für den völligen Strukturwandel der internationalen Beziehungen nach 1918 haben Historiker denn auch den Begriff der »Diplomatischen Revolution« geprägt. Gemeint ist die rapide Zunahme der auf der internationalen Bühne handelnden Staaten, das explosionsartige Anwachsen der Zahl außenpolitischer Akteure, die Konferenzdiplomatie und das Sondermissionswesen, die Völkerbundsidee und der Schiedsgerichtsgedanke, die Deklarationsdiplomatie und die Anerkennung der öffentlichen Meinung durch das Bemühen um demokratisch legitimierte public diplomacy statt der zuvor gepflegten Geheimpolitik. Der Pariser Konferenz mag eine dauerhafte Friedensordnung nicht gelungen sein; eine Epochengrenze der Völkerrechtsgeschichte und der internationalen Beziehungen bleibt sie allemal.
Indessen geriet 1919 der Konferenzmarathon schon seines schieren Ausmaßes und seiner Dauer wegen zur Karikatur der alten Kongressidee. Nachdem in den ersten zwei Monaten mehr über die Beratungen in den Zeitungen gestanden hatte, als an Ergebnissen vorzuweisen war, hatten die Hauptsiegermächte vorerst genug von den Segnungen ihrer »Neuen Diplomatie« und zogen im März 1919 die Notbremse. So waren es am Ende doch wieder nur drei Männer, die über die Geschicke der Menschheit befanden: Wilson, der französische Premier Clemenceau und sein britisches Gegenüber Lloyd George. Der neue hohe Ton, mit dem Interessenpolitik zumindest öffentlich auch zu einer Frage der überlegenen Moral erklärt werden musste, gab die Begleitmusik, derweil in recht herkömmlicher Großmachtmanier die Aufteilung gefallener Reiche und die neuen Grenzen Europas beschlossen wurden. Im Unterschied zum staatsmännischen Herrenclub alter Schule aber, wo man, wie Metternich 1814 meinte, »als Freunde«10 zusammengesessen hatte, war das Trio von 1919 binnen Kürze überkreuz. Clemenceau fand sich nach eigenem Dafürhalten »zwischen Jesus Christus auf der einen und Napoleon Bonaparte auf der anderen Seite«.11 Es war denn auch vor allem dem heillosen Auseinanderdriften der Siegerkoalition geschuldet, dass die Deutschen allen diplomatischen Gepflogenheiten zum Trotz von einer gemeinsamen Diskussion ihres Friedensverdikts ausgeschlossen blieben. Das Vorbild für ein derartiges Diktat hatten sie ein Jahr zuvor im Friedensvertrag von Brest-Litowsk mit den russischen Bolschewiki selber geliefert.
Das Büßerhemd, das man den Deutschen in Versailles überstreifen wollte, mochten sie freilich nicht anziehen. Die Empörung des deutschen Delegationschefs Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau war echt, als er – entgegen dem Rat sämtlicher Kollegen – die Alliierten bewusst brüskierte und bei der Übergabe der Friedensbedingungen am 7. Mai 1919 sitzen blieb. »Sie taten uns leid, als sie hereinkamen, und wir waren außer uns vor Wut, als sie gingen«,12 beschrieb der französische Diplomat Paul Cambon die Reaktion der Alliierten auf Brockdorffs förmlichen Affront. Der durchaus konziliante Inhalt seiner Rede ging im allgemeinen Aufruhr unter. Die ohnehin geringen Chancen der im Château de Villette regelrecht internierten deutschen Delegation, doch noch an den Verhandlungstisch zu kommen, waren nun erst recht geschmälert. Dabei kamen nicht nur ihr die Friedensbedingungen einem vernichtenden Urteilsspruch gleich. So mancher Vertreter der Siegermächte reagierte schockiert, als er den riesenhaften Korpus des Friedenswerks am selben Tag wie die Deutschen erstmals in Gänze zu Gesicht bekam. Immerhin sollten die hernach nur schriftlich eingereichten deutschen Gegenvorschläge, trotz ihrer legalistischen Bleifüßigkeit, im Lager der Alliierten besonders die Finanzexperten in der britischen und amerikanischen Delegation tief beeindrucken. Dies beschränkte sich nicht auf das deutsche Reparationsangebot über 100 Milliarden Goldmark, das bei näherem Hinschauen zwar nominal weit geringer ausfiel, den Siegermächten aber mehr eingebracht hätte, als sie je bekommen sollten. Es darf nicht übersehen werden, dass die in Versailles formulierten deutschen Friedensvorschläge dem Geist von Wilsons Vierzehn Punkten tatsächlich am nächsten kamen. Und das »Traumland der Waffenstillstandszeit«,13 wie die Illusionen der deutschen Friedensstrategie im Vorfeld von Versailles bezeichnet worden sind, hatte auch viele auswärtige Bewohner.
Gleichwohl wollte sogar John Maynard Keynes in den Mitgliedern der deutschen Delegation weithin das populäre »Hunnen«-Klischee bestätigt sehen. Doch wer da die Weimarer Republik in Versailles als Delegierter und Sachverständiger vertrat – sei es der Pazifist Walther Schücking, die Privatbankiers Carl Melchior und Max Warburg, der Soziologe Max Weber oder der Völkerrechtler Albrecht von Mendelssohn-Bartholdy –, gehörte nicht unbedingt zum Schlechtesten, was die junge Demokratie aufzubieten hatte. Sie haben sich jedoch in Paris ebenso vergeblich bemüht wie später in Weimar, wo sie geschlossen dafür eintraten, die Unterschrift unter den Versailler Frieden zu verweigern. In der rachsüchtigen Pariser Atmosphäre empfanden die Sieger in ihrer »Gottgeschlagenheit«,14 wie Thomas Mann es nannte, ohnehin selbst die Errungenschaften des neuen Deutschland als Provokation. Ihnen war es, so formulierte der Publizist Theodor Wolff seinerzeit treffend, »als zeige eine Familie von Neureichen mit übertriebenem Eifer den erst frisch erworbenen Schmuck«.15 Andererseits ist das Unvermögen, sich beliebt zu machen, wie auch das kleinlich Nachtragende während der Weimarer Republik ein Charakterzug der deutschen Diplomatie geblieben. Als Wilson 1924 starb, weigerte sich die deutsche Botschaft in Washington als einzige Außenvertretung, ihre Flagge auf Halbmast zu setzen.
Ein vernichtender karthagischer Friede, wie Keynes im Juni 1919 nach seinem demonstrativen Rücktritt von der britischen Delegation zunächst meinte und im Dezember darauf in seinem Buch Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages aller Welt verkündete, ist Versailles nicht gewesen. Sicher: Die Abtrennung von 13 Prozent des deutschen Staatsgebiets mit 10 Prozent seiner Einwohner war schmerzlich, besonders für eine Bevölkerung, der – anders als nach dem Zweiten Weltkrieg – trotz der drastischen Auswirkungen der alliierten Hungerblockade die physische Erfahrung der Niederlage auf eigenem Boden erspart geblieben war. Die von zynischen Militärs aufgebrachte Dolchstoßlegende schien so manchem sehr viel einfacher zu akzeptieren. Der Verlust war aber, auch eingedenk der eigenen kaiserzeitlichen Siegfriedenspläne, zu verkraften, zumal es dem noch nicht einmal fünfzig Jahre alten Reich in Versailles womöglich sehr viel schlechter hätte ergehen können. Für seine Auflösung oder Zerschlagung haben sich 1919 nicht nur die Franzosen, sondern auch die Bayern interessiert. Aufgrund des Kollaps des Zarenreichs und der breiten Schütterzone ungefestigter neuer Klein- und Mittelstaaten im Osten war Deutschlands geopolitische Position nach Versailles sogar günstiger als vor dem Ersten Weltkrieg. Genau hierin lag freilich die Krux einer Friedensschikane, die in ihrem moralischen Triumphalismus die Warnung Machiavellis – »Demütige niemanden, den du nicht vernichten kannst«16 – außer Acht gelassen hatte. Stattdessen lieferte die Entente Anreiz wie Legitimation für einen langfristigen militärischen Wiederaufstieg Deutschlands gleich mit, indem seine Entwaffnung, anders als proklamiert, nicht zum Auftakt einer allseitigen Abrüstung wurde. Mehr noch aber als die fragwürdigen Friedensbedingungen selber, und mehr auch als der wenig überraschende Unwillen der Deutschen, diese rückhaltlos zu akzeptieren, ist es die fatale Halbherzigkeit seiner Ausführung gewesen, die den Versailler Vertrag zum Menetekel der Epoche nach 1919 machen sollte.
Tatsächlich ist es den Friedensmachern von Paris noch nicht einmal gelungen, die Tatsache ihres Sieges im Ersten Weltkrieg zu konservieren. Dieses paradoxe Ergebnis stand schon 1919 fest, also noch bevor der amerikanische Kongress die Ratifizierung des Versailler Vertrags auch im dritten Anlauf verweigerte und die USA sich in den Isolationismus zurückzogen. Denn der Völkerbund war schon wegen seiner militärisch zahnlosen Konzeption von Anfang an nicht geeignet, die zusammengebrochene Gleichgewichtsordnung der europäischen Mächte zu ersetzen. Und die beiden Parias der Weltpolitik, Deutschland und die Sowjetunion, blieben von diesem bloß ansatzweise konstruierten System kollektiver Sicherheit zunächst ohnehin ausgeschlossen. Schon 1922 fanden sie in Rapallo zusammen.
Während die USA sich davor scheuten, der Verantwortung ihrer neuen Weltmachtrolle gerecht zu werden, erwies sich Großbritannien als unfähig, den durch den Weltkrieg herbeigeführten Verlust seiner Vormachtstellung durch ein Konzept der wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Konsolidierung des Kontinents abzufedern. Stattdessen war Lloyd George bald von der eifersüchtigen Sorge einer zu deutlichen Stärkung Frankreichs gegenüber Deutschland besessen. So wurde der »Frieden ohne Sieg«, den Wilson Anfang 1918 den im Weltkrieg Unterlegenen großherzig angekündigt hatte, vor allem für Frankreich Wirklichkeit, freilich in einem ganz anderen, tragischen Sinne. Denn mit dem Scheitern der in Paris bloß zaudernd versprochenen Sicherheitsgarantie durch Großbritannien und die USA stand fest, dass das wirtschaftlich wie bevölkerungsmäßig seinem Ostnachbarn weit unterlegene Land einem erneuten Angriff Deutschlands so gut wie hilflos ausgeliefert sein würde. Lloyd George freilich wusste Frankreichs Katastrophe im Juni 1940 nur mit den Worten zu kommentieren, Hitler sei »die größte Persönlichkeit in Europa seit Napoleon« – »und womöglich sogar größer als er«.17
Niemand hat nach dem Ersten Weltkrieg die Notwendigkeit einer Wiedergutmachung der immensen Kriegsschäden in Frankreich und Belgien bezweifelt. Auch die Deutschen nicht – trotz der rechenhaften Mitleidlosigkeit, mit der sie zuweilen den von ihnen angerichteten Verwüstungen die eigenen Verluste an Soldaten und die vielen Zivilopfer der alliierten Hungerblockade entgegensetzten. Durch die mangelnde Bereitschaft der Angelsachsen, sich auf dem Kontinent zu engagieren, und den Unwillen der USA zum finanziellen burden-sharing mit seinen Kriegskoalitionären wuchs sich die Reparationsregelung allerdings von einem Entschädigungsproblem zum zentralen Ordnungsinstrument des Versailler Nachkriegssystems aus. Das Deutschland auferlegte Reparationsregime wurde gleichsam zum Substitut der unterbliebenen machtpolitischen Justierung Europas. Doch dieser Versuch, ein originär geo- und sicherheitspolitisches Problem, nämlich Deutschlands Übermacht auf dem Kontinent, durch wirtschaftliche Pressionen zu lösen, war – das sah Keynes ganz richtig – ebenso unvernünftig wie untauglich. Mit der Fesselung der größten europäischen Volkswirtschaft konnte der Wiederaufbau Europas, geschweige denn das Anknüpfen an die wirtschaftliche Vorkriegsherrlichkeit, kaum gelingen.
Als die deutsche Delegation nach dem Erhalt der Friedensbedingungen im Mai 1919 beklagte, das zarte Pflänzchen der Weimarer Demokratie könne nicht für die Taten des Kaiserreichs haftbar gemacht werden, hielt ihnen Clemenceau die Verträge von Frankfurt 1871 und Brest-Litowsk 1918 entgegen, die ebenfalls jeweils nach Revolutionen den französischen respektive russischen Nachfolgeregierungen vom Deutschen Reich auferlegt worden waren. In Brest-Litowsk hatten die Deutschen allerdings klug auf Reparationen verzichtet. Und ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen den Reparationen des Jahres 1871 und denen von Versailles war die Tatsache der durch den Weltkrieg bloß zeitweise unterbrochenen enormen wirtschaftlichen Verflechtung der europäischen Industrienationen. Von dem Ausmaß der industriellen Grenzüberschreitung und des ökonomischen Internationalismus in der Welt vor 1914 macht man sich gemeinhin keine Vorstellung: Tatsächlich ist der weltwirtschaftliche Globalisierungsgrad, der die europäisch dominierte Wohlstandsepoche in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg auszeichnete, bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts, also in unseren Tagen, noch nicht wieder erreicht worden.
Zwar hatte schon 1873 die von Frankreich unter dem Druck der deutschen Besatzung bewerkstelligte vorzeitige Rückzahlung seiner Kriegsreparationen in Deutschland eine Wirtschaftskrise ausgelöst, den sogenannten Gründerkrach. Das Reparationsregime der zwanziger und dreißiger Jahren aber sollte weitaus komplexere Wechselwirkungen hervorrufen. Insbesondere im industriellen Herzland Europas, vom Ruhrgebiet über Luxemburg bis nach Lothringen und an die Saar reichend, wurde dies nicht erst während der Ruhrkrise von 1923 deutlich, als die von der Ruhrkohle abhängigen belgischen und französischen Stahlwerke mangels Lieferungen aus Deutschland schließen mussten. Der ökonomische Zwangszusammenhang, das war Keynes’ zentraler Punkt, unterschied nicht zwischen Siegern und Besiegten und scherte sich auch sonst nicht um politische Ziele und Wunschvorstellungen. So waren etwa die im Reparationsplan festgelegten deutschen Kohlelieferungen für das kriegsversehrte Frankreich und Belgien zwar notwendig, sie bedeuteten aber zugleich eine unliebsame Konkurrenz für die britische Exportkohle. Und die Konfiszierung deutscher Handelsschiffe brachte Großbritannien und den USA im Sommer 1919 zwar einen gewissen Ausgleich ihrer Kriegsverluste durch den deutschen U-Boot-Krieg. Mittelfristig aber trug der Zwang zum Neuaufbau der Tonnage in Deutschland selbst mit zu jenem industriellen Wiedererstarken bei, das Großbritannien und Frankreich durch die Reparationen just hatten verhindern wollen.
Dass mit den Reparationen tief und störend in die europäischen Wirtschaftskreisläufe eingegriffen würde, war auch den Siegermächten schon 1919 deutlich. Und ihnen war ferner klar, dass Deutschland größere Zahlungen nur erwirtschaften konnte, indem es die anderen Länder mit Billigexporten überfluten und zugleich die eigenen Importe stark reduzieren, als Absatzmarkt also weitgehend ausfallen würde. »Das Problem«, fasste der amerikanische Vertreter in der Reparationskommission ein interalliiertes Spitzengespräch im Juli 1919 zusammen, »ist daher nicht so sehr, was Deutschland bezahlen kann, sondern inwieweit sich die Alliierten Deutschlands Zahlungen überhaupt leisten können«.18 Doch das Versprechen an ihr Wahlvolk, dass Deutschland die Zeche bezahle, konnten Großbritannien und Frankreich ebenfalls nicht ignorieren. In der Presse wie in den Kommissionen wurden astronomische Tributhöhen diskutiert. Aus diesem Dilemma heraus entstand mit Artikel 231 des Versailler Vertrags der fatale »Kriegsschuldparagraph«, um das Vergeltungsbedürfnis vor allem der britischen homefront zu bedienen. Die Schadenersatzforderungen an die Verlierernation wurden nicht, wie seit jeher üblich, mit ihrer Niederlage begründet, sondern zur gerechten Strafe für einen Schurkenstaat erklärt. In der deutschen Übersetzung noch schärfer formuliert als im Original, sollte die Kriegsschuldfrage die innenpolitische Atmosphäre der Weimarer Republik dauerhaft vergiften. Das Geld kam erst nach der Moral: Im Folgeartikel 232 wurde die zuvor umfassend formulierte, mithin theoretisch unbegrenzte Reparationspflicht Deutschlands in einem ausführlichen Annex tatsächlich nur für Zivilschäden spezifiziert.
Am Ende blieb die Summe offen. Dies war vor allem der Eifersucht zwischen den beiden Alliierten geschuldet, die sich untereinander weder über den Umfang noch über den Verteilungsschlüssel künftiger Reparationszahlungen einigen mochten. Dabei sprach, auch angesichts der Waffenstillstandsbedingungen, für die französische Forderung, dem Wiederaufbau der von den Deutschen zerstörten Gebiete Vorrang zu geben, weitaus mehr als für das Bemühen Lloyd Georges, den britischen Anteil am Reparationskuchen durch die Hereinnahme von Pensions- und Unterhaltsansprüchen von Kriegswitwen und Soldatenfamilien künstlich aufzublähen. Angeregt zu diesem mehr als fragwürdigen Schritt wurde Lloyd George vom südafrikanischen General Smuts. Ironischerweise machte Smuts wenig später vor allem durch seine lautstarke Missbilligung des Friedenswerks, das er gleichwohl unterschrieb, von sich reden. Ihm, der Keynes hartnäckig drängte, seine kritischen Gedanken publik zu machen, verdankt sich auch die Entstehung von Keynes’ Versailles-Buch.
Kam man in Paris aus der Klemme zwischen wirtschaftlichen Zwängen und dem Druck der öffentlichen Meinung schon nicht heraus, entschied man sich nun für die schlechteste aller Lösungen, den Aufschub des Problems. Zusätzlich zu einer anfänglichen Zahlungsverpflichtung